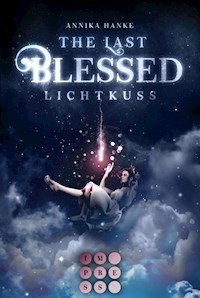Die Drachenwandler: Sammelband zur magischen Drachen-Fantasy-Serie »Die Drachenwandler« E-Book
Annika Hanke
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Drachenwandler
- Sprache: Deutsch
**Entzünde deine Magie** Das Einzige, worüber sich Romy bisher Gedanken machen musste, war ihre anstehende Abschlussprüfung. Diese Sorge rückt allerdings in den Hintergrund, als plötzlich unzählige Drachen vom Himmel stürzen. Obwohl die feurigen Wesen die ganze Erde bedrohen, spürt Romy statt Angst nur eine tiefe Sehnsucht in sich aufflammen. Allem voran ihr Anführer löst unerwartete Gefühle in ihr aus. Doch Greyer möchte ihr nicht nur die Augen für eine sagenhafte und unbekannte Welt öffnen. Er braucht ihre Hilfe, um sein Volk zurück in seine Heimat zu führen. Denn der Schlüssel zur Erlösung der Drachen liegt tief in Romys brennendem Herzen verborgen. Eine atemberaubende Fantasy-Dilogie voller Magie, Mut und Liebe //Dies ist der Sammelband der spannungsgeladenen Buchserie »Die Drachenwandler«. Alle Romane der Fantasy-Liebesgeschichte: -- Die Drachenwandler 1: Fire in your Eyes -- Die Drachenwandler 2: Fire in your Blood// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2020 Text © Annika Hanke, 2020 Lektorat: Dietlind Koch Coverbild: stock.adobe.com / © lassedesignen / © sweasy / © Halfpoint / shutterstock.com / © Raisa Kanareva / © Kiselev Andrey Valerevich / © EVKA / © New vision Covergestaltung: Dream Design - Cover and Art Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60596-9www.carlsen.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Annika Hanke
Die Drachenwandler 1: Fire in your Eyes
**Spüre das Feuer in dir**Eigentlich wollte Romy nur mit ihren besten Freunden für ihre Abschlussprüfungen lernen. Als jedoch zahllose Meteoriten vom Himmel fallen und die Welt im Chaos versinkt, sind Schulnoten das Letzte, woran sie noch denkt. Die vermeintlichen Meteoriten sind nämlich nichts Geringeres als Drachen, die die Erde überfallen. Statt in Panik zu geraten, verspürt Romy eine merkwürdige Sehnsucht nach den flammenden Wesen. Besonders der Drachenwandler Greyer übt eine ungeahnte Anziehungskraft auf sie aus, die sie bald nicht mehr ignorieren kann. Die beiden müssen erkennen, dass diese Kraft zwischen ihnen mehr zu bedeuten hat als nur brennende Gefühle …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Annika Hanke, geboren 1996, lebt in Schleswig-Holstein. Schon früh wurde sie durch Fan-Fiction zum Schreiben animiert, nahm diese Leidenschaft allerdings erst Ende 2014 wieder richtig auf und schrieb ihren ersten Fantasyroman, der bis heute darauf wartet neu geschrieben zu werden. Wenn sie nicht gerade im Planen oder Schreiben einer Geschichte untergeht, ist sie viel mit ihrem Hund Tony unterwegs und sucht Inspiration und Ruhe in langen Waldspaziergängen.
I
Die Menschen sind sich zu sicher, dass sie die einzigen hoch entwickelten Lebewesen in einem ganzen Universum sind.
Sie werden eines Besseren belehrt.
Lebewesen, Kreaturen, fallen auf die Erde,
kommen mit Feuer, Tod und Zerstörung.
Nehmen sich alles, was sie wollen.
Es gibt kein Entkommen, keinen Ausweg
aus den Klauen der Drachen.
Denn irgendwann werden sie auch Dich finden,
Dich ziehen und zerren,
bis Du hinter der Mauer bist.
Es gibt kein Entkommen, keinen Ausweg.
Keinen Ausweg.
Prolog
Romy
»Das schaffst du niemals!« Lachend warf ich Luca eine Handvoll Erdnüsse zu, doch nicht eine einzige fand ihren Weg in seinen Mund.
»Du solltest eine werfen, Romy, nicht zweihundert!«, erwiderte er grinsend und sammelte die Nüsse von der Picknickdecke auf. Wir hatten uns im Stadtpark niedergelassen und genossen den ersten warmen Tag des Jahres. Eigentlich wollten wir für das bevorstehende Abitur lernen, doch irgendwie waren wir davon abgekommen. Außerdem war Sina, Lucas Freundin, bisher noch nicht aufgetaucht und da sie ein Ass in Mathematik war, mussten Luca und ich uns anderweitig beschäftigen, während wir auf sie warteten. Dabei ließen wir es ganz bewusst außen vor, dass Mathe nicht das einzige Fach war, das wir büffeln mussten.
»Leute, entschuldigt die Verspätung!« Endlich kam Sina über den Rasen auf uns zugelaufen. Aus ihrem Zopf hatten sich einige blonde Haarsträhnen gelöst und tanzten im Wind. Sie wirkte abgehetzt, als sie auf der Decke Platz nahm und außer Atem die Luft ausstieß.
»Ich habe die Zeit im Café völlig vergessen. Es war so viel los und dann hatte ich schon längst Feierabend.« Sie seufzte, beugte sich dann zu Luca vor und küsste ihn auf den Mund.
»Jetzt bist du ja hier«, erwiderte dieser immer noch grinsend und deutete auf mich. »Die da ist übrigens richtig unfair. Sie hat mich die ganze Zeit mit Nüssen beworfen.« Er lachte und ich schnitt ihm eine Grimasse.
»Hör nicht auf ihn, Sina. Er kann nur nicht verlieren.«
Schmunzelnd winkte Sina ab. »Das weiß ich schon längst.« Sie strich sich eine der losen Haarsträhnen hinters Ohr und öffnete ihren Rucksack, um irgendetwas darin zu suchen. »Ah, da ist es!«, sagte sie, als sie fündig wurde. »Du kennst doch noch Mirco Richter?«
Ihre Frage ging an mich und sie wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. Ich runzelte die Stirn und erinnerte mich an die erste Klasse zurück; Mirco war ein dicklicher Junge gewesen, der immer eine Tüte Süßes in der Hand gehabt hatte. Sina und ich, die seit dem ersten Schultag beste Freundinnen waren, hatten uns ein bisschen vor ihm geekelt. Ihm hatte ständig irgendetwas rund um den Mund geklebt.
Als er mir in der dritten Klasse dann einen Liebesbrief geschrieben und nach dem Sportunterricht aufgelauert hatte, hatte er in seinem kindlichen Leichtsinn sogar versucht mich zu küssen. Ich erinnerte mich noch genau daran, dass ich kreischend weggelaufen war, nachdem ich ihn mit voller Kraft von mir geschubst hatte.
»Den Mirco Richter?!«
»Genau den. Er ist wieder in der Stadt und – Mann! – er sieht verdammt gut aus!«
»Bitte?«, meldete sich nun Luca zu Wort, doch Sina machte nur eine ungeduldige Handbewegung in seine Richtung.
»Ich soll dir das hier von ihm geben. Er war im Café und hat nach dir gefragt. Offenbar will er an alte Zeiten anknüpfen.« Während meine beste Freundin mich breit angrinste, nahm ich den Zettel zögerlich an mich. Stirnrunzelnd faltete ich ihn auseinander – es stand nur sein Name und seine Telefonnummer drauf.
»Hat er was dazu gesagt?«, fragte ich Sina. »Dieser Zettel ist ziemlich nichtssagend.«
Sina zuckte mit den Schultern. »Er hat gefragt, ob wir immer noch befreundet sind, und gesagt, dass ich dir den Zettel geben soll, wenn ich dich sehe. Das habe ich getan, meine Mission ist beendet. Was steht denn drauf? Willst du mit mir gehen? Ja. Nein. Vielleicht?«
Ich verdrehte die Augen und knüllte den Zettel zusammen, um ihn in meine Tasche zu stopfen. Um nichts auf der Welt wollte ich die Peinlichkeit erleben, Mirco wieder zu begegnen. Seine Flirtversuche hatten bis in die zehnte Klasse angedauert und hätte es ihn nach dem Abschluss nicht zu Verwandten in die USA verschlagen, wären sie wahrscheinlich die folgenden Jahre auch noch weitergegangen. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, wollte ich garantiert nicht an vergangene Zeiten anknüpfen.
Während Sina und ich uns intensiv mit Geschichten aus unserer Schulzeit in der Unterstufe beschäftigten, griff Luca nach seinem Handy. Dabei war keinem von uns aufgefallen, dass es plötzlich dunkler geworden war. Die Sonne war hinter düsteren Wolken verschwunden, wahrscheinlich würde es jeden Moment anfangen zu regnen.
»Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir irgendwo nach drinnen kommen«, sagte ich mit einem Seufzen.
»Hey, Leute.« Luca ging gar nicht auf meinen Kommentar ein, sein Blick war auf das Display seines Handys geheftet.
Er sah besorgt aus und wirkte um die Nase herum ziemlich blass. Bevor er jedoch weitersprechen konnte, grollte bereits Donner über uns und ich zuckte zusammen. Wie konnte sich das Wetter so schlagartig ändern?
»Schaut mal, es wurden Meteoriten oder so was gesichtet.« Endlich drehte er sein Handy zu uns herum, das ein verwackeltes Video abspielte: Irgendetwas darauf stürzte vom Himmel und zog einen rubinroten Schweif hinter sich her. Plötzlich erbebte die Erde und in das Donnergrollen mischte sich ein undefinierbares Zischen. Ein Blitz zerriss den Himmel und keine Sekunde später konnten auch wir hier die Meteoriten sehen, die gen Boden stürzten. Es waren nur eine Handvoll, doch sie fielen auf die Erde, völlig ungebremst.
Obwohl der Erste so weit entfernt einschlug, dass man den Aufprall nur gedämpft hören konnte, brach plötzlich eine Massenpanik im Stadtpark aus, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Die Menschen sprangen von ihren Decken auf, schrien panisch durcheinander, schnappten sich ihr Hab und Gut und rannten los – so schnell, wie sie konnten.
»Scheiße!«, brüllte Luca gegen den Lärm an und sprang ebenfalls auf. Er griff nach Sinas Hand und zerrte sie auf die Füße, die Angst war den beiden deutlich anzusehen. Ich stand auch auf, doch anders als die meisten um uns herum, verspürte ich keine Panik. Ich hatte keine Ahnung wieso, denn eigentlich hätte ich auch schreiend aufspringen und weglaufen müssen. Aber irgendwie war da keine Angst – vor dem Ende der Welt oder mächtigen Meteoriten, die in die Umlaufbahn unserer Erde gerieten und uns zerstören würden. Da war nur eine seltsame Wärme in meiner Brust, die ich mir nicht erklären konnte. Es fühlte sich an, als wäre etwas Vertrautes auf die Erde gekommen und das war das Einzige, was mir Angst machte.
»Romy! Nun komm schon!«, rief Sina und ich blinzelte mich zurück in die Realität. Schnell tat ich es Sina und Luca gleich und klaubte mein Zeug zusammen. Kaum waren alle Sachen verpackt, riss Luca die Decke hoch und klemmte sie unter seinen Arm. In den Gesichtern der beiden spiegelte sich die gleiche Panik, die um uns herum herrschte.
»Wir sollten uns abholen lassen. Kannst du deinen Vater erreichen?« Sinas Stimme zitterte.
Ich zog mein Handy aus der Jackentasche, doch ehe ich die Nummer wählen konnte, hatte Luca auch schon Sina an der Hand gepackt und zerrte sie mit in Richtung der Bahnhaltestelle.
»Das dauert viel zu lange!«, hörte ich ihn noch sagen. Ich griff meinen Rucksack und rannte den beiden hinterher, doch der Abstand zwischen uns wurde rasch größer und schon bald konnte ich die beiden kaum noch in der Masse ausmachen.
»Jetzt wartet doch mal!«, rief ich ihnen hinterher, doch sie hörten mich nicht mehr. Ich blieb stehen und atmete gegen das heftige Seitenstechen an.
Inzwischen war der Stadtpark wie ausgestorben. Mein Finger schwebte über dem grünen Telefonzeichen auf dem Handydisplay, doch das Krachen, welches mit dem Meteoritenschauer einhergegangen war, war ebenso wie die herunterstürzenden Gesteinsbrocken verschwunden. Es herrschte Totenstille und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt meinen Vater anrufen und ihn in Sorge versetzen sollte. Die Entscheidung wurde mir allerdings abgenommen, als das Foto meiner Mutter aufleuchtete, die mich anrief. Mit zitternden Fingern nahm ich den Anruf an.
»Romy! Gott sei Dank, geht es dir gut? Bist du noch im Stadtpark?«
»Ja, bin ich, aber ich komme jetzt nach Hause. Und mir geht es gut, es ist nichts passiert«, versuchte ich sie zu beruhigen. Man hörte ihr an, wie besorgt und ängstlich sie war, doch im Gegensatz zu allen anderen, konnte ich noch immer keine Spur von Panik in mir finden.
»Dein Vater ist schon auf dem Weg, er holt dich ab.«
»Okay, ich warte auf ihn.«
»Sind Luca und Sina in Ordnung? Ich habe nur ein verwackeltes Video im Internet gesehen.«
»Ja, alles gut. Sie sind mit der Bahn nach Hause.« Glaubte ich zumindest. »Hey, ich sehe Papas Wagen, bis gleich, ja? Mach dir keine Sorgen«, fügte ich hinzu, als vorn an der Straße unser Auto heranfuhr. Ich beendete das Gespräch und rannte zur Parkmündung, wo der Jeep meines Vaters gerade zum Stehen kam.
»Alles okay? Wir haben uns große Sorgen gemacht«, begrüßte mein Vater mich und musterte mich eingehend. Ich nickte, während ich bereits den Sicherheitsgurt einrasten ließ.
»Ja, es ist wirklich alles gut. Diese Meteoriten sind nicht im Stadtpark eingeschlagen. Sie müssen irgendwo im Stadtzentrum oder sogar außerhalb von Hamburg gelandet sein. Bei manchen konnte ich gar nicht sehen, wo sie eingeschlagen sind«, erklärte ich ihm. Dann schüttelte ich noch immer fassungslos über das Geschehene den Kopf. »Es ist so … heftig. Meteoriten in Hamburg!«
Mein Vater nahm einen tiefen Atemzug und warf einen kurzen Blick in den Außenspiegel, ehe er Gas gab und losfuhr. »Damit hat niemand gerechnet. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht.«
Ich strich mir eine Strähne hinters Ohr und rief den Chat von Sina auf, um zu fragen, ob alles in Ordnung war. Hoffentlich waren sie heil zu Hause angekommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren vielleicht nicht die klügste Option gewesen, sicherlich waren mehrere Hundert Menschen dorthin gerannt.
Ich tippte ungeduldig mit dem Finger gegen die Seite meines Handys, doch die Nachricht blieb ungelesen. Bestimmt waren sie noch auf dem Weg nach Hause. Ich seufzte und schob mein Handy in den Rucksack. Als die Nachrichten im Radio von den Meteoriten berichteten, drehte ich die Lautstärke hoch.
»… ein Meteoritenschauer über Norddeutschland. Wissenschaftler vermuten, dass es ein einmaliges Ereignis bleibt, da es keinerlei Hinweise auf weitere kosmische Aktivitäten gibt.«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Waren das wirklich Meteoriten gewesen? Wieso hatte ich nicht wie alle anderen reagiert? Verwirrt über das, was geschehen war, lehnte ich mich im Sitz zurück und blickte aus dem Fenster, während wir den Stadtpark immer weiter hinter uns ließen.
***
»Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist!«, rief meine Mutter, als wir die Haustür hinter uns ins Schloss fallen ließen. Sie kam in den Flur und riss mich augenblicklich in eine halsbrecherische Umarmung. Meinem Vater legte sie liebevoll eine Hand an den Oberarm, nachdem sie sich endlich von mir gelöst hatte.
»Es ist alles gut, wirklich. Mach dir bitte keine Sorgen«, erwiderte ich.
»Du hättest sofort anrufen müssen, als das passiert ist. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass dieses Handy auch dafür da ist, um mit anderen Menschen zu telefonieren!«
Ich presste die Lippen aufeinander, um nicht zu seufzen. Meine Mutter war schon immer sehr fürsorglich und manchmal etwas überbesorgt.
»Es tut mir leid, Ma. Im Stadtpark ist das Chaos ausgebrochen, und als ich dann anrufen wollte, war alles schon vorbei. Waren das wirklich Meteoriten?« Keine Ahnung, wieso ich diese Frage noch einmal stellte – die Nachrichten hatten mehr als deutlich gemacht, dass es sich um kosmische Gesteinsbrocken gehandelt hatte.
»Was soll es denn sonst gewesen sein?« Mein Vater runzelte die Stirn.
»Natürlich waren es Meteoriten!«, bestätigte meine Mutter und ich hörte an ihrer Stimme, dass ich ihre Geduld bereits überstrapaziert hatte.
Ich sollte mich also am besten leise davonmachen und erst mal nicht mehr aus meinem Zimmer kommen. Doch ihre Frage war berechtigt: Was sollte es sonst gewesen sein? Ich wusste es nicht, aber immer noch meldete sich ein leiser Zweifel in mir und dieses Gefühl, das ich im Stadtpark empfunden hatte, ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich konnte gar nicht beschreiben, was es gewesen war, aber es hatte sich angefühlt, als wäre ein Teil von mir mit den Meteoriten angekommen. Wie ein Puzzleteil, von dem ich jahrelang nicht gewusst hatte, dass es mir fehlte. Schnell schob ich die Gedanken beiseite und lächelte meine Mutter an.
»Ihr habt recht. Ich bin einfach immer noch völlig fassungslos, dass so etwas hier passiert«, ruderte ich zurück, um das Thema zu begraben. »Bleibt es dabei, dass wir morgen Smoothies machen?«, fragte ich beiläufig an meine Mutter gewandt, um den Hauch der Normalität wiederzuerlangen.
Sie blinzelte verwirrt, nickte dann aber. »Ja, natürlich.«
»Perfekt. Ich bin oben, muss noch ein paar Hausaufgaben machen. Ruft ihr mich, wenn es Essen gibt?« Ehe einer der beiden antworten konnte, machte ich mich schon auf den Weg in mein Zimmer. Meine Gedanken fuhren noch immer Achterbahn und es war schwer, mich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Nach dem, was heute passiert war, schienen sie so unwichtig zu sein.
Wie von selbst schaltete ich den Fernseher an und sah mir die Nachrichten an, verfolgte völlig gebannt die Bilder von den Meteoriten. Sie zogen keinen gelblichen Feuerschweif hinter sich her, sondern einen rubinroten. Und als ich sie sah, verspürte ich schon wieder diese merkwürdige Wärme in meiner Brust. Diese … Sehnsucht? Als würden sie nach mir rufen.
Was hatte das alles zu bedeuten? Ich verstand die Welt nicht mehr und eine Gänsehaut kroch mir die Arme hinauf. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Nicht in Panik zu geraten, wenn man einen verdammten Meteoritenschauer sah, war doch vollkommen verrückt!
Mein Handy meldete sich mit Vogelgezwitscher und ich nahm es sofort in die Hand in der Hoffnung, eine Nachricht von Sina oder Luca erhalten zu haben. Und tatsächlich: Das Display zeigte den Chat von Sina an.
Sina: Alles okay. Die Bahn war völlig überfüllt und es hat ewig gedauert, ehe wir zu Hause angekommen sind. Luca ist gerade weg. Wie geht es dir? Sorry, dass wir einfach so abgehauen sind. :(
Ich rief die Nachricht auf und tippte sogleich meine Antwort.
Romy: Hab ich mir schon gedacht. Alles gut, mein Vater hat mich abgeholt. Das war ja auch echt krass! Unglaublich, dass das hier in Deutschland passiert …
Sinas Online-Status änderte sich und ich seufzte, weil sie nicht mehr antwortete. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit irgendjemanden ausgiebig darüber zu reden, wie seltsam alles gewesen war. Andererseits sagte etwas in mir, dass ich es lieber für mich behalten sollte.
Mein Blick heftete sich erneut auf den Fernseher, der wie in Dauerschleife verschiedene Videos abspielte, die das Phänomen zeigten. Eine ganze Weile schaute ich mir die Nachrichten an, bis mir die Augen zufielen und ich eindöste.
***
»Romy! Essen ist fertig!« Die Stimme meiner Mutter riss mich aus meinem Dämmerzustand und ich rieb mir über die Augen. Ich schaltete den Fernseher aus und ging runter in die Küche, wo ebenfalls die Nachrichten liefen. Ich musste mir ein Seufzen verkneifen, denn ich hatte schon so viel über die Meteoritenabstürze gesehen und gehört, dass ich jetzt lieber meine Ruhe gehabt hätte. Ich wollte einfach nicht mehr darüber nachdenken, auch nicht über dieses bittere Geheimnis um das Gefühl im Stadtpark. Denn was sollte ich auch sagen? »Hey, ich hatte gar keine Panik, als die Meteoriten zu sehen waren. Für mich war es eher, als würde mich ihr Anblick … vervollständigen. Verrückt, nicht wahr?« Meine Eltern würden durchdrehen.
»Läuft denn gar nichts anderes?«, fragte ich gedehnt, als ich mich an den Esstisch setzte.
»So etwas passiert nun mal nicht alle Tage, es ist doch klar, dass die Nachrichten darüber berichten.« Mein Vater griff sich dann allerdings die Fernbedienung und schaltete das Gerät auf der Küchenzeile aus. Meine Mutter verwickelte ihn in ein Gespräch, dem ich nur mit halbem Ohr folgte. Ich aß die Spaghetti, spürte jedoch ständig einen Blick auf mir. Als ich zu meiner Mutter sah, blitzte so etwas wie Skepsis in ihren dunklen Augen auf.
Kapitel 1
Greyer
Chaos und Zerstörung. Das hatte er angerichtet und jetzt war es zu spät. Ich spürte eine gähnende Leere in mir, die mich zu verschlingen drohte, aber mein Volk zählte auf mich. Vielleicht sollte ich nicht darüber nachdenken, einfach die Gedanken ausschalten und handeln, statt mir den Kopf zu zerbrechen. Aber wenn ich mich umsah und meine Umgebung betrachtete, fühlte ich mich verloren. Denn um mich herum war alles zerstört.
Dadurch, dass unser Lebensstern zerbrochen war, verwelkte Davantos binnen Stunden. Es schien, als würde eine Lawine des Todes über unseren Planeten hinwegfegen und alles Leben mit sich nehmen. Die Pflanzen verdorrten, das saftige Grün des Grases nahm ab und die Halme ließen traurig die Köpfe hängen. Ich hörte keine Tiere mehr, selbst die Luft schien zu verderben. Aber das Schlimmste war: Ich konnte meine Kraft nicht länger spüren.
Mit der Zerstörung des Dracarian hatten wir unsere Fähigkeiten verloren. Ich versuchte das Gefühl der Machtlosigkeit zu ignorieren, doch die Gewissheit, dass ich mich nicht mehr lange in einen Drachen würde verwandeln können, lähmte mich beinahe. Bald würden da keine Schuppen mehr sein, die über meine Haut glitten, keine Flügel, die mich in den Himmel hoben. Das alles würde gänzlich verschwinden und nur zu uns zurückkehren, wenn wir es schafften, den Lebensstern wieder zusammenzusetzen.
»Greyer, es ist Zeit!« Die Stimme drang durch den dichten Nebel der Fassungslosigkeit zu mir durch. Lean, mein treuer Freund. Ich blickte zu ihm und erkannte, dass auch er nicht weniger mitgenommen aussah, als ich es wohl tat. Der erbitterte Kampf gegen Kasimir hatte uns alle erschöpft und doch konnten wir nicht verschnaufen. Wir mussten auf den Planeten, auf dem die Splitter des Dracarian gefallen waren. Unser Seher Valentin hatte die Laufbahn der verschiedenen Splitter ausmachen können, allerdings sah er nur den Planeten, nicht aber den genauen Ort, wo sie aufgeschlagen waren. Wir würden die ganze verdammte Erde absuchen müssen.
»Ist er bewacht? Wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen«, hörte ich mich sagen und Lean nickte.
»Kasimir wird aus seinem Gefängnis nicht ausbrechen können. Greyer, wir haben keine Zeit mehr. Das Portal schließt sich bald!«
Ich drehte mich in die Richtung, in der das Portal zu einer anderen Welt waberte. Entschlossen nickte ich, nahm den Rest meiner Kraft zusammen und verwandelte mich ein letztes Mal in einen Drachen. Meine Flügel trugen mich mit wenigen Schlägen direkt zum Portal und wie mein Volk vor mir glitt auch ich hindurch und ließ zu, dass es mich zur Erde trug.
Kapitel 2
Romy
Am nächsten Morgen waren meine Gedanken noch immer wirr und ich freute mich, dass Samstag war und ich die Hausaufgaben schon erledigt hatte.
»Guten Morgen«, rief ich meinen Eltern zu, die auf der Terrasse saßen, als ich nach unten kam. Obwohl es noch recht früh war, wehte durch die Terrassentür eine angenehm warme Brise ins Innere des Hauses. In der Küche machte ich mich daran, etwas Obst klein zu schneiden und in den Mixer zu werfen, um die Frühstücks-Smoothies zu machen, über die meine Mutter und ich uns gestern unterhalten hatten.
Als mein Vater in die Küche kam und sich seinen Thermobecher mit Kaffee füllte, runzelte ich die Stirn.
»Musst du zur Arbeit?«
Er nickte. »Es ist viel zu tun, gestern gab es einen Vorfall. Ich werde nicht den ganzen Tag dort verbringen. Schließlich wollen wir heute Abend doch noch grillen«, versprach er mir und ich gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange, bevor ich den Mixer anschaltete und dem Obst dabei zusah, wie es im Handumdrehen zerkleinert wurde. Danach goss ich den Smoothie in zwei Gläser und ging damit zu meiner Mutter auf die Terrasse.
»Bis später«, rief ich meinem Vater, der gerade zur Haustür hinausging, hinterher und setzte mich an den Tisch.
Meine Mutter reckte die Nase bereits zur Sonne, während ich mich lieber unter der Markise verkroch. Sonnenstrahlen und meine Haut kamen irgendwie nicht so gut miteinander aus und da ich nicht – wie in allen Vorjahren – krebsrot werden wollte, blieb ich lieber im Schatten.
»Hat man noch irgendwas wegen der Meteoriten gehört?«, fragte ich beiläufig und meine Mutter öffnete ein Auge, um mich skeptisch anzusehen.
»Nein. Es ist wohl nichts Schlimmeres passiert«, antwortete sie. Ich nickte kurz und griff nach meinem Handy, als plötzlich die Erde erbebte.
»Was zur Hölle war das?«, fragte ich alarmiert und setzte mich in meinem Liegestuhl wieder auf. Es herrschte für den Bruchteil eines Herzschlags Totenstille, dann hörte ich ein donnerndes Geräusch, was mich an ein heftiges Gewitter erinnerte. Keine Sekunde später verdunkelte etwas den Himmel und schien die Sonne gänzlich verschlucken zu wollen. Das da am Himmel sah aus wie ein Portal ins Universum, zu Welten, die wir nicht für existent gehalten hatten. Doch dann, ganz plötzlich, schossen mehrere Lichter aus dem violettschwarzen Loch, das den Himmel zerrissen hatte, hervor und stürzten auf die Erde. Es sah aus, als würden weitere Kometen vom Himmel fallen, als würden Dutzende Sternschnuppen ihren Weg auf die Erde finden.
»Oh, du meine Güte«, flüsterte meine Mutter neben mir, packte mich an der Hand und zog mich ins Innere des Hauses. Auf dem Fernseher lief Das Erste und brachte die aktuellen Nachrichten. Zeigte, dass diesmal in ganz Deutschland Meteoriten vom Himmel fielen.
»Offenbar ist der gestrige Meteoritenschauer über Norddeutschland nur ein Vorbote gewesen«, sagte der Nachrichtensprecher gerade und Bilder aus Frankreich und Großbritannien wurden eingeblendet, die dieses Phänomen ebenfalls miterlebten.
»Sie … sehen aus wie Drachen.« Das Amateurvideo, welches im Fernsehen abgespielt wurde, zeigte deutlich ein Wesen, welches vom Himmel fiel und einen flammenden Schweif hinter sich herzog. Ein riesiger eisblauer Drache näherte sich dem Erdboden, doch auf den Füßen kam ein … Mensch auf. Sein weißes Haar hing ihm ins Gesicht und er trug ein schiefes Lächeln auf den Lippen. Die riesigen Flügel falteten sich auf seinem Rücken zusammen, ehe sie gänzlich verschwanden. Mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit lief er auf einen Wagen zu und riss die Beifahrertür mit solch einer Kraft auf, dass sie nur noch schief in ihren Angeln hing. Das, seine Haltung und alles, was er ausstrahlte, zeigte deutlich, dass er uns um Welten überlegen war.
»Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland leider nicht sagen, von wem der Angriff ausgeht. Spezialisten vermuten einen Terrorakt des IS, doch Bestätigungen lassen auf sich warten. Die Bewohner der Städte werden gebeten …« Das Bild verzerrte sich, ehe der Nachrichtensprecher nicht mehr zu sehen war und nur ein rabenschwarzer Bildschirm zurückblieb. Ein unmenschliches Kreischen zerriss die aufgekommene Stille und als mein Blick aus dem Fenster glitt, konnte ich eines dieser Geschöpfe sehen, welches nicht weit von unserem Haus landete. Auf dem Boden kam ein Mensch auf, der sich umsah und dann auf das Haus unserer Nachbarn zuging. Ich packte meine Mutter an der Hand und zog sie vom Fenster weg.
»Wir können hier nicht bleiben. Wir müssen … uns verstecken.« Es dauerte gefühlte Ewigkeiten, ehe ich wieder halbwegs normal funktionierte. Auch meine Mutter schien endlich aus ihrer Starre zu erwachen, drückte meine Hand und riss mich mit sich in den Flur, wo wir leise die Kellertür öffneten und direkt hinter uns wieder schlossen. Im Dunkeln gingen wir die Stufen hinab, ertasteten uns einen Weg zum abschließbaren Heizungskeller.
***
»W…was war das, Mama …?«, fragte ich flüsternd, als ein Poltern ertönte. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Stumm kauerten wir eine gefühlte Ewigkeit in dem kleinen Raum und lauschten auf die Schritte, die in der Etage über uns zu hören waren. Jemand war in unserem Haus und schien nach etwas zu suchen. Oder nach jemandem?
»Ich weiß es nicht«, wisperte sie endlich und ich schloss die Augen, versuchte die Tränen aufzuhalten, die sich bereits einen Weg über meine Wangen suchten. Die Bilder der Nachrichten flackerten vor meinem inneren Auge wieder auf und ich dachte an die Gestalt dieser Wesen, die auf die Erde gekommen waren. Es waren Drachen. Völlig verrückt! So etwas durfte doch eigentlich gar nicht möglich sein. Die angenehme Wärme, die sich gestern in mir festgesetzt hatte, war wie weggeblasen und ich verspürte eine alles vernichtende Angst in mir.
***
Stunden waren vergangen.
Die Schritte verklangen allmählich und durch das kleine Gitterfenster im Heizungsraum konnte ich erkennen, dass sich der Himmel bereits zur Abenddämmerung zu verfärben begonnen hatte. Tausend Gedanken wirbelten in meinem Kopf umher. Was war mit Luca, meinem besten Freund? Und was war mit meinem Vater? Wieso war er noch nicht von der Arbeit zurück, warum war er nicht bei uns? War er vielleicht am falschen Ort gewesen, als diese Wesen auf die Erde gefallen waren? War er bereits …?
Wie versteinert starrte ich auf das immer dunkler werdende Fenster. Was, wenn alle, die ich kannte, gar nicht mehr da waren? Wenn es nur noch mich und meine Mutter gab? Mir wurde schlecht.
»Wir müssen hier raus«, hörte ich sie plötzlich sagen.
Verwirrt schaute ich sie an. Der Gedanke, das sichere Versteck verlassen und mich der Welt dort draußen stellen zu müssen, ließ mich erzittern. Ich hatte Angst vor dem, was mich auf den Straßen unserer Wohngegend erwarten würde.
»Wir können nicht ewig hierbleiben, Romy. Außerdem … dein Vater … wir müssen ihn finden.« Ein dumpfer Knall ertönte und ich zuckte zusammen.
»Was war das?«, flüsterte ich mit vor Angst bebender Stimme.
Meine Mutter presste die Lippen aufeinander. »Eine Bombe … die Bundeswehr ist bestimmt mobilisiert worden.« Sie riss den Blick vom Fenster los, nahm meine Hände in ihre, blickte mich energisch aus braunen Augen an. »Hör zu, wenn die Bundeswehr eingeschritten ist, wird es sicherlich auch eine Sammelstelle für die Leute geben. Wir können unseren Soldaten vertrauen. Aber wir dürfen nicht hierbleiben, Romy. Um beschützt zu werden, müssen wir die Soldaten finden.«
»Woher willst du wissen, dass eine Sammelstelle eingerichtet wird? Was, wenn es so etwas gar nicht mehr geben kann?«, gab ich schluchzend von mir. Meine Mutter riss mein Kinn hoch, damit ich ihr ins Gesicht sah. Wilde Entschlossenheit tobte in ihren Augen.
»Dein Vater war Jahre lang bei der Bundeswehr, ich weiß also in etwa, wie so etwas abläuft. Vertrau mir, Liebes, hier stehen unsere Chancen nicht so gut wie bei den Soldaten.«
Ich nickte, wischte mir die Tränen weg und versuchte tapfer zu sein.
Sie lächelte mild und strich mein Haar glatt, drückte mir einen Kuss auf die Stirn und flüsterte: »Alles wird gut.« Sie schien um einiges ruhiger zu sein, als ich es war.
Als sie vorsichtig den Schlüssel umgedreht und die Stahltür geöffnet hatte, lauschte sie einen Moment, konnte jedoch keine Geräusche im Inneren des Hauses ausmachen. Ich folgte ihr – so leise ich konnte – die Treppe nach oben. Wir öffneten die Tür zum Flur.
***
Um uns herum herrschte einen Atemzug lang eine alles verschlingende Stille. Erneut ertönte eine Explosion und aus der Ferne drangen Schüsse zu uns. Mein Herzschlag beschleunigte sich.
Meine Mutter ging in die Küche, schnappte sich einen Rucksack und warf haltbare Sachen hinein, wie Dosenravioli, Cracker und getrocknetes Obst. Ziemlich schnell erkannte ich ein System dahinter und mein Magen wollte sich umdrehen, mir wurde richtig schlecht. Dachte sie etwa, dass wir in nächster Zeit nicht hierher zurückkehren würden?
Ohne weiter Zeit zu verlieren, zog sie mich mit nach draußen. Ich stolperte über meine eigenen Füße, die nur in Flipflops steckten, und versuchte mit ihr Schritt zu halten. Mein luftiges Sommerkleid erschien mir jetzt albern und unpassend zu sein, doch wer hätte denn ahnen können, dass so etwas passieren würde?
***
Auf den Straßen herrschte Chaos. Die Menschen rannten panisch umher und wussten nicht, was sie tun sollten. Eine junge Frau war nur mit einem dünnen Bikini bekleidet, eine weitere trug noch ihr Handtuch nach der Dusche auf dem Kopf. Uns alle hatte dieses Ereignis völlig unvorbereitet getroffen und keiner wusste wirklich, wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Woher denn auch? Bisher hatten Drachen und Wesen aus einer anderen Welt nur in Büchern oder Filmen existiert.
Ein erneuter Knall ließ mich zusammenzucken, dieses Mal deutlich näher bei uns. Neben uns tauchte ein Panzer der Bundeswehr auf, weitere Fahrzeuge folgten. Die Fußsoldaten trugen schwere Gewehre um die Schultern, ebenso die, die auf den Fahrzeugen mitfuhren.
»Bitte bewahren Sie Ruhe und suchen Sie die Universität im Stadtzentrum auf. Dort ist eine Sammelstelle eingerichtet. Bitte bleiben Sie ruhig und gehen Sie geordnet zu der Universität.«
Meine Mutter und ich mischten uns unter die verängstigten Leute und liefen mit dem Strom. Ich konnte nicht anders und blickte mich immer und immer wieder um. Egal wohin ich sah, überall hingen Rauchschwaden in der Luft und zeigten das Ausmaß der Zerstörung.
Je näher wir der Innenstadt von Hamburg kamen, desto mehr konnte man sehen, wie schwer es uns getroffen hatte: Die meisten Gebäude waren gänzlich zerstört, überall flammten kleinere und große Feuer auf und erhellten die Nacht. Soldaten schrien etwas, Verletzte wurden von den Straßen gezogen. Männer und Frauen kauerten auf dem Boden vor toten menschlichen Körpern und weinten; weinten so bitterlich, dass dieses Geräusch für immer in meinem Kopf bleiben würde.
Und dann sah ich sie. Sie sahen aus wie wir, nur nicht so verängstigt, hilflos und überfordert. Während in unseren Gesichtern die pure Angst stehen musste, schienen sie völlig gelassen zu sein. Ich sah Leute, die voller Panik ihre Fahrzeuge mit Taschen beluden, vermutlich um die Stadt zu verlassen. Und dann sah ich einen Mann, dessen muskulöse Gestalt in einer schwarzen Lederhose und Lederweste steckte – fast hätte man denken können, er wäre einer von uns, doch dann traf er einen Soldaten mit einem gewaltigen Tritt gegen die Brust, was ihn mehrere Meter weit durch die Luft schleuderte. Er musste enorme Kräfte haben.
Eine blonde Frau wich einem Soldaten aus und griff an den Lauf seines Sturmgewehrs. Als wäre es Butter in ihrer Hand, bog sie ihn nach oben und machte die Waffe völlig unbrauchbar. Panik brach aus, als ein weiterer Knall in unmittelbarer Nähe ertönte, und die Menschen rannten wild durcheinander. Ich verlor die Hand meiner Mutter und wurde zu Boden gedrückt.
»Romy!«, hörte ich meine Mutter schreien, doch eine weitere Explosion trieb sie fort von mir. Spitze Steine und Glasscherben bohrten sich in meine Haut, als Leute rücksichtslos über mich hinwegtrampelten. Ich krümmte mich zusammen und schützte den Kopf mit den Armen. Ein weiterer Tritt in den Rücken. Dann stolperte jemand über mich und fiel. Tränen rannen über mein Gesicht und ich wollte einfach nur, dass es aufhörte.
Verschwommen nahm ich die Silhouetten von davonrennenden Menschen wahr, bis es irgendwann gespenstisch ruhig wurde. So ruhig, dass ich die drohende Bewusstlosigkeit, die an mir zerrte, nicht mehr zurückdrängen konnte.
***
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich dort auf der Straße gelegen hatte, doch endlich kam wieder Leben in mich. Jeder Muskel in meinem Körper brannte, der rechte Arm, auf dem ich gelegen hatte, war wegen der Glassplitter mit unzähligen kleinen Schnittwunden übersät. Ich brauchte meine ganze Willenskraft, um mich irgendwie aufzurichten. Ein heißer Schmerz schoss mir in die Seite und ich merkte, wie mein Blickfeld erneut zu verschwimmen drohte. Dann war da plötzlich eine Hand, die mich am Oberarm packte und auf die Füße zerrte. Ich wusste nicht, wie mir geschah.
»Komm schon, Kleine! Nicht am Boden bleiben!«, schrie der Mann mir zu und ich stolperte blindlings mit ihm.
Adrenalin begann sich in mir auszubreiten; trotzdem war ich durch die vielen Tritte, die ich abbekommen hatte, zu benommen, um mich schnell fortzubewegen. Die Flipflops hatte ich verloren, ich erinnerte mich aber nicht, wann. Glasscherben bohrten sich schmerzhaft in meine Füße und ich stolperte, fiel und wollte nicht mehr aufstehen.
»Verdammt! Dennis, ich muss sie tragen!« Der Zorn und die Verzweiflung waren dem Fremden deutlich anzuhören, als er zu mir zurückkam und mich auf seine Arme hob. Meine Muskeln zitterten und jeder Atemzug brannte in der Lunge, löste eine Welle von Schmerz an meinem rechten Rippenbogen aus. Ich wusste nicht, wie lange der Unbekannte lief, doch irgendwann wurde es ruhiger um uns. Sein Atem ging nur noch stoßweise, und als er mich absetzte, sah ich ihn das erste Mal an.
Er trug eine Uniform der Bundeswehr, doch das, was meine Aufmerksamkeit anzog, waren die blutigen Wunden, die sich über sein ganzes Gesicht zogen. Fünf Stück an der Zahl, als wäre er von jenen Bestien aufgeschlitzt worden.
Eine weitere Gestalt trat in mein Blickfeld. Der zweite Mann, Dennis, vermutete ich, war nicht so geschunden wie der Soldat.
»Kannst du laufen? Die Universität ist nicht mehr weit, vielleicht zwei Straßen entfernt. Du musst nur bis dahin durchhalten, okay?«
Eigentlich wollte ich nicht mehr. Ich wollte die schmerzenden Beine nicht mehr bewegen müssen und ich wollte auch nicht länger weglaufen. Ich wollte einfach die Augen öffnen und aus diesem Albtraum erwachen. Das konnte doch alles nicht real sein!
»Meine Mutter …« Meine Stimme brach und ich hustete, um das Kratzen im Hals zu beseitigen. Ich hatte sie verloren. War sie tot? Oder hatte sie es bis zur Universität geschafft?
»Die ist sicher bei der Universität, viele Menschen haben es dorthin geschafft. Komm schon, Kleine.«
»Romy«, krächzte ich, weil ich es trotz allem nicht ausstehen konnte, wenn man mich »Kleine« nannte. Ein Lächeln trat auf das verschmutzte Gesicht des Soldaten.
»Alles klar, Romy. Ich bin Jakob, der hinter mir heißt Dennis. Und wir drei werden jetzt zu dieser gottverdammten Universität gehen, verstanden?«
Ich nahm all meine Willenskraft zusammen und stand mit Jakobs Hilfe auf. Er stützte mich und schlang meinen Arm um seine Schulter. Ich keuchte vor Schmerz auf, als ich die ramponierte rechte Seite strecken musste, weil Jakob viel größer war als ich.
»’tschuldige«, murmelte er, während wir Dennis hinterherliefen, der sicherstellte, dass sich die Wesen nicht hinter einer Hausecke befanden und nur auf uns warteten.
»Was sind das für Dinger?«, fragte ich leise. Die Sonne war bereits untergegangen und es herrschte tiefschwarze Nacht. Nur die noch immer glühenden Feuer erhellten unseren Weg. Ich musste mehrere Stunden auf der Straße gelegen haben. Ein kalter Schauer überlief mich, diese Wesen hätten mich töten können.
»Ich habe keine Ahnung. Sie sehen aus wie wir, sind aber unmenschlich schnell und stark. Sie haben uns überrannt, als wären wir nichts.«
»Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie aussahen, als sie fielen. Es waren … Drachen.« Als ich es aussprach, fühlte ich mich furchtbar albern, wie ein kleines fünfjähriges Mädchen, das noch an die Zahnfee glaubte. Doch Jakob lachte nicht.
»Ich weiß« war alles, was er antwortete.
Der Rest des Weges zur Universität war die reinste Qual. Jeder Muskel und jeder Knochen in meinem Körper protestierte, doch ich hielt die Schmerzen aus, um zu diesem Gebäude zu gelangen. Als wir in der Straße ankamen und sahen, dass die Universität kaum beschädigt war, konnte ich das erste Mal so etwas wie Hoffnung in meiner Brust spüren. Vielleicht würden wir auf weitere Überlebende treffen. Und vielleicht waren meine Eltern unter diesen Leuten. Ich biss die Zähne zusammen und zwang mich, die letzten Meter etwas schneller zu laufen. Jakob ließ mich vorsichtig los und eilte voraus, während ich ohne ihn als Stütze nur langsam vorankam.
Er stieß die Tür zur Universität auf und mit einem dumpfen Knall schwang sie zur Seite.
***
Jakob hielt sein Sturmgewehr vor sich, bereit zu schießen, während er mit langsamen Schritten ins Innere des Gebäudes trat. O Gott. Rechnete er etwa damit, dass wir in einen Hinterhalt gerieten? Meine Kraft war aufgebraucht und ich würde sicher sterben, wenn wir erneut fliehen mussten.
Als auch ich durch die Tür gekommen war, ließ Jakob gerade die Waffe sinken und hob die Arme in die Luft. Zwei Männer standen mit angelegtem Gewehr vor uns, schwarze Tücher bis zu den Augen hochgezogen.
»Seid ihr wie die oder seid ihr Überlebende?«, fragte der eine und richtete das Gewehr auf mich, als ich stehen blieb und langsam die zittrigen Hände in die Luft hob.
»Überlebende«, antworteten Jakob und ich wie aus einem Mund. Einen kurzen Moment blieben die Waffen noch auf uns gerichtet, dann schaute der Mann zu Dennis und richtete das Gewehr auf ihn.
»Und was ist mit dir?« Sein Zeigefinger schwebte über dem Abzug, ich konnte die feinen Schweißperlen auf seiner Stirn ausmachen, die deutlich zeigten, dass der Mann bis aufs Äußerste angespannt war. Mein Blick glitt zu Dennis und gerade als dieser den Mund öffnete, verlor der Mann die Beherrschung und drückte den Abzug. Ich sah noch, wie seine Augen in einem so leuchtenden Grün glühten, wie ich es nie zuvor gesehen hatte, bevor blaues Blut aus den Einschusslöchern floss und sein Hemd benetzte. Ein Schrei kletterte meine Kehle hinauf, als Dennis zu Boden fiel und nicht mehr aufstand.
»Er ist einer von denen!«, brüllte einer der Männer und zielte mit der Waffe erneut auf mich und Jakob. Tränen verschleierten meinen Blick und ich schloss die Augen, sendete ein Stoßgebet an den Himmel, dass diese Männer uns nicht einfach erschossen.
»Gottverdammte Scheiße!« Jakobs Gewehr fiel scheppernd zu Boden. »Ich hatte keine Ahnung, dass er einer von denen ist, bitte, ich wusste es nicht! Mein Name ist Jakob Hamann und ich bin Soldat der Deutschen Bundeswehr, bitte, ich schwöre euch, ich wusste nicht, dass er einer von denen ist!«
Als ich etwas Kühles an meiner Haut spürte, öffnete ich die Augen. Der metallene Lauf einer Pistole wurde gegen meine Stirn gepresst. Erneut kamen mir Tränen und ich schüttelte vehement den Kopf, war völlig überfordert mit dieser ganzen Szenerie.
»Er sagt die Wahrheit, bitte. Bitte töten Sie uns nicht«, brachte ich schluchzend hervor und konnte nicht verhindern, dass ich am ganzen Körper zitterte wie Espenlaub. Der Mann, der Dennis getötet hatte, blickte den anderen an. Sie trugen noch immer die schwarzen Tücher vor Nase und Mund, sodass nur ihre Augen zu sehen waren.
»Was ist denn hier los?!«, ertönte eine weitere Stimme und eine hochgewachsene Frau mit rotem Haar kam aus dem Gebäude und trat zwischen den beiden Männern hindurch. Ihr Blick glitt zu der Leiche am Boden, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf mich und Jakob.
Ich sah Zuneigung in ihren Augen aufflammen, als sie den Soldaten ansah.
»Jakob? O Gott, ich hatte ja keine Ahnung, dass du schon wieder zurück bist!«
Ehe ich mich’s versah, fiel sie dem Soldaten um den Hals, legte ihm die Hände an seine Wangen und betrachtete die tiefen Furchen in seinem Gesicht. Tränen glitzerten in ihren Augen und auch er schien nicht weniger berührt von diesem Wiedersehen zu sein.
»Das ist mein Bruder. Bring sie rein, Erik, und lass ihre Wunden von Marie verarzten«, sagte sie an die Männer gewandt, ohne jedoch den Blick von Jakob zu nehmen. »Du kommst mit zu Wolf, es wird ihn sicher freuen, einen weiteren Soldaten in unserem Team zu haben.«
Erik zog das Tuch hinunter, nahm mich am Arm und führte mich ins Innere der Universität. Der Stein, der mir vom Herzen fiel, schien die Größe eines verdammten Berges zu haben.
***
Im Gebäude waren viele Überlebende und die Hoffnung, dass meine Eltern auch hier sein könnten, überwältigte mich fast. Fiebrig suchend blickte ich mich um, doch ehe ich jemanden finden konnte, zog Erik mich mit zu einer jungen Frau. Ein Pflaster klebte auf ihrer dunklen Haut über der Augenbraue und ihr schwarzes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Spitzen sahen aus, als wären sie angekokelt worden, ihre Kleidung war schmutzig und wies ebenfalls einige Brandlöcher auf.
»Setz dich hierhin«, forderte sie geschäftig und Erik versetzte mir einen kurzen Stoß, als ich nicht sofort reagierte. Ich ließ mich auf dem Boden nieder, lehnte den Rücken gegen die Wand und schloss die Augen. Erschöpfung floss durch meine Adern und alle Glieder wurden so schwer, dass ich fürchtete nie wieder aufstehen zu können.
Während Marie meine Wunden säuberte und meine Rippen abtastete, hielt ich die Augen geschlossen und versuchte, keinen Mucks von mir zu geben. Als ich ihre Hände nicht mehr auf meinem Körper spürte, wollte ich endlich die Lider öffnen und weiter nach meinen Eltern suchen, aber die Müdigkeit und Erschöpfung zerrten so heftig an mir, dass ich nicht einmal mehr das schaffte. Ich ließ mich mitreißen und hinab in die Schwärze ziehen, die ihre fahrigen Finger nach mir ausstreckte.
Ob es Ohnmacht oder Schlaf war, wusste ich nicht, doch rückblickend würde ich froh sein, dass der mögliche Verlust meiner Eltern zumindest in diesem Moment nicht mehr gegenwärtig war.
Kapitel 3
Romy
Als ich zu mir kam und gegen die aufgehende Sonne, die durch die Fenster schien, blinzelte, verlor ich mich fast in der Annahme, dass alles nur ein schlimmer Traum gewesen war. Die Ereignisse waren noch nicht bis in meinen Verstand eingedrungen, doch als ich mich umsah und die Menschen erkannte, die Zuflucht in der Universität gefunden hatten, wurde mir klar, dass es sich um die harte Realität handeln musste. Gleich darauf ertönte der Knall einer detonierenden Bombe und ließ die Erde erbeben. Die gläsernen Anhänger eines Kronleuchters klirrten.
Meine schmerzenden Muskeln und das Dröhnen im Kopf ignorierend stand ich auf und bahnte mir einen Weg durch die Menge. Meine Füße, die in dicken Verbänden steckten, protestierten. Aber ich musste unbedingt nach meinen Eltern suchen, denn ich wollte nicht daran denken, dass sie es vielleicht gar nicht bis hierher geschafft hatten. Mit jedem weiteren markerschütternden Knall zuckte ich zusammen, während langsam der Staub von der Decke der Universität rieselte. Ewig würde das Gebäude nicht standhalten.
»Bist du sicher, dass du schon laufen solltest?«, fragte jemand und ich drehte mich um. Es war der Soldat von gestern, Jakob. In den Händen hielt er ein Bündel frische Kleidung und Schuhe, die ich wirklich gut gebrauchen konnte. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich keine Schuhe trug und ich noch immer das Sommerkleid anhatte, welches mit Rissen, Schmutz und Blut übersät war. Ich blickte an mir hinunter und zuckte leicht mit den Schultern.
»Ich muss meine Eltern finden, weißt du?«
Er nickte, reichte mir die Kleidung und lenkte mich zurück zu meinem Platz, an dem ich die Nacht verbracht hatte. »Zieh dich erst einmal um, ich sage Marie Bescheid, dass du wach bist. Sie wird nach dir sehen, dann kannst du nach deinen Eltern suchen, okay?«
Ich wollte protestieren, wollte die nutzlose Behandlung nicht, doch da zog es heftig in der schmerzenden Seite, weswegen ich lieber den Mund hielt. Meine Rippen mussten mehr abbekommen haben, als ich gestern geglaubt hatte. Ich nuschelte eine Zustimmung, ehe ich mich hinter einer Säule versteckte und das farbenfrohe Kleid gegen Cargohose und T-Shirt tauschte.
Über die Verbände stülpte ich Socken, dann versuchte ich in die Stiefel zu kommen, die Jakob mir hingestellt hatte. Ich sog die Luft scharf ein, als die gereizte Haut an den Schnitten spannte, schaffte es allerdings, die Schuhe anzuziehen. Die Schnürsenkel würde ich vorerst offen lassen müssen. Gerade als ich mich doch etwas umsehen wollte, kam Marie durch die Menge auf mich zu.
»Nicht so schnell«, hielt sie mich auf und ich blickte die Augen verdrehend zu ihr. Sie trug einen Pappteller mit etwas Brot und einen Becher vor sich. »Frühstück«, erklärte sie, stellte den Teller ab und deutete auf meine Seite. »Ich muss mir deine gebrochene Rippe noch mal ansehen, okay?«
Seufzend nickte ich. Da ich wusste, dass ich sowieso keine Chance gegen sie hatte, zog ich das Shirt hoch und ließ Marie ihre Arbeit tun. Sie lockerte den stabilisierenden Verband und drückte etwas an meinem Brustkorb entlang, was mir ein leises Keuchen entlockte. Die ganze rechte Seite schmerzte und war vermutlich vollkommen blau. Anders gesehen hatte ich noch Glück gehabt, eine gebrochene Rippe war nichts im Gegensatz zu den vielen Menschen, die ihr Leben gelassen hatten.
»Ich muss meine Eltern suchen«, sagte ich, als Marie einen neuen Verband anlegte. Ihre dunklen Augen waren konzentriert auf meine Rippen gerichtet, doch sie nickte als Zeichen, dass sie mir zugehört hatte.
»Bitte bleib innerhalb des Gebäudes. Die Überlebenden aus der Umgebung sind sehr wahrscheinlich alle hier. Wenn du mit deinen Eltern auf dem Weg hierher warst, wirst du sie finden. Iss erst etwas, dann kannst du sie suchen, okay? Du musst bei Kräften bleiben, so gut es geht.«
Keine Ahnung, ob ich erwartet hatte, dass Marie mich sofort gehen ließ, aber ihre Worte gefielen mir nicht. Ich presste die Lippen aufeinander, nickte bloß zur Antwort und ließ mich wieder auf den Boden sinken.
»Es wird alles wieder gut werden«, versuchte sie mich mit einem schwachen Lächeln zu trösten, derweil ich in das Brot biss. Kurz nachdem Marie weg war, schmiss ich die angebissene Scheibe zurück auf den Teller und stand auf, um endlich loszugehen. Vielleicht waren Luca und Sina bei meinen Eltern. Vielleicht machten sie sich Sorgen und wussten nicht, ob ich es geschafft hatte.
Mein Herz machte einen Satz, als ich durch die Menge ging und eine Frau auf dem Boden ausmachte, die so leuchtendes kastanienbraunes Haar trug wie meine Mutter. Hoffnungsvoll fasste ich an ihre Schulter.
»Ma?«
Sie drehte sich um, doch nicht die vertrauten braunen Augen blickten mir entgegen, sondern fremde blaue. Ich zog die Hand zurück und schenkte ihr einen entschuldigenden Blick. »Oh, ich habe Sie verwechselt, tut mir leid.«
Ich ging weiter durch das Erdgeschoss und suchte den Eingangsbereich erfolglos ab. Fast wollte ich schon die Hoffnung verlieren, da hörte ich hinter mir plötzlich eine Stimme. »Romy?«
Mein Herz klopfte wie wild, als ich mich umdrehte und meiner Mutter in die Augen blickte. »Mama!«, schrie ich und rannte, trotz bandagierten Füßen, auf sie zu, Tränen rannen mir die Wangen hinab. Sie schlang ihre Arme um meinen Körper und drückte mich fest an sich, sodass meine Rippen schmerzten, doch es kümmerte mich nicht. Ich nahm den vertrauten Duft nach Rosen wahr, der sich mit etwas Verbranntem mischte. Die Erleichterung, sie unversehrt in den Armen halten zu können, überwältigte mich.
»Als ich dich verloren hatte, dachte ich, du würdest sterben«, stieß sie schluchzend hervor und ich schüttelte den Kopf, verbarg das Gesicht in ihrem weichen Haar.
»Ein Soldat hat mich gefunden und hergebracht.«
Sie hielt mich eine Armeslänge von sich und betrachtete mich abschätzend.
Bevor sie jedoch etwas sagen konnte, kam ich ihr zuvor. »Was ist mit Papa? Ist er … hier? Und hast du Luca oder Sina gesehen …« Die Worte kamen so schnell aus mir heraus, dass ich mich verhaspelte. Ich drückte ihre Hände. Die Hoffnung, sie alle wiederzusehen, wollte mich schier übermannen und ich mochte nicht einmal daran denken, was mit mir geschehen würde, wenn sie jetzt mit traurigem Blick erzählte, dass keiner von ihnen es geschafft hatte.
»Sie sind alle hier, Schätzchen. Komm mit, wir gehen zu ihnen.« Sie lächelte mich an und ein riesiger Stein fiel mir vom Herzen. Fast spürte ich schon, wie sich neue Tränen in meinen Augen bildeten, die Erleichterung und Freude, meine Familie wiederzusehen, war gewaltig!
Als sie mich in einen Nebenraum gebracht hatte und ich meinen Vater sowie Sina und Luca sah, konnte mich nichts mehr aufhalten. Ich stürmte auf sie zu, warf mich meinem Vater um den Hals und drückte Sina und Luca an mich. Es tat gut, sie alle hier lebendig anzutreffen, ich hatte gar nicht zu hoffen gewagt sie jemals wieder zu Gesicht zu bekommen. Wären sie gestorben, hätte ich nicht gewusst, wie ich das alles überstehen sollte.
»Wir dachten schon, du würdest es nicht schaffen, als deine Eltern uns gefunden haben und du nicht dabei warst«, erzählte Luca mir und presste mich an sich. Sein dunkelblondes Haar war zerzaust, er sah müde und ausgelaugt aus. Ich löste mich aus der Umarmung und stürzte mich in die Arme meiner besten Freundin, die einen feinen Kratzer oberhalb der Augenbraue hatte.
»Ich hatte Glück im Unglück«, erwiderte ich mit einem schwachen Lächeln und erzählte meinen Freunden die Kurzversion der Geschichte, wie Jakob mich gefunden hatte. »Habt ihr … diese Dinger gesehen? Was ist mit euren Eltern?«, fragte ich, ohne Luft zu holen.
Sina und Luca tauschten kurz einen Blick aus, ehe Sina die Arme vor der Brust verschränkte und sich mit den Händen über ihre Oberarme rieb. Ich war mir sicher, dass sie genauso gruseliges Zeug gesehen hatten wie ich.
»Sinas Eltern und mein Vater sind auch hier, es geht ihnen gut. Das waren Drachen, nicht wahr? Wie abgefahren ist das bitte?« Luca schüttelte den Kopf, als könne er es nicht begreifen. Und so war es ja auch. Jetzt, wo etwas Zeit verstrichen war und wir darüber nachdenken konnten, was wir erlebt hatten, wirkte alles völlig surreal. Aber jeder von uns wusste, was wir gesehen hatten, und das waren definitiv Drachen gewesen.
»Hey, was ist da drüben los?«, fragte mein Vater und deutete auf die Menschen, die es in den Eingangsbereich der Universität verschlug. Ich folgte meinen Eltern, als sie sich in Bewegung setzten und ebenfalls in die Richtung gingen. Ein Mann, vielleicht Ende vierzig oder Anfang fünfzig, stand am Geländer des ersten Stocks und schaute auf die Menge hinunter. Seiner Uniform nach zu urteilen, war er ebenfalls ein Soldat.
»Mein Name ist Johannes Wolf, ich bin Generalmajor der Deutschen Bundeswehr. Wie Sie alle mitbekommen haben, befinden wir uns im Krieg mit einer nicht identifizierten Spezies. Soweit wir wissen, ist nicht nur Deutschland befallen worden, sondern ganz Europa. Vermutlich haben diese Kreaturen auch Asien, Amerika und die anderen Kontinente besetzt. Was sie wollen, ist nicht klar, doch das hier ist ein Krieg wie jeder andere und wir sind ausgebildet worden, um Wesen wie sie zu vernichten. Die Universität ist vorerst sicher, Sie brauchen keine Angst zu haben. Meine Männer und ich werden dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert.«
Er nickte der Menge einmal zu, ehe er zu den Treppen ging und wieder nach unten kam. Ich betrachtete ihn, er war ein gut gebauter Mann, der vermutlich schon viel mehr gesehen hatte, als ich mir vorstellen konnte. Während er an uns vorbeiging, konnte ich die Narben erkennen, die sein Gesicht zeichneten. Das graue Haar war kurz geschoren, eine weitere wulstige Narbe zog sich von seiner linken Schläfe bis zum Hinterkopf. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie er sie bekommen hatte.
Draußen war es verdächtig ruhig geworden. Ich hasste die Tatenlosigkeit und nachdem Sina zu ihren Eltern gegangen war und Luca und meine Mutter sich hingelegt hatten, lief ich ziellos durch das Universitätsgebäude. Als ich sah, dass mehrere Soldaten mit erhobenen Sturmgewehren zur Tür rannten, hielt ich Jakob auf, der ebenfalls zu Hilfe eilen wollte. Seine Schwester, der wir unser Leben verdankten, war einige Schritte entfernt und half Verletzten.
»Hey, was ist da los?«, fragte ich Jakob und deutete auf die Tür, die sich einige Meter vor uns befand. Die Soldaten waren verschwunden, doch irgendwie baute sich ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend auf.
»Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Dinger nicht so leicht zu töten sind. Dennis hat die Schüsse überlebt, kannst du dir das vorstellen? Er ist aufgestanden und davongelaufen, als hätte er nicht mindestens ein halbes Dutzend Kugeln im Bauch gehabt. Keine Ahnung, was das für Wesen sind, aber ich glaube, für uns sieht es nicht gut aus. Jedenfalls nicht, solange wir nicht wissen, wie sie zu töten sind.«
Ich presste die Lippen aufeinander. Dennis lebte also. Es schien mir so unmöglich, dass er diese Schüsse überlebt hatte und immer noch da draußen herumlief. Was war sein Plan gewesen? Hatte er nur sehen wollen, wo wir uns zusammenfanden und Schutz suchten? Was, wenn er ein Spitzel der anderen war und sich nun eine ganze Gruppe von denen auf den Weg zur Universität machte? Ein Schauer überlief meinen Rücken.
»Denkst du, wir sind hier sicher?«, fragte ich ihn besorgt. Die Wunden in seinem Gesicht waren gereinigt und mit Wundnahtstreifen zusammengeflickt worden. Seine braunen Augen waren voller Wärme, ganz gleich, in welcher schwierigen Situation wir uns befanden. Erst jetzt fiel mir auf, dass er ein attraktives Gesicht hatte. Ohne den Helm, den er gestern getragen hatte, konnte ich die kurzen dunkelbraunen Haare erkennen, die sich leicht lockten. Der stoppelige Dreitagebart ließ ihn älter wirken, als er vermutlich war. Bevor er antwortete, blickte er sich um, um sicherzugehen, dass uns niemand zuhörte.
»Willst du, dass ich ehrlich bin?« Ich nickte, erwiderte prüfend den durchdringenden Blick in seinen Augen. »Ich glaube nicht, dass diese Universität tatsächlich sicher ist. Früher oder später werden sie hier reinkommen und dann, hoffe ich, sind wir schon weitergezogen.«
Ich wollte etwas erwidern, doch ein markerschütterndes Brüllen, das nicht von dieser Welt sein konnte, machte jegliche Erwiderungen nichtig. Ich fuhr zur Tür herum, hörte Schüsse und Schreie von den Männern, die vergeblich versuchten, die Universität zu verteidigen.
»Sie brechen durch!«, schrie jemand und keine Sekunde später zerbarst die Tür und die Quelle des Brüllens stürzte ins Innere der Universität. Augenblicklich brach Panik aus, doch der Schock lähmte mich, sodass ich dieses Wesen vor mir nur anstarrte.
Man konnte es vielleicht mit einer Raubkatze vergleichen, nur war diese Kreatur viel, viel größer. Sein gewaltiger Kiefer zeigte messerscharfe Zähne, kleine Ohren lagen an dem bulligen Kopf an, weiße ölige Haut spannte sich über jeden Muskel des Körpers. Das Ende des zuckenden Schweifs war mit Stacheln besetzt, rabenschwarz wie das Pech, welches uns verfolgte. Es riss das Maul auf, Geifer triefte zu Boden und verätzte die Fliesen, ein weiteres Brüllen drang tief aus der Kehle des Monsters.
»Wir müssen hier weg. Komm schon, Romy!«, schrie Jakob, packte meinen Arm und riss mich mit sich.
Ich stolperte über meine eigenen Füße und konnte den Blick kaum nach vorn richten, denn weitere Ungeheuer brachen ein, strauchelten und rutschten einige Meter ins Innere der Universität. Hätten sie nicht so grotesk und Furcht einflößend ausgesehen, hätte man sie mit einer Schar tollpatschiger Welpen gleichsetzen können. Doch diese Dinger pflügten durch die Menschenmenge, als wären wir Streichhölzer. Zwei dieser Wesen stritten sich um einen Soldaten, dann erklang ein reißendes Geräusch – und der Mann war entzweigerissen. Ein erstickter Schrei entwich mir und mein Herz pumpte viel zu schnell. Adrenalin schoss mir durch die Adern und meine Beine lernten wieder, was es hieß, zu rennen.
»Sieh zu, dass du hier rauskommst!« Jakob schubste mich in die Arme meines Vaters, der wie aus dem Nichts auftauchte, ehe er sein Gewehr in beide Hände nahm und auf die Wesen schoss. Mein Vater legte eine Hand an meinen Rücken und schob mich nach vorn.
»Wir können ihn nicht zurücklassen!«, rief ich verzweifelt, als ich sah, wie Jakob sich einen Weg zu Erik bahnte, der verletzt am Boden lag.
Eine dieser Raubkatzen richtete den Blick aus milchigen Augen auf ihn, der Schweif zuckte, ehe sie sich nach vorn stürzte. In dem Moment, in dem ich sah, wie dieses Wesen sich auf Jakob und Erik stürzen wollte, während beide am Boden waren, setzte irgendetwas in meinem Gehirn aus. Ich riss mich von meinem Vater los, hörte nur wie aus weiter Ferne, dass er meinen Namen schrie, hetzte nach vorn und half Jakob auf die Füße.
»Komm schon!«, schrie ich ihn an und zerrte an seinem Arm.
»Wir müssen ihm helfen!« Verzweiflung stand in Jakobs Gesicht, doch plötzlich war das Monster da und versenkte die scharfen Zähne in Eriks Bein. Er schrie, während es ihn schüttelte. Ein ekelerregendes Geräusch von Knochenknacken, Eriks markerschütternder Schrei, welcher von jetzt an immer in meinem Kopf bleiben würde, und dann spritzte Blut.
Ich verstand erst nicht, dass es Eriks Bein war, das die Kreatur vor uns gierig verschlang, verstand nicht, dass er dem Tode geweiht war, dass sein Blut sich rasend schnell auf den Fliesen verbreitete. Seine Augen wurden glasig, als er zu uns sah, seine Lippen formten ein tonloses Helft mir!, ehe sich die Zähne des Monsters erneut in Eriks Fleisch fraßen und sein Körper erschlaffte. Er … war nicht mehr.
»Wir müssen … hier weg«, flüsterte Jakob fassungslos. Ich krallte die Finger in den Stoff seiner Jacke. »Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg!«
Als würde ein Schalter umgelegt werden, kam wieder Leben in uns und Jakob riss mich mit sich. Menschen rannten wild umher, immer wieder ertönten Schüsse und das Brüllen der Kreaturen, die uns zerrissen wie Postkarten. Ein blutüberströmter Mann prallte gegen mich und ich wäre gefallen, hätte Jakob mich nicht festgehalten.
»Wir dürfen keine Zeit verlieren, komm schon! Nicht stehen bleiben, Romy!« Jakob hatte recht: Wenn wir überleben wollten, durften wir nicht stehen bleiben. Wir mussten rennen, weitermachen. Immer weiter. Blut begann in meinen Ohren zu rauschen und ich hörte die Worte von Johannes Wolf, die sich in meinem Kopf abspielten wie ein Mantra, während das Chaos um uns herum jegliche Hoffnung zerstörte.
Die Universität ist sicher, hatte der Generalmajor gesagt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Universität ist sicher.
Jakob und ich rannten weiter, dorthin, wo sich schon zahlreiche Menschen befanden. Erst konnte ich nicht sehen, was hinter der Traube war, doch dann erkannte ich ein Notausgangsschild. Der Hinterausgang! Natürlich.
Eine Frau, in deren Gesicht pure Panik stand, bahnte sich brutal um sich schlagend einen Weg durch die Menschenmenge und stieß mich heftig zu Boden. Ich verlor Jakobs Hand und kam auf den Fliesen auf, durch meine rechte Seite schoss ein heftiger Schmerz, als meine demolierten Rippen mit dem Boden Bekanntschaft machten. Ich spürte, wie man über mich hinwegtrampelte, Bilder von gestern flammten vor meinem inneren Auge auf, wie die Leute achtlos über mich fielen, wie sich die Glasscherben in mein Fleisch bohrten und ich bewusstlos wurde. Nein, nein, nein!
Ich musste leben, ich musste aufstehen! Ein verzweifelter Schrei zwängte sich aus meiner Kehle und ich versuchte mich aufzurichten. Wieder waren da Hände, die mich auf die Füße zerrten, und wieder war es Jakob, der mir entgegenblickte. Irgendwie schafften wir es, zum Hinterausgang zu gelangen. Warme, nach Feuer stinkende Luft wehte mir entgegen und Rauch brannte in meiner Kehle.
***
»Die Hälse! Schießt auf die Hälse!«, schrie Wolf, der etwas weiter vorn sein Sturmgewehr erneut anlegte. Mein Blick glitt über die Schulter und ich sah eines dieser Wesen, das sich bis zu uns gekämpft hatte. Die Kugeln prallten an der stahlharten Haut ab, doch tatsächlich war der Hals ungeschützt. Ein weiterer Soldat schoss eine Kugelsalve ab und zielte direkt in das geöffnete Maul. Mit einem letzten, gurgelnden Geräusch krachte die Kreatur zu Boden und blieb reglos liegen.