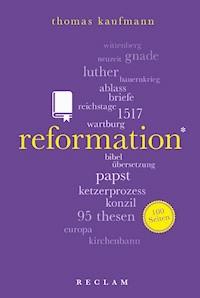21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Buchdruck veränderte die Welt, doch es bedurfte einer zweiten Generation von «Printing Natives», die mit Ablassbriefen, Thesen, Diffamierungen und Sensationsmeldungen als Massenware einen tiefgreifenden Kulturwandel entfesselte. Der renommierte Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann zeigt in seinem anschaulichen, Augen öffnen den Buch, warum wir die «Generation Luther» besser verstehen, wenn wir die heutigen «Digital Natives» betrachten – und umgekehrt. Die ersten Autos waren motorisierte Kutschen, der Computer diente als Schreibmaschine, und gedruckte Bücher setzten die handgeschriebenen fort: Innovationen werden zunächst in den gewohnten Bahnen genutzt, bevor eine zweite Generation die neuen Möglichkeiten ausschöpft. Thomas Kaufmann beschreibt, wie um 1500 eine junge Generation die Drucktechnik nutzte, um gegen die «Türkengefahr» zu mobilisieren, Ablassbriefe zu vertreiben und für eine «Reformation» der Kirche zu kämpfen. Drucker wie Aldus Manutius, Graphiker wie Albrecht Dürer, Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und Johannes Reuchlin oder Theologen wie Martin Luther und Ulrich Zwingli vermarkteten sich auf Flugschriften und in Traktaten selbst und machten Druck: Gegner wurden in wachsenden Echoräumen diffamiert, Ereignisse zu Sensationen gemacht, um eine sich zerstreuende Aufmerksamkeit zu fesseln. Die Reformation war, wie Thomas Kaufmann zeigt, nur ein Teil dieses viel breiteren kulturellen Umbruchs. Schließlich veränderte die neue Technik die Art des Forschens und mit Enzyklopädien oder druckgraphischen Werken die Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
THOMAS KAUFMANN
DIEDRUCKMACHER
Wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte
C.H.BECK
Zum Buch
Der Buchdruck veränderte die Welt, doch es bedurfte einer zweiten Generation von «Printing Natives», die mit Ablassbriefen, Thesen, Diffamierungen und Sensationsmeldungen als Massenware einen tiefgreifenden Kulturwandel entfesselte. Drucker wie Aldus Manutius, Graphiker wie Albrecht Dürer, Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und Johannes Reuchlin oder Theologen wie Martin Luther und Ulrich Zwingli vermarkteten sich auf Flugschriften und in Traktaten selbst und machten Druck: Gegner wurden in wachsenden Echoräumen diffamiert, Ereignisse zu Sensationen gemacht, um eine sich zerstreuende Aufmerksamkeit zu fesseln. Die Reformation war, wie Thomas Kaufmann zeigt, nur ein Teil dieses viel breiteren kulturellen Umbruchs. Schließlich veränderte die neue Technik die Art des Forschens und mit Enzyklopädien oder druckgraphischen Werken auch die Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen.
Über den Autor
Thomas Kaufmann ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 2020 wurde er mit dem Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Bei C.H.Beck erschienen von ihm u.a. «Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der Reformation» (4. Aufl. 2017) sowie in C.H.Beck Wissen «Martin Luther» (5. Aufl. 2017).
Inhalt
Einleitung: Digital Natives und Printing Natives
1: Die erste Medienrevolution
Von Lettern, Setzkästen, Druckpressen und Schrifttypen
Großprojekte, Einblattdrucke, hohe Auflagen
Zeitungen, Sensationsmeldungen, Fake News
Ein expansives Gewerbe
Begeisterung und Skepsis, Zensur und nationaler Stolz
Der Buchdruck in der protestantischen Erinnerungskultur
2: «Männer des Buches»
Johannes Reuchlins kostspieliges Projekt
Erasmus von Rotterdam und sein Bestseller
Das Buch als Objekt der Begierde
Selbstvermarktung und der Schutz von Urheberschaft
Der «Judenbücherstreit» als Medienereignis
3: Publizistische Explosionen
Die Lawine rollt: Der Streit um den Ablasss
Luthers Publizistik unter Druck
Wittenberg gegen Ingolstadt: Luther und Karlstadt gegen Eck
Nichts mehr zu verlieren: Luthers Veröffentlichungen 1520
Die Verbrennung der päpstlichen Bulle und Luthers Auftritt in Worms
Die Verbrennung der Bannandrohungsbulle
Luthers Auftritt auf dem Wormser Reichstag
Lagerbildung in der reformatorischen Bewegung
Neben Luther: Zwingli und Oekolampad
Huldrych Zwingli
Johannes Oekolampad
Echokammern der radikalen Milieus: Hätzer und Müntzer
Ludwig Hätzer
Thomas Müntzer
Laien verfassen Flugschriften
Der Bauernkrieg und seine Publizistik
Neue Konkurrenz auf dem Buchmarkt
Allzweckwaffe: Illustrierte Einblattdrucke
Gedruckt bis in den Tod: Luthers multimediales Sterben
4: Eine veränderte Welt
Selbststudium und Lehrbetrieb
Speicherplatz: Bibliotheken, Kompendien, Enzyklopädien
Suchmaschinen: Indizes, kritische Apparate, Editionen
Neue Bibeln für alle
Kirchenlieder und Gesangbücher
Der Katechismus als Grundausbildung
Die Grenzen der Zensur
Quergedachtes, Utopisches und Subversives
Epilog: Unter Druck
Anhang
Zitierweise und Abkürzungen
Anmerkungen
Einleitung: Digital Natives und Printing Natives
1. Die erste Medienrevolution
2. «Männer des Buches»
3. Publizistische Explosionen
4. Eine veränderte Welt
Epilog: Unter Druck
Quellen und Literatur
Quellen
Literatur
Nachweis der Bildzitate
Personenregister
Ortsregister
Einleitung
Digital Natives und Printing Natives
Der Begriff der digital natives wurde 2001 von dem amerikanischen Medienpädagogen Marc Prensky[1] geprägt, um die generationsspezifische Disposition derer zu bezeichnen, die von klein auf mit den Techniken des digitalen Zeitalters vertraut sind. Mobiltelefone, Mails, Computerspiele, soziale Netzwerke, das Internet sind integrale Bestandteile ihrer Welt. Der schnelle Erwerb und die zügige Weitergabe von Informationen auf multiplen Verbreitungswegen prägen ihren Alltag und ihr Kommunikationsverhalten. Nicht online zu sein erscheint ihnen beschwerlich, ja unbehaglich oder beängstigend – beinahe ein sozialer Tod. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass auch die digital immigrants, also die Älteren, die erst in einer fortgeschrittenen Lebensphase mit den Techniken der digitalen Kommunikation vertraut wurden, ähnliche Verhaltensweisen, Neigungen und Abhängigkeiten entwickeln wie die Jüngeren. Offenbar haben die wenigen Jahre seit der Erstverwendung des Begriffs der Digital Natives ausgereicht, um die Differenzen zwischen den «eingeborenen» und den «eingewanderten» Bewohnern des digitalen Äons weitgehend zu nivellieren.
Trifft die Beobachtung zu, dass sich die Verhaltensprofile der Generationen im Gebrauch der digitalen Medien angeglichen haben, dann zeigt dies nichts anderes, als dass die Digitalisierung zu einem Sachverhalt geworden ist, der Kultur, Lebenswelt, Politik, Gesellschaft, Ökonomie, kurz: unser gesamtes Leben in einem solchen Ausmaß betrifft und bereits verändert hat, dass – etwa in Analogie zum Zeitalter der Industrialisierung – die Bezeichnung unserer Epoche als «digitales Zeitalter» sachgerecht erscheint, und zwar im globalen Maßstab. Die digitalen Medien sind kein partikulares oder segmentierbares Moment unserer Kultur. Ihre Präsenz zu begrenzen ist nur durch bewusste individualistische oder kollektive Akte partieller Verweigerung möglich – etwa indem jemand auf ein Smartphone verzichtet oder indem Familienmitglieder vereinbaren, dass das Handy bei gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschaltet bleibt, oder Liebende sich der besonderen Bedeutung ihrer analogen Präsenz wechselseitig dadurch versichern, dass sie gemeinsam offline gehen. Traditionelle Medien wie Postkarten oder handgeschriebene Briefe sind rar geworden. Wo sie noch begegnen, wächst ihnen eine besondere Bedeutung zu.
Die Beschleunigung und die neue Dominanz der digitalen Kommunikation infolge der Corona-Pandemie haben in verdichteter Form deren Ambivalenzen vor Augen geführt: Zum einen war man froh und dankbar, dass im Home Office manches weitergeführt werden konnte, dass auch Schulen und Universitäten funktionierten oder doch zu funktionieren schienen, häufig reibungslos, störungsfrei, aber auch ohne dass man viel Notiz davon nahm. Zum anderen wurden die Verluste direkter Interaktion und die unveräußerliche, durch nichts zu ersetzende Bedeutung menschlicher Kontakte schmerzlich erfahrbar. Einerseits war man froh, Verwandte und Freunde, Kolleginnen und Kollegen wenigstens per Video zu sehen. Andererseits zeigte sich, dass die erzwungene Entsinnlichung und die forcierte Zwangsindividualisierung vielen, ja vielleicht den meisten von uns gegen die Natur geht. Dass wir als Spezies in unserer schieren biologischen Existenz so eminent gefährdet sind, hat – durchaus schmerzhaft – die Grenzen der Individualisierung, der Kultur und des Gefühls der technischen Überlegenheit bewusst gemacht. Diese Erfahrungen werden auch den Umgang mit der Digitalisierung nicht unberührt lassen.
Zwischen der «Erfindung» des Internets um 1990[2] und dem Hervortreten umwälzender Wirkungen in sehr vielen Lebensbereichen – in Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen und Verkehrstechnologie, im Wirtschafts- und Kommunikationsverhalten, in der Mediennutzung usw. – liegen einige Jahre, eher Jahrzehnte. Im Rückblick aber ist deutlich, dass die häufig als «Zweite Medienrevolution» bezeichnete Digitalisierung unsere Kultur – verstanden als Inbegriff menschlichen Verhaltens, Denkens, Fühlens, Kommunizierens und Sich-Selbstverstehens – längst tiefgreifend verändert hat. Verhielt es sich bei der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern um 1450 ähnlich? Die kulturellen Auswirkungen, ja die Tragweite der «Ersten Medienrevolution» zeigten sich im Abstand einiger Jahrzehnte, und dann begann sie, erhebliche gesellschaftliche Umwälzungen in Gang zu setzen. Das «Reformation» genannte Syndrom reiht sich hier ein.
Die dieses Buch leitende Perspektive lautet: Eröffnen sich dadurch, dass wir durch die Erfahrungen des Medienwandels unserer Tage sensibilisiert sind, umfassendere und profundere Perspektiven auf die kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Folgen des Buchdrucks? Und umgekehrt: Erwachsen aus der Einsicht in die zunächst sukzessiv einsetzenden, dann umfassenden Veränderungen infolge der Verbreitung der Schwarzen Kunst Erkenntnisse, die Orientierungshilfen in unserer Gegenwart bieten könnten? Suggeriert die geläufige Rede von den Medienrevolutionen damals und heute mehr an Gemeinsamkeiten, als zutreffend ist? Oder verstellt der Begriff der Revolution die Sicht auf die gleitenden Übergänge, die langen Kontinuitäten und das Ineinander von Manuskript- und Druckzeitalter, Print- und Digitalkultur?
Gewiss: In der Zeit der Ersten Medienrevolution betraf die Befähigung und Nötigung zum Lesen und Schreiben einen weitaus geringeren Teil vornehmlich der städtischen Gesellschaften, als dies heute für die Nutzung der digitalen Medien gilt. Die Partizipation hatte elementar mit Bildung zu tun. Ihr maßgebliches Symbol, das gedruckte Buch, gilt bis heute als Merkmal, Requisit oder Fetisch «Gebildeter» oder gar «Gelehrter». Ihm haftet etwas Hohes, Elitäres an. An der Zweiten Medienrevolution, in der die Bilder den Text dominieren, haben auch Analphabeten teil. Insofern ist der Dispersionsgrad der Zweiten gegenüber der Ersten Medienrevolution ungleich umfassender. Auch das Durchsetzungstempo der Zweiten ist mit dem der Ersten Medienrevolution kaum zu vergleichen. Es entspricht der beschleunigten Gangart der entfesselten Moderne, in der wir leben. Etwa ein halbes Jahrhundert dauerte es, bis sich die typographische Reproduktionstechnologie in verschiedenen Ländern Lateineuropas – in sehr unterschiedlicher Dichte – durchsetzte. Die globale Verbreitung neuer digitaler Techniken, Programme oder Viren erfolgt heute eher in Sekunden, Minuten und Stunden als in Tagen oder Wochen. Die Chance, Erste und Zweite Medienrevolution miteinander in Beziehung zu setzen und wechselseitig zu erhellen, bleibt dennoch reizvoll, auch, ja vor allem, weil der Medienwandel in beiden Fällen als prägende Signatur eines Epochenumbruchs zu gelten hat. Am Schluss des Buches sollen diese vergleichenden Überlegungen knapp wieder aufgenommen werden.
In Analogie zu den Digital Natives sind die Printing Natives die maßgeblichen Träger der Ersten Medienrevolution, also die Vertreter jener Generation, für die der Umgang mit gedruckten Texten zu einer Selbstverständlichkeit geworden war. Geboren in den 1470er- bis 1490er-Jahren, wuchsen sie in eine kulturelle Situation hinein, in der die Printtechnologie etabliert und weithin konsolidiert war und erste Standardisierungen und Normierungen hinsichtlich der Gestaltung, Vermarktung und Akzeptanz ihrer Produkte erreicht waren. Meist lernten die Printing Natives mit gedruckten Schulbüchern und studierten in der Regel an Texten, die in gleichmäßiger Qualität gedruckt waren. Nicht selten besaßen sie eigene Bücher oder hatten Zugang zu Bibliotheken. Auch in den öffentlich verfügbaren Buchexemplaren brachten sie mit größter Selbstverständlichkeit Unterstreichungen und Annotationen an. Individuelle Rezeption war eingebunden in ein Gespräch mit Menschen, die das Buch vorher gelesen hatten oder nachher lesen würden. Um interessante Texte dauerhaft verfügbar zu haben, mussten sie sie weitaus seltener abschreiben als frühere Generationen. Die dadurch gewonnene Zeit konnte in beschleunigte und exzessive Lektüren oder in literarische Tätigkeiten einfließen. Manche der Printing Natives scheuten sich nicht, auch eigene Texte in den Druck zu befördern. Die im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert insbesondere in den größeren Städten verfügbare typographische Infrastruktur unterstützte dies. Und die internationalen ökonomischen Vernetzungsstrukturen des zeitgenössischen Buchhandels eröffneten «virtuelle» Kommunikationsräume, die so zuvor undenkbar gewesen waren.
Auch in anderer Hinsicht sind Ähnlichkeiten zwischen der Ersten und der Zweiten Medienrevolution unübersehbar: Die mit der typographischen Reproduktionstechnik entstehende Öffentlichkeit beschleunigte die Kommunikation, wobei städtische und ländliche Räume fundamental differierten. Insbesondere dann, wenn es um Kontroversen oder bahnbrechende Neuheiten ging, wurde das Tempo der Druckproduktion gesteigert. Verzögertes Reagieren grenzte an das Eingeständnis von Unterlegenheit und bedeutete, dem Gegner das Feld zu überlassen. «Fake news» und zügellose Polemik, auch in visueller Form, waren bereits Begleiterscheinungen der Ersten Medienrevolution, ebenso wie die meist gescheiterten Versuche kirchlicher und staatlicher Instanzen, diesen durch Regulationen oder Zensur Einhalt zu gebieten. Auch in der Ersten Medienrevolution wurden Texte und geistige Erzeugnisse anderer weitergegeben, kopiert, plagiiert oder entstellt, somit Schutzstandards, wie sie ein später nach und nach entstehendes Urheberrecht definierte, konterkariert und unterlaufen. Dass dies in mannigfacher Weise auch im Zuge der derzeit erlebten und erlittenen digitalen Transformation der Gesellschaft geschieht, ist evident. Ob die Zweite eine Fortsetzung der Ersten Medienrevolution ist, wird am Ende des Buches zu klären sein.
1
Die erste Medienrevolution
Die um 1450 erfundene Technologie der Textvervielfältigung mit beweglichen Metalllettern hat ihre Erprobungs-, Etablierungs- und Konsolidierungsphase innerhalb einer Generation durchlaufen. Die spezifischen Möglichkeiten und Herausforderungen dieses mechanischen Reproduktionsverfahrens traten um 1480 immer deutlicher hervor. War das beginnende Buchdruckgewerbe zunächst primär an der elaborierten Handschriftenkultur orientiert gewesen, so geriet dies in den letzten beiden Jahrzehnten jener Epoche des Frühdrucks (1450–1500), die Inkunabel- oder Wiegendruckzeit genannt wird, zusehends in den Hintergrund. Seit etwa 1480 war klar, dass das gedruckte sich gegen das geschriebene Buch durchgesetzt hatte. In dieser Perspektive sollen die Konturen der ersten Medienrevolution im Folgenden nachgezeichnet werden.[1]
Von Lettern, Setzkästen, Druckpressen und Schrifttypen
Die Erfindung des Johannes Gensfleisch – allgemein als Johannes Gutenberg bekannt, da sich im Besitz seiner Patrizierfamilie ein Mainzer Hof mit dem Namen «zum Gutenberg» befand – war nicht nur das Ergebnis seiner ingeniösen Ideen, seines handwerklichen Könnens und unternehmerischen Wagemuts. Sie basierte auch auf einer besonderen historisch-kulturellen, technikgeschichtlichen und ökonomischen Konstellation: Die Goldschmiedekunst und die metallverarbeitenden Gewerbe der Münzerei und der Glockengießerei florierten im Südwesten des Reichs. Für die Gravur sakraler Objekte wie Monstranzen, Patenen oder Kelche hatten Goldschmiede Stempel mit Ornamenten oder Buchstaben zu nutzen gelernt. Pressen waren in den Weinbauregionen der Pfalz und des Elsass, in denen sich Gutenberg überwiegend bewegte, bekannt und verbreitet. Das Papier, ein bereits im 1. oder 2. Jahrhundert in China erfundener Schriftträger, der durch arabische Vermittlung seit dem 11./12. Jahrhundert nach Europa vorgedrungen war, wurde seit den 1390er-Jahren in Deutschland produziert. Mitte des 15. Jahrhunderts gab es am Oberrhein und in Oberschwaben etwa zehn Papiermühlen.[2] Auch ein internationaler Papierhandel existierte bereits. Bei der Papierherstellung wurden ebenfalls Pressen verwendet, die gleichmäßigen und hohen Druck erzeugen konnten.
Im frühen 15. Jahrhundert hatte die serielle Produktion von Handschriften in professionellen Kopierwerkstätten, etwa in Florenz oder in Hagenau,[3] ein bisher unbekanntes Ausmaß erreicht. Formale Standardisierungen in Bezug auf Layout, graphische Gestaltung und Schrift sowie die Entstehung internationaler Markt- und Vertriebsstrukturen gingen damit einher. Der Holzschnitt, der ursprünglich aus Ostasien stammte, verbreitete sich in Europa seit dem frühen 15. Jahrhundert. Er fand zunächst für die serielle Herstellung von Spielkarten und Heiligenbildern Verwendung. Auch Texte wurden in Holzplatten geschnitten und zu ganzen Büchern, den «Blockbüchern»,[4] verbunden. Häufig zeichneten sich diese durch enge Text-Bild-Bezüge aus und führten die Tradition von Bilderhandschriften fort. Als mechanische Form der Herstellung identischer Texte bzw. Bilder unter der Presse und auf Papier antizipierten sie, was Gutenberg anstrebte. Dass sich ein mit Text- und Bildgravuren versehener Holzblock nur einmal verwenden ließ, markierte allerdings eine Nutzungsgrenze dieses Verfahrens und machte die Suche nach Alternativen plausibel. Die Verwendung, Umformung und Kombination der genannten Fertigkeiten, Instrumente und Dinge und ihre Verbindung mit einer Idee bildeten die Grundlage für jene Erfindung, die die lateineuropäische Kultur tiefgreifender und nachhaltiger prägen sollte als jede andere.
Im Kern bestand Gutenbergs Idee darin, Texte von ihren kleinsten Bestandteilen – den sechsundzwanzig Buchstaben des lateinischen Alphabets – her zu verstehen und daraus ihre serielle Reproduktion zu entwickeln. Diese Idee war ebenso elementar wie genial. Bisher war es nämlich üblich gewesen, ganze Texte als integrale Einheiten fortlaufend, verlässlich und – im Unterschied zur Praxis der monastischen Skriptorien – möglichst zügig in Unikaten zu kopieren. Dies geschah auf Bestellung oder auch auf Vorrat, gemäß dem Kalkül der teils international agierenden Schreibwerkstätten, die Sortimente anlegten und dafür zu werben begannen. Auch das europäische Universitätssystem beförderte die Entstehung der Strukturen eines funktionierenden Handschriftenmarktes. Der Buchdruck machte sich diese später zunutze. Im Unterschied zu Holzschnitt und Blockbuch konnten die gemäß Gutenbergs Idee aus Metall gegossenen Buchstaben in beliebiger Kombination für immer neue Texte verwendet und für die Reproduktion einer kaum begrenzten Menge identischer Exemplare genutzt werden. Ein Typensatz enthielt also potentiell jeden beliebigen Text.
Der vielleicht wichtigste Aspekt der Gutenberg’schen Erfindung bestand in der Entwicklung eines Gießinstruments,[5] das es möglich machte, die Typen der einzelnen Buchstaben in identischer Größe und Form herzustellen.[6] Die Metalllegierung, die dabei verwendet wurde, war vermutlich das Ergebnis längeren Experimentierens. Ihre genaue Mischung ist unbekannt. Sie dürfte aber etwa vier Fünftel Blei, ein Zehntel Antimon und zwischen 5 und 10 Prozent Zinn sowie je ein Prozent Kupfer und Eisen enthalten haben. Wichtig war, dass diese Legierung rasch erkaltete, der aufwändige Guss der Lettern also zügig erfolgen konnte. Um die Typen zu gestalten, die die Drucker in der Nachfolge Gutenbergs während des 15. und frühen 16. Jahrhunderts in der Regel selbst herstellten, wurden die Formen der Buchstaben zunächst seitenverkehrt gezeichnet. Nach dieser Vorlage wurde der Buchstabe dann mit Punze und Feile aus einem erhitzten und dadurch erweichten Metallstempel herausmodelliert. Die seitenverkehrte «Patrize» wurde dann mit Druck in eine Kupferplatte geschlagen. Dieser seitenrichtige Abdruck des Buchstabenkörpers hieß «Matrize». Sie wurde nun in das Gießinstrument eingespannt; dann wurde das Gussmaterial eingefüllt. Auf diese Weise konnten beliebig viele identische Lettern gegossen werden, die seitenverkehrte Buchstaben bildeten. Ihre Abdrucke waren wiederum seitenrichtig. Die Buchstaben und die sonstigen Zeichen (Interpunktionszeichen, Klammern etc.) wurden einzeln gegossen und in Setzkästen gesammelt. Diese waren so angeordnet, dass die häufiger gebrauchten Buchstaben in Griffnähe des Setzers lagen.
Bei der Satzarbeit wurden die einzelnen Lettern in der Reihenfolge der Wörter zeilenweise auf einen Winkelhaken gesteckt. Abstände zwischen den Wörtern füllte der Setzer durch Blindmaterial auf. Die fertigen Zeilen wurden auf einem Holzbrett, dem Setzschiff, zu einem Text zusammengefügt, der entweder eine Spalte oder eine Seite ergab. Die fertige Seite wurde dann in einer rahmenden Form und mit Bändern fixiert.
Nun begann der Druckvorgang: Die gesetzte Seite wurde mittels eines Lederballens mit Druckerschwärze eingefärbt, die aus Lampenruß, Firnis und Eiweiß bestand und schnell trocknete. Der eingefärbte Satz wurde auf einem Wagen befestigt, der unter die Druckplatte, den Tiegel, geschoben werden konnte. Ein angefeuchteter Papierbogen wurde in einem beweglichen Pressdeckel mit Nadeln fixiert. Über das Papier klappte man einen dem Format des Satzes entsprechenden Rahmen, der die nicht bedruckten Ränder vor Verschmutzung schützte. Nun wurde der Wagen mit dem Satz und der Pressdeckel mit dem Papier unter den Tiegel geschoben und dieser durch den ruckartigen Zug eines Bengels auf das Papier gedrückt. Dem Druck der ersten Seite eines noch unbedruckten Bogens, dem Schöndruck, folgte der Widerdruck auf der Rückseite. Durch die Nadelspuren im Papier konnte erreicht werden, dass beide Seiten registerhaltig, das heißt exakt übereinander gedruckt wurden. Die einzelnen Produktionsschritte des Buchdrucks hingen in starkem Maße vom Tageslicht ab. Wahrscheinlich wurde darum in den helleren Jahreszeiten mehr gedruckt als in Spätherbst und Winter. Die Grundstrukturen dieses von Gutenberg und seinen frühen Mitarbeitern entwickelten Fertigungsprozesses blieben während der Ära der Handpresse, das heißt bis ins 19. Jahrhundert hinein, erhalten.
1 Grant danse macabre des hommes et des femmes …, Lyon, Matthias Huss, 1499/1500. Das französische Gedicht führt nach Ständen hierarchisch geordnete Totentänze vor, die durch Holzschnitte und Über- bzw. Unterschriften veranschaulicht werden. Im Gespräch mit dem Tod führen die Drucker ihre Verdienste um den Klerus und ihre Bedeutung bei der Verbreitung theologischer, juristischer und poetischer Texte an. Auch dem Buchhändler wird als eigener Profession das Wort gegeben.
Die Veränderungen, die das Druckwesen im 15. Jahrhundert durchlief, betrafen vor allem rationellere und kostengünstigere Verfahrensschritte. Dies galt zunächst für die Typographie. Gutenberg hatte sich für sein berühmtes «Werk der Bücher», die Bibel mit zweiundvierzig Zeilen pro Seite (B 42) in lateinischer Version, die sogenannte Vulgata, an der Ästhetik der Handschriften orientiert und diese auch in der Typographie kopiert. Die Folge war, dass er etwa besondere Schreibformen für zusammengezogene Buchstaben, sogenannte Ligaturen (ae, ff, fl, ll, st), die der beschleunigten Niederschrift gedient hatten, typographisch mit eigenen Zeichen wiedergab. Auch für die Symbole des höchst elaborierten Abkürzungssystems des mittelalterlichen lateinischen Schriftwesens, das etwa für Buchstabendoppelungen (mm, nn), Vorsilben (pro, per, prae), Endungen (us, am, as) oder kurze Wörter (quis, quia, propter, et usw.) besondere Zeichen kannte, fertigte Gutenberg je eigene Lettern an. Die Folge war, dass er für die B 42 insgesamt zweihundertneunzig unterschiedliche Schriftzeichen zu gießen hatte. Dass es für einen Setzer aufwändiger war, die jeweils passenden Lettern aus dieser riesigen Menge herauszusuchen, als die Texte allein aus den je sechsundzwanzig Groß- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets zu setzen, versteht sich von selbst.
Kennzeichnend für die weitere Geschichte der Typographie in der Inkunabelzeit war, dass handschriftliche Formen, die große regionale Unterschiede aufwiesen, abgelöst wurden und eine Tendenz zur Normierung und Standardisierung einsetzte.[7] In der Frühzeit des Buchdrucks waren gotische Schriftformen typographisch reproduziert worden: die Textura – eine den Eindruck eines Gitters erzeugende, mit eckigen Formen operierende, vor allem in Nordeuropa verbreitete Schrift, die Rotunda – eine breit ansetzende, rundlich wirkende, im südeuropäischen Raum dominierende Schrift, und die vor allem als französische Kanzleischrift verbreitete Bastarda. Diese drei gotischen Schriftarten wurden gleichermaßen für den Druck lateinischer wie volkssprachlicher Texte verwendet. Seit den 1480er-Jahren rückten die Bastardatypen dann zusehends in den Vordergrund. Zugleich wurden die vielfältigen Sonderzeichen im Interesse eines rationelleren Satzes reduziert. Gegen Ende der Inkunabelzeit trat die sogenannte Schwabacher, die zu den besonders gut lesbaren gotischen Schriftarten der Familie der Bastarda gehörte, ihren Siegeszug in ganz Europa an. Die standardisierte und vereinfachte Typographie trug zur Reduzierung der Produktionskosten des Buchdrucks und damit zu seiner Expansion entscheidend bei.
Für den Druck lateinischer Texte kam der Antiqua nach und nach eine ähnliche Bedeutung zu. Im Zuge der in der Renaissance üblich werdenden Orientierung an der Antike war neben der Capitalis die karolingische Minuskel, die man für römisch hielt, in den Rang einer bevorzugten Schrift gerückt. Insbesondere die berühmte Schreibschule von Florenz,[8] die bei der Verbreitung antiker Texte eine Schlüsselrolle spielte, hatte sich ihrer seit dem späteren 14. Jahrhundert bedient. Venezianische Drucker begannen in den 1470er-Jahren, die Antiqua zu verwenden. 1501 führte der dort ansässige Drucker Aldus Manutius, die wichtigste europäische Instanz für die Verbreitung philologisch bewährter Ausgaben der klassischen Autoren in griechischer und lateinischer Sprache, die Antiquakursive in den Buchdruck ein. Von hier aus setzte sie sich bald weithin erfolgreich durch. Dort, wo die Antiqua die Oberhand gewann, gingen die Abbreviaturen und Ligaturen nach und nach, aber konsequent dahin.
Die Nachahmung des Handschriftenstils war im Falle von Gutenbergs Meisterwerk, der B 42, so weit gegangen, dass er in Kolumnen verteilt setzte und, wie bei liturgischen Manuskripten üblich, mit recht großen Buchstaben in Textura druckte. Außerdem sparte er Räume für Initialen aus und ließ vergleichsweise breite Ränder. Üblicherweise wurden die einzelnen Exemplare dieses wie anderer Frühdrucke mit individuellem Buchschmuck versehen: Rubrikatoren erleichterten die Lesbarkeit, indem sie durch feine rote Linien bestimmte Namen hervorhoben oder Kapitel- und Satzanfänge kennzeichneten. Illuminatoren gestalteten die Initialen mit Bildschmuck und die Seitenränder mit Rankenwerk – je nach Geschmack und Zahlungskraft des einzelnen Kunden. Auch darin, dass Gutenberg einen Teil der Auflage der B 42, rund vierzig von insgesamt hundertachtzig geschätzten Exemplaren, auf Pergament, dem traditionell bevorzugten kostbaren Schreibmaterial des Mittelalters, drucken ließ – für jedes dieser Pergamentexemplare wurden etwa achtzig Tiere benötigt! –, setzte er die mittelalterliche Manuskriptkultur fort. Doch dies sollte sich im Laufe des späteren 15. Jahrhunderts ändern. Dadurch, dass Setzer die Zeilenzahl pro Seite erhöhten, den Satzspiegel vergrößerten oder in kleineren Typen setzten, konnte dieselbe Textmenge nach und nach auf weniger Papier untergebracht werden. Die Papierkosten machten mindestens die Hälfte der gesamten Produktionskosten aus, Satz- und Druckkosten die andere. Folglich erhöhten diese Maßnahmen zur Papierersparnis die Gewinne und trugen gegen Ende der Inkunabelzeit zur Verbilligung der Druckerzeugnisse bei. Seit dem frühen 16. Jahrhundert traten verstärkt auch unterschiedliche Qualitäts- und Kostenniveaus beim Papier auf, die für die Druckkostenkalkulation relevant wurden.
Großprojekte, Einblattdrucke, hohe Auflagen
Weitere Entwicklungen in der Gestaltung der gedruckten Bücher forcierten deren Emanzipation gegenüber der Handschrift: Durch Kapitelüberschriften und Kolumnentitel, Leerzeilen, Spatien, eingerückte Absätze und den Einsatz unterschiedlicher Typengrößen, auch durch Hervorhebungen mittels kursiv oder gesperrt gesetzter Wörter oder Sätze, durch Leserlenkung mithilfe kleiner gedruckter Hände mit Zeigefingern, auch durch die Anfügung gedruckter Marginalien mit Erläuterungen, Quellenangaben oder Kernbegriffen wurde die Gestaltung einer Seite verfeinert, ihre Übersichtlichkeit und Lesbarkeit erhöht, die Wiederauffindbarkeit bestimmter Stellen optimiert.[9]
Auch paratextuelle Elemente[10] trieben die Evolution des gedruckten Buches zu einem gegenüber der Handschrift selbständigen Medium voran: Ein separates Titelblatt mit Angaben zu Autor und Werk, das nach 1480 immer üblicher wurde, korrespondierte mit einer Ausweitung der Produktion. Nun erschien es wünschenswert, einzelne Titel auf den ersten Blick unterscheiden zu können. Die Titelblätter boten auch Raum für Druckersignets. Dabei handelt es sich um zumeist graphisch gestaltete Firmenlabels, die, anknüpfend an handelsgeschäftliche Warenkennzeichnungen, zu immer differenzierteren Identitätssymbolen einer Offizin, einer Druckwerkstatt, weiterentwickelt werden konnten.[11] Am Schluss des Buches wurden Kolophone üblich, summarische Angaben zu Druckort, Drucker und Datum der Drucklegung (häufig mit dem Tagesdatum der finalen Fertigstellung), die auch Werbehinweise auf andere Titel der Offizin oder sonstige Buchnachrichten enthalten konnten. Die neu aufkommenden Inhaltsverzeichnisse erleichterten den Zugriff auf das Buch, ermöglichten raschere Übersicht und verbesserten die Wiederauffindbarkeit. Sie korrespondierten mit einem Leserverhalten, das von immer schnelleren Zugriffen auf immer größere Mengen verfügbarer Texte bestimmt war. Ähnliche Funktionen der Texterschließung und der beschleunigten Nutzung hatten Register, teils auch Blatt-, Bogen- oder Seitenzählungen. Insbesondere bei wissenschaftlichen Werken dienten diese dazu, Zusammenhänge leichter zu erfassen und bestimmte Themen eigenständig zu strukturieren. Manche zeitgenössischen Leser erweiterten die Register um eigene Einträge.
2 Seit 1502 verwendete der venezianische Drucker Aldus Manutius den sich von rechts oben nach links unten um einen Anker windenden Delphin als Druckersignet. Das Bild symbolisiert das Sprichwort «Festina lente» – Eile mit Weile.
Lesespuren in Büchern konnten den Charakter fortschreibender Kommentierungen annehmen und auf spätere Nutzer abzielen. Widmungsvorreden und Dedikationsgedichte, die den gedruckten Büchern nun vermehrt beigegeben wurden, erleichterten deren Integration in ein soziokulturelles Milieu, stifteten oder stabilisierten Beziehungen zwischen Autoren, Herausgebern, Druckern und hochgestellten Persönlichkeiten und konnten – etwa durch Zuschüsse – der Finanzierung eines Druckwerks dienen. Die genannten paratextuellen Elemente waren auch der wachsenden Konkurrenz zwischen den Buchdruckern geschuldet, denn sie sollten die Attraktivität des je eigenen Produkts steigern.
3 Druckermarke Johann Fust und Peter Schöffer. Die in dem 48-zeiligen Mainzer Vulgatadruck von 1462 verwendete Druckermarke gilt als die erste überhaupt. Sie stellt ein an einem Baumast aufgehängtes Schild mit den griechischen Großbuchstaben Χ (Chi) und Λ (Lambda) dar, die als «Christus» und «Logos» gedeutet werden. In ihrer Erstverwendung besiegelte die Marke den Abschluss der Druckarbeiten am 14.8.1462.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurden einige drucktechnische Optimierungen entwickelt. Sie gingen vor allem von Gutenbergs engstem Mitarbeiter Peter Schöffer[12] aus. Der aus Gernsheim stammende Bauernsohn hatte in Erfurt studiert und war an der Sorbonne als Schreiber tätig gewesen, brachte also gelehrtes Wissen, Kenntnisse der Handschriftenherstellung und -vermarktung und gewiss auch der Metallverarbeitung ein. Mit dem Psalterium Moguntinum, einem liturgischen Prachtdruck des Psalters von 1457, gelang Schöffer und Johann Fust, mit dem zusammen er 1455 Gutenbergs Werkstatt infolge eines Rechtsstreites wegen nicht zurückgezahlter Schulden übernommen hatte, der erste Mehrfarbendruck: Einzelne Großbuchstaben zu Beginn der Sätze wurden in Rotdruck abgesetzt, in Metall geschnittene Initiale mit typographischem Zierrat in Rot und Blau. Der erste Kolophon der Druckgeschichte war am Schluss des Werkes zu lesen und verriet den Stolz des Gutenbergs Leistungen überbietenden Konsortiums Schöffer-Fust:
Vorliegendes Psalmenbuch […] wurde durch die kunstvolle Erfindung des Druckens und Buchstabenformens ohne jede Anwendung eines Schreibrohres gestaltet und zum Preise Gottes mit solcher Sorgfalt fertiggestellt durch Johannes Fust, Bürger zu Mainz, und Peter Schöffer aus Gernsheim im Jahr des Herrn 1457, am Vortag von Mariae Himmelfahrt [14. 8.].[13]
Schöffer war es auch, der die Verwendung von Illustrationen im Buchdruck revolutionierte. In einem lateinischen Heilkundebuch, dem Herbarius von 1484,[14] druckte er hundertfünfzig Holzschnitte ab, die überwiegend heimische Kräuter zeigten. Den einfachen Konturen-Holzschnitten, die zur Nachkolorierung geeignet waren, hatten wohl gepresste Pflanzen zugrunde gelegen. Die klar regulierten Text-Bild-Relationen sprechen für eine gut abgestimmte Herstellungsweise. Die visuelle Orientierung, die das Buch bot, steigerte seinen Nutzen.
Dass es dem Buchdruck zwischen 1450 und 1500 gelang, breitere, vor allem stadtbürgerliche Käuferschichten anzusprechen, effizientere Marktstrukturen aufzubauen, sich ökonomisch zu stabilisieren und kulturell durchzusetzen, wird einerseits an der Diversifikation der gedruckten Titel, andererseits an der Erhöhung der Auflagen deutlich. Für die Zeit der frühen Wiegendrucke geht man bei umfänglicheren Büchern meist von einer Auflagenhöhe von 100 bis 200 Exemplaren aus. Aus einem Briefwechsel Papst Sixtus’ IV., der 1472 gebeten wurde, in Rom tätige Buchdrucker beim Verkauf einiger Titel zu unterstützen, die sie mit einer Auflage von 275 Exemplaren gedruckt hatten, geht hervor, wie unsicher die Absatzchancen bisweilen sein konnten. Bis etwa 1480 geht die Forschung von durchschnittlich 200 bis 300 Exemplaren pro Titel aus. Nach 1480 stiegen die Auflagen dann auf 400 bis 500 an, in den 1490er-Jahren gelegentlich sogar auf 1000 und mehr. In Italien sollen die Auflagen tendenziell höher gewesen sein als in Deutschland, wohl eine Folge der dichteren Urbanisierung und intensiveren Literarisierung. Bei gemeinschaftlichen Druckaufträgen, wie sie beispielsweise die Bursfelder Kongregation – ein Zusammenschluss reformwilliger Benediktinerkonvente – auf den Weg brachte, konnten auch im Reich höhere Auflagen erreicht werden. Eine Sammlung geistlicher Übungen, die von jedem Mitglied der Bursfelder Vereinigung praktiziert werden sollten, sowie eine Anleitung des Johannes Trithemius für die monastische Lebensführung wurden 1497 und 1498 in einer Auflage von je 1000 Exemplaren gedruckt.[15] Für Heiligenpredigten des italienischen Bischofs Robertus Caracciolus im Jahre 1489 ist eine Auflagenhöhe von 2000 belegt. Ein venezianischer Druck der Dekretalen Gregors X. brachte es 1491 sogar auf 2300 Exemplare.[16] Bei der Schedelschen Weltchronik, wegen ihrer reichhaltigen Bildausstattung eines der spektakulärsten Druckprojekte der Inkunabelzeit, wird mit etwa 1300 lateinischen und 600 bis 700 deutschen Exemplaren gerechnet.[17]
An wiederholten Auflagen desselben Textes kann man erkennen, dass die Befürchtung, in unverkauften gedruckten Bögen Kapital zu binden, zunächst groß war. Der in Venedig tätige Buchdrucker Johannes de Spira (Johann von Speyer) etwa stellte 1469 einen Druck von Ciceros Epistolae familiares zunächst in einer Auflage von 100 Exemplaren her, im selben Jahr folgte noch eine weitere in Höhe von 300 Exemplaren.[18] Durch höhere Auflagen ließen sich die Gewinne substanziell steigern, da keine neuerlichen Satzkosten, die etwa ein Viertel der Gesamtkosten eines Druckes ausmachten, entstanden. Wenn man etwa die Herstellung eines Druckwerks in 500 Exemplaren mit rund 450 Gulden kalkulierte, dann entfiel mehr als die Hälfte der Aufwendungen (etwa 250 Gulden) auf das Papier, entsprechend 100 Gulden auf den Satz einschließlich Korrektur und dieselbe Summe auf den Druck inklusive Druckerschwärze etc. Der Gewinn war bei einem Verkaufspreis von einem Gulden pro Druckwerk mit circa 50 Gulden anzusetzen, entsprach also einem Neuntel der Gesamtkosten. Bei einer Verdoppelung der Auflage auf 1000 Exemplare beliefen sich die Kosten entsprechend auf 800 Gulden (500 für Papier, wieder 100 für den Satz, dazu 200 für die Herstellung des Drucks), wodurch sich die Gewinnspanne, wieder bei einem Exemplarpreis von einem Gulden, auf 200 Gulden und damit ein Viertel der Gesamtkosten steigern ließ.[19] Die größeren Investitionsrisiken, die sich aus einer höheren Auflage ergaben, korrespondierten also mit der Aussicht auf höhere Gewinne. Der Buchdruck bildet ein Paradebeispiel für die Mechanismen der frühkapitalistischen Ökonomie.
4 Paulinus Chappe, Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken und die Verteidigung Zyperns, Mainz, Joh. Gutenberg, 1454. Dies ist der erste bekannte Druck eines Ablassbriefes, der bereits die für die Gattung typischen Merkmale aufweist: die an Urkunden orientierte Form; Aussparungen, die auf den Ablassbrieferwerber bezogene Einträge ermöglichen; amtliche Beglaubigung durch Unterschrift oder Siegel. Das Dokument steht für den Beginn des «Brotdrucks», d.h. der Herstellung von vergleichsweise wenig aufwändigen, massenhaft herstellbaren Druckerzeugnissen, an denen der Drucker gut verdiente.
Bereits für Gutenbergs eigene Produktionspraxis war charakteristisch, dass er neben den aufwändigen Großprojekten – außer der B 42 das 1460 fertiggestellte Catholicon, ein nicht zuletzt der Bibelauslegung dienendes lateinisches Lexikon des Dominikaners Johannes Balbus, ein Psalterium cum canticis, vielleicht die sechsunddreißigzeilige Vulgata[20] – vor allem Kleinst-, zum Teil Einblattdrucke herstellte: Ablassbriefe, den Türkenkalender Eine Mahnung wider die Türken, Bullen, die zum Türkenkreuzzug aufriefen, apokalyptische Weisungen,[21] auch den Cisiojanus deutsch – ein Merkgedicht für die unbeweglichen Festtage des Kirchenjahrs, das nach dem eröffnenden Hexameter für die Beschneidung Jesu (Circumcisio domini, 1. Jan.)[22] benannt ist. Gutenberg druckte auch Traktate mit wenigen Dutzend Seiten Umfang.[23] Diese einkömmlichen «Brotdrucke» in höherer Auflage erforderten geringe finanzielle Vorlagen und sicherten raschere Renditen, als dies bei den Großprojekten der Fall war.
Die nach der Belagerung und Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (6. April bis 29. Mai 1453) gesteigerte «Türkenfurcht» im sogenannten Abendland[24] stimulierte den Vertrieb von Ablassbriefen und Ähnlichem: Wer die Planungen für einen Kreuzzug gegen die Türken auch finanziell unterstützte, konnte einer vollständigen Sündenvergebung sicher sein. Der sogenannte Türkenkalender Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken von Ende Dezember 1454 kann als erste Flug- oder Gelegenheitsschrift des Druckzeitalters gelten; ihr thematischer Bezug zur Türkenthematik ist keineswegs zufällig. Die aus sechs Blättern bestehende Schrift, die im Durchgang durch die zwölf Monate des Jahres den Papst, den Kaiser, die Könige Europas, das Reich, die Reichsstädte und die ganze Christenheit auffordert, sich gegen die Türken zu erheben, agitiert kämpferisch:
Allmechtig könig in himmels tron [/] Der uff ertrich ein dorne crone […] Hilff uns vorbas in allen stunden widder unser fynde durcken unn heiden [/] Mache en yren bosen gewalt leiden [/] Den sie zu constantinopel in kriechen lant [/] An manchen cristen mentschen begangen hant.[25]
Die gefühlte Bedrohung aus dem Osten fachte den Einsatz der typographischen Reproduktionstechnologie kräftig an.
In den kommenden Jahrzehnten verstärkten sich der mit der Türkenabwehr vielfach verbundene Ablassvertrieb und die Expansion des Druckwesens wechselseitig: Große Ablasskampagnen, wie sie etwa der französische Kardinal Raimund Peraudi konzipiert und in weiten Teilen Europas propagiert hatte,[26] setzten eine starke Nachfrage nach Druckaufträgen in Gang: Ablassbriefe, päpstliche Bullen, Summarien und Instruktionen in kürzeren und längeren, lateinischen oder volkssprachlichen Versionen, Werbeplakate und anderes mehr wurden benötigt. In einigen Fällen ist die Auflagenhöhe der entsprechenden Erzeugnisse dokumentiert: Im Jahre 1452 sollen in Frankfurt am Main zweitausend in Mainz gedruckte Ablassbriefe verkauft worden sein; für 1480 ist bezeugt, dass ein Beichtbrief in zwanzigtausend Exemplaren gedruckt worden war, und für das Benediktinerkloster im katalanischen Montserrat soll in den Jahren 1499/1500 die gigantische Menge von hundertneunzigtausend Ablassbriefen hergestellt worden sein.[27] Der Ablassvertrieb brachte den Buchdruck in Schwung und förderte den Ausbau einer typographischen Infrastruktur. Der Buchdruck wiederum ermöglichte es, wirksame Werbemaßnahmen für die Ablasskampagnen zu starten. Die landauf, landab in verschiedenen europäischen Ländern nach demselben Muster durchgeführten Ablasskampagnen trugen das Ihre zur Ausbreitung des Buchdrucks und zur kulturellen Integration Lateineuropas bei. Unter den Einblattdrucken machten die auf den Ablass bezogenen gewiss den größten Anteil aus, wohl mehr als die Hälfte des gesamten bekannten Materials.
Ansonsten spielten Blätter mit Heiligen- und Christusbildern und entsprechenden Texten eine Rolle. Vermutlich standen sie in einem engeren Zusammenhang mit frömmigkeitsgeschichtlichen Entwicklungstrends. Einerseits entsprachen sie, andererseits befriedigten und beförderten sie individualisierende Tendenzen. Der einzelne Christenmensch hatte nun «seinen» Heiligen, seinen Heiland visuell im eigenen Heim verfügbar. Auch Wandkalender mit astrologisch-medizinisch-naturkundlichem Wissen, etwa zu geeigneten Zeiten des Aderlassens oder der Aussaat, wurden gern auf Einblattdrucken vertrieben. Weltliche und geistliche Obrigkeiten entdeckten das Medium ebenfalls für ihre Zwecke. Amtliche Verordnungen der Fürsten, Bischöfe oder städtischen Magistrate wurden auf Einblattdrucken verbreitet, die man an Rathäusern, Kirchen, Schulen und Universitäten oder sonstigen öffentlichen Orten aushängte. Das Printmedium hatte seinen Anteil an der Durchsetzung, Verdichtung und Ausweitung von Staatlichkeit und obrigkeitlicher Disziplinierung, die vor allem das 16. Jahrhundert prägen sollte.
Zeitungen, Sensationsmeldungen, Fake News
Das neue Medium, das rasch in weiten Teilen des Kontinents heimisch wurde, trug zur Entwicklung eines gemeinsamen kulturellen Kommunikations- und Erfahrungsraumes bei. Dies geschah auch, verstärkt gegen Ende des Jahrhunderts, durch nun aufkommende «neue Zeitungen», die Sensationsmitteilungen über Naturereignisse, militärische Vorgänge oder geographische Entdeckungen enthielten und in Form von Kleindrucken in verschiedenen Ländern und Sprachen verbreitet wurden. Mittels reißerisch gestalteter Einblattdrucke, die häufig sprechende Illustrationen enthielten, wurde über aufregende Neuheiten berichtet. So verbreitete Sebastian Brant die Kunde von einem über 200 Pfund schweren «Donnerstein», einem Meteoriten, der am 7. November 1492 in der Nähe des elsässischen Ensisheim eingeschlagen war.[28] Das auf Deutsch und Latein abgefasste Flugblatt gilt als ältester Augenzeugenbericht eines solchen Ereignisses. Der deutsche Text interpretierte den «Donnerstein» als Zeichen drohenden Unheils für Franzosen und Burgunder und appellierte an Kaiser Maximilian, sich in diesem Sinne militärisch zu engagieren. Einblattdrucke konnten aber auch für andere Neuigkeiten eingesetzt werden, etwa zur Warnung vor falschen Münzen. 1482 waren solche von den Niederlanden aus in Umlauf gekommen. In Göttingen hatte man etliche Falschmünzer hingerichtet. Dass Einblattdrucke zu dieser Affäre, teils in mehreren Auflagen, in Augsburg, Magdeburg, München, Nürnberg, Reutlingen, Ulm und Zürich erschienen,[29] verdeutlicht, dass der Buchdruck – ähnlich den Ablasskampagnen – zur Entstehung regional entgrenzter Kommunikationsräume beitrug.
Neuigkeiten besonderer Art enthielt der Brief des Christoph Kolumbus an König Ferdinand von Aragon über die neu gefundenen «indischen» Inseln. Er war 1493 auf Spanisch erschienen, noch im selben Jahr in Rom, Paris, Antwerpen und Basel auf Latein und 1497 in Straßburg auf Deutsch herausgekommen.[30] Dieser publizistische Lauf mag verdeutlichen, welche Rolle das Printmedium dabei spielen konnte, elementare Sachverhalte weithin bekannt zu machen, die nach und nach auch das Selbstverständnis des Kontinents verändern sollten. Wissens- und Deutungsmomente, etwa dass die Bewohner der neu entdeckten Inseln «nackend gont wie sie geborn werdent» oder dass man ihnen am besten «tusenterley guter ding» schenke, damit sie «ein liebe gewinn[en] christen zu werden»,[31] konnten weiten Teilen eines lesekundigen Europa auf diesem publizistischen Wege implementiert werden. Knapp zehn Jahre nach Kolumbus machten dann die Briefe des Amerigo Vespucci Furore. Entscheidend wurde nun, dass der Florentiner Entdecker plausibel machen konnte, dass es sich bei den «neuen Inseln» nicht um Indien, sondern um bisher unbekannte Welten handelte. Einer Veröffentlichung in Paris 1503 folgten schon 1504 Drucke in Venedig, Augsburg und Rom sowie fünfundzwanzig weitere Ausgaben in den folgenden beiden Jahren, davon achtzehn im deutschen Sprachgebiet. Nicht zuletzt der Wucht des publizistischen Echos war es zuzuschreiben, dass die humanistischen Gelehrten Martin Waldseemüller und Mathias Ringmann in ihrer Cosmographiae introductio (1507) den neuen Kontinent nach ihm als «America»[32] bezeichneten.
Vespucci teilte ethnographische Beobachtungen mit, die sich im wirkungsreichen Bild eines ordnungsfreien, dem Naturrecht widerstreitenden, von zügelloser Lust bestimmten «Epikuräismus» der Wilden verdichteten:
Sie haben kein thuech noch deck/weder leinen noch baumwollen/dan sie es nit bedürffen unn haben kein aygen gut. Sunder alle ding seind under jnen gemein/sie haben auch keinen künig oder regierer. Sunder ein yeder ist im selbs ein herr/sovil weiber nehmen sie so vil sie wöllen/unn der sun mit der mutter/unn der bruder mit der schwester […]. Und vereinigen sich als dick als sie wöllen/scheiden sie die ee unn hallten gantz kein ordenung/darum haben sie auch keinen tempel unn halten kein gesetz […] sie leben nach der natur dz sie wol Epicuri bauchfuller genant werden mügen […].[33]
Durch den Buchdruck entfalteten auch Deutungsstereotype, Ressentiments, Zerrbilder sowie Hate Speech und Fake News eine europaweite Verbreitung und globalgeschichtliche Wirkungen.
5 Amerigo Vespucci, Das sind die new gefunden menschen … Nürnberg, Stuchs, um 1505. Vespuccis zunächst auf Italienisch, dann auf Latein erschienener Entdeckungsbericht machte in ganz Europa Furore. Das illustrierte Flugblatt begründete Wahrnehmungsmuster der wilden Fremden, die das Verhältnis der Europäer zu den indigenen Völkern Amerikas nachhaltig beeinflussen sollten.
Ein expansives Gewerbe
Ausgehend von Mainz, wo zunächst Johannes Gutenberg (gest. 1468), dann ab 1457 sein ehemaliger Kompagnon Johannes Fust und sein erfinderischer Geselle Peter Schöffer die erste Buchdruckoffizin im Haus «zum Humbrecht» betrieben, erreichte die neue Kunst innerhalb weniger Jahre Bamberg und Straßburg (1459/60), Köln (1464), Subiaco (1465) und Rom (1466/67), Basel (1467), Augsburg (1468) und Venedig (1469). In einigen Fällen sind direkte personelle Verbindungen dieser Start up-Unternehmen zu Gutenberg, Fust und Schöffer nachweisbar. Das noch auf lange Zeit zunftfreie Buchdruckgewerbe gab die für einen Werkstattbetrieb erforderlichen, höchst komplexen Kenntnisse in unregulierter Form an Mitarbeiter weiter, die sich dann andernorts um Neugründungen bemühten. In den 1460er-Jahren lassen sich in 14 Städten Druckereien nachweisen. Im folgenden Jahrzehnt beschleunigte sich die Ausbreitung erheblich. Bis 1479 waren bereits in 104 europäischen Städten Druckbetriebe ansässig, darunter Nürnberg, Paris, Mailand, Florenz, Utrecht, Valencia, Breslau, Lübeck, Brüssel, Krakau, Pilsen und London. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es etwa 260 Druckstädte in Europa, von denen 80 in Italien lagen, 62 im deutschen Sprachgebiet, 45 in Frankreich, 24 in Spanien, 21 in den Niederlanden – darunter 7 im heutigen Belgien, 6 in Portugal und 4 in England. In Böhmen, Schweden, Dänemark, Polen, Ungarn, Dalmatien und Montenegro gab es vereinzelt Druckereien. Eine Übersicht über die geographische Verteilung der Offizinen ergibt, dass sie in ihrer weit überwiegenden Mehrheit in der wirtschaftlichen Prosperitätszone zwischen Norditalien und den nördlichen Niederlanden bzw. Südengland angesiedelt und in Handels- und Universitätsstädten besonders stabil waren. Offizinen im Besitz kirchlicher oder weltlicher Obrigkeiten waren im Ganzen kurzlebige Erscheinungen, deren Kosten den Nutzen deutlich überstiegen. In der Regel boten lukrative Druckaufträge hoher Herren hinreichende Einflussmöglichkeiten auf Drucker, die sich ja auch gegenüber ihrer stetig wachsenden Konkurrenz behaupten mussten. Universitätsdrucker standen gelegentlich in Dienstverhältnissen bei den landesherrlichen Trägern der hohen Schulen und waren deshalb in ihren wirtschaftlichen Risiken abgesichert.
Die Druckorte des 15. Jahrhunderts nach dem «Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke». Die Konzentration der Druckereien korrespondiert mit den ökonomischen Aktions- und Prosperitätszonen des späten Mittelalters, die sich zwischen den Niederlanden, Burgund, Oberdeutschland und Norditalien erstreckten.
Hinsichtlich der Produktionsintensität lässt sich im Verlauf der fünf Jahrzehnte der Inkunabelzeit eine rasante Steigerung erkennen. Waren in den 1460er-Jahren insgesamt 1500 Inkunabeln gedruckt worden, was circa 6 Prozent der Gesamtproduktion des 15. Jahrhunderts entsprach, so stieg deren Summe in den 1470er-Jahren auf etwa 7000 Drucke (circa 25 Prozent) an. Die 1480er-Jahre gelten als «Beginn der Massenproduktion des gedruckten Buchs und das Ende der mittelalterlichen Form der Textüberlieferung».[34] In dieser Zeit verringerten sich auch die Buchpreise. Der Anteil der volkssprachlichen Titel stieg deutlich an. Das Buch drang weiter in die städtischen Mittelstandsgesellschaften vor. In der Inkunabelzeit wurden etwa 28.000 unterschiedliche Drucke in ganz Europa hergestellt, von denen jeweils etwa ein Drittel in Italien (36,4 Prozent) und im deutschsprachigen Raum (33,6 Prozent) herauskam; auf Frankreich entfielen 17,5, auf die Niederlande 7,4, auf England 1,4 und auf die Iberische Halbinsel 3,7 Prozent.[35] Etwa 20.000 Inkunabeln waren in Latein abgefasst; unter den nationalsprachlichen Drucken stachen die italienischen mit ca. 2300 und die deutschen mit etwa 2500 Ausgaben hervor; an französischen waren es 1500, an englischen 231, an hebräischen 150.
Die produktivsten Druckorte des 15. Jahrhunderts waren die großen Handels- und Kulturmetropolen Venedig (3705 Inkunabeldrucke), Paris (3026) und Rom (2021). Unter den deutschen Druckerstädten rangierten Köln (1531), Leipzig (1210), Straßburg (1121) und Augsburg (1073) vor Nürnberg (926) und Basel (764). Die polyzentrische Struktur der politischen und kulturellen Verhältnisse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation beförderte also auch eine typographische Infrastruktur, die durch eine ganze Reihe mittelgroßer Druckzentren, nicht aber – wie in Italien und Frankreich – durch einige wenige Druckmetropolen geprägt war. Bereits im 15. Jahrhundert wurde Augsburg der wichtigste Druckort für deutschsprachige Texte – eine Tendenz, die noch in der Reformationszeit anhielt.
Seit den 1470er- und 1480er-Jahren kann man von relativ stabilen internationalen Handels- und Vertriebsstrukturen des Buchmarkts ausgehen. Dabei spielten die Messen eine Schlüsselrolle. Unter ihnen ragte die im Frühjahr und im Herbst stattfindende Messe in Frankfurt am Main hervor, die seit dem frühen 13. Jahrhundert – das älteste Privileg stammt von 1219 – bezeugt ist. Hier kamen mehrere Handelsrouten zusammen, die nord-südlichen zwischen den Niederlanden und Italien, die west-östlichen, die Frankreich, das Reich und Osteuropa verbanden, dazu eine dem Rhein zufließende große Wasserstraße, der Main. Die Buchdrucker produzierten vielfach auf die Frankfurter Messetermine hin, brachten große Teile ihrer Produktion dorthin mit, verkauften sie weiter oder tauschten sie gegen die Druckerzeugnisse ihrer Kollegen. In der Inkunabelzeit lagen das Verlagswesen, das heißt das wirtschaftliche Risiko des Buchdrucks, die Buchherstellung und der Buchhandel, vielfach in denselben Händen. Für Autoren und gelehrte Käufer bildeten die Frankfurter Messen wichtige Anziehungspunkte, denn nirgendwo sonst konnte man so umfassende Übersichten über Neuerscheinungen des europäischen Buchmarktes gewinnen und Kontakte zu möglichen Herstellern eigener Bücher aufbauen. Der konstant hohe Anteil der lateinischen Titel unter den hier gehandelten Büchern entsprach der Bedeutung dieser Messe für den gesamten internationalen Buchmarkt.[36]
Begeisterung und Skepsis, Zensur und nationaler Stolz
Dass das mit beweglichen Metalllettern gedruckte Buch um 1480 über die Handschrift zu siegen begann und nun auch einzelne zunächst aus der Handschriftenkultur übernommene Besonderheiten abstreifte, bedeutete keineswegs, dass es nicht auch skeptische Stimmen auf sich zog. Der Gelehrte Johannes Trithemius etwa, Abt der Benediktinerabtei Sponheim und später des Schottenklosters in Würzburg, stellte 1494 in einer dem «Lob der Skriptoren» gewidmeten Schrift heraus, dass die monastischen Schreiber die eigentliche Stütze der christlich-biblischen Kultur bildeten. Das Druckwesen sei eine «papierene Sache» (res papirea). Ein Schreiber, der Pergament benutze, mache dagegen einen Text und sich selbst unsterblich. Denn er «bereichere die Kirche, bewahre den Glauben, zerstöre Häresien, bekämpfe Sünden und schaffe Anreize für Tugenden».[37] Bei auf Papier gedruckten Büchern rechnete der Abt mit einer Lebenszeit von höchstens zweihundert Jahren, bei Pergamentkodices mit einer von tausend.[38] Außerdem sei die Sorgfalt der Schreiber in aller Regel viel größer als die der Setzer. Die Kurzlebigkeit der gedruckten Bücher, so unterstellte er, werde zu einer einseitigen Orientierung an der Gegenwart führen. Niemals, so war sich Trithemius 1494 gewiss, werde man gedruckte Bücher auf dieselbe Stufe stellen wie geschriebene. Auch vom Herzog von Urbino, Federico von Montefeltro, ist bezeugt, dass er sich geschämt habe, seiner Bibliothek gedruckte Bücher einzufügen.[39] Solche Urteile konnten sich allerdings durch die vermehrten Erfahrungen mit dem gedruckten Buch ändern. So bekannte Trithemius 1506 in einem Brief an seinen Bruder, dass man für die Erfindung des Buchdrucks dankbar sein müsse, denn viele gelehrte Werke aus alter und neuer Zeit würden so bekannt und könnten mit geringem Geldaufwand erworben werden.[40]
Das Problem, dass durch den Buchdruck Fehler dramatisch vervielfältigt würden, führten Kritiker, aber auch Befürworter der neuen Technologie an – Letztere in der Absicht, die besondere Bedeutung eines sorgfältigen Vorgehens einzuschärfen. Ein mit dem Beruf des Kopisten vertrauter Drucker wie Peter Schöffer d. Ä. warb selbstbewusst damit, dass seine Textausgaben mit peinlicher Akribie und unter größtem geistigem und körperlichem Einsatz hergestellt würden.[41] Wenn auch ein enthusiastischer Editor und Publizist wie Erasmus von Rotterdam offen ansprach, dass früher ein einzelner Schreibfehler in einem handschriftlichen Exemplar wirksam geworden sei, ein Setzfehler heute aber in tausend Exemplaren verbreitet werde, dann wollte er vor allem herausstellen, wie verantwortungsbewusst, behutsam und gewissenhaft er selbst und sein Drucker agierten. Überhaupt sei bei den neutestamentlichen Textüberlieferungen noch längst nicht jene Sorgfalt erreicht, die bei den hebräischen Texten des Alten Testaments selbstverständlich sei.[42] Die Chancen und Herausforderungen des Buchdrucks forderten und förderten jene philologische Akuratesse, deren Entwicklung ein Herzensanliegen vieler Humanisten war.
Die Meinung, dass die Menschen vor Gutenbergs Erfindung gelehrter gewesen seien als jetzt, da sie gezwungen waren, zentrale Texte verschiedener Fachgebiete abzuschreiben, finden wir bei Printing Natives wie Philipp Melanchthon oder Andreas Osiander. Außerdem führe die durch den Buchdruck stimulierte Vielschreiberei dazu, dass substantielle Texte wie die Bibel vergessen würden.[43] Solche Urteile kursierten bereits seit der Frühzeit des Buchdrucks. Sie verdeutlichen, dass Kulturpessimismus oder doch ein Bewusstsein der Ambivalenzen als integrales Moment der ersten Medien- und Kulturrevolution zu gelten hat.
Ein verbreiteter Topos war und blieb, dass es sich bei der neuartigen Methode der Textreproduktion «ohne die Hilfe eines menschlichen Schreibrohres, eines Griffels oder einer Feder», die dank des «wunderbaren Zusammenspiels» von «Druckstempeln und Typen» funktioniere – so in der Kolophon des Catholicon von 1460 –, um ein «Gottesgeschenk» (dei … donum)[44] handle, dessen höchster Zweck in der Verkündigung der Ehre Gottes bestehe. In einer gedruckten Kölner Chronick aus dem Jahr 1499 wurde die Frage aufgeworfen «Wanne. Wae. Innd durch wen … dye unyssprechlich kunst boicher tzo drucken» «vonden», also: erfunden, worden sei. Für den Kölner Chronisten war klar, dass «der ewige got uyss synte unuyssgruntliche wijßheit […] die lousesam kunst/dat men nu boicher druckt» «uperweckt» habe. Was die Erfindung vor allem preiswürdig mache, sei, «dat eyn yeder mynsch mach den wech der selicheit selffs lesen off hoeren lesen».[45] Der Hinweis auf das «Lesen hören» spielte auf die zeitgenössische Sitte des lauten, sozial eingebetteten Lesens als üblicher Praxis an. Welche ungeheuerliche Sprengkraft darin liegen mochte, dass die «Gottesgabe» des Buchdrucks jedem Einzelnen unabhängig von der heilsvermittelnden Institution der Kirche den «Weg der Seligkeit» eröffnen konnte, sollte sich erst allmählich, nicht zuletzt in der Reformation zeigen.
Dass der Buchdruck entscheidend dazu beitrage, dass «in kurczen jaren/Die christlich ler/So weiten wer/In alle welt entsprungen», die neue Technologie also die christliche Lehre in kurzer Zeit in alle Welt verbreite, war schon im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert eine Überzeugung, die vielfach belegt ist, etwa in dem hier zitierten, auf 1475 anzusetzenden Hohelied über den Buchdruck.[46] Für den Priester, Lehrer und humanistischen Kirchenväterexegeten Jakob Wimpfeling – so in einer nur fragmentarisch überlieferten Schrift über die Druckkunst von 1507 – waren diejenigen, die sich des Buchdrucks bedienten, «Herolde des Evangeliums, Prediger der Wahrheit und Wissenschaft», die jetzt aus Deutschland hinaus zögen «wie ehemals die Sendboten des Christentums».[47]