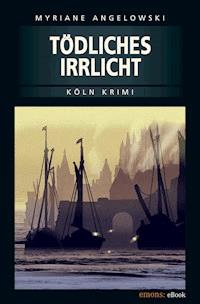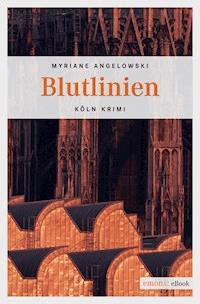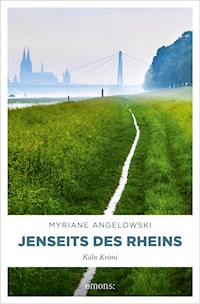Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maline Brass und Lou Vanheydens
- Sprache: Deutsch
Ein stiller, eindringlicher Krimi aus der Domstadt. Die junge Mutter Romy steht vor den Scherben ihrer Existenz: Von Obdachlosigkeit bedroht, stiehlt sie aus Verzweiflung einen Kleintransporter im Bergischen Land, um darin zu wohnen. Ohne es zu ahnen, manövriert sie sich und ihren kleinen Sohn damit in eine gefährliche Lage. Von den Mordfällen, in denen die Kölner Kommissarinnen Maline Brass und Lou Vanheyden ermitteln, ahnt sie nichts – doch durch ihren Diebstahl gerät Romy in unmittelbare Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Myriane Angelowski wurde 1963 in Köln geboren und ist überwiegend im Bergischen Land aufgewachsen. Nach einem Auslandsjahr in Israel studierte sie Sozialarbeit, arbeitete als Referentin für Gewaltfragen bei der Kölner Stadtverwaltung und war einige Jahre Lehrbeauftragte an der Fachhochschule. Neben ihrer Arbeit als Autorin ist sie im Bereich Skript-Coaching tätig, leitet Krimi-Seminare und Schreibworkshops. »Die dunklen Straßen von Köln« ist der fünfte Fall der Kölner Kommissarinnen Maline Brass und Lou Vanheyden.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Konrad Kleiner Umschlaggestaltung: Franziska Emons-Hausen, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-324-0 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Guido
Prolog
Als ich zehn Jahre alt war, mussten wir für die Schule den Lauf der Sonne in unserem persönlichen Umfeld verfolgen. Durch dieses Projekt bemerkte ich, dass sie im Winter nur für die Dauer von zwei Stunden in die Fenster unserer Wohnung schien. Von Dezember bis Februar stand sie so niedrig, dass die Strahlen den Weg nicht über die Agneskirche schafften und wir ein regelrechtes Schattendasein führten. Dieses Phänomen lässt sich auch in Bergregionen beobachten, sagte meine Lehrerin. Im Wallis beispielsweise, wo etliche Dörfer den gesamten Winter ohne Sonne auskommen. Und sie fügte hinzu, dass manche Menschen ohne Sonnenlicht zur Schwermut neigen. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land.
Damit lieferte sie mir, ganz nebenbei, eine mögliche Erklärung für die Depressionen meiner Mutter, die kaum noch aus dem Bett fand. Bis dahin hatte ich keinen Zusammenhang zwischen ihrer Gemütsverfassung und der fehlenden Sonne gesehen. Mir kam sie lediglich verändert vor, nachdem unser Vater mit einer Arbeitskollegin durchgebrannt war. Aber anscheinend lag ich mit meiner kindlichen Wahrnehmung daneben.
Von diesem Zeitpunkt an sehnte ich in jedem Frühjahr ungeduldig die Blaumeisen herbei, die im Nistkasten brüteten, den jemand an einem Baum unmittelbar neben der Kirche angebracht hatte. Mit der Ankunft der Vögel blühte meine Mutter nämlich tatsächlich auf und dudelte in einer Tour »Morning has broken« auf dem alten Plattenspieler. Diese eine verkratzte Single von Cat Stevens machte mir und meinem Bruder bewusst, dass es ein Leben vor unseren Geburten gegeben haben musste. Mit dem Song auf den Lippen trug sie dem Frühling all ihre Wünsche an. Sie erträumte sich einen treueren Ehemann, uns eine bessere Wohnung und einen Lottogewinn, obwohl wir nie tippten. In besonders übermütigen Gefühlsmomenten bat sie um Heilung oder wenigstens um das Abklingen ihrer Schmerzen. Träumen und Wünschen. Das zelebrierte meine Mutter, wenn der Lenz grüßen ließ, fand aus dem Bett, kochte und saß neben uns Geschwistern, wenn wir Hausaufgaben machten.
Der Zustand hielt nur wenige Wochen an. Ehe wir uns versahen, packte sie die Niedergeschlagenheit unbarmherzig am Schlafittchen und katapultierte sie zurück in die Finsternis. Die tiefere Ursache für ihre Qualen blieb mir ein Mysterium. Offenbar auch den Ärzten und Spezialisten, zu denen sie jahrelang rannte, bis meine Mutter aufgab und das Familiengeschehen nur noch vom Bett aus dirigierte.
Ich schämte mich für den Zustand der Wohnung, diese Unordnung. Den abgewetzten PVC-Bodenbelag, Schimmelflecken an den Wänden, die rostigen Herdplatten und den alten Bollerofen, den wir noch mit Briketts befeuerten. Klassenkameraden hielt ich durch Lügen auf Abstand. Mal erfand ich Renovierungsarbeiten, schob einen Stromausfall oder Wasserrohrbrüche vor. Mit den Jahren ließ das Interesse meiner Altersgenossen an gemeinsamen Aktivitäten nach. Bis zum Ende der Schulzeit hatte ich keine Freundschaft geschlossen, die meine Kindheit überdauerte.
Uns lähmten Mutters Schreie. Die verschriebene Medizin half nicht. Sie flehte mich an, in die Apotheke zu gehen und um andere Mittel zu bitten. Ich sollte nach Morphium fragen. Stattdessen brachte ich mich in Sicherheit, verschanzte mich hinter den dicken Kirchenmauern von St.Agnes und entzündete Teelichter. Wenn ich zehn Pfennige entbehren konnte, warf ich sie großzügig in den Opferkasten. Anderenfalls betete ich umso inbrünstiger.
Es fiel mir leicht, die Nachbarskinder zu boxen, die über meine Familie lachten. Ich log, dass sich die Balken bogen. Aber den Apotheker um Hilfe zu bitten lag außerhalb meiner Möglichkeiten.
Eines Tages zitierte Mutter mich ins Schlafzimmer und schilderte mir in epischer Breite ihre Symptome.
»Töte mich«, forderte sie mich am Ende ihrer Litanei auf.
Ich glaubte, mich verhört zu haben.
»Drück mir ein Kissen aufs Gesicht«, bettelte sie.
Ich rannte aus dem Zimmer.
Von da an wiederholte sie ihren Wunsch wie in der Endlosschleife einer Hotline, sobald ich in ihre Nähe trat. Ich lernte, ihr Flehen zu ignorieren, bis ich es nicht mehr wahrnahm, so wie die Geräusche der Fahrzeuge auf der nahe gelegenen Inneren Kanalstraße. Mit siebzehn begann ich eine Ausbildung, zog aus und schneite nur herein, um einzukaufen und nach dem Rechten zu sehen.
Bis ein Novembertag alles veränderte.
Meine Mutter war allein zu Hause, lag im schummrigen Licht und atmete flach. Sie schien kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihr Gesicht war von dünnen Linien durchzogen und erinnerte mich an eine vertrocknete Rosine. Ich beugte mich über sie und küsste ihre Stirn. In dem Moment öffnete sie die Augen, griff nach meinem Handgelenk und deutete auf das Kissen, das zu ihren Füßen lag. Die Kraft, mit der sie meinen Arm umklammerte, überraschte mich völlig. Ich weiß nicht, warum, aber ich nahm das Kissen und presste es ihr entschlossen auf Mund und Nase. In meinem Handeln lag eine gewisse Zwangsläufigkeit, ein Automatismus. Als fügte ich das allerletzte Puzzleteil endlich in ein Bild, das Ewigkeiten unvollendet auf dem Tisch gelegen hatte.
Ich drückte zu, bis meine Oberarme schmerzten. Anschließend saß ich neben ihrem Bett, bis der Arzt erschien, um den Totenschein auszustellen. Mein Nacken krampfte, und ich traute mich nicht, ihm in die Augen zu sehen. Aus Sorge, dass er mir die Tat ansehen könnte. Aber die natürliche Todesursache wurde nie in Zweifel gezogen. Noch am selben Tag entzündete ich Kerzen in St.Agnes und warf beinahe mein gesamtes Lehrgeld in den Opferstock. Bei Mutters Trauerfeier spielte der Organist »Morning has broken« auf der Orgel.
Mein jüngerer Bruder stellte keine Fragen. Aber ich bin davon überzeugt, dass er wusste, woher der Wind wehte. Er ist nach seiner Hochzeit in die Nähe von Tübingen geflohen, so habe ich es empfunden. Wir hatten kaum Kontakt. Und als er vor einigen Jahren an Krebs starb, hat mich diese Nachricht ehrlich gesagt erleichtert. Er war der einzige Mensch, der wusste, wozu ich fähig bin.
Vielleicht hätte er mich konfrontieren sollen.
Köln-Höhenberg
Sie bevorzugt das Gebiet diesseits und jenseits der Gleise. Schon bevor die Sonne aufgeht, steuert sie dicklich süßen Honigtau an, den Ameisen oder Schildläuse auf Fichtenzweigen ausgeschieden haben. Nektar und Pollen sind eine willkommene Abwechslung zu verdorbenen organischen Stoffen, die normalerweise ganz oben auf ihrem Speiseplan stehen. Sie lässt sich von ihrem Geruchssinn leiten und legt durchschnittlich acht Kilometer in der Stunde zurück. Fortwährend reinigt sie ihren Leckrüssel, den sie in die klebrige Köstlichkeit tunkt, und reibt ihre Beinpaare zur Säuberung aneinander. Diese Prozedur nimmt Zeit in Anspruch. Entgegen weitläufigen Annahmen nimmt sie es mit der Körperpflege nämlich sehr genau.
Andere Spezies brummen umher. Die Luft ist noch kühl. Vorbeirasende Züge und der morgendliche Berufsverkehr nehmen mit rasanter Geschwindigkeit zu. Lärm ist allgegenwärtig.
Mit rotbraunen Facettenaugen sondiert sie die Umgebung. Ihr Radar hält kontinuierlich Ausschau nach Leckerbissen. Obendrein muss sie auf der Hut sein und drohende Gefahren einschätzen, Rangeleien finden ständig statt. Und Fressfeinde lauern überall. Aber sie hat kaum Mühe, ihr Revier zu verteidigen. Sie ist größer als die meisten ihrer Gattung, kann ihre Flügel imposant spreizen und damit bis zu dreihundertmal in der Sekunde schlagen. Dieses Gebaren schreckt potenzielle Gegner durchaus ab.
Gegen Mittag wechselt sie den Standort, landet auf einem Komposthaufen unweit des Bahndamms und krabbelt an frischen Kartoffelschalen vorbei zu gärenden Kohlresten, die heiß begehrt und belagert sind. Ein wuchtiger Brummer ist nicht gewillt, sie zu dulden, attackiert sie und lässt sich nicht abschütteln. Als sie zudem die Fäden einer hellgrauen Kreuzspinne bemerkt, die quer über verschimmelten Äpfeln gewebt sind, verlässt sie den Biomüllberg. Sie steuert eine Ladung warmen Hundekot an, der auf einem schmalen Grünstreifen neben dem Bürgersteig liegt. Mit ihrer Ankunft vertreibt sie einige Artgenossen, die sich erst nach einer Weile wieder herantrauen. Vorsichtshalber lassen sie sich einige Zentimeter entfernt nieder. Unbeirrt benetzt sie die Exkremente mit ihrem Speichel, damit sie noch breiiger werden. Diese Anstrengung nimmt ihr ganzes Wesen ein und wird nur von vorbeifahrenden Autos unterbrochen oder von Menschen, die in einem gewissen Turnus an ihr vorübereilen. Zwangsläufig setzt sie dann für einen Augenblick ihren Fressvorgang aus, ohne sich nachhaltig stören zu lassen.
Lästig ist dagegen ein hartnäckiges Männchen, das ihre Rückenplatte mit seinen starken Vorderbeinen umklammert und sie zu begatten versucht, während die Sensoren seiner Hinterläufe ihren Körper ertasten. Sein aufdringliches Verhalten zwingt sie mehrfach, die Nahrungsaufnahme zu unterbrechen, wovon sich der paarungsbereite Zweiflügler kaum beeindrucken lässt. Ebenso wenig interessiert ihn die Tatsache, dass ihr Rumpf bereits mit Eiern angefüllt ist. Es ist nur ihrem kräftigen Flügelschlag zu verdanken, dass sich das Männchen endlich veranlasst sieht, sein Vorhaben aufzugeben.
Später klebt sie im Licht der Nachmittagssonne am rauen Putz einer Hauswand und säubert die Geruchshaare ihrer Beine und die schwarzen Borsten, die ihren Körper überziehen. Auch diese aufwendige Prozedur bewältigt sie mit äußerster Geduld. Als sie erneut losfliegt, ist ihr Körper von der Sonne gewärmt. Es fällt ihr jetzt schwerer, den Leib, der vom Gelege dick ist, in Balance zu halten. Instinktiv nimmt sie die Suche nach einem Ort auf, an dem es möglich ist, annähernd einhundertfünfzig Eier so abzulegen, dass die Larven optimale Entwicklungschancen haben. Sie fliegt kreuz und quer, landet auf der Faust eines Säuglings, der in einem Buggy schlummert. Sie krabbelt über den Anorakärmel bis zu den Speckringen am Hals, läuft über sein Kinn zu den Nasenlöchern. Die feinen Härchen ihrer Beine kitzeln die rosige Haut des Babys. Es dreht seinen Kopf im Schlaf. Gleichzeitig wird sie von der Mutter des Kindes entdeckt, die sofort nach ihr schlägt. Dank ihres Dreihundertsechzig-Grad-Rundumblicks und der Fähigkeit, zwischen Hunderten Lichtimpulsen in der Sekunde zu unterscheiden, hat sie die Gefahr kommen sehen und innerhalb einer Zehntelsekunde reagiert.
Auch wenn Müdigkeit und Leibesfülle ihre Bewegungen insgesamt plumper machen– von verlockenden Düften fühlt sie sich dennoch angezogen. Dem halb verwesten Kadaver einer Ratte kann sie sich nicht entziehen. Er erscheint ihr auf den ersten Blick sogar zur Ablage ihrer Brut geeignet. Ärgerlicherweise flattert eine Elster heran, keckert lautstark, pickt in die Gedärme und bohrt ihre Krallen demonstrativ in die Fellreste des Aases. Notgedrungen muss sie diesen Zwischenstopp wieder beenden. Mittlerweile beginnt es zu dämmern, und die Temperatur sinkt beachtlich. Vielleicht schärft dieser Umstand noch einmal ihre Sinne. Ihre Antennen wittern eine unwiderstehliche, proteinreiche Substanz.
Sie steigt in größere Höhen auf und gelangt durch ein gekipptes Oberlicht an einen wärmeren Ort. Zusätzlich zu dem magischen Geruch, der durch den bakteriellen Abbau von Eiweiß entstanden ist, zieht das Aroma gärender Lebensmittel sie nun an. Mit weit gespreizten Flügeln bewegt sie sich zielsicher auf einen matschigen Salat zu, der im unteren Bereich von einer Plastiktüte umgeben ist. Die Landung ist etwas holperig. Ungeachtet dessen krabbelt sie zum Strunk. Der schwimmt in einer trüben Lache, die sie in sich hineinsaugt. Prompt drängen fertige Maden aus ihrem trapezförmigen Hinterteil und versinken im Sud.
Ein Windstoß weht durch das Fenster, bewegt sanft die Filzschmetterlinge eines Mobiles, das an einer Perlonschnur von der Decke über einem Wickeltisch hängt. So entsteht ein Lichtreflex, der sie aufschreckt. Fliegend verliert sie noch zwei Maden. Taumelnd wie ein Segelflieger im nachlassenden Wind schwirrt sie auf einer Geruchsbahn, deren Dunst sie schon bei ihrer Ankunft wahrgenommen hat. Müde und schwer segelt sie über Kisten mit Kinderspielzeug, Abfall, Wochenblattstapel, die ungelesen vermodern, und Kleidersäcke, bis sie sich schließlich auf einem Körper niederlässt, dessen Ausdünstung alles überlagert. Betört vom Zersetzungsgeruch des menschlichen Körpers inspiziert sie den Ort, zwängt sich in die schmalzige Enge eines Gehörgangs und wieder hinaus. Dabei bleiben einige ihrer kopflosen Maden an den Flimmerhärchen der Ohrmuschel hängen. Intuitiv stuft sie das gesamte Gebiet als sicher ein. Dabei spielt die Regungslosigkeit des Leibes eine wesentliche Rolle.
An diesem Punkt unterscheidet sie sich deutlich von nahen Verwandten. Erst am Vormittag hat sie sich in der Nähe einer Krötenfliege aufgehalten, die für ihre Eier lebende Wirte bevorzugt und sie unter der Rückenhaut einer Amphibie ablegt. Diese Larven werden das Tier wie selbstverständlich als Futterquelle erachten und von innen heraus bei lebendigem Leib fressen. Sie dagegen bevorzugt Kadaver, macht keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier.
In diesem Fall deponiert sie die erheblichere Menge des Nachwuchses an einem feuchtweichen Ort. Hier empfindet sie die käsige Geruchskonzentrierung als besonders unwiderstehlich und weiß instinktiv, dass sich die Maden bestens entwickeln werden. Erschöpft bringt sie sich in Rückenlage und pumpt ihre rötlich gelben Backen auf. Das Gelege quillt aus ihrem metallisch blauen Rumpf. Einige Nachkommen sind weit entwickelt, wimmeln sogleich in den geöffneten Augen des Wirts und purzeln die Nasenflügel hinunter zum Mund. Der überwiegende Teil befindet sich hingegen im Larvenzustand und wird zur Verpuppung Zeit benötigen.
Es ist die vierte Brut des Muttertiers.
Die unablässige Nahrungssuche und das mehrfache Gebären des Weibchens haben Spuren hinterlassen. Entkräftet sucht sie dennoch den Weg zurück zum Oberlicht, verliert die Orientierung und knallt mit Wucht gegen die untere Einfachverglasung. Benommen rappelt sie sich auf, startet nächste Versuche und scheitert. Es dauert, bis sie schließlich in Rückenlage fällt, die Gliedmaßen in die Luft streckt, und es nicht mehr schafft, sich zu drehen. Unter Zuhilfenahme der Flügel versucht sie dennoch, ihre Position zu ändern. Erfolglos bäumt sie sich ein letztes Mal auf. Sie stirbt auf der Fensterbank neben einem Christstern, der schon vor Wochen in einem Plastiktopf vertrocknet ist. Bis zu ihrem Tod hat diese Blaue Schmeißfliege neunundzwanzig Tage gelebt und insgesamt sechshundertvierundachtzig Eier abgelegt.
Brühl bei Köln
»Aufmachen! Polizei!«
Maline Brass hämmert mit der Faust gegen die Tür und drückt unentwegt den Klingelknopf.
»Öffnen Sie bitte!«
Sie sind zu viert. Zwei Teams. Angehörige des Kommissariats11. Mord, Totschlag und Selbsttötung sind fester Bestandteil ihres beruflichen Alltags. Dazu gehören neben der Ermittlungsarbeit auch die Festnahme von Tatverdächtigen und die Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen, so wie sie jetzt gerade ansteht.
Maline lauscht an der Tür. In der Wohnung ist es still. Die Kommissarin überlegt. Sie trägt die Verantwortung und gibt nun Franka ein Zeichen. Die Kollegin tritt vor, zieht einen Türfallengleiter aus der Tasche und setzt das dünne Blech in Höhe des Fallenkopfs zwischen Rahmen und Tür an. Dabei drückt sie gleichzeitig mit der Schulter gegen den Zugang und öffnet ihn. Volle Konzentration. Malines Muskeln sind angespannt. Der Verdächtige könnte bewaffnet sein. Sie bedeutet Franka, sich aus der Schusslinie zu bringen. Die Kollegin tritt hinter Ben und Kevin zurück.
»Herr Weber! Hier ist die Polizei! Wir kommen jetzt rein!«
Keine Reaktion.
Maline stößt die Tür mit dem Fuß auf. Die Diele ist leer. Eine geschlossene Tür befindet sich auf zwölf Uhr, eine näher liegende auf der linken Seite ist geöffnet. Drei Schritte, größer ist die Entfernung nicht. Ben ist jetzt direkt neben Maline und sichert sie mit gezogener Waffe. Gemeinsam bewegen sie sich bis zum ersten Türrahmen. Vor Betreten des Raums erfasst Maline die Gegebenheiten dieses Durchgangszimmers in Sekundenschnelle. Das Rattanregal vor dem Fenster, Schreibtisch, Computer. Rechts ein Zugang zum nächsten Zimmer.
Maline bedeutet Kevin, sich an der Eingangstür zu positionieren, um auszuschließen, dass die Ermittler von jemandem überrascht werden. Franka ist aufgerückt, bleibt im Durchgangszimmer stehen und gibt Rückendeckung, während Ben und Maline den nächsten Raum checken. Das Schlafzimmer ist spärlich möbliert. Einzelbett, Schrank, Sessel. Maline sieht auch hinter die Tür. Der Gesuchte befindet sich weder dort noch im Schrank. Unverzüglich kehren die Beamten in die Diele zurück.
Maline reißt die geschlossene Tür am Ende des Flurs auf und macht jetzt Tempo. Die Küche ist ebenfalls ein Durchgangszimmer. Ben sichert. Franka gerät in seine Schusslinie, als sie den einzigen Unterschrank öffnet.
»Mensch, pass doch auf!«, schimpft Ben leise und senkt sofort die Pistole.
Maline prescht vor ins Wohnzimmer und erfasst das Szenario. Zwei Personen. Mann und Frau. Sie sitzt auf einem Sessel, er auf der weißen Ledercouch. Ein massiger Typ, breiter Schädel, Oberlippenbart. Es handelt sich eindeutig um den Gesuchten. Vor ihm steht ein Couchtisch, der mit Gegenständen überfrachtet ist.
»Herr Weber?«, ruft Maline, während sie im Türrahmen stehen bleibt. »Handflächen nach unten auf dem Tisch ablegen!«
Weber macht keine Anstalten, dem Befehl nachzukommen.
»Was wollen Sie hier?«, schreit die Frau los. Sie trägt bunt gemusterte Leggings. »Mein Mann hat nichts getan!«
Franka ist sofort bei ihr und nimmt ihr die Sicht auf ihren Ehemann.
»Scheiß-Bullen!«, kreischt Frau Weber. »Das ist meine Wohnung! Ihr könnt hier doch nicht einfach–«
»Verhalten Sie sich ruhig!«, herrscht Franka sie an. »Ansonsten werde ich Sie hinausbegleiten.«
»Los jetzt, Hände auf den Tisch«, ruft Maline Weber zu, und diesmal kommt er der Aufforderung nach.
Sie behält ihn im Blick, ohne ihre Position zu verlassen, und scannt gleichzeitig den Raum. Ein Wohnzimmerschrank ist von der Wand abgerückt, daneben sind Umzugskisten gestapelt.
»Sauber«, ruft Ben, nachdem er in und auch hinter den Schrank geschaut hat.
Maline schaut durch die Küche in die Diele zurück. Kevin steht auf dem Posten.
Ben nähert sich Weber und hält die Waffe direkt auf ihn gerichtet. Der Tisch vor der Couch wirkt wie eine Barriere zum Vorteil für den mutmaßlichen Täter.
»Stehen Sie jetzt auf, kommen Sie langsam hinter dem Tisch hervor und begeben Sie sich in die Raummitte!«, befiehlt Ben, während er weiter auf ihn zielt.
Weber zögert schon wieder.
»Wenn Sie dem nicht nachkommen, setzen wir Pfefferspray ein«, ruft Maline.
Das wirkt. Weber setzt sich in Bewegung.
Gleichzeitig beginnt seine Frau erneut zu krakeelen. »Scheiß-Bullen. Blödes Pack!«
Franka hält sie in Schach.
Ben dirigiert ihren Mann auf den Boden. Maline legt ihm Handfesseln an, während Ben den Bund seiner Jeans gründlich nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Anschließend tastet er Webers Körper ab und befördert ein Klappmesser aus dem rechten Strumpf.
»Wir helfen Ihnen jetzt beim Aufstehen und bringen Sie zur Dienststelle«, sagt Maline laut.
»Ende!«, ruft Edwin.
Maline braucht einen Moment, um von ihrem Stresspegel herunterzukommen.
Die Simulation ist im Rahmen des jährlichen Einsatztrainings erfolgt. Weber ist Polizeikommissar, genau wie seine »Frau«. Sie sind Beamte aus einem anderen Kommissariat. Die Kölner Behörde ist groß, und Edwin, der Leiter des Einsatztrainings, hat es für die Konfrontation extra so inszeniert, dass Maline und ihr Team die Gegenspieler nur flüchtig kennen. Trainingseinlagen wie diese wirken dadurch noch wirklichkeitsnaher.
Um Einsätze im häuslichen Umfeld so realistisch wie möglich zu üben, nutzt die Kölner Polizei ihr Trainingshaus in Brühl, in dem verschiedene Wohnungen für ihre Zwecke hergerichtet sind, beispielsweise um bei Durchsuchungen jemanden zu finden, der sich in einem Zimmer versteckt hält. Unvorhersehbare Eskalationen inklusive. Zwei Tage Eingriffstechniken und taktische Grundlagen in diesem Trainingshaus liegen hinter Maline und den anderen. Den krönenden Abschluss bildete die heutige Festnahme eines »Täters«. Seine »Ehefrau« hatte die Aufgabe, die angespannte Atmosphäre in der Übungswohnung zu steigern. Echte Verhaftungen können schnell aus dem Ruder laufen. Eine falsche Entscheidung, eine Unachtsamkeit, und schon eskaliert die Lage.
Maline hat einige brenzlige Situationen erlebt. Menschen, die sich in die Ecke gedrängt fühlen, sind unberechenbar. Wie vor Jahren dieser Familienvater, der seine Frau mit einem Messer schwer verletzt hatte. Beim Eintreffen der Polizei gab er sich kooperativ, ruhig und einsichtig. Maline sprach mit ihm im Arbeitszimmer. Seine Kinder schrien in der Küche. Als er abgeführt wurde, ging Maline vor ihm die Treppe hinunter. Diese Unvorsichtigkeit nutzte er sofort aus und trat ihr mit voller Wucht in den Rücken. Maline fiel unglücklich, zog sich schwere Prellungen und einen Nasenbeinbruch zu. Ein anderes Mal verpasste ihr ein Junkie einen Tritt in den Bauch. Auch aus diesem Grund schwört Maline auf das jährliche Einsatztraining.
Edwin sammelt die Rotwaffen ein, die innerhalb der Fortbildung anstelle der P99 eingesetzt werden. Die Trainingspistolen sind leuchtend rot und ohne Munition. Auch das Pfefferspray geben ihm die Beamten wieder zurück.
»Du warst richtig gut«, lobt Maline ihre Kollegin. »Frau Weber« hat ihre Leggings wieder gegen Jeans getauscht. Die Gruppe steht zur Nachbesprechung zusammen.
Edwin kommt noch mal auf die Wichtigkeit des Quick Peaks zu sprechen. »Schneller Blick«, sagt er stakkatomäßig. »Zack. Das Zimmer checken. Zack. Durchsuchen und ab in den nächsten Raum. Ihr müsst alles schnell erfassen und auf die Deckung achten.« Edwin sieht zu Franka, und Ben nickt.
Es klopft an der Tür. Maline hofft, dass die Abschlussrunde hiermit beendet ist. Heute wird sie Jette zum Japaner entführen. Und egal, ob sie sich für Sushi, Kiji-Don oder Shake-Teriyaki entscheiden, danach werden sie auf eine Elektro-Swing-Party ins Gloria gehen. Gedanklich schwingt Maline schon das Tanzbein und braucht deshalb einen Moment, um zu begreifen, dass der Kollege ihretwegen die Runde stört. Eine Leiche wurde aufgefunden, und dieser Umstand vernichtet mit einem Schlag die Abendpläne der Oberkommissarin. Sie hat Rufbereitschaft.
Eigentlich ist es Lou Vanheydens Dienst, den Maline kurzfristig übernommen hat. Eine Gefälligkeit unter Kolleginnen, die auch Freundinnen sind. Lous Tochter hat ihren Work-and-Travel-Aufenthalt in Kanada nach nur fünf Monaten überraschend abgebrochen, geplant war ein volles Jahr. Zu den Gründen hat Frieda geschwiegen und ihren Eltern via Skype vor ein paar Tagen nur die Ankunftszeit am Flughafen mitgeteilt. Seitdem befindet sich vor allem ihr Vater Henry im emotionalen Ausnahmezustand und spekuliert in alle Richtungen. Heimweh? Liebeskummer? Lou bleibt gelassen. Frieda wirkte im Skypegespräch unversehrt, und das ist für sie die Hauptsache.
Maline hat die Bereitschaft übernommen, damit Lou dabei sein kann, wenn ihre Tochter ankommt, obwohl sie längst Karten für die Swing-Party gekauft und einen Tisch beim Japaner reserviert hatte. Selbstverständlich in der Hoffnung, dass es zu keinem Einsatz kommen wird. Zähneknirschend fährt sie nun in Richtung Innenstadt, ruft ihre Freundin über die Freisprechanlage an und sagt ihre Verabredung ab.
Jette möchte keinesfalls allein losziehen. »Es gibt Schlimmeres und noch viele Partys«, sagt sie.
Maline hat nichts anderes erwartet. Am Anfang einer Beziehung ist das Entgegenkommen oft groß. Jede ihrer Partnerinnen hatte in den ersten Monaten Verständnis für die Unregelmäßigkeiten ihres Jobs.
»Kommst du später zu mir, oder fährst du ins Bergische?«, will Jette nur wissen.
Maline ist kürzlich nach Marialinden gezogen, hält sich dort aber kaum auf. Jette wohnt im Belgischen Viertel, in der Nähe vom Brüsseler Platz zwischen Altbauten mit Gründerzeitfassade, und Maline schlendert gern durch das Viertel, in dem sich hippe Cafés, Szenekneipen, kleine Boutiquen und Galerien befinden. Außerdem machen ihr die vielen Sondereinsätze oft einen Strich durch die Rechnung. Um Zeit zu sparen, begibt sich Maline dann erst gar nicht auf die Autobahn, um im Bergischen Land zu übernachten, sondern bleibt gleich in Köln. Die Anforderungen der Behörde wachsen ständig.
Zur Bewältigung der Aufgaben, die aufgrund der Flüchtlingswelle und den Silvesterübergriffen 2015/16 zusätzlich zur alltäglichen Organisation anfallen, muss jedes Kommissariat Personal stellen. Hinzu kommen Aufmärsche der Rechten mit Gegendemonstrationen, andere politische Versammlungen und die ganz normalen Großevents wie Fußballspiele, Karneval, CSD, Kölner Lichter, Weihnachtmärkte und so weiter und so weiter. Maline schiebt neunhundertachtzig Überstunden vor sich her. Sie ist ihrem Beruf mit Leib und Seele verschrieben. Doch die Stimmung kippt, bei ihr genauso wie bei manchen Kollegen.
Wegen der herrschenden inneren Strukturen ist es schwierig, geleistete Stunden abzubauen. Dienstfreisperre. Permanenter Personalmangel. Rufbereitschaften, die nur8:1 vergütet werden. Obendrein nehmen Anfeindungen der verschiedenen Gesellschaftsgruppen, politischen Lager und mancher Medien bisweilen absurde Ausmaße an. Und über den Inhalt der Verpflegungsbeutel bei Großeinsätzen regt sich Maline schon gar nicht mehr auf.
So oder so– der gemeinsame Abend mit Jette ist gelaufen. Maline schluckt ihren Frust hinunter, blendet ihn auf dem Weg zum Einsatzort aus. Ein Mensch ist gestorben. Dieser Umstand versetzt sie in den Go-Modus. Für die nächsten Stunden wird Maline Brass dem Toten und dessen Umfeld ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmen.
Honrath-Jexmühle
Der Zugbegleiter nähert sich durch den Mittelgang und prüft die Tickets der Fahrgäste. Romy hat die Kapuze ihres Sweatshirts aufgesetzt und lässt ihren Blick unauffällig durch das Großraumabteil schweifen. Die Regionalbahn ist gut frequentiert. Romy wäre lieber zu einer späteren Uhrzeit gefahren. Aber ein verwaistes Abteil bedeutet nicht automatisch, dass sie weniger auffällt. Außerdem gehört Linus früh ins Bett. Er kränkelt. Abends ist es besonders schlimm.
Romy sieht, wie sich der Bahnbedienstete kontinuierlich nähert, und spürt den Stein in der Magengrube, der sich neuerdings bemerkbar macht, wenn sich brenzlige Situationen anbahnen. Um sich abzulenken, stiert sie demonstrativ aus dem Fenster.
Linus zeichnet mit dem Zeigefinger die Verläufe des Regens nach, der die Scheiben außen hinunterperlt, obwohl sie ihn mehrfach ermahnt hat, es zu unterlassen. Gott weiß, welche Bakterien an den Fenstern kleben. Sie setzt schon an, um ihn erneut zu tadeln, aber der Junge summt ein Regenlied und löchert sie ausnahmsweise nicht mit Fragen. Für diese Atempause nimmt Romy die schmutzigen Hände in Kauf. Sie kuschelt sich an ihren Sohn, der nun den Deckel des Tischmüllbehälters aufklappt. Und zu. Zu und auf. Der Kleine ist blass, hat einen trotzigen Zug um den Mund, durchsichtiger Schleim rinnt ihm aus der Nase. Seine Handgelenke sind zart, die Finger schmal und kurz. Sind so kleine Hände…
Die Bahn rumpelt durch die beginnende Dunkelheit und durchquert das Gebiet von Brunsbach. Birken und Tannen säumen die Gleise. Die Bäume sind nur schattenhafte Umrisse, ebenso wie die Forsythiensträucher und das Meer aus wilden Narzissen. Romy kennt die Wegstrecke im Schlaf und liebt sie besonders im Frühling. In der Schule hat sie an den Lippen ihrer Deutschlehrerin gehangen. »Nun jauchzet alles weit und breit, da stimmen froh wir ein: Der Frühling ist die schönste Zeit! Was kann wohl schöner sein?« Nun ja, da fällt Romy einiges ein. Ihre Wunschliste ist länger als das gesamte Netz der Deutschen Bahn.
Der Schaffner hat die Distanz zwischen ihnen verringert. Bis zur Haltestelle, an der sie und Linus aussteigen müssen, sind es noch knapp vier Minuten. Äußerlich entspannt wägt Romy Fluchtmöglichkeiten ab. Die Toilette ist keine Option. Defekt und zugesperrt. Gewohnheitsmäßig hat Romy beim Einsteigen die Lage gecheckt. Sie könnte aufstehen, Linus an die Hand nehmen und ganz langsam in die entgegengesetzte Richtung schlendern. Oder mit erhobenem Kopf am Bahnbediensteten vorbeimarschieren, den nächsten Ausgang ansteuern, Blickkontakt zu ihm halten und freundlich lächeln. Ihr Lachen ist ein Türöffner. Damit wickelt Romy jeden um den Finger. Die Behauptung ihres Stiefvaters hat stets diffamierend geklungen.
Der Marsch des Schaffners wird durch eine Frau gebremst, die offenbar über eine Seniorenkarte verfügt, ihren Ausweis allerdings nicht mitführt. Zwischen den beiden entbrennt eine Diskussion, weil die Dame nachlösen soll und sich weigert. Der Kontrolleur bleibt hart, obwohl es sehr wohl Handlungsspielräume gibt, wie die Frau mehrfach betont. Ein Erbsenzähler, denkt Romy und beginnt zu schwitzen.
Sie könnte gelassen bleiben. Ausnahmsweise besitzt sie einen Fahrschein und hat ihn ordnungsgemäß am Automaten entwertet. Linus ist der Grund für ihre Nervosität. Er ist im Februar sechs geworden, wird im Sommer eingeschult und lehnt es neuerdings ab zu lügen, wenn ihn jemand nach seinem Alter fragt. Dabei geht er von der Statur locker als Fünfjähriger durch. Kinder unter sechs können kostenlos mitgenommen werden– wie sehr Romy auf dieses Sonderrecht angewiesen ist, ahnt Linus natürlich nicht. Und prinzipiell möchte sie ihn zu einem ehrlichen Menschen erziehen. Notlügen toleriert Romy nur gelegentlich, auch wenn es schwer ist, diesen Grundsatz im Alltag durchzuhalten. Dabei sehnt sie sich nur nach Normalität. Diesem Wunsch ordnet sie alles unter. Für Linus. Ihn schirmt sie weitestgehend von der Realität ab, lässt ihn im Glauben, dass vieles, was sie unternehmen, ein Spiel ist. »Das Leben ist schön.« Romy hat den Film siebzehnmal gesehen. Früher. In einem anderen Leben.
Der Bahnangestellte diskutiert weiter mit der alten Dame. Romy kann sein Aftershave riechen. Er steht breitbeinig und dreht ihr den Rücken zu. Romys Blick geht hinauf zu seinem ausrasierten Nacken. Die Dienstmütze sitzt eng und drückt sich in eine rötliche Fettwulst, seine Ohren stehen ab.
Die Regionalbahn verlangsamt die Geschwindigkeit. Romy hilft Linus in die Jacke, die ihm zu klein geworden ist. Der Reißverschluss lässt sich nicht mehr schließen. Romy behilft sich mit zwei Sicherheitsnadeln und ermahnt Linus, vorsichtig aufzustehen. Er hangelt sich von Sitzlehne zu Sitzlehne bis zum nächsten Ausstieg und hält sich an einer Haltestange fest. Wenn es drauf ankommt, ist er gehorsam. Der Zugbegleiter baut sich vor der renitenten Frau auf. Erst als Romy sich an ihm vorbeidrängelt, dreht er sich um und spricht sie direkt an.
»Fahrausweis, bitte!«
Die Bahn kommt quietschend zum Stehen.
Romy knipst ihr Lächeln an und zückt das Ticket, ohne Linus aus den Augen zu lassen, der durch den Bremsvorgang einen Moment die Balance verliert, die Situation aber ohne Probleme meistert. Als er ins Freie hüpft, hat der Schaffner schon das Interesse an Romy verloren. Dem Kind hat er keine Aufmerksamkeit geschenkt. Linus springt in die erstbeste Pfütze und wiehert wie ein Fohlen, das nach einem langen Winter im Stall endlich auf die Weide darf.
Zahlreiche Menschen haben den Zug verlassen und stürmen zu ihren Autos. Romy holt Linus ein, schlingt ihre Arme von hinten um seinen schmächtigen Körper, hebt ihn hoch und wirbelt ihn im Kreis. Engelchen flieg. Er quietscht vor Begeisterung.
Romy trödelt, inspiziert unnötigerweise den Zugfahrplan und schnürt sich seelenruhig die Turnschuhe. Aus den Augenwinkeln beobachtet sie, wie ein Auto nach dem anderen die Park-and-Ride-Anlage verlässt, die einer beachtlichen Anzahl Pkw Platz bietet. Trotzdem kommt es in Stoßzeiten regelmäßig zu Engpässen.
Als wieder Ruhe eingekehrt ist, nimmt Romy Linus an die Hand und biegt mit ihm an der Kurve nach Jexmühle ab. Erfreulicherweise ist die Straße jetzt wie leer gefegt. Sie überqueren den Bahnübergang, und es hört endlich auf zu regnen. Romy zieht Linus zur Seite und zaubert eine schwarze Sturmhaube aus ihrer Umhängetasche. Als Jugendliche hat sie das Baumwollding unter dem Motorradhelm getragen, wenn sie sich bei Eiseskälte an Robin festklammerte. Diese Zeit scheint Lichtjahre her. Zwischen Gegenwart und Vergangenheit liegen Welten.
Romy stülpt Linus die Sturmmaske über den Kopf. Die Augenöffnung ist zu groß. Das Gesicht des Kindes ist komplett zu sehen, aber seine langen blonden Haare sind verdeckt. Linus’ Augen strahlen vor Begeisterung. Es bedarf nur weniger Accessoires, um seine Phantasie anzuregen.
Romy kramt eine große Sicherheitsnadel hervor, strafft den Stoff an Linus’ Nacken, befestigt die Nadel und lächelt. Die Kopfbedeckung sitzt perfekt. »Wir sind Ninjas«, flüstert sie. »Niemand darf uns sehen, und deshalb gehen wir nicht über die Straße, sondern schleichen am Bahndamm entlang.«
»Wo sind unsere Schwerter?«, fragt Linus, zieht die Nase hoch und zappelt von einem auf das andere Bein.
»Wir haben die Aufgabe, unsere Mission mit bloßen Händen zu erledigen.«
Romy nimmt ein dunkles Tuch, bindet es um ihre Stirn und knotet es hinter dem Kopf zusammen. Linus hebt den Daumen und grinst.
Ein Auto nähert sich. Scheinwerfer blenden auf.
»Komm!« Romy zieht ihren Sohn von der Straße hinter einen Busch. Gemeinsam beobachten sie, wie der Pkw an ihnen vorbeirollt. Als er nicht mehr zu sehen ist, dirigiert Romy das Kind auf einen Pfad und bedeutet ihm, still zu sein, indem sie ihren Zeigefinger auf seine Lippen legt.
Sie laufen parallel zu den Gleisen in Richtung Hoffnungsthal.
Linus ist ganz in seinem Element, macht sich klein und rennt gebückt am Saum der Böschung entlang. Im Eifer des Gefechtes verliert er zwischendurch die Orientierung und stolpert über den losen Schotter, in dem die Bahnschwellen eingebettet liegen. Romy schwitzt Blut und Wasser. Wiederholt zerrt sie ihren Sohn von der Trasse und lenkt ihn auf Kurs.
Begleitet von einem mulmigen Gefühl behält sie vor allem die Strecke hinter sich im Auge, auch wenn die nächste RB25 erst in neun Minuten den Bahnhof in Honrath erreichen wird. Romy hat die Taktung der Regionalbahnen auswendig gelernt. Aber vielleicht gibt es auf diesen Schienen auch Güterverkehr. Gefährlich ist die Aktion in jedem Fall.
Die Straße muss Romy unbedingt meiden. Leider ist sie in der Gegend bekannt, und diese Tatsache zwingt sie zu der kleinen Abenteuereinlage. Und auch wegen Linus ist es klug, ihre Absichten zu verschleiern. Er plappert drauflos, wenn er dazu aufgefordert wird.
Die Leiterin seines Kindergartens interessiert sich außerordentlich für seine Geschichten. »Erzähl mal, Linus, was hat deine Mami mit dir am Wochenende denn so unternommen?« Die Einrichtung, die der Junge besucht, besteht aus zwei Gruppen, solider Erzieherinnenschlüssel mit einer Köchin, die sich richtig ins Zeug legt und alle Kinder beim Namen kennt. In ihrer momentanen Situation wäre Romy eine anonyme Großeinrichtung lieber.
Auf der rechten Seite taucht die Rückfront eines Hauses auf, in dem Romy früher ein und aus ging. Sie lässt ihren Blick schweifen. Überall standen ihr hier einst die Türen offen, es gab Freunde und Gemeinschaft. Schall und Rauch. Romy stellt sich vor, wie einstige Weggefährten heute mit ihren Familien am Abendbrottisch sitzen und die Nase rümpfen, wenn ihr Name fällt.
Linus trottet langsamer vorwärts und bückt sich nicht mehr so mustergültig wie am Anfang. Er hat keine Ahnung, wo sie sich befinden und was sie in dieser Gegend zu suchen haben.
»Es ist nicht mehr weit«, sagt Romy und bemerkt, dass sie ihre Geschwindigkeit ebenfalls gedrosselt hat. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Sie erreichen ein markantes Birkenpaar, und Romy scheucht Linus den Abhang hinauf. Ihr gelingt die erwartete Punktlandung. Das Haus liegt umgeben von einem hüfthohen Gartenzaun direkt am Waldrand und ist an der Nordseite in den Hang gebaut. Romy hatte es größer in Erinnerung.
Optisch passt das Gebäude eher in den Schwarzwald. Das Walmdach ist an zwei Seiten tief nach unten gezogen und verschattet im Sommer die Außenwände. An der Südseite sind bodentiefe Fenster eingelassen. Ein großer Holzbalkon erstreckt sich über die obere Etage, und der Keller ist aus Natursteinen gemauert, ebenso die Doppelgarage. Das gesamte Grundstück wirkt verlassen und düster. Nirgends brennt Licht. Der nächste Nachbar lebt einhundert Meter entfernt. Bis auf das Dach wird sein Haus, aus Romys Perspektive, von Sträuchern und Tannen verdeckt.
»Ich hebe dich über den Zaun«, flüstert Romy. »Siehst du die zugedeckten Gartenmöbel?«
»Mhm.«
»Da müssen wir hin.«
Sie hilft Linus über die Umzäunung, bevor sie selbst rüberspringt, und geht vor dem Kleinen in die Hocke.
»Wir überqueren jetzt die Wiese. Dabei werden Lampen angehen und den Garten ausleuchten. Davor brauchst du keine Angst zu haben. Das sind Bewegungsmelder. Sie sollen die Leute im Haus vor Eindringlingen warnen.«
»Rufen die dann die Polizei?«, fragt Linus, zieht die Augenschlitze seiner Sturmhaube nach unten und wischt den Rotz, der ihm aus der Nase läuft, mit dem Ärmel seines Anoraks fort.
»Es ist niemand im Haus. Die Nachbarn werden auch nicht reagieren, weil diese bekloppten Lichter ständig angehen. Bei jedem Igel, Hasen und allen Katzen, die umherstreunen. Verstanden?«
»Ich muss Pipi.«
»Gleich.«
Sie rennen Hand in Hand den leicht abschüssigen Rasen hinauf und sind kaum zwanzig Meter vorangekommen, als der Garten in hellem Flutlicht erstrahlt. Trotz Ansage stößt Linus einen Schrei aus. Romy legt einen Zahn zu und treibt ihn über das feuchte Nass. Bei den Gartenmöbeln angekommen, überwindet sie die kurze Distanz zur Hauswand. Romy drückt sich mit dem Rücken dagegen. Außer Atem imitiert Linus ihr Verhalten.
Wenige Schritte entfernt führt eine schmale überdachte Kellertreppe ins Untergeschoss des Hauses. Auf ihr Geheiß springt Linus mit ihr die moosbedeckten Steinstufen hinab. Romy nimmt einen Pflasterstein in die Hand, der in einer alten Bananenkiste liegt. Linus verfolgt jede ihrer Bewegungen mit großen Augen.
»Du musst mir jetzt genau zuhören.« Romy fängt den Blick ihres Sohnes ein. »Es ist nicht erlaubt, bei anderen Menschen einzubrechen, und es ist auch nicht in Ordnung, fremdes Eigentum zu zerstören. Du findest meine Verhaltensweise deshalb bestimmt paradox, aber heute machen wir eine Ausnahme, weil ich keine Wahl habe.«
»Was heißt paradox?«
»Pst!«
Romy schiebt Linus zur Seite und lässt den Stein gegen das wasserkistengroße Fenster krachen, das etwa auf ihrer Kopfhöhe in die Kellertür eingelassen ist. Die geriffelte gelbliche Scheibe geht klirrend zu Bruch. Der größte Teil der Scherben landet im Keller. Linus reißt die Augen noch weiter auf.
Romy lauscht wie versteinert, bis das Licht des Bewegungsmelders ausgeht. Alles bleibt ruhig. Mit Hilfe des Steins vergrößert sie das Einschlagloch bis zum Rahmen, nimmt ihre alten Motorradhandschuhe aus dem Rucksack und stülpt sie Linus über die Hände.
»Die sind viel zu groß«, quiekt er lachend.
»Egal, Hauptsache, deine Hände sind geschützt.«
Linus zieht eine Grimasse.
»Ich hebe dich jetzt mit den Füßen zuerst durch das Fenster. Drinnen steckt ein Schlüssel im Schloss. Meinst du, dass du es schaffst, ihn zu drehen und die Tür zu öffnen?«
Der Kleine nickt.
»Eins noch«, sagt Romy, geht vor Linus in die Knie und sieht ihm in die Augen. »Welche geheime Handbewegung machen wir, wenn Gefahr droht und wir nicht miteinander sprechen können?«
»Wir klopfen uns leicht mit der linken Faust auf die Mitte der Brust.«
»Richtig.« Romy lächelt. »Und was machen wir dann?«
»Weglaufen, verstecken…« Linus zieht die Nase hoch und sieht in die Luft.
»Oder wir holen Hilfe«, ergänzt Romy.
»Sind wir denn in Gefahr?«, fragt Linus und schaut sich um.
»Unsinn«, beruhigt ihn Romy. »Ich wollte dich nur testen.«
Sie stellt sich hinter ihren Sohn, wuchtet ihn empor und befördert ihn mit Schwung hinauf zur Fensteröffnung.
»Setz deine Füße auf dem Rahmen ab!«
»Da ist Glas!«
»Ja, pass auf, wenn du drüben aufplumpst, dort liegen Scherben auf dem Boden.«
Nach dem zweiten Versuch gelingt die Prozedur, und Linus fällt ins Innere des Hauses.
»Siehst du den Schlüssel, der auf der Tür steckt?«
Glas knirscht.
»Linus? Hast du dir wehgetan?«
»Ich hab Pipi in die Hose gemacht.«
»Das ist nicht schlimm, Spätzchen. Öffne jetzt die Tür!«
»Hier ist es dunkel.«
»Der Lichtschalter ist auf der rechten Seite direkt über deinem Kopf.«
Sekunden später schließt Romy ihren Sohn wieder in die Arme und küsst seine Wangen. Er lächelt gequält. Seine Jeans hat einen feuchten Kranz im Schritt.
»Ich habe Hunger.«
»Gleich.«
»Nein, jetzt.«
Romy angelt eine Taschenlampe aus ihrem Rucksack, schaltet sie ein, löscht das große Licht, durchquert den Kellerraum und führt Linus die steile Treppe hinauf. Sie vermeidet es, ihren Empfindungen nachzuspüren, und instruiert sich, ihren Plan konsequent in die Tat umzusetzen.
Die beiden gelangen in einen Flur. Links befindet sich die Garderobe, an der eine Strickjacke neben dem großen Regenschirm hängt, unter den locker drei Leute passen. Es riecht nach Raumerfrischungsspray der Duftsorte exotischer Früchte. Romy verzieht das Gesicht. Manche Dinge ändern sich anscheinend nie.
»Hier stinkt’s«, bemerkt Linus.
»Musst du noch auf die Toilette?«, fragt Romy und deutet auf das Gäste-WC.
Linus schüttelt den Kopf.
Sie öffnet die Tür zur Küche und knipst das integrierte Licht in der Dunstabzugshaube an. Linus folgt ihr zögernd.
Die Inneneinrichtung ist luxuriös, eine Überraschung, die niemand hinter der unspektakulären Außenfassade vermutet. Romys Magenstein meldet sich und wiegt jetzt einen Zentner. Allein der Anblick der Küche löst bei ihr Beklemmungen aus. Auch die bodentiefen Sprossenfenster mit Blick in den Garten. Der frei stehende Küchenblock mit Quarzsteinarbeitsplatte, das Induktionskochfeld und die runde Granitspüle. Unaufdringlich protzende Markenware. Natürlich fehlt weder eine Hightech-Kaffeemaschine noch der in Augenhöhe angebrachte Backautomat mit TFT-Touchdisplay, Klimagaren-Vorrichtung und integriertem Speisenthermometer. Erwartungsgemäß kann Romy kein Staubkörnchen entdecken. Die Einrichtung wirkt wie der Verkaufsraum einer Möbelhauskette.
Linus lässt sich auf den Boden fallen. Er schafft es, die Sicherheitsnadeln zu lösen, zieht die Jacke aus, befördert ein Matchboxauto aus den Untiefen seiner Hosentasche und schiebt es über die sandfarbenen Bodenfliesen, die auch als Spritzschutz hinter der Spüle verbaut sind. Wegen ihrer empfindlichen Oberfläche wird die Küche allerdings kaum benutzt. Romy kaut auf ihrer Unterlippe. In diesem Haushalt schwört man auf Mikrowelle oder geht auswärts essen, vorzugsweise beim Italiener.
»Kann ich Pommes haben?«, fragt Linus.
Romy legt ihr Handy auf den Tisch und öffnet den Multi-Airflow-Umluftkühlschrank. Blaues LED-Licht und bis auf ein Senfglas gähnende Leere. Dafür lagert in den Gefrierfächern eine ansehnliche Auswahl Mikrowellenmenüs.
»Darf ich mich etwas umsehen?«, fragt Linus.
»Klar, aber bitte nichts anfassen.«
Romy sieht den Jungen die Treppe hinauflaufen. »Hier ist ein riesiges Badezimmer mit Planschbecken«, hört sie ihn begeistert rufen. Er meint wahrscheinlich die Whirlpool-Badewanne.
»Darf ich mich reinsetzen?«
»Nein!«, schreit Romy. »Komm wieder runter!«
»Gleich.«
Fritten findet Romy nicht und entscheidet sich für schwedische Fleischklöße mit Nudeln.
Linus ist begeistert, als sie wenige Minuten später vor der dampfenden Mahlzeit sitzen. Romy löst die Sicherheitsnadel in seinem Nacken und zieht ihm die Haube vom Kopf.
»Hier ist es cool«, sagt er. »Oben ist ein Raum mit Computern und einem tollen Tischkicker.«
Romy lächelt.
»Wohnen wir jetzt hier?«, will Linus wissen und zieht schon wieder die Nase hoch.
»Nein.«
»Wem gehört das Haus?«
»Kennst du nicht.«
»Meine Hose ist nass.«
»Ich weiß.«
»Bist du böse mit mir?«
»Nein.«
»Haben die Leute, die hier wohnen, nichts dagegen, dass wir ihre Sachen essen?«
Romy hebt die Schultern.
»Du hast gesagt, dass man fremde Dinge nicht anfassen darf.«
»Ja, genau.«
»Kaputt machen darf man auch nix.«
»Stimmt.«
»Die Scheibe im Keller hast du aber zertrümmert.« Linus fasst die Situation zusammen. »Peng. Knall. Schepper!«
»Du sollst nicht in dieser Comicsprache reden«, sagt Romy schärfer als beabsichtigt.
Linus isst schweigend ein paar Happen.
»Mein Hals tut weh«, sagt er dann.
Romy legt ihm die flache Hand auf die Stirn. Fieber hat er nicht, aber der Junge brütet definitiv etwas aus. Sein Immunsystem ist anfällig.
Romy stellt ihren Teller ins Spülbecken, öffnet den Backofen, zieht einen gusseisernen Topf hervor und hebt den Deckel hoch. Sie nimmt den Autoschlüssel heraus, schiebt ihn in ihre Hosentasche und stellt den Topf zurück. Linus bohrt in der Nase und schmollt. Er ist sensibel und mag es nicht, wenn man ihn tadelt oder zurechtweist. Natürlich nicht. Sie wuschelt ihm durch die schulterlangen Haare und drückt ihm einen Kuss auf den Hinterkopf.
»Zieh deine Hose und den Slip aus.«
Er starrt sie entgeistert an.
»Keine Sorge, ich werfe beides nur schnell in den Trockner.«
»Was ist–«
»Eine Maschine, die feuchte Sachen trocken macht.«
»Cool!«
Linus öffnet den Bundknopf, und seine Jeans fällt zu Boden. Den Schlüpfer streift er schnell ab. Romy wickelt ihm zwei Geschirrhandtücher um die Hüften.
»Ich muss in die Garage«, sagt sie. »Du bleibst sitzen und isst den Teller leer.«
Bevor sie die Tür hinter sich zuzieht, wirft sie einen letzten Blick auf Linus. Er hat die Kapuze seines Sweaters aufgesetzt, baumelt mit seinen nackten Beinen und spricht mit dem Fleischklößchen, das er mit der Gabel aufgespießt hat.
Das Licht der Taschenlampe leuchtet Romy den Weg, die Treppe hinunter in die Waschküche. Prompt begegnen ihr alte Geister. Romy beißt die Zähne zusammen. Sie weiß, dass sie verloren hat, wenn sie sich den Dämonen stellt, und klatscht in die Hände. Krach mögen Geister nicht.
Romy wirft Linus’ Sachen in den Wäschetrockner, schaltet ihn ein und geht im Lichtstrahl der Taschenlampe den schmalen Flur entlang, der an einer weiß lackierten Eisentür endet. Der Schlüssel steckt. Sie öffnet und betätigt den Lichtschalter. Wie zu erwarten ist der Alfa Romeo verschwunden, aber der dunkelgrüne Fiat Qubo steht auf seinem angestammten Stellplatz. Bei seinem Anblick ringt Romy um Fassung, fängt sich aber sofort wieder. Sentimentalitäten will sie sich jetzt nicht erlauben.
Romy geht um den Minibus herum. Der Wagen ist erstaunlich gut in Schuss und hat noch zwei Jahre TÜV. Das Heckfenster und die Scheiben der seitlichen Schiebetüren sind dunkel getönt. Romy öffnet den Kofferraum. Er ist mit Allzweckvlies ausgelegt. Im Fond befinden sich eine Kiste Mineralwasser, eine Taschenlampe und zwei Decken. Das Auto riecht neu, obwohl es acht Jahre auf dem Buckel hat. Die Felgen glänzen.
Von der Garagendecke hängt ein Kanu. Es ist an Karabinern und Bandschlingen befestigt und baumelt waagerecht über dem Qubo. An den Wänden der geräumigen Doppelgarage sind Regale angebracht. Auf den meisten Einlegeböden herrscht Unordnung. Konserven, Einmachgläser, Blumendünger und Werkzeuge. Alles liegt kunterbunt durcheinander. Romy schnappt sich eine leere Plastikkiste und füllt sie mit Milchtüten, verschiedenen Marmeladengläsern, abgepacktem Brot, Margarine, Dosenwürstchen und mehreren Packungen Kekse.
»Was machst du hier?«
Romy zuckt zusammen und dreht sich um. Linus steht im Rahmen. Das Geschirrhandtuch verdeckt seine nackten Oberschenkel. Die Kniestrümpfe sind ihm bis zu den Knöcheln hinuntergerutscht. Er hat die Kapuze seines Sweatshirts immer noch auf, die Hände in die Bauchtasche geschoben und schaut sich interessiert um.
»Ich packe Sachen.«
»Warum?«
»Wir nehmen den Wagen mit«, sagt Romy, steckt diverse Dosensuppen, Nudeln und eine Palette Orangensaft in Jutebeutel und verstaut alles im Kofferraum.
Linus bohrt in der Nase. »Aber der gehört doch bestimmt den Leuten, die hier wohnen, oder?«
»Ja.«
»Klauen wir?«
»Es ist ein Geschenk.«
»Soll ich denen ein Dankeschön-Bild malen?«, fragt Linus und niest.
»Wem?«
»Na, den Leuten.«
»Dafür haben wir keine Zeit.«
»Warum sind sie nicht da?«
»Der Besitzer mag das Auto sehr und gibt es nur ungern ab, deshalb will er nicht dabei sein, wenn wir damit wegfahren.«
»Muss der sonst weinen?«
»Ja.«
»Darf ich da drinnen sitzen?«
»Moment«, sagt Romy und nimmt die Sitzerhöhung, die neben Fahrradhelmen liegt, aus dem Regal. Der Stoffbezug ist löchrig, und an manchen Stellen schimmert die Plastikhartschale durch. Ein ramponiertes Modell, aber es wird seinen Zweck erfüllen.
Der Junge klettert auf die Rückbank.
»Ich laufe hoch, räume kurz auf und hole deine Klamotten aus dem Trockner.«
Romy springt die Steintreppe hinauf, beseitigt rasch alle Spuren in der Küche und hebt Linus’ Jacke vom Boden auf.
Bevor sie in den Keller zurückgeht, gleitet ihr Blick das Holzgeländer hinauf in den ersten Stock. Für den Bruchteil einer Sekunde wehen Stimmen herab. Jemand ruft sie beim Namen. Romys Nackenhaare stellen sich auf.
Mit einem Ruck öffnet sie die schwere Kellertür, lässt sie zuschlagen, geht in die Waschküche, leert die Maschine und läuft in die Garage. Romy schnallt Linus fest, setzt sich hinters Steuer und atmet tief durch.
Während ihr Sohn über die noch klamme Jeans mault, versucht sie, die Technik des Autos zu erfassen. Ihre letzte Autofahrt liegt Jahre zurück, und es kostet sie Überwindung, den Motor zu starten. Das Cockpit ist übersichtlich angeordnet. Zu ihrer Erleichterung ist vollgetankt. Fensterheber, Außenspiegel, Sitzhöhe. Alles funktioniert auf Knopfdruck. Der Kilometerstand steht bei zwölftausend. In Relation zum Alter des Qubos ist das ein Witz.
Nach kurzer Orientierung ist Romy fahrbereit und hat die Hand schon an der Gangschaltung, als ihr Blick auf die alte Campingkiste fällt. Sie schaltet in den Leerlauf, zieht vorsichtshalber die Handbremse, steigt aus dem Fahrzeug und wuchtet die große Plastikbox zu Boden.
Sie inspiziert Gaskocher, Kartuschen, Campinggeschirr, eine Rolle Müllbeutel, Besteck und mehrere Päckchen Zündhölzer. Außerdem entdeckt sie drei faltbare Wasserkanister, eine große Trinkflasche, ein funkelnagelneues Luftbett und eine Solar-Shower, deren Beutel zwanzig Liter fasst. Sie macht sich nicht die Mühe, Dinge auszusortieren, sondern stellt die Kiste neben Linus auf die Rückbank. Zwei Schlafsäcke und altmodische Klappcampingstühle mit vergilbten Stoffbezügen wandern in letzter Minute vorn vor den Beifahrersitz. Ebenso eine Flasche Allzweckreiniger und eine Tüte Schwämme.
Romy findet den automatischen Toröffner im Handschuhfach, öffnet und setzt rückwärts aus der Garage. Sie fährt ein Stück die Einfahrt hinab. Augenblicklich erklingt ein Signalton, und eine Lampe leuchtet im Armaturenbrett.
»Was ist los?«, fragt Linus.
»Ich bin nicht angeschnallt«, antwortet Romy, zieht erneut die Handbremse, schließt die Garage und steigt aus. Sie läuft zum Haus zurück und befördert den Funk-Handsender in den Außenbriefkasten. Nichts wie weg. Wenig später biegt sie bei Rösrath auf dieA4.
Der Wagen lässt sich gut lenken. Romy ist erleichtert und findet schnell Gefallen an der Fahrt. Sie stellt sogar das Radio an. WDR2 spielt »Castle on the Hill«. Romy mag Ed Sheeran, und für eine Minute fühlt sie sich wie eine ganz normale Mutter, die mit ihrem Sohn nach einem kurzen Besuch bei Freunden nach Hause unterwegs ist.
Linus ist wie aufgedreht und stellt unzählige Fragen. Er will wissen, wie viele Zimmer das Haus hatte. Ob da Kinder wohnen und wann sie die Leute noch einmal besuchen, um sich zu bedanken.
Romy antwortet zerstreut.
»Kaufen wir einen Aufkleber?«, fragt Linus und zieht die Nase hoch. »So einen mit meinem Namen drauf. Felix’ Mama hat so einen auf der Heckscheibe.«
»Du bist doch kein Baby mehr«, sagt Romy und sucht Blickkontakt im Rückspiegel.
»Manno. Nie machst du, was ich sage!«
Er schmollt nur kurz, fragt, ob Matchboxautos frieren können, und gibt sich mit Romys Antwort zufrieden.
Drei Kilometer später fällt Romy ihr Handy ein. So ein Mist. Sie hat es auf dem Tisch im Esszimmer liegen lassen. Reflexartig tritt sie auf die Bremse. Der Fahrer hinter ihr gestikuliert wild und hupt wie verrückt.
»Was ist los?«, will Linus wieder wissen.
»Wir müssen zurück, ich habe mein Handy vergessen.«
Linus lacht, zaubert das Mobiltelefon aus der Kängurutasche seines Sweatshirts hervor und hält es in die Höhe. »Ich habe es gefunden!«
Romy purzeln tausend Steine vom Herzen. »Das hast du sehr gut gemacht, Spätzchen!«
Linus macht Faxen und freut sich über das Lob seiner Mutter. Romy ist in Gedanken bei dem Besitzer des Hauses in Jexmühle und stellt sich sein Gesicht vor, wenn er sieht, dass der Wagen verschwunden ist. Das eingeschlagene Fenster im Keller und die fehlenden Lebensmittel wird er verkraften. Der gestohlene Qubo ist ein völlig anderes Kaliber.
Romy schämt sich keine Sekunde für ihr Verhalten. Sie hat sich geholt, was ihr zusteht, so sieht die Sache aus, und sie ist überzeugt, das Richtige getan zu haben. Für Linus.
Vor der Polizei fürchtet sie sich nicht. Niemand wird Anzeige erstatten. Immerhin hat sie die Fernbedienung für das Garagentor in den Briefkasten geworfen und damit ein klares Statement abgegeben: Hey, keine Sorge. Die Aktion bleibt eine einmalige Angelegenheit!
Romy liegt falsch. Einzig Linus’ Matchboxauto federt die Wut des Bestohlenen ab. Er findet es im Gemüsefach des Kühlschranks. Es ist allein das Spielzeug, das ihn veranlasst, von einer Anzeige abzusehen und den Vorfall diskret zu behandeln. Romy hat einen schlafenden Hund geweckt. Aber vielleicht war genau das ihre Absicht.
Köln-Kalk
Vor dem Haus steht ein Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Es regnet Bindfäden. Maline parkt ihren Smart, greift nach der Tüte auf dem Beifahrersitz, gibt sich einen Ruck und verlässt das Fahrzeug. Sie schlägt den Kragen ihres Mantels hoch, tritt unbeabsichtigt in eine Pfütze und flucht leise. Stoffturnschuhe sind bei dieser Witterung eine schlechte Wahl.
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein unauffälliges Mehrfamilienhaus. Die Beschriftungen der Klebeetiketten sind teilweise unleserlich. Manche Namensschilder wurden einfach auf den Plastikclip geklebt. Maline genügt ein kurzer Blick auf das Durcheinander, um die Wohnung des Toten auszumachen.
Sie klingelt, vernimmt den Summer und betritt den grau gekachelten Eingangsbereich. Auf den Blechbriefkästen setzt sich das Beschriftungschaos fort. Einige Boxen haben keine Schlösser und stehen offen. Das hölzerne Stiegenhaus ist eng, die Stufen zeugen von den vielen Benutzern, und es ist schummrig, obwohl das Flurlicht eingeschaltet ist. Putz bröckelt großflächig von den Wänden. Auf dem Treppenabsatz des zweiten Stocks steht ein junger Polizist. Maline zeigt ihren Dienstausweis.
»Die Notfallärztin und ein Kollege von der K-Wache sind oben«, sagt er kaugummikauend, die rechte Hand ruht auf dem Holster seiner Dienstwaffe.
Maline zieht den feuchten Mantel aus und legt ihn über das Treppengeländer. Mit der kleinen Digitalkamera ausgestattet, stößt sie die angelehnte Tür zur Wohnung auf, die nur aus einem Raum besteht, den sie auf achtzehn Quadratmeter schätzt.
»Gut, dass du da bist«, sagt Tillmann, den Maline schon von diversen Großeinsätzen kennt. Er eilt ihr entgegen und begrüßt sie mit Handschlag.
In der Wohnung riecht es säuerlich und muffig. Oktay Demirkan liegt in Embryohaltung auf dem Boden in unmittelbarer Nähe eines einfachen Holztisches. Er trägt ein weißes Oberhemd, das am Kragen vergilbt ist, braune Anzughosen, altmodische Hosenträger und abgelaufene Lederschuhe. Der Kopf ruht auf dem angewinkelten Arm, dem Mund haftet ein rötlich brauner Brei an.
»Der Tote hat sich mehrmals erbrochen«, sagt die diensthabende Notärztin, deren Haare auffällig hoch toupiert sind. »In die Spüle, auf den Boden. Ihm dürfte ziemlich schlecht gewesen sein.«
»Ist er erstickt?«
»Das kann ich nicht ausschließen.« Sie räuspert sich und setzt mit Schwung ihre Unterschrift unter die Todesbescheinigung, auf der sie den ungeklärten Tod angekreuzt hat. »Meine Enkelin feiert heute ihren Achtzehnten. Wenn Sie mich dann entschuldigen…« Sie drückt Maline Formulare in die Hand und schnappt sich ihre Tasche.
»Moment«, sagt Maline. »Was sind das für Medikamente auf dem Tisch?«
»Clopidogrel wirkt im Prinzip wie Acetylsalicylsäure. Anders ausgedrückt: Es verhindert das Zusammenklumpen der Blutplättchen und beugt somit Störungen bei der Durchblutung vor. Es wird in der Regel zur Vermeidung von Arterienverschlüssen nach Herzinfarkten und Schlaganfällen verschrieben. Eignet sich aber auch für Patienten mit einer sogenannten peripheren Verengung der Blutgefäße, also einer einfachen Durchblutungsstörung.«
»Führt eine Überdosierung zum Tod?«, fragt Maline.
Die Ärztin deutet auf die Likörflasche. »Grundsätzlich ja, vor allem wenn es zu Wechselwirkungen mit unterschiedlichen Arzneimitteln oder Alkohol kommt.«
»Gibt es denn Anzeichen von Fremdeinwirkung?«
»Nicht, soweit ich das beurteilen kann.«
»Was ist mit dem Todeszeitpunkt?«
»Ich habe die Körpertemperatur bei meiner Ankunft gemessen. Sie betrug einunddreißig Grad. Da die Werte um ungefähr null Komma acht Grad pro Stunde auf Raumniveau sinken, gehe ich davon aus, dass der Tod vor maximal acht Stunden eingetreten ist. Zudem ist die Leichenstarre noch immer vollständig ausgebildet.« Mit diesen Worten verlässt sie endgültig die Wohnung.
»Die Identifizierung ist immerhin eindeutig«, sagt Tillmann und reicht Maline den Ausweis des Toten.
Sie vergleicht das Foto mit dem Verstorbenen. »Hat die Ärztin den Leichnam überhaupt abgetastet?«
Tillmann schüttelt den Kopf.
Bevor Maline beginnt, die erste Leichenschau vorzunehmen, hält sie die Zimmertemperatur, Fenster- und Türbeschaffenheit schriftlich fest. Im Anschluss streift sie Einweghandschuhe über und fotografiert die Auffindesituation des Toten. Akribisch hält sie die Lage der Leiche fest und verfährt genauso mit der unmittelbaren Umgebung.
Der Tisch ist für eine Person gedeckt. Kaffeegeschirr mit blassblauen Blümchen. Auf dem Teller befindet sich ein Stück Käsekuchen, das nicht angerührt wurde. Maline beugt sich vor. Der Puderzucker ist eingetrocknet. Edelkirschlikör steht neben der unbenutzten Tasse, die Flasche ist fast leer. Ein Glas liegt umgekippt daneben, und unter dem Tisch entdeckt Maline ein Blatt Papier.
»Schon als wir eintrafen, lag der Zettel genau an der Stelle«, sagt Tillmann.
Maline geht in die Hocke und fotografiert das Beweisstück.
Die Großbuchstaben sind ungleichmäßig, schief, wie gemalt und überdimensional. »Es tut mir leid.« Das Schriftbild passt eher zu einem Kind. Maline sichert das Beweismittel in einer Papiertüte.
Vor dem Fenster steht eine alte Nähmaschine, ein versenkbares Modell der Firma Pfaff ohne Holzabdeckung. Der Lederriemen des Fußantriebsrads ist porös. Maline betätigt das Pedal, und sofort surrt das Getriebe. In die Nadel ist weißes Garn eingefädelt. Ein Stück hellblauer Stoff wurde unter dem Fuß eingeklemmt. Auf dem Boden liegen Fadenreste jedweder Couleur. Der Platz sieht so aus, als habe Oktay Demirkan seine Tätigkeit nur kurz unterbrochen.
Auf dem unteren Boden eines Regals, das sich unmittelbar neben der Maschine befindet, liegen Stoffballen in allen Farben. Darüber entdeckt Maline weitere Nähutensilien. Scheren, verschiedene Garne, Gummibänder und eine erhebliche Menge Tüten mit weißer Watte. Die beiden oberen Regalbretter sind mit Engeln in kissenähnlicher Form gefüllt, die teilweise übereinanderliegen. Sämtliche Exemplare bestehen aus einem dreieckigen Rumpf, Kopf und Flügeln. Augen, Nase und Mund fehlen. Farben und Größen variieren.
»Vielleicht ein Hobby«, sagt Tillmann. Er deutet auf eine unscheinbare Tür. »Dort befindet sich übrigens die Toilette.«
Der Raum ist so klein, dass es nicht mal Platz für eine Dusche gibt. Dem Waschbecken haften breiige Reste an.
»Wahrscheinlich Erbrochenes«, sagt Tillmann.
Unter dem Becken stehen Reinigungsmittel. Ein kleiner Kanister erregt Malines Aufmerksamkeit. Er ist unbeschriftet und bis zu einem Viertel mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt. Maline löst den Schraubverschluss, nimmt einen leicht alkoholisch-fischigen Geruch wahr und verschließt den Behälter wieder.
»Es könnte sich um ein Desinfektionsmittel handeln«, meint Tillmann und folgt Maline zur Küchenzeile.
Neben der Spüle brummt ein Kühlschrank, der keiner Energieeffizienzklasse entspricht. Im Inneren findet Maline Eier und eine angefangene Dose Schafskäse. An der Kühlschranktür klebt ein Foto, auf dem ein Baby zu sehen ist. Maline hebt das Bild an und schaut auf die Rückseite. Keine Beschriftung. Sie nimmt eine Postkarte von der Wand, die mit einer Stecknadel über der Spiegelkachelleiste befestigt wurde. Darauf ist eine Ausgrabungsstätte zu sehen.
»Das ist Göbekli Tepe«, sagt Tillmann. »Archäologen graben da seit 1994. Angeblich sollen dort schon im siebten Jahrtausend vor Christus Menschen gesiedelt haben. Ich bin vor ein paar Jahren mit meiner Frau in Şanlıurfa gewesen, das ist da ganz in der Nähe. Die Gegend ist unheimlich schön. Wir waren immer richtige Türkei-Fans.«
Auf der Rückseite stehen Demirkans Anschrift und einige Sätze: »Sevgili Amca, yazý için teþekkürler. Ben iyiyim. Anne ve baba da. Sana günes gönderiyom. Selamlar Hatice.«
»Türkisch kann ich nicht«, sagt Tillmann schulterzuckend.
Jetzt beginnen sie mit der ersten Leichenschau.
Maline tastet den Schädel des Verstorbenen nach Wunden ab, schaut ihm in die Ohren. Im Mundraum finden sich Reste des Erbrochenen. Gemeinsam drehen die Ermittler den Toten auf den Rücken. Sie gehen die Beschaffenheit der Kleidung durch, schauen, ob die Reißverschlüsse geschlossen oder beschädigt, ob Knöpfe abgerissen sind und sie offensichtliche Anhaftungen an seinen Schuhen ausmachen können. Maline leert den Tascheninhalt der Hose. Darin befinden sich zwei Papiertaschentücher, fünf Cent und eine Rolle Nähgarn.
»Was hast du bisher über ihn in Erfahrung gebracht?«, fragt sie, während Tillmann Demirkan das Oberhemd auszieht.
»Er ist siebenundsiebzig und in dieser Wohnung gemeldet.«
Maline öffnet den Reißverschluss seiner Hose und streift sie ihm vorsichtig hinunter. Kotgeruch schlägt durch. Offenbar hat der Verstorbene durch die Erschlaffung des Schließmuskels Exkremente ausgeschieden. Die blau-rötlichen Totenflecken sind ausgeprägt, fehlen an den Auflagestellen und entsprechen damit dem typischen Erscheinungsbild.
»Ist er verheiratet?«
»Laut Einwohnermeldeamt verwitwet.«
»Kinder?«
»Bisher keine Erkenntnisse.« Tillmann zeigt mit dem Kinn zum Festnetztelefon, das auf der Fensterbank steht. »Unter dem Apparat klebt ein Zettel, darauf sind die Erreichbarkeiten verschiedener Ärzte, diverse Notruf- und zwei Handynummern notiert, die ich gewählt habe, allerdings ohne Erfolg.«
»Hast du irgendwo ein Mobiltelefon gesehen?«
»Nein.«
Maline dreht den Körper auf die Seite, um einen Blick auf den Rücken zu werfen. Auch hier sind Totenflecken deutlich sichtbar. Offene Wunden, Hämatome, physische Abnormitäten oder Tattoos kann Maline dagegen nicht ausmachen. Der Fäkaliengeruch ist extrem.
Tillmann deutet auf eine Narbe, die sich quer über den rechten Oberschenkel zieht. Wulstig, erhaben und hellrot.
»Eine typische OP-Narbe«, bemerkt Maline. »Wer hat die Leiche gefunden?«
»Genau genommen eine Katze.«
»Wie bitte?«
»Die Wohnungstür stand offen«, sagt Tillmann. »Die Nachbarskatze ist hereingehuscht und ihre Besitzerin hinterher. Die alte Frau ist fix und fertig.«
»Er soll sich bei geöffneter Tür das Leben genommen haben?«
»Ja, kaum zu glauben, oder?«
Maline betrachtet Demirkans Arme. Am rechten Handgelenk fallen ihr leicht gerötete Stellen auf.
»Dabei könnte es sich einfach um eine Hautirritation handeln«, sagt Tillmann, und gleichzeitig klingelt sein Smartphone.
»Es ist Demirkans Tochter.« Er überreicht Maline das Handy.
»Hier ist Sibel Demirkan. Sie haben versucht, mich anzurufen?«
Maline zögert. Das Übermitteln einer Todesnachricht sollte nicht übers Telefon erfolgen. »Frau Demirkan, sind Sie zu Hause? Ich möchte einen Streifenwagen vorbeischicken.«
»Warum? Ist was mit meinem Vater? Wenn ja, können Sie sich den Weg zu mir sparen. Hatte er einen Herzinfarkt, oder hat er sich am Ende totgesoffen?«
»Dazu kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts sagen. Die Staatsanwaltschaft wird eine Obduktion anordnen, damit die Todesursache zweifelsfrei geklärt werden kann.«
»Spielt das eine Rolle? Tot ist tot, meinen Sie nicht?«
»Für gewöhnlich möchten die Hinterbliebenen wissen, wie ihre Angehörigen gestorben sind.«
»Mich interessiert es nicht, und mir ist es völlig egal, was Sie von mir denken.«
»Es ist mein Job, herauszufinden, ob Fremdverschulden vorliegt, und dazu gehört eine umfassende Ermittlungsarbeit.«
»Dann wird er wohl kaum innerhalb von vierundzwanzig Stunden unter die Erde kommen«, stöhnt Sibel Demirkan.