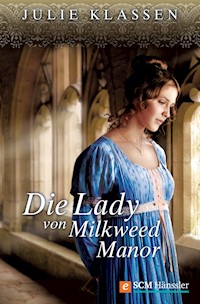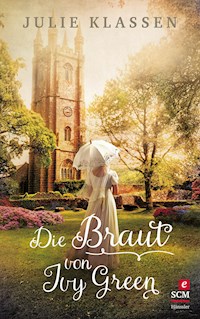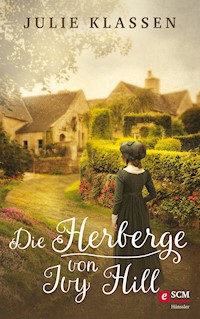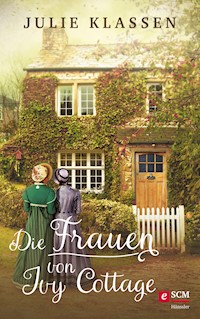Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler im SCM-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency-Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Captain Stephen Overtree reist an die Küste von Devon, um seinen Bruder Wesley zu finden. Doch er stellt entsetzt fest, dass sich Wesley abgesetzt hat und Sophie, die Tochter seines Gastgebers, in einer unmöglichen Situation zurückgelassen hat. Stephen fühlt sich verpflichtet zu handeln und macht Sophie einen Heiratsantrag, um ihre Ehre zu retten. Sophie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer großen Liebe und diesem finsteren Mann, den sie kaum kennt. Soll sie auf Wesley warten? Oder Stephens Antrag annehmen und hoffen, dass sie dies nicht bereut? Der neue Roman der Erfolgsautorin Julie Klassen - eine fesselnde Geschichte über Ehre und Vergebung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ISBN 978-3-7751-7336-0 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5717-9 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2016SCM-Verlag GmbH & Co. KG · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-verlag.de · E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: The Painter’s DaughterCopyright © 2015 by Julie KlassenPublished by Bethany House, a division of Baker Publishing Group,Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.Cover art used by permission of Bethany House Publishers.All rights reserved. This Work published under license.
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.
Übersetzung: SuNSiDe, ReutlingenUmschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im SchönbuchTitelbild: Mike Habermann PhotographySatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Für Anna PaulsonIn Liebe
»Ich habe Mr Rochester geheiratet.Die Trauung fand in aller Stille statt,außer meinem Mann und mir waren nurder Pfarrer und sein Ministrant zugegen.«Jane Eyre, von Charlotte Brontë
Herr, wer darf in dein Heiligtum kommenund dich auf dem heiligen Berg anbeten? (…)Ein Mensch, der (…) seine Versprechen hält,auch wenn es ihm schadet.Psalm 15
Inhalt
Über die Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Epilog
Nachwort der Autorin
Anmerkungen
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
Julie Klassen ist Autorin von zehn Romanen aus der Zeit von Jane Austen, von denen drei den begehrten Christy-Award gewannen. Ihre Geschichten voller Spannung und Romantik begeistern Leserinnen in vielen Ländern. Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie in Minnesota (USA).
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 1
März 1815Devonshire, England
»Diese vermaledeiten Künstler …«, schimpfte Captain Stephen Marshall Overtree vor sich hin, während er durch das Hafenviertel der ihm fremden Stadt irrte und die Auslagen in den Schaufenstern betrachtete.
Hin und wieder blickte er auf das zusammengeknüllte Stück Papier in seiner Hand und las aufs Neue die hastig hingekritzelte Nachricht seines Bruders.
… Ich werde mir ein Cottage mieten, so wie letztes Jahr, aber ich weiß noch nicht genau, wo. Falls nötig, kannst du mir schreiben zu Händen von Mr Claude Dupont, Lynmouth, Devon. Aber ich bin sicher, dass du wunderbar ohne mich zurechtkommst, Marsh. Wie immer.
Stephen steckte die Notiz wieder ein und musterte die Gebäude, an denen er vorüberging: ein Pub, das Hafenamt, ein Tabakwarenladen, ein Weinhändler. Plötzlich fiel sein Blick auf ein stilvolles Schild:
CLAUDE DUPONT
Maler, Royal Academy of Arts
–
Porträts und Landschaften als Auftragsarbeiten
Unterricht und Materialien für Künstler auf Studienreise
Nachfrage bitte im Laden
Stephen drückte den Türgriff, doch er bewegte sich nicht. Er legte eine Hand an die Glasscheibe und spähte ins Ladeninnere. Im Dämmerlicht konnte er Staffeleien, gerahmte Landschaftsgemälde und Regale mit Malerutensilien erkennen, doch ein Mensch war nicht zu entdecken.
Er unterdrückte einen weiteren Fluch. Wie sollte er drinnen nachfragen, wenn die verflixte Tür verschlossen war? Hielt der Besitzer sich denn nicht an Öffnungszeiten? Jetzt konnte Stephen sich eine weitere Unfreundlichkeit über Künstler nicht verkneifen.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie eine ungepflegte Frau aus dem Pub trat und einen Eimer Wasser ausgoss, und rief ihr zu: »Ich suche Wesley Overtree. Haben Sie ihn vielleicht gesehen?«
»Sie meinen sicher den jungen Adonis?« Sie zwinkerte ihm zu. »Nein, Sir. Jedenfalls heute noch nicht.«
»Wissen Sie, wo er wohnt?«
»In einem der Cottages am Hang, glaube ich, aber fragen Sie mich nicht, in welchem.«
»Ah ja. Und was ist mit Mr Dupont?« Stephen deutete auf die verschlossene Tür.
»Mr Dupont ist nicht da, Sir, aber seine Tochter habe ich vor knapp fünfzehn Minuten noch gesehen. Ich nehme an, sie war auf dem Weg zum Valley of the Rocks, wie fast jeden Tag um diese Zeit …« Die Frau deutete auf einen Weg auf der anderen Seite des großen Platzes, der den Hang hinaufführte und dann nicht mehr weiter zu sehen war.
»Gehen Sie einfach diesen Weg hinauf. Sie können Ihr Ziel gar nicht verfehlen.«
»Danke.«
Stephen blieb noch einen Moment stehen und blickte in die Richtung, die die Frau ihm gewiesen hatte – hier und da klammerten sich strohgedeckte Cottages und auch ein paar größere Häuser an den bewaldeten Hang. Ganz oben thronte Lynton, die Zwillingsstadt Lynmouths. Vielleicht hätte er doch die Kutsche behalten sollen, der Anstieg nach Lynton zog sich mindestens über eine halbe Meile. Er seufzte. Jetzt war es zu spät.
Er ging ein Stück die Uferpromenade entlang und bog dann ab auf den Weg landeinwärts, der den Hang hinaufführte. Zum Glück hatte er seinen Spazierstock mitgenommen, in dessen Inneren praktischerweise ein schlanker Degen versteckt war. Man wusste nie, ob man auf Reisen Straßenräubern begegnete, und er zog es vor, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Seine militärische Ausbildung hatte ihre Spuren hinterlassen.
Er geriet auf dem steilen Pfad schon bald außer Atem. Eigentlich hatte er angenommen, über eine bessere Kondition zu verfügen. Der eine Monat Lotterleben, fern von seinem Regiment und dem ständigen Drill, hatte bereits seinen Tribut gefordert. Er würde erst einmal ein paar deutliche Worte mit Wesley reden müssen, wenn er ihn gefunden hatte. Stephens Platz war bei seinem Regiment, nicht zu Hause, um Wesleys Pflichten zu erfüllen, und auch nicht hier.
Er lief zwischen den Bäumen hindurch und trat schließlich ins Freie hinaus. An dieser Stelle beschrieb der steinige Weg einen Bogen nach Westen und verlief weiter an den Klippen entlang, hoch oben über dem Bristol Kanal, der tiefblau und grau unter ihm leuchtete. Der steil abfallende Hang war mit vertrocknetem Gras und struppigem Ginster bedeckt. Hier und dort sah man einen verkrüppelten Jungbaum, der mit Sicherheit keinen Halt bot, wenn man stürzte. Wer hier ausglitt, fiel ungehindert vier- oder fünfhundert Fuß weit nach unten in das eiskalte Wasser. Bei diesem Gedanken wurde ihm übel.
Die Prophezeiung seiner alten Kinderfrau fiel ihm ein: »Du wirst nicht lange genug leben, um dein Erbe anzutreten …« Er spürte noch den Klammergriff ihrer Hand und sah das düstere Glimmen in ihren Augen.
Mit einem Schaudern wandte er den Blick vom Abgrund und ging weiter.
Der Schrei eines Seevogels ließ ihn aufblicken. Die Möwen schwangen sich hoch in die Luft, getragen vom Aufwind. In den Felsvorsprüngen nisteten schwarzweiße Tordalken und graugeflügelte Klippenmöwen.
Er marschierte zehn oder fünfzehn Minuten zügig weiter, ohne die junge Frau irgendwo auf dem Weg vor sich zu erblicken. Hoffentlich hatte er keine Abzweigung übersehen. Während er weiterging, schien die Temperatur zu fallen. Hier an der Südwestküste kam der Frühling zwar früher, doch in dem Wind, der aus dem Norden über den Kanal blies, spürte man noch immer die Eiseskälte des Winters.
Er zog den Hut tiefer in die Stirn und stellte den Kragen seines Mantels, eines Paletots, auf. In knapp zwei Wochen würde er die Zivilkleidung wieder gegen seine Uniform tauschen, zu seiner Pflicht zurückkehren und seinen Großvater stolz machen. Doch zuerst musste er Wesley finden und nach Hause schicken. Da Humphries in Rente gehen wollte, brauchte Papa Hilfe bei der Betreuung des Anwesens. Ihr Vater war gesundheitlich nicht auf der Höhe und benötigte einen fähigen Vertreter, der sich um die Pächter kümmerte und die Arbeiter bei der Stange hielt – eine Aufgabe, die Stephen, der Captain in der britischen Armee war, leichtfiel, doch sein Urlaub war bald zu Ende, woran auch die Tatsache, dass Napoleon jetzt im Exil war, nichts änderte.
Die Pflichten zu Hause auf dem großen Gut wären eigentlich Sache seines älteren Bruders gewesen, doch Wesley hatte verkündet, den Winter im Süden verbringen zu wollen, entgegen aller Bitten ihrer Mutter. Seine Kunst stehe an erster Stelle, verkündete er immer. Die praktischen, alltäglichen Arbeiten überließ er meist anderen.
Stephen bog um eine Kurve und stand vor einer felsigen Landzunge: riesige Quader, die wie zu einer Befestigungsanlage aufeinandergetürmt waren und an deren Rand die Klippen nahezu senkrecht bis in die peitschende Strömung unter ihm hinabfielen. Er blickte nach unten, um zu sehen, wo er hintrat, doch ein plötzliches Aufblitzen von Farbe ließ ihn wieder aufschauen.
Bei dem Anblick, der sich ihm bot, musste er tief durchatmen. Am Rand des Abgrunds stand eine Gestalt, deren Röcke vom Wind aufgebläht waren, mit wehendem Cape und einem Strohhut mit breitem Rand auf dem Kopf. Hinter ihr der Fels, vor ihr die Klippen, verharrte sie gerade aufgerichtet und hatte den einen Fuß leicht über den Rand gestreckt. Was hatte diese verrückte Frau vor?
In diesem Augenblick sank sie auf die Knie und streckte eine behandschuhte Hand aus – versuchte sie, irgendetwas zu fassen zu bekommen, oder wollte sie sich hinunterstürzen? Wollte sie sich tatsächlich umbringen?
Mit pochendem Herzen rannte Stephen los. »Halt! Nicht!«
Sie schien ihn in dem tosenden Wind nicht zu hören. Als er oben war, sah er, dass sie versuchte, ein Stückchen Papier zu erreichen, das sich in dem stacheligen Ginster verfangen hatte.
»Bleiben Sie stehen, ich hole es Ihnen.«
»Nein«, rief sie, »nicht!«
Da er glaubte, dass sie nur um seine Sicherheit besorgt sei, streckte er seinen Spazierstock aus und zog das Papier damit den Hang hinauf. Dann bückte er sich und griff nach einer Ecke des kompakten Rechtecks – es war eine Zeichnung. Ihm stockte der Atem.
Er drehte sich um und starrte in das tränenüberströmte Gesicht unter der breiten Krempe des Hutes, dann wieder auf die Zeichnung in seiner Hand. Das Bild zeigte das Antlitz der Frau vor ihm, einer Frau, deren Gesicht ihm wohlbekannt war, denn er hatte ihr Porträt das ganze letzte Jahr bei sich getragen – in einem Jahr voller Drill und Kampf – und es im Schein so manchen Lagerfeuers hervorgeholt und betrachtet.
Ein Windstoß riss ihr den Hut vom Kopf. Die Bänder legten sich fest um ihre Kehle, der Hut selbst hing auf ihrem Rücken. Dichte goldene Locken wurden vom Wind angehoben und peitschten gegen ihr schmales, herbes Gesicht. Traurige blaugraue Augen blinzelten in das sterbende Sonnenlicht.
»Sie … Sie sind es?«, stammelte er.
»Verzeihung?« Sie sah ihn stirnrunzelnd an. »Sind wir uns schon … begegnet?«
Er räusperte sich und riss sich zusammen. »Nein. Das heißt, das Bild … es ist nur die Ähnlichkeit.« Er hielt das Porträt hoch und jetzt erkannte er auch den Stil: Es war eindeutig eine Arbeit seines Bruders.
Statt ihm zu danken, verzog sie das Gesicht. »Warum haben Sie das getan? Ich wollte es vernichten, auslöschen, in alle vier Winde verstreuen. Ich will es nicht mehr.«
»Warum?«
»Geben Sie es her.« Sie streckte die Hand aus.
»Nur, wenn Sie mir versprechen, es nicht zu zerstören.«
Ihre Lippen wurden ganz schmal. »Wer sind Sie?«
»Captain Stephen Overtree.« Er gab ihr die Zeichnung. »Und Sie müssen Miss Dupont sein. Ich glaube, Sie kennen meinen Bruder.«
Sie starrte ihn kurz an, dann wandte sie den Blick ab.
»Er hat ein Cottage von Ihrer Familie gemietet. Ich war unten beim Atelier, aber es war geschlossen. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann?«
»Da kann ich Ihnen leider nicht helfen«, sagte sie. »Er ist abgereist. Er befindet sich auf dem Weg nach Italien, auf der Suche nach der perfekten Muse – nach seiner Dulcinea oder Mona Lisa …« Sie blinzelte erneut die Tränen fort, drehte das Bild um und hielt ihm ein paar flüchtig hingekritzelte Zeilen unter die Augen. Es war die Handschrift seines Bruders.
Er las:
Meine liebe Miss Dupont,das italienische Paar auf Reisen, dem wir begegnet sind, hat mich eingeladen, sie in ihre Heimat zu begleiten. Ich kann in ihrer Villa wohnen und nach Herzenslust malen. Es war ein spontaner Entschluss, ich konnte einfach nicht widerstehen. Sie wissen doch, wie sehr ich Italien liebe! Wir reisen in einer Stunde ab.
Ich weiß, dass ich mich hätte persönlich verabschieden sollen, und habe auch versucht, Sie zu finden, aber Sie waren nicht da. Zum Glück weiß ich, dass Sie, die Sie ebenfalls Künstlerin sind, mich verstehen und wissen, dass ich meiner Muse und Leidenschaft folgen muss. Ich muss diese Gelegenheit beim Schopf packen, bevor sie mit der Flut auf und davon ist.
Wir zwei hatten eine wunderbare Zeit. Ich werde immer gern an Sie zurückdenken.
Arrivederci
W. D. O.
Himmel noch mal!, schäumte Stephen im Stillen. Wie sollte er seinen Bruder jetzt nach Hause schicken?
»Und er hat keine Nachsendeadresse hinterlassen?«, fragte er. »Oder vielleicht sogar einen bestimmten Hafen oder eine Stadt genannt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Mir jedenfalls nicht. Ich glaube, das Paar, das er erwähnt, stammt aus Neapel, aber da bin ich nicht sicher.«
»Ist Leutnant Keith mit ihm mitgefahren?«
»Carlton Keith, meinen Sie? Ich glaube schon. Sie schienen ja überall zusammen hinzugehen.«
Stephen nickte. »Wissen Sie zufällig, ob mein Bruder alle seine Besitztümer mitgenommen hat?«, fragte er in dem Versuch herauszufinden, ob Wesley vorhatte, nach Lynmouth zurückzukehren.
Wieder schüttelte sie den Kopf. »Als ich heute Morgen nachsah, habe ich zu meiner Überraschung gesehen, dass er viele von seinen Bildern dagelassen hat, und auch seinen Wintermantel.«
»Und er hat Ihrem Vater nicht gesagt, dass er abreisen wollte?«
»Mein Vater hat einen Auftrag und ist nach Bath gefahren. Wir haben angenommen, dass Ihr Bruder das Frühjahr über bleiben wollte. Deshalb war ich so … überrascht … als ich seine Nachricht fand.«
War das wirklich der Grund gewesen? Der einzige Grund? Stephen glaubte ihr nicht. Ihre Tränen und Wesleys rechtfertigende Zeilen erzählten etwas anderes. Miss Dupont hatte sich in Wesley verliebt. Ganz bestimmt hatte er sie mit seinem Charme umgarnt und dann sitzengelassen, als sie anfing, ihn zu langweilen. Vielleicht hatte er sie sogar eine gewisse Zeit lang geliebt oder doch zumindest bewundert. Wie weit mochte die Geschichte gegangen sein? Hatte er mehr getan, als ihr das Herz zu brechen? Stephen graute bei dem Gedanken.
Er fragte: »Darf ich das Cottage sehen?«
Sie warf den Kopf zurück. »Warum?«
»Ich würde mich gern umsehen – nachschauen, ob ich einen Hinweis darauf finde, wo genau er hingefahren ist. Ich muss versuchen, ihn in Italien zu erreichen.«
»Oh …« Sie dachte nach, dann sagte sie forsch: »Sie könnten den Hafenmeister fragen, ob er weiß, wohin das Schiff ausgelaufen ist.«
»Das werde ich tun, vielen Dank. Trotzdem würde ich das Cottage gern sehen.«
Sie biss sich auf die Lippen, dann sagte sie stockend: »Ich … ich glaube nicht, dass Bitty schon dort war und aufgeräumt hat. Vielleicht könnten Sie …«
»Das macht nichts. Ich habe wenig Zeit, wenn ich also bitte …«
Sie holte tief Luft. »Nun gut.«
Miss Dupont kletterte von dem Felshang herunter, flink und trittsicher wie ein junges Mädchen, obwohl sie bestimmt schon Anfang zwanzig war. Sie deutete auf einen Weg auf der anderen Seite der Landspitze, nicht den Pfad, den er gekommen war. »Hier entlang ist es kürzer«, erklärte sie.
Er ging mit und fühlte sich wie ein grober Klotz neben ihrer zarten Gestalt. Sie führte ihn nach Lynton hinein, in die höher gelegene der beiden Zwillingsstädte, am Schmied, der Pferdestation und der alten Kirche vorbei, und bog dann ab auf einen gepflasterten Weg, der ein Stückchen den Hügel hinunterführte. Dort schmiegten sich drei weiß getünchte Cottages an den Hang, hoch über dem Hafen von Lynmouth mit dem schimmernden Kanal dahinter.
Vor dem ersten Cottage angelangt, löste sie die Chatelaine von ihrem Rock, suchte den richtigen Schlüssel heraus, schloss dann die Tür auf und trat ein.
Stephen war überrascht, mit welcher Unbefangenheit die junge Frau das Cottage eines Junggesellen betrat, zumal ihr Auftreten und ihre Sprache gerade eben noch die einer Lady gewesen waren. Er trat hinter ihr ein und ließ der Schicklichkeit wegen die Tür offen. Dann schlenderte er durch den einzigen Raum, aus dem das Cottage bestand. Dabei fiel ihm auf, dass sie sich genauso aufmerksam umsah wie er: Es wirkte, als suche sie etwas. Vielleicht gab es hier irgendetwas, das er nicht sehen sollte? Er entdeckte ein paar Künstlerutensilien: eine Staffelei, gebrauchte Farbtöpfe, Leinwände und Skizzenbücher. An einer Wand standen ein Tisch, ein paar Stühle und ein einfacher Ofen, an der anderen ein ungemachtes Bett. Sein Blick glitt hinüber, dann sah er rasch wieder fort.
Sie nahm rasch einen Spitzenhandschuh von einer Stuhllehne und versuchte, ihn unter dem Ärmel ihres Kleides verschwinden zu lassen. Als sie seinen Blick sah, murmelte sie: »Ich muss ihn fallen gelassen haben, als ich vorhin vorbeischaute …«
Er betrachtete das paar zusammenpassender Handschuhe, die sie trug, sagte jedoch nichts. Dann sah er die Bilder durch, die an der Wand lehnten, und blätterte auch in dem Skizzenbuch, das auf dem Tisch lag. Immer das gleiche, vertraute Gesicht – ihr Gesicht – schaute ihn mit wechselndem Ausdruck an. Anfangs ernst und zögernd, dann zunehmend vertrauensvoller, mit einem schüchternen ersten Lächeln und schließlich mit einem lachenden, strahlenden Ausdruck. Ebenso wechselte auch ihre Kleidung – die sittsamen Spitzenkrägen gingen über in tiefe, runde Ausschnitte, und am Schluss sah er sogar eine nackte Schulter.
Miss Dupont griff an ihm vorbei nach dem Skizzenbuch und schlug es zu. Ihre Wangen waren tiefrot geworden. »Ja, ich habe ihm mehrmals Modell gesessen.« Sie klang defensiv. »Er war sehr beharrlich. Ich hatte so etwas noch nie getan – nicht einmal für meinen Vater, und es war mir sehr unangenehm. Aber Sie können sich sicher vorstellen, dass die Auswahl an Modellen an diesem abgelegenen Ort nicht gerade groß ist.«
Stephen stöhnte innerlich auf. Ihm wurde schon wieder übel. Also doch. Das Ganze war zu weit gegangen. Wesley hatte mehr getan, als diesem Mädchen das Herz zu brechen. Sie war noch unschuldig gewesen. In diesem Punkt war er sich sicher.
Er fragte: »Hat Leutnant Keith ebenfalls hier gewohnt?«
»Ja. Wir haben angeboten, ein zweites Bett hereinzustellen, doch er meinte, er zöge seinen Schlafsack vor.« Sie sah sich im Zimmer um. »Ich sehe ihn nicht. Er muss ihn mitgenommen haben.«
Ja, das klang ganz nach Keith, dachte Stephen. »Ich nehme nicht an, dass mein Bruder Anweisungen hinterlassen hat, was mit seinen Sachen geschehen soll, oder die Miete für das Cottage bezahlt hat, bis er zurückkommt?«
»Nein. Er hat nur den laufenden Monat bezahlt.«
Stephen stellte im Kopf eine rasche Berechnung an. Eine Seereise nach Italien konnte zwei bis drei Wochen dauern, für einen Weg, je nach Wetter und Windverhältnissen. Ganz zu schweigen davon, wie lange Wesley dort bleiben wollte, um zu malen. Was hatte Keith sich dabei gedacht, ihn gehen zu lassen? Einfach ohne ein Wort zu verschwinden! Aber vielleicht war ja bereits ein Brief auf dem Weg nach Overtree Hall.
Stephen seufzte. »Ich werde seine Sachen zusammenpacken und sie irgendwie nach Hause befördern.«
Sie nickte abwesend. »Wir haben wahrscheinlich eine passende Kiste im Atelier. Kommen Sie. Ich bitte Papas Assistenten, Ihnen zu helfen.«
»Danke.«
Sie bot ihm an, im Cottage zu übernachten, da sein Bruder dafür bezahlt hatte. Er lehnte höflich ab, da er sich bereits ein Zimmer im Rising Sun genommen hatte, wo ein warmes Abendessen auf ihn wartete.
Er bedeutete ihr vorauszugehen. »Ich begleite Sie zurück.«
Sie wanderten im Sonnenuntergang den gewundenen Weg zurück nach Lynmouth.
»Ach übrigens«, sagte sie, »Ihr Bruder hat nie einen Bruder namens Stephen erwähnt, nur einen ›Marsh‹ – dem Anschein nach ein wahres Monster.«
Stephen verzog das Gesicht. Er wusste genau, dass die Narbe in seinem Gesicht ihn dadurch noch mehr wie ein Monster aussehen ließ. Er erklärte: »Mein zweiter Name ist Marshall. Er nennt mich Marsh – einer seiner vielen Spitznamen für mich. Einschließlich Captain Black.«
»Oh – tut mir leid, ich …«
»Keine Ursache, es ist eine durchaus passende Beschreibung.«
Als sie zum Atelier am Hafen kamen, schloss Miss Dupont mit einem anderen Schlüssel die Tür auf. Stirnrunzelnd lauschte sie in das dämmerige, stille Innere. »Maurice sollte eigentlich mindestens bis um fünf Uhr die Lichter brennen und die Tür offenlassen, aber es sieht so aus, als sei er schon seit Stunden fort.«
»Wohnen Sie hier?«, fragte Stephen.
»Wir haben ein Haus in Bath, aber wenn wir in Lynmouth sind, wohnen wir in der Wohnung über dem Laden. Wenn mein Vater nicht da ist, wohne ich allerdings bei einer Nachbarin, Mrs Thrupton.«
Er las zwischen den Zeilen. »Ist der Gehilfe Ihres Vaters ein Junge oder ein verheirateter Mann?«
»Weder noch.«
»Ah.« Er nickte. Unverständlicherweise war er erleichtert, dass sie offenbar doch auf ihren guten Ruf achtete.
Ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren kam auf Strümpfen die Treppe herunter. Er trug eine Hose, ein zerknittertes Hemd und eine Weste, aber keine Jacke. Sein dunkles Haar war zerzaust, als sei er gerade aufgestanden.
»Bringst du mir etwas zu essen?«, fragte er. »Ich bin am Verhungern.«
»Ich fürchte, da bist du auf dich selbst angewiesen«, antwortete sie, nahm ihren Hut ab und zog die Handschuhe aus.
»Wer ist das?« Der junge Mann deutete mit einer überheblichen Bewegung des Kinns zu Stephen hinüber.
»Das ist Captain Overtree, Mr Overtrees Bruder. Captain – Maurice O'Dell, der Assistent meines Vaters.«
»Noch ein Overtree? Das ist wirklich mein Glückstag«, sagte er sarkastisch. »Und was will der hier?«
»Er will die Sachen abholen, die sein Bruder im Cottage zurückgelassen hat. Ich möchte, dass du ihm hilfst.«
»Ich … ich habe gehört, dass er abgereist ist«, sagte O'Dell. »Gut, dass wir ihn los sind, wenn du mich fragst.«
Miss Dupont sagte kühl: »Das habe ich aber nicht.«
Stephen musterte den jungen Mann eindringlich, ebenso wie er einen Gegner einzuschätzen pflegte. Er war kaum größer als Miss Dupont, aber deutlich stämmiger. Seine hervortretenden dunklen Augen und die aufgeworfene Nase erinnerten ihn an einen schlecht erzogenen Mops, der einen größeren Hund angeht.
O'Dell wandte sich zu ihm um, die wulstigen Lippen gekräuselt. »Ich bin hier nicht nur Assistent, ich gehöre zur Familie. Ich bin Claude Duponts Neffe.«
»Durch Heirat, ja«, erläuterte sie. »Mein Vater hat vor ein paar Jahren Maurices Tante geheiratet.«
»Ich werde nicht immer Drucke herstellen«, meinte O'Dell. »Ich bin selbst Künstler. Eines Tages werde ich berühmt sein. Sie werden schon sehen.«
»Schade, dass ich nicht so lange Zeit habe«, sagte Stephen trocken. »Wenn ich Sie jetzt um eine Kiste und den Namen der hiesigen Frachtgesellschaft bitten dürfte …?«
»Im Vorratsraum stehen mehrere Kisten«, sagte Miss Dupont. »Maurice, würdest du bitte dafür sorgen, dass die größte zum ersten Cottage gebracht wird?«
»Gern, aber erwarte nicht, dass ich helfe, die Hinterlassenschaft dieses Fatzkes einzupacken.«
»Dann pass bitte morgen Vormittag auf den Laden auf, während ich helfe.«
Sie wandte sich an Stephen. »Wann treffen wir uns?«
»Ich bin Frühaufsteher. Sagen wir, um acht – oder neun, wenn es Ihnen lieber ist.«
»Acht ist in Ordnung. Bis morgen.«
Stephen zögerte. »Ist … ist alles in Ordnung oder soll ich Sie noch zu der Nachbarin bringen, von der Sie sprachen?«
»Ich komme allein zurecht, vielen Dank.«
Sophia Margaretha Dupont blickte dem schwarzhaarigen, breitschultrigen Fremden nach. Sie konnte kaum glauben, dass er tatsächlich mit Wesley Overtree verwandt war. Dem schönen Herzensbrecher Wesley.
Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass ihr Verhältnis sich geändert hatte. Heute Morgen war sie wie gewöhnlich zum Cottage gekommen, lächelnd, mit Schmetterlingen im Bauch vor Glück, voller Vorfreude auf das Wiedersehen und ganz in Gedanken darüber versunken, wie sie ihm die Neuigkeit beibringen sollte – um dann festzustellen, dass das Cottage leer stand und er lediglich eine Nachricht hinterlassen hatte. Das Lächeln war ihr schlagartig vergangen. Ihr Magen verkrampfte sich vor Furcht. Was hatte sie falsch gemacht?
Sie wusste, dass die Männer es nicht mochten, wenn man sie bedrängte, also hatte sie ihn nicht bedrängt. Hatte er einfach das Interesse an ihr verloren, oder hatte er gemerkt, dass sie nicht schön genug für ihn war – weder als Modell noch als Frau?
Sie hatte den geretteten Brief noch einmal gelesen und die Schlussfolgerung schien unvermeidlich: Wesley hatte nicht nur Lynmouth überraschend verlassen, sondern auch sie. Sie drehte das Blatt um und war erneut beinahe erschrocken, dass er die Nachricht auf eins der Dutzende von Bildern geschrieben hatte, die er von ihr gemalt hatte. Offenbar ein paar Dutzend zu viel.
Sophie lehnte sich an den Tisch im Atelier. Sie fühlte sich plötzlich ausgelaugt und todmüde. Dieser Tag war der schlimmste ihres gesamten Lebens gewesen, mit Ausnahme jenes Tages, vor langer Zeit, an dem ihre Mutter gestorben war. Bei diesem Gedanken tastete sie vorsichtig nach dem Ring, den sie an einer Kette um den Hals trug, dicht an ihrem Herzen.
Nicht nur, dass Wesley fort war und mit ihm ihre letzte Hoffnung, glücklich zu werden, sondern sie hatte auch noch das demütigende Gespräch mit seinem Bruder erdulden müssen. Der harte, wissende Ausdruck im Gesicht des Mannes hatte ihr die widerliche Gewissheit gegeben, dass er die Wahrheit erraten hatte – dass das Modellstehen nicht der Schwerwiegendste ihrer Fehltritte gewesen war.
Sie erinnerte sich gut daran, wie Wesley seinen mürrischen, ewig missbilligenden Bruder Marsh beschrieben hatte. »Captain Black würde einen Mann niederschlagen, bevor er ihm zuhört«, hatte er gesagt. Dabei war vor ihrem inneren Auge das Bild eines übellaunigen, hartgesottenen Soldaten erstanden, eines Mannes, der Schreckliches gesehen – und wahrscheinlich auch Schreckliches getan hatte.
Captain Overtree sah wirklich grimmig aus, mit dieser gezackten Narbe, die durch seinen buschigen Backenbart und seine langen dunklen Haare kaum verborgen wurde. Trug er den Spitznamen »Captain Black« wegen seiner Haarfarbe oder wegen seiner grüblerischen Persönlichkeit? Vielleicht war beides zusammen der Grund. Er war größer als Wesley – bestimmt fast einen Meter neunzig – und sein markantes Gesicht wies weder die Feingliedrigkeit noch die Vollkommenheit von Wesleys Zügen auf. Nur seine Augen waren beeindruckend. Strahlend blau. Wesleys Augen waren hellbraun. Sie hätte nie gedacht, dass sein Bruder so blaue Augen haben könnte.
Ihr kurzer Vergleich der beiden Brüder trat zurück vor der unbarmherzigen Erkenntnis ihrer eigenen, zutiefst beängstigenden Situation. Sie hatte keine Zeit, über so triviale Dinge nachzudenken, nicht jetzt, da ihr ganzes Leben auf dem Spiel stand und sich bald alles für immer verändern würde.
Seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie nicht oft über Gott nachgedacht. Die Kirche hatte während ihrer gesamten Kindheit keine große Rolle gespielt. Doch in den letzten Wochen hatte sie so viel gebetet wie noch nie, in der Hoffnung, dass das, was sie befürchtete, nicht wahr war.
Jetzt hatten sich ihre Bitten geändert. Sie war so sicher gewesen, dass Wesley sie heiraten würde, doch jetzt war er fort. Und selbst wenn er zurückkam – würde es rechtzeitig genug sein, um sie und ihren Ruf zu retten? Bitte, Gott, lass ihn rechtzeitig zurückkommen …
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 2
Am nächsten Morgen stand Stephen zeitig auf und frühstückte. Er verspürte eine innere Unruhe und darum fragte er den Gastwirt nach der nächstgelegenen Kirche. Dort ging er hin, um zu beten. Als junger Mann und jüngerer Sohn hatte er einst gehofft, seine Berufung in der Kirche zu finden. Doch sein Großvater hatte andere Pläne mit ihm gehabt, und in gewisser Weise hatte das Militär Stephen Gott näher gebracht, als eine Laufbahn als Geistlicher es je vermocht hätte. Doch noch immer sehnte er sich danach, seinen Mitmenschen wahrhaft zu dienen.
In der feierlichen Stille des leeren Kirchenschiffs bat er Gott um Weisheit, was er wegen Wesley … und Miss Dupont unternehmen sollte. Und er betete auch darum, den Willen Gottes annehmen zu können, falls die Vorhersage seiner alten Kinderfrau richtig gewesen war. Sie hatte diese unselige Bemerkung ausgerechnet in dem Moment gemacht, in dem er Overtree Hall verließ. Die Szene stand ihm noch deutlich vor Augen …
Stephen, der gerade die Treppe herunterkam, blieb abrupt stehen, als er sah, dass Miss Whitney in der offenen Hintertür stand. Seine ehemalige Kinderfrau kam selten nach unten. Wollte sie sich von ihm verabschieden?
Er trat zu ihr. »Was ist denn los, Winnie? Ist alles in Ordnung?«
»Nein. Aber du oder ich können nichts daran ändern.« Die Frau seufzte. Dann blickte sie auf den Koffer in seiner Hand. »Willst du Wesley zurückholen?«
»Ja. Aber mach dir keine Sorgen. Kate wird nach dir sehen, solange ich fort bin. Es wird alles gut gehen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Du wirst ihn nicht ewig retten können, das weißt du genau.«
Sie schaute zur Tür hinaus. Er folgte ihrem Blick und sah überrascht, dass seine alte Freundin und Nachbarin Miss Blake durch den Garten ging.
»Der Wind schlägt um«, sagte Miss Whitney. »Ich spüre es in den Knochen.«
Stephen war verwirrt. »Ich verstehe nicht, Winnie. Aber ich fürchte, ich muss jetzt aufbrechen.«
Sie holte tief Luft und stieß sie langsam wieder aus. »Es ist nicht richtig.«
»Was ist nicht richtig?«
»Dass Wesley der Erbe ist, obwohl du die ganze Arbeit erledigst.«
Diese Klage hatte er schon oft gehört. »Mach dir keine Sorgen. Und vergiss nicht, dass ich das Treuhandvermögen von meinem Großvater bekomme, wenn ich dreißig werde.« Er lachte leise und neckte sie: »Wenn ich so lange lebe.«
»Nein. Ich glaube nicht, dass du das wirst«, sagte sie mit ernstem Gesicht. »Du wirst nicht lange genug leben, um dein Erbe anzutreten. Ich weiß Dinge, die ich lieber nicht wüsste. Die Welt ist verrückt geworden.«
Stephen runzelte die Stirn. »Wovon redest du?«
Ihre Augen schienen durch ihn hindurch in die Ferne zu blicken. »Er wird jeden nach seinen Werken belohnen.«
»Du sprichst von meiner Belohnung im Himmel? Nun hetz mich doch bitte nicht so.« Erneut versuchte er, die befremdlichen Worte der Frau mit einem Scherz abzutun, doch das seltsame Leuchten in ihren Augen war ihm unheimlich.
Sie packte ihn am Arm. »Sei bereit, mein Junge. Deine Zeit kommt.«
In diesem Moment stürzte seine Schwester in die Halle und winkte ihm lebhaft zu. »Stephen! Alle suchen dich! Roberts sagt, du musst jetzt gehen, sonst verpasst du die Kutsche.«
Stephen riss seinen Blick von Miss Whitney los und rief: »Ich komme!«
Doch seine alte Kinderfrau hielt ihn fest.
Stephen tätschelte ihre Hand. »Ich bin bald zurück, Winnie. Und es kommt alles in Ordnung – wie immer.«
»Nein. Mein lieber Stephen. Ich glaube nicht, dass die Dinge je wieder so sein werden wie früher. Bist du bereit, deinem Schicksal ins Auge zu sehen?«
Seine Kehle zog sich zusammen. Meinte sie wirklich das, was er befürchtete?
»Ja«, flüsterte er und entzog sich langsam ihrem Griff.
Jetzt saß er in der ihm unbekannten Kirche und Miss Whitneys Worte fielen ihm wieder ein: »Du wirst nicht lange genug leben, um dein Erbe anzutreten … Bist du bereit, deinem Schicksal ins Auge zu sehen?«
Seine ehemalige Kinderfrau hatte nie behauptet, das Zweite Gesicht zu haben oder besondere Offenbarungen von Gott zu empfangen, aber dennoch stimmten ihre Äußerungen ihn nachdenklich. Er erinnerte sich an zahllose Ereignisse im Laufe der Jahre, in denen sie Dinge gewusst hatte, die sie eigentlich nicht hatte wissen können, oder etwas vorausgesagt hatte, was später tatsächlich eingetroffen war. Er vertraute ihr – sie hatte sich noch nie in irgendetwas geirrt. Doch gleichzeitig glaubte Stephen an Gott und wusste, dass sein Schicksal in Gottes Hand stand. Er redete sich selbst ein, dass er Winnies Worten keinen Glauben zu schenken brauchte. Andererseits würde er in Kürze in den aktiven Dienst zurückkehren, und das bedeutete, dass er ständig sein Leben aufs Spiel setzte.
Plötzlich kam ihm ein Bibelvers in den Sinn: »Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt.«
Diese Eingebung schien ihm kein gutes Omen zu sein.
Kurz vor acht ging er den Hügel zum Cottage hinauf und traf noch vor Miss Dupont ein. Er wartete draußen. Auf der Treppe stand eine große Kiste, doch die Tür war verschlossen. Er sah auf seine Taschenuhr und sagte sich, dass Miss Dupont nicht einer seiner Gefreiten war, die einen Rüffel bekamen, wenn sie ihn warten ließen.
Fünf Minuten später kam sie den steilen Pfad heraufgeeilt. Sie war blass. »Es tut mir leid, ich bin heute Morgen nicht ganz auf der Höhe. Normalerweise komme ich nicht zu spät.«
Sie schloss die Tür auf, trat ein und fing an, die Läden zu öffnen. Doch irgendwie ließ das helle Morgenlicht die verlassenen Besitztümer und das ungemachte Bett noch trister wirken als gestern.
Er trug die Kiste hinein und sagte: »Ich fange mit den größeren Bildern an. Vielleicht könnten Sie die Materialien durchsehen. Behalten Sie alles, was Ihrem Vater gehört, und auch alle Farben oder Öle, die verderblich sind. Ich nehme an, Ihr Vater oder sein Assistent haben Verwendung dafür.«
»Ja. Danke.«
»Es wäre dumm, die Sachen verderben zu lassen.«
Stephen packte Wesleys Mantel und ein paar persönliche Gegenstände, die er zurückgelassen hatte, ein, und wandte sich dann den Bildern zu.
»Es überrascht mich, dass er seine Staffelei nicht mitgenommen hat«, bemerkte er.
»Die hier gehört in den Laden.« Sie wischte sich die Hände an einem Tuch ab und schlug vor: »Wir sollten die Bilder in Stoff einschlagen, damit sie auf der Fahrt nicht beschädigt werden. Diese Landschaften sind sehr gelungen.«
Stephen nahm eines der Bilder von der Staffelei. »Das hier gefällt mir, dabei ist es gar nicht Wesleys Stil.«
»Äh – das ist auch nicht von ihm. Es stammt von … von einem seiner Schüler.«
»Ah. Wenn Sie dann bitte so gut sein wollen, es zurückzugeben.«
»Natürlich.«
Er nahm ein anderes in die Hand. »Und das hier von Wesley? Das ist doch kein Selbstporträt, oder?«
»Nein. Es stammt … von demselben Schüler. Ich werde es ebenfalls zurückgeben.«
Er griff nach einem weiteren Bild, einem Gemälde von Wesley, das Miss Dupont in einem griechischen Gewand zeigte – vom Wind zerzaustes Haar, dessen Locken zum Teil den Haarnadeln entschlüpft waren, kupferne Glanzlichter in goldenen Pinselstrichen, ihr Gesicht schmal, aber lieblich, volle Lippen, große, fragende Augen. Er überlegte, warum er unter den Landschaftsgemälden, die Wesley voriges Jahr aus Lynmouth mitgebracht hatte, keinerlei Ganzporträts von Miss Dupont entdeckt hatte. Anscheinend gehörte die Miniatur, die er gefunden hatte, zu den wenigen kleinen Bildern und Skizzen, die Wesley im letzten Jahr von der Tochter des Malers angefertigt hatte. Dieses Jahr schien er dagegen kaum etwas anderes gemalt zu haben. Stephen schlug das Bild vorsichtig ein. Anschließend griff er nach dem, das sie mit nackter Schulter zeigte. Als er es betrachtete, empfand er einen Stachel von – ja, was war es? Unwillige Bewunderung? Missgunst? Eifersucht?
Sie blickte zu ihm herüber, und zwischen ihren blonden Brauen erschien eine Falte. »Müssen Sie das mitnehmen? Müssen Sie überhaupt ein Bild von mir mitnehmen?«
Er schob die unlogischen Gefühle beiseite. »Was schlagen Sie vor? Sind die Gemälde nicht Wesleys Eigentum?«
»Ich glaube schon. Aber Sie verstehen doch sicher, warum mir der Gedanke, dass sie für alle sichtbar in Ihrem Haus hängen, unangenehm ist?«
»Daran hätten Sie vielleicht denken sollen, bevor Sie ihm Modell standen.«
Sie senkte beschämt ihren Kopf, und sofort bereute er seinen scharfen Ton.
»Sie haben natürlich Recht«, gab sie zu. »Ich habe nicht nachgedacht, und vor allem habe ich die Sache nicht zu Ende gedacht.«
»Was haben Sie sich überhaupt dabei gedacht?«
Sie zuckte hilflos mit den Achseln. »Ich wollte einfach helfen – einen Künstler bei seiner Arbeit unterstützen. Dabei habe ich nicht daran gedacht, dass seine Bilder eines Tages verkauft oder aufgehängt würden und seine Familie sie sehen können würde.«
Er legte das letzte Bild in die Kiste. »So, das wär's.«
Sie nickte. »Ich werde Maurice mit Hammer und Nägeln heraufschicken. Er soll die Kiste verschließen und die übrigen Sachen herunterbringen. Ich …«
Plötzlich wurde sie blass und riss die Augen auf. Dann schlug sie eine Hand vor den Mund, wirbelte herum und lief zur Tür hinaus.
Durch das Fenster sah er, wie sie sich zwischen zwei Büschen übergab.
Bei dem Anblick krampfte sich sein Magen ebenfalls zusammen. O nein! Bedeutete das, dass seine Befürchtung stimmte? In seinem Regiment hatte es genügend Soldatenfrauen gegeben – er kannte die Vorzeichen. Er dachte an ihre Tränen, ihre peinlich berührten Blicke zum Bett hinüber, die nackte Schulter … wenn er Recht hatte – was sollte er dann tun? Die Beweise, die sich ihm boten, einfach ignorieren? Dem armen, missbrauchten Mädchen Geld anbieten? Doch sie war kein Londoner Straßenmädchen, sie war die Tochter eines geachteten Künstlers – die Frau, deren Bild er seit fast einem Jahr heimlich bei sich trug …
Einen Moment später trat Miss Dupont auf wackligen Beinen ein. Sie versuchte, sich lässig zu geben. Es war anzunehmen, dass sie nicht wusste, dass er sie beobachtet hatte.
Er reichte ihr ein sauberes Taschentuch. Sie sah ihn an, dann wanderte ihr Blick zum Fenster, und als Nächstes wurde ihr grünliches Gesicht leuchtend rot.
»Tut mir leid. Ich hatte Ihnen das ersparen wollen. Kein schöner Anblick.« Sie zwang sich zu einem schwachen Lächeln. »Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben.«
Er fragte: »Fühlen Sie sich jetzt besser?«
»Ja. Wo waren wir stehengeblieben?« Sie wandte sich zu der Kiste um.
»Miss Dupont – einen Moment, bitte.«
Sie drehte sich langsam wieder zu ihm um.
»Es lag nicht am Essen.«
Ihr Mund öffnete sich, dann sagte sie schnell: »Nun, das kann man natürlich nie mit Sicherheit wissen. Aber es ist nichts Ansteckendes, keine Sorge.«
»Ich mache mir aber Sorgen.«
»Bitte?«
Er deutete auf die Stühle am Tisch. »Bitte setzen Sie sich doch.«
»Ich möchte mich aber nicht hinsetzen. Wir wollten die Sachen Ihres Bruders zusammenpacken, sonst nichts. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Bitty das Cottage für den nächsten Mieter vorbereitet, falls es einen geben wird. Das ist zwar unwahrscheinlich so früh im Jahr, aber …«
Er schob ihr mit einem quietschenden Scharren einen Stuhl hin und fixierte sie mit seinem strengsten Blick. »Hinsetzen.«
»Ich bin kein Soldat unter Ihrem Befehl, Sir.«
»Bitte, setzen Sie sich.«
»Na gut. Aber nur für einen Moment.« Sie setzte sich hin, die Hände züchtig im Schoß gefaltet. »Mir ist noch ein bisschen übel, das stimmt. Aber es wird gleich besser.«
»Ja, in acht oder neun Monaten – habe ich Recht?«
Sie blickte mit weit aufgerissenen Augen zu ihm auf. »Wie können Sie es wagen …? Das ist … das geht Sie überhaupt nichts an.«
Er verzog das Gesicht. »Doch, ich fürchte, das tut es. Familiensache.« Er fuhr sich mit der Hand durch sein störrisches Haar. »Schauen Sie, es tut mir leid, dass ich so deutlich werden muss. Aber ich pflege mich nicht mit Höflichkeiten aufzuhalten, wenn es gilt, ein Problem zu lösen. Außerdem habe ich im Augenblick gar nicht die Zeit dafür.«
»Es ist nicht Ihr Problem.«
»Nicht? Ich bin hierhergekommen, weil ich meinen Bruder gesucht habe. Ich wollte ihn nach Hause schicken, damit er unseren Vater entlastet, weil ich zu meinem Regiment zurück muss. Stattdessen muss ich nun feststellen, dass er nach Italien gefahren ist und eine junge Dame in einer ziemlich schlimmen Lage alleingelassen hat. Er ist doch für Ihren Zustand verantwortlich, oder?«
Sie presste die vollen Lippen zu einem beleidigten Strich zusammen. »Sir, Sie sind unglaublich dreist.«
»Nein. Wesley war dreist. Ich versuche nur zu helfen. Was haben Sie jetzt vor?«
Einen Moment lang starrte sie ihn nur an, mit funkelnden Augen und starrem Gesicht. Dann stieß sie die Luft aus und ließ sich gegen die Stuhllehne sinken. »Ich weiß es nicht. Es ist noch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, was ich überhaupt tun kann. Bitte, sagen Sie es niemandem – es würde meinen Vater umbringen.«
»Aber Sie tun doch nichts … Folgenschweres, hoffe ich? Als ich Sie gestern auf den Klippen sah, fürchtete ich einen Augenblick, dass Sie sich etwas antun wollten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss zugeben, dass mir die Idee kam. Aber – nein.«
»Darüber bin ich sehr froh. Das Leben ist kostbar. Es ist ein Geschenk Gottes.«
»Ich bin überrascht, das aus dem Mund eines Militärs zu hören. Sind Sie religiös, Captain?«
Er zuckte die Achseln. »Wenn ein Soldat weiß, dass er jeden Moment sterben kann, wird er entweder Gott ignorieren und ›essen, trinken, töten und fröhlich sein‹ oder er wird sich der Kürze und des Wertes des Lebens bewusst.«
Sie nickte nachdenklich. »Vermutlich sollte ich in aller Stille das Baby bekommen und es sofort in ein Findelhaus geben. Aber ich kann mein Kind nicht einfach hergeben.«
Ihre Augen ruhten eine Zeit lang auf dem Bild, das oben auf der offenen Kiste lag. »Ich habe nicht nachgedacht. Ich dachte, Wesley würde mich heiraten. Ich glaube, ich hoffe immer noch, dass er rechtzeitig zurückkommt …«
Wahrscheinlich glaubte sie, dass Wesley seinen Fehler einsehen, sie um Vergebung bitten und ihr ewige Liebe schwören würde. Stephen hätte das selbst gern geglaubt. Doch er kannte seinen Bruder schon sein ganzes Leben lang, und deshalb bezweifelte er es. Vielleicht war seine Meinung von persönlichem Vorurteilen getrübt, doch eigentlich glaubte er das nicht.
Er erinnerte sich an sein morgendliches Gebet in der Kirche und an den Vers, der ihm durch den Kopf gegangen war. Aber das würde Gott doch ganz bestimmt nicht von ihm verlangen – oder?
Stephen war es gewöhnt, die Pflichten seines Bruders zu übernehmen und seine Fehler wiedergutzumachen. Doch diesmal war es mehr. Töricht oder nicht, er verspürte den Drang, diese Frau, deren Gesicht ihn während zwölf Monaten der Entbehrungen und Kämpfe angelächelt hatte, zu beschützen. Er fühlte sich zu ihr hingezogen. Und er wollte etwas Sinnvolles mit seinem Leben anfangen. Er wollte wiedergutmachen, was mit Jenny geschehen war. Vor allem jetzt, da Winnies düstere Drohung über seinem Haupt hing.
Sollte er es wagen? Würde Miss Dupont sein Angebot ablehnen? Würde sie sich gekränkt fühlen? Schließlich liebte sie seinen Bruder – den Goldjungen Wesley. Sein Bruder, der so unendlich viel attraktiver und charmanter war, als er es je gewesen war, und das erst recht, seit ihm der Spanische Unabhängigkeitskrieg die entstellende Narbe auf der Wange beschert hatte.
Doch Wesley war nicht hier.
Die Hände auf dem Rücken, ging Stephen vor dem Stuhl von Miss Dupont auf und ab und legte ihr seine Ansicht so entschlossen dar wie ein General seinen Schlachtplan.
»Wesley ist nach Italien gefahren. Wer weiß, wann er zurückkommt und ob er, wenn er überhaupt zurückkommt, seine Pflicht Ihnen gegenüber tun wird. Ich sage das nicht, um Sie zu verletzen, doch im Moment können wir uns den Luxus von Wunschdenken nicht leisten. Wir müssen realistisch sein.«
Er hielt kurz inne, dann fuhr er fort: »Darf ich fragen, in welchem Monat Sie sind?«
Wieder errötete sie. »Im zweiten.«
Er nickte und rechnete nach. Konnte Wesley rechtzeitig wieder hier sein, um sie zu heiraten? Würde er zurückkommen, wenn er von ihrer Schwangerschaft erfuhr? Es war auf jeden Fall ein Risiko, einfach zu warten.
Er fing wieder an, auf und ab zu gehen. »Eigentlich sollte Wesley Ihnen den Heiratsantrag machen, aber er wird frühestens in einigen Monaten zurückkehren. So lange kann ich nicht warten, und Sie können es auch nicht. Ich kann Ihnen natürlich keine Liebe bieten, schließlich kennen wir uns kaum. Aber ich kann Ihnen einfach eine Ehe anbieten und dazu noch eine möglicherweise sehr kurze, da ich Grund zu der Annahme habe, dass ich nicht mehr lange auf dieser Welt sein werde. Doch auch wenn dem so ist, wird Ihr Kind doch ehelich sein. Es wird meinen Namen tragen und den Schutz meiner Familie genießen.«
Sie starrte ihn an, dann verzog sich ihr Gesicht ungläubig oder vielleicht auch vor Abscheu. »Sie wollen mich heiraten? Sie selbst?«
»Das sagte ich doch. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt, Madam?«
»Ihre Worte waren deutlich, aber schwer zu begreifen. Warum wollen Sie das tun?«
»Nicht aus unehrenhaften Motiven, falls Sie das befürchten.«
»Ich …« Sie zögerte, dann runzelte sie die Stirn. »Was meinen Sie damit, dass Sie nicht mehr lange auf dieser Welt sein werden? Warum glauben Sie, dass Sie nicht mehr lange leben werden, obwohl Napoleon doch jetzt im Exil ist? Sind Sie krank?«
»Nein. Aber der Militärdienst ist immer ein Risiko.« Er beschloss, das Thema nicht zu vertiefen. »Lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen, was ich Ihnen anbiete und was nicht. Möglicherweise keine lange gemeinsame Zukunft. Ganz sicher keinen Reichtum – ich bin nur der zweite Sohn. Wenn ich sterbe, werden Sie allerdings die Witwenpension bekommen, und meine Familie wird für Sie und für das Kind sorgen.«
Ihre Augen wurden groß. »Aber Sie können doch nicht wissen, dass Sie nicht zurückkommen. Sie sind nicht Gott. Und was wird, wenn Sie doch zurückkommen? Dann hätten Sie eine Frau, an der Ihnen nichts liegt, und ein Kind, das nicht Ihres ist. Was werden Sie dann tun?«
Er nickte ernst. »Über diese Brücke werden wir gehen, wenn es so weit ist. Aber ich halte mein Wort. Wenn ich vor Gott schwöre, Sie zu lieben, zu ehren und zu schützen, bis dass der Tod uns scheidet, dann werde ich das auch tun.«
Konnte Sophie das auch von sich sagen? Sie starrte den Fremden an, der vor ihr stand. Ihre Gedanken überschlugen sich. Es war richtig, sie suchte verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrer Notlage. Aber was war schlimmer: einen Fremden zu heiraten oder ein uneheliches Kind zu bekommen? Sie hatte nicht übertrieben, als sie gesagt hatte, dass die Nachricht ihren Vater umbringen würde. Und wie ihre Stiefmutter lästern und sich an ihrem Unglück weiden würde! Vielleicht würde sie sogar darauf bestehen, dass ihr Vater sie fortjagte. Maurice, der zwei Jahre jünger war als sie, würde sie vielleicht heiraten, aber wenn er herausfand, dass sie ein Kind erwartete, würde er dafür sorgen, dass sie nie vergaß, was sie getan hatte. Er würde ihr – und ihrem Kind – das Leben zur Hölle machen. Würde Captain Overtree das auch tun? Würde sie ihr Leben lang bereuen, dass sie ihn geheiratet hatte?
Ihr Herz setzte aus – und wenn Wesley doch zurückkam? Wenn ihm bewusst wurde, dass er sie liebte, und er sie bat, ihn zu heiraten? Dann wäre es zu spät, und sie wäre bereits an seinen Bruder gebunden. Würde Wesley sich verraten fühlen oder erleichtert sein, dass jemand anders seine Pflicht erfüllt hatte? Auch wenn Captain Overtree nicht lange leben sollte, als seine Witwe konnte sie Wesley auf keinen Fall heiraten. Das war nach englischem Recht verboten. Seinen Bruder zu heiraten, bedeutete also, Wesley für immer aufzugeben.
Sie fragte: »Darf ich darüber nachdenken?«
Er fuhr sich mit der Hand über das vernarbte Gesicht. »Ich fürchte, ich muss Sie um eine rasche Entscheidung bitten. Ich kehre in knapp vierzehn Tagen zu meinem Regiment zurück. Apropos – wenn wir es tun, werden wir nicht die Zeit haben, das Aufgebot zu bestellen, wir werden durchbrennen müssen.«
»Durchbrennen?« Das Wort rief eher skandalöse als romantische Vorstellungen in ihr wach. Außerdem würde ein solches Verhalten in jedem Fall genau die Gerüchte heraufbeschwören, die sie zu vermeiden versuchte. »Nach Schottland?«
Er schüttelte den Kopf. »Zu weit. Aber auf den Kanalinseln sind die Heiratsgesetze ebenfalls großzügiger.«
»Das wusste ich nicht …«, murmelte Sophie nachdenklich. Sie wusste, dass ihr Vater ein solches Verhalten ganz und gar nicht gutheißen würde, aber er würde es ihr doch eher verzeihen als ein uneheliches Kind.
Sie dachte wieder an Wesleys kurzen Abschiedsbrief. Kein Wort von Liebe, keine Versprechungen. Sophie trat ans Fenster, sie konnte seinem Bruder, der sie offen ansah, nicht in die Augen blicken. Dann fragte sie ruhig: »Er wird nicht zurückkommen, nicht wahr? Zu mir, meine ich.«
Sie spürte, wie er sie ansah, und wappnete sich für seine Antwort.
»Ich bin kein Prophet«, sagte er freundlich, »aber soweit ich ihn kenne … nein. Ich glaube nicht.« Dann straffte er sich. »Gut. Sie können bis morgen darüber nachdenken. Schlafen Sie eine Nacht darüber.«
Schlafen? Sophie bezweifelte, dass sie heute Nacht schlafen würde, auch wenn sie ganz sicher den ganzen Tag damit verbringen würde, auf und ab zu gehen und an Wesley … und seinen Bruder zu denken.
Wesley Dalton Overtree saß allein im Salon eines Gasthauses, von dem aus man den Trubel im Hafen überblickte. Der Schoner war heute Morgen in Plymouth eingelaufen, und bald würden er und das italienische Ehepaar an Bord des großen Handelsschiffes gehen, das sie nach Italien bringen würde. Noch zwei Stunden, zwei Stunden, sich zu erinnern – und zu bereuen.
Seine Reisegefährten schienen seinen Wunsch, allein zu sein, zu spüren und zu respektieren und waren bereits ohne ihn in den Schankraum gegangen. Ein junger Diener kniete vor der glühenden Asche im Kamin und versuchte, das glimmende Feuer zum Leben zu erwecken. Der Rauch drang Wesley in die Augen und ließ sie tränen. Er fuhr sich mit der Hand darüber und wünschte, er könnte seine Reue genauso leicht fortwischen.
Er hätte sich persönlich von Sophie verabschieden sollen.
Doch als sich ihm überraschend die Gelegenheit bot, nach Italien zu fahren, war er im ersten Moment versucht gewesen, einfach ohne ein Wort zu verschwinden. Ein kleiner, egoistischer Teil von ihm glaubte, so würde es leichter sein. Besser. Einfach alle Verbindungen abbrechen, bevor ihn jemand festhalten konnte. Doch das brachte er dann doch nicht fertig. Er war schließlich trotz allem ein Gentleman, ganz gleich, was Marsh über ihn sagte. Und so hatte er all seinen Mut zusammengenommen und war ins Atelier gegangen.
Doch dort hatte er nur den sauertöpfischen Assistenten, O'Dell, angetroffen.
»Sie ist nicht da«, hatte O'Dell gesagt. Seinen Ton konnte man kaum noch als höflich bezeichnen.
»Ist sie nach Castle Rock gegangen?«
Der junge Mann zögerte, wahrscheinlich wollte er ihm nicht sagen, wo sie war, doch dann meinte er: »Diesmal nicht. Sie ist mit Mrs Thrupton nach Barnstaple gefahren.«
»Wann kommt sie zurück?«
O'Dell zuckte die Achseln. »Ich denke, zu spät für Sie.«
Irgendetwas an seinem Ton machte Wesley nachdenklich. War das Bosheit, die da in den Augen des jungen Mannes glomm, oder war es nur eine Widerspiegelung von Wesleys eigenem schlechten Gewissen? Gleich darauf lächelte O'Dell ihm nämlich freundlich zu und wünschte eine gute Reise.
Wie sich herausstellte, hatte der Mann Recht gehabt – es war zu spät. Wesley hatte den Kapitän der Schaluppe gefragt, ob sie ein wenig später ablegen könnten, doch der alte Seebär bemühte nur das bekannte Sprichwort »Die Gezeiten warten auf niemanden« – und er war offenbar ebenfalls nicht dazu bereit.
Wesley hatte sich zerrissen gefühlt. Das Schiff und seine neuen Freunde würden mit ihm abfahren oder ohne ihn. Und in zweitem Fall entschwand mit ihnen die Möglichkeit, sein geliebtes Italien wiederzusehen, in ihrer Villa zu wohnen und das Land Michelangelos, Raphaels und Caravaggios zu malen. Wie sehr sehnte er sich nach Italien! Neapel. Rom. Florenz. Danach, inspiriert zu werden, die flüchtige Muse wiederzufinden.
Also hatte er schließlich ein paar Zeilen für Sophie hingekritzelt, die Nachricht im Cottage hinterlassen, wo sie sie finden würde, und war abgereist, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.
Jetzt saß er in Plymouth und dachte darüber nach, was er geschrieben hatte. Im Nachhinein kamen ihm die flüchtig hingeworfenen Zeilen schrecklich unzulänglich vor. Kalt und unpersönlich.
Sophie hatte Besseres verdient.
Er stellte sich ihre Reaktion auf den Brief vor – ihr Lächeln, das traurig heruntergezogenen Mundwinkeln wich, die Enttäuschung, die sie überschwemmte – und er empfand nagende Schuldgefühle. Wie ernüchtert musste sie sein, nachdem sie so hoch von ihm gedacht hatte! In ihrer Gesellschaft hatte er sich immer wie ein Held gefühlt. Es war, als könnte er gar nichts falsch machen. Und jetzt hatte er selbst dieses Podest umgestoßen.
Wieder traten ihm Tränen in die Augen, und er zuckte zusammen.
Wesley wusste, dass er egoistisch gewesen war. Er dachte an die vielen vertrauten, zärtlichen Dinge, die er in seiner Leidenschaft gesagt und getan hatte, und wurde erneut von Reue überwältigt. Er hatte sie nicht belogen. Die Gefühle, die er ihr gestanden hatte, waren zu diesem Zeitpunkt wahr gewesen. Doch wie schon so oft war ihm bald alles zu eng geworden. Er meinte zu spüren, wie sein Leben und seine Möglichkeiten eingeschränkt und beschnitten wurden. In dieser Situation schienen ihm der ausländische Künstler und seine kultivierte Frau mit einem Mal alles zu verkörpern, was er sich wünschte, was er so sehr vermissen würde: ein sorgloses Leben, Reisen, Abenteuer, neue Erfahrungen, Inspiration, Erfolg … Er war schließlich Künstler, rief er sich ins Gedächtnis, und Sophie kannte ihn gut. Sie würde ihn verstehen.
All das hatte Wesley sich gesagt und war davon ausgegangen, er könne mit leichtem Gewissen abreisen, oder zumindest die Schuldgefühle rasch überwinden. Doch noch immer quälte ihn die Reue. Sein Herz war nicht mit auf die Reise gegangen, aber jetzt war es zu spät umzukehren. Die Fahrt war bezahlt, seine Begleiter erwarteten ihn. Er musste das Beste daraus machen.
Er würde es wiedergutmachen, wenn er zurückkam. Sie beide hatten schließlich Zeit, oder nicht? Sie hatte nie von der Zukunft gesprochen. Kein Bitten, kein Drängen. Genau das hatte ihm an ihr ja so gefallen. Es war so erfrischend im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen, die entschlossen schienen, ihn mit schüchternem Lächeln und nur schlecht verschleierten Manipulationen zu zwingen, sich zu erklären.
Wesley fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. Die Wahrheit war, er hatte Angst gehabt. Eine Angst, wie er sie bis jetzt nur ein einziges Mal im Leben empfunden hatte. Wieder hielt eine Frau sein Leben in der Hand, und die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein waren unerträglich für ihn. Dennoch war es dieses Mal anders, wie er sehr wohl wusste. Dieses Mal hatte er sich verliebt.
Wesley fasste einen Entschluss. Er würde Sophie einen anderen Brief schreiben. Einen besseren. Er würde sich entschuldigen. Sie um Vergebung bitten. Und er würde sie bitten, auf ihn zu warten.
Würde sie ihn wieder aufnehmen?
Ja, das würde sie, da war er ganz sicher. Sie war eine großherzige, gütige Frau, und sie liebte ihn.
Bei dem Gedanken wurde ihm warm ums Herz, und er stand auf, um den Wirt zu suchen. Er lieh sich Feder, Papier und Siegelwachs und setzte sich hin, um ihr zu schreiben.
Liebe Sophia mia …
Während er das schrieb, betete er, dass sie ihm vergeben, auf ihn warten und ihn mit offenen Armen aufnehmen würde, wenn er zurückkam.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 3
In Sophies Kopf überschlugen sich die Fragen. Konnte sie Captain Overtree trauen? Durfte sie sich einfach so, ohne etwas über ihn zu wissen, darauf verlassen, dass er ein guter Mensch war? Sie dachte an Wesleys Beschreibungen von »Captain Black«. Ein Soldat, der in der Schlacht wahrscheinlich mit bloßen Händen Menschen getötet hatte. Konnte sie ihr Leben in dessen Hände legen? Und wie würde er ihr Kind behandeln – Wesleys Kind, das die Welt als das Seine betrachten würde, auch wenn sie beide es besser wussten?
Jetzt, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, wusste sie nicht, was sie denken sollte. Ernst und sehr direkt, ja. Aber gefährlich? Sie war sich nicht sicher. Seine höfliche Zurückhaltung und tiefe Religiosität hatten sie überrascht – aber waren sie echt?
Sie sah seine leuchtend blauen Augen vor sich – wie sie glitzerten, entschlossen, hart und unbeugsam, eisig, wenn er sich ärgerte. Sie erinnerte sich aber auch an einen wärmeren Ausdruck, den sie glaubte ein oder zwei Mal erhascht zu haben. Das konnte allerdings auch ein Irrtum gewesen sein. Es war zu früh, sich aus diesen wenigen Eindrücken ein Bild von dem Mann zu machen, und mit Sicherheit zu früh, sich für das ganze Leben an ihn zu binden. Wenn sie doch nur mehr Zeit hätte!
Sie beschloss, zu Mrs Thrupton zu gehen und sie um Rat zu fragen; vielleicht konnte sie ihr helfen, zu einem Entschluss zu kommen.
Mavis Thrupton saß im Sessel am Fenster ihres Wohnzimmers. Das Sonnenlicht milderte die Linien um ihre Augen und auf ihrer Stirn und verlieh ihrer Haut einen goldenen Schimmer. Bei diesem Anblick konnte Sophie sich mühelos die bezaubernde Frau vorstellen, die Mavis einst gewesen war, mit schimmerndem Teint, feinen Zügen, großen dunklen Augen und dichtem braunem Haar, das sie hochgesteckt trug. Genau so hatte sie Mavis sogar schon gesehen, auf einem Bild, das ihr Vater ihr einmal im Haus eines reichen Gönners gezeigt hatte. Mavis hatte schon früher Modell gesessen. Viele Künstler hatten um ihre Gunst und die Gelegenheit, die brünette Schönheit malen zu dürfen, gewetteifert.
Sophie spürte einen Stich der Trauer beim Anblick dieser ehemaligen Schönheit. Was war schlimmer, fragte sie sich, schön gewesen zu sein und diese Schönheit verloren zu haben, oder gar nicht erst schön zu sein?
Kein Mann hatte jemals Sophies Schönheit gerühmt, um sie geworben oder sie gebeten, ihm Modell zu sitzen – bis auf Wesley … Doch sogar er hatte gemeint, dass sie nicht das weibliche Ideal verkörpere. Ihrem blassen Teint fehlte das Leuchten, in einem bestimmten Lichteinfall wirkte er fahl. Ihr Gesicht war hager – ebenso wie ihre Gestalt. Sie besaß nicht die Apfelwangen, die runden Arme und den Busen, die den Männern so sehr zu gefallen schienen. Doch Wesley hatte sie trotz all dieser Fehler schön gefunden, und dafür hatte sie ihn noch mehr geliebt. Er hatte sie gern geneckt und gesagt, sie erinnere ihn an eine traurige, halb verhungerte Madonna. Sie sah noch seine goldbraunen Augen vor sich, die vor Humor und Bewunderung leuchteten.
Jetzt hörte Mavis zu, wie Sophie ihr ihre Notlage gestand und von Captain Overtrees überraschendem Angebot erzählte.
»Du meine Güte«, keuchte die Matrone, mit erstaunt aufgerissenen Augen. »Aber was ist mit Wesley? Ich weiß doch, was du für ihn empfindest.«
Sophie nickte. »Ich liebe ihn. Von ganzem Herzen. Aber … was müssen Sie nur von mir denken? Sie haben mich doch die ganze Zeit versucht zu warnen«, meinte sie voller Reue.
»Das spielt jetzt keine Rolle. Wir machen alle Fehler. Ich bin die Letzte, die dich verurteilt. Im Gegenteil, ich fühle mich mitverantwortlich. Genauso gut könntest du fragen, was ich nur für eine Anstandsdame gewesen bin! Dein Vater wird sehr enttäuscht von mir sein.«
»Es ist nicht Ihre Schuld.«
»Wesley ist ein gut aussehender Mann, und er hat sich sehr um dich bemüht. Ich kann verstehen, wie groß die Versuchung für dich gewesen sein muss. Aber ich hielt ihn für einen Gentleman, deshalb habe ich nicht so aufgepasst, wie ich es eigentlich hätte tun sollen.« Mavis schnalzte mit der Zunge. »Ich hätte nie gedacht, dass er dich einfach so sitzen lässt und dich das Ganze allein ausbaden lässt.«
»Verurteilen Sie ihn nicht zu hart«, verteidigte Sophie ihn. »Ich … genau genommen hatte ich es ihm noch gar nicht gesagt.«
Mavis zuckte zusammen. »O Sophie!«
»Ich hatte damit gerechnet, dass er mich bittet, ihn zu heiraten, und wollte ihn nicht drängen. Jeden Tag sagte ich mir, ich wollte nur noch heute warten, und wenn er dann wieder nicht fragte, fand ich nicht den Mut, es ihm zu sagen. Ich dachte, er liebt mich. Ich liebe ihn. Er ist der Mann, den ich mir wünsche. Nicht sein Bruder, nicht dieser Fremde, den ich nicht kenne. Und was ich über ihn gehört habe, lässt nichts Gutes ahnen.«
»Was meinst du damit?«, fragte Mavis stirnrunzelnd.
»Wesley hat mir von seinem aufbrausenden Temperament erzählt, von seiner kritischen, kalten Art, seinem Hang, zuzuschlagen und erst später Fragen zu stellen.«
»Das könnte an seiner militärischen Ausbildung liegen, es muss nicht unbedingt eine natürliche Veranlagung sein. Du … du glaubst doch nicht, dass er dir etwas antun würde, oder?«
»Ich glaube nicht, aber woher soll ich es wissen? Ich bin ihm doch erst einmal begegnet.«
»Du bist in einer bösen Zwangslage, meine Liebe. Zwischen Scylla und Charybdis, wie man sagt. Aber was sollst du sonst tun? Du willst ja wohl kaum Maurice heiraten.«
Bei dem Gedanken wurde Sophie übel. »Nie im Leben!« Ihr Vater mochte eine hohe Meinung von dem jungen Mann haben, doch Sophie konnte ihn nicht ausstehen und traute ihm auch nicht.
»Gut. Was dann – auf Wesley warten?«
»Ich weiß nicht. Sein Bruder hat mir vorgerechnet, dass es, selbst wenn Wesley in Italien sofort, wenn er angekommen ist, das nächste Schiff zurück nimmt, zu spät sein wird. Bis dahin wird mein Zustand deutlich erkennbar sein.«
»Aber … wäre das wirklich das Schlimmste? Wenn du sicher wärst, dass er dich heiratet, sobald er davon erfährt?«
»Ich weiß nicht. Seine Eltern hoffen bestimmt auf eine vorteilhaftere Partie. Aber ich glaube schon, dass er mich heiraten würde, wenn er Bescheid wüsste.«
»Aber bist du dessen so sicher, dass du dein Leben dafür riskieren würdest? Deine Zukunft und die deines Kindes?«
Sophie dachte wieder an Wesleys unbeschwerten Abschiedsbrief. Und an die mitleidlose Aussage seines Bruders, dass er nicht zurückkommen würde, zumindest nicht um ihretwillen. Captain Overtree hatte doch keinen Grund, sie in die Irre zu führen – oder?
»Ich weiß nicht«, gab sie zu.
Mavis sagte: »Ich bin froh, dass du nicht den drastischen Weg in Erwägung ziehst, den Frauen manchmal wählen.« Mavis kaute an ihrer Unterlippe, dann fuhr sie fort: »Ich … kannte einmal eine Frau, das Modell eines Malers, so wie ich – die sich in einer ähnlichen Zwangslage befand und glaubte, keine andere Wahl zu haben.«