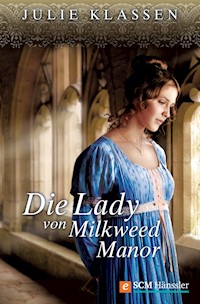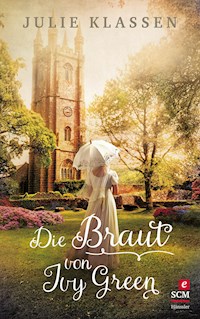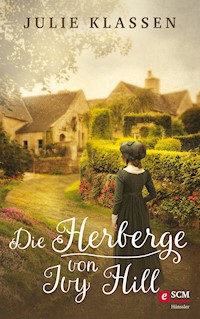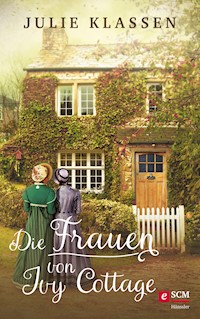Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency-Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie weit würdest du gehen, um zu beschützen, was du liebst? England 1820. Miss Rebecca Lane kehrt zurück in ihr Heimatdorf Swanford, um ihrem Bruder zu helfen, der sich in letzter Zeit sehr seltsam verhält. Doch als sie ankommt, schickt er sie fort ins Grand Hotel Swanford Abbey, einem umgebauten mittelalterlichen Kloster. In den alten Mauern scheint das Flüstern der Vergangenheit widerzuhallen ... auch ihrer eigenen. Plötzlich taucht ihre alte Jugendliebe wieder auf und wirbelt vergrabene Gefühle wieder auf. Als auch noch ein Mord passiert, bleibt ihr keine Wahl: Sie macht sich selbst auf die Suche nach dem Täter. Konfrontiert mit Geheimnissen, Lügen und verdrängten Erinnerungen beginnt eine Jagd nach Frieden. Und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe,die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung,die sich für die Förderung und Verbreitung christlicherBücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7598-2 (E-Book)ISBN 978-3-7751-6172-5 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz: Satz & Medien Wieser, Aachen
© der deutschen Ausgabe 2023SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: Shadows of Swanford Abbey© Copyright 2021 by Julie KlassenOriginally published in English by Bethany House Publishers,a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.All rights reserved.Cover design by Jennifer ParkerCover photography by Todd Hafermann Photography, Inc.Front cover background photograph is of the interior of the Cloister of Lacock Abbey,Wiltshire, UK © Alamy Images.Zitate am Buchanfang:Jane Austen, Die Abtei von Northanger (Mehrbuch, 2020)Jane Austen, Überredung (EClassica, 2019)Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen.Übersetzung: Susanne Naumann (SuNSiDe)Umschlaggestaltung: Jan Henkel, www.janhenkel.comSatz: Satz & Medien Wieser, Aachen
In Erinnerung an Katy Benton,deren Lächeln, Gebet und Freundschaftdie Welt erhellten1986–2020
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Nachwort
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
JULIE KLASSEN arbeitete sechzehn Jahre lang als Lektorin für Belletristik. Mittlerweile hat sie zahlreiche Romane aus der Zeit von Jane Austen geschrieben, von denen mehrere den begehrten Christy Award gewannen. Abgesehen vom Schreiben, liebt sie das Reisen und Wandern. Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie in Minnesota, USA.www.julieklassen.com
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über das Buch
Ein geheimnisvolles Hotel,eine aufflammende Jugendliebeund ein schauerlicher Mord
England 1820. Miss Rebecca Lane kehrt zurück in ihr Heimatdorf Swanford, um ihrem Bruder zu helfen, der sich in letzter Zeit sehr seltsam verhält. Doch als sie ankommt, schickt er sie fort ins Grand Hotel Swanford Abbey, ein umgebautes mittelalterliches Kloster. In den alten Mauern scheint das Flüstern der Vergangenheit widerzuhallen … auch ihrer eigenen. Plötzlich taucht Rebeccas alte Jugendliebe wieder auf und wirbelt vergrabene Gefühle wieder auf. Als auch noch ein Mord passiert, bleibt ihr keine Wahl: Sie macht sich selbst auf die Suche nach dem Täter. Konfrontiert mit Geheimnissen, Lügen und verdrängten Erinnerungen beginnt eine Jagd nach Frieden. Und Liebe.
… es spuke in diesem Flügel der Abtei
Jane Austen, Die Abtei von Northanger
Das GENTLEMEN’S HOTELin der King-Street, Saint James’s Squareergreift die Gelegenheit,alle Adligen, Gentlemen, Reisenden und andereHerren davon in Kenntnis zu setzen,dass unser Haus äußerst bequeme und elegante Unterkünftefür eine Nacht oder einen von Ihnen zu bestimmenden Zeitraum bereithält.
Annonce in einer Londoner Zeitung aus dem 18. Jahrhundert
Ein unruhiger Morgen musste erwartet werden, wie es bei einer zahlreichen Reisegesellschaft in einem Wirtshause nicht anders sein konnte.
Jane Austen, Überredung
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben,sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 1
März 1820Worcestershire, England
Miss Rebecca Lane erschauderte bei dem Gedanken, nach über einem Jahr Abwesenheit nach Swanford zurückzukehren. Ihr Herz hatte es in Wirklichkeit nie verlassen.
Sie saß in der rumpelnden Postkutsche, die sämtliche Reisenden tüchtig durchschüttelte, und betete: Bitte lass ihn nichts Törichtes tun, bevor ich da bin.
Die Zeilen aus dem letzten Brief ihrer Haushälterin gingen ihr nicht aus dem Kopf:
Das Verhalten Ihres Bruders wird immer beunruhigender, mir graut vor dem, was er tun könnte. Mein Gewissen lässt nicht zu, dass ich noch länger damit warte, Ihnen zu schreiben. Ich kann nur beten, dass es nicht schon zu spät ist.
Wieder stieg die blanke Angst in Rebecca auf, wie schon beim ersten Lesen dieser Worte. Wollte John womöglich sich selbst oder jemand anderem etwas antun? Was war nur geschehen?
Sie seufzte tief auf und lehnte ihren schmerzenden Kopf an das glatte, kühle Fenster der Kutsche. Über der hügeligen Landschaft, die an ihr vorüberglitt, lag dichter Märznebel, die Wiesen waren gesprenkelt mit den weißen Tupfen der Schafe und ihrer neugeborenen Lämmer.
Schon bald kam der Turm der All-Saints-Kirche über den Baumwipfeln in Sicht und gleich darauf die hohen Schornsteine von Wickworth Mansion.
Rebecca deutete aus dem Fenster auf das Dorf. »Da ist es. Swanford.«
Die französische Zofe auf dem Sitz neben ihr schlief weiter, doch Lady Fitzhoward, ihre Arbeitgeberin, folgte ihrem Blick. »Ah ja.« Dann sah sie sie an. »Freuen Sie sich, wieder zu Hause zu sein?«
Rebecca nickte und lächelte pflichtschuldig, doch ihr Lächeln geriet wenig überzeugend.
Wo ist mein Zuhause?, fragte sie sich im Stillen.
Seit dem Tod ihrer Eltern wohnten in dem Pfarrhaus, das ihnen ohnehin nie gehört hatte, der neue Pfarrer und seine Familie. Das Häuschen des Verwalters, in dem ihr Bruder untergekommen war, gehörte zum Anwesen der Wilfords. Bis auf einen kurzen Besuch in Swanford zum vorletzten Weihnachtsfest hatte sie die beiden letzten Jahre in ihrer Rolle als Gesellschafterin einer Lady in wechselnden Hotels nur aus Koffern und Hutschachteln gelebt. Vielleicht lernte sie ja mit der Zeit, wie Lady Fitzhoward Freude an diesen endlosen Reisen zu haben, und sich nicht mehr nach Hause zu sehnen. Doch bis jetzt war ihr das noch nicht gelungen.
Die Kutsche bog von der Hauptstraße ab. Sie passierten mehrere Gehöfte und Cottages, dann ging es durch das Dorf. Gleich dahinter ragte das imposante Swanford Abbey wie ein verwittertes uraltes Grabmal aus dem Bodennebel empor.
Noch ehe der Anblick des alten Klosters, das zu einem Hotel umgebaut worden war, wie üblich Beklemmungen bei den Neuankömmlingen wecken konnte, rumpelte die Kutsche auch schon durch einen Torbogen in den Stallhof.
Ein Portier trat an die Kutsche heran, um ihnen beim Aussteigen zu helfen. Miss Joly, die Zofe, war aufgewacht und stieg als Erste aus, um das Abladen des Gepäcks ihrer Arbeitgeberin zu beaufsichtigen. Lady Fitzhoward folgte ihr; dabei stützte sie sich schwer auf die Hand des Dienstmannes, bis sie ihren Stock auf dem Boden aufsetzen konnte.
Rebecca, die nach ihr ausgestiegen war, fragte die Zofe: »Darf ich meinen Koffer ebenfalls in Ihrer Obhut lassen?«
Die Zofe schien verärgert über dieses Ansinnen, doch Lady Fitzhoward gestattete es. »Ja, natürlich. Joly wird sich darum kümmern.«
Ein alter Mann in grober Arbeitskleidung kam mit einem Spaten in der Hand in den Hof gehumpelt. Er blieb bei den Angekommenen stehen und fixierte Lady Fitzhoward mit verblassten blauen Augen.
»Hübsche Blume …«, murmelte er so leise, dass die Lady es wahrscheinlich überhört hatte. Rebecca wunderte sich über diesen dreisten Spruch, doch da hatte der Dienstmann ihn schon fortgescheucht.
Lady Fitzhoward wandte sich an Rebecca: »Falls Ihnen eine Woche mit Ihrem Bruder nicht genügt, dürfen Sie es mir ruhig sagen. Wenn ich nicht im Hotel bin, können Sie mir eine Nachricht beim Portier hinterlassen. Ich hoffe, wie ich schon sagte, selbst ein paar Freunde zu besuchen, solange wir hier sind.«
Rebecca nickte. »Das tue ich, danke. Und vielen Dank noch einmal, dass Sie Ihre Pläne geändert haben, um mich zu begleiten.«
Der Portier hatte mitbekommen, dass Rebecca ein anderes Ziel hatte, und bot an, ihr eine Droschke zu rufen.
Sie lehnte höflich ab. Der Weg durch das Dorf und den Wald zum Häuschen ihres Bruders zog sich zwar über eine Meile, doch da es ein schöner Tag war und sie nur eine leichte Tasche hatte, entschied sie, zu Fuß zu gehen.
Sie holte ihre kleine Reisetasche und die Hutschachtel aus den übrigen Gepäckstücken hervor, verabschiedete sich von den beiden Frauen und wandte sich zum Gehen. Schon nach wenigen Schritten wog die Reisetasche überraschend schwer – doch noch viel schwerer wog die Schuld, die sie mit sich schleppte.
Rebecca ging die Abbey Lane hinauf und überquerte die belebte High Street. Dann führte der Weg am Dorfanger entlang, auf dessen beiden Seiten sich Reetdachhäuser aneinanderreihten. Als sie die All-Saints-Street erreicht hatte, bog sie nach rechts in eine gepflasterte Straße mit Fachwerkhäusern ab. Aus dem Swan & Goose, der Dorfkneipe, drang der Geruch von Sauerbier.
Schließlich überquerte sie die kleine Brücke über den Fluss und ließ den Ort hinter sich. Der Weg an der Kirche und am Pfarrhaus vorbei wäre kürzer gewesen, doch sie war noch nicht bereit, sich den damit verbundenen ergreifenden Erinnerungen zu stellen.
Während sie dem Fluss in Richtung Wald folgte, drang das Weinen eines Kindes an ihr Ohr, das sich rasch zu einem herzzerreißenden Schluchzen steigerte. Sie schaute sich um, weil sie wissen wollte, woher das Weinen kam, und entdeckte unter einer ausladenden englischen Eiche einen kleinen Jungen von vielleicht vier oder fünf Jahren in langen Hosen mit hohem Bund, die mit den Knöpfen der Jacke verbunden waren. Auf den schmalen, zuckenden Schultern ruhte ein breiter, mit Rüschen besetzter Kragen.
Rebecca stellte ihr Gepäck ab und lief zu ihm. »Was hast du denn? Was ist passiert?«
Der Junge deutete mit tränenfeuchten Augen auf einen Baum. Ganz oben hatte sich ein Drache in den Zweigen verfangen; sein Schwanz und die Schnur hingen in dem knorrigen Geflecht fest.
»Oh je! Das ist ja schlimm.« Rebecca sah sich nach Hilfe um. »Wo wohnst du denn?«
Er fuhr sich mit dem Jackenärmel unter der laufenden Nase entlang und deutete über den an dieser Stelle sehr schmalen Fluss auf den Hintereingang des Pfarrhauses auf der anderen Seite.
»Bist du ganz allein hier draußen?«
Er schüttelte den Kopf und fing wieder an zu schluchzen.
Ein Mädchen, das ein paar Jahre älter als er war, tauchte mit einem langen Stock in der Hand auf.
»Hör auf zu weinen, Colin! Du bist doch kein Baby mehr! Ich versuche, ihn für dich runterzuholen.«
Als das Mädchen Rebecca bemerkte, erklärte es: »Er hat den Drachen zum Geburtstag bekommen, an dem er zum ersten Mal Kniehosen tragen durfte. Ich sollte ihm helfen, ihn fliegen zu lassen, aber der Wind hat ihn gepackt und mitgerissen.«
»Verstehe.« Rebecca blickte in den Baum hinauf und versuchte, die Lage einzuschätzen. »Ich klettere hinauf«, bot sie an. »Du bleibst hier unten und passt auf deinen Bruder auf, ja?«
Das Mädchen machte große Augen und betrachtete kritisch Rebeccas ordentliche Reisekleidung und ihren Hut. »Sie, Miss?«
Rebecca nickte und nahm den Hut ab – Lady Fitzhoward hatte ihn ausgesucht. Die Feder würde sich nur im Geäst verfangen. Dann band sie ihren Unterrock zwischen ihren Knien fest, um nicht mehr zu zeigen, als ihr lieb war. Ein rascher Rundumblick überzeugte sie, dass nur die beiden Kinder Zeugen ihres wenig damenhaften Verhaltens sein würden.
Ganz in der Nähe lag neben einem Baum ein zerbrochenes Wagenrad. Sie rollte es herüber und lehnte es gegen den Stamm; es sollte ihr als Aufstiegshilfe dienen. Der unterste Zweig des Baumes war ein ganzes Stück fast horizontal gewachsen, bevor er sich nach oben bog. Seine Form hatte sie schon immer an einen trompetenden Elefanten erinnert, so wie der, den sie einmal in Astley's Amphitheater gesehen hatte. Für die Kinder war der Ast zu hoch, doch Rebecca gelang es mithilfe des Rads, ihn mit ihren behandschuhten Händen zu ergreifen und sich halb hochzuziehen, halb hochzuschwingen. Die raue Rinde streifte über ihre feinen Strümpfe, die bei dieser Kletterei ganz bestimmt ruiniert werden würden. Von dem Ast aus war der weitere Aufstieg relativ einfach, beinahe wie auf einer Leiter.
Die Kinder unter ihr applaudierten begeistert. Fast fühlte sie sich selbst wie eine Akrobatin von Astley's Theater.
Rebecca hatte noch nie unter Höhenangst gelitten und war als Mädchen mit Begeisterung auf Bäume – auch auf diesen – geklettert, ohne auf zerkratzte Hände und aufgeschürfte Knie zu achten. Doch jetzt war sie eine junge Dame, und dazu noch völlig aus der Übung und ohne jede Kondition, sodass ihr das Atmen beim Ersteigen der großen Eiche schon bald schwer wurde.
Endlich kam sie in die Nähe des Drachens. Sie setzte einen Fuß auf einen passenden Ast und stemmte den anderen zum besseren Stand gegen einen anderen. Dann begann sie die mühselige Arbeit, den Schwanz und die Schnur des Drachens zu entwirren.
Dazwischen warf sie einen Blick auf die unten wartenden Kinder. Das Blätterdach verbarg das Mädchen vor ihren Blicken, doch der Junge, der immer noch Tränen in den Augen hatte, war gut zu sehen.
»Bekommen Sie ihn frei?«, hörte sie das Mädchen fragen. »Schaffen Sie es?«
Plötzlich verengte sich ihr Blickfeld und ihr wurde seltsam schwindelig. Die Szene und diese Bitte waren ihr nur allzu vertraut, sie versetzten sie um Jahre zurück, als sie aus einer ähnlichen Höhe auf den weinenden John hinuntergesehen hatte, auch wenn dieser damals etliche Jahre älter war als der Junge, der jetzt dort unten stand.
»Darf ich?«, hatte er gebeten. »Bitte! Nur dieses eine Mal!«
Er hatte mit ihr zusammen den Baum hinaufklettern wollen. Ihre Eltern hatten ihr aufgetragen, gut auf ihren kleinen Bruder aufzupassen, damit ihm nichts passierte. Sie hatte gewusst, dass John noch zu klein war, um auf den Baum klettern zu können. Doch er hatte nicht aufgehört zu betteln und zu weinen, sodass sie schließlich nachgegeben hatte. Wenn sie dicht bei ihm blieb, so hatte sie gedacht, würde es schon gut gehen. Sie hatte ihm auf den untersten Ast geholfen, und von dort war er allein weitergeklettert und hatte ihre Warnungen und Bitten, auf sie zu warten und nicht zu hoch zu klettern, ignoriert.
Mit klopfendem Herzen war sie ihm nachgeklettert, doch bevor sie ihn erreicht hatte, war er ausgerutscht und heruntergefallen. Er war auf dem harten Boden unter dem Baum aufgekommen und still, ganz still liegen geblieben …
»Ist alles in Ordnung, Miss?«, rief das Mädchen hinauf und riss sie aus der dunklen Wolke ihrer Erinnerung.
»Äh – ja. Es hat nur ein Weilchen gedauert, ihn freizubekommen.«
Endlich ließ Rebecca den befreiten Drachen in die ausgestreckten Hände fallen, die ihn erwarteten. Die Schnur, die sie ebenfalls losgemacht hatte, ließ sie hinterherfallen.
Dann kletterte sie vorsichtig wieder von dem Baum hinunter, bis sie auf dem untersten Ast saß und sich zum Sprung bereitmachte. Irgendwie kam ihr der Ast plötzlich viel höher vor als beim Aufstieg.
Sie holte tief Luft und sprang, doch beim Aufkommen verlor sie das Gleichgewicht und fiel hin. Als sie sich aufrappelte, entdeckte sie einen Grasfleck auf ihrem Kleid und stöhnte innerlich. Lady Fitzhoward sah alles. Sie bückte sich und rubbelte an dem Fleck, doch ohne Erfolg. Hoffentlich konnte Rose ihr helfen, ihn zu entfernen.
Der kleine Junge schlang die Arme um ihre Knie und fügte dem braun-grünen Fleck noch ein wenig Schnodder hinzu.
Das Mädchen knickste. »Vielen Dank, Miss …? Darf ich Ihren Namen wissen?«
»Ich bin Miss Lane.« Rebecca sammelte ihre Sachen zusammen und richtete sich auf. »Darf ich euch für euer nächstes Drachenabenteuer die Dorfwiese vorschlagen?«
Die Kinder lächelten schüchtern und nickten zustimmend. Dann winkten sie ihr zum Abschied.
Als Rebecca die schmale Fußgängerbrücke erreicht hatte, überquerte sie erneut den Fluss und setzte ihren Weg durch Fowler's Wood fort, der zum Hintereingang des Häuschens führte, in dem ihr Bruder wohnte. Das strohgedeckte Cottage war früher das Wohnhaus des Verwalters von Wickworth gewesen, doch die Wilfords beschäftigten inzwischen nur noch einen Wildhüter und hatten John und Rebecca das Häuschen billig vermietet. Sie hatte ein paar Jahre mit ihrem Bruder zusammen dort gewohnt, bis finanzielle Schwierigkeiten und Spannungen zwischen den Geschwistern sie veranlasst hatten, eine Stellung als Gesellschafterin bei einer älteren Lady anzunehmen.
Auf ihr Klopfen hin kam die alte Haushälterin, Rose Watts, an die Tür. Ein Lächeln trat bei Rebeccas Anblick auf ihr freundliches, alterndes Gesicht.
»Miss Rebecca! Was für eine schöne Überraschung! Gott sei Dank!«
Rebecca stutzte. »Warum denn eine Überraschung, Rose? Ich habe John doch geschrieben und ihn gebeten, Ihnen meine Ankunft mitzuteilen. Hat er meinen Brief denn nicht bekommen?«
Der Blick der Frau wanderte zu einem Korb auf dem Regal, der überquoll von Briefen und Zeitungen. »Vielleicht liegt er ja da drin.« Rose sah Rebecca an und fragte. »Haben Sie meinen Brief erhalten?«
»Ja, deshalb bin ich ja hier. Ist John zu Hause?«
»Natürlich. Er ist immer zu Hause.«
Rebecca konnte durch das Esszimmer ins Wohnzimmer sehen; sie waren beide leer.
Rose, die ihren Blick gesehen hatte, seufzte. »Er ist in seinem Zimmer. Wahrscheinlich schläft er noch.«
»Er schläft noch? Es ist drei Uhr nachmittags!«
Das Gesicht der Haushälterin verzog sich zu einem seltsamen Ausdruck, der halb entschuldigend, halb gequält war. »Ich habe es Ihnen doch geschrieben. Er ist die ganze Nacht wach und geht in seinem Zimmer auf und ab, dann verschläft er den Tag. Und wenn ich versuche, ihn darauf anzusprechen, wird er fuchsteufelswild.«
Rebecca ging durch den Flur und klopfte an die Schlafzimmertür. »John? Ich bin's, Rebecca. Ich bin wieder da.«
Keine Antwort. Sie nahm ihren Hut ab, zog die Handschuhe aus und versuchte es erneut. Wieder keine Antwort.
Um ihre aufsteigende Panik zu beschwichtigen, ging Rebecca erst einmal über den Flur zu ihrem Zimmer, um ihre Reisetasche abzustellen. Sie öffnete die Tür und – erstarrte. Ein heilloses Durcheinander empfing sie. Zwischen Tür und Bett stand ein kleiner Tisch, der willkürlich hineingeschoben und mit einem gefährlich hohen Stapel beschriebener Seiten beladen worden war. Auch das Bett war übersät mit Papieren. Quer durch den Raum waren Schnüre gespannt, an denen Manuskriptseiten aufgehängt waren. Auf dem Beistelltisch und der Frisierkommode stapelten sich Nachschlagewerke, Tintenfässer, Kerzenstümpfe, Kaffeetassen, Teller, ganze Berge getragener Kleidung. Inmitten des Desasters lag Johns Bratsche, auf der er, soviel Rebecca wusste, seit Jahren nicht mehr gespielt hatte.
Rose, die ihr gefolgt war, blieb hinter ihr in der Tür stehen. »Es tut mir leid, Miss Rebecca. Er benutzt das Zimmer als eine Art Büro und – Lager. Ich hätte ihn gebeten, es aufzuräumen, oder es auch selbst aufgeräumt, wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen. Was müssen Sie nur von mir denken! Zu meiner Rechtfertigung kann ich allerdings anführen, dass ich in letzter Zeit alle Hände voll damit zu tun hatte, eine Abschrift von Johns neuem Manuskript anzufertigen.«
»Ich verstehe.« Rebecca deutete auf die Seiten, die an den Schnüren hingen. »Und was soll das?«
»Ich glaube, er hat etwas darüber verschüttet und versucht, sie zu trocknen.«
»Ah ja. Ich … hm. Ich werde heute Nacht erst einmal auf dem Sofa schlafen, und morgen sehen wir weiter.«
Rose sah sie mit gequältem und entschuldigendem Blick an. »Kommen Sie doch mit in die Küche, ich muss Ihnen noch etwas erzählen.«
In der Küche bekam Rebecca eine Tasse Tee und setzte sich zu Rose an den abgenutzten Holztisch.
Die ältere Frau begann: »Nachdem ich Ihnen geschrieben hatte, habe ich erfahren, dass ein gewisser Autor – Sie wissen schon, wen ich meine – sich ein Zimmer im Swanford Abbey Hotel genommen hat. Ich weiß das von Cassie Somerton selbst – sie ist die Hausdame dort. Er ist gestern Abend eingetroffen. Die Neuigkeit hat sich rasch im Dorf herumgesprochen, und ich mache mir Sorgen, wie John darauf reagieren wird.«
Rebecca nickte. Eine neue Angst stieg in ihr auf. Was wollte dieser Mensch in Swanford?
Sie hatten gerade ausgetrunken, als der Verwalter der Wilfords an die Tür klopfte.
Rebecca versuchte erneut, ihren Bruder aufzuwecken. »John«, rief sie durch die geschlossene Tür. »Mr Jones ist hier, wegen der Miete. John?«
Der große Mann hinter ihr trat verlegen von einem Fuß auf den anderen, dann zuckte er die Achseln. »Schon gut, Miss. Ich möchte Ihnen das Nachhausekommen nicht verderben. Ich kann ein andermal wiederkommen.«
Mit hochrotem Gesicht antwortete Rebecca: »Ich danke Ihnen, Mr Jones, und entschuldige mich für die Umstände, die wir Ihnen bereiten.«
Später, als Rose den Tisch deckte, versuchte Rebecca es erneut. »John? Das Essen ist gleich fertig. Bitte komm zu Tisch.«
Keine Antwort. Sie presste ihre Stirn gegen die dicke Holztür und fuhr in bittendem Ton fort: »John? Bitte antworte mir doch. Ich mache mir allmählich Sorgen.«
Schließlich kehrte sie in die Küche zurück und fragte Rose: »Sie haben doch einen Schlüssel zu seinem Zimmer, oder?«
Rose, die gerade die Bratensoße in die Soßenschüssel goss, nickte »Ich habe ihn einmal benutzt, als er nicht geantwortet hat, aber da ist er sehr zornig geworden und hat mir verboten, das jemals wieder zu tun.«
Rebecca hob das Kinn. »Nun, mich hat er noch nicht gewarnt.«
Rose reichte ihr den Schlüssel von ihrem Schlüsselbund und runzelte bekümmert die Stirn. Rebecca machte sich ebenfalls Sorgen. Ihre größte Sorge war, dass ihr Bruder sich etwas angetan hatte.
Sie ging über den Flur, holte tief Luft und führte den Schlüssel ins Schlüsselloch ein. Dann stieß sie die Tür auf. Die Angeln quietschten protestierend.
Da lag er: Er hatte die Augen geschlossen und befand sich halb angezogen, ungewaschen und ungekämmt inmitten von zerwühltem Bettzeug. Um ihn herum lagen und standen überall Teetassen, leere Whiskeyflaschen, zusammengeknüllte Blätter, kleinere, verdächtig aussehende braune Fläschchen und halb leer gegessene Teller. Der Geruch nach Schweiß und verdorbenem Fleisch hing in der Luft.
Sie rümpfte die Nase. »John?«
Keine Reaktion. Ihr Herz schlug heftig.
»John!«, wiederholte sie scharf, trat vorsichtig zwischen dem Unrat hindurch ans Bett und rüttelte an seiner Schulter.
Seine Lider flatterten. »Was ist denn?« Sein Gesicht verzog sich verwirrt und missmutig. »Becky? Was machst du denn hier? Lass mich in Ruhe!«
Was ist los mit dir?, hätte sie am liebsten geschrien, doch der dicke Kloß in ihrer Kehle ließ es nicht zu. Sie wusste, was mit ihm los war, oder konnte es sich zumindest vorstellen. Er war seit jenem Sturz vom Baum nie mehr so gewesen wie vorher. Stattdessen hatte sich sein Zustand in den letzten Jahren ständig verschlimmert, und durch eine tiefe Depression und zu viel Alkohol war er zerfahren, lethargisch und launenhaft geworden.
Und was war der Grund für all das?
Sie kannte ihn nur allzu gut.
Frederick Wilford stand in der Tür des Salons von Wickworth und ließ den Blick durch die Eingangshalle schweifen. Sämtliche Möbel, die Spiegel und die stehen gebliebenen Uhren waren mit weißen Leintüchern verhüllt – und das nun schon seit zwei Jahren.
Werde ich die Vergangenheit denn nie hinter mir lassen können?, fragte er sich. Werde ich ihr … und mir selbst je vergeben können?
Im oberen Stock erklangen Hammerschläge, das Geräusch schien sich förmlich in sein Hirn zu bohren. Er rieb sich die schmerzenden Schläfen, doch es half nichts.
Plötzlich schwang die Eingangstür auf. Der Besucher hatte es offensichtlich nicht für nötig erachtet zu klopfen. »Freddy? Da bin ich!«
Frederick ging quer durch die Halle, um seinen jüngeren Bruder zu begrüßen, der in London lebte, aber jedes Jahr zweimal zu Besuch kam.
Der sehr gepflegt wirkende, lebhafte blonde junge Mann stellte seine Reisetasche ab und reichte einem wie aus dem Nichts aufgetauchten Diener seinen Mantel.
Frederick sah an ihm vorbei und fragte. »Hast du deinen Kammerdiener gar nicht mitgebracht?«
»Nein. Der Narr hat mich verlassen und geheiratet.« Thomas sah sich erstaunt um. »Immer noch alles unter Schutzhüllen? Also wirklich, Freddy, hier sieht's aus wie in einem Mausoleum.«
»Dir ebenfalls eine guten Tag, Tom. Willkommen zu Hause.«
Thomas schüttelte abwehrend den Kopf. »Wickworth ist seit Ewigkeiten nicht mehr mein Zuhause, vielen Dank. Wer wollte auch hier leben? Geister vielleicht, aber ganz bestimmt keine lebendigen, atmenden Menschen.«
»Du weißt doch, warum alles zugedeckt ist. Wir renovieren.«
»Wirklich? Ich dachte, nach Marinas Tod hättest du das abgeblasen. Die Renovierung war doch ihre Idee, oder?«
»Ich habe die Pläne für dieses Stockwerk erst einmal verschoben. Die Männer arbeiten momentan oben und richten die Gästezimmer her.« Er deutete hinter sich. »Aber ich kann diese klaffende Lücke zwischen der Bibliothek und dem Salon nicht für immer offen lassen.«
Die Augen seines Bruders glitzerten. »Wie eine Wunde, die nicht heilen will?«
Frederick runzelte die Stirn.
»Also, hier kann ich nicht bleiben«, erklärte Thomas entschieden. »Nicht mit diesem Gestank nach Farbe und dem vielen Staub in der Luft. Als ich nach Weihnachten abgereist bin, habe ich einen schrecklichen Husten mitgenommen. Lass uns für diese Zeit in die Abtei ziehen – als kleinen Urlaub für uns beide. Was meinst du?«
Oben setzte das Hämmern wieder ein, Fredericks Kopfschmerzen wurden unerträglich.
»Komm schon«, drängte Thomas. »Die Zusammenkunft wegen des Kanalprojekts hältst du doch sowieso dort ab. Außerdem – wann hast du das letzte Mal ein paar Nächte außerhalb dieses Gemäuers verbracht?«
Und außerhalb der Erinnerungen, die es birgt …, fügte Frederick im Stillen hinzu.
»Na gut, von mir aus. Vorausgesetzt, sie haben noch Zimmer frei.«
Thomas strahlte. »Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Wir werden es uns dort so richtig gut gehen lassen.«
Das bezweifelte Frederick dann doch sehr.
Am nächsten Morgen lag Rebecca noch auf dem Sofa im Wohnzimmer und schlief, als John plötzlich mit einem Packen Manuskriptseiten in der Hand aus seinem Zimmer gestürzt kam.
»Dass du gerade jetzt gekommen bist, ist ein Zeichen, Becky!«
Rebecca fuhr erschrocken hoch und blickte verwirrt auf die verwahrloste Erscheinung ihres Bruders. Er stand wie unter Strom und machte einen fiebrigen Eindruck. »Hast du überhaupt geschlafen?«
Er schüttelte den Kopf, dabei fielen ihm fettige Haarsträhnen in die Stirn. »Ich war die ganze Nacht wach und habe nachgedacht – und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Du bist die perfekte Wahl, ihm mein neues Manuskript zu übergeben.«
Sie war noch immer verwirrt. »Was?«
»Ich habe es anderen Verlegern zugeschickt, aber alle haben abgelehnt, die meisten, ohne es überhaupt zu lesen. ›Zurück an den Absender!‹, stand einfach drauf. Meine einzige Chance ist, dass Oliver es seinem Verleger empfiehlt.«
Rebecca setzte sich auf. »Glaubst du denn, das würde er tun? Nach allem, was vorgefallen ist?«
»Rose hat eine Abschrift für mich angefertigt. Er braucht ja nicht zu wissen, dass es von mir ist, bis er es seinem Verleger vorgelegt hat. Wir verwenden einfach ein Pseudonym.«
Rebecca dachte nach, dann runzelte sie die Stirn. »Wird Mr Edgecombe denn überhaupt im Hotel sein? Ich bin ihm an jenem Tag begegnet, wir …« Sie verstummte, weil sie John nicht an jene unselige Szene erinnern wollte, und sagte nur: »Vielleicht könnte ich ihm das Manuskript geben?«
John schüttelte den Kopf. »William Edgecombe ist vor gut einem Jahr gestorben. Sein Bruder Thaddäus hat den Verlag übernommen, aber auch er nimmt keine unaufgefordert zugesandten Manuskripte an.«
»Wir könnten an Mr Olivers Mitgefühl appellieren und ihn daran erinnern, was er dir verdankt.«
John setzte sich auf dem Sofa neben ihre Füße. »Nein, Becky. Am besten, du erwähnst mich überhaupt nicht. Du weißt doch, dass er dann nur misstrauisch wird. Er würde es vermutlich aus reiner Gehässigkeit verbrennen.«
»Oder stehlen«, murmelte Rebecca.
»Vielleicht. Aber wenn ich meine Arbeit aufs Spiel setzen will, ist das einzig und allein meine Sache.« Johns Augen glänzten. »Und wenn er sie ein zweites Mal stiehlt – nun, diesmal bin ich vorbereitet. Wir haben eine Kopie, und Rose hat das Buch gelesen. Du könntest vielleicht ebenfalls ein paar Kapitel lesen, das hast du ja letztes Mal versäumt. Dann stünde nicht nur mein Wort gegen das seine.«
Wieder empfand sie einen schmerzhaften Stich der Reue. Sein Sturz vom Baum war nicht das Einzige, wofür sie sich verantwortlich fühlte.
»Es gibt keinen anderen Weg«, fuhr John mit lauterer Stimme fort. »Das ist die einzige Möglichkeit.«
Rebecca traute Ambrose Oliver nicht und konnte nicht verstehen, dass ihr Bruder eine solche Möglichkeit überhaupt in Erwägung zog. Zögernd wandte sie ein: »Ich halte es nicht für ratsam …«
»Hör auf«, schrie er. »Davon verstehst du nichts. Ich weiß sehr viel mehr über das Verlagsgeschäft als du!«
Rebecca verbiss sich eine Antwort, sie konnte sehen, dass er im Begriff war, sich in einen seiner Wutanfälle hineinzusteigern.
Oh John! Er konnte nicht vernünftig denken. Würde sein Verstand je wieder Frieden finden?
Sie legte ihm eine Hand auf die heiße Stirn. »Du musst ihm vergeben, John, um deiner selbst willen. Die Verbitterung frisst dich auf.«
»Ihm vergeben?«, höhnte ihr Bruder. »Er hat mich bestohlen, hat meine Zukunftschancen, meinen Namen ruiniert. Mich einen Lügner genannt. Ich sollte ihn wegen Verleumdung verklagen, das wäre das Mindeste! Und das würde ich auch – wenn ich Belege hätte. Oder mir einen besseren Anwalt leisten könnte.«
Rebecca seufzte. Wie oft hatte sie sich das schon anhören müssen! Sie sagte leise: »Ich möchte nicht schon wieder gehen, ich bin doch gerade erst angekommen. Und ich möchte dir helfen …«
»In der Abtei kannst du mir sehr viel nützlicher sein«, beharrte er. »Ich habe doch Rose. Ich brauche keine zwei Frauen um mich herum, die mich ständig maßregeln. Also pack deine Sachen zusammen, es könnte etwas dauern, bis du Gelegenheit hast, mit ihm zu reden.«
»John, eine unverheiratete Frau kann nicht allein in einem Hotel logieren.«
»Hält sich deine Lady F denn nicht gerade dort auf?«
»Das weiß ich nicht. Sie hat gesagt, sie wolle eventuell Freunde besuchen.«
Er zuckte die Achseln. »Wie auch immer, es gibt keinen Grund, sich so anzustellen, schließlich sollst du nicht in einem Herrenclub in London absteigen. Wir reden von Swanford Abbey – das ist eine höchst respektable Unterkunft.«
Sie blickte zu ihrem Bruder auf, eine Erwiderung auf den Lippen, doch bevor sie etwas sagen konnte, sah er ihr in die Augen und flehte: »Bitte. Bitte, hilf mir, Becky.«
Und plötzlich sah sie wieder den kleinen Jungen vor sich, der mit zerzaustem Haar und einem Buch in der Hand auf ihr Bett kletterte. »Lies mir eine Geschichte vor, Becky. Bitte!«
Sie holte tief Luft und sagte: »Ich werde darüber nachdenken.« Dann wollte sie nach dem Manuskript greifen, doch er zog es weg.
»Nicht das hier, du machst es nur schmutzig. Du kannst die Kopie lesen, wenn du willst. Allerdings hast du dich ja nie sehr für meine Arbeit interessiert …«
Bei dieser Erinnerung an ihre alte Schuld zog sich ihr Magen schmerzhaft zusammen. Wie sehr wünschte sie sich ihren Bruder zurück, wie er einmal gewesen war, doch sie fürchtete, dass dieser John für immer fort war.
Rebecca setzte ihre Brille auf und las ein paar Kapitel von Johns Manuskript. Es war in der Tat nicht schlecht, dachte sie, doch dann legte sie die Blätter beiseite und erhob sich, um sich anzukleiden. Danach ging sie in die Küche, wo Rose über das Haushaltsbuch gebeugt am Tisch saß.
Die alte Haushälterin, die auch ihre Köchin war, hob den Kopf und sah sie entschuldigend an. »Ich bin ein bisschen im Verzug: mit den Büchern und auch mit der Hausarbeit.«
Rebecca setzte sich ihr gegenüber. »John hat mich gebeten, Mr Oliver Ihre Kopie des Manuskripts zu bringen.«
Rose nickte. »Ich habe es gehört.«
»Ich halte es für unvernünftig, ja für völlig falsch. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt versuchen soll.«
Rose hob ihre mit Adern überzogene, von harter Arbeit gezeichnete Hand und legte sie an Rebeccas Wange. »Wenn das alles ist, was er verlangt, dann tun Sie ihm den Gefallen. Immer noch besser, Sie gehen hin, als wenn John selbst es tun würde. Wir müssen ihn von Swanford Abbey fernhalten, bis Ambrose Oliver wieder abgereist ist.«
Rose hatte recht. Und doch – es graute Rebecca davor, Swanford Abbey zu betreten, einen Ort, den sie seit ihrer Kindheit gemieden hatte.
Mit einem resignierten Seufzer machte sie sich daran, ihre Reisetasche wieder zu packen. Zum Schluss schaute sie sich noch einmal im Zimmer um, um sich zu vergewissern, dass sie nichts vergessen hatte.
Dabei fiel ihr auf, dass das Familienbild der Lanes nicht mehr über dem Kamin hing. Hatte Rose oder John es aus einem bestimmten Grund abgenommen?
Sie trat näher an den Kaminsims. Jemand hatte drei Skizzen daraufgestellt – zwar künstlerisch nicht perfekt und ungelenk gezeichnet, und doch so unersetzlich. Ihre Mutter hatte sie im Garten des Pfarrhauses gezeichnet. Die erste Skizze zeigte die getäfelte Vordertür und die Veranda des Pfarrhauses mit den geißblattumrankten Säulen. Die zweite stellte zwei Kinder beim Ballspiel dar. Die Kinder sollten sie und John sein, das wusste sie, auch wenn die schlichte Zeichnung keinerlei Ähnlichkeiten mit ihnen aufwies. Und auf der dritten Zeichnung sah man einen Mann in Schwarz – ihren Vater. Er stand neben dem alten Rosenstrauch, der Rebecca an die Treibhausblumen erinnerte, die sie bei ihrem letzten Besuch hier zu Hause auf das Grab ihrer Eltern gelegt hatte.
Ihr Blick wanderte nach oben, auf die leere Stelle an der Wand. Die Zeichnungen waren ihr lieb und teuer, weil sie von ihrer Mutter stammten. Doch sie waren nur ein höchst unvollkommener Ersatz für das von einem bekannten Maler geschaffene Gemälde, auf dem ihre Eltern, sie selbst und John als Kleinkind zu sehen waren.
Rose schwärmte mit einem Besen um sie herum.
»Rose, wo ist unser Familienporträt?«
Die Haushälterin zögerte und verzog das Gesicht, das dadurch noch zerfurchter wirkte. »Weg. John hat es verkauft.«
Rebecca war fassungslos. »Verkauft? Aber warum?«
»Er hat das Geld gebraucht. Oder jedenfalls gewollt.«
»Aber wer wollte denn ein Familienbild von uns kaufen?«
»Keine Ahnung. Hat es nicht irgendeine Berühmtheit gemalt?«
Rebecca zuckte die Achseln. »Samuel Lines, glaube ich. Oder einer seiner Schüler. Ich war damals noch sehr klein.« Der Verkauf, den sie wie einen Verrat empfand, machte sie zornig. »Er hatte nicht das Recht, es zu verkaufen!«
»Ich verstehe Ihren Ärger, meine Liebe. Aber glauben Sie mir, die Sache ist es nicht wert, dass Sie Ihren einzigen Bruder darüber verlieren. Ein lebender, atmender Angehöriger ist wichtiger als jedes Gemälde.«
Rebecca schloss die Augen und holte etwas zittrig Luft. »Da haben Sie wohl recht. Ich werde es noch mit John selbst besprechen, aber erst später. Im Moment sind andere Dinge wichtiger.«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 2
Während sie zitternd die Mappe mit dem Manuskript in der einen und die Reisetasche in der anderen Hand hielt, machte Rebecca sich auf den Weg zurück zu der mittelalterlichen Abtei – der Stätte zahlreicher Gruselgeschichten aus ihrer Kindheit. Ihr Herz klopfte so heftig, dass es beinahe wehtat. Das Aussteigen im Stallhof war nicht so schlimm gewesen, aber die Abtei selbst betreten …
Als kleines Mädchen hatte sie alles getan, um diesen Ort zu meiden. Lieber war sie um Mr Dodges Acker herumgelaufen, als den direkten Weg an der Abtei vorbei zu nehmen. Jedes Jahr am Abend vor Allerheiligen hatten sich die Dorfkinder Geschichten von der bösen Äbtissin erzählt, die durch die Kirchenruine spukte und sich wie das Skelett eines vorzeitlichen Mammuts über der Abtei erhob. Rebecca hatte einmal auf einer Ausstellung eins gesehen.
Unter den Dorfkindern galt Swanford Abbey noch immer als Spukhaus. Sie erzählten sich, dass darin die Geister der Nonnen wohnten, die ihr Heim und ihr Leben verloren hatten, als der englische König sämtliches Kircheneigentum beschlagnahmt und alle Klöster aufgelöst hatte. Damals war die Abtei an einen Adligen gefallen, einen Getreuen der Krone, der über den alten Kreuzgängen und um sie herum eine weitläufige private Residenz errichtet hatte. Sharington Court war ein zweieinhalb Stockwerke hohes Haus mit einem Schieferdach, spiralförmig geriffelten Schornsteinen und Bogenfenstern. Viele Generationen der Familie Sharington hatten dort gelebt, bis vor gut dreißig Jahren schließlich der letzte Sharington ohne Nachkommen gestorben war. Das Haus war verschlossen worden, die angrenzende Kirche, deren Dach bereits eingestürzt war, verfiel vollends. Die Dorfkinder pflegten später als eine Art Mutprobe die eingestürzten Mauern zu erklettern, die Mutigsten unter ihnen spielten sogar in den Ruinen.
Rebecca erinnerte sich noch gut an das einzige Mal, dass sie auf eine solche teilweise eingestürzte Mauer der Ruine geklettert war. Ein Junge aus dem Dorf hatte ihr dabei die ganze Zeit Gruselgeschichten erzählt, bis sie sich irgendwann weder vor- noch zurückgetraut hatte.
Und dann war plötzlich der hübsche Frederick Wilford aufgetaucht und hatte amüsiert lächelnd zu ihr aufgesehen.
»Darf ich Ihnen helfen, junge Dame?«
Erleichtert hatte sie genickt, und gleichzeitig war ihr ein wohliger kleiner Schauer über den Körper gelaufen, als er sie auf den Boden gestellt hatte …
Rebecca blinzelte die Erinnerung fort. Könnte sie ihre kleinmädchenhafte Backfisch-Verliebtheit doch nur ebenso leicht abstreifen!
Vor mehreren Jahren war Sharington Court verkauft und – nach mehreren finanziellen Rückschlägen – in ein Grand Hotel umgebaut worden. Doch Rebecca hatte noch immer nicht das geringste Bedürfnis, diesen Ort zu betreten. Sie spürte, wie sich ihre Nackenhärchen aufrichteten, während sie in die kiesbedeckte Einfahrt einbog und dabei an die körperlosen Gespenster dachte.
Als sie vor einer der zum Eingangsportal emporführenden zwei Treppen stand, holte sie noch einmal tief Luft und stieg hinauf. Augenblicklich wurde die große Tür von einem beflissenen Portier geöffnet, der ganz erfüllt von seiner eigenen Wichtigkeit zu sein schien. Zu ihrem großen Schrecken erkannte sie in ihm Sir Roger Wilfords ehemaligen Kammerdiener; jetzt trug er eine vornehme Dienstkleidung.
»Guten Tag, Mr Moseley.«
»Ah – wenn das nicht Rebecca Lane ist! Sie sind aber erwachsen geworden! Du meine Güte, ich komme mir plötzlich richtig alt vor. Ich weiß noch, wie Sie in einer mit Grasflecken übersäten Schürze über die Dorfwiese gerannt sind.«
Rebecca war rot geworden. Verlegen neigte sie den Kopf. »Das war vor langer Zeit. Wie schön, Sie wiederzusehen.«
»Ich freue mich auch, Miss. Es ist eine Ewigkeit her.«
»Ich war auf Reisen.«
»Ach wirklich? Ich würde ja sagen, ›wie schön‹, aber die Wahrheit ist, ich bin ein richtiger Stubenhocker. Ich genieße es, mich abends in mein eigenes Bett zu legen.«
Er bot an, ihr die Tasche abzunehmen, doch sie schüttelte den Kopf. Sie wusste ja noch gar nicht, ob sie ein Zimmer bekam. Hoffentlich nicht!
Er schien darauf bestehen zu wollen, doch in diesem Moment fuhr eine große Reisekutsche vor. Moseley wandte sich augenblicklich den Neuankömmlingen zu und rief nach zwei Trägern, die sich um das Gepäck kümmern sollten.
Rebecca betrat Swanford Abbey allein.
Drinnen befand sie sich in einer gotischen Halle von beeindruckender Größe, die jetzt als weitläufige Empfangshalle diente. In einem Kamin, in dessen Sims zwei gekreuzte Säbel geschnitzt waren, brannte ein üppiges Feuer. Rechts und links der Feuerstelle standen zwei glänzend polierte Kaminböcke. Ein dicker türkischer Teppich dämpfte die Geräusche in dem riesigen Raum. Überall standen kleine Teetische, rote Samtsessel und Sofas.
Alles um sie herum strahlte Reichtum und Luxus aus. Als Begleiterin einer wohlhabenden Witwe sollte Rebecca diese Dinge eigentlich gewohnt sein, doch heute war sie als sie selbst hier. Sie war eine ehemalige Pfarrerstochter und zurzeit Gesellschafterin einer älteren Lady. Daher fühlte sie sich sehr fehl am Platz.
Ob Lady Fitzhoward wohl noch hier war? Oder war sie schon unterwegs, um ihre Freunde zu sehen? Aber sie war nicht wegen Lady Fitzhoward gekommen.
Zögernd trat sie an den schimmernden Eichenholz-Tresen. Der Hotelangestellte taxierte sie mit geübtem Blick. Vielleicht hätte sie eines der modernen Kleider anziehen sollen, die Lady Fitzhoward ihr gekauft hatte, und nicht das schlichte Tageskleid mit dem schmucklosen Jäckchen.
»Kann ich … Ihnen helfen?«, fragte der junge Mann.
»Guten Tag. Ich würde gern Mr Ambrose Oliver sprechen. Soviel ich weiß, logiert er hier.«
Er musterte sie erneut von oben bis unten und fragte dann schmallippig: »Darf ich nach Ihrer Verbindung zu Mr Oliver fragen? Sind Sie … eine Freundin?« In seinen Augen lauerte ein schmutziger Verdacht.
»Aber nein. Ich möchte ihn in einer geschäftlichen Angelegenheit sprechen. Das Verlagsgeschäft betreffend.« Sie hob die Mappe, die sie unter dem Arm trug, um ihre Bitte zu unterstreichen, und fügte hinzu: »Mein Bruder war sein … Mitarbeiter.«
Der Angestellte schüttelte den Kopf. »Mr Oliver ist für niemanden zu sprechen. Er hat Anweisung gegeben, ihn nicht zu stören.«
Rebecca wusste nicht, was größer war, ihre Bestürzung oder ihre Erleichterung. »Könnte ich dann vielleicht mit seinem Verleger, Mr Edgecombe, sprechen?«
Erneutes Kopfschütteln. »Bei uns wohnt niemand mit diesem Namen.«
Jetzt war sie doch enttäuscht. Hoffentlich sah sie nicht so niederschlagen aus, wie sie sich fühlte.
Mr Moseley, der gerade die Neuankömmlinge hineinbegleitete, sagte: »Raymond, das ist doch Miss Lane, die Tochter unseres ehemaligen Pfarrers. Sei bitte höflich zu ihr.«
Der Angesprochene hob streitlustig das Kinn, doch dann erläuterte er ihr mit gedämpfter Stimme: »Ich kann Ihnen nur sagen, dass ein Mr Edgecombe gestern hier war, um sich mit einem berühmten Gast zu treffen, und dass wir ihn in den nächsten Tagen zum Dinner zurückerwarten. Mehr kann ich leider nicht für Sie tun.«
»Ich verstehe. Vielen Dank.« Rebecca drehte sich um und trat beiseite, um den hinter ihr wartenden neuen Gästen Platz am Tresen zu machen.
Sie ging quer durch die Halle zu einem der Sessel und setzte sich, um erst einmal nachzudenken. Ihre Reisetasche stellte sie neben den Stuhl. Sie hätte es vorgezogen, die Ausgaben für eine Übernachtung zu vermeiden, obwohl ihr Bruder unmissverständlich geäußert hatte, dass er es nicht schätzte, wenn sie bei ihm im Haus wohnte und ihn oder seine Unordnung kritisierte. Doch sollte sie wirklich als junge, unverheiratete Dame allein in einem Hotel bleiben?
Wenn sie sich ganz still verhielt und für sich blieb, bemerkte sie ja vielleicht niemand.
Eine Bewegung am anderen Ende der Halle erregte ihre Aufmerksamkeit. Hinter einem großen Flügel führte eine prachtvoll geschwungene Treppe zu einer Galerie hinauf. Gerade kam ein hochgewachsener, dunkelhaariger Mann die Stufen herunter. Der Anblick traf sie wie ein Schlag. Nicht er. Nicht hier. Nicht jetzt. Rasch wandte sie das Gesicht ab und betete, dass er sie nicht gesehen hatte.
Zu spät.
»Miss Lane?«
Sie schloss für einen Moment die Augen. Gab es noch eine Möglichkeit, dieser Situation zu entkommen? Nein. So viel zu ihrem Wunsch, für sich zu bleiben.
Sie blickte mit vorgetäuschter Nonchalance auf. Hoffentlich sah er nicht, dass ihre Lippen zitterten. Jetzt war er unten und kam auf sie zu – wie ein Bild aus einem jener alten, romantischen Träume, die sie aus ihren Fantasien zu verbannen versucht hatte.
»Ja?« Es war die einzige Silbe, die ihre sich überstürzenden Gedanken zu bilden fähig waren, und die sie durch ihre eng gewordene Kehle hindurchpressen konnte.
Er trat näher. Dabei fiel ihr auf, dass Sir Frederick älter wirkte. Er musste jetzt fünfunddreißig sein, doch er sah noch immer umwerfend gut aus und sehr viel einschüchternder, als sie in Erinnerung hatte.
Bei ihrer wenig begeisterten Antwort blieb er stehen, wo er war. Sein Lächeln erlosch. »Verzeihen Sie.« Er verbeugte sich. »Ich möchte nicht stören.«
Sie stand auf und knickste. »Sie stören nicht. Ich bin nur überrascht, Sie hier zu sehen.«
»So wie ich bei Ihrem Anblick. Es ist lange her.«
»Ich war auf Reisen.«
»Sie sind in Swanford, um Ihren Bruder zu besuchen, nehme ich an?«
»J-ja.«
»Wohnen Sie hier im Hotel oder bei ihm?« Sir Frederick hob die Hand. »Keine Sorge, wir erhöhen die Miete nicht, nur weil Sie da sind!« Er lachte leise.
Sie rang sich ebenfalls ein Lächeln ab.
Da sie nicht antwortete, fragte er: »Haben Sie auf Ihren Reisen schöne Orte besucht?«
»Oh ja, das haben wir. Bath, Brighton, Paris …«
»Wir …?« Seine dunklen Brauen hoben sich erwartungsvoll.
Sie schluckte. Es dürfte sie eigentlich nicht verlegen machen, zuzugeben, dass sie eine Stellung als Gesellschafterin angenommen hatte, doch so war es nun einmal. Oder wusste er es vielleicht schon? Rose oder auch einer der Fenchurches könnte es erwähnt haben. Doch bevor sie antworten konnte, kam ein anderer Mann durch die Halle auf sie zu, eine jüngere, hellhaarige Version des Ersten, der mit der makellosen Eleganz eines Gentlemans gekleidet war.
»Paris? Paris ist anbetungswürdig. So wunderschön.« Sein Blick schien auf ihrem Gesicht zu ruhen, als er das sagte, aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein. Er stieß seinen Bruder leicht mit dem Ellbogen an. »Mach uns bekannt, Freddy.«
Sir Frederick zögerte kurz, dann tat er wie gewünscht. »Miss Lane, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an meinen Bruder, Thomas Wil…«
»Tommy Wilford«, unterbrach der jüngere Mann ihn und verbeugte sich. »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen.«
Thomas sah sehr gut aus und stand ihr altersmäßig näher, doch sie hatte immer seinen älteren Bruder bevorzugt.
Frederick fügte hinzu: »Miss Lanes Vater war unser Pfarrer und mein Lehrer.«
Die goldenen Augenbrauen hoben sich. »Ah ja! Ich habe Sie gar nicht erkannt, Miss Lane. Sie sind erwachsen geworden – und zwar aufs Allerschönste, wenn ich das sagen darf!«
Sir Fredericks Lippen waren schmal geworden bei dieser Schmeichelei. »Du warst den größten Teil von Miss Lanes Kindheit auf dem Internat, und später hast du dich ohnehin nur noch in London aufgehalten«, meinte er.
»Das könnte es erklären. Außerdem kannte ich den legendären Mr Lane längst nicht so gut wie mein Bruder, da er das Lehren bereits aufgegeben hatte, als ich alt genug war. Aber Freddy spricht oft und mit sehr viel Zuneigung von ihm.«
Frederick nickte, dann fügte er hinzu: »Rebeccas Bruder John lebt im Cottage des Verwalters. Vielleicht bist du ihm ja mal begegnet.«
Das Interesse in Thomas' Augen schien zu erlöschen. »Nein, ich hatte nicht das Vergnügen.«
Sir Frederick wandte sich zu ihr und erklärte: »Wir logieren diese Woche hier im Hotel. Das Haus wird renoviert.«
»Ah ja. Ich habe mich schon gefragt, warum Sie hier sind, wo Wickworth doch so nah ist.«
»Und Sie, Miss Lane?«
Zwei Paar sehr ähnliche Augen sahen sie neugierig an.
Sie befeuchtete ihre trockenen Lippen. »Ich bleibe vielleicht eine oder zwei Nächte. Mein Bruder ist … äh … er schreibt, wissen Sie. Ich habe ihn mit meinem Besuch überrascht.«
»Ah so. Nun, was auch immer der Grund ist, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Nicht wahr, Freddy?« Wieder stieß Thomas seinen Bruder leicht in die Seite.
»Aber ja. Ich hoffe, wir haben während Ihres Aufenthalts Gelegenheit, über alte Zeiten zu plaudern.«
»Das hoffe ich ebenfalls.«
Sie nickte den beiden zu, dann ging sie noch einmal zum Empfang. Der junge Mann von vorhin schien nicht besonders erfreut, sie wiederzusehen.
»Miss, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich hätte gern ein Zimmer.«
»Für eine Person?«
»Ja.« Ihre Ohren brannten vor Verlegenheit.
»Haben Sie reserviert?«
»Nein. Ist das ein Problem?«
»Nun ja, wir sind gut belegt.« Er schlug ein Buch auf und gab vor, mit dem Finger eine Seite voller Eintragungen entlangzufahren. »Ich muss erst nachsehen, was noch frei ist.«
Sie wäre tatsächlich erleichtert gewesen, eine Entschuldigung zu haben, zu ihrem Bruder zurückzukehren, doch gleichzeitig wäre es eine schreckliche Demütigung, wenn man sie vor den Wilfords abwies. Deshalb fügte sie leise hinzu: »Ich warte hier auf Lady Fitzhoward.«
Sie wollten sich zwar erst in einer Woche treffen, doch das sagte Rebecca nicht.
»Lady Fitzhoward?« Der missbilligende Gesichtsausdruck des Portiers glättete sich etwas. »Ah. Ich habe tatsächlich noch ein Zimmer. Allerdings nicht gerade unser komfortabelstes.«
»Das ist schon in Ordnung. Ich brauche nichts Großartiges.«
Auch wenn ein besseres Zimmer zu haben wäre, konnte sie sich für diesen ungeplanten Aufenthalt keine größeren Ausgaben leisten.
»Für wie viele Nächte?«
»Das weiß ich nicht genau. Kann ich es Ihnen später sagen?«
»Sehr gern, Miss.« Er drehte das Buch zu ihr um.
Während sie die erforderlichen Angaben machte, holte der Angestellte einen Schlüssel aus einer Schublade und winkte einem Träger.
»Neville, bitte bringen Sie Miss Lane auf Zimmer dreizehn.«
»Dreizehn?«, wiederholte der junge Mann überrascht, doch dann zuckte er die Achseln und griff nach ihrer Tasche. »Gern. Hier entlang, Miss.«
Neville deutete mit dem Kopf zu der geschwungenen Treppe hin. »Ihr Zimmer ist auf zwei Wegen zu erreichen. Wir können die Haupttreppe in den ersten Stock nehmen oder, wenn Sie nichts gegen ein bisschen frische Luft haben, können wir auch durch den Kreuzgang gehen. Letzteres geht schneller.«
Den Kreuzgang, in dem es spukt?, dachte Rebecca und schluckte einen törichten Klumpen in ihrer Kehle hinunter. »Wenn Sie meinen.«
Nachdem er sie aus der Halle einen Flur entlanggeführt hatte, kamen sie in den Kreuzgang, dessen vier Seiten einen grün bepflanzten Innenhof umrahmten. Auf einer Seite des Kreuzgangs verlief eine feste Mauer. Die andere Seite zum Innenhof hin wurde von Säulen gesäumt, die mit anmutigen Spitzbögen reich verziert waren. Von Weitem sahen die Bögen wie Fenster aus, doch sie waren nicht verglast. Durch ihre Öffnungen fiel das Sonnenlicht auf die steinernen Bodenplatten, sodass die »Fenster« wie spitze Kerzen mit flackernden Flammen wirkten.
Rebecca bewunderte das Fächergewölbe über dem Kreuzgang. So viel Schönheit für Frauen, die ein Armutsgelübde abgelegt hatten. Oder war die Schönheit zur Ehre Gottes geschaffen worden? Wie auch immer, Rebecca war froh, dass die Nonnen an diesem Ort, an dem sie so viele Stunden täglich im Gebet verbracht hatten, von Schönheit umgeben gewesen waren.
»Der Kreuzgang war das Herz der Abtei«, erklärte der Träger. »Und der älteste Teil. Er ist wunderschön, wenn an einem milden Tag wie heute die Sonne scheint, aber im Januar ist es hier sehr kalt.«
»Das kann ich mir gut vorstellen. Stimmt es, dass es im Kreuzgang … spukt, wie die Leute erzählen?«
Er warf ihr einen Seitenblick zu und kratzte sich mit seiner freien Hand am Ohr. »Darüber darf ich eigentlich nicht sprechen. Sie wollen doch nicht, dass ich Schwierigkeiten bekomme, oder?«
»Natürlich nicht.«
Sie waren auf der anderen Seite angelangt. Er deutete auf eine Treppe, die im Halbdunkel lag. »Ihr Zimmer liegt ganz oben an der Nachttreppe.«
»Nachttreppe?«
Er nickte. »Wenn die Nonnen aus ihrem Schlafsaal zum Gottesdienst herunterkamen, war es noch dunkel. In die Kirche geht es durch diese Tür.« Neville deutete nach rechts. »Beziehungsweise in das, was davon übrig ist.«
Rebecca blickte die nur trüb erleuchtete Treppe hinauf. Die Stufen wiesen in der Mitte Vertiefungen auf, als sei jahrhundertelang ein Strom darüber hinabgeflossen. In diesem Fall, dachte sie, war es ein Strom pflichtbewusster Füße gewesen, die zum Gottesdienst und wieder zurück gegangen waren.
Der Träger führte sie die Treppe hinauf. »Passen Sie auf, wo Sie hintreten.«
Nach einem Treppenabsatz stieg er weiter hinauf. Ganz oben befand sich auf der einen Seite eine Tür, auf der anderen ein offener Bogen, der in den Hauptflur führte. Er drehte sich zu der Tür. An der Wand befand sich eine Messingplakette, auf der die Nummer 13 eingraviert war. Mit etwas Mühe schloss er sie auf und ließ Rebecca beim Betreten des Zimmers den Vortritt. Drinnen stellte er ihre Reisetasche ab, trat an das kleine Fenster und schlug die Fensterläden auf.
»Wir vermieten dieses Zimmer nicht oft. Es gehörte früher zum Schlafsaal der Nonnen.«
Der spartanisch eingerichtete Raum enthielt ein Einzelbett, einen Sessel, einen Waschtisch aus Metall, eine Frisierkommode und einen kleinen Schrank. Wahrscheinlich waren hier die Zofen oder Kammerdiener untergebracht, vermutete Rebecca. Über dem Bett hing ein schmuckloses Kruzifix als Erinnerung an die frommen Frauen, die hier früher geschlafen hatten.
»Es ist zwar klein, aber es hat immerhin einen Balkon.« Er deutete auf eine schmale Tür, die ins Freie führte.
Dann betrachtete er stirnrunzelnd die Waschschüssel – sie war bis auf eine vertrocknete Spinne leer – und das einsame Handtuch daneben. »Ich lasse Ihnen Wasser und frische Handtücher heraufbringen.«
»Danke.« Sie nahm eine Münze aus ihrem Pompadour und gab sie ihm.
»Vielen Dank, Miss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt.«
Er verließ das Zimmer. Rebecca nahm ihre Haube ab, holte das Kleid, das sie zum Abendessen tragen wollte, aus der Reisetasche und legte es auf das Bett, um es ein wenig zu glätten. Dann stellte sie ihre Toilettenartikel auf die Frisierkommode. Die Kosten für das Zimmer schmerzten sie zwar, doch sie stellte fest, dass sie bei dem Gedanken, in einem Hotel zu übernachten, eine leichte, durchaus angenehme Erregung empfand – nicht zuletzt, weil Sir Frederick Wilford ebenfalls hier logierte.
Frederick wollte nach dem jungen Vollblüter sehen, den er im Stall der Abtei eingestellt hatte. Es war ihm ein Bedürfnis, jederzeit auszureiten – und das Hotel verlassen zu können. Nachdem er die letzten Jahre in größter Zurückgezogenheit verbracht hatte, war er nicht mehr an menschliche Gesellschaft gewöhnt. Vor allem ging es ihm schnell auf die Nerven, höflich Konversation betreiben zu müssen. Er war einfach nicht der Mann, der einfach nur herumsitzen oder Karten spielen konnte – Varianten des Zeitvertreibs, die sein Bruder umso mehr genoss. Er für seinen Teil zog ein gutes Pferd, klaren Himmel und eine ordentliche Wegstrecke vor.
Als er den Stall erreichte, sah er, dass sein Fuchshengst zufrieden sein Heu kaute. Bei Fredericks Eintreten blickte das Pferd auf und wieherte leise, als es ihn erkannte.
Frederick musste unwillkürlich an die vielen Stunden denken, die er häufig in Gesellschaft der jungen Rebecca Lane im Stall von Wickworth verbracht hatte.
Er hatte immer große Zuneigung für das lebhafte Mädchen mit den großen haselnussbraunen Augen empfunden, die Erstgeborene seines geliebten Lehrers, Mr Arthur Lane.
Ihre Eltern hatten nichts gegen ihre Liebe zu Pferden einzuwenden gehabt, und Frederick hatte ihr das Reiten und alles, was er über Pferde wusste, beigebracht. Rebecca besaß eine schnelle Auffassungsgabe und hatte seine Unterweisungen – sowohl im Reiten als auch später im Schach und in anderen Spielen – mit geduldiger Aufmerksamkeit und echtem Interesse aufgenommen. Qualitäten, die Thomas nie an den Tag gelegt hatte.
Später allerdings, als Frederick die schöne Miss Seward kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte, hatte er die Familie Lane aus den Augen verloren. Neben der Gesellschaft einer verführerischen Frau hatten Spiele und Ausritte mit einem halbwüchsigen Mädchen ihren Reiz verloren.
Zweifellos hatte er Rebecca mit seiner Vernachlässigung verletzt, doch was war ihm übrig geblieben? Es war ohnehin an der Zeit gewesen, dass er heiratete, und er hatte nicht mehr oft an Rebecca Lane gedacht. Sie war nur ein Mädchen, hatte er sich gesagt. Sie würde die Enttäuschung verwinden, erwachsen werden und sich eines Tages selbst verlieben.
Aber jetzt …?
Rebecca Lane war kein kleines Mädchen mehr. Wie Thomas gesagt hatte, war sie erwachsen geworden – und dazu bemerkenswert hübsch. Er hatte sie nach seiner Heirat in den letzten Jahren zwar hin und wieder von Weitem gesehen – zuletzt beim Weihnachtsgottesdienst vor zwei Jahren –, doch bei ihrer Begegnung vorhin erinnerte ihn kaum noch etwas an das altkluge Mädchen von früher. Jetzt war sie eine elegante, wortgewandte, weitgereiste junge Dame.
Zum ersten Mal seit Jahren schienen die rostigen Angeln seines hermetisch von der Außenwelt abgeriegelten Herzens versuchsweise zu knarren.
Nein. Er schloss die Augen und sein Herz gleich mit.
Rebecca war noch jung und unschuldig. Sie hatte Besseres verdient, sehr viel Besseres als einen gut zehn Jahre älteren, desillusionierten Witwer mit bitteren Erfahrungen und einer schuldbeladenen Seele.
Das Sonnenlicht fiel in ihr sauberes, schlichtes Zimmer, und Rebeccas frühere Vorstellungen von der Abtei – einem dunklen, gefährlichen Ort! – schwanden.
Sie schob das Unbehagen, das sie beim Gedanken an Johns Bitte erneut überkam, beiseite und beschloss, das Hotel zu erkunden. Nach der wunderschönen renovierten großen Halle wollte sie gern mehr von diesem Ort kennenlernen, der früher einmal verboten und furchterregend gewesen war.
Doch erst einmal musste sie auf das Mädchen warten. Rebecca versuchte, die Balkontür zu öffnen, die sich nach dem langen Nicht-Gebrauch mit einem knarzenden Quietschen gegen dieses Ansinnen wehrte. Der schmale Balkon mit dem schmiedeeisernen Geländer bot einen weiten Blick über die Klostergärten. In der Ecke stand ein kleiner, ebenfalls schmiedeeiserner Stuhl. Vielleicht konnte Rebecca sich irgendwann mal ein Weilchen hinsetzen und die Gärten betrachten oder sie sogar selbst erkunden, doch zunächst wollte sie gern mehr von der Abtei selbst sehen.
Das Zimmermädchen brachte warmes Wasser und Handtücher und lächelte sie freundlich an.
Rebecca war überrascht, als sie sie erkannte. »Mary?«
Die Augen der jungen Frau weiteten sich erstaunt. »Miss Lane! Was machen Sie denn hier?«
»Ich …« Sie zögerte. Was tat sie hier, wo ihr Bruder doch in einem gemütlichen Häuschen keine zwei Kilometer entfernt wohnte?
»Ich freue mich so, dich zu sehen, Mary«, sagte sie hastig. »Wir vermissen dich zu Hause.«
Mary Hinton hatte als Hausmädchen bei ihnen gearbeitet und Rose geholfen, bis sie sich keine zwei Bediensteten mehr hatten leisten können.
»Ich wusste nicht, dass du jetzt hier arbeitest«, fuhr Rebecca fort. »Ich dachte, du hättest eine Stellung bei den Griffiths angenommen.«
Das Mädchen nickte. »Das hatte ich auch. Aber die Stelle hier ist besser bezahlt, deshalb habe ich gekündigt und bin hierhergekommen. Vor ungefähr einem Jahr.«
»Gefällt es dir hier?«
Mary zuckte die Achseln. »Es ist in Ordnung. Manchmal bekomme ich Trinkgeld, das gefällt mir natürlich. Ansonsten ist die Arbeit dieselbe wie sonst überall auch.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass du hier … interessanten Leuten begegnest.«
»Ja, manchmal. Aber im Grunde ›begegne‹ ich den Gästen ja nicht, wissen Sie? Ich schleppe ihre Sachen und putze für sie. Manche sind freundlich und manche eine echte Plage.« Im selben Moment schien dem Mädchen bewusst zu werden, mit wem sie sprach, und sie biss sich auf die Lippen. »Ich wollte Sie nicht kränken, Miss. Ich meine natürlich nicht Sie. Und ich tue meine Arbeit gern, vor allem für Sie.«
»Danke, Mary. Ich werde mir auch Mühe geben, keine zu große ›Plage‹ zu sein.«
Das Mädchen schaute sie verängstigt an, doch als sie Rebeccas Lächeln sah, atmete sie erleichtert auf und erledigte rasch, weswegen sie gekommen war.
Auf dem Weg zur Tür informierte sie Rebecca noch: »Die Innentoilette ist auf dem Flur. Frühstück wird im Refektorium serviert oder auch auf dem Zimmer, wenn Ihnen das lieber ist. Wenn Sie irgendetwas brauchen, sagen Sie es mir.«
»Das tue ich. Danke, Mary.«
Das Mädchen ging. Rebecca wusch sich Gesicht und Hände und frisierte sich vor dem kleinen Spiegel. Dann trat sie aus dem Zimmer, schloss hinter sich ab und steckte den Schlüssel in ihre gehäkelte Handtasche.
Diesmal nahm sie nicht die Nachttreppe, die der Portier sie vorhin hinaufgeführt hatte, sondern ging daran vorüber durch den Türbogen in den Hauptkorridor und an mehreren nummerierten Zimmern vorbei. In den Wänden waren Fenster eingelassen, die auf den Kreuzgang im Hof hinunterblickten.
Sie schlenderte auf der einen Seite entlang und bog dann nach rechts ab in den zweiten Gang des oberen Stockwerks. Auch im dritten Gang passierte sie mehrere Türen und blieb schließlich oben am Geländer stehen, von dem aus man in die große Empfangshalle hinabsehen konnte.
Vor ihr, direkt an der Haupttreppe, saß ein Mann auf einem Stuhl vor der letzten Tür in diesem Gang. Sie überlegte, was er da wohl machte. Auch im Sitzen vermittelte er durch seine aufrechte, disziplinierte Haltung den Eindruck eines Militärs, obwohl er Zivilkleidung trug. Wenn er kein Offizier war, dann vielleicht ein Kutscher, mutmaßte sie.
Als er ihrer gewahr wurde, verengten sich seine Augen. Erschrocken, weil man sie beim Anstarren ertappt hatte, ging sie rasch und mit gesenktem Kopf an ihm vorbei die Treppe hinunter. Dabei hielt sie sich am Geländer fest, weil sie Angst hatte, die hohe Treppe hinunterzustürzen.
Unten durchquerte sie die Halle. Dabei mied sie den Blick des unhöflichen jungen Angestellten am Empfang. Sie betrat den Gang hinter der Halle und ging am Speisesaal, dem Klosterspeisesaal und dem Kaffeezimmer vorbei. Der köstliche Geruch gerösteter Kaffeebohnen und frisch gebackenen Brotes drang zu ihr hinaus. Ihr Magen protestierte laut. Sie überlegte, ob es wohl unangebracht war, ganz allein in den Speisesaal zu gehen. Sie konnte Mary bitten, ihr ein Tablett aufs Zimmer zu bringen, so ersparte sie sich die Verlegenheit, allein essen zu müssen.
Im Weitergehen fiel Rebecca auf, dass ein irgendwie altertümlicher Duft in der Luft hing, obwohl die Einrichtung des Hotels eindeutig neu war. Sie schnupperte, um ihn einzuordnen. Ein leichter Modergeruch, vermischt mit … was? … Kreide und Weihrauch?
Die hohen Decken und Türen mit den wuchtigen Querbalken verliehen dem Raum eine förmliche Atmosphäre; es erinnerte sie an eine Universität oder eine Kirche. Vermutlich, dachte sie, war er früher ein bisschen von beidem gewesen.
Sie bog um die nächste Ecke und ging an einer geschlossenen Tür mit der Aufschrift Grand Suite und einem dahinter abzweigenden Gang vorbei, der zu einem Hinterausgang führte.
Unmittelbar dahinter lockten eine offene Tür und der sehr viel angenehmere Geruch nach Leder und alten Büchern. Die Bibliothek und der Schreibraum, vermutete sie, wo die Gäste Bücher leihen oder ihre Korrespondenz erledigen konnten. Rebecca beschloss, ihren Rundgang fürs Erste zu beenden und nur noch einen kurzen Blick in die Kapelle zu werfen, um sich dann mit etwas Lesestoff aus der Bibliothek zu versorgen.
Sie ging an der Nachttreppe vorüber zu dem Hinterausgang, der nach Aussage des Trägers zu den Ruinen der Kirche führte.
Hoffentlich störe ich nicht gerade einen Gottesdienst, dachte sie, als sie die schwere Tür aufdrückte. Vielleicht konnte sie ja für John beten, wenn sie schon einmal hier war.
Drinnen kniete eine Frau mit gesenktem Kopf vor dem Altargitter. Die Kapelle war nur spärlich beleuchtet, doch durch die Buntglasscheiben der Fenster fiel ein farbiger Lichtstrahl direkt auf die Frau. Rebecca konnte einen Hut mit breiter Krempe und die Umrisse eines Profils erkennen.
Als sie gedämpfte Schluchzlaute hörte, zog sie sich behutsam zurück und schloss leise die Tür hinter sich.
Sie ging zurück zur Bibliothek und trat ein. An zwei Wänden standen raumhohe Regale, die von oben bis unten mit Büchern bestückt waren. Um einen Kamin herum waren mehrere Sessel mit hohen Lehnen gruppiert, außerdem gab es einen Spieltisch mit Schachfiguren und mehrere Schreibtische.
Sie blieb stehen. An einem der Schreibtische saß eine Frau mit dem Rücken zur Tür und schrieb. Plötzlich knüllte sie die frisch angefangene Seite zusammen und warf sie in einen Papierkorb. Dann schlug sie die Hände vors Gesicht – eine Geste der äußersten Verzweiflung.