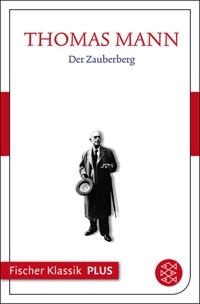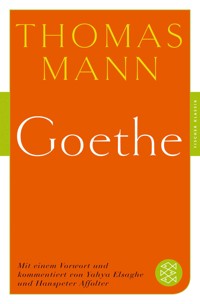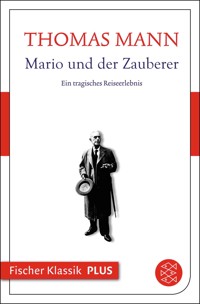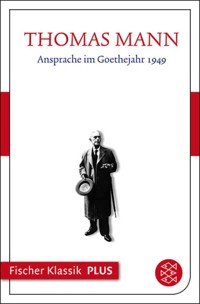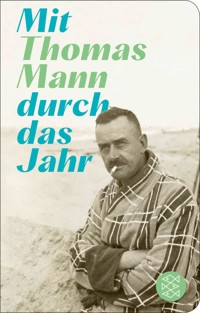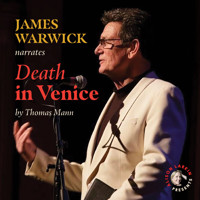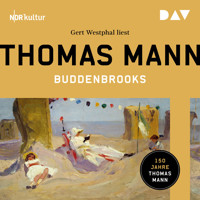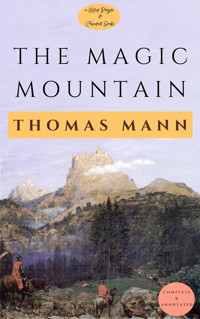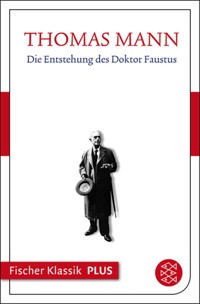
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Von 1943 bis 1947 hat Thomas Mann an seinem großen Altersroman ›Doktor Faustus‹ gearbeitet. Der 1949 erschienene umfangreiche Essay zur Entstehung dieses Romans, seinem, wie er schreibt, »wildesten« Buch, erzählt dessen Geschichte, »eingebettet wie sie ist in den Drang und Tumult der äußeren Ereignisse«. Nach dem Vorbild von Goethes ›Dichtung und Wahrheit‹ entsteht anhand von zahlreichen Tagebucheinträgen eine Mischung aus Werkstattbericht und autobiographischem Text, der die Entstehung des Romans vor dem Hintergrund weltpolitischer Ereignisse wiedergibt und persönliche Begegnungen und Erlebnisse Thomas Manns schildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Ähnliche
Thomas Mann
Die Entstehung des Doktor Faustus
Roman eines Romans
Essay/s
FISCHER E-Books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
Inhalt
Die Entstehung des Doktor Faustus Roman eines Romans
Denn obgleich jedes dichterische Werk zur Zeit seiner Erscheinung auf sich selbst ruhen und aus sich selbst wirken soll, und ich deswegen bei keinem weder Vor- noch Nachwort, auch gegen die Kritik keine Entschuldigung geliebt, so werden doch solche Arbeiten, insofern sie in die Vergangenheit zurücktreten, unwirksamer, eben je mehr sie im Augenblick gewirkt, ja man schätzt sie weniger, je mehr sie zur Verbreitung der vaterländischen Kultur beigetragen haben: wie die Mutter so leicht durch eine Anzahl schöner Töchter verfinstert wird. Deshalb ist es billig, ihnen einen historischen Wert zu verschaffen, indem man sich über ihre Entstehung mit wohlwollenden Kennern unterhält.
GOETHE, DICHTUNG UND WAHRHEIT
I
Tagebuch-Notizen von 1945 zeigen mir, daß am 22. Dezember dieses Jahres der Korrespondent von »Time Magazine« in Los Angeles mich besuchte (es ist eine Stunde Wagenfahrt von Down-town bis zu unserem Landhause), um mich zur Rede zu stellen wegen einer Prophezeiung, die ich vor anderthalb Jahrzehnten getan, und die in Erfüllung zu gehen säumte. Am Schluß eines damals verfaßten, auch ins Englische übersetzten Lebensabrisses hatte ich im halb spielerischen Glauben an gewisse Symmetrien und Zahlenentsprechungen in meinem Leben die ziemlich bestimmte Vermutung geäußert, daß ich im Jahre 1945, siebzigjährig, im selben Alter also wie meine Mutter, das Zeitliche segnen würde. Das ins Auge gefaßte Jahr, sagte der Mann, sei so gut wie abgelaufen, ohne daß ich Wort gehalten hätte. Wie ich es vor der Öffentlichkeit rechtfertigen wolle, daß ich immer noch am Leben sei.
Was ich erwiderte, wollte meiner Frau nicht gefallen, umso weniger, als ihr sorgsames Herz seit längerem schon um meine Gesundheit bangte. Sie suchte, mich zu unterbrechen, zu protestieren, Erklärungen nicht gelten zu lassen, die ich mir von einem Interviewer entlocken ließ, während ich sie bis jetzt damit verschont hatte. Mit dem In-Erfüllung-gehen von Prophezeiungen, sagte ich, sei es ein eigenes Ding; sie bewahrheiteten sich oft nicht wortwörtlich, sondern auf eine andeutende Weise, die etwas von ungenauer und bestreitbarer, doch aber unverkennbarer Erfüllung habe. Es gebe da Substitute. Gewiß, meine Ordnungsliebe habe nicht ausgereicht, meinen Tod herbeizuführen. Aber wie der Besucher mich da sehe, sei immerhin in dem Jahr, das ich dafür angesetzt, mein Leben – biologisch genommen – auf einen Tiefpunkt gekommen, wie es ihn noch nicht gekannt habe. Ich hoffte, daß es aus dieser Depression mit meinen vitalen Kräften noch wieder aufwärts gehen werde, aber als Bewährung meines Sehertums genüge mein gegenwärtiger Zustand mir vollkommen, und es sollte mir lieb sein, wenn er und sein sehr geschätztes Blatt sich auch daran genügen ließen.
Als ich so sprach, waren es nur drei Monate noch bis zu dem Augenblick, wo das biologische Tief, auf das ich mich berufen, seinen äußersten Punkt erreichte, eine ernste, zum chirurgischen Eingriff zwingende Krankheitskrisis alles Gewohnte für Monate unterbrach und meine Natur auf eine späte, in dieser Form keineswegs erwartete Bewährungsprobe stellte. Ich erwähne dies aber, weil eine merkwürdige Divergenz zwischen biologischer und geistiger Lebenskraft mir daraus hervorzugehen scheint. Durchaus nicht müssen die Zeiten körperlicher Wohlfahrt und gesundheitlichen Hochstandes, Zeiten der physischen Ungestörtheit und des festen Schrittes auch die produktiv gesegneten sein. Die besten Kapitel von Lotte in Weimar habe ich unter den, Unerfahrenen nicht zu beschreibenden, Qualen einer wohl über ein halbes Jahr sich hinziehenden infektiösen Ischias geschrieben, den tollsten Schmerzen, die ich je ausgestanden, und denen zu entgehen man Tag und Nacht vergebens nach der rechten Position sucht. Sie existiert nicht. Nach Nächten, vor deren Wiederholung mich Gott bewahre, pflegte das Frühstück eine gewisse Besänftigung des in Entzündungsgluten stehenden Nerven zu bringen, und in irgendeiner schräg angepaßten Sitzmanier an meinem Schreibtisch vollzog ich danach die Unio mystica mit Ihm, dem »Stern der schönsten Höhe«. Immerhin ist die Ischias keine sehr tief ins Leben reichende und bei aller Tortur nicht recht ernst zu nehmende Krankheit. Die Zeit dagegen, von der ich spreche, und für die ich meinen Tod prophezeit hatte, war eine Periode wirklichen, langsam fortschreitenden Niederganges meiner Lebenskräfte, einer unverkennbaren biologischen »Abnahme«. Gerade mit ihr aber ist die Entstehung eines Werkes verbunden, das vom Augenblick seines Erscheinens an eine eigentümliche Ausstrahlungskraft bewährt hat.
Es wäre doktrinär, in der vitalen Minderung Ursache und Bedingung einer Hervorbringung sehen zu wollen, die den Stoff eines ganzen Lebens in sich aufnahm, ein ganzes Leben, halb ungewollt, halb in bewußter Anstrengung, synthetisiert und zur Einheit zusammenrafft und darum kaum umhinkann, eine gewisse Lebensgeladenheit zu bewähren. Leicht ist die Kausalität umzukehren und meine Erkrankung dem Werk zur Last zu legen, das wie kein anderes an mir gezehrt und meine innersten Kräfte in Anspruch genommen hat. Wohlwollende Beobachter meines Lebens haben das Verhältnis so gesehen und bei meinem bedenklichen Anblick nicht mit der Erklärung gezögert: »Es ist das Buch.« Und gab ich ihnen nicht recht? Es ist ein großes Wort, daß, wer sein Leben hingibt, es gewinnen wird, – ein Wort, das in der Sphäre der Kunst und Dichtung nicht weniger Heimatrecht besitzt als in der religiösen. Nie ist das Opfer des Lebens aus mangelnder Lebenskraft gebracht worden, und nicht eben auf solchen Mangel deutet es, wenn einer – seltsamer Fall! – mit siebzig Jahren sein »wildestes« Buch schreibt. Es deutete darauf auch nicht die Behendigkeit, mit der ich, gezeichnet mit einer Narbe von der Brust bis zum Rücken, zur Erheiterung der Ärzte von der Operation erstand, um dies fertig zu machen …
Aber ich will die Geschichte des Faustus, eingebettet wie sie ist in den Drang und Tumult der äußeren Ereignisse, an Hand meiner knappen täglichen Aufzeichnungen von damals für mich und die Freunde zu rekonstruieren suchen.
II
November 1942 verzögerte eine Reise nach dem Osten des Kontinents die Beendigung von Joseph, der Ernährer, der ich während der vorangehenden Wochen, unter den Donnern der Kämpfe um das glühende und qualmende Stalingrad zugestrebt hatte. Der Ausflug, auf dem ein Vortragsmanuskript über das fast zum Abschluß gebrachte vierfache Romanwerk mich begleitete, führte über Chicago nach Washington und New York, war reich an Begegnungen, Veranstaltungen und Leistungen und brachte unter anderem ein Wiedersehen mit Princeton und den vertrauten Gestalten jener Lebensperiode: mit Frank Aydelott, Einstein, Christian Gauß, Helen Lowe-Porter, Hans Rastede von Lawrenceville School nebst seinem Kreise, Erich von Kahler, Hermann Broch und anderen. Die Tage von Chicago hatten im Zeichen des afrikanischen Krieges gestanden, erregender Nachrichten über den Durchmarsch deutscher Truppen durch den unbesetzten Teil Frankreichs, den Protest Pétains, die Verschiffung der Hitler-Corps nach Tunis, die italienische Besetzung von Corsica, die Wiedereinnahme von Tobruk. Man las von fieberhaften Schutzmaßnahmen der Deutschen überall, wo eine Invasion denkbar war, von Anzeichen für den Übergang der französischen Flotte auf die Seite der Alliierten. Washington in Kriegszustand zu sehen war mir neu und merkwürdig. Zu Gaste, wieder einmal, bei Eugene Meyer und seiner schönen Frau in ihrem Palais am Crescent Place, betrachtete ich verwundert die schwer militarisierte Gegend um das Lincoln-Memorial mit ihren Baracken, Bureauhäusern und Brücken, den unaufhörlich einrollenden, mit Kriegsmaterial beladenen Zügen. Es herrschte drückende Wärme, ein verspäteter »indian summer«. Bei einem Dinner im Haus meiner Gastfreunde, an dem der brasilianische und der tschechische Gesandte mit ihren Damen teilnahmen, drehte die Diskussion sich um die amerikanische Zusammenarbeit mit Darlan, das Problem der »expediency«. Die Meinungen waren geteilt. Ich verhehlte nicht meine Abneigung. Man hörte nach Tische die Radio-Rede Willkies, der eben von seiner One-World-Tour zurück war. Meldungen über den bedeutenden Seesieg bei den Solomons hoben die Stimmung.
Die Vortragsveranstaltung in der Library of Congress führte mich zu meiner Freude wieder mit Archibald MacLeish, damals noch Staatsbibliothekar, und seiner Frau zusammen, und als besondere Ehre empfand ich es, daß Vice-President Wallace, von MacLeish eingeführt, meiner Rede den Vorspruch gab. Die Lesung selbst, von den Zeitereignissen nicht ungefärbt, durch den Lautsprecher hörbar noch in einem zweiten dicht gefüllten Saal, fand nach so gewinnender Vorbereitung des Publikums mehr als freundliche Aufnahme. Den Abend beschloß ein figurenreicher Empfang im Meyer’schen Hause, bei dem ich mich vornehmlich zu den Männern meines Vertrauens, den Offiziosen des Roosevelt-Régimes, Wallace und Francis Biddle, dem Attorney General, hielt, dessen liebenswürdige Frau mir viel Zartes über meinen Vortrag sagte. Biddle, mit dem ich über die den »enemy aliens«, besonders den deutschen Emigranten, auferlegten Einschränkungen korrespondiert hatte, gab mir seine Absicht kund, diese Beengungen baldigst aufzuheben. Von ihm erfuhr ich auch, daß Roosevelt, dessen Verhältnis zum Vichy-Régime nicht mir allein Zweifel und Unbehagen bereitete, immerhin die Freilassung der in Nordafrika gefangengehaltenen Anti-Fascisten und Juden verlange.
Dankbar war ich unserer Hausfrau, meiner langjährigen Gönnerin, der literarisch, politisch und sozial so aktiven Agnes Meyer, für das Arrangement eines Zusammenseins mit dem Schweizer Gesandten Dr. Bruggmann und seiner Frau, einer Schwester von Henry Wallace. Der Austausch mit dem klugen und warmherzigen Vertreter des Landes, das uns fünf Jahre lang seinen Schutz geliehen, war mir lieb und wichtig. Gegenstand des Gesprächs war natürlich das dunkle Schicksal Deutschlands, seine Ausweglosigkeit, da die Möglichkeit der Kapitulation abgeschnitten schien. Das Eindringen der Russen war unserem Unterredner bereits Gewißheit.
Bedeutender noch war mir die persönliche Begegnung mit Maxim Litwinow, den unsere Wirte uns mit seiner charmanten englischen Frau zum Lunch einluden. Diese, höchst aufgeweckt, gesellschaftlich begabt und rasch von Rede, beherrschte bei Tisch die Unterhaltung. Nachher aber hatte ich Gelegenheit, dem Botschafter meine Bewunderung auszudrücken für seine politische Haltung und Tätigkeit vor dem Kriege, seine Reden im Völkerbund, sein Bestehen auf der Unteilbarkeit des Friedens. Immer sei er der einzige gewesen, der die Dinge bei ihrem rechten Namen genannt, der Wahrheit – leider vergebens – zum Wort verholfen habe. Er dankte mir mit einiger Melancholie. Seine Stimmung schien mir eher moros und bitter, – was nicht allein auf die furchtbaren Prüfungen, Opfer und Leiden zurückzuführen sein mochte, die der Krieg seinem Lande auferlegte. Mein Eindruck war, daß man ihm seine Sendung als Mittler zwischen Ost und West so schwer wie möglich mache, ja, daß seines Bleibens auf dem Botschafterposten in Washington kaum lange mehr sein werde.
In gesellschaftlich freien Stunden suchte ich das laufende Kapitel von Joseph, der Ernährer, eines der letzten schon, das Kapitel der Segnung der Söhne, vorwärtszutreiben. Was mir aber auffällt und mich geheimnisvoll anmutet, ist die Lektüre, mit der ich mich auf dieser Reise, in Zügen, Abendstunden, Ruhepausen, abgab, und die, entgegen meiner sonst gepflogenen Lese-Hygiene, in gar keinem Zusammenhang mit meiner aktuellen Beschäftigung, noch mit der nächstvorgesehenen stand. Es waren die Memoiren Igor Stravinskys, die ich »mit dem Bleistift«, das heißt mit Anstreichungen zum Wiedernachlesen studierte; und es waren zwei mir längst bekannte Bücher, Nietzsches Zusammenbruch von Podach und die Erinnerungen der Lou Andreas-Salomé an Nietzsche, die ich in jenen Tagen, ebenfalls unter Bleistift-Markierungen, wieder durchnahm. »Verhängnisvolle Mystik, unerlaubt, oft Mitleid erregend. Der ›Unselige!‹« Das ist eine Bleistiftnotiz im Tagebuch, die von dieser Lektüre zeugt. Musik also und Nietzsche. Ich wüßte keine Erklärung für solche Gedanken- und Interessenrichtung zu diesem Zeitpunkt zu geben.
In unserem New Yorker Hotel suchte uns eines Tages der Agent Armin Robinson auf, um uns, recht bestechend, den Plan eines nicht nur auf Englisch, sondern in vier, fünf anderen Sprachen noch zu veröffentlichenden Buches zu entwickeln, das den Titel »The Ten Commandments« führen sollte. Die Idee war moralisch-polemisch. Zehn international bekannte Schriftsteller sollten in dramatischen Erzählungen die verbrecherische Mißachtung des Sittengesetzes, jedes einzelnen der zehn Gebote behandeln, und von mir wünschte man, gegen ein Honorar von 1000 Dollars, eine kurze essayistische Einleitung zu dieser Sammlung. Man ist auf Reisen leichter empfänglich für solche von außen kommenden Arbeitsvorschläge, als zu Hause. Ich sagte zu und unterzeichnete zwei Tage später in dem Bureau eines Rechtsanwalts, wo ich die ebenfalls zur Mitarbeit bereite Sigrid Undset traf, einen an Fußangeln und Widerhaken reichen Vertrag, den ich kaum gelesen hatte, und mit dem ich ewig dauernde Rechte des Unternehmers auf eine Arbeit besiegelte, die noch nicht existierte, von deren Entwicklung ich keine Vorstellung hatte, und mit der ich es weit ernster nehmen sollte, als der Anlaß forderte. Ist es leichtsinnig, »die Katze im Sack zu kaufen«, so ist, sie darin zu verkaufen, noch weniger empfehlenswert.
Das erschütternde Kriegsereignis der Versenkung der französischen Flotte vor Toulon durch ihre Befehlshaber und Mannschaften fiel in unsere von Konzert- und Theaterbesuchen, Einladungen, Freundeszusammenkünften belebten Tage, in denen es immer auch allerlei zu improvisierende Gelegenheitsarbeit gab. Die sonst recht stillen Blätter des noch aus der Schweiz stammenden Schreibheftes führen nun viele Namen an – Walters und Werfels, Max Reinhardt, der Schauspieler Karlweis, Martin Gumpert, der Verleger Landshoff, Fritz von Unruh und seine Frau figurieren da, die liebenswerte alte Annette Kolb, Erich von Kahler, unsere britische Freundin aus Princeton, Molly Shenstone, und amerikanische Kollegen der jüngeren Generation wie Glenway Westcott, Charles Neider, Christopher Lazare, dazu unsere Kinder. Wir verbrachten »Thanksgivings-Day« zusammen mit südamerikanischen Gästen im Landhause Alfred Knopfs zu Whiteplane. In deutschsprachigem Kreise gab es Vorlesungen aus entstehenden Büchern: Kahler teilte einiges höchst Eindrucksvolle aus seiner Geistesgeschichte der Menschheit mit, die unter dem Titel Man the Measure erscheinen sollte; ich selbst ließ mich wieder einmal mit dem dankbaren Verkündigungskapitel aus Joseph, der Ernährer, auch mit den Becher- und Erkennungsszenen vernehmen und fand die beifällige Ermutigung, die Lohn und Zweck solcher mündlichen Hergabe von einigermaßen »sicheren« Stellen aus dem Werke ist, um das man sich müht. Was man an langen Vormittagen sorgsam geschmiedet, wird in rapider Lesestunde über die Hörerschaft ausgegossen, die Illusion des Improvisierten, fertig Hervorspringenden erhöht den Eindruck, und mit Hilfe der erregten Verwunderung erfreut man seinerseits sich der Illusion, daß alles zum besten stehe.
III
Über San Francisco, wo wir ein Kinderpaar, unseren jüngsten Sohn, den Musiker, und seine anmutige Schweizer Frau besuchten und das Himmelsblau der Augen meines Lieblingsenkels, des kleinen Frido, eines bezaubernden Kindes, mich wieder einmal entzückte, kehrten wir vor Mitte Dezember nach Hause zurück, und sogleich nahm ich die Arbeit am Segenskapitel wieder auf, nach dessen Abschluß nur Jaakobs Tod und Bestattung, der Gewaltige Zug von Ägypten nach Kanaan noch zu schildern war. Das Jahr 1943 war erst einige Tage alt, als ich die letzten Zeilen des vierten Joseph-Romans und damit des Gesamtwerkes niederschrieb. Ein mir merkwürdiger, aber gewiß nicht übermütiger Tag, dieser 4. Januar. Das große Erzählwerk, das mich durch all diese Jahre des Exils, die Einheit meines Lebens gewährleistend, begleitet hatte, war zustandegebracht, war abgetan, und ich war bürdelos, – ein fragwürdig-leichter Zustand für einen, der seit frühen Tagen, den Tagen der Buddenbrooks, unter einer weithin zu tragenden Bürde gelebt hat und ohne solche kaum recht zu leben weiß.
Antonio Borgese und seine Frau, unsere Elisabeth, waren bei uns, und im Familienkreis las ich am selben Abend die beiden Schlußkapitel vor. Der Eindruck war tröstlich. Man trank Champagner. Bruno Frank, vom Ereignis des Tages unterrichtet, rief an zur Gratulation mit freundschaftlich bewegter Stimme. Warum ich »leidend, kummervoll, quälend erregt und müde« war in den nächsten Tagen, weiß Gott allein, dessen Wissen, auch über ihn selbst, wir so viel anheimgeben müssen. Vielleicht trugen der herrschende Föhnsturm und solche Nachrichten zu meiner Verfassung bei, wie daß die Nazis in idiotischer Grausamkeit, trotz schwedischer Intervention, darauf bestanden, die dreiundachtzigjährige Witwe Max Liebermanns nach Polen zu deportieren. Sie nahm Gift statt dessen … Dabei stießen russische Corps gegen Rostow vor, die Vertreibung der Deutschen aus dem Kaukasus war nahezu vollendet, und in einer starken, zuversichtlichen Rede vor dem neuen Kongreß kündigte Roosevelt die Invasion Europas an.
Ich nahm die Kapitel-Betitelungen des vierten Bandes, die Einteilung in sieben Hauptstücke oder »Bücher« vor und las unterdessen Dinge wie Goethes Aufsatz Israel in der Wüste, Freuds Moses, das Buch Wüste und Gelobtes Land von Auerbach und übrigens im Pentateuch. Längst hatte ich mich gefragt, warum ich zu jenem Buch der Celebritäten nur mit einem essayistischen Vorwort, – warum nicht lieber mit einem »Vorspiel auf der Orgel«, wie Werfel sich später ausdrückte, beitragen sollte: mit einer Erzählung von der Erlassung der Gebote, einer Sinai-Novelle, wie sie mir als Nachklang des Joseph-Epos, von dem ich noch warm war, sehr nahe lag: Notizen und Vorbereitungen dazu nahmen nur ein paar Tage in Anspruch. An einem Vormittag tat ich die fällige Radiosendung zum zehnjährigen Bestehen der Naziherrschaft ab und begann am nächsten Morgen die Moses-Erzählung zu schreiben, in deren XI. Kapitel ich schon stand, als, am 11. Februar, der Tag sich zum zehnten Male jährte, an dem wir – es war unser Hochzeitstag – München mit leichtem Gepäck verließen, ohne zu ahnen, daß wir nicht wiederkehren würden. In nicht ganz zwei Monaten, einer für meine Arbeitsart kurzen Frist, schrieb ich fast ohne Verbesserungen, die Geschichte nieder, der, zum Unterschied von der quasi-szientifischen Umständlichkeit des Joseph, ein Frisch-darauf-los-Tempo angeboren war. Während der Arbeit, oder vorher schon, hatte ich ihr den Titel Das Gesetz gegeben, womit nicht sowohl der Dekalog, als das Sittengesetz überhaupt, die menschliche Zivilisation selbst bezeichnet sein sollte. Es war mir ernst mit dem Gegenstande, so scherzhaft das Legendäre behandelt und soviel voltairisierender Spott, wiederum im Gegensatz zu den Joseph-Erzählungen, die Darstellung färbt. Wahrscheinlich unter dem unbewußten Einfluß von Heines Moses-Bild gab ich meinem Helden die Züge – nicht etwa von Michelangelos Moses, sondern von Michelangelo selbst, um ihn als mühevollen, im widerspenstigen menschlichen Rohstoff schwer und unter entmutigenden Niederlagen arbeitenden Künstler zu kennzeichnen. Der Fluch am Ende gegen die Elenden, denen in unseren Tagen Macht gegeben war, sein Werk, die Tafeln der Gesittung, zu schänden, kam mir von Herzen und läßt wenigstens zum Schluß keinen Zweifel an dem kämpferischen Sinn der übrigens leicht wiegenden Improvisation.
Am Morgen nach diesem Abschluß erst räumte ich das gesamte mythologisch-orientalistische Material zum Joseph, Bilder, Exzerpte, Entwürfe, verpackt beiseite. Die Bücher, die ich zum Zwecke gelesen, blieben, eine kleine Bibliothek für sich, auf ihren Fächern. Tisch und Schubfächer waren leer. Und nur einen Tag später, dem 15. März, um genau zu sein, taucht in meinen abendlichen Tagesrapporten das Sigel »Dr. Faust«, fast ohne Zusammenhang, zum erstenmal auf. »Durchsicht alter Papiere nach Material für ›Dr. Faust‹.« Welcher Papiere? Ich wüßte es kaum zu sagen. Aber der Vermerk, der sich am nächsten Tag wiederholt, ist verbunden mit der Erwähnung von Briefen an Professor Arlt von der University of California in Los Angeles und an MacLeish in Washington wegen leihweiser Überlassung des Volksbuches von Faust und – der Briefe Hugo Wolfs. Die Kombination weist auf eine gewisse, seit langem bestehende Umrissenheit der auch wieder sehr nebelhaften Idee, die ich verfolgte: Augenscheinlich handelte es sich um die diabolische und verderbliche Enthemmung eines – noch jeder Bestimmung entbehrenden, aber offenbar schwierigen – Künstlertums durch Intoxikation. »Vormittags in alten Notizbüchern«, heißt es unterm 17ten. »Machte den Drei-Zeilen-Plan des Dr. Faust vom Jahre 1901 ausfindig. Berührung mit der Tonio Kröger-Zeit, den Münchener Tagen, den nie verwirklichten Romanplänen ›Die Geliebten‹ und ›Maja‹. ›Kommt alte Lieb’ und Freundschaft mit herauf‹. Scham und Rührung beim Wiedersehen mit diesen Jugendschmerzen …«
Zweiundvierzig Jahre waren vergangen, seit ich mir etwas vom Teufelspakt eines Künstlers als mögliches Arbeitsvorhaben notiert, und mit dem Wiederaufsuchen, Wiederauffinden geht eine Gemütsbewegung, um nicht zu sagen: Aufgewühltheit einher, die mir sehr deutlich macht, wie um den dürftigen und vagen thematischen Kern von Anfang an eine Aura von Lebensgefühl, eine Lufthülle biographischer Stimmung lag, die die »Novelle«, meiner Einsicht recht weit voran, zum Roman vorherbestimmte. Es war diese innere Bewegung, die damals den Lakonismus meiner Tagebuchnotizen zu Selbstgesprächen erweitert. »Erst jetzt realisiere ich, was es heißt, ohne das Joseph-Werk zu sein, die Aufgabe, die in dem ganzen Jahrzehnt immer neben mir, vor mir stand. Erst da auch das Gesetz-Nachspiel abgetan, wird mir die Neuheit und Fragwürdigkeit der Lage bewußt. Es war bequem, an dem Herangebrachten weiterzuwirken. Wird noch die Kraft zu neuen Konzeptionen da sein? Ist nicht die Thematik aufgebraucht? Und sofern sie es nicht ist – wird noch die Lust dazu aufgebracht werden? – Dunkles Wetter, regnerisch, kalt. Unter Kopfschmerzen skizziert und notiert für die Novelle. Nach Los Angeles zum Konzert, in Steinbergs Loge mit seinen Damen. Horowitz spielte das B-dur Klavierkonzert von Brahms, das Orchester die Don Juan-Ouvertüre und die Pathétique von Tschaikowsky. ›Auf vielfaches Verlangen‹, hätte man früher gesagt. Es ist aber sein Schwermutsvoll-Bestes, das Höchste ihm Erreichbare, und immer hat es sein Schönes und Ergreifendes, ein bestimmtes Talent, wer weiß durch welche Fügung der Umstände, auf den Gipfel seiner Möglichkeiten kommen zu sehen. Auch erinnerte ich mich, wie Stravinsky mir vor Jahren in Zürich seine Bewunderung für Tschaikowsky einbekannte. (Ich hatte danach gefragt.) – Beim Dirigenten im Künstlerzimmer … Las mit Erheiterung Geschichten in Gesta Romanorum, ferner in Nietzsche und die Frauen von Brann und Stevensons Meisterstück Dr. Jekyll and Mr. Hyde, die Gedanken auf den Fauststoff gerichtet, der jedoch fern davon ist, Gestalt anzunehmen. Obgleich das Pathologische ins Märchenhafte zu rücken, ans Sagenmäßige anzuschließen wäre, geht eine Art von Bangigkeit davon aus, die Schwierigkeiten scheinen unüberwindlich, und die Vermutung mischt sich ein, daß ich deshalb vor dem Unternehmen zurückschrecke, weil ich es immer als mein letztes betrachtet habe.«
Ich lese das nach und weiß, daß es richtig war. Richtig, was das Alter der kaum definierbaren Idee, die langen Wurzeln betrifft, die davon in mein Leben hinabreichen, und richtig insofern ich sie beim Ausblick auf einen Lebensplan, der immer ein Arbeitsplan gewesen war, von jeher an das Ende gestellt hatte. Was da, vielleicht, eines späten Tages, zu machen sein würde, nannte ich im stillen meinen »Parsifal«. So sonderbar es scheinen mag, daß einer ein Alterswerk in jungen Jahren sich programmmäßig vorsetzt, – es war der Sachverhalt; und eine spezifische, in manchen kritischen Versuchen sich äußernde Vorliebe für die Betrachtung von Alterswerken, des Parsifal selbst, des zweiten Faust, des letzten Ibsen, der Stifter’schen, Fontane’schen Spätprosa, mag wohl damit zusammenhängen.
Die Frage war, ob nun die Stunde für diese von langer Hand, wenn auch noch so unscharf visierte Aufgabe gekommen war. Ein Gegeninstinkt, verstärkt durch die Ahnung, daß es mit dem »Stoff« nicht geheuer war und daß es Herzblut, viel davon, kosten werde, ihn in Gestalt zu bringen, durch die unbestimmte Vorstellung einer gewissen aufs Ganze gehenden Radikalität seiner Anforderungen, – ist unverkennbar. Dieser Instinkt wäre auf die Formel zu bringen gewesen: »Erst lieber noch etwas anderes!« Das mögliche, beträchtlichen Aufschub bietende Andere war die Aufarbeitung und Durchführung des vor dem ersten Weltkriege liegengebliebenen Roman-Fragments Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
»K.« (das ist meine Frau) »erwähnt die Fortführung des Krull, nach der Freunde öfters verlangt haben. Ganz fremd ist der Gedanke mir nicht, aber ich erachtete den Plan, der aus Zeiten stammt, wo das Künstler-Bürger-Problem dominierte, für verjährt und überholt durch den Joseph. Dennoch gestern abend beim Lesen und Musikhören merkwürdig bewegte Annäherung an den Gedanken der Wiederaufnahme, hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Lebenseinheit. Es hätte seinen Reiz, nach zweiunddreißig Jahren dort wieder anzuknüpfen, wo ich vor dem Tod in Venedig aufgehört, zu dessen Gunsten ich den Krull unterbrach. Alles Werk und Beiwerk seit damals erwiese sich als Einschaltung, ein Menschenalter beanspruchend, in das Unternehmen des Sechsunddreißigjährigen. – Vorteil, auf einer alten Grundlage weiterzubauen.«
Das alles heißt nur: »Lieber erst noch etwas anderes!« Und doch saß mir ein Stachel im Fleisch, der Stachel der Neugier nach dem Neuen, Gefährlichen. Es gab Ablenkungen in den nächsten Tagen. Gelegenheitsarbeiten waren abzutun, eine Sendung nach Deutschland, ein Offener Brief an Alexej Tolstoi als Beitrag zu einem russisch-amerikanischen Austausch zu schreiben. Erschütterung brachte der plötzliche Tod Heinrich Zimmers, des geistvollen Indologen und Gatten der Christiane Hofmannsthal, aus dessen großem Buch über den indischen Mythos ich den Stoff zu den Vertauschten Köpfen geschöpft. Nachrichten aus New York über die von Sforza, Maritain und anderen geführte Gegenbewegung gegen den Kapitalisten-Club Coudenhoves, sein reaktionäres Pan-Europa, beschäftigten mich und forderten Stellungnahme. Der Krieg in Nordafrika, wo Rommel von Montgomery zum Stehen gebracht worden, spannte die Aufmerksamkeit. Aber die erbetenen Bücher, der Volks-Faust und eine ganze Kollektion von Brief-Bänden Hugo Wolfs, von der Library of Congress zur Verfügung gestellt, trafen ein, und ungeachtet aller Expektorationen über die »Vorteile« der Wiederaufnahme des Krull laufen alle Tagesvermerke von Ende März und Anfang April auf Studien zum Faust-Thema hinaus.
»Auszüge aus dem Faust-Buch. Abends Lektüre darin. Zweites Bombardement Berlins in 48 Stunden … Exzerpte aus Wolfs Briefen. Gedanken, Träume, Notizen. Abends Wolfs Briefe an Grohe. Die Urteilslosigkeit, der törichte Humor, die Begeisterung für seine schlechten Operntexte, die Dummheiten über Dostojewsky. Euphorische Vorklänge des Wahnsinns, der dann, wie bei Nietzsche, in Größenideen sich äußert, aber nichts Großes hat. Traurige Illusionen über die Opern. Kein gescheites Wort … Die Briefe wieder. Welche Form könnte das annehmen? Der Geist des Vortrags ist fraglich. Selbst Zeit und Ort … Aufzeichnungen zum Faust-Thema. Nach Tische in Paul Bekkers Musikgeschichte, im Jahr 1927 von ihm geschenkt ›für die Eisenbahn‹. Weiteres, angelegentlich, abends darin … Heftige und systematische Bombardements des Hitler-Kontinents. Fortschritte der Russen in der Krim. Anzeichen für das nahe Bevorstehen der europäischen Invasion … Bei Bruno und Liesl Frank in Beverly Hills zum Abendessen. Er las seine vortrefflich gemachte Nazi-Geschichte zum Vierten Gebot. Vertrauliches über den Faust-Plan …«
Wie, ich konnte mich alten Freunden schon darüber anvertrauen, bei gänzlicher Fraglichkeit von Form, Handlung, Vortragsart, ja Zeit und Ort? Mit welchen Worten mag es geschehen sein? Jedenfalls war es das erste Mal, daß ich, außer in Beratungen mit meiner Frau, die dem Neuen Vorschub leistete gegen das Alte, den Mund darüber auftat. Übrigens ging es mir schlecht. Ein Rachen- und Luftröhrenkatarrh machte mir trotz heiterem, warmem Wetter zu schaffen, und ich fand mich »sehr matten Geistes, unsicher und pessimistisch meiner produktiven Zukunft wegen. Und doch habe ich noch kürzlich Dinge gemacht wie Thamar, Verkündigung und die zweite Hälfte des Moses!… In Schriften über Nietzsche. Ergriffen von einem Brief Rohdes über ihn. Nachts Kater Murr von Hoffmann. In Bekkers Werk über das Kunstspiel bei Haydn, die Heiterkeit im Sinne des Jenseits von Scherz und Ernst, der Realitätsüberwindung«.
Ein Tag brachte trotz allem die Auflösung der Materialpakete zum Hochstapler, die Wiederlesung der Vorarbeiten – mit wunderlichem Ergebnis. Es war »Einsicht in die innere Verwandtschaft des Faust-Stoffes damit (beruhend auf dem Einsamkeitsmotiv, hier tragisch-mystisch, dort humoristisch-kriminell); doch scheint dieser, wenn gestaltungsfähig, der mir heute angemessenere, zeitnähere, dringendere …« Die Waage hatte ausgeschlagen. Dem Joseph-Theater sollte nicht »erst noch« der Schelmenroman folgen. Der Himmel mochte geben, daß auch an dem radikal Ernsten, Drohenden, auf irgendeine Weise von Opferstimmung Umwitterten, dessen Forderung und Verheißung sich als die stärkere erwies, ein wenig Kunstspiel und -scherz, Ironie, Travestie, höherer Spaß teilhaben durfte! Die Vermerke der nächsten Wochen geben von nichts anderem mehr Kunde als von dem Sich-eingraben in den neuen Arbeitsgrund, dem Erinnern und Herbeibringen von Material, Zubehör, um dem vorschwebenden Schatten einen Körper zu schaffen.
»Über deutsches Städtewesen aus der Luther-Gegend. Dazu Medizinisches und Theologisches. Tasten, Versuchen und beginnendes Gefühl größerer Sicherheit in der Stoffsphäre. Mit K. die Bergstraße gegangen. Tagsüber in Luthers Briefen. Vorgenommen Ulrich von Hutten von D. Strauß. Studium von Musikbüchern vorgesetzt. Bekkers Werk mit größter Aufmerksamkeit beendet. Was noch fast völlig fehlt, ist die menschenfigürliche Ausstattung des Buches, die Füllung mit prägnanten Umgebungsfiguren. Beim Zauberberg war sie durch das Sanatoriumspersonal gegeben, beim Joseph durch die Bibel, deren Gestalten realisierend heranzubringen waren. Beim Krull hätte die Welt phantasmagorisch sein dürfen. Sie darf es bis zu einem gewissen Grade auch hier, doch ist mehrfache Vollrealität erfordert, und da fehlt es an Anschauungsstütze … Irgendwie muß aus der Vergangenheit, aus Erinnerung, Bildern, Intuition geschöpft werden. Aber die Entourage ist erst zu erfinden und festzustellen …«
Ein Brief an Professor Tillich vom Union Theological Seminary ging nach New York mit Erkundigungen über den Prozeß des Theologie-Studiums. Empfangen, merkwürdig genug, wurde gleichzeitig ein Brief Bermann Fischers, der eine schwedische Anregung übermittelte, ein Buch über Deutschland, seine Vergangenheit und Zukunft, zu schreiben. »Wenn man alles tun könnte. Aber die Forderungen der Zeit, zu denen sie sich des Mundes der Leute bedient, – man erfüllt sie im Grunde; nur auf andere Weise, als es verlangt wird.« – Immerhin, ein Dankschreiben des Office of War Information fällt auch in diese Tage, »für den Artikel über Deutschlands Zukunft, der in Schweden sehr beifällig aufgenommen worden sei.« Ich habe keine Ahnung mehr, um welchen Artikel es sich handelte.
»Klagen Fausti und Spott des ›Geistes‹ ausgezogen (als Symphonie gedacht). Notizen, Exzerpte, Überlegungen und zeitliche Berechnungen. Luthers Briefe. Dürer-Bilder. Ernest Newman: H. Wolf, englisch. Gedanken zum Zusammenhang des Sujets mit den deutschen Dingen, der deutschen Welt-Einsamkeit überhaupt. Hier liegen Symbolwerte … Gelesen im Hexenhammer. Einzelheiten aus Münchener Jugendtagen. Figur des Rud. Schwerdtfeger, Geigers im Zapfenstößer-Orchester (!) … Gestalten-Revue und Personennamen für den Roman. Pascal and the Medieval Definition of God von Nitze …«
Unter solchen Umblicken und Studien ging es in den Mai 43, der zarteste, zärtlichste Eindrücke und Empfindungen in ein Mühen, Probieren, Erfinden mischte, das bereits existenzbeherrschend geworden war und alles Vorkommende in sich einbezog. Die Kinder aus San Francisco trafen zu längerem Besuch bei uns ein »mit den beiden Buben, die gut und kräftig