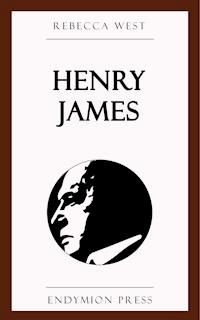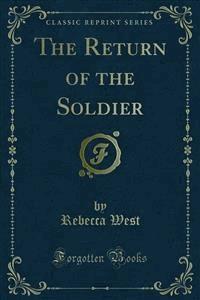15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Familie Aubrey
- Sprache: Deutsch
In „Die Familie Aubrey“, einem Bestseller aus dem Jahr 1957, verwandelte Rebecca West ihre eigene Kindheit in einen Klassiker der englischen Literatur.
Rose Aubrey ist eines von vier Geschwistern. Mit der Weisheit eines Kindes betrachtet sie ihre Zwillingsschwester Mary, deren Charakter perfekt mit dem ihren korrespondiert. Die schöne, begriffsstutzige Schwester Cordelia, die bemitleidet wird, weil sie als Einzige der Familie nicht über musikalisches Talent verfügt. Ihren geliebten kleinen Bruder Richard Quinn. Ihren charmanten, aber höchst unzuverlässigen Vater Piers, dessen törichte Geschäfte die Familie immer wieder an den Rand des finanziellen und sozialen Ruins treiben. Es ist schließlich ihre exzentrische Mutter Clare, die sich als die wirklich Starke der Familie erweist.
Rebecca West zeichnet ein liebevolles Bild einer außergewöhnlichen Bohemien-Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die junge Protagonistin Rose lotet die schwer fassbaren Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsensein, Freiheit und Abhängigkeit, dem Gewöhnlichen und dem Geheimnisvollen aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Rose Aubrey ist eines von vier Geschwistern. Mit der Weisheit eines Kindes betrachtet sie ihre Zwillingsschwester Mary, deren Charakter perfekt mit dem ihren korrespondiert. Die schöne, begriffsstutzige Schwester Cordelia, die bemitleidet wird, weil sie als Einzige der Familie nicht über musikalisches Talent verfügt. Ihren geliebten kleinen Bruder Richard Quin. Ihren charmanten, aber höchst unzuverlässigen Vater Piers, dessen törichte Geschäfte die Familie immer wieder an den Rand des finanziellen und sozialen Ruins treiben. Es ist schließlich ihre exzentrische Mutter Clare, die sich als die wirklich Starke der Familie erweist.
Rebecca West zeichnet das liebevolle Bild einer außergewöhnlichen Bohemien-Familie vor dem Ersten Weltkrieg. Die junge Protagonistin Rose lotet die schwer fassbaren Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsensein, Freiheit und Abhängigkeit, dem Gewöhnlichen und dem Geheimnisvollen aus.
Zur Autorin
Dame Rebecca West (1892 – 1983) wurde als Cicily Isabel Fairfield geboren und wählte ihren Künstlernamen nach einer starken Frauenfigur in einem Ibsen-Drama. West war Journalistin und Reiseschriftstellerin. Sie schrieb unter anderem für TheNew York Herald Tribune und Harper’s Bazaar. Für den Daily Telegraph nahm sie als Berichterstatterin an den Nürnberger Prozessen teil. Sie pendelte zwischen London, New York, Rom und Florenz. Neben ihren journalistischen Texten verfasste sie mehrere erfolgreiche Romane und Erzählungen. »Die Familie Aubrey« ist der erste Teil einer dreibändigen Familiengeschichte. Erstmals 1956 veröffentlicht, wurde der Roman mit dem Originaltitel »The Fountain Overflows« zum Verkaufshit. Die Aubrey-Trilogie ist von Wests eigener Familiengeschichte inspiriert und umfasst das gesamte 20. Jahrhundert.
Rebecca West
Die Familie Aubrey
Roman
Aus dem Englischen neu übersetzt von Ute Brammertz und Carola S. Fischer
Mit einem Vorwort von Andrés Barba
Die englische Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel »The Fountain Overflows« bei Macmillan & Co., London.
Das Vorwort von Andrés Barba hat Carola S. Fischer aus dem Spanischen übersetzt.
Die Arbeit von Carola S. Fischer an dieser Übersetzung wurde unterstützt durch das Programm NEUSTARTKULTUR von BKM und VGWORT.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © The Estate of Rebecca West 1957
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Richard Tuschman / Trevillion Images
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-28731-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Vorwort
Die Kindheit der Künstlerin oder des Künstlers ist eines der großen Romanthemen des 20. Jahrhunderts. Sie stellt naturgemäß die Verbindungsachse zwischen dem deutschen Bildungsroman, einer traditionellen Erzählform vornehmlich romantischer Prägung, und den psychologischen Tendenzen dar, die der Roman der Moderne erforschte. Im Zuge dessen wurde die erzählende Prosa des Realismus aus ihrer Mitte, dem gesellschaftlichen Umfeld des 19. Jahrhunderts, an den Abgrund der individuellen Subjektivität katapultiert, die um die Jahrhundertwende ihren Anfang nahm. Einige der berühmten literarischen Vorbilder von Rebecca West (wie Henry James oder Gustave Flaubert, um nur zwei von ihr genannte Einflüsse anzuführen) entwickelten ausgefeilte Erzähltechniken, um zu erklären, inwieweit die Konstruktion unseres Ichs sowohl von persönlichen Trieben als auch von familiären, gesellschaftlichen, politischen Umständen durchsetzt ist – oder sogar von der Fülle der Erbanlagen, die nicht einmal für uns selbst leicht zu entschlüsseln sind. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Werke wie Das Herz ist ein einsamer Jäger von Carson McCullers, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Robert Musil, Ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce, Die Kindheit eines Chefs von Jean-Paul Sartre, Der Teufel von Marina Zwetajewa oder der großartige Roman Die Familie Aubrey von Rebecca West alle etwas gemeinsam haben, obwohl sie so unterschiedlichen Strömungen wie dem Realismus, dem Existenzialismus, dem Pragmatismus, der Psychoanalyse oder der Erinnerungsliteratur entstammen.
Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Herausbildung des Ichs die Frage par excellence der Literatur. Aus diesem Grund warteten die Autorinnen und Autoren häufig bis zur vollen Entfaltung ihrer literarischen und mentalen Fähigkeiten, um diese Meisterwerke in Angriff zu nehmen. Es stand viel auf dem Spiel. Das sollte man sich vor Augen führen, um zu verstehen, warum Rebecca West sich die keineswegs verwerfliche »Auszeit« von zwanzig Jahren nahm, um zu diesem Roman zu gelangen, und warum sie sich im Alter von fünfundsechzig Jahren dazu entschied, als sie sich ihrer Kindheit nicht nur mit der notwendigen Objektivität, sondern auch mit dem reifen Verstand eines Menschen nähern konnte, der gelernt hat, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Die Familie Aubrey erzählt – wie könnte es auch anders sein – von einer Kindheit, die der von Rebecca West in sehr vieler Hinsicht gleicht. Die Autorin wurde unter dem Namen Cicely Isabel Fairfield geboren (das Pseudonym Rebecca West lieh sie sich von der Protagonistin aus Henrik Ibsens Theaterstück Rosmersholm). Ihre eigene Familie wies große Ähnlichkeiten mit dieser Familie Aubrey auf. Hier gibt es drei Schwestern – die drei angehenden Musikerinnen –, einen Bruder, eine Mutter, die sich ständig am Rande eines Nervenzusammenbruchs befindet – eine ehemalige Konzertpianistin von Rang, die sich ganz dem Musikunterricht ihrer Töchter widmet, damit diese später nicht von ihren zukünftigen Ehemännern finanziell abhängig werden –, und einen abwesenden Vater, ein charismatischer Journalist und eher zum Schurken neigender Charakter, der stark an den Mann erinnert, der die Autorin im realen Leben im Alter von acht Jahren verließ.
Der Feminismus, der aus jeder einzelnen dieser Seiten spricht, ist für uns heute vollkommen nachvollziehbar, für die englische Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er beinahe ein Aufbegehren gegen die Natur, und auch noch 1956, als West den Roman der Öffentlichkeit präsentierte, sah man darin eine exzentrische Haltung. Die Erzählerin und Protagonistin dieser Geschichte, Rose Aubrey, ein junges Mädchen, das wir von den letzten Kindheits- bis zu den ersten Jugendjahren begleiten, besitzt die gleiche Selbstsicherheit hinsichtlich ihrer Gefühle und Gedanken wie eine schlaue Montessori-Schülerin des 21. Jahrhunderts. Ihr Klassenbewusstsein – erst recht in einer Gesellschaft, snobistisch und mit so streng voneinander getrennten Schichten wie die englische – ist von einer frappierenden Modernität, ebenso wie ihre Weisheit, die nur durch den literarischen Kunstgriff, dass eine »ältere« Rose, eine Frau im Alter von Rebecca West, zu uns spricht, leicht gemildert wird. Sie berichtet uns von ihrer Kindheit in London zu Beginn des 20. Jahrhunderts, von den ersten Automobilen, den Gaslaternen, den Wohltätigkeitskonzerten; das Unterhaus und die Arbeiterstreiks kommen vor, ebenso wie die Erfindung der Margarine und kämpferische Pamphlete. Es ist ein London vor der Zeit zweier Weltkriege und demzufolge noch voller Selbstvertrauen und in Unkenntnis seiner eigenen Fragilität.
In diesem Roman von West steckt ein hohes Maß an Lebensweisheit, und bei einer flüchtigen Lektüre kann leicht darüber hinweggelesen werden. Nachdem ich diese Seiten in Zusammenarbeit mit Carmen Cáceres sorgfältig übersetzt habe, scheint mir dies die herausragendste Eigenschaft von Rebecca West zu sein, und sicherlich macht genau das sie zu einer wirklich unvergleichlichen Schriftstellerin. Im Unterschied zu anderen guten Schreibenden (vor allem männlichen Geschlechts), die ihre Leserschaft jede Wahrheit über das Leben mit viel Getöse verkünden, ist West in der Lage, in aller Beiläufigkeit einen Satz zu formulieren, der ganze Jahrzehnte geduldiger und genauester Beobachtung des menschlichen Verhaltens enthält, das Wesen der Liebe oder dieses Monster mit den tausend Köpfen, das wir gemeinhin Familie nennen. Im gesellschaftlichen Leben gilt das als vornehm, in der Literatur als gehobener Stil. Rebecca Wests Stil ist so distinguiert wie ein Outfit ohne jegliche Schrillheiten, bei dem man nur aus nächster Nähe den vorzüglichen Geschmack erkennt. Die Entscheidung, dass die eigene Größe von der Mehrheit der Menschen unbeachtet bleibt, empfinde ich – und im Laufe der Jahre immer stärker – als eine Geste, zu der wirklich nur sehr wenige imstande sind.
In Kindheit eines Chefs fragt sich Sartre, was außergewöhnlich am Aufwachsen eines Menschen ist, der später einmal ein Anführer sein wird. Genau diese Frage stellt sich Rebecca West vom Standpunkt ihres Geschlechts und ihrer sozialen Klasse aus in Die Familie Aubrey: Wie verläuft die Kindheit einer Frau, die dazu bestimmt ist, den Zwängen zuwiderzuhandeln, die die Gesellschaft jener Zeit ihrem Geschlecht und ihrer sozialen Klasse auferlegt hat? Was ist daran außergewöhnlich? Was ist anders an diesem Blick, mit dem sie auf ihr Leben schaut und ihre Erfahrungen bewertet? Das Mädchen Rose Aubrey bringt ihren Eltern, wie naturgemäß alle Kinder, eine abgöttische Liebe entgegen, und ist dennoch auch kritisch ihnen gegenüber, was mir außergewöhnlich gut gefällt. Eine andere großartige Schriftstellerin, Iris Murdoch, hat einmal gesagt, eines der größten Privilegien der Liebe bestehe darin, dass wir die Einsamkeit des geliebten Menschen so intensiv fühlen, als wäre es unsere eigene. Wenn dieser ebenso traurige wie schöne Gedanke zutrifft, dann ist Rose Aubrey – mit diesen ganzen kleinen, trivialen Offenbarungen über jedes Mitglied ihrer Familie – zwangsläufig auch diejenige von ihnen, die am meisten liebt. Ein weiterer herausstechender Zug ihres so reizenden Charakters bilden ihre felsenfesten Ansichten, wie grob und respektlos Erwachsene im Umgang mit Kindern werden können, wodurch Rose einer heimlichen Heldin gleicht. Aber das Aufregendste an diesem großartigen Roman ist die Entdeckung, dass die Familie sowohl ein Ort der Zugehörigkeit als auch Quell ständiger Konflikte und Verunsicherung ist. Wenn die Psychoanalyse uns zum Zeitpunkt der Handlung schon beinahe endgültig davon überzeugt hatte, dass wir für uns selbst ein Rätsel darstellen, dann sammelt die Erzählerin Rose Aubrey all jene Momente, in denen ihre Schwestern, ihre Mutter, ihre Cousine, ihr Vater oder ihr bemerkenswerter kleiner Bruder – häufig gegen ihren eigenen Willen – als vielschichtige, hochkomplexe Wesen entlarvt werden. Für Rose sind die anderen das Geheimnis, und diese Feststellung habe ich schon immer – wenn auch heute mehr denn je – für ein Charaktermerkmal gütiger Menschen gehalten.
Die Familie Aubrey liest man – und nie waren diese Worte zutreffender –, wie man einer schönen Sinfonie lauscht: voller Hingebung. Rebecca West ist mehr als eine erstklassige Erzählerin, sie ist eine weise Frau: Unbestreitbar besitzt sie nicht nur die Gabe der präzisen Wortwahl, sondern sie hat sich auch die Mühe gemacht, aufmerksam hinzuschauen und darauf zu warten, dass sich das echte Leben zeigt.
Andrés Barba
Für meine Schwester
Letitia Fairfield
1
Das Schweigen währte so lange, dass ich mich fragte, ob meine Mamma und mein Papa je wieder miteinander sprechen würden. Nicht dass ich befürchtete, sie hätten gestritten, Streit hatten nur wir Kinder, aber sie waren beide in einen Traum versunken. Dann sagte Papa zögerlich: »Du weißt, dass mir das alles sehr leidtut, meine Liebe.«
Fast wäre Mamma ihm ins Wort gefallen. »Das macht rein gar nichts, wenn nur diesmal alles gut geht. Und es wird doch gut gehen, nicht wahr?«
»Ja, ja, ganz bestimmt«, sagte Papa. In seine Stimme mischte sich ein spöttischer Unterton. »Ich sollte doch wohl den Anforderungen genügen. Ich werde doch wohl in der Lage sein, ein kleines Vorstadtblatt herauszugeben.«
»Ach, mein lieber Piers, ich weiß, dass diese Arbeit unter deiner Würde ist«, sagte Mamma versöhnlich. »Doch sie ist ein Geschenk des Himmels! Was für ein Glück, dass Mr Morpurgo zufällig so eine Zeitung besitzt, und wie gütig von ihm, schließlich hilft er dir …« Sie geriet ins Stocken.
»Wieder einmal«, beendete Papa geistesabwesend den Satz. »Ja, es ist sonderbar, dass ein reicher Mann wie Morpurgo sich mit der Lovegrove Gazette abgibt. Zwar wirft sie guten Profit ab, heißt es, aber für einen Mann mit diesen gewaltigen Einnahmen ist es doch nur ein Klacks. Aber wenn einer ein großes Vermögen anhäuft, mischen sich wohl alle möglichen Lumpen und Knochen unter das Gold und die Diamanten.« Erneut verfiel er in seine Träumereien. Der Blick aus seinen grauen Augen, strahlend unter den geraden schwarzen Brauen, durchbohrte die Wände der Bauernstube. Obwohl ich noch ein ganz kleines Mädchen war, wusste ich, dass er sich vorstellte, wie es wäre, Millionär zu sein.
Mamma griff nach der braunen Teekanne, schenkte ihm und sich nach und seufzte. Da richtete sein Blick sich wieder auf sie. »Findest du es sehr schlimm, hier an diesem einsamen Ort zurückzubleiben?«
»Nein, nein, ich bin überall glücklich«, antwortete sie. »Und ich habe mir schon immer gewünscht, die Kinder könnten einmal Ferien in den Pentlands machen, so wie ich damals in ihrem Alter. Und für Kinder gibt es nichts Besseres als das Leben auf einem Bauernhof. Jedenfalls wird das immer behauptet, warum, ist mir schleierhaft. Aber die Wohnung möbliert zu vermieten, das gefällt mir gar nicht. So etwas tun zu müssen!«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Papa bedrückt, aber ungeduldig.
All das geschah vor über fünfzig Jahren, und die Sorge meiner Eltern war keine Nichtigkeit. Damals waren nur wenige ehrbare Leute bereit, ihre Häuser möbliert zu vermieten, und kein ehrbarer Mensch wollte sie nehmen.
»Ich weiß, diese Leute haben einen triftigen Grund, eine Bleibe für den Sommer zu suchen, da sie aus Australien anreisen, um ihre Tochter in Dr. Phillips’ Sanatorium zu besuchen«, murmelte Mamma. »Aber es ist so riskant, die Wohnung mit den guten Möbeln Fremden zu überlassen.«
»Sie sind wohl wertvoll«, sagte Papa nachdenklich.
»Nun, sie sind natürlich bloß Empire«, sagte Mamma, »aber da doch vom Feinsten. Tante Clara hat sie während ihrer Ehe mit dem französischen Geigenspieler in Frankreich und Italien erworben, und sie sind durch und durch massiv und bequem, und natürlich sind sie kein Chippendale, aber die Stühle mit den Schwänen und die anderen mit den Delfinköpfen sind wirklich sehr hübsch, und die Seidenbezüge mit den Bienen und den Sternen sind ausgesprochen reizvoll. Wenn wir in Lovegrove von vorn anfangen, werden wir dankbar für die Möbel sein.«
»In Lovegrove«, sagte Papa. »Dass ich nach Lovegrove zurückkehre, ist wirklich sehr seltsam. Ist es nicht seltsam, Rose«, sagte er, während er mir ein Stück Zucker aus der Dose gab, »dass ich dich an einen Ort bringe, wo ich früher gelebt habe, als ich so klein war wie du?«
»War Onkel Richard Quin auch dort?«, fragte ich. Papas Bruder war mit einundzwanzig in Indien am Fieber gestorben. Zur Unterscheidung von einem anderen Richard in der Familie hatte man ihn Richard Quinbury getauft, und Papa hatte ihn so sehr geliebt, dass er unseren kleinen Bruder, den wir bei Weitem am nettesten von uns vier Kindern fanden, nach ihm benannte. Deshalb empfanden wir, dass uns mit dem Tod unseres Onkels eine Freude verloren gegangen war, und versuchten stets, ihn durch die Geschichten unseres Vaters zurückzuholen.
»Richard Quin war auch dort«, sagte Papa, »sonst würde ich mich nicht so gut daran erinnern. Die Orte, an denen ich ohne ihn war, sind mir nie so deutlich im Gedächtnis geblieben.«
»Du könntest versuchen, uns etwas in der Nähe des Hauses zu finden, in dem ihr gewohnt habt«, schlug Mamma vor. »Das wäre reizvoll für die Kinder.«
»Wie hieß es denn nur? Ach ja, Caroline Lodge. Aber es wird natürlich längst abgerissen worden sein. Es war ein recht kleines Haus, aber voller Charme.«
Auf einmal lachte Mamma. »Warum sollte es abgerissen worden sein? Sofern es nicht um die Zukunft von Kupferbergwerken geht, siehst du immer gleich schwarz.«
»Kupfer wird auf lange Sicht Gewinn bringen«, sagte Papa plötzlich kalt in einem Anflug von Verärgerung.
»Mein Lieber, du darfst nichts darauf geben, was ich sage!«, beteuerte sie. Sie und ich betrachteten ihn bang, und kurz darauf lächelte er. Gleichwohl sah er zur Uhr und sagte, es sei an der Zeit, dass er zum Bahnhof zurückkehre, wenn er den Sechsuhrzug nach Edinburgh erreichen wolle. Das Strahlen in ihm war erloschen, er hatte dieses heruntergekommene Bettleraussehen, das selbst wir Kinder manchmal an ihm bemerkten. Zärtlich sagte Mamma: »Nun gut, du sollst nicht den Zug verpassen und stundenlang an dem zugigen kleinen Bahnhof warten müssen, auch wenn wir dich weiß der Himmel bis zum letzten Moment bei uns behalten wollen. Ach, es ist gut von dir, wirklich herzensgut, mir dabei zu helfen, die Kinder hierher zu bringen, obwohl du so beschäftigt bist.«
»Es ist das Mindeste, was ich tun konnte«, antwortete er bedrückt.
Während der Pferdewagen vors Haus gebracht wurde, traten wir ins Freie und stellten uns auf die frisch gescheuerten Stufen des Bauernhauses. Die Weide vor uns erstreckte sich hinunter bis zum Ufer des Sees, der unten an den grau-grünen Talwänden einen dunkel schimmernden Kreis bildete, vollkommen rund. Auf halbem Weg zum Wasser erblickten wir zwei weiße Tupfen – meine ältere Schwester Cordelia und meine Zwillingsschwester Mary –, und einen blauen Tupfen – mein kleiner Bruder Richard Quin. Er war jetzt gerade einmal alt genug, dass er sehr schnell herumlief und hinfiel, immer ohne sich wehzutun, und in einem fort brabbelte und lachte und uns neckte; wir spielten den ganzen Tag lang mit ihm, ohne seiner jemals überdrüssig zu werden.
Meine Mutter warf den Kopf zurück und rief nach ihnen, ihre Stimme spitz wie ein Vogelschrei: »Kinder, kommt und verabschiedet euch von eurem Vater!«
Meine Schwestern blieben einen Augenblick wie angewurzelt stehen. An diesem neuen reizenden Ort hatten sie vergessen, was uns drohend überschattete. Dann hob Cordelia Richard Quin hoch und eilte, so schnell es die Vorsicht erlaubte, herbei; und nun standen wir vier da und sahen zu Papa hoch, sahen ihn eindringlich an, um ihn während seiner schrecklichen sechswöchigen Abwesenheit voll und ganz in Erinnerung zu haben. Vielleicht war es verkehrt, ihn so eindringlich anzusehen, aber er war so wunderbar. Kindliche Einbildung war das nicht; bei gewissen Dingen waren wir ausgesprochen objektiv. Wir wussten alle, dass Mamma nicht gut aussah. Sie war zu dünn, ihre Nase und ihre Stirn glänzten knöchern, und ihre Gesichtszüge waren nicht ebenmäßig, weil ihre gequälten Nerven ständig wie eine Harke ihr Antlitz zerfurchten. Außerdem waren wir so arm, dass sie nie neue Kleidung trug. Doch es war uns bewusst, dass unser Papa viel schöner war als alle anderen Väter. Nicht groß, aber schlank und anmutig, stand er wie ein Fechter in einem Bild da und strahlte etwas dunkel Romantisches aus; sein Haar und sein Schnurrbart waren tiefschwarz, seine Haut war sonnengebräunt, mit blassrosa schimmernden Wangen; und er hatte hohe Wangenknochen, was sein Gesicht so scharf geschnitten wie ein Katzenmaul aussehen ließ – es war das intelligenteste Gesicht, das man sich nur vorstellen konnte. Außerdem wusste er alles, er war schon auf der ganzen Welt gewesen, sogar in China, er konnte zeichnen und schnitzen und kleine Figuren und Puppenstuben anfertigen. Manchmal spielte er mit uns und erzählte uns Geschichten, und es war schier unerträglich, denn jeder Augenblick löste eine derart intensive Wonne in uns aus, so unvorhersehbar, dass man sich gar nicht darauf einstellen konnte. Sicher, er nahm manchmal tagelang keine Notiz von uns, und auch das war kaum zu ertragen. Doch es gehörte mit zu unserem Kummer, dass wir auch diese Qual sechs Wochen lang nicht erdulden würden.
»Kinder, Kinder, wir werden bald wieder zusammen sein«, sagte Papa, »und es wird euch hier gefallen!« Er deutete auf die Hügel jenseits des Sees. »Noch vor Ferienende werden sie sich alle violett verfärben. Das wird euch gefallen.«
»Violett?« Uns war unerklärlich, was er damit meinen konnte. Alle vier waren wir in Südafrika auf die Welt gekommen und hatten es erst vor einem knappen Jahr verlassen.
Nachdem er die Blüte des Heidekrauts beschrieben hatte, stieß Cordelia, die beinahe zwei Jahre älter als Mary und ich war und das ständig hervorkehrte, einen geräuschvollen Seufzer aus und sagte: »Oje! Für mich werden es schreckliche Ferien werden. Die Kinder werden die ganze Zeit weglaufen, um sich das anzusehen, und wenn sie sich auf den Hügeln verirren, muss ich immerzu hinter ihnen herrennen und sie zurückbringen. Und der See, da fallen sie bestimmt auch hinein.«
»Dummkopf, wir schwimmen beide genauso gut wie du«, murmelte Mary, und in der Tat hatten wir Mädchen es allesamt als Kleinkinder an den südafrikanischen Stränden gelernt. Mamma hörte sie und sagte: »Ach, jetzt streite nicht mit Cordelia, Mary«, und daraufhin neckte Mary sie: »Wann denn dann?«, und Cordelia zog eine übertriebene Grimasse der Verzweiflung, wie eine, der es nicht gelingen will, die Aufmerksamkeit der Welt auf die gewaltige Bürde zu lenken, die sie zu schultern hat, und ich flüsterte Mary zu: »Später hauen wir sie.« Doch dann wurden wir von Mammas Worten abgelenkt.
»Ich verstehe es also richtig, du reist morgen nach London und stattest dann wohl sofort Mr Morpurgo einen Besuch ab.«
»Nein«, sagte Papa. »Nein, ich begebe mich direkt in die Redaktion in Lovegrove.«
»Kein Besuch bei Mr Morpurgo? Um dich zu bedanken? Ach, aber er wird doch gewiss erwarten, dass du das zuallererst tust.«
»Nein«, sagte Papa. »Er sagt, er wolle mich nicht sehen.« Als Mammas Blick sich verhärtete, stieß er ein leises spöttisches Lachen aus. »Er war schon immer ein scheuer Geselle. Etwas hat ihn momentan verärgert, und er sagt, es freue ihn, dass ich seine Zeitung für ihn leiten werde, aber er halte es für besser, wenn ich mich nur mit einem seiner Direktoren, der sich um derlei Bagatellen kümmert, auseinandersetzen würde und wir uns nicht träfen. Soll er seinen Willen haben, auch wenn ich es nicht begreife.«
Mamma begriff es vielleicht doch. Nach einem bebenden Atemzug sagte sie: »Na schön. Du fährst also direkt in die Redaktion in Lovegrove und triffst sämtliche Vorbereitungen für deine Arbeit, und anschließend suchst du ein Haus für uns. Dann fährst du nach Irland zu deinem Onkel, und ich komme mit den Kindern und den Möbeln rechtzeitig nach London, damit alles bereit ist, wenn die Kinder nach den Ferien in die Schule gehen und du am ersten Oktober mit der Arbeit beginnst. So machen wir es, nicht wahr?«
»Ja, ja, meine Liebe«, sagte er, »so machen wir es.« Er küsste uns alle, angefangen bei Cordelia bis hin zu Richard Quin, eine Reihenfolge, an die er sich immer hielt, denn er war ein gerechter Mann. Früher hatte dies Mary und mich bekümmert, denn wir waren gegen das Erstgeburtsrecht, bis Mary in den Sinn kam, dass auch wir immer zuerst das fadeste Essen auf unseren Tellern aßen und uns das, was wir gern mochten, bis zum Schluss aufsparten. Dann ließ Papa den schnurrbärtigen Mund an Mammas Wange sinken und fragte, als er den Kopf wieder hob, leichthin: »Wie lang könnt ihr hierbleiben?«
Mammas Gesicht zuckte. »Aber ich habe es dir doch erklärt. Mit dem Geld, das mir die Australier für die Wohnung gegeben haben, habe ich den Zahlungsrückstand bei unserem Vermieter beglichen und die Schulden bei sämtlichen Lieferanten bezahlt, und mit dem Rest können wir bis zur dritten Septemberwoche hierbleiben. Aber nicht länger. Nicht länger. Aber warum fragst du? Stehen deine Pläne denn nicht fest? Machen wir es nicht, wie wir es eben besprochen haben?«
»Doch, doch«, erwiderte mein Vater.
»Sag es mir, wenn sich etwas ändert«, bat sie mit Nachdruck. »Ich ertrage alles. Aber ich muss es wissen.«
Wir beobachteten die beiden mit einer Neugier, die sich auf viel mehr als diesen einen Augenblick bezog. Warum mussten wir Edinburgh schon so bald verlassen? Bei unserer Abreise aus Südafrika, wo wir recht beschaulich an der Peripherie eines Krieges gelebt hatten, hatte Mamma uns Folgendes erklärt: Da Papa eine Stelle als stellvertretender Redakteur beim Caledonian bekäme, würden wir in Edinburgh leben, bis wir fast erwachsen wären und nach London gehen müssten, um, ganz wie sie früher einmal, eines der bedeutenden Konservatorien zu besuchen. Und in Südafrika, warum waren wir dort so plötzlich von Kapstadt nach Durban umgezogen? Und warum war Mamma immer so bekümmert, wenn es hieß, dass ein Ortswechsel bevorstand, wohingegen Papa gelassen blieb, aber geistesabwesend sprach, als widerfahre das alles einem anderen, und oft leise und verächtlich in sich hineinlachte. Genau das tat er jetzt auf dem Weg zum Pferdewagen. »Es gibt nichts zu wissen, meine liebe Clare«, sagte er und sprang auf den Sitz neben dem Kutscher.
»Auf Wiedersehen«, rief Mamma ihm nach. »Und schreib! Schreib! Nur eine Postkarte, wenn du für einen Brief zu beschäftigt bist. Aber schreib!«
Wir sahen zu, wie der Wagen losfuhr und das Stück Straße zurücklegte, das bis zum Ende des Tals verlief, und danach den Pass überquerte und verschwand. Das dauerte nicht lange. Der Bursche, der fuhr, holte das Äußerste aus seinem Pferd heraus; vor Papa wollten die Leute sich immer hervortun. Dann zog Richard Quin an Mammas Rock und sagte ihr in seinem Gebrabbel, sie solle nicht weinen und dass er etwas zu trinken wolle. Wir kehrten in die Stube zurück und konnten uns an ihm nicht sattsehen, während er auf Mammas Schoß saß und glucksend Milch hinunterschluckte, am ganzen Leib vor Anstrengung und Freude am Schlucken bebend wie ein Welpe an einer Untertasse.
»Wer ist Mr Morpurgo?«, fragte Mary. »Ein komischer Name. Er hört sich wie ein Zauberer an. ›Der Große Morpurgo.‹« Sie wusste nur zu gut, dass Mamma etwas beunruhigte, was dieser Unbekannte getan hatte, aber sie war nicht einfach taktlos. Zwar waren wir noch recht jung, aber auch bereits schlau wie die Füchse. Das mussten wir sein. Wir mussten in den Wind schnuppern und entscheiden, aus welcher Richtung das nächste Unheil kommen würde, und uns dagegen wappnen, auch wenn unsere Eltern unsere Methoden nicht immer gebilligt hätten. Als der Ärger beim Caledonian begonnen hatte – worum auch immer es sich gehandelt haben mochte –, hatten Mary und ich es für ratsam gehalten, den Nachbarskindern zu erzählen, dass Papa anderswo eine bessere Stellung angeboten bekommen habe. Auf diese Weise erreichten wir, dass Mamma zu einer Zeit, als sie unglücklich war, von den Nachbarn nicht mit weniger, sondern mit mehr Respekt behandelt wurde; außerdem, so sagten wir uns, stellte es sich ohnehin als wahr heraus, denn er ging ja nun zur Lovegrove Gazette. Wir waren auf eine vernünftige Verhaltensweise gestoßen, und die Pingeligkeit der Erwachsenen würde uns nicht davon abbringen.
»Mr Morpurgo«, sagte Mamma, »ist jemand, dem wir ein Leben lang dankbar sein müssen. Er ist ein sehr reicher Mann, Bankier, glaube ich, und seit er euren Papa kennengelernt hat, irgendwo auf einem Schiff, hat er alles in seiner Macht Stehende für ihn getan. Er hat eurem Papa die Stelle in Durban verschafft, nachdem die Besitzer seiner Zeitung in Kapstadt sich so eigentümlich verhielten. Sie nahmen überhaupt keine Rücksicht. Und da The Caledonian sich nun als so eine Enttäuschung für euren Papa entpuppt hat, ist er von Mr Morpurgo zum Chefredakteur seiner Zeitung in Südlondon gemacht worden. Ich weiß nicht, was ohne ihn aus uns geworden wäre. Obwohl ich das eigentlich nicht sagen sollte. Ihr dürft niemals glauben, dass euer Papa nicht irgendeinen Weg fände, um für uns zu sorgen. Er wird uns niemals«, sagte sie, während sie die Tasse schräg hielt, damit Richard Quin den letzten Tropfen bekam, »im Stich lassen.«
»Wie sieht Mr Morpurgo aus?«, fragte ich.
»Das weiß ich nicht«, sagte Mamma. »Ich glaube nicht, dass ich ihm je begegnet bin. Aber euer Papa kennt ihn nun schon eine ganze Weile. Er bewundert euren Papa sehr. Das tut ein jeder, abgesehen von Leuten, die neidisch auf ihn sind.«
Cordelia fragte: »Warum sollte ihn jemand beneiden? Wir haben doch so wenig Geld.«
»Ach, man beneidet ihn um seinen Verstand, sein Aussehen, alles an ihm«, seufzte Mamma, »und außerdem hat er immer recht, wohingegen alle anderen sich irren. Eine Lage«, sagte sie streng und richtete die lodernd schwarzen Augen der Reihe nach auf jede Einzelne von uns, »in der sich wahrscheinlich keiner von euch je befinden wird.« Dann wurde sie wieder sanft und blickte auf Richard Quin, wie er die Tasse beinahe umgedreht hielt, um an die letzten Tropfen zu gelangen. »Nein, mein Lämmchen. Wenn du beim Essen laute Geräusche von dir gibst, musst du aufhören, denn dann machst du es falsch, und wenn du nicht aufhörst und es nicht geräuschlos tust, wirst du dich in ein kleines Ferkel verwandeln, und dann wirst du in einem Schweinestall leben müssen, und auch wenn dir das vielleicht gefallen würde, wären doch deine armen Schwestern außer sich. Sie würden bei dir sein wollen, aber es gäbe keinen Platz für sie, und du musst Rücksicht auf sie nehmen, sie sind doch so lieb zu dir. Ach, mein kleines Lämmchen, ich frage mich, was für ein Instrument du wohl einmal spielen wirst. Wie ärgerlich, das nicht zu wissen.«
Denn natürlich spielten wir alle ein Instrument. Genau wie alle Mitglieder von Papas Familie in Irland Soldaten oder Soldatenfrauen waren, war jeder in Mammas Familie aus den West Highlands Musiker, und das schon immer, seit mindestens fünf Generationen. Einen großen Namen in der Welt der Musik hatten sie sich nicht gemacht, vielleicht weil alle sehr jung gestorben waren; doch Mammas Großvater war nach Österreich gegangen und hatte im Orchester der Wiener Oper gespielt und Beethoven und Schubert persönlich kennengelernt, und ihr Vater war Kapellmeister an einem kleinen deutschen Herzoghof gewesen, ihr verstorbener Bruder hatte als Dirigent und Komponist einige Bekanntheit erlangt, und sie selbst wäre eine berühmte Pianistin geworden, ja, mit Mitte zwanzig war sie bereits bekannt, als man ihr eines Abends, gerade als sie bei einem Konzert in Genf aufs Podium treten wollte, ein Telegramm überreichte, in dem stand, ihr Lieblingsbruder sei in Indien an einem Hitzschlag gestorben. Sie hatte das Programm zu Ende gespielt, war dann in ihr Hotel zurückgekehrt und an einer Art Fieber erkrankt, das wochenlang anhielt und sie letztlich so melancholisch machte, dass sie sich zur Genesung auf eine Weltreise begab, als Gesellschafterin einer alten Frau, die ihr Klavierspiel bewunderte. In Ceylon war sie Papa begegnet, der damals gerade eine gute Stellung auf einer Teeplantage hingeworfen hatte. Sie heirateten und zogen nach Südafrika, wo ihm einer seiner Verwandten eine andere gute Stellung verschaffte. Doch auch dort war er glücklos, Mamma hatte uns die Einzelheiten nie erzählt. Allerdings war es nicht so wichtig. Denn er hatte schon seit einiger Zeit geschrieben und sein Talent dafür entdeckt, und so bekam er ganz leicht die Stelle als Leitartikelschreiber bei einer Zeitung in Kapstadt. Und Mamma hatte uns bekommen und alle Hände voll zu tun gehabt, und nun war sie über vierzig, ihre Finger wurden allmählich steif, und um ihre Nerven war es nicht gut bestellt, und mit dem Klavierspiel war es für immer vorbei. Doch sie brachte uns das Musizieren bei, und obwohl Cordelia kein Talent besaß und Mamma sie mit sieben Jahren als hoffnungslosen Fall aufgegeben hatte, hielt sie doch Mary und mich für recht begabt. Und irgendwie wussten wir, dass Richard Quin ebenfalls begabt war. Die Triangel, mit der wir alle angefangen hatten, beherrschte er schon recht gut.
»Das Klavier wird es wohl nicht«, sagte Mamma und musterte ihn eingehend, als stünde es in der Maserung der Haut geschrieben, welches Instrument man spielen werde. Und das ergab auch Sinn. Schon damals war es unvorstellbar, dass Richard Quin sich an ein Klavier setzte, ein imposantes, gewaltiges Instrument, größer als der Mensch, der es spielt, das für jegliche Annäherung, die nicht über die Klaviatur entsteht, unempfänglich ist. Allerdings konnte man sich gut vorstellen, dass er nach einer Geige oder einer Klarinette griff. »Und ihr, Mary und Rose«, fuhr sie fort, »der Erard in der Ecke ist alt, aber er ist gestimmt. Alle halbe Jahre kommt ein Mann aus Penicuik her und stimmt den Flügel. Das Schicksal ist uns hold. Die Weirs erlauben euch, jederzeit darauf zu spielen, nur nicht sonntags. Keine Ausflüchte also, ihr müsst ganz genauso regelmäßig üben wie zu Hause. Und während unseres Aufenthalts hier erteile ich euch fünfmal statt dreimal die Woche Unterricht. Ich habe jetzt mehr Zeit.«
»Und was ist mit mir?«, fragte Cordelia.
Mary und ich blickten sie liebevoll an, obwohl wir häufig nur Abneigung für sie übrighatten, und es entstand eine Pause, ehe Mamma antwortete: »Ach, du wirst deine Stunden genau wie die anderen erhalten, keine Sorge.«
Cordelia ahnte nicht, dass sie keinerlei musikalisches Talent besaß. Und da ein kleines Nachbarmädchen gerade Geigenunterricht bekam, als Mamma Cordelias Klavierstunden einstellte, hatte unsere Schwester darauf bestanden, ebenfalls dieses Instrument zu lernen. Seither legte sie einen außerordentlichen und fehlgeleiteten Fleiß an den Tag. Sie hatte ein feines Ohr, ja, sie besaß im Gegensatz zu Mamma, Mary oder mir das absolute Gehör, was eine schreckliche Verschwendung war, und ihre Finger waren gelenkig, sie konnte sie bis ganz ans Handgelenk zurückbiegen, und sie spielte alles vom Blatt. Doch Mammas Gesicht verzog sich, erst vor Zorn und dann, gerade noch rechtzeitig, vor Mitleid, wann immer sie hörte, wie Cordelia mit dem Bogen über die Saiten fuhr. Ihr Ton war furchtbar dick aufgetragen, und ihr Ausdruck hörte sich immer wie die Erklärung an, die ein dummer Erwachsener einem Kind gibt. Außerdem war sie unfähig, gute Musik von schlechter zu unterscheiden, wie wir es konnten, es schon immer gekonnt hatten.
Es war nicht Cordelias Schuld, dass sie unmusikalisch war. Mamma hatte uns das häufig auseinandergesetzt. Kinder kamen nach der Familie ihres Vaters oder nach der ihrer Mutter, und Cordelia hatte eben Papa beerbt. Das brachte ihr wahrlich einige Vorteile ein. Mary hatte schwarzes Haar und ich hatte braunes, und so war es bei vielen anderen kleinen Mädchen. Doch obgleich Papa so dunkel war, kam in seiner Familie auch rotes Haar vor, und Cordelia hatte einen Kopf voll mit kurzen rotgoldenen Locken, die im Licht glänzten, sodass sich die Leute auf der Straße umdrehten. Dahinter steckte aber mehr als bloße Vererbung, was es noch unerträglicher machte. Auf Papas Insistieren hin ließ Mamma Cordelia das Haar kurz tragen zu einer Zeit, als das eine längst in Vergessenheit geratene Mode war, die erst Jahre später wieder aufleben sollte. In seinem Elternhaus in Irland hatte ein Porträt seiner Tante Lucy gehangen, die kurz nach den Napoleonischen Kriegen nach Paris gegangen war und sich von Baron Gérard in einem Chiton mit Leopardenfell malen ließ, das Haar in der als à la Bacchante bekannten Art frisiert, und da Cordelia ihr stark ähnelte, brachte Papa Mamma dazu, ihr die Locken in einem ganz ähnlichen Stil schneiden zu lassen, jedenfalls so gut es die verwirrten Friseure in Südafrika und Edinburgh zuwege brachten.
Mary und mir gefiel das nicht. Es gab uns das Gefühl, dass Cordelia Papa nicht nur aufgrund einer ungerechten Entscheidung der Natur näherstand, sondern dass sie zudem ein Objekt war, an dem er so lange gefeilt hatte, bis sie den Maßstäben seines Geschmacks entsprach. Mit uns hatte er das nicht getan. Und auch sonst feilte niemand an uns. Vor lauter Klavierspielen blieb Mary und mir keine Zeit, und Mamma hatte auch keine Zeit, uns irgendeine Behandlung angedeihen zu lassen, die funkelnde Brillanten aus uns machen würde. Wir blieben Rohdiamanten. Es war wirklich grausam, dass wir zusätzlich zu unserem Klavierspiel auch noch so viel zu tun hatten, dass Mamma einzukaufen und bei der Hausarbeit zu helfen und mit Papas Sorgen umzugehen hatte, sodass sie nie gelassen und wie andere Mammas gekleidet war, dass wir in die Schule gehen mussten und immer einen nachlässigen und gehetzten Eindruck auf unsere Lehrerinnen machten.
Doch eben das Klavierspiel machte alles wieder wett. Denn wenn es in Papas Familie auch rote Haare gab, so fehlte doch jeder Funke musikalisches Talent, und wir wollten lieber wie Mamma musikalisch sein als rotgoldene Locken zu haben und uns zum Gespött zu machen, indem wir wie Cordelia Geige spielten. Cordelia tat uns leid, besonders jetzt, da Papa, von dem sie ihren gesamten Reiz bezog, sechs Wochen fort war. Nichtsdestotrotz war es eine Eselei von ihr zu glauben, sie könnte Geige spielen, es war, als glaubten Mary und ich, wir hätten rotgoldene Locken.
Die Zimmerluft wogte im Gezeitenstrom von Sympathie und Antipathie, Vergebung und Groll, und dann trat die Bäuerin ein und fragte, ob wir Lust hätten, uns die Stute und das Fohlen anzusehen, die ihr Mann gerade eben von einem Verkauf auf einem Berghof mitgebracht habe, und wir gingen hinüber in die Welt der Tiere. Doch auch hier gab es Gezeiten, nichts war von Bestand. Zuerst wurden wir den Collies vorgestellt, die an uns schnuppern und uns belecken sollten, damit sie uns als Hausbewohner erkennen und uns weder anbellen noch beißen würden. Das mochten wir nicht, denn wir missbilligten Tiere von so böswilliger Gesinnung, dass es solcher Zeremonien bedurfte, ehe sie sich darauf einließen, harmlosen Menschen wie Mamma und uns die angemessene Höflichkeit entgegenzubringen. »Aber es sind Wachhunde«, rief Mamma uns ins Gedächtnis, »sie schützen den Hof vor Dieben«, doch wir spotteten: »Was für Diebe?«, und ließen den Blick triumphierend durch das Amphitheater aus freien grünen Hügeln schweifen, als bewiese die Unschuld des Bühnenbilds die Unschuld des Dramas. Sonderbarerweise lag damals der Glaube in der Luft, dass Krieg, Verbrechen und jegliche Grausamkeit demnächst aus der Welt verschwinden würden. Selbst kleine Mädchen wussten, dass dies ein Versprechen war, das gehalten werden würde.
Dann deutete die Bäuerin auf ein paar Felder am Hang, die von Vieh braun gesprenkelt waren, und riet uns, nicht dorthin zu gehen, weil ein Stier bei den Kühen sei. Dagegen hatten wir nichts einzuwenden, denn wir mussten gefühlt haben, dass das geheimnisvolle sichere Geleit, das uns das Universum gewährte, nicht für Stiere galt. Uns wurde der Mund trocken bei der Vorstellung, wie es wäre, auf jenen Weiden in Bedrängnis zu geraten, ganz besonders zusammen mit Richard Quin. Doch in den Kuhställen stand das Jungvieh – die Kälber, die noch keine Jährlinge waren –, so gesittet und freundlich da, wie wir es selbst gern gewesen wären, und auf dem Boden lag schlaff wie ein großer Strang strohfarbener Seide ein zweieinhalb Tage altes Kalb, das sich vor uns ängstigte, wie wir uns vor den Hunden und dem Stier geängstigt hätten, wenn wir unsere Furcht nicht betäubt hätten, aus Sorge, die Lüge zu untermauern, dass Mädchen nicht so mutig wie Jungen waren. Der Feminismus lag ebenfalls in der Luft, selbst in den Kinderstuben. Aber die Hofkatzen fauchten uns an, und wir mussten, Mut hin oder her, die Hände zurückziehen, während sie uns zornig anfunkelten, ungehobelt wie Einbrecher, ungehobelt wie der berüchtigte Verbrecher Charles Peace und so gar nicht wie Katzen. »Vergesst nicht«, rief Mamma, »dass die Ärmsten gegen Ratten kämpfen müssen, was sie nicht könnten, wenn sie zahm wären. Einen derartigen Luxus könnten sie sich nicht leisten.« War die Welt nun freundlich oder nicht, würde der Bauernhof ein sicherer Ort für Richard Quin sein?
Doch in einer Bewegungsbox fanden wir die neue Stute mit ihrem Fohlen vor und sahen, dass es Hoffnung gab. Ihr langer gerader Schopf, der zwischen ihren großen Ohren hindurchfiel, verlieh ihr das Aussehen einer unscheinbaren Frau mit einem hässlichen Hut. Ihr Blick war nervös, als wäre sie menschlich und hätte Gewicht. Sie überragte uns zwar bei Weitem, doch es war unvorstellbar, dass sie ihre Kraft gegen uns einsetzen würde. Ihr langbeiniges Fohlen war scheu, als hätte man es ermahnt, ja kein Geräusch von sich zu geben und die Leute an diesem neuen Ort, wohin das Schicksal sie verschlagen hatte, zu erzürnen. Die Stute erinnerte mich an eine duldsame und diensteifrige, aber traurige Witwe mit ihrem vaterlosen Kind, die ich einmal in einer Stellenvermittlung für Dienstboten gesehen hatte, wohin meine Mutter gelegentlich ging. (Denn obgleich wir so wenig Geld besaßen, hatten wir doch eine Hausangestellte, denn damals gab es sogar in armen Häusern Dienstboten, man teilte die eigene Armut mit irgendeinem völlig mittellosen Mädchen.)
Wir gingen weiter in die Ställe hinein und konnten in der Dunkelheit nichts ausmachen als die weißen Sterne an den Stirnen der stehenden Pferde, die langen weißen Blessen auf ihren Gesichtern, ihre weißen Stiefel, und ein weißes Muster aus Licht, das durch ein zweibogiges Fenster hoch oben an die Wand geworfen wurde. Dieser Hof war in der Ruine einer mittelalterlichen Burg erbaut worden, die einst ein Versammlungsort der Tempelritter gewesen war, und hier an dieser Stelle hatten sie gespeist. Nach einer Weile erkannten wir das nervöse Rollen der sanften Augen, das zeigte, dass diese Pferde sehr wohl einen eigenen Willen besaßen, wenn sie denn wollten, und den fassartigen Rumpf ihrer gegürteten Leiber, die baumstammhafte Geradlinigkeit ihrer Vorderbeine, die geschickt federnde Elastizität ihrer Hinterbeine, die gewaltigen Ausmaße ihrer Hufe; wir konnten die ganze Kraft sehen, die sich so wenig regte und so viel milder gab, als wenn hier Feindseligkeit geherrscht hätte. Es waren gutmütige Geschöpfe. Wir bemerkten zwei Mäuse, die in der Streu unter einem Riesen spielten, und sahen dies als Beweis.
Die Anreise, der Abschied von Papa und die Begegnung mit all diesen Tieren hatten uns so ermüdet, dass wir kaum später als Richard Quin zu Bett gingen, noch im Hellen, obwohl wir sonst bis zum letzten Moment aufblieben, der uns erlaubt wurde. Cordelia, Mary und ich schliefen in einem Zimmer, Mary und ich in einem Doppelbett mit einem hohen Mahagonikopfteil, in das rundes Obst und Blumen geschnitzt waren, und Cordelia in einem Feldbett am Fußende. Niemand konnte mit Cordelia schlafen, denn sie wälzte sich in ihren Träumen oft herum und stieß Befehle aus. Mary und ich lagen nachts ganz behaglich da, wir kuschelten uns immer aneinander, indem eine das Gesicht an den Rücken der anderen schmiegte und den Bauch an ihren Po drückte, woraufhin wir bis zum Morgen nichts mehr mitbekamen. Mary war hochgewachsen und schlank, sie sah gewissermaßen wie eine Erwachsene aus, obwohl sie noch ein Kind war. In ihrer ruhigen, abwägenden Art gelang es ihr am Klavier, jedes Problem des Fingersatzes still zu lösen, wohingegen ich mich darauf stürzte, in helle Aufregung geriet und weinte; doch mir gegenüber war sie immer sanft und nachgiebig, miteinander waren wir wie zwei kleine Bären.
Als Mamma uns eine gute Nacht wünschte, fiel mir auf, dass ihr schottischer Dialekt seit dem Gespräch mit den Bauersleuten viel breiter geworden war, die Linie ihrer Sätze musste nur in die Länge gezogen werden, um Liedzeilen daraus zu machen. Es klang sehr hübsch. Falls wir nachts irgendetwas brauchten, so erklärte sie uns, sollten wir sie wecken, und dafür müssten wir noch nicht einmal auf den Flur hinaustreten, denn die Tür neben dem Fenster sei keine Schranktür, wie wir vielleicht vermuteten, sondern führe in das Zimmer, in dem sie und Richard Quin schliefen. Immer sagte sie solche Dinge, aber wir brauchten nie Hilfe, so eigenständig waren wir, so reif für unser Alter. Doch es war nett von ihr, fanden wir, während wir in den Schlaf sanken.
Plötzlich waren wir alle wieder munter. Ich war so hellwach, als hätte ich gar nicht geschlafen. Mit ausgestreckter Hand tastete ich nach Mary, die aufrecht, den Rücken an das Kopfteil gelehnt, im Bett saß; und das Feldbett knarrte unter Cordelia, als sie aufschreckte. Stockdunkel war es, und grässliche Töne waren zu hören. Es war, als fürchtete die Nacht sich vor sich selbst. Jemand oder etwas schlug auf eine Trommel. Das Geräusch war nicht sonderlich laut, hallte jedoch von überall wider, es war, als wäre die Erde selbst die Trommel. Darüber wurden wir wieder so traurig wie bei Papas Abreise, wie bei Mammas gelegentlichen Tränen. Das Geräusch bedeutete nichts als Traurigkeit und tat sie fortwährend kund.
Dann verstummte es. Marys Hand schob sich in meine. Ich benetzte die Lippen und hauchte: »Was war das?« Schließlich war Cordelia älter als wir und wusste vielleicht Bescheid.
Cordelia sagte: »Es ist nichts. Es kann nichts sein. Die Bauersleute müssen es auch hören. Wenn es etwas Gefährliches wäre, würden sie herkommen und uns warnen.«
»Aber wenn es vielleicht noch nie da gewesen ist?«, sagte Mary.
»Ja, das hier könnte mit dem Weltuntergang zusammenhängen«, sagte ich.
»Unsinn«, widersprach Cordelia, »wir werden den Weltuntergang nicht erleben.«
»Warum denn nicht?«, fragte ich. »Irgendjemand wird den Weltuntergang schließlich erleben.«
»Und in gewisser Weise wäre es aufregend, dabei zu sein«, sagte Mary.
»Schlaft weiter«, sagte Cordelia.
»Wenn wir schlafen wollen, machen wir das schon«, sagte Mary, »aber schreib es uns nicht vor.«
»Ich bin die Älteste«, sagte Cordelia.
Da setzte es erneut ein, dieses Schlagen auf der Riesentrommel.
»Mary, Mamma hat gesagt, dass an deiner Bettseite eine Kerze ist«, sagte ich. »Zünde sie an, dann können wir ans Fenster gehen und nachsehen, ob etwas los ist.«
In der Dunkelheit hörten wir das Kratzen der Zündhölzer an der Schachtel, aber es wurde nicht hell.
»Ich begreife nicht«, sagte Cordelia, »warum Mamma die Kerze nicht bei mir gelassen hat.«
»Weil bei dir kein Tisch steht, du Esel«, sagte Mary. »Aber ich glaube, die Streichhölzer sind feucht, sie zünden nicht.«
»Nichts als eine Ausrede, weil du zu ungeschickt bist«, sagte Cordelia.
»Du wirst sauer, weil du Angst hast«, entgegnete Mary.
Der Lärm schwoll an, um von Unheil und Verderben zu künden; doch auf einmal zerrann die Dunkelheit zu einem blassen, flackernden Licht, denn die Tür in der Wand öffnete sich, und Mamma kam herein, einen Kerzenhalter in der einen Hand und sich mit der anderen die Augen reibend. »Kinder, was soll denn dieses laute Gerede mitten in der Nacht?«, fragte sie. »Wir sind nicht allein, so wie zu Hause, und ihr könntet die Weirs aufwecken, die doch so hart arbeiten.«
»Mamma, was ist das für ein schrecklicher Lärm?«
»Ein schrecklicher Lärm! Was für ein schrecklicher Lärm?«, fragte sie, Augen und Mund ganz dumpf vom Schlaf.
»Na, der jetzt gerade zu hören ist«, sagte Mary.
Mamma murmelte: »Kann noch etwas Außergewöhnliches vor sich gehen?« Sie lauschte angestrengt, ihr Gesicht hellte sich auf. »Aber, Kinder, das sind doch die Pferde, die in ihren Boxen stampfen.«
Wir waren verblüfft. »Was, bloß die Pferde, die wir heute Nachmittag gesehen haben?«
»Ja, genau die. Ach, wenn ich nun hinhöre, wundert es mich nicht, dass ihr euch gefürchtet habt. Die Pferdehufe machen wirklich einen Heidenlärm.«
»Aber warum klingt es so traurig?«
Gähnend antwortete sie: »Nun, so klingt Donner auch; so traurig, als wäre alles endgültig in die Brüche gegangen. Und das Meer hört sich oft traurig an und der Wind in den Bäumen fast immer. Schlaft weiter, meine Lämmchen.«
»Aber wie kann ein Pferdehuf, der auf den Stallboden stampft, so traurig klingen?«, fragte ich.
»Nun, warum klingen Mammas Finger, die sich auf Elfenbeintasten legen, manchmal so tieftraurig?«, fragte Mary.
»Darüber denken wir bitte morgen nach«, bat Mamma, »selbst wenn ich eigentlich nicht weiß, warum ich euch versprechen sollte, dass unsere Grübeleien irgendeinen Zweck haben werden. Wenn ihr mich morgen oder sonst irgendwann danach fragt, warum manche Töne traurig klingen und andere fröhlich, werde ich es euch nicht erklären können. Noch nicht einmal euer Papa wäre dazu imstande. Aber was für eine Frage, meine Lieblinge! Wenn ihr das wüsstet, dann wüsstet ihr alles. Gute Nacht, meine Süßen, gute Nacht.«
Etwa die ersten zehn Tage waren wir alle glücklich auf dem Bauernhof. Wir Kinder waren trunken von der Bergluft, denn bis dahin hatten wir nie mehr als ein paar Stunden so hoch über dem Meeresspiegel verbracht. »Und in den richtigen Gebirgen ist es sogar noch schöner«, erklärte Mamma uns. »O Kinder, wenn ihr euer Glück gemacht habt, müsst ihr unbedingt in die Schweiz reisen. Dort oben in Davos war die Luft so klar, dass alles aussieht, als habe man es mit einem weichen Tuch poliert.« Wir sagten skeptisch: »In die Schweiz?«, und taten unsere Absicht kund, weiter weg zu reisen, zum Kilimandscharo, zum Popocatépetl, zum Mount Everest. Ja, wir würden warten, bis Richard Quin alt genug wäre, und dann würden wir die Ersten sein, die den Mount Everest bestiegen. »Nein, nein«, sagte Mamma, gar nicht begeistert, »nicht den Everest. Sobald ihr Erfolg habt, werdet ihr feststellen, dass ihr mit euren Konzerten alle Hände voll zu tun habt, ja tatsächlich zu viel.«
Ernst gemeinte Antworten dieser Art gab sie häufig, und sie waren der Grund für eine der größten Widrigkeiten in unserem Leben. Gewöhnliche Leute unterhielten sich oft eine Zeit lang mit Mamma und gingen dann aufgrund solcher Bemerkungen in dem Glauben fort, sie wäre dumm oder sogar nicht ganz richtig im Kopf. Dabei zeigte sie sich wunderbar verständig. Sie wusste, dass sie auf den Mount Everest gestiegen wäre, hätte sich ihr die Möglichkeit geboten, und da sich die Welt derart schnell veränderte, ging sie davon aus, dass wir die Gelegenheit haben würden; sie wäre beinahe eine berühmte Pianistin geworden, und sie hielt es für wahrscheinlich, dass wir mit unserem Talent erfolgreich sein würden, wo sie nur aufgrund von Pech gescheitert war; und überhaupt redete sie in dem Moment mit Kindern, und so redete sie eben als Kind, wie man Bach auf Bach’sche Manier spielte, und Brahms auf Brahms’sche Manier.
Wir nutzten diese Ferien als Vorübung für den Everest, als eine Kraftprobe, und abermals war Mamma verständnisvoll, bestand jedoch darauf, dass wir uns nicht übernahmen. Eigentlich waren wir davon ausgegangen, wir würden den Teil des Tages, an dem wir nicht mehr üben mussten, mit langen Spaziergängen durchs Moor verbringen, aber es machte uns mehr Spaß, auf dem Hof auszuhelfen und Arbeiten zu erledigen, die der Bauer und seine Frau uns nicht zugetraut hätten, weil sie uns nicht für stark oder erwachsen genug hielten. So brachten wir einen vergessenen Korb Fladenbrot hinunter zu den Männern, die auf dem abgelegensten Feld weit hinter dem Pass arbeiteten; wir putzten am Tag, ehe der Wagen hinunter zum Markt fuhr, die runden Schmuckplaketten am Pferdegeschirr; wir pflückten die Lavendelblüten von den Sträuchern im Garten und legten sie zum Trocknen unter Nesseltuch auf Bretter in die Sonne. Mamma ließ uns tun, wonach uns der Sinn stand, vorausgesetzt wir übten lange genug am Klavier, was uns keine große Mühe kostete, denn in den Ferien spielten wir immer besser, weil es keine idiotischen Hausaufgaben gab, und da es uns nun so gut ging, waren unsere Finger doppelt so schlau wie sonst. Und sobald wir alle unseren Unterricht gehabt hatten, nahm Mamma an unserer wunderbaren, großtuerischen, neuen und aufregenden Arbeit auf dem Hof teil, auch wenn der Bauer und seine Frau sie anfangs fernhalten wollten. Am Morgen nach unserer Ankunft hatten wir mit angesehen, wie ihr noch so ein Fehler unterlaufen war, der die Leute dazu veranlasste, sie für sonderbar zu halten. Fröhlich hatte sie die ganze Summe, die für unseren sechswöchigen Urlaub vereinbart worden war, in Geldscheinen und Sovereigns der Bank of Scotland auf dem Küchentisch ausgeschüttet. Die Weirs, hagere, rotblonde, ernste Leute, hatten sie voller Skepsis mit verkniffenen und blöden Blicken gemustert. Sie begriffen nicht, warum jemand im Voraus bezahlen wollte, wenn es doch gar nicht nötig war; und noch weniger verstanden sie, warum eine Frau mittleren Alters wie ein junges Mädchen auf dem Weg zu einem Ball lachte, während sie so etwas Unangebrachtes tat. Wir hatten Verständnis für sie. Es bereitete ihr großes Vergnügen, dieses Geld den geheimnisvollen Mächten zu entreißen, die über jegliches Geld in unserer Familie walteten, indem sie es zunichtemachten, als hätte es nie existiert; schon seit Jahren hatte sie nicht mehr die Befriedigung erlebt, eine Zahlung zu leisten und dafür zu sorgen, dass sie noch nicht einmal einen Moment lang im Rückstand war. Doch erklären ließ sich das nicht. Den Weirs war anzusehen, dass sie glaubten, sie wäre wahrscheinlich eine törichte, nichtsnutzige Frau, die an ihrer Armseligkeit selbst schuld war.
Doch schon bald kam alles in Ordnung. Eines Tages half sie Mrs Weir in der Molkerei, denn als Kind hatte sie das Buttern gelernt, und jetzt fiel es ihr wieder ein; und ihre geschickten Hände, die überall so flink und fähig waren wie auf der Klaviatur, bewiesen der Bäuerin, dass sie sich getäuscht hatte. Mit der Zeit mochte man sie sogar noch mehr als uns, sie schien von Tag zu Tag jünger zu werden, und sie aß mehr, und ihre Augen hatten nicht ständig diesen starren Blick.
Doch es währte nicht lange. Bald sah sie wieder kränklich aus, ihr schmeckte das Essen nicht mehr, und in den Unterrichtsstunden ging sie nachsichtiger mit uns um.
»Was, glaubst du, bereitet ihr Sorge?«, fragte Mary mich eines Tages beim Bohnenpflücken im Küchengarten. Mamma war mit Richard Quin auf dem Arm an uns vorübergegangen; zwar sagte ich es nicht, aber sie hatte mich an die neue Stute mit ihrem Fohlen erinnert, obwohl sie sich immer noch schnell und kraftvoll bewegte.
»Na ja, Papa hat nicht geschrieben«, antwortete ich.
»Ich habe auch das Gefühl, dass es daran liegt«, sagte Mary. »Aber ich begreife nicht, wie sie sich je einbilden konnte, er würde es tun.«
»Hast du denn gewusst, dass er nicht schreibt?«, fragte ich.
»Ich habe mir gedacht, dass er es wahrscheinlich vergisst.«
Es missfiel mir, dass sie besser über sein Handeln Bescheid gewusst hatte als ich.
»Ich begreife einfach nicht«, fuhr Mary fort, »dass sie sich nie aneinander zu gewöhnen scheinen. Mamma ist immer überrascht, wenn Papa Dinge tut wie etwa nicht zu schreiben. Und Papa überrascht es jedes Mal wieder, wenn Mama Rechnungen bezahlen möchte.«
»Ja, und Mamma nimmt es sich so zu Herzen«, sagte ich.
»Sehr seltsam«, sagte Mary.
Damit rührten wir an einem Thema, das uns schon lange vor ein Rätsel stellte. Wir begriffen, dass Papa regen Anteil an uns nahm und wir an ihm, immerhin gehörten wir zu einer Familie. Und wir konnten nachvollziehen, dass Mamma auf andere Weise großes Interesse an uns hegte und wir im Gegenzug an ihr. Doch wir verstanden nicht, dass Mamma und Papa einander sonderlich viel bedeuten konnten, denn sie waren ja nicht miteinander verwandt.
»Aber, Mary, ich frage mich schon die ganze Zeit: Was wird passieren, wenn Papa gar nicht schreibt?«
»Wenn er nicht zurückkommt?«
»Ja.«
»Das wäre mein Tod«, sagte Mary.
»Meiner auch«, sagte ich. Ich trat einen Schritt von den Bohnen zurück und sah in das Rund aus grünen Hügeln, die durch meine Tränen glasig miteinander verschmolzen und wankten. Doch sie waren dort, sie blieben unverrückbar, wenn ich die Tränen fortwischte. »Aber was würden wir tun?«, fragte ich.
»Ach, wir könnten arbeiten gehen, wir könnten in Fabriken oder Geschäften oder Büros anfangen, oder wir könnten Hausangestellte werden, und zusammen könnten wir genug verdienen, um Mamma und Richard Quin zu unterstützen, bis er erwachsen ist«, sagte Mary.
»Aber ich glaube doch, es gibt ein Gesetz dagegen, dass Menschen in unserem Alter arbeiten gehen«, sagte ich.
»Wir könnten schwindeln und uns für älter ausgeben, als wir tatsächlich sind«, sagte Mary. »Alle sind immer überrascht, wenn sie hören, wie alt wir sind.«
»Das stimmt auch wieder«, räumte ich ein.
»Wie dem auch sei, alles wird gut werden«, sagte Mary. »Wirklich gut. Schau mal, wir würden abends weiter Klavier üben, und eines Tages würden wir stattdessen Pianistinnen sein, und danach wäre alles in Ordnung.«
»O ja, natürlich, da mache ich mir gar keine Sorgen«, versicherte ich, »und ich glaube, wir haben jetzt genug Bohnen.«
Mamma hatte uns auf dem Weg durch den Küchengarten nicht an dem Bohnenspalier bemerkt, ansonsten hätte sie nicht traurig ausgesehen. Stattdessen hätte sie wie eine Kranke ausgesehen, die sich fotografieren ließ, um das Bild jemandem zu schicken, den sie über ihren Gesundheitszustand täuschen wollte. Sie war wieder nachdenklich und hatte diesen starren Blick, aber sie lächelte unablässig, sie rief jedem auf ihrem Weg über den Hof zur Begrüßung fröhliche Worte zu – »Wieder ein schöner Tag« oder »Nicht so sonnig, aber ein wenig Frische können wir zur Abwechslung einmal gebrauchen« –, wobei sie dieselbe Person häufig zweimal grüßte. Wir hatten ruhiges Wetter; es war ein ungewöhnlich schöner Sommer. Die Hügel um uns her lagen ruhig da; es handelte sich um den höchsten Hof auf diesem Ausläufer der Pentlands, und niemand stieg bis zu uns herauf. Die Sommerfrischler nahmen einen Wanderweg, der im Süden direkt zum Hauptkamm führte, und wir sahen sie höchstens einmal in der Ferne am Horizont. Diese Ruhe bildete einen unvorteilhaften Rahmen für die Rastlosigkeit meiner Mutter, und die Leute auf dem Hof bedachten sie wieder mit skeptischen Blicken.
Eines Nachmittags kam ich mit einer polierten Zaumplakette, die in meiner Hand funkelte, aus dem Stall und sah sie auf dem Steinwall sitzen, der die Koppel vom Garten trennte. Der Postbote wurde ungefähr in einer Viertelstunde erwartet, und sie wiegte sich vor und zurück, nicht sehr, aber mehr, als natürlich gewesen wäre, außer sie würde sich durch das Ausbleiben eines Briefs völlig im Stich gelassen fühlen. Ich blickte durch den Garten zum Bauernhaus und glaubte, hinter den Spitzengardinen im Zimmer der Weirs jemanden zu erkennen, der herüberschaute. Wahrscheinlich handelte es sich um Mrs Weir, von der ich mir ein Lob für die blitzblanke Zaumplakette erhofft hatte. Teils beschäftigte mich mein Mitleid mit Mamma, teils jedoch war ich verärgert, weil die Dinge für uns nie so einfach waren wie für andere Kinder und weil ich nicht den mir zustehenden Dank einstreichen würde. Ich konnte das Große und die Kleinigkeit gedanklich nicht voneinander trennen und fragte mich, ob ich mich deswegen schämen müsste. Ich legte die Plakette auf dem Mäuerchen ab, doch als mir einfiel, wie häufig ich Dinge verlor, nahm ich sie wieder an mich und schob sie unter eines der Gummibänder am Knie meiner langen Unterhose. Ich legte die Arme um Mammas Hals, küsste ihr zerzaustes Haar und flüsterte: »Wenn du dir Sorgen machst, weil Papa noch nicht geschrieben hat, warum telegrafierst du dann nicht an die Zeitungsredaktion in Lovegrove oder an seine Onkel und die Familie in Irland? An einem von beiden Orten muss er doch sein.«
Ihre Antwort war ein Flüstern. Wenn wir nichts hiervon laut aussprachen, fiel es uns leichter, so zu tun, als geschähe es gar nicht. »Rose, du bist ein aufmerksames Kind.«
»Willst du damit sagen«, fragte ich tapfer, »dass wir den Sixpence nicht haben?«
»O doch, den Sixpence haben wir, Gott sei Dank. Aber schau mal, keiner soll erfahren, dass Papa uns nicht Bescheid gegeben hat, wo er ist. Sie würden es merkwürdig finden.«
»Nun, das ist es ja auch«, sagte ich.
»Aber nicht«, behauptete sie hoffnungsvoll, »auf die Weise, wie sie es deuten würden. Ach, uns bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten. Und gib ihm Zeit, er wird schon schreiben. Genau heute Nachmittag trifft vielleicht ein Brief ein.«
Wir gaben uns einen Kuss. Sie nahm die Lippen von meinen und sagte, immer noch im Flüsterton: »Verrate den anderen nichts.«
Ihre Naivität erstaunte mich.
Mary trat aus dem Stall, sah mit einem Blick über den Hof, dass etwas nicht stimmte, und gesellte sich zu uns. »Mamma, warte nicht auf die Post, heute ist Dienstag, und dienstags passiert nie etwas Schönes«, sagte sie und verstummte dann. Cordelia hatte in ihrem Zimmer mit dem Üben angefangen. Zu dritt lauschten wir schweigend, während sie Tonleitern spielte. Dann brach sie ab und wiederholte ein paar Takte einer Melodie. »Es klingt schlimmer als Katzen«, sagte Mary. »Katzen miauen nicht so schrill.«
»Ach, Kinder, Kinder«, sagte Mamma. »Ihr dürft mit eurer armen Schwester nicht so unduldsam sein. Es hätte viel schlimmer sein können, sie hätte taub oder blind zur Welt kommen können.«
»Selbst für sie wäre das nicht schlimmer gewesen«, erwiderte Mary, »denn genau wie jetzt hätte sie gar nicht gemerkt, was nicht mit ihr stimmt, und sie wäre in eines dieser großen Häuser mit Garten für die Tauben und Blinden gekommen, die man vom Zug aus sieht, und es hätten sich Menschen um sie gekümmert, die gern nett zu Tauben und Blinden sind. Aber für schlechte Geigerinnen gibt es keine Heime.«
»Heime für schlechte Musiker, was für eine schreckliche Vorstellung«, sagte Mamma. »Das Heim für schlechte Altstimmen wäre das schlimmste. Die Leute hätten Angst davor, nachts in die Nähe zu gehen, denn die Geräusche von dort wären einfach furchterregend, besonders bei Vollmond. Aber ihr Kinder seid eurer Schwester gegenüber unnötig herzlos, ja wenn ich euch nicht kennen würde, würde ich euch für gehässig halten. Und so schlecht spielt sie nun auch wieder nicht. Heute Nachmittag ist sie gar nicht übel. Sie ist viel besser als früher. Du lieber Himmel, das war grässlich! Es ist unerträglich, ich muss versuchen, dem armen Kind zu helfen.«
Händeringend eilte sie den Gartenweg zum Bauernhaus hoch. Ein Fremder hätte angenommen, einer derart verzweifelten Mutter müsse eben eingefallen sein, dass ihr Baby ganz allein in einem Zimmer mit offenem Feuer oder einem gefährlichen Hund zurückgelassen worden war. Mary und ich setzten uns auf das Mäuerchen, und als wir mit den Beinen zu baumeln begannen, spürte ich auf einmal die Zaumplakette in meiner Unterhose. Und da sie in ihrem Versteck trübe angelaufen war, machte ich mich gleich noch einmal ans Polieren.
»Hör nur, es ist einfach albern«, sagte Mary kalt. Manchmal gab es gar nichts zu hören, denn Mamma konnte nicht Geige spielen und musste ihre Anweisungen daher mündlich geben oder vorsingen. Zwischen diesen Momenten der Stille wiederholte Cordelia ihre Melodie, immer ohne Verbesserung, aber stattdessen jedes Mal mit einem anders gearteten Fehler. »Was gibt es denn da zu lachen?«, fragte Mary durch zusammengebissene Zähne.
»Natürlich lache ich«, antwortete ich. »Schließlich ist es lustig, wenn jemand ständig auf dem Eis ausrutscht, und Cordelia tut sich dabei noch nicht einmal weh.«
Ich kannte Mary in- und auswendig und spürte, dass sie mit dem Gedanken spielte, mich zu übertrumpfen, indem sie sich – genau wie es die Lehrerinnen an der Schule getan hätten – zu erwachsen gab, um über jemanden zu lachen, der aufs Eis fiel. Ich aber polierte weiter meine Plakette. Ganz bestimmt würde ihr noch einfallen, dass dies nicht aufrichtig wäre, denn sie fand es sehr wohl lustig, wenn jemand auf dem Eis ausrutschte, und überhaupt wollte sie mich gar nicht übertrumpfen, jedenfalls nicht unbedingt.