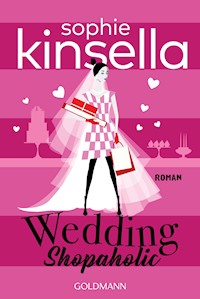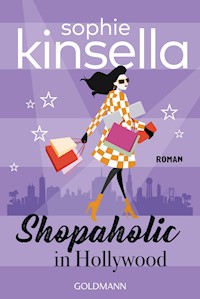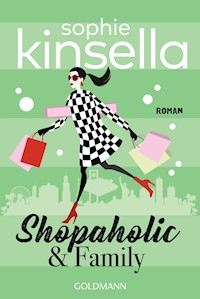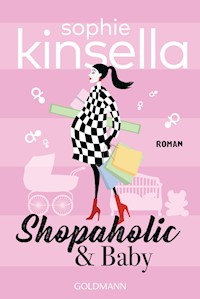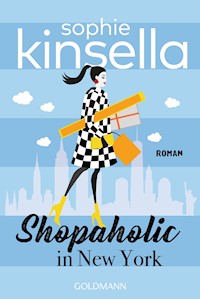9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drama, Geheimnisse und große Liebe: Willkommen auf der Familienfeier des Jahres!
Seit ihr Vater mit der unmöglichen Krista zusammen ist, spricht Effie kaum mehr ein Wort mit ihm. Als das Paar auch noch das Familienanwesen Greenoaks verkauft und zu diesem Anlass eine große Abschiedsparty schmeißt, hat Effie endgültig genug. Sie beschließt, sich auf die Feier zu schleichen, um heimlich ein paar Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit zu retten. Prompt läuft sie in Greenoaks Joe in die Arme – ihre Jugendliebe und inzwischen umschwärmter Herzchirurg. Während Effie unbemerkt von den anderen Gästen durch Greenoaks schleicht, lernt sie nicht nur Joe, sondern auch ihre Familie von einer ganz neuen Seite kennen. Und sie muss sich fragen, ob nicht jeder eine zweite Chance verdient hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Seit Effies Vater ihre geliebte Stiefmutter verlassen hat und mit der schrecklichen Krista sein neues Glück feiert, spricht Effie so gut wie kein Wort mehr mit ihm. Als das Paar auch noch beschließt, das alte Familienanwesen Greenoaks zu verkaufen, eine große Abschiedsparty für Familienmitglieder und die gesamte Nachbarschaft zu schmeißen und nur Effie nicht einzuladen, hat sie endgültig genug. Doch dann fällt ihr ein, wie viele Kindheitserinnerungen in dem Haus stecken – ihre Lieblingspuppen, zum Beispiel. Effie beschließt, sich auf die Party zu schleichen und ihre Schätze zu bergen, während alle feiern. Dummerweise hat Krista einen Türsteher engagiert, und um ins Haus zu kommen, ist Effie ausgerechnet auf die Hilfe von Joe Murran angewiesen. Joe, ihre große Jugendliebe. Joe, der inzwischen ein umschwärmter Herzchirurg ist. Und während Effie versucht, sich unbemerkt durch Greenoaks zu schleichen, hört sie überraschende Gespräche mit an und lernt die Menschen in ihrem Leben von einer ganz neuen Seite kennen. Schließlich muss sie sich fragen, ob nicht jeder eine zweite Chance verdient hat?
Weitere Informationen zu Sophie Kinsellasowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sophie Kinsella
Die Familienfeier
Roman
Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Party Crasher« bei Bantam Press, LondonDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2022
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Sophie Kinsella
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
MR · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28849-5V002www.goldmann-verlag.de
***Zum Andenken an Sharon Propson***
EINS
Ich weiß, ich krieg das hin. Ich weiß, dass ich es hinkriege. Egal, was alle anderen sagen. Es ist nur eine Frage des Durchhaltevermögens.
»Effie, lass es dir sagen: Dieser Engel wird da oben nicht halten«, sagt meine große Schwester Bean, als sie mit einem Glas Glühwein in der Hand herüberkommt, um mir zuzusehen. »Nie im Leben.«
»Doch, wird er.« Entschlossen wickle ich weiter Bindfaden um unseren geliebten Silberschmuck, ohne auf die Tannennadeln zu achten, die mir in die Hände piksen.
»Wird er nicht. Gib es auf! Er ist zu schwer!«
»Ich werde nicht aufgeben!«, entgegne ich. »Dieser Silberengel sitzt immer oben auf dem Weihnachtsbaum.«
»Aber dieser Baum ist ja nur halb so groß wie die Bäume, die wir sonst hatten«, erklärt Bean. »Ist dir das noch nicht aufgefallen? Der ist doch spindeldürr.«
Ich sehe mir den Baum kurz näher an, wie er da in seiner üblichen Nische in der Diele steht. Selbstverständlich habe ich gemerkt, dass er klein ist. Normalerweise haben wir einen eindrucksvollen, ausladenden Baum, während dieser einen eher mickrigen Eindruck macht. Aber dafür habe ich jetzt keinen Kopf.
»Es muss gehen!« Mit großer Geste binde ich meinen letzten Knoten, dann lasse ich los – woraufhin der ganze Zweig abknickt und unser Engel kopfüber hängt, sodass sich das Kleid umstülpt und sein Höschen zu sehen ist. Mist.
»Na, das sieht ja superfestlich aus«, sagt Bean prustend vor Lachen. »Wollen wir ›Frohe Weihnachten‹ auf das Höschen schreiben?«
»Na gut.« Ich binde den Engel los und trete zurück. »Am besten verstärke ich die Spitze mit einem kleinen Stock oder so.«
»Setz doch einfach irgendwas anderes auf den Baum!« Bean klingt halb amüsiert, halb genervt. »Effie, warum musst du bloß immer so stur sein?«
»Ich bin nicht stur, ich bin beharrlich.«
»Gib’s ihnen, Effie!«, mischt Dad sich ein, der mit einem Arm voller Lichterketten vorbeikommt. »Lass dich nicht unterkriegen!«
Seine Augen blitzen, seine Wangen sind leicht gerötet, und ich lächle liebevoll zurück. Dad versteht mich. Er ist einer der hartnäckigsten Menschen, die ich kenne. Er wurde in einer winzigen Wohnung in Layton-on-Sea von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, und in der Schule herrschten raue Sitten. Aber er hat durchgehalten, war auf dem College und ist dann bei einer Investment-Firma eingestiegen. Jetzt ist er, was er ist: im Ruhestand, gut situiert, zufrieden, alles super. Das erreicht man nicht, wenn man schon bei der ersten Hürde aufgibt.
Okay, seine Hartnäckigkeit kann sich manchmal auch zur irrationalen Halsstarrigkeit auswachsen. So wie damals, als er bei einem 10km-Spendenlauf partout nicht aufgeben wollte, obwohl er schon humpelte. Am Ende stellte sich heraus, dass er einen Muskelfaserriss in der Wade hatte. Hinterher meinte er nur, entscheidend sei doch, dass er das Geld gesammelt und seine Aufgabe erfüllt habe. Er würde es schon überleben. Als wir klein waren, sagte Dad immer »Du wirst es überleben!«, was manchmal aufmunternd, manchmal unterstützend und manchmal total unangemessen war. (Manchmal will man nicht hören, dass man etwas überleben wird. Man will sein blutendes Knie anstarren und heulen und jemanden freundlich sagen hören: »Ach, du Ärmste, was bist du für ein tapferes Kind!«)
Dad hatte sich offenbar schon am Glühwein bedient, bevor ich heute angekommen war – aber warum auch nicht? Es ist Weihnachten und sein Geburtstag und der Tag, an dem der Baum geschmückt wird. Es hatte bei uns schon immer Tradition, den Baum an Dads Geburtstag zu schmücken. Obwohl wir mittlerweile alle erwachsen sind, kommen wir doch immer wieder zurück nach Greenoaks, unser Elternhaus in Sussex, jedes Jahr.
Während Dad in der Küche verschwindet, trete ich näher an Bean heran und frage leise: »Wieso hat Mimi dieses Jahr so einen kleinen Baum besorgt?«
»Weiß nicht«, sagt Bean nach einer Pause. »Vielleicht ist der praktischer? Schließlich sind wir alle inzwischen erwachsen.«
»Vielleicht«, sage ich, ohne dass mich die Antwort zufriedenstellen würde. Unsere Stiefmutter Mimi hat eine künstlerische, kreative Ader und ist für ihre eigenwillige Art bekannt. Sie mochte immer gern den Baum schmücken, je größer, desto besser. Warum sollte sie plötzlich praktisch denken? Ich beschließe, nächstes Jahr mitzugehen, wenn sie den Baum kauft. Ich werde sie ganz subtil daran erinnern, dass wir auf Greenoaks schon immer einen eher großen Baum hatten und es keinen Grund gibt, mit dieser Tradition zu brechen, obwohl Bean immerhin dreiunddreißig ist und Gus einunddreißig. Ich selbst bin sechsundzwanzig.
»Endlich!«, höre ich Bean bei einem Blick auf ihr Telefon sagen.
»Was?«
»Gus. Er hat gerade das Video rübergeschickt. Endlich ist es fertig.«
Vor etwa einem Monat meinte Dad, er wollte in diesem Jahr keine Geschenke bekommen. Als hätte er die Wahl. Allerdings hat er zugegebenermaßen schon ziemlich viele Pullis und Manschettenknöpfe und so Sachen, also haben wir beschlossen, kreativ zu werden. Bean und Gus haben ein Video zusammengebastelt, dem Gus noch den letzten Schliff verpasst hat. Ich selbst habe auch ein Überraschungsprojekt und kann es kaum erwarten, es Dad zu zeigen.
»Ich könnte mir vorstellen, dass Gus ziemlich beschäftigt ist mit Romilly«, sage ich und zwinkere Bean zu, die mich angrinst.
Unser Bruder Gus hat sich vor kurzem diese atemberaubende Freundin namens Romilly geangelt. Was uns nicht überrascht, wirklich nicht, aber … na ja. Die Sache ist die: Er ist eben Gus. Immer mit den Gedanken woanders. Irgendwie nicht greifbar. Er sieht ganz gut aus, auf seine eigene Art, ist liebenswert und sehr gut in seinem Software-Job. Aber er ist nicht gerade das, was man als »Alphatier« bezeichnen würde. Wohingegen sie ein erstaunliches Energiebündel mit makelloser Frisur und schicken, ärmellosen Kleidern ist. (Ich habe sie gegoogelt.)
»Ich will mir das Video mal ansehen«, sagt Bean. »Komm doch kurz mit nach oben.« Während sie auf der Treppe vorausläuft, fügt sie hinzu: »Hast du dein Geschenk für Dad schon eingepackt?«
»Nein, noch nicht.«
»Denn ich hab extra noch ein bisschen Papier mitgebracht, für den Fall, dass du was brauchst. Und Geschenkband auch. Übrigens habe ich den Präsentkorb für Tante Ginny bestellt«, fügt sie noch hinzu. »Ich sag dir noch, was du mir schuldest.«
»Bean, du bist die Größte«, sage ich liebevoll. Was wirklich stimmt. Sie denkt immer voraus. Sie kriegt immer alles hin.
»Ach, und noch was.« Auf dem Treppenabsatz fängt Bean an, in ihrer Tasche zu kramen. »Es gab da ein Drei-für-zwei-Angebot.«
Sie reicht mir ein Vitamin-D-Spray, und ich beiße mir auf die Lippe, um nicht laut loszulachen. Bean wird noch zur Gesundheitsfanatikerin. Letztes Jahr hat sie mir ständig Lebertrankapseln mitgebracht, und davor Grüntee-Extrakt.
»Bean, du brauchst mir doch keine Vitamine zu kaufen! Aber … danke«, füge ich etwas verspätet hinzu.
In ihrem Zimmer blicke ich mich lächelnd um. Es sieht immer noch genauso aus wie früher, mit den handbemalten Möbeln, die sie schon seit ihrem fünften Lebensjahr hat – zwei weiße Holzbetten, eine Kommode, ein Schrank und ein Frisiertisch, allesamt mit Peter Rabbit verziert. Als Teenager wollte sie das Zimmer etwas cooler gestalten, brachte es aber nie übers Herz, sich davon zu trennen, also sind die Kindermöbel immer noch da. Ich verbinde dieses Zimmer so sehr mit ihr, dass ich unweigerlich »Bean« denke, wenn mir irgendwo Peter Rabbit über den Weg läuft.
»Hast du Dominic für heute auch eingeladen?«, fragt Bean, während sie ihr iPad aufklappt, und mir wird ganz warm ums Herz, als ich seinen Namen höre.
»Nein, es ist noch etwas zu früh, um ihn der Familie ›vorzustellen‹. Wir haben uns ja erst ein paar Mal getroffen.«
»Und war das gut?«
»Ja, das war gut.« Ich lächle glücklich.
»Ausgezeichnet. Okay, los geht’s.« Sie stellt ihr iPad auf den Frisiertisch, und gemeinsam sehen wir uns eine pompöse Titelsequenz an, die da lautet Der unvergleichliche, unverwechselbare … Tony Talbot! Als Nächstes erscheint ein Foto von Dad aus der Lokalzeitung von Layton-on-Sea, als er mit elf Jahren einen Mathe-Preis gewonnen hat. Dann kommt ein Bild vom Schulabschluss, gefolgt von einem Hochzeitsfoto mit unserer leiblichen Mutter Alison.
Ich betrachte ihr hübsches Gesicht mit den großen Augen und empfinde diese seltsame Unverbundenheit, wie immer, wenn ich sie auf Bildern sehe, wobei ich wünschte, ich könnte mich ihr verbundener fühlen. Ich war erst acht Monate alt, als sie starb, und drei Jahre, als Dad Mimi geheiratet hat. Ich erinnere mich daran, wie Mimi mir vorgesungen hat, wenn ich krank war, wie sie in der Küche Kuchen gebacken hat, wie sie immer für mich da war. Mimi ist meine Mum. Für Bean und Gus ist es was anderes – sie können sich noch an Alison erinnern. Ich dagegen sehe ihr nur ähnlich – das allerdings sehr. Wir kommen alle nach ihr, mit unseren breiten Gesichtern, den ausgeprägten Wangenknochen und weit auseinanderstehenden Augen. Ich wirke immer irgendwie erstaunt, und Beans große blaue Augen haben so einen fragenden Ausdruck. Gus dagegen wirkt normalerweise eher abwesend, als würde er nicht zuhören (was daran liegt, dass er es nie tut).
Auf dem Bildschirm flackern alte, selbstgedrehte Videos, und ich beuge mich vor. Da ist Dad mit der kleinen Bean auf dem Arm … ein Familienpicknick … Dad baut eine Sandburg für den kleinen Gus … dann ein Video, das ich schon mal gesehen habe: Dad geht auf die Tür von Greenoaks zu und öffnet sie mit großer Geste an dem Tag, an dem das Haus in unseren Besitz überging. Er hat oft gesagt, es sei einer der größten Momente seines Lebens gewesen, ein solches Haus zu kaufen. »Der Bengel aus Layton-on-Sea hat es geschafft«, wie er immer zu sagen pflegt.
Weil Greenoaks nicht irgendein altes Haus ist. Es ist einzigartig. Es hat Charakter. Es hat sogar einen Turm! Und ein Buntglasfenster. Besucher bezeichnen es oft als »exzentrisch« oder »schrullig«, oder sie staunen einfach nur: »Wow!«
Und, okay, ja, es mag einige wenige fehlgeleitete Menschen geben, die es »hässlich« nennen. Aber die sind blind und haben keine Ahnung. Als ich zum ersten Mal mitbekam, wie jemand Greenoaks als »Monstrosität« bezeichnete – eine fremde Frau im Dorfladen –, war ich zutiefst erschüttert. Mein elfjähriges Herz brannte vor Empörung. Ich war noch nie einer Architekturbanausin begegnet. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gab. Und ich liebte leidenschaftlich alles an meinem Zuhause. Alles, worüber sich diese bösartige Unbekannte mokierte. Vom angeblich »hässlichen Mauerwerk« – es ist nicht hässlich – bis hin zum Hügel. Der Hügel ist eine steile Anhöhe im Garten, gleich neben dem Haus. Auch darüber lachte die Frau, und am liebsten hätte ich gerufen: »Wenn sie wüssten! Der ist toll für Lagerfeuer«
Stattdessen stolzierte ich aus dem Laden und warf Mrs McAdam, der Besitzerin, einen bösen Blick zu. Man muss ihr wohl zugutehalten, dass sie etwas schockiert wirkte und rief: »Effie, Liebes, wolltest du etwas kaufen?« Aber ich wandte mich nicht um, und bis heute weiß ich nicht, wer diese spöttische Fremde war.
Seitdem beobachte ich die Reaktionen der Menschen auf Greenoaks ganz genau. Ich habe schon erlebt, wie sie zurückweichen und schlucken müssen, während sie das Haus betrachten und nach etwas Positivem suchen, was sie anmerken könnten. Ich sage nicht, dass es ein Charaktertest ist, aber … es ist ein Charaktertest. Wer keine einzige freundliche Bemerkung über Greenoaks machen kann, ist ein mieser Snob und für mich gestorben.
»Effie, guck mal, da bist du!«, ruft Bean, als ein neues Video auf dem Bildschirm beginnt, und ich betrachte mein Kinder-Ich, wie es über den Rasen wankt und sich an der Hand der achtjährigen Bean festhält. »Ist nicht so schlimm, Effie«, sagt sie fröhlich, als ich hinfalle. »Versuch’s nochmal!« Mimi erzählt immer allen, dass Bean mir das Laufen beigebracht hat. Und das Radfahren. Und das Haareflechten.
Mir fällt auf, dass wir das düstere Jahr von Alisons Tod übersprungen haben. Dieses Video zeigt nur die guten Zeiten. Warum auch nicht? Dad muss nicht daran erinnert werden. Er hat mit Mimi sein Glück gefunden und führt ein zufriedenes Leben.
Es klingelt an der Tür, was Bean gar nicht beachtet, aber ich blicke auf, hoffnungsvoll. Ich erwarte ein Paket mit Mimis Weihnachtsgeschenk. Ich habe extra vereinbart, dass es heute geliefert wird, und möchte nicht, dass Mimi es versehentlich auspackt.
»Bean«, sage ich und halte das Video an. »Kommst du mit runter zum Tor? Ich glaube, Mimis Nähmaschinenschrank ist da, und ich möchte ihn möglichst unbemerkt reinholen. Aber er ist ziemlich groß.«
»Na klar«, sagt Bean und stellt das iPad aus. »Und wie findest du es jetzt?«
»Toll!«, rufe ich entzückt. »Dad wird begeistert sein.«
Als wir die Treppe hinunterhasten, ist Mimi gerade dabei, Ziergrün durchs Geländer zu fädeln. Sie blickt auf und lächelt uns an, wirkt allerdings ein wenig mitgenommen. Vielleicht bräuchte sie mal Urlaub.
»Ich geh schon«, sage ich eilig. »Ist bestimmt die Post.«
»Danke, Effie, Liebes«, sagt Mimi mit ihrem weichen, irischen Tonfall. Sie trägt ein langes, farbenfrohes Kleid, und ihre Haare werden von einer handbemalten Holzklammer zusammengehalten. Ich sehe gerade noch, wie sie ein rotes Samtband zu einer Schleife knotet, und wie bei ihr nicht anders zu erwarten, hält ihre Konstruktion. War ja klar.
Als Bean und ich über den Kiesweg zu den großen Eisentoren knirschen, herrscht bereits so eine winterliche Abendstimmung, obwohl noch Nachmittag ist. Draußen steht ein weißer Lieferwagen, und ein Mann mit kahlem Kopf hält einen Pappkarton in den Händen.
»Das kann es nicht sein«, sage ich. »Zu klein.«
»Lieferung für das alte Pfarrhaus«, sagt der Mann, als wir das Gartentor aufmachen. »Da ist keiner. Würden Sie es annehmen?«
»Klar«, sagt Bean und greift danach, und sie will schon auf seinem Gerät unterschreiben, da packe ich ihre Hand und halte sie zurück.
»Moment! Nicht einfach so unterschreiben! Ich habe für meine Nachbarn mal ein Paket mit einer gläsernen Vase angenommen, die beschädigt war, und dann konnten sie keine Entschädigung bekommen, weil ich dafür unterschrieben hatte. Am Ende haben sie mir die Schuld gegeben.« Atemlos stocke ich. »Wir müssen erst sichergehen.«
»Mit diesem Paket ist alles in Ordnung«, sagt der Mann ungeduldig, und ich merke, wie sich mir die Nackenhaare aufstellen.
»Das wissen Sie doch gar nicht.« Ich reiße den Deckel auf und hole den Lieferschein hervor. »Yogaskulptur«, lese ich. »Montage inbegriffen.« Ich blicke auf, fühle mich bestätigt. »Sehen Sie? Es ist nicht alles in Ordnung! Sie sollen es zusammenbauen.«
»Ich werde hier überhaupt nichts zusammenbauen«, sagt der Mann und zieht eklig die Nase hoch.
»Sie müssen«, erkläre ich. »So steht es auf dem Lieferschein. Montage inbegriffen.«
»Ja, klar.«
»Bauen Sie es zusammen!«, beharre ich. »Erst dann werden wir dafür unterschreiben.«
Einen Moment lang betrachtet mich der Mann mit finsterem Blick, wischt sich über den kahlen Kopf, dann sagt er: »Sie sind ne echte Nervensäge. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt?«
»Ja«, entgegne ich und verschränke meine Arme. »Jeder.«
»Es stimmt.« Bean nickt grinsend. »Sie sollten das Ding besser zusammenbauen. Was ist überhaupt eine Yogaskulptur?«, fügt sie an mich gewandt hinzu, und ich zucke mit den Achseln.
»Ich hol mein Werkzeug«, sagt der Mann, der uns inzwischen beide mit finsterem Blick mustert. »Auch wenn das eigentlich Schwachsinn ist.«
»Man nennt es Nachbarschaftshilfe«, entgegne ich.
Kurz darauf kommt er mit seinem Werkzeug zurück, und wir sehen ihm neugierig dabei zu, wie er widerwillig Metallteile zusammenschraubt zu einem … Was genau ist das? Es soll wohl irgendwie einen Menschen darstellen … nein, zwei Menschen, männlich und weiblich, und offenbar steckt man sie zusammen … was machen die da?
Augenblick mal.
O mein Gott. Mir will sich der Magen umdrehen, und ich sehe Bean an, der es offenbar die Sprache verschlagen hat. Bedeutet Yogaskulptur eigentlich Schlüpfrige Sexfigur?
Okaaaaay. Ja, tut es.
Und offen gesagt, bin ich schockiert! Andrew und Jane Martin tragen wattierte Westen im Partnerlook. Sie stellen ihre Dahlien auf dem Sommerfest aus. Wie können sie das hier bestellt haben?
»Soll seine Hand nach ihrer Titte greifen oder nach dem Arsch?«, erkundigt sich der Mann und blickt auf. »Das steht nicht in der Anleitung.«
»Ich … ich bin mir nicht sicher«, presse ich hervor.
»O mein Gott.« Langsam kommt wieder Leben in Bean, als der Mann das letzte noch fehlende, unverkennbar männliche Körperteil aus dem Karton holt. »Nein! Nicht weiter! Könnten Sie bitte kurz warten?«, fügt sie schrill hinzu. Dann wendet sie sich an mich und sagt etwas aufgebracht: »Wir können das unmöglich rüber zu den Martins bringen. Ich könnte den beiden nie wieder in die Augen blicken!«
»Ich auch nicht!«
»Wir haben das nicht gesehen. Okay, Effie? Wir haben es nicht gesehen.«
»Abgemacht«, sage ich mit Nachdruck. »Hm, entschuldigen Sie?« Ich wende mich wieder dem Mann zu. »Kleine Planänderung. Meinen Sie, Sie können das Ding wieder auseinanderbauen und im Karton verstauen?«
»Das soll ja wohl ein Witz sein«, sagt der Mann fassungslos.
»Tut mir leid«, sage ich betreten. »Wir wussten ja nicht, was es ist.«
»Vielen Dank für Ihre Mühe«, fügt Bean eilig hinzu. »Und frohe Weihnachten!« Sie langt in ihre Jeanstasche und findet einen zerknüllten Zehner, was den Paketboten etwas beschwichtigt.
»Was für ein Heckmeck«, flucht er, während er die Teile forsch wieder auseinanderschraubt. »Entscheiden Sie sich endlich mal.« Missbilligend betrachtet er die nackte, weibliche Figur. »Wenn man mich fragt, wird die Kleine wohl Knieprobleme kriegen, wenn sie das länger macht. Sie könnte ein paar Kissen brauchen. Das geht doch auf die Gelenke.«
Ich sehe zu Bean hin und wieder weg.
»Gute Idee«, presse ich hervor.
»Da kann man gar nicht vorsichtig genug sein«, fügt Bean hinzu, mit so einem leichten Beben in der Stimme.
Der Mann verstaut das letzte metallene Körperteil im Karton, und Bean unterschreibt auf dem elektronischen Lesegerät. Als er wieder in seinen Wagen steigt, sehen wir uns an.
»Knieprobleme«, prustet Bean heraus.
»Die Martins!«, stimme ich leicht hysterisch mit ein. »O Gott, Bean, wie sollen wir jemals wieder mit den beiden reden?«
Als der Lieferwagen schließlich wegfährt, brechen wir in schallendes Gelächter aus.
»Ich kleb den Karton wieder zu«, sagt Bean. »Die werden gar nicht merken, dass wir ihn aufgemacht haben.«
Eben beugt sie sich herab, um das Paket anzuheben, als ich in einiger Entfernung auf der Dorfstraße etwas wahrnehme: Da kommt jemand auf uns zu. Ein Jemand, den ich überall wiedererkennen würde, von den dunklen Haaren über das energische Kinn bis hin zu seinen langbeinigen Schritten. Joe Murran. Und sein bloßer Anblick bringt mit sich, dass meine Hysterie dahinschmilzt. Augenblicklich. Als wäre nie etwas gewesen.
»Was ist?«, sagt Bean, als sie meinen Gesichtsausdruck sieht, und sie wendet sich um. »Oh. Oh.«
Während er immer näher kommt, krampft sich mir das Herz zusammen. Als würde es von einer Python gewürgt. Ich glaube, ich krieg keine Luft mehr. Kann ich noch atmen? Ach, hör schon auf, Effie. Sei nicht albern. Selbstverständlich kannst du atmen. Komm schon. Ich werde ja wohl meinem Ex-Freund in die Augen sehen können, ohne gleich tot umzufallen.
»Bist du sicher?«, murmelt Bean.
»Natürlich!«, sage ich eilig.
»Aha.« Sie klingt nicht sonderlich überzeugt. »Na dann. Weißt du was? … Ich bring diesen Karton rein, dann könnt ihr zwei … ein bisschen plaudern.«
Während sie auf die Haustür zugeht, trete ich einen Schritt zurück, sodass ich auf dem Kies der Auffahrt stehe. Auf heimischem Territorium. Ich habe das Gefühl, als bräuchte ich Rückendeckung, von meinem Zuhause, von Greenoaks, der Liebe meiner Familie.
»Oh, hi«, sagt Joe, als er an mich herantritt, mit undurchschaubarem Blick. »Wie geht es dir?«
»Gut.« Lässig zucke ich mit den Schultern. »Und dir?«
»Gut.«
Joes Blick wandert zu meinem Hals, und instinktiv berühre ich meine Perlenkette – dann verfluche ich mich. Ich hätte nicht reagieren dürfen. Ich hätte einfach so tun sollen, als wäre nichts. Was? Wie? Ich habe früher mal etwas um den Hals getragen, das eine gewisse Bedeutung für uns beide hatte? Verzeih, dass ich mich an Details nicht mehr so ganz erinnern kann.
»Hübsche Kette«, sagt er.
»Ja, die habe ich von Bean«, sage ich nonchalant. »Von daher ist sie was ganz Besonderes. Du weißt schon. Sie bedeutet mir was. Ich liebe sie sehr und lege sie niemals ab.«
Vermutlich hätte ich bei »Die habe ich von Bean« aufhören können. Aber meine Botschaft ist angekommen. Das sehe ich Joe an.
»Arbeit läuft gut?«, fragt er höflich, wenn auch etwas steif.
»Ja, danke.« Auch ich bleibe höflich. »Ich habe die Branche gewechselt. Inzwischen betreue ich vor allem Firmen-Events.«
»Super.«
»Und du? Willst du immer noch Herzchirurg werden?«
Ich tue so, als wäre ich mir nicht ganz sicher, in welchem Stadium seiner medizinischen Laufbahn er sich gerade befindet. Als hätte ich nicht bis nachts um zwei für sein Studium mit ihm gelernt.
»Das ist der Plan.« Er nickt. »Bin auf dem besten Weg dahin.«
»Super.«
Wir schweigen einen Moment. Wie üblich runzelt Joe angestrengt die Stirn.
»Was ist mit …«, setzt er schließlich an. »Bist du … mit jemandem zusammen?«
Seine Worte sind wie Salz in einer offenen Wunde. Was geht es ihn an? Warum sollte er sich dafür interessieren? Du hast dich nicht nach meinem Liebesleben zu erkundigen, Joe Murran, möchte ich aufgebracht erwidern. Aber damit würde ich mich nur verraten. Außerdem habe ich etwas, mit dem ich angeben kann.
»Ja, ich bin allerdings mit jemandem zusammen«, sage ich und setze meine verträumteste Miene auf. »Er ist wirklich toll. So toll. Gutaussehend, erfolgreich, liebevoll. Verlässlich …«, füge ich noch hinzu.
»Doch nicht Humph«, sagt Joe vorsichtig, und ich spüre einen leisen Anflug von Ärger. Warum muss er unbedingt von Humph anfangen? Ich war drei Wochen lang mit Humphrey Pelham-Taylor zusammen, um mich an Joe zu rächen, und ja, es war kindisch und ja, ich bereue es. Aber glaubt er denn wirklich, dass aus Humph und mir was werden könnte?
»Nein, nicht Humph«, sage ich übertrieben geduldig. »Er heißt Dominic. Er ist Ingenieur. Wir haben uns im Internet kennengelernt, und wir verstehen uns wunderbar. Wir passen so gut zusammen. Weißt du? Wenn es einfach so von selbst läuft?«
»Super«, sagt Joe nach längerer Pause. »Das ist … Ich freue mich.«
Er sieht nicht so aus, als würde er sich freuen. Tatsächlich guckt er etwas gequält. Aber das ist nicht mein Problem, sage ich mir. Und wahrscheinlich guckt er auch gar nicht gequält. Ich habe mal geglaubt, ich würde Joe Murran kennen, aber das war offenbar ein Irrtum.
»Bist du denn mit jemandem zusammen?«, frage ich höflich.
»Nein«, sagt Joe sofort. »Ich bin … Nein.«
Wieder macht sich Schweigen breit, wobei Joe den Kopf einzieht und die Hände in den Jackentaschen vergräbt.
Dieses Gespräch will nicht so recht in Gang kommen. Ich atme die kalte Winterluft tief ein und merke, wie mich Trauer überkommt. An diesem grauenhaften Abend vor zweieinhalb Jahren habe ich nicht nur die Liebe meines Lebens verloren. Ich habe auch den Freund verloren, mit dem ich schon als Fünfjährige gespielt habe. Joe ist auch hier groß geworden. Seine Mum leitet immer noch die Dorfschule. Erst waren wir Spielkameraden. Als Teenager dann ein Paar. Und als Studenten fingen wir an, unser gemeinsames Leben zu planen.
Aber jetzt sind wir … was? Kaum noch in der Lage, einander in die Augen zu blicken.
»Na gut«, sagt Joe schließlich. »Frohe Weihnachten.«
»Dir auch. Frohe Weihnachten.«
Ich sehe ihm hinterher, als er geht, dann wende ich mich um und trotte über die Auffahrt zurück zum Haus, wo Bean schon in der Tür auf mich wartet.
»Alles okay, Effie?«, fragt sie besorgt. »Immer wenn du Joe triffst, bist du so … durch den Wind.«
»Mir geht’s gut«, sage ich. »Lass uns reingehen.«
Ich habe Bean nie von diesem Abend erzählt. Manches ist einfach zu schmerzhaft, um es jemandem anzuvertrauen. Ehrlich gesagt, versuche ich, möglichst nicht daran zu denken. Punktum.
Ich nehme mir vor, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Auf das Gute. Das Baumschmücken. Die Tatsache, dass Weihnachten vor der Tür steht. Dass die ganze Familie auf Greenoaks versammelt ist.
Als ich Bean ins Haus folge und die Tür hinter mir gegen die Kälte schließe, ist mir schon leichter ums Herz. Jedes Jahr freue ich mich auf diesen Tag, und ich lasse ihn mir nicht verderben. Schon gar nicht von Joe Murran.
Eine Stunde später bin ich sogar noch besserer Dinge, was möglicherweise mit den zwei Gläsern Glühwein zu tun hat, die ich mir genehmigt habe. Wir haben den Weihnachtsbaum fertig geschmückt und uns in der Küche versammelt, um uns auf dem iPad das Video anzusehen, das Bean und Gus für Dad gemacht haben. Ich habe mich auf dem alten Korbstuhl in der Ecke eingerollt, mit einem zufriedenen Glimmer, sehe mich selbst im Alter von vier Jahren, in einem geblümten Kittelkleid, das Mimi genäht hat. Auf dem Bildschirm ist Sommer, und ich sitze auf einer Decke auf dem Rasen, packe meine russischen Matrjoschka-Püppchen aus und führe Dad jede davon einzeln vor.
Jetzt werfe ich einen Blick zu Dad auf seinem Sessel hinüber, möchte wissen, ob er sich amüsiert. Lächelnd trinkt er mir mit seinem Glühwein zu. Das ist eine typische, charmante Dad-Geste. Meine beste Freundin Temi findet, mein Dad hätte Schauspieler werden sollen, und ich weiß, was sie meint. Er hat das Aussehen und die Ausstrahlung dafür. Die Menschen fühlen sich zu ihm hingezogen.
»Als kleines Mädchen warst du wirklich zu und zu süß, Ephelant«, sagt Bean liebevoll. Alle in meiner Familie nennen mich »Ephelant«, wenn sie mich nicht Effie nennen – es war mein Babywort für »Elefant«. Niemand nennt mich bei meinem richtigen Namen Euphemia (Gott sei Dank), aber es nennt auch niemand Bean »Beatrice« oder Gus »Augustus«.
»Ja, schade, dass aus dir geworden ist, was aus dir geworden ist«, fügt Gus hinzu, und ich entgegne etwas gedankenverloren »Ha, ha«, ohne mich vom Bildschirm abzuwenden. Ich bin ganz fasziniert vom Anblick meiner makellosen Matrjoschkas, nigelnagelneu aus der Schachtel. Ich habe sie immer noch – fünf ineinandersteckende, handbemalte Holzpüppchen, mit glänzenden Augen, rosigen Wangen und heiterem Lächeln. Mittlerweile sind sie angeschlagen und voller Filzstiftflecken, aber sie sind das kostbarste Andenken, das ich an meine Kindheit besitze.
Andere Kinder hatten einen Teddy, ich hatte meine Püppchen. Oft nahm ich sie auseinander, reihte sie vor mir auf, ließ sie »Gespräche« führen und unterhielt mich mit ihnen. Manchmal verkörperten sie unsere Familie: zwei Eltern und drei kleinere Kinder, wobei ich die winzigste Puppe von allen war. Manchmal stellte ich sie mir als unterschiedliche Versionen meiner selbst vor. Oder aber ich gab ihnen die Namen von Freunden aus der Schule und spielte die Streitigkeiten des Tages nach. Öfter noch aber waren sie so etwas wie meine Sorgenperlen. Ohne groß hinzusehen, nahm ich sie auseinander und steckte sie wieder zusammen, tröstete mich mit dem vertrauten Ritual. Das mache ich heute noch so. Nach wie vor stehen sie neben meinem Bett, und ich nehme sie mir, wenn ich gestresst bin.
»Guck mal, dein Kleid!«, sagt Bean gerade mit Blick auf den Bildschirm. »So eins möchte ich auch!«
»Du könntest dir eins nähen«, sagt Mimi. »Das Muster habe ich noch. Es gab da auch eine Version für Erwachsene.«
»Ach, ja?« Beans Augen leuchten. »Das nähe ich mir auf jeden Fall!«
Und wieder staune ich darüber, wie Bean sich von Mimis Kreativität hat anstecken lassen. Beide nähen und stricken und backen für ihr Leben gern. Sie können jedem Raum eine heimelige Atmosphäre verleihen, mit einem Samtkissen hier und einem Teller Haferkekse dort. Bean arbeitet im Marketing, von zu Hause aus, und selbst ihr Arbeitszimmer ist hübsch, voll hängender Pflanzen und Kunstplakaten an den Wänden.
Ich kaufe Kissen und Haferkekse. Ich habe es sogar mal mit einer Hängepflanze versucht. Aber es sieht nie genauso aus. Ich habe einfach kein Händchen dafür. Meine Talente liegen auf anderem Gebiet. Zumindest glaube ich das. (Braucht man Talent, um eine Nervensäge zu sein? Denn das kann ich offenbar am besten.)
Unsere Küche ist ein anschauliches Beispiel für Mimis Kreativität, denke ich, während ich mich liebevoll umsehe. Dieser Raum ist nicht nur eine Küche, er ist eine Institution. Ein Kunstwerk. Im Laufe der Jahre verwandelte sich jeder einzelne Schrank mit Hilfe von Filzstiften in einen Teil eines dichten Waldes. Es fing an mit einer kleinen Maus, die Mimi gezeichnet hatte, um mich aufzuheitern, als ich mir mal das Knie aufgeschlagen hatte, so mit drei etwa. Sie hat die Maus in die Ecke von einem Schrank gemalt, mir zugezwinkert und gesagt: »Kein Wort zu Daddy.« Fasziniert habe ich die Maus betrachtet, konnte nicht glauben, dass sie etwas derart Wundervolles gezeichnet hatte, und noch dazu auf dem Schrank.
Eine Woche später war Gus wegen irgendwas außer sich, und sie hat ihm einen lustigen Frosch gezeichnet. Und so fügte sie im Laufe der Jahre eine Zeichnung nach der anderen hinzu und schuf detaillierte Waldszenen. Bäume markierten Geburtstage, Tiere das Weihnachtsfest. Wir durften auch selbst etwas beitragen. Stolz malten wir drauflos, kamen uns bedeutend vor. Ein Schmetterling … ein Wurm … eine Wolke.
Inzwischen sind die Schranktüren mehr oder weniger voll, und doch bringt Mimi hin und wieder etwas Neues unter. Unsere Küche ist im ganzen Dorf berühmt und das Erste, was unsere Freunde sehen wollen, wenn sie zu Besuch kommen.
»So eine Küche hat sonst keiner!«, rief Temi, als sie zum ersten Mal bei uns war, im Alter von elf Jahren, und platzend vor Stolz entgegnete ich: »Es hat auch niemand sonst eine Mimi!«
Auf dem iPad ist nun eine Fotomontage von Dad auf diversen Festen zu sehen, die wir im Laufe der Jahre gefeiert haben, und mir wird ganz nostalgisch zumute, wenn ich ihn als Weihnachtsmann verkleidet sehe, als ich acht war … Dad und Mimi mit schwarzer Krawatte, wie sie auf Beans achtzehntem Geburtstag tanzen … so viele glückliche Familienfeiern.
Happy Birthday, Tony Talbot! erscheint als letztes Bild, und alle applaudieren überschwänglich.
»Also wirklich! Kinder!« Gerührt blickt Dad sich in der Küche um. Er kann manchmal etwas sentimental werden, und ich sehe, dass seine Augen ganz feucht sind. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Bean, Gus, Effie … Vielen Dank.«
»Es ist nicht von mir«, sage ich eilig. »Das waren Bean und Gus. Ich habe dir … das hier gemacht.«
Mit einem Mal werde ich ganz schüchtern, als ich ihm mein Geschenk überreiche, in Beans Papier gewickelt. Ich halte die Luft an, während er das großformatige Buch auswickelt und den Titel vorliest.
»Ein Bengel aus Layton-on-Sea.« Er wirft mir einen fragenden Blick zu, dann fängt er an zu blättern. »Ach … du meine Güte.«
Es ist so etwas wie ein Sammelalbum, das ich über Layton-on-Sea zusammengestellt habe, mit alten Fotos aus Dads Kindertagen, Postkarten, Straßenkarten und Zeitungsausschnitten. Ich war völlig in das Thema vertieft, während ich daran gebastelt habe – wahrscheinlich könnte ich inzwischen ein Referat über Layton-on-Sea halten.
»Die Spielhallen auf dem Pier!«, ruft Dad, als er umblättert. »Das Rose & Crown! St. Christopher’s School … Da werden Erinnerungen wach …«
Schließlich blickt er auf. Man sieht ihm an, wie sehr es ihn bewegt. »Effie, mein Schatz, das ist wundervoll. Ich bin richtig gerührt.«
»Es ist nicht künstlerisch oder irgendwas«, sage ich, als mir plötzlich bewusst wird, dass ich die Ausschnitte allesamt nur eingeklebt habe und Bean vermutlich irgendwas Superkreatives damit gemacht hätte. Doch Mimi legt mir eine Hand auf den Arm.
»Mach dich nicht kleiner, als du bist, Effie, Schätzchen. Es ist künstlerisch. Ein Kunstwerk. Voller Geschichte. Voller Liebe.«
Überrascht merke ich, dass auch ihre Augen glänzen. An Dads Sentimentalität bin ich ja gewöhnt, aber Mimi hat nicht wirklich nah am Wasser gebaut. Heute ist sie allerdings definitiv sanfter als sonst. Ich sehe, wie sie ihren Glühwein mit zitternder Hand nimmt und Dad ansieht, der ihr einen vielsagenden Blick zuwirft.
Okay, da ist was komisch. Irgendwas ist im Busch. Das merke ich erst jetzt. Aber was?
Und da wird es mir mit einem Mal klar. Die beiden planen irgendwas. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Dad und Mimi gehörten schon immer zu der Sorte Eltern, die sich im Stillen absprechen und dann vorformulierte Erklärungen von sich geben, ohne vorher irgendwelche Andeutungen zu machen. Sie haben einen Plan, und sie werden ihn uns unterbreiten, und das geht offensichtlich beiden nahe. Was mag es sein? Sie werden doch wohl kein Kind adoptieren wollen, oder?, denke ich mit einem Mal. Nein. Bestimmt nicht. Aber was dann? Ich sehe, wie Dad das Buch zuklappt und dann Mimi ansieht, bevor er das Wort erhebt.
»Also. Ihr alle. Wir haben uns … Er räuspert sich. »Wir haben eine Neuigkeit.«
Ich wusste es!
Ich nehme einen Schluck Glühwein und sitze erwartungsvoll da, während Gus sein Handy weglegt und aufblickt. Es folgt langes, eher betretenes Schweigen, und ich sehe Mimi an. Sie hat die Hände so fest gefaltet, dass ihre Knöchel weiß hervortreten, und zum ersten Mal ergreift mich eine gewisse Unruhe. Was ist hier los?
Eine Nanosekunde später kommt mir der naheliegendste, entsetzlichste Gedanke.
»Ihr seid doch hoffentlich gesund, oder?«, platze ich panisch heraus, sehe schon Wartezimmer und Infusionsschläuche und freundliche Ärzte mit schlechten Nachrichten vor mir.
»Ja!«, sagt Dad sofort. »Schätzchen, bitte mach dir keine Sorgen. Es geht uns beiden gut. Wir sind kerngesund. Das … ist es nicht.«
Verwundert betrachte ich meine Geschwister, die reglos dasitzen. Bean guckt besorgt, und Gus starrt stirnrunzelnd seine Knie an.
»Wie dem auch sei.« Dad schnauft. »Wir müssen euch mitteilen, dass wir … einen Entschluss gefasst haben.«
ZWEI
Achtzehn Monate später
Ich hatte genau dreimal in meinem Leben eine außerkörperliche Erfahrung.
Das erste Mal war, als meine Eltern uns damit schockierten, dass sie sich scheiden lassen würden, aus heiterem Himmel und – soweit ich es beurteilen kann – ohne guten Grund.
Das zweite Mal war, als Dad verkündete, er habe eine neue Freundin namens Krista, eine Verkaufsleiterin für Sportbekleidung, die er in einer Bar kennengelernt hatte.
Das dritte Mal passiert gerade jetzt.
»Hast du mich gehört?« Beans sorgenvolle Stimme klingt mir im Ohr. »Effie? Sie haben Greenoaks verkauft.«
»Ja«, sage ich mit krächzender Stimme. »Ich hab dich gehört.«
Mir ist, als würde ich hoch oben in der Luft schweben und auf mich herabschauen. Da stehe ich an die Außenmauer von 4 Great Grosvenor Place in Mayfair gelehnt, in meiner Kellnerinnenuniform, mein Kopf abgewandt vom grellen Sonnenlicht, die Augen geschlossen.
Verkauft. Verkauft. Greenoaks. Gehört jetzt Fremden.
Es war ein Jahr lang auf dem Markt. Fast hatte ich schon gehofft, es würde für immer auf dem Markt sein. Unverkäuflich.
»Effie. Ephelant? Alles okay?«
Beans Stimme dringt in meine Gedanken, und abrupt kehre ich in die Wirklichkeit zurück. Ich bin wieder in meinem eigenen Körper. Stehe auf dem Bürgersteig, wo ich eigentlich besser nicht sein sollte. Salsa Verde Catering sieht es nicht gern, wenn das kellnernde Personal Telefonpausen einlegt. Oder Klopausen. Oder überhaupt irgendwelche Pausen.
»Ja. Klar! Natürlich ist alles okay.« Ich richte mich auf und atme scharf aus. »Gott im Himmel! Es ist nur ein Haus. Das ist doch keine große Sache.«
»Na ja, irgendwie schon. Wir sind dort aufgewachsen. Es wäre verständlich, wenn du aufgebracht wärst.«
Aufgebracht? Wer sagt, dass ich aufgebracht bin?
»Bean, dafür habe ich keine Zeit«, sage ich forsch. »Ich bin hier bei der Arbeit. Das Haus ist verkauft. Was soll’s? Sie können ja machen, was sie wollen. Bestimmt hat Krista sich schon eine Luxusvilla in Portugal ausgesucht. Vermutlich mit eingebautem Schmuckschrank für die vielen Anhänger von ihrem Bettelarmband. Entschuldige, wie nennt sie die Dinger noch immer? Ihren Klimperkram.«
Ich spüre regelrecht, wie Bean zusammenzuckt. Wir beide sind bei vielen Themen unterschiedlicher Meinung, von Balconette-BHs bis zu Custard – vor allem aber beim Thema Krista. Bean ist einfach viel zu nett. Sie hätte Diplomatin werden sollen. Sie sieht das Gute in Krista. Wohingegen ich nur Krista sehe.
Sofort habe ich Dads Freundin vor meinem inneren Auge: blonde Haare, weiße Zähne, Bräunungscreme, nerviger Dackel. Als ich ihr zum ersten Mal begegnet bin, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Sie war so jung. So … anders. Ich war ohnehin schon baff, dass Dad eine Freundin hatte. Und dann lernten wir sie kennen.
Ich habe versucht, sie zu mögen. Oder zumindest höflich zu sein. Ich habe es wirklich ehrlich versucht. Aber es ist unmöglich. Also bin ich irgendwie … ins Gegenteil umgeschlagen.
»Hast du sie heute bei Instagram gesehen?« Ich kann nicht anders, als Salz in die Wunde zu streuen, und Bean seufzt.
»Du weißt doch, ich guck mir das nicht an.«
»Solltest du aber!«, sage ich. »Es ist ein echt tolles Foto von Dad und Krista in der Badewanne, mit Sektflöten in der Hand, Hashtag sexindensechzigern. Ist das nicht nett? Denn selbstverständlich hatte ich schon überlegt, ob Dad wohl noch Sex hat, und jetzt weiß ich es. Das ist also gut. Da eine Bestätigung zu bekommen. Aber ist Krista nicht erst Mitte vierzig? Sollte sie sich nicht auch repräsentiert fühlen? Ach, und er hat definitiv wieder mit dem Selbstbräuner angefangen.«
»Das guck ich mir nicht an«, wiederholt Bean auf ihre stille, resolute Art. »Aber ich habe mit Krista gesprochen. Offensichtlich wird es ein Fest geben.«
»Ein Fest?«
»Eine Auszugsparty. Eine Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Es soll eine große Feier werden. Abendgarderobe, mit Catering und allem, was dazugehört.«
»Abendgarderobe?«, wiederhole ich fassungslos. »Wessen Idee war das … Kristas? Ich dachte, sie gibt das ganze Geld für eine Villa aus, nicht für irgendein protziges Fest. Wann soll es denn stattfinden?«
»Na, das ist es ja gerade«, sagt Bean. »Anscheinend stand es schon eine ganze Weile zum Verkauf, nur hat Dad niemandem was gesagt, für den Fall, dass es nichts werden würde. Das Ganze ist also schon weit gediehen. Mittwoch nächster Woche schließen sie den Vertrag ab, und das Fest ist am Samstag.«
»Schon nächste Woche Mittwoch?« Plötzlich kriege ich so ein hohles Gefühl im Magen. »Aber das ist … Das ist …«
Bald. Zu bald.
Wieder schließe ich die Augen, lasse die schmerzliche Neuigkeit auf mich wirken. Unwillkürlich kehren meine Gedanken wieder zu jenem Tag zurück, der unsere Welt für immer verändert hat. Als wir in der Küche saßen, Glühwein tranken, glücklich und zufrieden, ohne etwas von der Bombe zu ahnen, die gleich hochgehen würde.
Im Nachhinein ist mir wohl bewusst, dass es Hinweise gab. Mimis verkrampfte Hände. Dads feuchte Augen. Diese unsicheren Blicke, die sie einander immer wieder zuwarfen. Selbst der kleine Weihnachtsbaum scheint mir nun vielsagend.
Aber nur, weil man einen kleinen Tannenbaum sieht, denkt man ja nicht automatisch: Moment mal … kleiner Baum … Ich wette, meine Eltern lassen sich scheiden! Ich hatte keine Ahnung. Die Leute sagen immer: »Du musst doch irgendwas geahnt haben.« Habe ich aber wirklich nicht.
Selbst jetzt wache ich noch manchmal auf und durchlebe ein paar erinnerungslose, selige Augenblicke, bis mir plötzlich – hmmmpf – alles wieder einfällt. Mimi und Dad sind geschieden. Dad ist mit Krista zusammen. Mimi hat eine Wohnung in Hammersmith. Das Leben, so wie wir es kannten, ist vorbei.
Und dann kommen mir natürlich auch wieder all die anderen katastrophalen Umstände meines Lebens in den Sinn. Nicht nur haben sich meine Eltern voneinander getrennt, unsere ganze Familie geht mehr oder weniger getrennter Wege. Ich bin in eine anhaltende Fehde mit Krista verstrickt. Ich spreche fast gar nicht mehr mit Dad. Ich wurde vor vier Monaten ausgemustert. Davon habe ich mich immer noch nicht erholt. Es ist, als lebte ich in einem Nebel. Manchmal fühlt es sich fast so an, als wäre jemand gestorben, dabei haben wir gar keinen Kranz bekommen.
Und ich hatte keinen richtigen Freund mehr seit Dominic, dem Mann mit den zwei Gesichtern (im Grunde der Mann mit den fünf Gesichtern, denn er war hinter meinem Rücken mit fünf anderen Mädchen im Bett), und ich kann gar nicht fassen, dass ich für ihn all diese Weihnachtskarten geschrieben habe, weil er meinte, ich hätte so eine hübsche Schrift. Ich bin echt eine dusselige Kuh.
»Ich weiß, plötzlich geht alles ganz schnell«, sagt Bean kleinlaut, als wäre es ihre Schuld. »Ich weiß nicht, was mit den Möbeln passiert. Vermutlich lagern sie alles ein, bis sie ein Haus gefunden haben. Meine Sachen hole ich sowieso ab. Dad und Krista wollen sich erstmal irgendwo einmieten. Jedenfalls meint Krista, sie will heute noch Einladungen rübermailen, also … wollte ich dich warnen.«
Alles geht so schnell, denke ich, und mir schnürt sich die Kehle zusammen. Scheidung. Freundin. Hausverkauf. Und jetzt auch noch ein Fest. Mal ehrlich: ein Fest? Ich versuche, es mir vorzustellen, aber ein Fest, bei dem Mimi nicht die Gastgeberin ist, fühlt sich einfach nur falsch an.
»Ich glaube nicht, dass ich hingehe«, sage ich, bevor ich es verhindern kann.
»Du willst nichthingehen?« Bean klingt bestürzt.
»Mir ist nicht zum Feiern zumute.« Ich gebe mir Mühe, beiläufig zu klingen. »Und ich glaube, an dem Abend habe ich schon was vor. Also. Viel Spaß dabei. Bestell allen schöne Grüße.«
»Effie!«
»Was?«, sage ich, stelle mich bewusst dumm.
»Ich finde, du solltest unbedingt hingehen. Es ist das letzte Fest auf Greenoaks. Alle werden da sein. Die letzte Gelegenheit, Abschied von unserem Haus zu nehmen … eine Familie zu sein …«
»Das ist nicht mehr unser Haus«, sage ich nur. »Krista hat es mit ihrem ›geschmackvollen‹ Anstrich ruiniert. Und wir sind auch keine Familie mehr.«
»Doch, sind wir!«, protestiert Bean erschrocken. »Natürlich sind wir eine Familie! So was darfst du nicht sagen!«
»Okay, gut, meinetwegen.« Trübsinnig starre ich zu Boden. Bean kann sagen, was sie will, aber es stimmt. Unsere Familie ist zerschlagen. Liegt in tausend Scherben. Und niemand kann uns jemals wieder zusammensetzen.
»Wann hast du das letzte Mal mit Dad gesprochen?«
»Weiß nicht mehr«, lüge ich. »Er hat zu tun, ich hab zu tun …«
»Aber du hast richtig mit ihm gesprochen?« Bean klingt hoffnungsvoll. »Ihr habt euch wieder vertragen, seit dem …«
Seit dem Abend, an dem ich Krista angeschrien habe und aus dem Haus gestürmt bin, meint sie eigentlich. Nur ist sie zu taktvoll, um es auszusprechen.
»Aber sicher«, lüge ich wieder, weil ich nicht möchte, dass Bean sich Sorgen um Dad und mich macht.
»Also, ich dringe gar nicht zu ihm durch«, sagt sie. »Immer antwortet Krista.«
»Hm.« Ich lege so wenig Interesse wie möglich in meine Stimme, denn wenn ich mit dem ganzen Dad-Problem fertigwerden will, darf ich am besten gar nicht darauf eingehen. Besonders Bean gegenüber, die es immer wieder fertigbringt, mein Herz zum Rasen zu bringen, wenn ich doch dachte, ich hätte es beruhigt.
»Effie, komm doch zu dem Fest!«, versucht Bean nochmal, mich zu überreden. »Denk nicht an Krista. Denk an uns.«
Meine Schwester ist so vernünftig. Sie versetzt sich in andere. Sie sagt Sachen wie Andererseits und Da ist was Wahres dran und Ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich sollte mich bemühen, vernünftig zu sein, so wie sie, denke ich. Zumindest sollte ich mich darum bemühen, vernünftig zu klingen.
Ich schließe meine Augen, hole tief Luft und sage: »Ich verstehe, was du mir sagen willst, Bean. Da ist was Wahres dran. Ich denk drüber nach.«
»Gut.« Bean klingt erleichtert. »Danach ist Greenoaks für immer weg, und dann ist es zu spät.«
Danach ist Greenoaks für immer weg.
Okay, dieser Vorstellung bin ich gerade nicht gewachsen. Ich sollte dieses Telefonat beenden.
»Bean, ich muss los«, sage ich. »Denn ich bin hier bei der Arbeit. In meinem sehr wichtigen Job als Aushilfskellnerin. Wir sprechen uns später. Bye.«
Als ich zurück in die große Marmorküche schleiche, wird überall fleißig gewerkelt. Eine Floristin schleppt Blumen herein, überall stehen große Eimer voller Eis, und ich sehe, dass der Typ, den sie den »House Manager« nennen, mit Damian, dem Besitzer von Salsa Verde, angestrengt über das Eindecken der Tische diskutiert.
Eine große Mittagsgesellschaft gleicht im Grunde einer Theaterinszenierung, und ich bin schon wieder besserer Dinge, als ich die Köche bei der Arbeit sehe. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich immer beschäftigt bin. Genau. Das ist die Lösung.
Es war ein echter Schock, als ich meinen Job in der Veranstaltungsbranche verloren habe. (Es lag nicht daran, dass ich unfähig gewesen wäre. Und falls doch, war ich zumindest nicht die Einzige, denn sie haben die ganze Abteilung zugemacht.) Aber ich gebe mir alle Mühe, positiv zu bleiben. Ich bewerbe mich um mindestens einen neuen Job pro Tag, und das Kellnern hält mich finanziell über Wasser. Man weiß ja nie, was für Gelegenheiten sich einem bieten. Vielleicht ist Salsa Verde noch meine Rettung, denke ich, während mein Blick durch den Raum schweift. Vielleicht hilft es mir wieder zurück in die Veranstaltungsbranche. Wer weiß, was noch passiert?
Meine Gedanken kommen zum Stehen, als mir auffällt, dass die Floristin, eine freundlich wirkende, grauhaarige Frau, einen etwas ratlosen Eindruck macht. Sie merkt, dass ich sie beobachte, und sagt sofort: »Würden Sie mir wohl einen Gefallen tun? Könnten Sie das hier rüber in die Eingangshalle bringen?« Mit dem Kopf deutet sie auf ein ausladendes Arrangement weißer Rosen auf einem Metallständer. »Ich muss meine Pfingstrosen retten, und das Ding hier steht im Weg.«
»Klar«, sage ich und nehme den Ständer.
»Ach, das musst du doch nicht!«, sagt Elliot, einer der Köche, als ich das unhandliche Teil an ihm vorbeischleppe, und ich grinse zurück. Er ist groß und braungebrannt, mit blauen Augen und von athletischer Statur. Wir haben vorhin schon ein wenig geplaudert, wobei ich mir heimlich seinen Bizeps näher ansehen konnte.
»Ich weiß doch, dass du weiße Rosen magst«, entgegne ich mit einem Lächeln.
Ob es wohl zu forsch wäre, eine einzelne Blüte aus dem Arrangement zu pflücken und sie ihm zu schenken?
Ja. Viel zu forsch. Außerdem Diebstahl.
»Hey, alles okay bei dir?«, fragt er etwas leiser. »Ich hab dich draußen gesehen. Du wirktest irgendwie gestresst.«
Er sieht mich so offen an, so voll aufrichtiger Sorge, dass ich gar nicht anders kann, als mich ihm anzuvertrauen. Zumindest ein bisschen.
»Ach ja, alles gut, danke. Ich habe gerade erfahren, dass mein Elternhaus verkauft wird. Meine Eltern haben sich vor anderthalb Jahren getrennt«, erkläre ich, weil er mich mit so leerem Blick betrachtet. »Ich bin darüber hinweg. Natürlich. Aber trotzdem.«
»Verstehe.« Er nickt mitfühlend. »Das ist traurig.«
»Ja.« Ich nicke zurück, dankbar für sein Verständnis. »Genau! Es ist traurig. Man fragt sich doch … warum? Denn es kam total aus heiterem Himmel. Unsere Familie war glücklich. Weißt du? Die Leute sagten: ›Wow, guck dir mal die Talbots an! Die sind so unfassbar glücklich! Was ist ihr Geheimnis?‹ Und plötzlich meinten meine Eltern so: ›Wisst ihr was, Kinder? Wir trennen uns.‹ Stellt sich raus, das war also ihr Geheimnis. Und ich kann es immer noch nicht … du weißt schon. Verstehen«, ende ich leiser.
»Wow. Das ist …« Elliot scheinen die Worte zu fehlen. »Obwohl, zum Glück haben sie gewartet, bis du erwachsen bist.«
Das sagen die Leute immer. Und es hat keinen Sinn zu widersprechen. Es hat keinen Sinn zu sagen: Aber begreifst du nicht? Jetzt betrachte ich meine Kindheit im Nachhinein und frage mich, ob alles eine große Lüge war.
»Da hast du recht!« Irgendwie bringe ich ein fröhliches Lächeln zustande. »Der Silberstreif am Horizont. Und sind deine Eltern noch zusammen?«
»Das sind sie.«
»Schön.« Ich lächle aufmunternd. »Das ist wirklich schön. Herzerwärmend. Allerdings hält es vielleicht nicht«, füge ich hinzu, weil es nur fair ist, ihn zu warnen.
»Stimmt.« Elliot zögert. »Aber sie machen einen ganz gefestigten Eindruck …«
»Sie machen einen gefestigten Eindruck.« Triumphierend deute ich auf ihn, weil er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. »Ganz genau! Sie machen einen gefestigten Eindruck. Bis dann plötzlich – Boom! Sie leben getrennt, und dein Dad hat eine neue Freundin namens Krista. Jedenfalls … Sollte es passieren, bin ich für dich da.« Ich drücke seinen Arm, zeige schon mal im Voraus mein Mitgefühl.
»Danke«, sagt Elliot mit etwas sonderbarer Stimme. »Das weiß ich zu schätzen.«
»Kein Problem.« Ich lächle ihn wieder an, so warmherzig wie möglich. »Ich sollte besser mal diese Blumen wegschaffen.«
Während ich das Gesteck in die Eingangshalle schleppe, wird mir ganz warm ums Herz. Er ist nett! Und ich glaube, er könnte Interesse haben. Vielleicht frage ich ihn, ob wir mal auf einen Drink ausgehen wollen. Ganz unverfänglich. Aber gleichzeitig meine Absichten deutlich machen. Wie heißt es noch immer in Kontaktanzeigen? Zum Spaßhaben und mehr.
Oh, hi, Elliot, ich dachte gerade, ob du wohl Lust hättest, mal in den Pub zu gehen, zum Spaßhaben und mehr?
Oha. Nein. Lieber nicht.
Als ich wieder in die Küche komme, wird mir klar, dass es definitiv nicht der richtige Moment ist. Hier ist mehr los als je zuvor, und der Stresslevel scheint in meiner Abwesenheit um ein paar Grad zugelegt zu haben. Damian hat Streit mit dem House Manager, und Elliot versucht, Kommentare einzuwerfen, während er Sahne auf ein Schokoladendessert sprüht. Ich bewundere seinen Mut. Damian ist einigermaßen furchteinflößend, selbst wenn er gute Laune hat, ganz zu schweigen davon, wie er ist, wenn er wütend wird. (Ich habe gehört, dass sich mal ein Koch lieber in einem Kühlschrank versteckt hat, als Damian gegenübertreten zu müssen – aber das kann eigentlich nicht stimmen.)
»Hey, du!«, bellt ein anderer Koch, der sich über einen monströsen Topf mit Erbsensuppe beugt. »Rühr das mal einen Moment.« Er reicht mir seinen Holzlöffel und stampft los, um sich an dem Streit zu beteiligen.
Nervös starre ich in die lindgrüne Flüssigkeit. Für Suppe bin ich eigentlich nicht qualifiziert genug. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Aber kann man Suppe überhaupt verderben? Nein. Nein, natürlich nicht.
Während ich rühre und rühre, piept mein Handy, und ich hole es unbeholfen mit einer Hand aus der Hosentasche, während ich mit der anderen weiterrühre. Es ist eine Textnachricht … und als ich den Namen Mimi lese, höre ich schon ihren warmen, irischen Tonfall. Ich öffne die Nachricht und lese, was sie geschrieben hat:
Hallo, meine Kleine, ich habe gerade erfahren, dass das Haus verkauft ist. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Nimm es dir nicht so zu Herzen, Ephelant. Ich denk an dich. Habe heute beim Aufräumen dieses Foto gefunden. Weißt du noch?
Bis ganz bald, meine Süße
Mimi xxx
Ich klicke auf das angehängte Foto und bin augenblicklich überwältigt von Erinnerungen. Es ist mein sechster Geburtstag – Mimi hat das ganze Haus in einen Zirkus verwandelt. Unser riesiges Wohnzimmer mit der gewölbten Decke hat sie in ein Zelt verwandelt und Millionen Ballons aufgeblasen, und sie hat sogar extra Jonglieren gelernt.
Auf dem Foto trage ich mein Ballett-Tutu und stehe auf dem alten Schaukelpferd. Meine Haare sind total verwuschelt, und ich sehe aus wie die glücklichste Sechsjährige der Welt. Dad und Mimi stehen links und rechts von mir, halten mich bei den Händen und lächeln einander an. Liebevolle Eltern.
Ich muss schlucken, als ich heranzoome, um ihre jungen, wachen Gesichter näher zu betrachten, gehe von einem zum anderen, wie ein Detektiv auf der Suche nach Hinweisen. Mimis Wangen glühen, als sie Dad anstrahlt. Sein Lächeln ist genauso liebevoll. Und während ich das sehe, krampft sich mir der Magen zusammen. Was ist bloß schiefgegangen? Sie waren glücklich, sie waren …
»Hey!« Eine Stimme dringt in meine Gedanken. Eine laute, ärgerliche Stimme. Mein Kopf zuckt hoch, und als ich sehe, dass Damian auf mich zugestürmt kommt, bleibt mir fast das Herz stehen.
Nein. Neeeein. Nicht gut. Ich lasse mein Handy klappernd auf den Tresen fallen und rühre forsch die Suppe weiter. Ich hoffe, dass sein »Hey!« vielleicht jemand anderem gegolten hat, aber plötzlich steht er direkt vor mir und sieht mich finster an.
»Du. Wie du auch heißen magst. Was ist mit dir? Hast du Fieber?«
Verdutzt fasse ich mir ins Gesicht. Es ist feucht. Warum ist es feucht?
»Moment mal.« Er kommt näher, sieht mich entsetzt an. »Weinst du etwa?«
»Nein!« Hastig wische ich mir übers Gesicht und setze ein gutgelauntes Lächeln auf. »O Gott, nein! Natürlich nicht!«
»Gut«, sagt Damian und klingt bedrohlich. »Denn wenn doch …«
»Tu ich nicht!«, sage ich überfröhlich, als eben ein dicker, fetter Tropfen in der grünen Suppe landet. Vor Schreck verkrampft sich mir der Magen. Wo kam der denn her?
»Du weinst ja doch!«, platzt er heraus. »Deine verdammten Tränen tropfen in die Suppe!«
»Tu ich nicht!«, rufe ich verzweifelt, als schon die nächste Träne hineintropft. »Es geht mir gu-hu-hut!« Meine Stimme bricht, als ich schluchzen muss, und zu meinem Entsetzen fällt gleich ein weiterer großer Tropfen in die Suppe. O Gott, der wird doch wohl nicht aus meinem Auge gekommen sein.
Zitternd blicke ich auf. Damians Miene lässt mich erschauern. Der Stille um uns herum entnehme ich, dass uns alle in der Küche beobachten.
»Raus!«, poltert er. »Raus! Hol deine Sachen!«
»Raus?« Ich stutze.
»Tränen in der Suppe.« Angewidert schüttelt er den Kopf. »Hau bloß ab!«
Ich schlucke ein paarmal, überlege, ob es eine Möglichkeit gibt, die Situation zu klären, dann komme ich zu dem Schluss, dass es keine gibt.
»Zurück an die Arbeit!«, bellt Damian die anderen in der Küche an, und sofort brechen alle wieder in frenetische Aktivitäten aus.
Ich lege meine Schürze ab, fühle mich etwas unwirklich, während ich auf die Tür zusteuere und alle anderen meinem Blick ausweichen.
»Wiedersehen«, nuschle ich. »Macht’s gut.«
Als ich an Elliot vorbeikomme, würde ich am liebsten stehen bleiben, aber ich bin doch zu benommen, um jetzt mal eben locker eine Einladung zustande zu bringen.
»Bye«, sage ich mit gesenktem Blick.
»Moment, Effie«, sagt er mit seiner tiefen Stimme. »Warte mal eben.«
Ein kleines Licht der Hoffnung leuchtet auf, als er sich die Hände wäscht, sie abtrocknet und auf mich zukommt. Vielleicht fragt er mich, ob wir ausgehen wollen, und wir verlieben uns, und das ist dann die hübsche Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben …
»Ja?«, sage ich, als er vor mir steht.
»Ich wollte dich nur was fragen, bevor du gehst«, sagt er leise. »Hast du einen festen Freund?«
O mein Gott! Es passiert tatsächlich!
»Nein«, sage ich und gebe mir Mühe, beiläufig zu klingen. »Nein, ich habe keinen festen Freund.«
»Na, vielleicht solltest du dir einen suchen.« Er betrachtet mich mitfühlend. »Denn wenn du mich fragst, hast du die Scheidung deiner Eltern noch nicht verwunden.«
DREI
Als ich zu Hause ankomme, bin ich immer noch verletzt. Ich habe die Scheidung meiner Eltern verwunden. Natürlich habe ich das. Man kann doch etwas »verwunden« haben und trotzdem darüber reden, oder?
Und ich habe nicht geweint. Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir. Meine Augen haben wegen der Suppe getränt. Wegen der Suppe.
Ich drücke die Tür zu unserer Wohnung auf, und als ich trübsinnig hineinschlurfe, sehe ich, wie Temi auf dem Boden hockt, vor ihrem aufgeklappten Laptop. Die zahllosen Zöpfe fallen über ihre Schultern.
»Hi«, sagt sie, als sie aufblickt. »Wieso bist du schon zu Hause?«
»War früher fertig«, sage ich, weil ich jetzt nicht darüber reden will. (Im Grunde ist es nicht so schlimm, wie ich dachte. Die in der Agentur waren ganz ruhig, als ich ihnen erzählt habe, dass Damian mich aus seiner Küche geworfen hat. Sie meinten, das macht er immer so, und sie würden mich für eine Woche nicht wieder zu ihm schicken. Dann haben sie mich für zehn Geschäftsessen gebucht.)
»Oh. Okay.« Temi kauft es mir ab. »Also, ich bin gerade auf der Immobilienseite. Da steht ›Verkauft‹. Sieht toll aus«, fügt sie hinzu.
Ich habe Temi vorhin eine Nachricht geschickt, was mit Greenoaks passiert. Sie ist ein bisschen immobilienbesessen, weshalb ich wusste, dass sie sich dafür interessieren würde. Außerdem hat sie oft ihre Ferien bei uns verbracht, sodass sie quasi dazugehört.
»Besucher dieses verwunschenen, viktorianischen Anwesens am Rande des hübschen Dorfes in West Sussex werden staunen angesichts des überwältigenden Eingangsbereiches«, liest sie vor. »Ja! Stimmt! Ich weiß noch, als ich dich zum ersten Mal besucht habe. Da dachte ich: ›Du meine Güte, hier wohnt Effie?‹«
»Steinerne Stabkreuzfenster fluten das Haus mit Licht. Und Zugluft«, fügt sie hinzu. »Da sollte stehen: ›Die Fenster fluten das Haus außerdem mit arschkalter Zugluft. Und außerdem mit echten Fluten. Von denen das Gelände mit schöner Regelmäßigkeit heimgesucht wird.‹«
Unwillkürlich muss ich lachen. Ich weiß ja, dass sie mich aufheitern möchte, und sie zwinkert mir zu. Temi und ich haben uns auf der Schule beim Tanzen kennengelernt – wir waren beide in der Jazztanzgruppe. Ich gehörte zu den Heimschläfern, aber sie wohnte dort im Internat, weil ihre Eltern beide irrsinnig anstrengende Jobs im Bankenbusiness hatten. Als sie zwei war, zogen die Eltern von Nigeria für ein paar Jahre nach Frankreich, dann nach London, wo sie schließlich blieben. Inzwischen arbeitet Temi auch für eine Bank. Wenn die Leute fragen: »Ist das nicht ein ziemlich harter Job?«, lächelt sie nur und sagt: »Genau das mag ich ja daran.«
»Wie war’s bei der Arbeit?«, frage ich in der Hoffnung, damit das Thema zu wechseln, doch sie liest immer weiter.
»Das Haus liegt umgeben von verwunschenen Gärten und Ländereien, passend zur unkonventionellen Architektur.«
»›Verwunschen‹ bedeutet ›ungepflegt‹«, sage ich stirnrunzelnd. »Und ›unkonventionell‹ bedeutet ›hässlich‹.«
»Nein, tut es nicht! Effie, ich liebe Greenoaks über alle Maßen, das weißt du, aber du musst auch zugeben, dass es anders ist. Speziell …«, fügt sie taktvoll hinzu. »Eine geräumige Diele führt in einen großen, holzgetäfelten Salon mit steinerner Sitzbank vor einem gotischen Stabkreuzfenster«, liest sie weiter vor, und einen Augenblick lang schweigen wir beide, denn als wir klein waren, haben wir auf dieser Bank regelrecht gelebt. Wir haben die alten, dicken Vorhänge hinter uns zugezogen, um uns eine muffige Höhle zu schaffen, in der wir Zeitschriften gelesen und Make-up ausprobiert haben. Als wir älter wurden, haben wir Wodka aus diesen Minifläschchen gekippt und über Jungs geredet. Als Temis Oma starb, haben wir einen ganzen Nachmittag dort verbracht, uns nur in den Armen gehalten, ohne was zu sagen, in unserem eigenen Reich.
Ich hocke mich neben Temi auf den Boden und sehe ihr dabei zu, wie sie die Fotos durchgeht und lustige Kommentare dazu abgibt. Doch als sie zu den Bildern der makellos glänzenden Küche mit ihren makellos glänzenden Schränken kommt, hören ihre Finger auf zu scrollen. Nicht mal Temi fällt etwas Lustiges dazu ein. Was Krista da getan hat, war sinnlose, mutwillige Zerstörung. Sie hat Mimis Wald – etwas Wunderschönes und Einzigartiges – einfach ausgelöscht.
Und da wundern sich die Leute, dass ich mit ihr auf dem Kriegsfuß stehe.
In der Küche geht ein Timer los, und Temi kommt auf die Beine.
»Ich muss mein Stew umrühren«, sagt sie. »Tässchen Tee? Du siehst aus, als könntest du es gebrauchen.«
»Ja, bitte«, sage ich dankbar. »Heute war mal wieder so ein Tag.«
Es ist ja nicht nur die Nachricht, dass Greenoaks verkauft wurde, oder der Umstand, dass man mich heute rausgeworfen hat … es ist alles. So vieles hat sich angestaut.