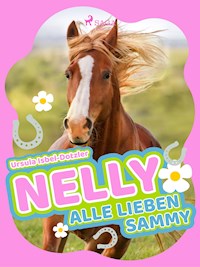Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Fanny wohnt in den Sommerferien bei ihrem Onkel in Cornwall. Dabei kommt es ihr so vor, als würde sie schon immer hier leben - dabei ist sie das erste Mal auf dem alten Anwesen! Und dann ist da dieser komische Traum, den sie seit ihrer Kindheit hat...Ursula Isbel wurde 1942 in München geboren und lebt heute als freie Schriftstellerin in Sulzburg. Sie schreibt hauptsächlich Jugendliteratur für ein überwiegend weibliches Publikum, darunter mehrere Reihen über Reiterhöfe und das Leben mit Pferden.Unter dem Pseudonym Ursula Dotzler übersetzte sie außerdem viele Jugendbücher aus dem Englischen und dem Schwedischen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel-Dotzler
Die Frau am Meer
SAGA Egmont
Die Frau am Meer
Copyright © 2005, 2018 Ursula Isbel-Dotzler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711804476
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
1
Immer wieder, in vielen Nächten, träumte ich den gleichen Traum. Ich nannte ihn den »Pferdetraum«. Er begleitete mich schon mein ganzes Leben lang. Vielleicht hatte ich ihn sogar als Säugling schon geträumt oder im Bauch meiner Mutter, auch wenn ich mich daran natürlich nicht erinnern konnte. Manchmal blieb er mehrere Monate aus, dann wieder kam er in Serien, Nacht für Nacht.
Ich kann nicht sagen, dass es Albträume waren, obwohl sie seltsam und beängstigend auf mich wirkten. Seltsam, dieses Wort fiel mir stets ein, schon sehr früh, als ich noch klein war, wenn ich über diesen Traum nachdachte oder davon erzählte. Bald hieß er in der ganzen Familie nur »Fannys seltsamer Pferdetraum«.
Die Träume begannen stets damit, dass ich einen steil abfallenden Pfad zwischen windzerzausten Büschen hinunterritt, der voller Sand und Geröll war. Ich saß auf einem isahellfarHenen Pferd. Und obwohl ich in Wirklichkeit nie ein Pferd besessen hatte und noch nie geritten war, spürte ich die Bewegungen der blassgoldenen Stute deutlich unter mir und wusste, wir gehörten zusammen, sie und ich.
Um uns her herrschte Dämmerung, früher Morgen oder früher Abend, ein graues, bleiches Licht. Der Wind wirbelte mein langes rotes Haar hoch und ließ die Mähne der Stute flattern, sodass die Strähnen meine bloßen Arme berührten.
Ich roch das Meer und spürte die Feuchtigkeit der Gischt, die der Wind uns zutrug, auf meinen Lippen; ja, ich schmeckte das Salz, obwohl es doch nur ein Traum war.
Die ganze Zeit über wusste ich, dass etwas Schlimmes geschehen würde und dass ich versuchen musste, es zu verhindern.
Der Ablauf war immer gleich. Wir galoppierten den Hohlweg hinunter, der sich plötzlich zu einer zerklüfteten Bucht öffnete, in der das Meer brandete und gurgelte und zischte. Hoch über uns, auf einem Felsen, der wie ein Turm aus den Wellen ragte, waren die Überreste einer verfallenen Burg.
Das Wasser war dunkel in der Dämmerung, fast schwarz. Kälte stieg von ihm auf. Ich zügelte mein Pferd, schwang mich zu Boden, geschmeidig und schwerelos, ließ die Stute am Strand zurück und begann, über die rauen Felsbrocken zu klettern, hin zu der Stelle, wo eine Treppe begann, die in den Fels gehauen war – dreihundertzwanzig Stufen bis hinauf zum alten Festungstor. Ich kannte die Zahl.
Gegen den stürmischen Wind kämpfte ich mich nach oben, Stufe um Stufe.
Die Treppe war sehr steil und schlüpfrig von der Gischt, grob behauen und an einer Seite durch ein Seil gesichert. Dazwischen sah ich die Brecher gegen die Klippen schlagen, tiefer und immer tiefer, je höher ich kam.
Die Angst trieb mich vorwärts, bis ich kaum noch Luft bekam, bis meine Knie zitterten und meine Brust bei jedem Atemzug schmerzte. Ich musste hinauf zu den Mauerresten, die sich hoch über dem Meer auf der Felsspitze wie die Zahnstümpfe eines Riesen türmten.
Es war lange her, seit Menschen dort oben gelebt hatten. Jetzt hausten nur noch Seevögel zwischen den bröckelnden Steinen, doch ich wusste, sie war dort oben. Ich musste sie erreichen, ehe es zu spät war …
Und immer endete der Traum auf der letzten Stufe, noch ehe ich den verfallenen Torbogen erreichte. Ich erwachte mit dieser Angst, dieser verzweifelten Gewissheit, dass etwas Furchtbares passieren würde, wenn ich nicht rechtzeitig kam.
Doch wer die Person war, die ich suchte, und wovor ich sie bewahren wollte, blieb mir verborgen. Und weil ich stets an der gleichen Stelle erwachte, glaubte ich auch, dass ich das Ende der Geschichte nie erfahren würde.
2
Ich erinnere mich noch genau, dass ich in der Nacht, ehe Onkel Haralds Anruf kam, nach fast einem halben Jahr Pause wieder den Pferdetraum träumte.
Es war kurz vor den Sommerferien. Wir saßen auf dem Balkon beim Frühstück und redeten über den Urlaub. Noch waren wir uns nicht einig, wer wohin fahren sollte. Unsere Eltern wollten in die Bretagne, wo eine Kollegin meiner Mutter ein Ferienhaus hatte, das wir mieten konnten. Tobias, mein Bruder, überlegte, ob er nicht lieber mit Freunden nach Kalifornien fliegen sollte.
Ich hatte eigentlich keine besondere Lust wegzufahren, denn ich erholte mich gerade von einem Anfall von Liebeskummer. Im Grunde wäre ich am liebsten während der kommenden Wochen in einen Dauerschlaf verfallen und erst wieder aufgewacht, wenn die Ferienzeit vorüber war; so wie ein verwundeter Bär, der sich in seine Höhle zurückzieht.
»Ihr tapert doch nur endlos durch die Landschaft und besichtigt altes Gemäuer«, sagte mein Bruder. »So was Langweiliges kann ich immer noch machen, wenn ich mit dem Leben abgeschlossen habe und gruftimäßig mit dem Kopf wackle.«
Unser Vater seufzte. »Na gut, okay. Dann fährst du eben nach Kalifornien. Aber denk an das, was wir ausgemacht haben: Du finanzierst die Reise selbst. Wir übernehmen nur den Flug. Und du, Fanny? Du wirst doch nicht allein zu Hause herumhängen?«
»Ja«, sagte meine Mutter und strich sich das blonde Haar aus der Stirn. »Komm doch mit. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dich ganz allein hier zurückzulassen.«
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Vater verschwand durch die Balkontür. Wir hörten seine gedämpfte Stimme aus dem Wohnzimmer, konnten aber nicht verstehen, was er sagte. Tobias schlug großzügig vor, ich könnte ja mit ihm und seinen beiden Freunden nach Kalifornien fliegen, vorausgesetzt ich beteiligte mich an den Kosten für den Landrover, hielt mich bescheiden im Hintergrund und sagte zu allem Ja und Amen. Ganz so drückte er es zwar nicht aus, aber es war natürlich genau das, was er meinte.
»Nein danke«, sagte ich. »Kein Bedarf. Ich will euren Vatertagsausflug nicht stören.«
Dann kam unser Vater zurück. Ich merkte, dass er mich ansah, als er sich wieder an den Tisch setzte. »Harald hat angerufen«, sagte er.
Harald ist Vaters Bruder. Es kam nicht oft vor, dass er sich meldete. Onkel Harald war Auslandskorrespondent und deshalb naturgemäß viel unterwegs. Tobias nannte ihn nur die Wanderratte. Eigentlich war es ein Wunder, dass er eine Familie hatte. Im Grunde gab es dafür in seinem Leben kaum Zeit. Trotzdem hatte er eine Frau und zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Sie lebten in Cornwall, irgendwo an der Küste. Das heißt, Onkel Haralds Frau und seine Kinder lebten da. Er selbst war dort wohl nur ein gelegentlicher Besucher.
»Sieh an, die Wanderratte!«, sagte mein Bruder. »Von wo hat er angerufen? Aus einer Telefonzelle in der Wüste Gobi?«
»Nein«, erwiderte Vater. »Von seinem Haus in Cornwall. Und er hat ein Problem.«
»Sonst hätte er sich ja wohl auch kaum gemeldet«, warf Mutter ein.
Vater schnitt eine Grimasse. »Er muss für einige Zeit nach Asien. Viereinhalb Wochen, um genau zu sein. Und er möchte Helen mitnehmen.«
Helen ist Onkel Haralds Frau. »Schwierig ist es nur mit den Kindern. Sie möchten sie nicht impfen lassen und fürchten, dass sie sich in Asien sofort allerhand Krankheiten holen würden. Die beiden haben offenbar auch keine Lust mitzufahren. Die Frage ist nur, wer sich in dieser Zeit um sie kümmern soll.«
»Ich dachte, sie hätten eine Kinderfrau oder so was Ähnliches?«, fragte Mutter und rührte wie besessen mit dem Löffel in ihrer Kaffeetasse herum.
»Eine Haushälterin, die putzt und kocht. Aber die wohnt nicht im Haus. Sie kommt morgens und verschwindet nachmittags wieder. Und sie scheint … na ja, sie scheint etwas eigenartig zu sein. Die Kinder mögen sie nicht besonders. Jedenfalls wollen ihr Helen und Harald die Kids nicht anvertrauen.«
»Heißt das, dass wir unseren Urlaub in Cornwall verbringen und Haralds Sprösslinge hüten sollen?«, fragte meine Mutter ziemlich entsetzt. Ich konnte sie verstehen. Als Lehrerin legte sie keinen Wert darauf, auch noch während der Ferien von Kindergeschrei genervt zu werden.
»Harald und Helen haben an Fanny gedacht«, erwiderte mein Vater.
»An mich?« Meine Stimme endete mit einem Kiekser. Ich war total überrascht, fühlte mich zugleich aber auch geschmeichelt. Dass Onkel Harald mir zutraute, seine beiden Kids zu versorgen, mehr als einen Monat lang, irgendwo in einem einsamen Haus in der cornischen Pampa, war doch ein Beweis, dass er mehr von mir hielt, als ich vermutet hatte.
Die Gedanken meiner Mutter gingen in eine ähnliche Richtung, wenn auch mit unterschiedlichem Ergebnis. »Also, ich weiß nicht«, sagte sie. »Das ist eine Menge Verantwortung für eine Siebzehnjährige. Und Haralds Anwesen scheint doch ziemlich abgelegen und einsam zu sein. Ich halte es für gefährlich, wenn zwei Kinder und ein junges Mädchen wochenlang allein dort hausen.«
»Es gibt ja immerhin ein Telefon. Und Harald hat im letzten Jahr eine Alarmanlage einbauen lassen, die direkt mit dem örtlichen Polizeirevier verbunden ist«, erwiderte Vater. »Helen scheint etwas ängstlich zu sein. Tagsüber ist ja noch die Haushälterin da. Übrigens ist das Haus gar nicht so einsam gelegen. Ganz in der Nähe gibt es ein Cottage, in dem Künstler wohnen, glaube ich.«
Ich wollte den Mund aufmachen, um etwas zu sagen, doch Tobias kam mir zuvor. »Warum heuern sie kein Kindermädchen an? Für so was gibt’s doch Agenturen. Ich sehe nicht, wo da das Problem liegt.«
»Harald sagt, sie möchten niemanden im Haus haben, den sie nicht schon eine Weile kennen. Und das verstehe ich auch. Wenn man bedenkt, was heutzutage so alles mit Kindern angestellt wird …«
»Wie alt ist Sally jetzt?«, fragte Mutter dazwischen.
»Neun oder zehn, glaube ich. Und Rian dürfte etwa acht sein.«
»Wie wär’s mit einem Kinderheim?«, schlug Tobias vor.
»Das kommt nicht infrage«, erklärte Vater. »Harald hält nichts von Kinderheimen, das weiß ich. Als wir Kinder waren, mussten wir mal einen Sommer lang in ein Kinderheim. Es war keine sehr angenehme Erfahrung, kann ich euch sagen. Seitdem hat er eine heftige Abneigung gegen Heime.«
»Zahlen sie Fanny wenigstens den Flug?«, wollte Tobias wissen, der immer auch gleich die praktische Seite einer Sache sah.
Vater nickte. »Sicher. Harald ist auch bereit, ihr so was wie ein Gehalt zu bezahlen. Er hat vorgeschlagen, dass wir uns mal erkundigen sollen, was Kindermädchen bei uns im Durchschnitt monatlich verdienen.«
Ich spitzte die Ohren. Das klang nicht schlecht. Immerhin sparte ich für den Führerschein. Im kommenden Frühling brauchte ich mindestens zweitausend Mark; und was sich auf meinem Sparkonto bisher angesammelt hatte, reichte bestenfalls für drei Fahrstunden.
Sie palaverten und verhandelten über meinen Kopf hinweg. Ich hörte schon nicht mehr hin. Vielleicht, dachte ich, war das ja die Höhle, die ich mir gewünscht hatte. Eine Bärenhöhle in Form eines alten Hauses in Cornwall, in der zwei kleine Bären auf mich warteten.
Schließlich öffnete ich den Mund und fragte laut: »Kann ich auch mal was dazu sagen?«
Drei Augenpaare musterten mich verblüfft. Tobe begann zu grinsen. »Ausnahmsweise«, erklärte er. »Aber mach’s kurz.«
»Sehr kurz«, sagte ich. »Wann geht mein Flieger?«
3
Die Reise war alles andere als romantisch. Während des Fluges nach Heathrow gab es Turbulenzen. Das Flugzeug vollführte wahre Bocksprünge, die mein Magen übel nahm. Ich sah nicht in den Spiegel, aber ich hätte schwören können, dass ich grün im Gesicht war, als wir endlich landeten.
Im Labyrinth des Flughafens verirrte ich mich. Die Zeit drängte, denn ich musste meinen Anschlussflug nach Exeter erreichen. Wie ein aufgescheuchtes Huhn hetzte ich durch Hallen und Gänge und über Rolltreppen auf der Suche nach dem richtigen Abfertigungsschalter.
Knapp fünf Minuten vor Abflug landete ich keuchend am Schalter und wurde als letzter Passagier in einsamer Größe im Kleinbus übers Rollfeld zum Flugzeug gebracht, das mir verdächtig klein und klapprig vorkam.
Die erneute Schaukelei war zu viel für meinen armen Magen. Ich spuckte auch die letzten Reste meines Bordfrühstücks in die dafür vorgesehenen Tüten und wünschte, ich könnte sterben oder wenigstens sofort aussteigen. Die halbe Flugstunde kam mir wie eine Ewigkeit vor.
Der Pilot verkündete munter durch den Lautsprecher, die Wetterbedingungen seien »etwas windig«. Nach der Art zu urteilen, wie der kleine Flieger wackelte und hopste, schienen wir einen mittleren Orkan zu durchqueren.
Mit weichen Knien wankte ich die Treppe hinunter zum Rollfeld. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass dieser Tag bereits gelaufen war, dass weiterhin alles schief gehen würde, was nur schief gehen konnte. Dass niemand in der Halle stehen und mich erwarten würde und dass mein Rucksack unter allen Gepäckstücken als Einziger nicht mit mir zusammen angekommen war, sondern irgendwo am anderen Ende der Welt auftauchen würde.
In dieser Stimmung ärgerte es mich fast, dass ich nicht Recht behielt. Mein Rucksack tauchte gleich zu Anfang zwischen den Gummilappen auf und hinter der Sperre stand Onkel Harald, groß und dünn in seinem klassischen Trenchcoat, die kinnlangen Haare vom Wind zerzaust.
Er umarmte mich fest, hielt mich dann von sich ab, sah mich an und sagte:
»Verträgst du das Fliegen nicht? Du siehst aus wie Gefrierspinat.«
»Vielen Dank«, erwiderte ich ziemlich verbissen. »Ich würde es nicht gerade fliegen nennen. Lieber fahre ich zwei Stunden am Stück mit der Achterbahn.«
»Ach, es hat wohl Turbulenzen gegeben?« Onkel Harald lachte und fügte hinzu: »Magst du irgendwo einen Whisky trinken, ehe wir losfahren?«
Ich schüttelte mich nur und war froh, als er mir meinen Rucksack abnahm.
»Meinst du denn, du verträgst jetzt überhaupt noch eine längere Fahrt?«, fragte er und sah mich besorgt von der Seite an, während wir in seinen Wagen stiegen. Vermutlich hatte er Angst um die teuren Ledersitze.
»So lange dein Auto nicht abhebt und Loopings macht, müsste es gehen«, sagte ich.
Er steckte den Zündschlüssel ins Schloss, startete aber noch nicht, sondern musterte mich wieder und bemerkte dann: »Es ist schon seltsam mit dieser Ähnlichkeit. Ich dachte, es verliert sich mit der Zeit, wenn du erwachsen wirst, aber ich würde eher sagen, es hat sich noch verstärkt. Verrückt, was die Gene oft für Sprünge machen, wie? Sie scheinen in den Familien kreuz und quer herumzuhüpfen wie Kugelblitze.«
Obwohl mir nach wie vor ziemlich elend war, musste ich lachen. Die Ähnlichkeit zwischen ihm und mir war wirklich verblüffend. Ich glich Onkel Harald weit mehr als meinem Vater oder meiner Mutter. Wir hatten die gleichen grauen, weit auseinander stehenden Augen und seine Nase zeigte wie die meine mit einem kleinen Kick nach oben. Nur seine Haare, die früher so rot gewesen waren wie meine, hatten inzwischen einen gelblich grauen Farbton wie ein alter Fuchspelz.
Während ich ihn ansah, entdeckte ich plötzlich, dass sich seine Augen auf die gleiche Weise verengten wie meine, wenn er lächelte.
»Verrückt, echt!«, sagte ich. »Jeder würde dich für meinen Vater halten.«
»Aber da gab’s keinen Seitensprung mit deiner Mutter, Ehrenwort!«
Ich lachte wieder, diesmal, weil er es von mir zu erwarten schien. »Und deine Kids? Sehen die dir ähnlich?«
»Überhaupt nicht. Rian kommt nach Helen und Sally nach ihrem Großvater mütterlicherseits. Schwarzes Haar und dunkle Augen – da schlägt das keltische Erbe voll durch.«
Ich hatte meinen Onkel und seine Familie vor sieben oder acht Jahren zum letzten Mal gesehen. Damals war Rian gerade erst ein paar Monate alt gewesen, ein dünnes, zartes, ewig quengelndes Baby. An Sally erinnerte ich mich kaum noch. Sie hatte sich immer schüchtern im Hintergrund gehalten. Das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben war, waren ihre großen, scheu wirkenden Augen.
Von Exeter sah ich nicht viel. Ich lehnte mich in den bequemen Sitz zurück und hielt die Augen meist geschlossen.
Bis Onkel Harald sagte, es wäre besser für mich, wenn ich sie aufmachte. »So wirst du die Übelkeit nicht los«, meinte er.
Da hatten wir die Stadt schon hinter uns gelassen und fuhren übers offene Land, hinein ins Dartmoor, das ich mir immer als öde, düstere Gegend vorgestellt hatte, mit Nebelschwaden und Sumpflöchern, in denen ausgebrochene Sträflinge herumirrten und versanken, untermalt vom schaurigen Geheul des Hundes von Baskerville.
Doch es war ganz anders. Die Moor- und Heidelandschaft war von melancholischem Liebreiz, mit kleinen Bächen und Tümpeln zwischen Felsbrocken und Schafen, die friedlich im Heidekraut weideten. In der Ferne ragten Hügel auf, die wie Zuckerhüte geformt waren. Und mitten in der Heide erhoben sich bizarre Türme aus Granit, Tors genannt, wie Onkel Harald mir erklärte.
Der Wind trieb pastellfarbene Wolken über den Himmel, sodass das Licht ständig zwischen gleißender Helligkeit und jagenden Schatten wechselte. »Hier gibt es wild lebende Pferde, wusstest du das?«, sagte mein Onkel. »Aber warte, bis du das Meer siehst. Die Küste von Cornwall ist atemberaubend, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Schade, dass man sich an alles so rasch gewöhnt, selbst an die Schönheit.«
Er steuerte den Wagen an einem Bus vorbei, der mitten auf der Fahrbahn stand. Ein Trupp kahlköpfiger Männer in Shorts und mehrere alte Damen mit bläulichem Silberhaar fotografierten die fernen Zuckerhüte.
»Nicht allzu weit von hier ist auch ein See, Dozmare Pool. In den soll Bedivere das Schwert Excalibur geworfen haben. Früher hielt man Dozmare Pool für unergründlich tief.«
»Excalibur? Ist das nicht dieses Zauberschwert? Das hat doch etwas mit König Arthus zu tun, oder?«
Onkel Harald nickte. »Excalibur war König Arthus’ magisches Schwert.«
»Hat es König Arthus eigentlich wirklich gegeben?«, fragte ich.
»Darüber streiten sich die Wissenschaftler. Der Überlieferung nach war Arthus ein keltischer Stammesfürst, dem es gelang, mit einem Heer von etwa zehntausend Männern die Invasion der Angelsachsen aufzuhalten. Es heißt, er wurde christlich erzogen, soll aber auch von Merlin, dem Zauberer, in die ›Anderwelt‹ der Kelten eingewiesen worden sein.«
»Das klingt aber, als hätte er tatsächlich gelebt«, sagte ich.
»Vermutlich schon. Er war wohl ein großer Heerführer, dem im Laufe der Geschichtsüberlieferung immer mehr Wunderdinge angedichtet wurden. So sind ja viele Sagen entstanden.«
Er begann, von Merlin, dem Zauberer, zu erzählen und von Arianrhod, der Herrin des Turms zum Jenseits. Seine Stimme war angenehm gleichmäßig und einschläfernd, der große Wagen fuhr schnurrend dahin. Ich begann, mich zu entspannen, und schloss die Augen wieder. Mein Magen beruhigte sich. Ich döste ein und erwachte davon, dass jemand meine Schulter berührte.
»Wir sind da, Fanny«, sagte Onkel Harald.
4
Das Haus hieß Rhiannon Hall nach einer alten walisischen Göttin, die eine weiße Stute besaß und selbst Pferdegestalt annehmen konnte. Das erklärte mir Onkel Harald, während wir aus dem Wagen stiegen.
Es war viel größer, als ich vermutet hatte, ein lang gestrecktes Gebäude aus grauem Naturstein, mit grauem Schieferdach, sieben Kaminen und einer Menge weiß gestrichener Fenster.
Der Rasen, der das Haus umgab, wirkte ungepflegt. Er war begrenzt von wild wuchernden Rhododendronbüschen und Hecken aus Lorbeer, Stechpalmen und schwarzgrünen Eiben. Abends, wenn ich aus dem Fenster schaute, musste ich oft zweimal hinsehen, um sicher zu sein, dass diese gespenstischen Schatten keine Monster waren. Auch die Kinder hatten es bei Einbruch der Dunkelheit immer eilig, die Vorhänge zuzuziehen, um »sie« auszusperren.
»Da draußen lauern sie«, sagte Rian manchmal; keiner konnte ihm ausreden, dass das Haus von jeder Menge schauriger Wesen umgeben war, sobald es finster wurde.
Jetzt, bei hellem Tageslicht, wirkte alles nur etwas vernachlässigt, so als wäre das Anwesen schon seit längerem unbewohnt. Doch während wir über den Trampelpfad gingen, der von der Auffahrt zur Gartenseite des Hauses führte, tat sich eine der Terrassentüren auf, und Tante Helen erschien auf der Schwelle.
Sie trug einen Kimono aus blauer Seide, der sie wie einen Schmetterling aussehen ließ. Neben ihr tauchte rechts und links je ein Kinderkopf auf. Zwei dunkle Augenpaare spähten mich aus sicherer Deckung hervor an.
»Hi!«, sagte ich, aber sie antworteten nicht.