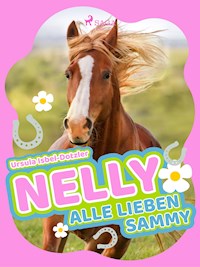Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Kathi und Kim sind in heller Aufruhr: Kims gemeiner großer Bruder quält die Stute Flora. Sie beschließen, das Pferd erstmal bei ihrem Freund Stevie unterzustellen, um es vor Kims Bruder zu schützen. Doch dieser ist ihnen dicht auf den Fersen. Wie lange wird Flora vor ihm sicher sein?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Flucht von Burg Ravensmoor
SAGA Egmont
Flucht von Burg Ravensmoor
Copyright © 2007, 2018 Ursula Isbel-Dotzler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711804445
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
»Das Wenige, was du tun kannst, ist viel – wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh und Angst von einem Wesen nimmst.«
Albert Schweitzer
1
Ich stand am Herd und rührte mit einem riesigen Holzlöffel im Kleietrank für die Pferde, während mein jüngerer Bruder Niko auf dem Küchentisch saß, die Füße auf einem Stuhl, und mir zusah.
»Hat Kim dir eigentlich schon mal was von diesem Burgmonster erzählt?«, fragte er unvermittelt.
»Burgmonster?«, wiederholte ich. »Blödsinn, wie kommst du darauf? Das ist doch Kinderkram. So was gibt es auf Ravensmoor nicht.«
»Sicher. Paps hat es erwähnt, erinnerst du dich nicht? Beim Umzug, auf der Fahrt von zu Hause nach England.«
Zu Hause, das war für uns immer noch Deutschland, unser kleines Dorf, in dem wir so lange gelebt hatten, bevor alles anders wurde. Jetzt wohnten wir seit einem Monat an der Küste von Cornwall. Vielleicht war Niko derjenige von uns allen, der mit diesem neuen Leben am wenigsten zurechtkam, auch wenn er nie zugegeben hätte, dass er Heimweh hatte.
»Ach so, das! Das ist doch nur ein Gerücht. Kim hat auf jeden Fall nie etwas davon gesagt.«
»Vielleicht redet sie nicht gern darüber. Könnte ja sein, dass sie’s uncool findet, in so einem verfallenen Gemäuer zu leben, wo nachts schräge Typen herumschlappen und mit den Zähnen klappern.«
»Du meinst, es ist ihr peinlich?«
Nachdenklich starrte ich in den Topf mit dem zähen Brei. Kim von Ravensmoor war meine neue Freundin. Sie wohnte mit ihrer Familie auf einer richtigen Burg ganz in unserer Nähe.
Die Ravensmoors waren eine der vornehmsten Familien von Cornwall, aber total verarmt. Bis auf ein kleines Wohnhaus und einen Stall war von Ravensmoor, ihrem Stammsitz, nur noch ein Eckturm und ein Trümmerhaufen alter Steine übrig, in dem Dohlen und Turmfalken hausten.
»Ich hab schon ein paarmal gedacht, dass sie vielleicht lieber eine stinknormale Familie hätte und froh wäre, wenn sie in einem einfachen Haus leben könnte. Sie redet eigentlich fast nie über ihre Familie – höchstens über ihren Bruder.«
»Auch nicht über das Burgmonster?«
Niko langweilte sich offensichtlich und suchte krampfhaft nach einer Ablenkung. Ich verstand ihn gut; schließlich hatte ich selbst hier in der neuen Umgebung beinahe die Krise gekriegt, bevor ich Kim kennenlernte. Ob sie mir davon erzählt hätte, falls es auf Ravensmoor wirklich spukte? Ich war nicht so sicher.
»Frag sie doch mal«, sagte Niko.
Gemeinsam schleppten wir den großen alten Kochtopf an den Henkeln ins Freie. Noch immer konnte man die Spuren des Sturms sehen, der vor zwei Wochen hier gewütet hatte. In Grannys Garten stand keine einzige Blume mehr aufrecht. Die Büsche und Bäume waren fast kahl und um den alten Stall lagen zerbrochene Schindeln.
Doch unsere Großmutter hatte behauptet, dass die Büsche und Bäume wieder austreiben würden; und sie musste es ja wissen. Schließlich hatte sie mehr als siebzig Jahre hier an der Atlantikküste verbracht und schon viele Stürme erlebt.
Als wir über den Gartenpfad zur Koppel gingen, sah ich, dass die Weißdornbüsche wirklich über Nacht winzige grüne Spitzen bekommen hatten, genau wie im Frühling.
Wir passierten den Durchgang in der Hecke und sahen den Eckturm von Burg Ravensmoor in der Ferne über uns aufragen, die höchste Landmarke weit und breit. Höher als alle Klippen und Hügel und Baumwipfel. Einst hatten Wächter von dort die Küste beobachtet und die Menschen vor dem Herannahen feindlicher Schiffe gewarnt.
Smilla und Kringle, unsere beiden Ponys, standen schon am Gatter und erwarteten uns. Auf geheimnisvolle Weise ahnten sie immer, wenn es Kleietrank gab. Vielleicht rochen sie den Brei durch das offene Küchenfenster.
Wir machten ihre Eimer halb voll und sie stürzten sich gierig darauf, mampften und schmatzten, dass Blasen und zähe Fäden in ihren Mundwinkeln erschienen. Wie immer war Kringle besonders verfressen. Er verschluckte sich ein paarmal, prustete und spritzte uns mit Kleie voll. Als er fertig war, versuchte er Smilla von ihrem Eimer wegzuschubsen.
»Verschwinde, Krümelmonster!«, sagte ich streng. »Lass Smilla in Ruhe essen! Sie wird sonst wieder sauer auf dich und zwickt dich irgendwann in den Hintern.«
Niko hockte auf dem obersten Gatterbalken. In seinen schwarzen Jeans und dem schwarzen T-Shirt sah er aus wie eine unglückliche Krähe, die die Flügel hängen lässt.
»Mann o Mann, ist mir langweilig!«, murmelte er.
»Geh an den Strand«, schlug ich vor.
»Hab keinen Bock auf das kalte Wasser.«
»Du könntest ausreiten. Mama ist froh, wenn Smilla bewegt wird.«
Er schnitt eine Grimasse. Niko war nicht besonders wild aufs Reiten. Als kleiner Junge war er einmal abgeworfen worden, hatte sich dabei das Schultergelenk ausgerenkt und den Oberarm gebrochen. Seitdem stieg er nur noch selten freiwillig auf ein Pferd.
»Reitest du mit?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich will noch an Svenja schreiben und später treffe ich mich mit Kim.«
Mein Bruder begann an seiner Nase zu zerren, wie meistens, wenn er sauer oder unglücklich war. Niko hasste seine Nase. Sie war etwas zu groß und zu breit für sein Gesicht. Er fand, dass sie sein ganzes Gesicht verunstaltete und verabscheute sie aus tiefstem Herzen.
»Lass deine arme Nase in Ruhe«, sagte ich. »In ein paar Jahren, wenn du älter bist und dein Gesicht größer geworden ist, fällt sie bestimmt nicht mehr auf. Sie ist eben nur schneller gewachsen als der Rest.«
Das sagte unser Vater auch immer. Doch wenn es um seine Nase ging, war Niko untröstlich. »Sie wird weiter wuchern und immer noch abartiger werden«, erwiderte er in düsterem Ton. »Aber eines Tages lasse ich sie operieren, sobald ich die Kohle zusammenhab, ich schwör’s dir!«
»Okay, warum nicht? Wenn du dann glücklicher bist.«
Er folgte mir auf die Terrasse, wo ich mich mit meinem Schreibblock auf die Stufen setzte. Heute war ein langer Brief an meine Freundin Svenja fällig. Gestern hatte ich nur ein paar Zeilen schreiben können, weil meine Eltern mit mir nach St. Austell gefahren waren, um eine Schuluniform für mich zu kaufen.
Eine Schuluniform! Allein schon das Wort war mir verhasst und mein Vorurteil bestätigte sich voll. An der Schule, die ich besuchen sollte, waren für Mädchen kurze blaue Röcke und blaue Blazer vorgeschrieben, dazu eine hellblaue Bluse mit affigem rundem Kragen.
Ich stritt mich mit meinem Vater, weil ich erklärte, kein Mensch könnte mich dazu zwingen, derart ätzende Klamotten zu tragen.
»Ihr wisst genau, dass ich nie einen Rock anziehe!«, sagte ich. »Mit so einem komischen kurzen Schlauch laufe ich nicht herum! Wenn ich sitze, sieht man meine Knie! Und überhaupt, wo gibt’s denn so was, dass einem vorgeschrieben wird, was man anziehen soll?«
»An englischen Schulen ist das eben so.« Paps und ich hatten selten Zoff, aber diesmal funkelten wir uns an wie zwei Hunde, die um einen Knochen kämpfen. »Ich musste auch eine Schuluniform tragen, als ich in deinem Alter war, und es hat mir nicht geschadet. Das Ganze hat durchaus einen Sinn, nämlich den, dass alle Schüler gleich gekleidet sein sollen, damit es keine sozialen Unterschiede gibt. Diesen Markenterror wie in deutschen Schulen gibt es hier zum Glück nicht.«
»Du meinst, man merkt dann keinen Unterschied zwischen armen und reichen Schülern?«, fragte ich.
Paps nickte.
Ich sagte: »Blödsinn! Die Unterschiede gibt es trotzdem. Man merkt doch nicht nur an den Klamotten, ob einer reiche oder arme Eltern hat. Außerdem ist das auch eine Form von Terror, wenn sie einen in eine Uniform stecken.«
Mama versuchte mich zu beruhigen. »So übel sieht die Uniform doch gar nicht aus, Kathi. Und warum soll man deine Knie nicht sehen? Du hast hübsche Knie, finde ich.«
»Sie sind zu knochig. Außerdem finde ich kurze Röcke abartig.«
Mein Vater seufzte tief, schob seine Halbbrille ungeduldig von der Nasenspitze nach oben und musterte mich. »Willst du dein Leben lang mit Jeans und ausgeleierten T-Shirts herumlaufen? Rede mal mit deiner Freundin Kim; die wird genau die gleiche Uniform tragen, wenn die Ferien vorbei sind. Und sie macht deswegen bestimmt nicht so einen Aufstand.«
»Ich mache keinen Aufstand. Hab nur keinen Bock, wie ein verkleideter Affe auszusehen.«
Diese Szene schilderte ich Svenja in meinem Brief. Svenja war meine beste Freundin, zu Hause in unserem Dorf. Wir kannten uns seit dem Kindergarten und wussten alles voneinander. Die Trennung von Svenja war für mich das Schlimmste am ganzen Umzug gewesen. Ich hatte beim Abschied feierlich versprochen, ihr jeden Tag zu schreiben.
Niko sagte: »Mann, was kritzelst du da unentwegt? Hier passiert doch kaum was und du schreibst ganze Romane.«
»Stör mich nicht, ich muss mich konzentrieren.«
In diesem Augenblick kam unser Vater um die Hausecke. »Hilft mir einer, das Gerümpel im alten Stall auszuräumen?«, fragte er. »Übermorgen kommen die Handwerker und decken das Dach neu ein. Wir müssen an den Herbst denken, da kann es stürmisch werden. Die Pferde brauchen einen warmen, geschützten Platz.«
»Stürme!«, brummte Niko. »Ich kann das Wort nicht mehr hören!«
Trotzdem erhob er sich aus dem Liegestuhl und folgte Paps, nachdem ich erklärt hatte, dass ich heute keine Zeit hätte, morgen früh aber beim Räumen mithelfen würde.
»Wo ist eigentlich Niels?«, fragte mein Vater über die Schulter.
Niels ist mein älterer Bruder.
»Den hab ich vor einer Stunde mit dem Feldstecher losziehen sehen«, sagte ich. »Wahrscheinlich ist er irgendwo in den Klippen unterwegs und beobachtet Vögel.«
»Oder Badenixen.« Niko kicherte blöde.
Ich tippte mir an die Stirn. Niels interessiert sich für Vögel und Insekten, aber nicht für Mädchen. Ich klappte meinen Block zu, faltete die vier Briefseiten und steckte sie in einen Umschlag. Morgen konnte ihn der Postbote, der täglich mit dem Auto angetuckert kam, mitnehmen. Der nächste Briefkasten war mehrere Kilometer weit entfernt.
Schnell aß ich ein Stück Toastbrot mit Käse, trank einen Schluck kalten Pfefferminztee und ging dann zur Koppel, um unser Connemara-Pony zu satteln und aufzuzäumen.
Kringle war nicht immer besonders wild auf Ausritte, doch an diesem Nachmittag freute er sich richtig, dass ich ihn holte. Er hatte die Ohren gespitzt und ließ sich bereitwillig die Trense zwischen die Zähne schieben, blähte sich auch nicht auf, als ich den Sattelgurt festzog.
Smilla sah nur kurz zu uns herüber und graste ruhig weiter. Am liebsten stand sie im Halbschatten unter den Bäumen, döste oder mampfte Gras in sich hinein oder beobachtete mit verträumtem Blick die Bienen und Hummeln, die vor ihrer Nase herumschwirrten.
Jetzt kannte ich schon den kürzesten Weg zu den Klippen hinauf; ein Trampelpfad, der inzwischen von Kringles zierlichen Hufspuren gemustert war. Er führte zwischen Hecken und windzerzausten Bäumen über Buckelwiesen und durch Mulden, in denen hohes raues Gras im Wind raschelte. Überall flogen Vögel vor uns auf und schwangen sich in die Luft. Hoch am Himmel segelten Möwen und Albatrosse mit den Luftströmungen dahin.
Das Meer hatte sich nach dem Sturm wieder beruhigt. Ich hörte es nur leise in der Ferne um die Uferfelsen rauschen und murmeln. Zwischen den Wolkenfetzen kam immer wieder die Sonne hervor, doch der Wind war kühl.
Noch war der August zwar nicht vorbei, aber ich hatte hier noch keinen wirklich heißen Sommertag erlebt, so wie zu Hause, wo Svenja jetzt vielleicht gerade an unserem kleinen Badesee lag, zusammen mit unserer alten Clique aus der Schule.
Der Gedanke trieb mir die Tränen in die Augen. Ich war erleichtert, als ich den Klippenpfad erreichte und Kim dort oben warten sah. Sie stand mit dem Rücken zu mir, das Gesicht dem Meer zugewandt, und hielt ihre rostrote Stute Flora am Zügel. Von Weitem sah sie aus wie ein Junge, hochgewachsen und dünn, fast knochig.
Seltsam, ich kannte Kim erst seit wenigen Wochen, und doch erriet ich schon an ihrer Haltung, in welcher Stimmung sie war. Da war etwas an der Art, wie sie den Kopf hielt und die Schultern straffte, was fast so deutlich wie Worte sagte: Lasst mich bloß in Ruhe, ich hasse euch alle!
Zögernd ritt ich auf sie zu. Falls sie wirklich keinen sehen mochte, konnte es passieren, dass sie mich wieder wegschickte. Doch sie war ja gekommen, und das bedeutete wohl auch, dass sie mit mir reden wollte.
Jetzt hob Flora den Kopf und schnaubte. Kringle antwortete mit einem kurzen, hellen Wiehern. Kim aber tat, als hätte sie nichts gehört. Erst als ich Kringle zügelte und mich aus dem Sattel schwang, drehte sie sich um. Ihre goldbraunen Augen waren dunkel vor Zorn. Ich merkte, wie mühsam sie die Tränen zurückhielt.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
Kim stieß einen zitternden Seufzer aus. »Ich muss Flora verstecken!«, sagte sie. »Ich muss sie in Sicherheit bringen. Hilfst du mir dabei?«
2
»Ich hab’s dir doch gesagt, Duncan sieht nichts ein!« Kim presste ihre geballte Faust gegen die Zähne und biss sich auf die Fingerknöchel.
»Ich dachte, er hätte was kapiert. Meine Mutter hat doch mit Engelszungen auf ihn eingeredet.«
»Das nützt nichts. Im Gegenteil, er schaltet erst recht auf stur, wenn ihm jemand eine Predigt hält.«
Ich streichelte Floras Nase, ihre weichen Nüstern. »Aber ihr Gelenk ist wieder verheilt, die Schwellung ist zurückgegangen. Kann’s nicht sein, dass er einfach nur ganz normal mit ihr ausreiten will?«
Ich redete Englisch mit Kim. Mein Vater war Engländer und hatte mit mir und meinen Brüdern immer Englisch gesprochen, als wir noch klein waren, sodass es unsere zweite Muttersprache war. Das machte jetzt nach dem Umzug manches leichter für uns.
»Ganz normal mit ihr ausreiten?« Kim schnaubte verächtlich »Du kennst Duncan nicht … «
Es stimmte, ich hatte Kims Bruder erst zweimal gesehen und beide Male hatte ich ihn ätzend gefunden. Er war hochnäsig und ekelhaft unhöflich, aber was am schlimmsten war, er ging brutal mit Flora um. Kim hatte mir erzählt, dass er die Stute rücksichtslos behandelte und sie durch die Gegend hetzte, bis sie völlig ausgepumpt war.
Ich hatte selbst erlebt, wie Flora sich vor Kims Bruder fürchtete. Von ihrem letzten Ausritt mit Duncan war Flora mit einer Gelenkentzündung zurückgekommen. Meine Mutter, die eine leidenschaftliche Pferdenärrin ist, hatte Duncan versucht klarzumachen, dass er anders mit Flora umgehen musste.
»Er sagt, Flora ist lange genug verzogen und geschont worden und jetzt müsste sie mal wieder was für ihren Unterhalt tun. Einer seiner ekelhaften Freunde ist zu Besuch gekommen. Der hat ein Motorrad. Und stell dir vor, Duncan wollte ein Wettrennen mit ihm veranstalten – er auf Flora und Keith auf seinem Motorrad! Da bin ich mit Flora abgehauen … «
Sie wandte das Gesicht ab. Ihre Schultern zuckten. Ich wusste, dass sie weinte. Vorsichtig strich ich ihr mit der Hand über den Rücken.
»Mann, wie kann einer bloß auf so eine abartige Idee kommen!«, murmelte ich.
»Flora wäre bestimmt gestürzt und hätte sich ein Bein gebrochen. Es wäre der Horror für sie gewesen. Du weißt ja, was für eine Panik sie vor Duncan hat, er muss sie jedes Mal gewaltsam dazu zwingen, sich von ihm reiten zu lassen. Und sie fürchtet das Geknatter von Motorrädern. Sicher wäre sie durchgegangen … Für Duncan wär’s eine Lektion, ich wäre froh, wenn er sich endlich seinen arroganten Hals brechen würde! Aber Flora –«
Schnell sagte ich: »Du kannst sie zu uns bringen. Mama ist bestimmt einverstanden. Bei uns ist sie sicher.«
Kim drehte sich wieder um. Ihr Gesicht war nass von Tränen. Sie schüttelte den Kopf. »Das dachte ich anfangs auch, aber es geht nicht. Duncan wird als Erstes bei euch auftauchen und nach ihr suchen. Er weiß doch jetzt, dass wir befreundet sind, und deine Mutter hat mit ihm gesprochen. Und ein Pferd kann man nicht so leicht verstecken.«
Sie hatte recht, das sah ich ein. Diesmal fragte ich nicht, ob sie ihre Eltern um Hilfe bitten konnte. Sie hatte mir schon einmal erzählt, dass ihr Vater es hasste, wenn sie ihn mit ihren Problemen belästigte. Ihre Mutter, der Flora eigentlich gehörte, vergötterte Duncan und fand alles gut und richtig, was er tat.
Kim schniefte in das Taschentuch, das ich ihr gab. Flora, die unsere Aufregung spürte, tänzelte unruhig hin und her, während Kringle mit hängendem Kopf döste.
»Ich hab an das verfallene Haus gedacht, das am Fuß des Hügels steht«, murmelte Kim. »Aber der Stall ist total baufällig und das Haus auch. Es wäre zu gefährlich für sie. Und Duncan ist nicht dumm. Wahrscheinlich käme er ziemlich schnell auf die Idee, dort nachzusehen.«
Einige Zeit brüteten und grübelten wir heftig. Kringle langweilte sich so, dass er versuchte an meinem Poloshirt zu kauen. Schließlich sagte Kim in finsterem Ton: »Vielleicht ist es am besten, ich haue richtig ab. Zusammen mit Flora natürlich.«
Ich erschrak. Mein erstes Gefühl war ziemlich selbstsüchtig: Ich fürchtete, Kim zu verlieren. Ohne sie wäre mir Cornwall wie ein öder, trübseliger Ort vorgekommen.
»Tu das bloß nicht!«, rief ich. »Das geht doch nicht, wohin willst du mit dem Pferd? Oder kennst du jemanden, bei dem ihr bleiben könnt?«
Sie schüttelte den Kopf. Jetzt sah sie noch unglücklicher aus als zuvor.
»Nein, keinen. Aber wir würden schon irgendwo ein verlassenes Haus finden. Nur … ich hab kein Geld. Und Flora braucht ihren Hafer und ihre Karotten. Jetzt kommt bald der Herbst, dann gibt es auch nicht mehr genug Gras … «
»Und du musst schließlich auch was essen! Aber warte mal, ich hab eine Idee: Hast du schon an Robin Hood gedacht?«
Kim wusste sofort, wen ich meinte. »Stevie? He, wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Stevie Trelawny von Little Eden – ja, das ist es!«
Plötzlich waren ihre Augen wieder klar und ihr Mund entspannte sich. Lächelnd sahen wir uns an. »Meinst du, dein Bruder denkt nicht daran, in Little Eden nach Flora zu suchen?«
»Möglich wär’s, aber Stevie würde ihn nicht auf seinen Hof lassen. Eher würde er ihm mit der Flinte seines Vaters eine Ladung Schrot in den Hintern jagen.« Ihr Gesicht heiterte sich richtig auf. »Wir reiten sofort hin! Du kommst doch mit?«
»Aber es ist ziemlich weit.« Ich sah auf meine Uhr. »Und jetzt ist es schon fast vier. Meine Eltern drehen durch, wenn ich nicht rechtzeitig zum Abendessen zurück bin.«
»Blödsinn, von wegen weit! Über den Klippenpfad brauchen wir nicht mal eine Stunde. Ihr seid ja mit dem Auto von Ravensnest nach Little Eden gefahren. Das ist ein totaler Umweg, da man erst mal zur Landstraße fährt, die nach Polperro führt, und dann wieder zurück zur Küste.«
Ich traute Kims Einschätzung von Entfernungen nicht recht. Was sie eine kurze Strecke nannte, entpuppte sich meistens als langer, anstrengender Ritt, und Kringle hielt nichts von solchen Gewalttouren.