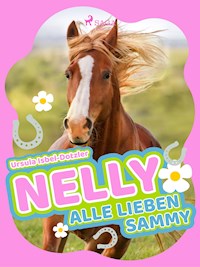Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Flora soll verkauft werden! Kim ist am Boden zerstört, und versucht mit allen Mitteln, den Verkauf ihrer geliebten Stute zu verhindern. Doch nichts scheint zu helfen. In ihrer Verzweiflung versteckt sie sich mit dem Pferd in einem alten Geisterhaus, als ein verheerender Sturm die Küste Cornwalls heimsucht. Kann jetzt nur noch Kathi helfen?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel-Dotzler
Sturm über Ravensmoor
SAGA Egmont
Sturm über Ravensmoor
Copyright © 2008, 2018 Ursula Isbel-Dotzler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711804452
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
»Seit du hier bist, fühle ich mich in der Schule nicht mehr wie der letzte Brüllaffe«, sagte Kim bei einem unserer Ausritte über den Klippenpfad. Dabei sah sie mit ihrem Späherblick übers Meer, als hätte sie weit draußen über den grauen, gischtgekrönten Wogen etwas entdeckt.
Brüllaffe! Ich lachte, aber Kim musterte mich beinahe strafend und fügte hinzu: »Das ist nicht witzig, Kathi, echt nicht. Du ahnst nicht, wie ich die Schule gehasst habe. Sie haben sich über mich lustig gemacht und hinter meinem Rücken über mich getuschelt. »HRH, Her Royal Highness«, haben sie mich immer genannt, so als wär ich Prinzessin Anne. Ich hab’s oft genug gehört.«
»Blödes Volk«, murmelte ich.
»Jetzt lassen sie mich wenigstens in Ruhe.« Kim zog sich die Wollmütze tiefer über die Ohren. Sie trug nie einen Reithelm.
Ich wischte die Nasentröpfchen ab, die sich dauernd unter meiner Nasenspitze sammelten. »Versteh ich nicht«, murmelte ich. »Dabei bist du echt nicht hochnäsig. Meine Mutter meint, die Leute sind einfach unsicher, wenn’s um den Hochadel geht. Vielleicht fühlen sie sich unterlegen und benehmen sich deshalb so komisch.«
»Ich hab ihnen nie einen Anlass dazu gegeben, weil ich mir nicht vorkomme, als wär ich was Besseres. Das bin ich auch nicht. Im Grund hab ich die anderen immer um ihr ganz gewöhnliches Leben in normalen, einfachen Häusern beneidet, wo man nicht ständig fürchten muss, dass das ganze Gemäuer über einem zusammenkracht.«
Ravensmoor, der Stammsitz von Kims Familie, war wirklich kein gemütlicher Wohnort. Von der einst so mächtigen Burg war kaum mehr geblieben als eine Ruine. Die Ravensmoors lebten in einem Nebengebäude, das früher die Bediensteten bewohnt hatten. Es stand inmitten von bröckelnden Steinen und geborstenen Mauern.
Meine Familie war im Sommer in Ravensnest eingezogen, in das Haus meiner Großmutter. Jetzt, in unserem ersten Winter in Cornwall, gab es kaum richtigen Frost. Doch tagaus, tagein fegten eiskalte Winde übers Meer und die Küste, rüttelten an Grannys Haus und trieben die Mähnen und Schweife unserer Ponys steil in die Luft. Wenn wir ritten, tränten unsere Augen, unsere Nasen liefen, die Lippen wurden blau und unsere Finger erstarrten in den Handschuhen zu Eiszapfen.
Mama bestand darauf, dass die Ponys Kringle und Smilla täglich bewegt wurden, obwohl mein Bruder Niko und ich jetzt nur noch wenig freie Zeit hatten. Im Herbst hatte die Schule begonnen; eine Privatschule, an der fast alles neu für mich war, von der affigen Schuluniform bis hin zum Notensystem.
Zum Glück hatte ich Kim zur Freundin. Ohne sie wäre ich mir in diesen ersten Wochen und Monaten an der englischen Schule total verloren vorgekommen.
Anfangs hatten sich alle um mich gerissen. Sie wollten wissen, wo ich früher in Deutschland gelebt hatte und warum wir hierhergezogen waren. Sie wunderten sich darüber, dass ich so gut Englisch sprach, und fragten nach meinen Brüdern. Doch weil Kim eine Außenseiterin war, wurde auch ich nie wirklich in eine der Cliquen aufgenommen.
Das machte mir nichts aus. Kims Freundschaft reichte mir, sie war mir wichtiger als alles andere. Wir saßen nebeneinander und verbrachten die Pausen gemeinsam. Morgens fuhr Mama Niko und mich zum Schulbus. Kim sammelten wir an der Wegkreuzung auf.
Die Möwen kreisten über den felsigen Buchten. Ihr Kreischen klang wie höhnisches Gelächter. Eine Windbö fegte über die Klippen und warf uns einen Schauer nadelspitzer, beißend kalter Regentropfen ins Gesicht.
Offenbar fand Kringle, unser Connemarapony, dass es jetzt mit der Bewegung an frischer Luft reichte. Er drehte sich mit einem so plötzlichen Ruck um, dass ich zur Seite kippte und mich gerade noch rechtzeitig am Sattel festklammern konnte.
Kim zog mich am Ärmel meiner Windjacke hoch. Ich hörte ihr sprödes, jungenhaftes Lachen.
»Er will nach Hause!«, schimpfte ich. »Kringle, du alte Socke! In Zukunft reite ich nur noch mit Smilla aus. Mama soll selbst schauen, wie sie mit deinen Launen klarkommt.«
Er versuchte den Klippenpfad hinunter zu galoppieren, aber jetzt zügelte ich ihn. »Nur benimmt er sich bei Mama meistens wie ein Engel. Ist das nicht komisch? Er denkt, mit mir kann er machen, was er will.«
»Kann er ja auch.« Kim folgte uns auf ihrer rostroten Stute Flora. »Tiere sind total klug. Sie verhalten sich bei jedem Menschen anders, hast du das noch nicht bemerkt?«
Ihre Stimme veränderte sich. Obwohl ich ihr den Rücken zuwandte, hätte ich ihr Gesicht genau beschreiben können: ihre Augen, die vom Goldbraun ins Schwärzliche wechselten, als wäre eine Gewitterwolke über sie hinweggezogen, ihre Brauen, die über der Nasenwurzel fast zusammenstießen.
»Und sie sind gute Menschenkenner. Flora war Duncan gegenüber vom ersten Tag an misstrauisch. Noch ehe sie ihn überhaupt richtig kannte, ist sie schon vor ihm zurückgescheut und wollte sich nicht anfassen lassen.«
Duncan war Kims Bruder. Sie hasste ihn, sogar jetzt noch, wo er im Krankenhaus lag und sich nur mit Krücken vorwärtsbewegen konnte. Vielleicht würde sie ihm nie verzeihen, wie brutal er mit Flora umgegangen war. Das war wohl Kims keltisches Erbe. Die Kelten sind nachtragend und rachsüchtig, sagt mein Vater immer.
An Kims Verhältnis zu Duncan hatte sich auch nach seinem schweren Motorradunfall im Herbst nichts geändert. Aber ihre Abneigung hatte sicher nicht nur mit Flora zu tun. Duncan war der verwöhnte Liebling seiner Mutter und wurde als Erbe des Herzogtitels von jeher viel mehr geschätzt als Kim. Dabei war sie hundertmal klüger, warmherziger und anständiger als er.
»Wie lange muss er noch in der Klinik bleiben?«, fragte ich vorsichtig. Duncan war Kims wunder Punkt. Ich passte immer auf, was ich sagte, wenn es um ihn ging.
»Hoffentlich noch Monate. Jetzt wartet er auf eine Art Schönheitsoperation. Sein Nasenbein ist mehrfach gebrochen und seine Kinnlade und seine Oberlippe waren total zerschnitten.«
Ich glaubte zu hören, wie sie heftig den Atem einzog. Aber vielleicht war das auch nur der Wind, der mir unter die Kapuze fuhr. »Am besten wär’s, er käme nie wieder nach Ravensmoor zurück!«
»Glaubst du denn, dass er je wieder reiten kann?«
»Keine Ahnung. Maman überlegt, ob sie Flora verkaufen sollen. Mein Vater hat ihr die Stute ja geschenkt, aber sie reitet nicht gern. Eigentlich hat sie Flora nur wegen Duncan behalten.«
»Aber das können sie nicht machen! Du liebst Flora, du kümmerst dich um sie, sie ist dein Pferd … «
»Daran denken sie nicht. Angeblich ist Flora zu teuer. Das Futter, die Kosten für den Tierarzt und so weiter. Du weißt ja, wir haben nichts als Schulden. Duncans Behandlung kostet ein Vermögen. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie Flora verkaufen. Wenn es sein muss, bringe ich sie wieder weg. Oder ich verschwinde mit ihr. Irgendwas fällt mir schon ein, falls es so weit kommt.«
Einfallsreich war Kim und unerschrocken dazu, das stimmte. Im Herbst hatte sie Flora von Ravensmoor weggebracht, um sie vor Duncan zu schützen, und auf Little Eden versteckt. Allerdings war ihr das nur mit Mamas und meiner Hilfe gelungen – und natürlich vor allem mit Stevie Trelawnys Unterstützung.1
2
Ich kann nicht behaupten, dass ich gern in die neue Schule ging. Natürlich hatte ich Schwierigkeiten mit dem Unterrichtsstoff. In einigen Fächern, zum Beispiel in Geografie, war ich voraus. In anderen wieder hinkte ich hoffnungslos hinterdrein.
So beschränkten sich meine Kenntnisse in englischer Geschichte auf ein paar Figuren wie Heinrich den Achten, der zwei seiner Frauen hinrichten ließ, und seine berühmte Tochter Elizabeth. Von Königin Victoria wusste ich, dass sie mit Albert, einem deutschen Prinzen, verheiratet gewesen war, den sie abgöttisch geliebt hatte. Sie trug nach seinem Tod nur noch schwarze Kleider und war total pummelig, mit hervorstehenden Fischaugen und Hängebacken.
Mein Vater gab mir einen dicken Wälzer über die Geschichte Englands. Doch er war so knochentrocken und schnarchlangweilig geschrieben, dass ich es nicht schaffte, mich durchzubeißen. Schon nach den ersten beiden Kapiteln gab ich entnervt auf.
Zum Glück hatte Mr Wall, unser Geschichtslehrer, Mitleid mit mir. Er besorgte mir ein paar Videofilme, in denen die wichtigsten Ereignisse und historischen Gestalten witzig und spannend vorgestellt wurden.
Dafür sollte ich einen Vortrag über Hitler und die NSZeit in Deutschland halten. Natürlich hatten wir zu Hause in meiner alten Schule einiges darüber gelernt und auch Filme dazu gesehen. Als ich aber daranging, den Vortrag vorzubereiten, merkte ich, wie wenig ich wusste.
Mama half mir. Sie holte ein paar Geschichtsbücher aus ihrem Regal und setzte sich einen Nachmittag lang mit mir zusammen. Wir überlegten, wie ich den Vortrag aufbauen und abfassen sollte.
»Eigentlich schäme ich mich«, sagte ich zu ihr. »Paps ist zwar Engländer, aber ich bin doch zur Hälfte Deutsche. Die Deutschen haben englische Städte bombardiert und Leid und Elend über Millionen Menschen gebracht.«
»Dafür schäme ich mich auch«, erwiderte Mama ernst. »Obwohl ich nichts damit zu tun hatte, sondern die Generation meiner Eltern und Großeltern. Aber es geht gar nicht darum, sich für etwas schuldig zu fühlen oder zu schämen. Es geht darum, zu erkennen, was falsch gemacht wurde. Wir dürfen nicht die Augen vor dem verschließen, was passiert ist, damit es sich nicht wiederholen kann – weder in Deutschland noch sonst wo auf dieser Welt.«
Ich beschloss, genau das in meinem Vortrag zu sagen. Es lief auch ganz gut. Hinterher hatten wir eine Gesprächsrunde, bei der ein Junge sagte, er habe bisher ziemlich schlecht von den Deutschen gedacht. Jetzt sei ihm klar geworden, dass man die Verbrechen der Hitlerzeit nicht den jungen Deutschen zur Last legen dürfe.
»Aber es gibt doch noch immer eine rechtsradikale Szene in Deutschland!«, wandte ein Mädchen ein.
»Die gibt es bei uns auch«, sagte Mr Wall ruhig. »Rechtsradikale gibt es leider überall.«
In der Pause kam Keith zu mir, ein Junge, der bisher noch nie mit mir gesprochen hatte. Er sagte, sein Großvater sei bei der Royal Air Force gewesen.
»Er flog im Krieg bei den Angriffen auf deutsche Städte mit. Mein Granddad meint, wir Engländer hätten uns auch nicht gerade mit Ruhm bedeckt, als wir Dresden in Schutt und Asche legten und Brandbomben auf unschuldige Menschen abwarfen. Er fühlt sich deswegen heute noch schuldig, weißt du. Granddad hat auch Geld für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche gespendet.«
Nach diesem Tag ging es mir irgendwie besser in der neuen Schule. Mein Bruder Niko hatte mehr Stress als ich. Für ihn gab es keine Kim, die neben ihm saß. Er war völlig fremd in seiner Klasse und musste erst Freunde finden. Im Schulbus war er immer mit Kim und mir zusammen. Keiner kümmerte sich um ihn oder rief ihm etwas zu, wenn wir ein- oder ausstiegen.
»Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause!«, sagte er jeden Tag mindestens einmal.
Auch ich hatte ab und zu Anfälle von Heimweh. Ein Teil von mir sehnte sich noch immer nach unserem kleinen Dorf mit den vertrauten Menschen, vor allem nach meiner Freundin Svenja.
Mama mahnte Niko zur Geduld. »›Gut Ding will Weile haben‹, hat eine von meinen Tanten immer gesagt. Plötzlich findest du einen Freund oder eine Freundin, dann löst sich der Knoten von allein.«
Doch ich merkte, dass sie sich Sorgen um ihn machte. Er war richtig schlecht drauf, hatte »voll die Krise«, wie er das selbst nannte. Dazu kam, dass ihm Niels fehlte, unser ältester Bruder, der Dritte im Bund. Dabei waren die beiden nicht gerade immer ein Herz und eine Seele gewesen. Seit Niels auf ein englisches College ging und nur noch manchmal übers Wochenende nach Cornwall kam, wurde ihm von der ganzen Familie ein Glorienschein verpasst.
Insgeheim hoffte ich darauf, dass er eines Tages mit seinem Rucksack vor der Tür stehen und sagen würde: Das passt mir alles nicht, es ist einfach zu eng für mich mit all den Typen, die ständig um mich herumschlappen.«
Denn das hatte Niels im Herbst angekündigt: dass er zurückkommen würde, falls es ihm auf dem College nicht gefiele.
Doch es schien ihm zu gefallen. Am vorletzten Novemberwochenende holte ihn Mama vom Bus ab. Er schwärmte den ganzen Abend lang von einem Professor, der Vorlesungen über die Geschichte und Glaubensvorstellungen der Kelten hielt.
»Keltenforscher, das wäre ein Beruf, der mich reizen könnte!«, sagte er.
Mama fragte ihn, wie er damit seinen Lebensunterhalt verdienen wolle. Ich saß neben Niels auf dem Sofa und war glücklich, dass ich wieder seine Stimme hörte, die vertrauten Bewegungen seiner Hände sah, seine Haare, die gewachsen waren und die er im Nacken mit einem Lederband zusammengefasst hatte. Am liebsten hätte ich ihn irgendwo festgebunden, damit er nie wieder von uns fortgehen konnte.
Schließlich erkundigte er sich, wie es Stevie Trelawny ging.
Seine Frage war eindeutig an mich gerichtet. Ich ärgerte mich, weil ich merkte, dass ich rot wurde.
»Ganz okay«, sagte ich möglichst cool. »Glaub ich wenigstens. Ich hab ihn ungefähr zwei Wochen lang nicht gesehen.«
Eigentlich wusste ich es genau. Es waren zwölf Tage, seit ich ihn mit Kim in seinem kleinen privaten Tierheim auf Little Eden besucht hatte. Jetzt im Winter war es schwierig hinzukommen.
Wir konnten die weite Strecke weder reiten noch mit dem Rad zurücklegen und eine direkte Busverbindung gab es nicht. Stevie telefonierte auch nur, wenn es unbedingt nötig war. Ich war nie sicher, ob er sich freute, wenn man ihn anrief.
»Ich dachte, ich fahre morgen mal bei ihm vorbei«, sagte Niels.
»Nimm eine Tüte Pellets für die Pferde mit.« Das kam von Mama. »Und Hafer. Der arme Junge weiß ja kaum, wie er alle seine Tiere ernähren soll. Ich wollte, er würde Geld von uns annehmen. Diese ständigen Ausgaben für das viele Futter und den Tierarzt … Wenn er sich nur mehr helfen lassen würde!«
»Er ist zu stolz«, sagte ich.
Ja, das war er, Stevie Trelawny von Little Eden. Ich kannte keinen, der so stolz war wie er. Und es gab auch keinen, den ich mehr bewunderte. Nicht nur weil er aussah wie ein moderner Robin Hood, sondern weil er sich so für Tiere einsetzte, die sonst keiner haben wollte. Weil er all die verletzten, kranken, alten, verstoßenen Vierbeiner, die zu ihm gebracht wurden, liebevoll aufpäppelte und versorgte und ihnen ein geschütztes Zuhause gab.
»Stevie ist ein wunderbarer Junge!« Mamas Stimme klang fast schwärmerisch.
Paps lachte und sagte: »Gut, dass er so jung ist, sonst würde ich eifersüchtig werden.« Und Mama lachte zurück.
»Ja, das müsstest du wohl, Erik.«
Niko zerrte an seiner Nase. »Insgeheim hast du dir natürlich immer einen Sohn wie Stevie gewünscht, gib’s zu«, murmelte er.
Obwohl er dabei grinste, hatte ich den Verdacht, dass er es nicht witzig meinte. Mama sah ihn an. »Ich bin ganz zufrieden mit dir und Niels. Meistens jedenfalls.«
»Lass deine Nase in Ruhe!«, mahnte Paps. Es kam fast schon automatisch, er sagte das täglich mindestens dreimal zu Niko.
»Mit meiner Nase kann ich machen, was ich will!«
Ich musste aufpassen, dass ich nicht lachte. Wenn es um seine Nase ging, war Niko empfindlich. Er nannte sie »das Knollengewächs« und hasste sie aus tiefstem Herzen.
Mama versprach Niels, dass er ihr Auto haben konnte, wenn er nach Little Eden fuhr. Sie hatte sich im Oktober einen gebrauchten Mini Cooper gekauft. Paps fuhr täglich mit unserem alten Volvo nach Exeter in die Uni, und wir wohnten so abgelegen, dass wir ohne ein Zweitauto nicht ausgekommen wären.
»Aber fahr vorsichtig!« Das war Paps. »Du hast den Führerschein erst seit Kurzem. Denk an Duncan Ravensmoor … «
»Ich brettere nicht wie ein Geistesgestörter durch die Gegend, das müsstest du eigentlich wissen.«
»Du kannst Niels echt nicht mit Kims Bruder vergleichen, diesem aufgeblasenen, tierquälerischen Wicht«, sagte ich.
»Vielleicht hat er sich durch den Unfall verändert.« Mama war aufgestanden. »Hilft mir einer die Pferde zu füttern?«
Niels sagte, er sei froh, mal etwas tun zu können, wobei man die Nase nicht in Bücher stecken musste. Ich folgte den beiden, weil ich jede Minute ausnützen wollte, die ich mit Niels zusammen sein konnte.
Der stämmige braune Kringle und Smilla, das helle Norwegerpony, standen im Gebüsch. Sie steckten die Köpfe zusammen und wendeten ihre prallen Hinterteile dem kalten Seewind zu.
Smillas weizenblonde Mähne flatterte steil nach oben. Mama rief nach ihnen, in diesem lockenden, zärtlichen Ton, der nur den Ponys galt. Sie kamen sofort und stürzten sich auf ihre Futtereimer, voran Kringle. Er war unglaublich verfressen und schlang immer alles in Rekordzeit in sich hinein, weil er hoffte, er könnte Smilla anschließend noch von ihrem Eimer verdrängen.
Über den Baumwipfeln, die sich jetzt kahl und schwarz gegen den Himmel abzeichneten, ragte der Eckturm von Ravensmoor auf. Dohlen und Krähen umkreisten ihn und ließen sich vom Wind tragen. Die Luft war erfüllt von ihrem Krächzen und ihrem harten Tschäk-Tschäk-Geschrei.
Ravensmoors Turm war der höchste Punkt weit und breit. Von dort oben konnte man den ganzen Küstenstrich bis hinunter nach Land’s End überschauen. Einst hatten auf dem Turm Wächter gestanden, um Burgherrn und Küstenbewohner vor dem Herannahen feindlicher Schiffe zu warnen.
Niels hob den Kopf. In das Schmatzen der Ponys und das Pfeifen des Windes mischte sich Hufgetrappel.
»Feindliche Indianer!«, murmelte er.
Ich musste lachen. Die Ponys hoben ihre Nasen aus den Eimern und wieherten. Von der anderen Seite der Hecke erklang Antwortgewieher, hell und durchdringend wie ein Trompetenstoß.
Hinter dem kahlen Gestrüpp wehte eine fuchsfarbene Mähne, verschwand und tauchte wieder auf. Ich wusste, dass es Flora war, noch ehe ich ihren schmalen, edlen Kopf sah.
Kim saß im Sattel, über den Hals ihrer Stute gebeugt wie eine Springreiterin. Einen Moment lang glaubte ich, sie würden über die Hecke hinwegsetzen, die mehr als mannshoch war, doch sie ritten weiter zur Auffahrt. Vielleicht hatte Kim uns nicht einmal bemerkt.
Während ich mich umwandte, um ihnen entgegenzulaufen, hörte ich Mama sagen: »Da ist irgendwas passiert, darauf wette ich.«
Ich erreichte die Garage, als Kim sich aus dem Sattel schwang. Ja, die Zeichen standen auf Sturm, denn ihre Augen waren fast schwarz. Ihre Füße in den Gummireitstiefeln berührten den Boden und sie stolperte.
»Was ist los?«, fragte ich.
Sie atmete stoßweise. Die Stute schnaubte angstvoll. Kims Hand zitterte, als sie ihr über die Flanke strich. »Meine Eltern haben beschlossen Flora zu verkaufen!«
3
Wir saßen im Wohnzimmer und hielten Kriegsrat, wie mein Vater das genannt hätte. Für Niko war es »das große Palaver«. Er, Mama, Kim, Niels und ich saßen um den Tisch herum. Die Lampe brannte, ich hatte Tee gekocht. Eine Schale voller Softies, süße Rosinenbrötchen, die Granny gebacken hatte, stand in der Mitte. Alles wirkte sehr gemütlich, aber das war es nicht. Es war überhaupt nicht gemütlich.
Kim weinte. Das allein verriet mir, wie ernst die Lage war. Sie hätte nie vor anderen geweint, höchstens vielleicht vor mir, wenn sie nicht wirklich verzweifelt gewesen wäre.
Nikos Gesicht zeigte sein Unbehagen. Niels saß abwartend da, für ihn sind Tränen etwas ganz Natürliches. Er findet, dass die Menschen zu wenig weinen. Mama sagte: »Vielleicht überlegen sie es sich noch. Sie wissen doch, wie sehr du an Flora hängst – spätestens seit Oktober, als du sie vor Duncan in Sicherheit gebracht hast.«