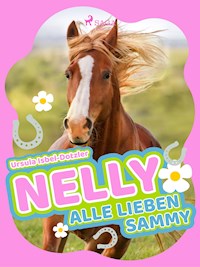Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Von einem Schulfreund erfahren Kathi und Kim von einem Tierquäler, der sein Pferd vernachlässigt und schlägt. Natürlich muss sofort etwas unternommen werden! Mithilfe von Stevie, dem Tierschützer, und Kathis Mutter können die beiden Mädchen das misshandelte Pferd, eine schöne Schimmelstute, sogar retten. Doch ist es für das schwer verletzte Pferd schon zu spät?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel-Dotzler
Pferdeglück auf Ravensmoor
SAGA Egmont
Pferdeglück auf Ravensmoor
Copyright © 2009, 2018 Ursula Isbel-Dotzler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711804469
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
Ich brütete in meinem Zimmer über einer ekelhaften Ansammlung von Zahlen für den Mathe-Unterricht. Irgendwie bildeten sich lauter Knoten und Knubbel in meinem Kopf, während ich die Aufgabenstellungen durchlas. Ich raufte mir die Haare und dachte verzweifelt: Das kapiere ich nie im Leben, nicht, wenn ich hundert Jahre alt werde – und wozu die ganze Kacke?
Mittendrin wurde an meine Tür geklopft. Es war Mama. Sie sagte: »Stevie hat angerufen, Kathi.«
Obwohl ihr Gesicht außerhalb des Lichtscheins war, den meine Schreibtischlampe verbreitete, merkte ich am Ton ihrer Stimme, dass es keine guten Nachrichten gab.
»Es ist Pepper«, fügte sie hinzu. »Er liegt im Stall und will nicht mehr aufstehen. Und er atmet so schwer, sagt Stevie.«
Ich sprang auf. Pepper, das liebe alte Zirkuspony, das auf Stevies Hof Little Eden sein Gnadenbrot bekam, das immer so geduldig und dankbar für jeden Leckerbissen, jedes gute Wort war …
»Wir fahren hin!«, rief ich. »Kommt der Tierarzt?«
»Bestimmt, aber es wird dauern. Dr. Muir operiert gerade einen Hund, der überfahren worden ist.«
Es war schon dunkel, aber Mama wäre auch nachts durch den Urwald gebrettert, wenn es darum ging, Stevie und einem kranken Pferd zu helfen.
Während wir die schmale Zufahrt zwischen den Hecken zur Landstraße hinunterholperten, fragte ich: »Hast du was mitgenommen, was du Pepper geben kannst?« Denn in unserer Hausapotheke gab es jede Menge pflanzliche Heilmittel und homöopathische Globuli, mit denen Mama uns und die Pferde bei leichteren Krankheiten behandelte.
Sie nickte. »Es gibt ein gutes Mittel, um Unruhe und Schmerzen bei kranken alten Tieren zu lindern. Leider hilft es nicht in jedem Fall. Zur Sicherheit hab ich auch noch Baldrian- und Melissentropfen eingepackt.«
Eine Weile fuhren wir schweigend durch die stürmische Nacht. Selbst durch die geschlossenen Wagenfenster und über das Brummen des Motors hinweg hörten wir das Meer gegen die Uferfelsen branden.
Unser zweiter Frühling in Cornwall war wieder mit stürmischen Winden gekommen. Tag und Nacht brausten und sangen sie rastlos ums Haus, schüttelten die Baumwipfel und wühlten das Meer auf, dass die Wellenbrecher gegen die Küste tosten. Doch es kam kein schwerer Sturm mehr, wie wir ihn im Winter erlebt hatten.1
»Dem Himmel sei Dank!«, sagte Granny, die ihr ganzes Leben hier verbracht hatte. Ihr Großvater war mit seinem Schiff bei einem solchen Sturm vor der Küste untergegangen, mit Mann und Maus, wie es in der Seemannssprache heißt.
Niko, mein jüngerer Bruder, fand das cornische Wetter ätzend. Doch abgesehen von den Stürmen mochte ich die häufig wechselnden Stimmungen, die prickelnde Luft und den Wind, der einem die salzige Gischt ins Gesicht sprühte und Wolkengebirge vor sich hertrieb. Vielleicht hatte ich diese Vorliebe von meinem Vater geerbt. Er war hier in Cornwall geboren und aufgewachsen. Ich glaube, er hatte in den zwanzig Jahren, die er in Deutschland verbrachte, immer Sehnsucht nach seiner Heimat und dem Meer gehabt.
Vor mehr als eineinhalb Jahren war er hierher zurückgekehrt und wir waren mitgekommen. Eigentlich hatten Mama und ich und meine Brüder Niels und Niko nicht von unserem Zuhause und unseren Freunden fortgewollt. Es hatte Streit und Kämpfe und Tränen gegeben, ehe wir uns mit Sack und Pack und unseren beiden Ponys auf die lange Reise machten.
Inzwischen hätte ich nicht mehr sagen können, wo ich lieber sein wollte: wieder zu Hause in unserem kleinen Dorf in Deutschland oder hier in Cornwall, am Meer; einem Land, das so schön und romantisch war, dass hier Filme gedreht wurden und jeden Sommer massenhaft Touristen kamen.
Während Mama konzentriert auf die Straße sah, dachte ich an Stevie und all die Tiere, die in seinem privaten Tierheim eine behütete Zuflucht gefunden hatten, und an Pepper und Cinnamon, die beiden Zirkusponys. Sie waren nach einem anstrengenden, kargen Leben in einem Wanderzirkus erschöpft und krank nach Little Eden gekommen und von Stevie liebevoll hochgepäppelt worden.
Irgendwann sagte Mama leise: »Pepper ist in den letzten Wochen und Monaten so klapperdürr geworden, das arme Kerlchen …«
Dann schwieg sie wieder. Als wir zum alten Seemannsfriedhof kamen, der auf einer Felsnase hoch über dem Meer lag, erinnerte ich mich, wie sehr ich mich sonst immer freute, wenn ich nach Little Eden kam.
Jetzt hatte ich zum ersten Mal Angst vor dem, was uns dort erwartete.
2
Ich hatte Stevie nie zuvor weinen sehen.
Im Schein der Lampe, die über der Haustür brannte, war sein Gesicht rot und verschwollen. Die Tränen liefen ihm nur so über die Wangen. Er versuchte nicht sie zu verbergen, fuhr sich nur mit dem Handrücken über die Nase und murmelte: »Danke, dass ihr gekommen seid!«
Erst jetzt wurde mir richtig klar, wie schlimm es um den alten Pepper stehen musste. Wir gingen über den Hof, begleitet von Stevies drei Hunden. Sie schienen zu spüren, dass Unheil in der Luft lag, denn sie begrüßten uns nicht wie sonst mit lautem Gekläff und freudigen Sprüngen. Sie ließen die Köpfe hängen und drängten sich dicht an Stevies Beine.
Im Stall verbreitete eine einzige Lampe ihr trübes Licht. Bei unserem Eintritt wieherte Cinnamon leise und angstvoll. Sie hatte ihre rotbraune Nase über die Trennwand zur Nachbarbox gestreckt, wo der graue Wallach in der Streu lag, die steifen alten Beine von sich gestreckt. Stevie hatte Kissen unter seinen Kopf und seine Schulter gelegt, wohl, um ihm das Atmen etwas zu erleichtern.
Es war schlimm, Peppers schwere, rasselnde Atemzüge zu hören. Sie klangen, als wäre eine Art Dampflokomotive in seiner Brust. Er hatte die Augen halb geschlossen. Seine Flanken hoben und senkten sich wie ein Blasebalg.
Tränen stiegen mir in die Augen. Mit erstickter Stimme flüsterte ich: »Hat er Schmerzen?«
Stevie antwortete nicht. Mama sagte: »Ich glaube nicht. Er muss nur furchtbar kämpfen, um Luft zu bekommen.«
Sie öffnete ihre Tasche, während Stevie in der Streu niederkniete. »Wenn’s dir recht ist, gebe ich ihm gleich ein paar Beruhigungstropfen«, sagte sie leise. »Vielleicht kann er ein bisschen schlafen. Das wäre ein Segen für ihn.«
»Pepper soll nicht leiden.« Stevie weinte jetzt so, dass er fast nicht sprechen konnte. »Wenn Dr. Muir kommt … Er muss entscheiden, ob … ob es nicht besser ist, ihn zu erlösen.«
Ich setzte mich auf den dreibeinigen Hocker in eine dunkle Ecke. Am liebsten wäre ich weggelaufen, doch das wäre feig gewesen. Wenn Stevie und Mama es aushielten, wollte ich mich nicht davonschleichen, auch wenn ich das Geräusch von Peppers gequälten Atemzügen kaum ertragen konnte.
Als mein Blick auf Cinnamons Kopf fiel, die Art, wie sie über die Trennwand hinweg auf ihren sterbenden Gefährten niedersah, krampfte sich meine Kehle zusammen, so sehr musste ich mich beherrschen, um nicht laut zu schluchzen.
Mama aber war stark. Ich hörte, wie sie Pepper beruhigende Worte zuflüsterte, mit ihrer sanftesten, weichsten Stimme. Dann bat sie Stevie um etwas Wasser, damit sie die Tropfen darin verdünnen konnte. Sie zog eine Einwegspritze aus ihrer Tasche und entfernte die Spitze.
Schon oft hatte ich zugesehen, wie sie einem unserer Ponys mithilfe der Spritze Medizin einflößte. Sie machte das immer rasch und sehr geschickt. Trotzdem senkte ich den Blick. Am liebsten hätte ich mir auch die Ohren zugehalten.
»Einen Teil hat er wenigstens geschluckt«, sagte sie nach einer Weile. »Das wird ihm guttun. Ich massiere ihm noch ein paar Stellen am Hals und an der Brust. Das hilft, den Schleim etwas zu lösen.«
Das wehe, krampfartige Gefühl in meiner Kehle verschwand. Wieder einmal dachte ich, was für ein unverschämtes Glück wir doch mit unserer Mutter hatten und dass ich keine andere gewollt hätte als sie, nicht einmal eine Herzogin mit einem Schloss oder eine berühmte Schauspielerin mit einem Geldberg wie Dagobert Duck.
Die Hunde kratzten an der Stalltür und winselten. Stevie erhob sich aus der Streu.
»Ich bring sie ins Haus.«
»Ich komme mit.«
Er sagte nicht Ja und nicht Nein, also hoffte ich, dass es ihn nicht stören würde, wenn ich ihn begleitete.
Es war eine dunkle Nacht. Kein Stern funkelte am Himmel. Der Mond war hinter Wolken verschwunden. Der Wind zerrte an unseren Haaren. Erleichtert rannten Arabella, Puccini und Grizzly voraus und warteten vor der Haustür auf uns.
»Kannst du ihnen Futter geben?«, fragte Stevie. »Sie haben abends noch nichts gekriegt.«
In der Küche war es kalt. Das Feuer im Herd war erloschen. Die Hunde wuselten um mich herum. Ich fiel fast über Grizzly, während ich zusammensuchte, was gerade da war, gekochten Reis aus dem Kühlschrank, Dosenfutter, das Stevie für Notfälle bereithielt, Karotten und Haferflocken.
Ich raspelte die Karotten, vermischte alles mit warmem Wasser und füllte die drei Näpfe. Während die Hunde gierig schmatzten und kauten und ihre Schüsseln über den Küchenboden schoben, kam Mimi, die blinde alte Katze, und bettelte um Futter. Daisy, das Eichhörnchen, flitzte unterm Sofa hervor und kletterte an meinem Hosenbein hoch.
Ich gab ihm eine Haselnuss und sah mich nach Stevie um. Bestimmt hatte er auch seit Stunden nichts gegessen. Er war bleich und sah total erschöpft aus.
»Setz dich aufs Sofa, ich mach dir Tee und ein Honigbrot«, sagte ich, aber er schüttelte nur den Kopf und erwiderte: »Danke, ich bring nichts runter.«
»Trink wenigstens eine Tasse Tee mit ordentlich Zucker drin!«
Er lehnte sich gegen die Fensterbank und ließ den Kopf hängen. Das Ticken der Uhr, das sonst immer so gemütlich klang, hatte plötzlich einen schweren, unheilvollen Klang.
Ich verrührte braunen Zucker im Tee, goss Milch hinein und reichte Stevie den Becher. Er nahm ihn und stellte ihn hinter sich auf die Fensterbank.
»Es ist so schwer auszuhalten, Kathi«, sagte er.
»Ich weiß.« Ich umarmte ihn und schmiegte meine Wange an seine. So etwas hatte ich bisher noch nie getan. Ich hatte es mir oft gewünscht, aber einfach nicht den Mut dazu gefunden, nicht bei Stevie. Jetzt war es plötzlich ganz selbstverständlich, und er ließ es zu, hob sogar die Hand und legte sie auf meinen Rücken.
So standen wir lange, ohne ein Wort zu sagen. Dass ich es endlich wagte, diesen lang ersehnten Schritt zu tun, hatte ich Pepper zu verdanken. Vielleicht war es sein Abschiedsgeschenk an uns.
Denn er starb noch in dieser Nacht, wenige Minuten ehe Dr. Muir in der Stalltür auftauchte. Sicher war es Mamas Beruhigungstropfen und ihrer sanften Streichelmassage zu verdanken, dass er die letzten Stunden seines Lebens ruhiger atmen konnte und einigermaßen friedlich in eine andere Welt hinüberdämmerte. Um zehn Minuten vor elf tat er den letzten mühsamen Atemzug.
Dann war es still im alten Stall von Little Eden.
3
Sogar Niko, der doch immer so tat, als wäre er Mister Cool persönlich, lief zwei Tage lang mit roter Nase und verheulten Augen herum. Pepper war aus irgendeinem Grund sein besonderer Liebling gewesen, während er für unsere Ponys Smilla und Kringle nicht allzuviel übrighatte. Doch man hätte schon ein Herz aus Stein haben müssen, um Pepper und Cinnamon nicht zu mögen.
Jetzt war Cinnamon allein, ohne ihren Gefährten, mit dem sie die vielen schweren und anstrengenden Jahre im Wanderzirkus geteilt hatte. Die beiden waren wie ein unzertrennliches altes Ehepaar gewesen.
»Vielleicht stirbt sie ja auch bald vor Einsamkeit und Kummer«, sagte meine Freundin Kim am Montagmorgen im Schulbus. Die Sommersprossen auf ihrer Stirn bildeten ein verrücktes Muster, als sie die Augenbrauen zusammenzog. »Stevie könnte doch ein Pferd von einem Schlachttransport freikaufen. Es gibt so viele armselige Pferde, die Hilfe bräuchten. Und für Cinnamon wäre es sicher leichter, wenn sie nicht allein bleiben muss.«
Ich warf ihr einen zweifelnden Blick zu. »Wenn bei einem alten Ehepaar ein Partner stirbt, kann man ihn auch nicht durch einen anderen ersetzen, Kim. So einfach ist das nicht.«
»Das weiß ich doch!« Kim zog an ihrer Strickmütze, bis ihre Ohren darunter verschwanden. »Aber vielleicht könnte sie sich ja noch mal neu verlieben oder so?«
Das klang total komisch, aber auch irgendwie süß.
»Es müsste halt das richtige Pferd sein. Ähnlich wie Pepper, sanft und lieb und geduldig. Ein Pony mit einer ähnlichen Ausstrahlung, verstehst du?«
Wieder einmal war ich total froh, dass ich kurz nach unserem Umzug Kim Ravensmoor kennengelernt hatte. Ohne sie hätte ich es bestimmt vor Heimweh nicht ausgehalten. Sie hatte mir über die Trennung von meiner besten Freundin Svenja hinweggeholfen und wir waren fast wie Schwestern geworden, denn Kim war durch ihre besondere Stellung als Tochter des Herzogs von Ravensmoor ziemlich einsam gewesen.
Während des Mathe-Tests dachte ich zu viel an Pepper. Ich konnte nur ungefähr zwei Drittel der Aufgaben beantworten, und auch da war ich nicht sicher, ob die Lösungen stimmten. Kim ging es noch bescheidener. Ms Straithpoodle, von allen »der zählende Pudel« genannt, hatte uns auseinandergesetzt, weil sie fand, dass wir uns gegenseitig zu sehr von der Arbeit ablenkten.
In der Pause trafen wir uns auf dem Flur. Kims Gesicht war mit grünen Filzschreiber-Krakeln verziert. Ihre kurzen rotblonden Haare standen wild in alle Richtungen.
»Alles Mist und Schweinekacke!«, sagte sie. »Aber was sind schon Tests und Noten im Vergleich dazu, dass wir den lieben alten Pepper nie mehr sehen werden?«
Als wir aus der Schule kamen, hatte das Wetter gewechselt, was in Cornwall mindestens dreimal täglich passierte. Jetzt segelten nur noch ein paar Schäfchenwolken am blauen Himmel, und der Wind war lind und roch nach Frühling.
Ich dachte, dass Pepper nie wieder auf der Wiese unter den knorrigen alten Apfelbäumen stehen und sich im frischen grünen Gras wälzen konnte, während die Seevögel über Little Eden kreisten. Er würde nie mehr erleben, wie die Schwalben zurückkehrten und ihre Nester unter dem Stalldach bauten. Und er würde nicht mehr dabei sein, wenn Stevies zahme Krähen Dagobert und Donald auf der Weide durchs Frühlingsgras staksten und nach Würmern und Käfern stocherten.
Sofort wurde ich traurig und meine Augen füllten sich mit Tränen. Kim legte den Arm um meine Schultern.
»Pepper geht es gut. Er ist jetzt an einem schönen Ort, wo es keine Schmerzen und keine Atemnot mehr gibt.«
Ja, ein Ort vielleicht, an dem eine Art ewiger Frühling herrschte? Ich wünschte es ihm so sehr nach seinem mühsamen Zirkusleben. Falls es ein Paradies für Menschen gibt, warum nicht auch für Tiere? Vielleicht würden er und Cinnamon sich eines Tages wiedersehen.
»Glaubst du an ein Tierparadies?«, fragte ich auf der Heimfahrt im Bus. »Tiere haben doch auch eine Seele, Kim, davon bin ich überzeugt.«
»Klar haben sie das! Man braucht ihnen nur in die Augen zu schauen, um das zu wissen!«
Kim redete leise. Die Mädchen und Jungen, die hinter uns und vor uns saßen, hätten sich womöglich über uns lustig gemacht, wenn sie das Gespräch mit angehört hätten. »Aber das mit dem Paradies … Mein Vater sagt immer, es gibt keines, das wäre eine Erfindung von uns Menschen, weil wir Angst haben, dass mit dem Tod alles zu Ende ist.«
Ich nahm mir vor, Niels anzurufen. Niels war seit dem vergangenen Sommer auf einem englischen College und kam nur noch in den Ferien und manchmal am Wochenende nach Hause. Wenn sich einer mit Sachen wie Tod und Wiedergeburt auskannte, dann mein älterer Bruder. Er wusste unheimlich viel über indianische und keltische Weisheiten, Bräuche und Glaubensvorstellungen.
Es tat so gut, Niels’ Stimme zu hören und ihm von Pepper zu erzählen. Zum Glück hatte er sein Handy an diesem Abend eingeschaltet und war allein auf seinem Zimmer, um für eine Prüfung zu lernen.
Irgendwann, als ich vor Weinen nicht mehr reden konnte, sagte er ganz ruhig: »Pepper geht es jetzt gut, Kathi. Mama hat ihm den Übergang in ein anderes Leben erleichtert. Der Körper ist manchmal eine Bürde, besonders für alte Menschen und Tiere. Diese Bürde hat er abgeworfen und ist jetzt leicht und frei und bestimmt auch glücklich.«
»Du glaubst also, dass er in einem … in einem Tierparadies ist?«
»Die Kelten haben nicht zwischen einem Paradies für Tiere und Menschen unterschieden. Für sie hatten Tiere eine Seele, genau wie wir, und sie kamen nach dem Tod auch an den gleichen Ort, der manchmal ›die Insel der Seligen‹ genannt wird, manchmal auch Paradies, manchmal ›die elysischen Felder‹ oder ›die ewigen Jagdgründe‹. Der Ort hat viele Namen, aber fast alle Kulturen haben sich darunter etwas Ähnliches vorgestellt: einen Zustand von ewigem Glück und ewiger Jugend, einen wunderbaren Garten, in dem Menschen und Tiere friedlich zusammen existieren.«
»Glaubst du wirklich daran?«, fragte ich.
»Ja sicher, Kathi. Manche Lebewesen müssen auch wieder in unsere irdische Welt zurückkehren, weil sie ihre seelische Entwicklung nicht abgeschlossen oder Schuld auf sich geladen haben. Aber Tiere sind unschuldig und tun nichts absichtlich Böses. Und Pepper hat seine Ruhe und seinen Frieden verdient. Weine ihm nicht zu sehr nach, du hältst ihn damit nur fest.«
In dieser Nacht träumte ich, dass ich auf Peppers Rücken saß und mit ihm durch einen wunderbaren Wald ritt, in dem Bäche zwischen Gras und Farnkraut sprudelten und weiße Blumen unter mächtigen, uralten Bäumen blühten. Schmetterlinge gaukelten durch die Luft, Nachtigallen schlugen. Pepper war jung und stark. Er galoppierte voller Kraft und Lebenslust über den bemoosten Pfad. Seine graue Mähne flatterte im Wind. Ich hörte seine leichten, regelmäßigen Atemzüge, spürte seine federnden Bewegungen unter mir.
Wir ritten einen Hang hinunter; es war fast, als würden wir fliegen. Peppers Hufe schienen den Boden kaum zu berühren. Dann wieherte er. Es klang wie ein triumphierender Trompetenstoß.
Sein Gewieher tönte mir noch in den Ohren, als ich aufwachte. Hinter dem Dachfenster dämmerte der Morgen. Vielleicht hatte mir Pepper eine Botschaft geschickt.
4
Kim und ich überlegten hin und her, wie wir es anstellen sollten, noch in dieser Woche nach Little Eden zu reiten, doch wir hatten jeden Nachmittag bis drei Uhr Unterricht, am Donnerstag sogar bis vier. Und der Weg nach Little Eden war weit. Mit den Pferden waren wir selbst auf den Schleichwegen, die nur Kim kannte, mehr als eine Stunde unterwegs. Wir wären also auf dem Rückweg unweigerlich in die Dunkelheit gekommen, und das war auf den steilen, schlüpfrigen Klippenpfaden eindeutig zu gefährlich für uns und die Pferde.
So mussten wir den Besuch auf Samstag verschieben. Ich rief Stevie an und fragte, wie es Cinnamon ging.
»Sie frisst kaum etwas«, sagte er. »Sie steht nur auf der Weide und lässt den Kopf hängen.«
»Kein Wunder. Sie trauert um Pepper. Stevie, ich muss dir einen Traum erzählen, aber nicht am Telefon. Wir wollten am Samstag vorbeikommen, Kim und ich. Ist das in Ordnung?«
»Sicher«, erwiderte er. »Vielleicht könnt ihr Cinnamon ein bisschen aufmuntern.«
Zögernd sagte ich: »Kim meint, es wäre gut, wenn sie wieder mit einem anderen Pferd zusammen sein könnte.«
Stevie schwieg eine Weile. Ich dachte schon, er hätte aufgelegt, da murmelte er: »So einfach ist das nicht. Erstens lässt sich Pepper nicht ohne Weiteres durch ein anderes Pferd ersetzen.«
»Das hab ich ihr auch gesagt.«
»Und zweitens … Aber darüber reden wir ein andermal.« Seine Stimme klang müde. Da war noch etwas anderes neben der Trauer um Pepper, was ihn bedrückte, ich spürte es deutlich. Doch ich begriff auch, dass er noch nicht bereit war, darüber zu sprechen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag regnete es. Ich lag im Bett, hörte den Regen gegen die Dachfenster trommeln und dachte: Mist und Hühnerkacke! Jetzt müssen wir die Pferde im Stall lassen …