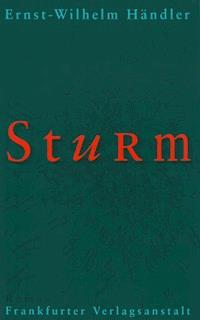Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Ich-Erzähler steht sichtlich unter Schock. Als habe er einen Zusammenbruch erlitten, hockt er mitten in der Nacht unter der Dusche seiner Münchner Wohnung, das heiße Wasser droht, ihm die Haut zu verbrennen. Am Abend war er zufällig dem einflußreichen Literaturagenten T. begegnet, den er nie wieder hatte treffen wollen, sofort war die schlimmste Geschichte seines Lebens wieder hochgekocht. T. hat vor einiger Zeit versucht, den Schriftsteller im Auftrag des renommierten Guggeis Verlags abzuwerben und ihm ein glänzendes Angebot gemacht. Das jedoch an eine seltsame Bedingung geknüpft war: Er sollte das neue Manuskript eines anderen Autors, Tonio Pototsching, selbst fertig schreiben. Als der Erzähler diesen ungewöhnlichen Auftrag schon ablehnen will, trifft er auf Laura, die Noch- oder Exfreundin Pototschings, und verliebt sich in sie. Und er nimmt er den dubiosen Auftrag an. Er ahnt nicht, daß er damit in eine bösartige Intrige hineingezogen wird, angezettelt von dem ungleich erfolgreicheren Schriftsteller und seinem Agenten. Eine Intrige, die ihn fast das Leben kostet, zumindest sein literarisches Leben. Denn Pototsching unternimmt nichts weniger, als ihm seine eigene Biographie zu rauben. Im Glauben, Herr seiner Biographie zu sein, muß er tatenlos zusehen, wie Pototsching Besitz von seinem Leben ergreift, sich seine Kindheit aneignet und mit seiner Hilfe ein enthüllendes Buch verfaßt. Ernst-Wilhelm Händlers neuer Roman schildert den narzißtischen Machtkampf zweier Schriftsteller und einer Frau, ebenfalls Schriftstellerin. Verhandelt wird dabei die Ethik des Literatendaseins, das Verhältnis von fiktionaler und tatsächlicher Identität. Angestoßen durch die Auseinandersetzung mit der Kindheit des Ich-Erzählers, beschwören dieser und sein Widerpart Pototsching die Dämonen aus der deutschen Geschichte der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts herauf. Spiegelt sich der Schriftsteller in diesen Bildern des Bösen oder nimmt das Böse tatsächlich wieder Gestalt an?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ernst-Wilhelm Händler in der Frankfurter Verlagsanstalt
Titelseite
Impressum
JETZT, DAMALS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
JETZT
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Ernst-Wilhelm Händler in derFrankfurter Verlagsanstalt:
Stadt mit Häusern. Erzählungen
Kongreß. Roman
Fall. Roman
Sturm. Roman
Wenn wir sterben. Roman
Ernst-Wilhelm Händler
Die Frau des Schriftstellers
Roman
1. Auflage 2006
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH
Frankfurt am Main 2006
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Laura J Gerlach
unter Verwendung eines Ölgemäldes
von Karin Kneffel (Feuer IV, 1992, 200 x 200 cm)
Herstellung: Thomas Pradel, Frankfurt am Main
eISBN: 978–3–627–02028–6
1 2 3 4 5 – 10 09 08 07 06
I have no favourite woman at all. You can’t love one in particular. I work for women in general.
Azzedine Alaïa
JETZT,
DAMALS
Ich ziehe die Beine an und verschränke die Arme um die Knie, damit ich nicht so zittere. Mich friert, obwohl mir das Wasser aus der Brause, unter die ich mich nach der Wiederbegegnung mit La Trémoïlle geflüchtet habe, fast Verbrennungen verursacht.
Als ich Kind war, hatten wir zu Hause kein Bad. Wenn ich mir keinen Rat weiß, gehe ich immer unter die Brause. Die durch mein Badezimmer ziehenden Schwaden von Wasserdampf geben regelmäßig für einen kurzen Moment die Sicht auf den beschlagenen Spiegel frei. Mein Bild versucht, einem Wesen aus Fleisch und Blut täuschend ähnlich zu sehen. Jedesmal bin ich gespannt auf den Übergang von einem Abbild zum anderen, auf das neue Mischwesen, das entsteht, wenn man die Abbilder miteinander vergleicht. Den Brief von La Trémoïlle hatte ich ungeöffnet weggeworfen, eine Mail gelöscht, ohne sie zu lesen. Ich habe befürchtet, er würde mich bei einer meiner Lesungen abpassen. Darauf, daß er mir im Schumann’s in der Nische auflauerte, war ich nicht vorbereitet.
La Trémoïlle ist taubstumm. Wenn er auf seinem Palm schreibt, habe ich stets das Gefühl, daß er mich imitiert. Man muß alle Buchstaben in einem Schwung vollenden, damit der Rechner die Schrift erkennt und in Druckbuchstaben umwandelt. Meine Handschrift hat mit derjenigen für den Palm gemeinsam, daß ich nicht absetze, nicht nur bei den Buchstaben, auch bei den Verbindungen der Buchstaben untereinander.
Das Schumann’s ist ein Laboratorium für die Macht des Blicks: Sämtliche Ereignisse werden registriert, die geringsten Bewegungen der Gäste protokolliert, eine ununterbrochene Beobachtungskette verbindet Charles Schumann über seine Boys mit den Gästen. Er übt seine Gewalt ungeteilt in einer bruchlosen Hierarchie aus. Dem Gast wird nicht nur sein Platz zugewiesen, jedem wird ein Körper und eine Geschichte zudiktiert. Von einer allgegenwärtigen und allwissenden Macht, die seine letzte Bestimmung kennt.
Nur der Stammgast kommt in die Lage, seinen Blick zuzuspitzen und in das Verhalten der anderen Gäste einzudringen. Mit jeder tieferen Schicht, die er erreicht, entdeckt er an der neuen Oberfläche Dinge, die er noch nie gesehen hat. Wer seinen Blick zur Waffe machen will, muß Stammgast werden.
Statt mit den Fäusten auf La Trémoïlle einzuschlagen und ihn mit Füßen zu treten, folgte ich willenlos der Einladung, die er auf den Palm geschrieben hatte, und setzte mich zu ihm. Es genügte, daß er in Richtung Theke sah, sofort kam Roman an unseren Tisch. Er hatte gerade eine neue Kellnerschürze angelegt, im Gehen band er sie zu. Nie trinke ich zuerst etwas anderes als einen Manhattan medium mit Canadian Whiskey, ein Teil Whiskey, ein Teil roter Wermut, ein Teil Cocktail-Wermut. La Trémoïlle orderte eine Kartoffelsuppe, die Kartoffelsuppe.
Wenn er schreibt, zieht La Trémoïlle den Kopf ein und die Schultern hoch, dabei winkelt er beide Arme an. Betrachtet man seine untersetzte Gestalt, fallen die Falten in seinem Gesicht nicht auf. Konzentriert man sich auf den Kopf, werden die Falten zu Furchen, und er bekommt etwas von einer alten Schildkröte.
Hast du Angst vor der Liebe
bist du deshalb allein?
Denk daran
niemand kann
ohne Liebe sein
Drei Jahre lang habe ich La Trémoïlle gemieden, drei Jahre habe ich Laura nicht gesehen, drei Jahre ihr Buch nicht in die Hand genommen. Als ich auf La Trémoïlles Palm mit den Zeilen aus Rex Gildos Song Die Liebe blickte, wurden die drei Jahre zu drei Tagen, drei Stunden oder drei Sekunden.
Ich sah Laura vor mir, wie sie auf meine Dachterrasse hinausging. Vor dem Hintergrund des weißen Himmels liefen schwarze Wasserfäden in regelmäßigen Abständen die Verglasung der Schiebetür herunter, weiße berührten den dunklen Holzboden.
Laura war nackt.
Ein Geburtsbild, sie schien im Leben verankert, zwischen dem kaum hörbaren Geräusch des Regens und meinem Schweigen? Oder ein Verzweiflungsbild, ein Todesbild über dem Königsplatz, dessen Asphaltbedeckung das Licht des Himmels anzog und verschluckte?
Ich versuchte, mich gegen die Erinnerung an Laura zu wehren. Aber ich erreichte nur, daß ich mit Lauras Augen sah, daß ich sie sah, sie sich selbst sah. Laura klemmte die linke Hand zwischen die Knie. Mit der rechten Hand umfing sie den linken Fuß. Sie hockte sich hin, das eine Bein auf dem Boden, das andere aufgestellt, und stützte sich auf ihre Faust. Sie schlug die Beine übereinander, so daß die Füße genau zur Deckung kamen, als ob sie nur einen Fuß mit sechs Zehen besaß.
Auf dem Bauch liegend, hob sie die Unterschenkel und kreuzte sie, dabei richtete sie sich mit dem Oberkörper auf. Das war kein Blick mehr durch ihre Augen. Sie ruhte auf der Seite, die Unterschenkel übereinander, die eine Hand zwischen den Füßen, die andere zwischen den Knien. Die Beine über Kreuz, lag sie auf dem Rücken.
Sie richtete sich auf und beugte sich vor, wer betrachtete ihre Brust? Sie ging barfuß über die nassen Planken, wer beobachtete ihren abknickenden Fuß? Sie hob den Arm hoch, und die Haare in ihrer Achselhöhle beschrieben einen Kreis. Wer sah diese riesenhaften Stücke Haut? Zart, faltig, fleckig, immer geprägt durch die Formen der darunterliegenden Knochen?
Für mich bedeutet das Schreiben eine Prüfung. La Trémoïlle prüft mit dem, was er schreibt, andere. Ich fließe in das aus, was ich schreibe. Ihm verleiht das Schreiben genau die Einheit und Dauerhaftigkeit, die es mir nimmt. Das Kreisen des Plastikstifts auf dem Touchscreen des Palm verkörpert seinen persönlichen Triumph.
La Trémoïlle stammt aus einem uralten Adelsgeschlecht. Er wurde in Paris geboren, sein Vater war als Diplomat an der französischen Botschaft in Bonn tätig, die Jugend verbrachte er in Deutschland. La Trémoïlle ist Lauras Agent. Er arbeitet allein, es gibt kein Büro und keine Sekretärin. Als ich ihm in dem bierfarbenen Licht im Schumann’s gegenübersaß, begriff ich, daß ich nicht Lauras Körper in meinem Inneren wiedererrichtete. Ich setzte Bilder von ihren Körperteilen und davon, was sie mit diesen Körperteilen tat, zu einem neuen Körper zusammen, der meiner sein sollte.
Zwei Ichs, als ich auf La Trémoïlles Palm blickte. Ein Ich, das wollte, was ich wollte, und ein anderes Ich als Ort Lauras. Das erste Ich als Anzeige dessen, daß es mich wirklich gab, das zweite Bürge und Fälscher, das Bild seiner Unabhängigkeit vortäuschend und gleichzeitig den Widerspruch zwischen seiner angeblichen Einheit und seiner tatsächlichen Abhängigkeit auslebend. Das erste Ich war erstarrt, als es La Trémoïlle gesehen hatte. Das zweite hatte ihn als Spiegel gewählt.
Aber vielleicht war der Spiegel ja dunkel und La Trémoïlle nichts als der Literaturagent, der sein Einkommen maximierte, indem er die Einkommen seiner Autoren maximierte, und der deshalb jetzt auf seinen Palm geschrieben hatte: Guggeis möchte dich sehen.
Ich habe Angst vor der Liebe. Seit der Trennung von Laura bin ich allein. Aber niemand kann ohne Liebe sein.
Ich versuche, die Erinnerungen an Laura zu bekämpfen, indem ich an Beatrice denke.
Beatrice sprach mich vor drei Monaten im Polo Shop in der Maximilianstraße an. Drei Polo shirts waren in meiner Größe nicht mehr im Regal, die Verkäuferin, eine Amerikanerin, mußte ins Lager. Ratlos stand ich vor einer vollständigen Farbskala von Polo chinos und einer unvollständigen Farbskala von Polo shirts. Sie wollen mit der Verkäuferin ins Gespräch kommen?
Mißtrauisch musterte ich die große Frau mit den langen blonden Haaren, die unvermittelt in der Herrenabteilung aufgetaucht war. Sie lachte mich an und kam von der anderen Seite des Tisches zu mir herüber. Gerade hatte ich der Verkäuferin erzählt, daß ich selbst im Flagship store in New York auf der Fifth Avenue bestimmte Farben nicht bekommen hatte. Und hinzugefügt, in den USA seien die Läden in kleineren Malls oft überraschend gut sortiert. Sie hatte mir freundlich geantwortet, war jedoch nicht weiter darauf eingegangen. Beatrice beugte sich vor und flüsterte mir zu: Lassen Sie sich nicht abschrecken! Ich starrte verlegen auf meine Polos, wobei ich noch nicht wußte, ob es wirklich meine sein würden. Sie lächelte: Sie müßten Ihr Gesicht sehen, während Sie mit der Verkäuferin reden. Sie machen den Mund nicht auf, und Sie verziehen keine Miene. So wird das nichts. Ich murmelte in ihre Richtung: Warum kümmern Sie sich um meine Angelegenheiten. Sie trat näher zu mir hin: Wollen Sie nun mit der Verkäuferin etwas anfangen oder nicht?
Beatrice zog ihren Pullover aus, um ein Sweatshirt anzuprobieren, dabei hob sich das Herrenhemd, das sie über der Hüfthose trug, und entblößte ihren Nabel. Sie schüttelte den Kopf, damit die blonden Haare über das orangefarbene Sweatshirt fielen, das ich vorher ebenfalls anprobiert hatte, zog es zurecht und blickte mich aus dem Spiegel heraus auffordernd an: Ist die Verkäuferin wirklich die Frau, die Sie brauchen?
In diesem Augenblick kam die Verkäuferin zurück, ein grünes und ein rotes Polo in der Hand. Ich fühlte mich erleichtert, weil sich die mir aufgezwungene Konversation nun einem absehbaren Ende zuneigte, und bemühte mich, der Verkäuferin erwartungsvoll und vielsagend entgegenzublicken. Beatrice ging den Stapel von Sweatshirts durch, der auf dem Verkaufstisch lag, und sagte beiläufig zu mir, Männer müssen authentisch sein, das ist die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg bei Frauen.
Ich bin kein Bestsellerautor, meine Bücher sind nicht spektakulär.
Aber ich schreibe schnell, fast jedes Jahr erscheint ein Buch von mir. Das ergibt ein für einen Schriftsteller unüblich regelmäßiges Einkommen. Sonst könnte ich nicht auf der Maximilianstraße einkaufen.
Natürlich besteht mein Leben nicht darin, ständig in die USA zu fliegen und in Groß- und Kleinstädten die Malls zu vergleichen. Das merkte die Verkäuferin, das merkt jeder. Was soll man mit jemandem anfangen, der einem von seinem Leben erzählt, und es ist gar nicht sein Leben, aber es ist auch nicht das Leben, das er erstrebt?
Ich kaufte nicht nur die Hosen, sondern auch die Hemden, obwohl Magenta fehlte und ich meine Farbskala nicht vervollständigen konnte. Hätte Beatrice mich nicht beobachtet, ich hätte überhaupt nichts genommen, aber ich mußte ihr beweisen, daß ich das Geschäft nicht nur wegen der Verkäuferin aufgesucht hatte. Magenta ist eine Allerweltsfarbe, die ich verabscheue, ich glaube nicht, daß ich das Polo jemals angezogen hätte.
Die Verkäuferin hatte inzwischen begriffen, daß sie Gegenstand der Unterhaltung ihrer beiden Kunden war. Womöglich hatten wir sogar eine Wette abgeschlossen, wie sie sich verhalten würde. Sie blickte mich nicht mehr an, reichte mir schweigend die Rechnung, nahm ohne Kommentar meine Kreditkarte in Empfang und gab mir wortlos die Tüte mit den Hemden und Hosen.
Eigentlich wollte ich noch in der Kunstbuchhandlung in einer Nebenstraße der Maximilianstraße vorbeischauen, doch die Lust dazu war mir vergangen.
Warten Sie! Ich drehte mich um und sah meine Schutzheilige hinter mir herlaufen. Sie hatte sich ihren Mantel nur übergeworfen. Ich beachtete sie nicht, sondern stieg in meinen Golf, den ich vor der Buchhandlung geparkt hatte. Sie klopfte an das Fenster der Beifahrerseite und deutete auf den Verriegelungsknopf. In diesem Augenblick trat die Inhaberin der Buchhandlung auf die Straße, sie erkannte mich und grüßte freundlich. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Verriegelung zu öffnen. Beatrice riß die Tür auf, schwang sich auf den Beifahrersitz und schlug die Tür sofort wieder zu.
Sie holte die Haare unter dem Mantelkragen hervor und blickte mich aus grünen Augen mitfühlend an. Ihre Haare schienen von Natur aus hellblond zu sein. Die langen Beine über Kreuz, lehnte sie sich zurück: Ich wollte Ihnen nur sagen, die Dinge stehen für Sie nicht so schlecht, wie Sie vielleicht denken! Sie haben nichts kaputtgemacht, die Verkäuferin ist zu haben! Ich widersprach: Aber nicht für mich. Unbeeindruckt fuhr sie fort: Ich bin der Meinung, diese Frau paßt nicht zu Ihnen. Aber wenn Sie entschlossen sind, bin ich bereit, Ihnen zu helfen.
Das Licht der beiden Fackeln rechts und links neben dem Eingang spiegelte sich derart im Glas der Eingangstür, daß ich zögerte, den Türgriff anzufassen, als ob die vor mir züngelnden Flammen meine Hand ansengen konnten.
Ich hatte Beatrice im Wagen meine Telefonnummer gegeben, sonst wäre sie nicht ausgestiegen. Sie hatte mich ins Lenbach eingeladen, wir trafen gleichzeitig ein. Über den Catwalk aus von unten blau beleuchteten Glasplatten wurden wir zu unserem Tisch geleitet. Die Kellner sahen in den schwarzen Anzügen mit den kleinen, hohen Revers wie Konfirmanden aus.
Wir bekamen einen Tisch im hinteren Teil des Saals zugewiesen. Während Beatrice an der Wand Platz nahm, blickte ich zu der in Weiß und Graublau gehaltenen, mit Friesen und Stukkaturen verzierten Decke hoch. Die roten Polsterstühle wirkten nur so lange bequem, wie man nicht Platz genommen hatte.
Guten Abend, mein Name ist Florian, ich werde Sie heute bedienen. Der Kellner hatte sein schwarzes Haar gegelt und nach hinten gekämmt. Beatrice lachte ihn an: Hallo Florian! Er blinzelte überrascht, bevor er uns die Speisekarten reichte und erläuterte, welche Gerichte der Küchenchef noch für den Abend vorbereitet hatte. Danach fragte ich Beatrice, ob sie sich die Zusatzauswahl gemerkt hatte, sie konnte jedes Gericht aufsagen, ich erinnerte mich nicht an ein einziges.
Ich trank auf nüchternen Magen Wein. Beatrice erzählte mir, in ihrer Freizeit koche sie und mache sogar die Wäsche. Ich bekannte, ich sei nervös, mein letztes Rendezvous liege länger zurück. Beatrice gefiel mir. Das erste Mal miteinander auszugehen ist nie einfach, bemerkte sie verständig und fuhr fort: Es ist immer schwer einzuschätzen, wie das läuft. Gerade wenn der Typ wirklich nett ist, kann ich den Abend nicht genießen, weil ich dauernd überlege, ob wir nachher Sex haben werden. Ich warf ein, für den Mann sei es schwerer. Versucht er es, obwohl es die Frau nicht will, steht er dumm da, will sie es, und er versucht es nicht, steht er auch dumm da. Wie soll das der Mann jemals richtig machen? Indem er es auf jeden Fall versucht, antwortete Beatrice ungerührt. Ich fragte mit unsicherer Stimme, wirklich? Es zeigt, daß der Mann Selbstvertrauen hat, darauf stehen die Frauen, erklärte Beatrice. Das heißt nicht, daß der Mann etwa grob oder aufdringlich sein darf. Aber die Frauen wollen Männer, die wissen, was sie wollen. Das finden sie sexy.
Sie trug eine längsgestreifte Hose mit niedriger Taille und ausgestellten Hosenbeinen wie aus den Siebzigern, dazu einen schwarzen Ledergürtel mit einem in Kunstharz eingegossenen Pfauenauge als Schließe. Die Ärmel der beigefarbenen Naturseidenbluse bedeckten die Hände, dafür war die Bluse weit ausgeschnitten und ließ den Nabel frei. Als der Kellner nachlegen wollte, lehnte sie ab: Nein danke Florian, ich möchte nichts mehr essen, sie streckte die endlosen Beine neben dem Tisch aus, so daß er die Schuhe mit den Bleistiftabsätzen sehen konnte, sonst perforiere ich mit meinen Absätzen Ihren Catwalk. Florian blickte auf ihre Taille und lachte laut auf: Die Gefahr besteht nun wirklich nicht! Sie berührte seinen Arm, er beugte sich zu ihr herunter. Sie lachen, aber wenn ich Pech habe, finde ich nie einen Mann. Beatrice blickte mich an, während sie zu ihm sprach. Florian strahlte: Soll das heißen, Sie beide sind nicht . . .? Nein, wir sind nur befreundet.
Nach dem Essen schlug Beatrice vor, eine Bar in Schwabing zu besuchen und auf dem Weg dorthin noch schnell bei einem Haus vorbeizuschauen, das Freunde von ihr renovieren ließen, die sich für mehrere Wochen außer Landes befanden. Sie hatte den Schlüssel und tauchte zu unterschiedlichen Zeiten im Haus auf, um die Handwerker zu überwachen. Eins von zwei völlig baugleichen zweigeschossigen Jugendstilhäusern in der Karl-Theodor-Straße. So auffällig hergerichtet das eine, so vernachlässigt das andere, die Fassade schwarz, die Fenster fast blind.
Das Parkett war im ganzen Haus ausgebessert beziehungsweise neu verlegt, im Erdgeschoß trocknete der Verputz, im Obergeschoß waren die Stuck- und Malerarbeiten fertig. Von den ursprünglichen Verzierungen hatte man Abgüsse gemacht und danach den Stuck abgeschlagen, auf dem neuen Verputz konnten die Stuckverzierungen viel haltbarer wiederauferstehen.
In den Zimmern gab es noch keine Beleuchtung, das durchs Schlafzimmer einfallende Korridorlicht begleitete uns ins Bad. Wir liefen auf einem weißen Marmorboden, die Wände waren mit fast mannshohen Marmorplatten verkleidet. Beatrice inspizierte zuerst die riesige Badewanne, die auf einem Marmorsockel stand, danach die beiden unter einem ausladenden Spiegel installierten Waschbecken auf der Breitseite des Bads. Ich ging zu der Trennwand, hinter der sich, ebenfalls auf Marmorsockeln, eine Toilette und ein Bidet befanden. Das Bad schien geputzt, weder Beatrice noch ich machten beim Gehen Geräusche. Sie hatte ihre Schuhe schon an der Eingangstür ausgezogen, damit sie das Parkett nicht beschädigte.
Brausen konnte man nur in der Badewanne. Die Wasserhähne, der Schlauch, die Halterung und der Kopf der Brause konnten nicht aus Messing sein, sie glänzten nicht, sondern schimmerten matt, sie mußten vergoldet sein.
Ich drückte einen Schalter, nicht damit rechnend, daß die Strahler angehen würden, die auf die Waschbecken, die Badewanne, die Toilette und das Bidet gerichtet waren. Beatrice zog mit einem Schwung ihre Bluse aus und lehnte sich an das rechte Waschbecken. Nur noch mit der Siebziger-Jahre-Hose bekleidet.
Ich starrte sie an.
Ich fände es nett, wenn du herkommst.
Während ich auf sie zuging, legte sie zuerst den Gürtel mit der Pfauenaugenschließe ab und öffnete dann den Knoten der Lederbänder, die den Reißverschluß ersetzten. Die Hose fiel von selbst auf den Boden.
Jetzt bist du dran.
Ich zog meine Jacke aus und überlegte, wo ich sie deponieren konnte. Beatrice machte eine Kopfbewegung in Richtung ihrer Bluse, die sie auf das Waschbecken neben sich geworfen hatte. Sie trat nach vorn, um aus der Hose zu steigen, dabei hielt sie sich an dem Waschbecken hinter ihr fest.
Ich knöpfte mein Hemd auf, zog es aus und ließ es auf den Boden fallen. Als ich die Hände nach Beatrice ausstreckte, schüttelte sie abwehrend den Kopf, ihre langen Haare bedeckten ihre Brüste. Sie blickte zuerst auf meine Hose und dann auf ihre Hose am Boden. Ich sagte ihr, daß ich meine Hose bei unserer ersten Begegnung in dem Polo Shop gekauft hatte.
Nachdem meine Hose ebenfalls am Boden lag, ließ sie sich aufs linke Knie nieder, ihr rechtes Bein blieb aufgestellt, mit der linken Hand umfaßte sie meinen Schenkel.
Dann erhob sie sich und lehnte sich an die Wand, die Toilette und Bidet abtrennte. Mit der rechten Hand preßte sie ihren Unterkörper gegen meinen, mit der linken zog sie meinen Kopf zu sich hin, um mich zu küssen.
An keinem anderen Ort hätte ich Beatrice das erste Mal lieben können. Im Bad des neu hergerichteten, noch unbewohnten Hauses flüchtete ich nicht mehr in meinem Körper, zog ich mich nicht mehr an die Stelle meines Körpers zurück, an der ich am wenigsten mit meiner Umgebung in Beziehung treten mußte. Beatrice hatte die Außenwelt verbannt, sie konnte uns nicht mehr beeinflussen und wir sie nicht mehr. Beatrice machte sowohl meinen Körper als auch mich stark.
Ich war hyperisoliert und hyperkonzentriert: Das Licht ging durch mich hindurch, ich warf keinen Schatten. Das Licht machte mich frei, im Licht verstand ich Beatrice. Das Licht war die Zeit. Ich begrenzte nicht mehr die Möglichkeiten meines Körpers, mein Körper fand zu seinen ursprünglichen Wichtigkeiten. Einen Luxus für mein Ich bildend, gab mein Körper die Härte nach außen ab, die sonst mein Ich erzeugen mußte. Mein Ich konnte sich verfeinern, mit dem Licht verschmelzen. Wer würde in diesem Treibhaus seine Chancen am besten nützen? Beatrice, das Licht, mein Körper oder sogar ich?
Sie kniete sich hin, ich küßte ihre Schultern. Auf dem glatten Boden, die Fugen waren abgeschliffen, rutschten wir an der Trennwand vorbei, bis wir vor dem Bidet zum Halten kamen.
Plötzlich begannen die Strahler über uns zu flackern. Im vorderen Teil des Bads leuchteten sie unverändert hell. Ich lehnte mich mit dem Rücken an das Bidet, Beatrice stützte sich mit den Armen nach hinten ab und setzte sich auf mich. Über uns pulsierte das Licht immer schneller, als wolle es uns zur Eile anhalten. Ich nahm ihre linke Brust in den Mund, dabei glitt ich am Bidet vorbei und mußte mich an dessen Rand festhalten.
Schließlich fielen die Strahler über uns völlig aus, und wir befanden uns in einer dunklen Höhle. Das Licht aus dem anderen Teil des Bads bildete unsere Körper als Schatten an der Wand ab. Glücklich, daß ich unseren Schatten folgen konnte, stimmte meine Zeit mit der Beatrices überein.
Gemeinsam suchten wir wieder die Helligkeit. Erst im Spiegel fiel mir die große waagrechte Narbe an ihrer linken Bauchseite auf. Ich fragte sie danach, sie antwortete mir, sie habe früher Morbus Crohn gehabt, ihr sei ein Teil des Darms entfernt worden. Ich fragte nicht, wann früher war, die Narbe schien kosmetisch nachbehandelt zu sein. Sie fügte hinzu, Morbus Crohn sei eine entzündliche Darmkrankheit, deren Ursache nach wie vor unbekannt sei, man nehme jedoch an, es gebe auch psychische Gründe. Seit der Operation habe sie nie wieder Probleme gehabt.
Als ich meine Unterhose anziehen wollte, bedeutete sie mir mit einer Geste innezuhalten. Sie reichte mir ihren Tangaslip und forderte mich auf, ihn anzuprobieren. Ich sagte lächelnd, er würde kaputtgehen, sie wiegelte ab, er sei sehr elastisch. Während ich in den Slip stieg, kam ich ihr ganz nah und merkte, daß ihr Atem wieder rascher ging. Ich zog den Slip hoch, sie lächelte zurück.
Alles, was für andere Menschen der Körper leistet, verwirklicht meine Handschrift. Sie grenzt mich gegen andere ab, sie vereinigt mich mit den anderen. Meine Handschrift führt fort, was ich nicht selbst fortführen kann, sie ist, was ich nicht selbst sein will.
Das Bild auf dem Bildschirm traut dem Geschriebenen Eigenschaften zu, die es im ersten Versuch nie und nimmer besitzen kann. Die Computerdarstellung eines Textes gaukelt uns vor, der Entwurfsvorgang sei mit dem ersten Niederschreiben bereits abgeschlossen, man müsse nur noch Korrektur lesen, höchstens ein paar Kleinigkeiten verändern. Ein Satz im Computer stellt eine Frage dar, die als Antworten andere Sätze erzwingt, dabei ist die Entscheidung über den Satz selbst noch gar nicht gefallen.
Ich schreibe ausschließlich mit der Hand. Nichts gefährdet den Anfang mehr als ein einzelnes Wort oder ein einzelner Satz. Ein Wort oder ein Satz auf dem Bildschirm wäre für mich wie eine Mauer. Ein Satz auf dem Bildschirm hat immer einen Anfang und ein Ende, bei einem Satz meiner Handschrift weiß man nie, ob er einen Anfang hat oder wo das Ende ist. Die Computerschrift ist sicher. Meine Handschrift ist unsicher, sie hält Entscheidungen in der Schwebe. Ich verlagere mein Denken nach außen, in den Stift, mit dem ich schreibe, in die Bewegung des Stifts auf dem Papier. Durch das fortdauernde Hervorzaubern von Buchstaben und Worten aus dem Nichts kann ich weder Gedanken fassen noch meine Gedanken entwickeln.
Mein Handwerk besteht darin, Spuren aus Sätzen zu erzeugen. Am Beginn stehen Sätze, die sichtbare wie unsichtbare Eigenschaften zu Papier bringen und auf diese Weise eine Brücke zwischen dem Denkbaren und dem Ausdrückbaren schlagen. Die verschiedenen Spuren überlagern sich und erzeugen neue Spuren. Die Sätze im Computer bringen keine neuen Spuren hervor.
Aus den vibrierenden, irritierenden Spuren drängen die wesentlichen in den Vordergrund, präziser als andere, klären nicht nur ihr Verhältnis zur Welt, sondern auch ihre Beziehung zu den anderen Spuren. Die vagen Spuren sorgen für Beweglichkeit, machen Druck, indem sie auf ungelöste Probleme hinweisen. Je zahlreicher die Spuren, je häufiger sie sich überlagern, um so größer die Chance, daß sich neue Zusammenhänge ergeben.
Ich wähle nicht bestimmte Spuren aus, um sie weiterzuverfolgen, und lasse andere brachliegen. Ob mich von Anfang an ein Plan leitet, den ich nur nicht ausformulieren kann, oder ob ich den Plan erst in dem Augenblick fasse, in dem sein Gegenstand durchscheint, kann ich nicht angeben. Die Summe des noch so sorgfältig ermittelten Wissens über das, was ich schreibe, ist nicht bruchlos und nicht zwangsläufig in das überführbar, was ich schreibe. Bestimmte Spuren verlaufen gleich zu Beginn, manche verzweigen sich bis zuletzt. Undenkbar, das Ziel des Schreibens festzuhalten, auszusprechen.
Auf dem Bildschirm kann ich jedes Wort ohne Folgen durch ein anderes ersetzen. Die Veränderung einzelner Wörter, ganzer Sätze bringt keinen Erkenntniszuwachs. Die Spuren der Sätze, die ich mit der Hand geschrieben habe, bilden ein Geflecht, das Wissen abbildet, über die Eigenschaften der Dinge, über das Spektrum der unendlich vielen Arten und Weisen, wie Menschen sich verhalten, zugleich eine Sammlung von Ideen. Einerseits relativieren sich die verschiedenen Areale dieses Geflechts gegenseitig, andererseits ergänzen sie sich zu größeren und umfassenderen Zusammenhängen, in jedem Fall schulen sie einander in Toleranz.
Meine Handschrift drückt alle Entscheidungen aus, die routinemäßigen wie die außerordentlichen, aber auch diejenigen, die sie nicht ausdrücken kann oder nicht ausdrükken soll. Fallen die Entscheidungen heraus, die die Schrift nicht ausdrücken soll, sorgen sie für ordinäre Häßlichkeit. Vergleiche ich Aufzeichnungen aus verschiedenen Jahren, erkenne ich Muster viel leichter, als wenn ich nur einen zu einer bestimmten Zeit entstandenen Text betrachte. Die Zeit hilft meiner Handschrift, konkret zu werden – nicht mit ihrem Vergehen, sondern durch ihre Tiefe. Die Zeit ordnet meine Handschrift, sie macht Vorschläge, wie Wörter und Sätze abgegrenzt werden können.
Meine Manuskripte sind nichts anderes als vorübergehend festgehaltene Bewegungsformen. Ein Text ist kein Gefäß, das jemand einmal mit Vorstellungen hat vollaufen lassen bis zum Rand und das dann stillsteht. Denn der Strom der Vorstellungen, der in den Text hineingeflossen ist, muß ewig aus ihm weiterfließen wie Zauberwasser aus der leeren Zauberkaraffe. Jeder Text ein Punkt, der mit dem gesamten Universum in Verbindung steht.
Meine Handschrift sprießt, sie schießt auf, sie biegt sich, sie spaltet sich, sie fügt, sie verbindet, sie trägt, sie hält.
Meine Hand fährt einfach über das Blatt. Ich überlege nicht, sondern ich lasse meine Wahrnehmung ins Unbewußte fallen. Ich folge dem, was ich schreibe, nicht mein Schreiben folgt mir. Ich betätige mich körperlich, als machte ich große Sprünge oder legte weite Strecken zurück. Was ich schreibe, ist geboren aus der Bewegung meiner Hand, aus der Leichtigkeit oder der Schwere meines Handgelenks. Meine Hand gibt meiner Schrift nach, während ich in meinen Gedanken abschweife, bei Dingen anlange, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich schreibe.
Ich löse mich von meinem Leben und Erleben und trete in einen Zusammenhang ein, in dem alles zugleich sorgfältig geplant und zufällig ist. Der Raum und die Zeit des Lebens verwandeln sich in etwas anderes Räumliches und in etwas anderes Zeitliches, das aus den Zeilen meiner Handschrift und aus der Leere zwischen ihnen besteht. Die Schwerkraft und andere physikalische Gesetze ordnen meine Handschrift und verstricken ihre verschiedenen Linien wie zufällig ineinander. Das ist mein Lieblingsgedanke. Derart darf meine Schrift, die mein Leben und das der anderen gleich behandelt, auch Ornamente bilden. Diese Ornamente stellen dann keine zwingenden Zusammenhänge dar, sondern etwas, das sich von ihnen so weit entfernt hat, daß es nie wieder zu ihnen zurückgelangen kann, obwohl es weiß, ohne sie wäre es niemals zustande gekommen.
Nachdem ich Beatrice nach Hause gebracht hatte, schrieb ich bis zum Morgengrauen. Dann legte ich mich hin und träumte. Ich war wieder mit Beatrice zum Essen im Lenbach, diesmal in der Mitte des Saals. Eine ungeheure Wut brodelte in mir. Ich warf Messer und Gabel auf den Tisch, Beatrice nahm es nicht zur Kenntnis. Erst als ich aufstand und den Stuhl hinter mich schleuderte, blickte sie auf.
Ich zog eine Pistole heraus, entsicherte sie und schrie: Niemand bewegt sich!
Die Pistole vor mich haltend, drehte ich mich einmal um die eigene Achse, dabei rief ich: Alle bleiben genau da, wo sie sind! Einige Gäste fingen an zu kreischen. Ich ging zur nächsten Säule, damit ich niemanden in meinem Rücken hatte. Als ich bemerkte, wie sich ein Kellner und zwei Frauen ganz langsam zur Ausgangstür hinbewegten, brüllte ich: Ich habe doch gesagt, alle bleiben, wo sie sind! Abwechselnd zielte ich auf die beiden Frauen und den Kellner. Auch andere, die sich zu den Fenstern begaben oder in den Ecken des Raums Schutz suchen wollten, rührten sich jetzt nicht mehr. Ich erklärte den Leuten, warum ich so wütend war. Man hatte mir eine große Ungerechtigkeit zugefügt, aber ich wußte nach dem Aufwachen nicht mehr, worin diese bestanden hatte.
Ich hatte gar nicht mitbekommen, daß sich Beatrice erhoben hatte. Sie ging auf mich zu und sagte ganz ruhig: Du machst den Menschen angst. Ich zielte auf sie und rief: Geh weg! Sie ging weiter auf mich zu und sagte: Bitte verletze niemanden. Ich schrie: Ich werde schießen! Sie kam immer näher und sagte: Die Menschen haben dir doch nichts getan. Ich fragte: Woher willst du das wissen?
Als sie unmittelbar vor mir stand, streckte sie beide Hände aus und umfaßte meine rechte Hand. Sie blickte mir in die Augen und drückte ganz langsam meine Hand mit der Pistole nach unten. In diesem Augenblick hörten die Gäste und ich eine Lautsprecherdurchsage von der Straße hinter dem Lenbach-Palais. Ich schnellte herum und sah durch die riesigen Fenster, wie Polizeifahrzeuge die Straße abriegelten und Scharfschützen auf mich zielten.
Ich schoß sofort, aber ich gab nur zwei oder höchstens drei Schüsse ab, denn ich erhielt einen Schlag in den Magen, der mich umwarf. Obwohl ich nicht hart mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug, war ich benommen. Die Hand mit der Pistole streckte ich von mir, so daß für niemanden mehr Gefahr bestand, die andere Hand legte ich auf die Stelle, wo mich der Schlag getroffen hatte. Ich spürte etwas Warmes.
Es dauerte lange, ehe ich mich dazu durchrang, den Kopf zu heben und die Stelle ins Auge zu fassen. Unter meiner linken Hand hatte sich ein roter Fleck gebildet, der immer größer wurde.
Ich blickte zur Decke hoch und sagte: Ich werde gleich sterben, oder? Meine linke Hand fiel zur Seite, ich spürte die Pistole in der rechten Hand nicht mehr, nicht einmal den Kopf konnte ich mehr drehen. Beatrice ließ sich auf die Knie nieder, genauso langsam, wie sie vorher auf mich zugegangen war. Sie legte ihre rechte Hand auf die Stelle, wo mich der Schlag getroffen hatte, und sagte: Niemand wird sterben.
Ich wußte nicht, ob ich mit meinen Schüssen jemanden getroffen hatte. Die Gäste verharrten reglos auf ihren Plätzen, die Polizisten vor dem Fenster machten keine Anstalten, den Saal zu stürmen, alle sahen uns neugierig zu.
Plötzlich spürte ich meine Hände wieder, und ich konnte den Kopf heben. Ich verfolgte, wie der rote Fleck kleiner wurde und schließlich ganz verschwand. Die Stelle war nicht mehr warm. Ich betastete mein Hemd, und ich fühlte nicht einmal ein Loch. Als ich aufwachte, hielt ich meine linke Hand an dieselbe Stelle.
Der Schriftsteller ist der einzige, dem noch erlaubt ist, ich zu sagen.
Der Wissenschaftler darf das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Tut er es trotzdem, gibt er zu erkennen, daß er einen Standpunkt vertritt, den niemand sonst teilen will. Nur Außenseiter und Querulanten sagen ich.
Der Geschäftsmann darf lediglich dann ich sagen, wenn er tatsächlich nicht sich selbst meint, sondern im Namen der Firma spricht. Aus tiefster Überzeugung. Die Firma spricht durch den Geschäftsmann. Der Geschäftsmann darf für die Firma angeben.
Weil es ihnen verboten ist, wollen alle anderen, daß der Schriftsteller ich sagt.
Der Schriftsteller sagt ich, auch wenn er gar nicht ich sagt. Jede Figur ist immer er. Der Schriftsteller sagt immer ich. Der Schriftsteller gibt mit der ganzen Welt für die für die ganze Welt an.
Beatrice möchte mir beibringen, du zu sagen.
Der erste Schritt meines Umerziehungsprogramms bestand darin, daß ich Beatrice auf den Ball der Freunde des Hauses der Kunst begleitete. Für die Freunde, die den größeren Teil des Budgets aufbringen, der kleinere Teil wird von der öffentlichen Hand finanziert, werden Previews, Führungen, Reisen und einmal im Jahr der große Ball veranstaltet. Die Funktionäre des Vereins sind allesamt gescheiterte Industrielle, diejenigen, die wirklich das Geld in die Kasse bringen, übernehmen keine Funktionen. Beatrice hat die Mitgliedschaft von ihrem Vater übernommen.
Wir hatten Plätze unmittelbar an der Tanzfläche und waren noch beim Dessert, als die ersten Ballbesucher mit dem Tanzen begannen, darunter Guggeis. Er mußte später gekommen sein, beim Stehempfang hatte ich ihn nicht gesehen. Er ist kein Freund, jemand hatte ihn mitgebracht, wie Beatrice mich. Eigentlich hätte er mich erkennen müssen, aber er konnte wirklich nicht mit meiner Anwesenheit rechnen, ich selbst erkannte mich kaum wieder in dem Smoking, den ich mir für den Anlaß hatte kaufen müssen. Ich drehte den Stuhl so, daß ich den Tanzenden den Rücken zuwandte, und stieß übertrieben herzlich mit den anderen Tischgästen an, obwohl ich sie gerade erst kennengelernt hatte. Als die Kapelle endlich Pause machte, erhob ich mich sofort und ging hinaus.
Beide hatten wir unsere Handys dabei, ich rief Beatrice an und erklärte ihr, mir sei nicht gut, sie fragte, ob sie mir helfen könne. Ich antwortete, auf der Herrentoilette könne sie das leider nicht. Ihre Stimme drückte nicht die Besorgnis aus, die für den Fall angebracht war, daß mir wirklich schlecht gewesen wäre. Sie begriff, es war ein Vorwand.
Ich wußte nicht, was ich tun sollte. Nicht einmal die Kabine verlassen konnte ich, es bestand ja die Möglichkeit, daß Guggeis hereinkam, vor der Spiegelreihe würde ich ihm nicht entgehen.
Nach einer Ewigkeit, zumindest kam es mir so vor, rief Beatrice mich an. Sie fragte gar nicht, ob ich mich besser fühlte, sondern schlug kommentarlos vor zu gehen. Wir trafen uns vor der Garderobe.
Ich griff nach ihrer Hand, als wir zu meiner Wohnung liefen. Sie erkundigte sich, ob es etwas mit dem großen Mann auf der Tanzfläche zu tun gehabt hatte. Ich erklärte ihr, wer Guggeis war. Darauf konnte sie sich auch an Fotos aus der Zeitung zum Jubiläum seines Verlags erinnern.
Beatrice hatte mit Herren von unserem Tisch getanzt und dabei die Nähe von Guggeis gesucht, um ihn zu beobachten.
Während des Tanzens habe er ständig geredet und gestikuliert. Sie habe an einen Schauspieler denken müssen, der weiß, daß er schauspielert, der aber zugleich an das glaubt, was er spielt. Sie könne ihn sich überhaupt nicht allein vorstellen, es gebe ihn nur, wenn er Publikum habe.
Erst habe er mit einer älteren Dame getanzt, dann mit einer jüngeren Frau, die der ersten ähnlich gesehen habe, vielleicht ihre Tochter. Beim ersten Mal habe er eine Hauptrolle in einem klassischen Stück gegeben, beim zweiten Mal eine Charge gespielt. Einen Aufschneider, der auf einer Parkbank Volksreden hält, der jungen Dame habe es gefallen. Der älteren Dame habe er geschildert, wie er eine Welt erst propagiert und schließlich in die Wirklichkeit umgesetzt habe. Der jungen Frau habe er den Scharlatan vorgemacht, um seinen Anteil an dieser Welt in einem möglichst rätselhaften Licht erscheinen zu lassen.
Ich erzählte ihr, seine Autoren sagten und schrieben gern über Guggeis Dinge wie: Er ist ein großes Geheimnis, je länger man ihn kennt, desto schwerer kann man ihn erklären, keine Darstellung kann ihm gerecht werden, sein Wirken ist eine Eruption in der Geschichte. Ich fuhr fort, Guggeis funktioniere auch als eine Art Rorschach-Test. Wer versucht, ihn zu portraitieren, zeichnet ein Selbstportrait. Entweder stattet er Guggeis mit Eigenschaften aus, die er am liebsten sich selbst zuschreiben würde, oder er schreibt Guggeis genau die Merkmale zu, die er an sich selbst verabscheut. Wer über Guggeis redet, spricht immer auch darüber, wie er selber sein möchte oder nicht sein möchte.
Beatrice fragte mich, ob Guggeis Kriegsteilnehmer gewesen sei. Ich nickte bejahend.
Wer so gut fickt wie sie, muß intelligent sein. Beatrice ist Psychohistorikerin, sie hat einen Lehrauftrag am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität. Ihr Vater besitzt eine Supermarktkette in Südtirol. Wir kamen auf ihren Artikel über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, der vor kurzem im Merkur erschienen war.
Ich bemerkte, der Ich-Erzähler von Heinrich Böll in Als der Krieg ausbrach leidet vor allem darunter, daß er kein nettes Mädchen findet, das mit ihm spazierengeht, Kaffee trinkt und ihn vielleicht am Abend ins Kino begleitet. Die Hölle, das sind für ihn leere, heiße Kasernenhöfe. Er beginnt erst dann wieder zu berichten, Als der Krieg zu Ende war. Alfred Andersch läßt in seinem Roman Winterspelt den Krieg mit stilistischen Tricks verschwinden, sein Protagonist Major Dincklage kämpft vor allem gegen seine Cox-Arthrose. Günter Grass hat mit der Blechtrommel gleich einen Fantasy-Roman geschrieben.
Beatrice fragte mich, ob ich auch sonst Andersch, Böll und Grass als Gewährsleute anführen würde. Ich sagte nein.
Sie schrieb gerade einen Artikel über die Auswirkungen der NS-Zeit auf das Gegenwartsbewußtsein.
Ich sagte, das Hauptnahrungsmittel der Deutschen sei Wurst. Kein anderes Volk der Welt verzehre so viel zerhacktes, in Därmen abgefülltes Fleisch. Da sei es unvermeidlich gewesen, daß die Nazis an die Macht kamen. Und die Deutschen essen immer noch so viel Wurst.
Am Tag nach dem Ball im Haus der Kunst machten wir eine Wanderung auf die Denkalm. Beatrice bestand darauf, mich zu Hause abzuholen, sie befürchtete wohl, ich würde es mir in letzter Minute noch anders überlegen.
Die bayerische Landschaft leugnet den Kitsch nicht, sie verdammt ihn nicht, vielmehr läßt sie den Kitsch gegen den Kitsch kämpfen. Dabei benutzt sie vor allem solche Kitschelemente, die früher eine sakrale Bedeutung besaßen, um die Wiederauferstehung eines Geheimnisses nahezulegen, von dem man glaubte, es gebe es nicht mehr. Die Jakobsleiter in den Himmel ist in Bayern das Netz der Wanderwege. Man kommt nicht umhin, die bayerische Natur auch zu bewundern, sie muß schon sehr luzid bleiben, um mit der Ambivalenz ihrer Bestandteile umgehen zu können, die immer im gleichen Ausmaß berauschend und unbefriedigend sind, faszinieren und abstoßen.
Die Wanderer in ihren Timberland-Schuhen, ihren Patagonia-Hemden und ihren Eastpak-Rucksäcken kamen mir vor wie ein einziger Kunde, der in einem großen Sportgeschäft ein Teil in der Hand hält und sich überlegt, ob er es kaufen soll oder nicht. Er dreht es, um es von allen Seiten zu betrachten, bis in alle Ewigkeit, es gibt das Geschäft nicht mehr, es gibt ihn nicht mehr, es gibt das Teil nicht mehr, es gibt nur noch die Natur, die infernalisch lacht.
Regelmäßig ist die Landschaft durch ein phantastisches Element oder durch mehrere solcher Elemente experimentell verformt, die Natur spielt mit großem Erfindungsreichtum die Auswirkungen durch. Aber immer fehlen Teile des Puzzles. Die Verbindung von paranormalen Fähigkeiten mit dem Schickimicki, die Darstellung des kosmischen Horrors als Sonn- und Feiertagsbanalität stellt die Signatur der bayerischen Landschaft dar. Die bayerische Landschaft ist Kolportage, die Münchner Umgebung paranoid. Alles ist zu kaufen, jedes Ding, jeder Mensch, jede Idee, allein Verschwörungen halten die gekauften Teile zusammen.
Endlich habe ich jemanden gefunden, mit dem ich wandern kann! Meine Freundin heißt Beatrice. Ich habe sie in einem Geschäft kennengelernt und gleich beim ersten Date mit ihr …Als Beatrice vorschlug, in die Berge zu gehen, freute ich mich riesig. Ich spürte, es würde ein besonderer Tag werden. Wir wollten in der Sonne wandern und dabei reden. Aber dann waren wir bald mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Ich hatte es noch nie ausprobiert, aber ich hatte schon oft gehört, daß man in den Bergen so gut …Mein Traum war schon immer, auf der Denkalm . . .
Zu den vier Elementarkräften im Universum, Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Wechselwirkung, muß eine fünfte hinzugenommen werden: Sex mit Beatrice. Beatrice schafft den, mit dem sie schlafen will, aus dem Nichts, in radikaler, durch nichts bedingter Kreativität und Souveränität. Dabei entsteht ihr Partner nicht in einem einmaligen Akt, er wird immer wieder neu geschaffen. Sex mit Beatrice dient der Verherrlichung Beatrices, ihr Partner vervollkommnet ihre Welt. Sie erweist ihm die Gnade, daß er an der Erhaltung und der Lenkung ihrer Welt mitbeteiligt ist, er spiegelt sich in ihrer Güte.
Alles, was Beatrice tut, entspringt ihrem Wissen, daß es einmal mit dem Sex vorbei sein wird. Sie kann nicht leben ohne das Phantasma, daß der Sex in einer anderen Form dauert. Dieser Horizont beschützt sie. Der Gedanke war mir völlig fremd, bis ich Beatrice traf. Das Bewußtsein, ihre Idee des Sex weitergeben zu können, bewahrt sie davor, in so etwas wie Depressionen zu verfallen. Sie konstruiert meine Erinnerungen und meine Erwartungen, damit ich mit den von ihr produzierten Erfahrungen andere prägen kann. Die Rechnungen, die im jetzigen Leben nicht aufgehen, erfüllen sich in zukünftigen Leben.
Sie schläft mit jemandem, der mit jemand anderem, und der wiederum mit jemand anderem, auf diese Weise entsteht für Beatrice so etwas wie ein heiliger Raum der Dauer. Niemals kann es das letzte Mal sein. Beatrice benutzt Männer zur Realitätsverdopplung. Sie nimmt Dinge und Ereignisse aus der gewöhnlichen Welt heraus und verleiht ihnen besondere Bedeutung, indem sie ihre sexuelle Seite hervorhebt oder sie in eine Situation verwandelt, in der sie Sex hat. Wenn sie daran denken müßte, daß es das letzte Mal ist, würde sie versagen. Trotzdem muß sie die Gewißheit erlangen, was dabei geschieht zumindest eine Strecke weit zu verstehen. Das letzte Mal bedeutet sicheres Wissen und sicheres Nichtwissen zugleich. Sie versucht, es als Grenzerfahrung zu definieren, dabei widerspricht seine Form dem Begriff der Grenze, denn der würde ja voraussetzen, daß sich das letzte Mal im vorletzten spiegeln kann. Ihr bleibt nur, das eigene Nichtwissen in der Welt festzumachen. Sie erschafft sich ein System, das ein Weltwissen mobilisiert, in dem ihr Problem kein Einzelproblem mehr ist, in dem es zurücktritt und in einer vertrauten Idee aufgeht.
Der Sex beobachtet uns. Aber der Sex ist doch keine Person, nur eine Person kann beobachten. Auch Dinge und Ideen können beobachten. Die Aufzählung aller Gelegenheiten, bei der Beatrice und ich miteinander schlafen, ergibt immer nur weitere Gelegenheiten. Aber niemals den Sex selbst.
Der Sex muß sich unterscheiden, um unterscheiden zu können. Er schafft sich Beatrice, er schafft sich mich, er schafft sich die Situation. Er muß sich nicht notwendigerweise von dem unterscheiden, was er beobachtet. Der Sex offenbart sich, Beatrice beruft sich darauf, ohne davon zu sprechen, es gibt keinen anderen Zugang zu ihm, als ihn zu haben. Er offenbart sich immer wieder, er wiederholt sich, als ob er ständig Neues verkünden möchte.
Ich bin der Feind, die Heimkehr und das Geheimnis für Beatrice.
Ich bin kein Umstand, der den Sex eines Tages unmöglich macht, ich will sein Ende, ich verkörpere es, im Licht meines Verhaltens gibt es kein natürliches Ende. Sie klagt mich an. Weil das, was ich will, nicht in der Natur der Dinge liegt oder besser in der Natur der Menschen, darf man mich nicht hinnehmen, man muß und kann etwas gegen mich tun.
Aber ich bin auch die Heimkehr, die Ahnung, daß es doch ein natürliches Ende gibt. Mein Schweigen stellt nicht nur eine Bedrohung dar, es verheißt auch Geborgenheit, Nahrung für ihren Geist, Erneuerung. Das Feindbild und das Heimkehrbild stehen im größtmöglichen Gegensatz zueinander, trotzdem gehören sie zusammen. Auf der einen Seite gefährde ich Beatrice in ihrem innersten Wesen, auf der anderen Seite kann ich gerade dieses Wesen in meinem Schweigen spiegeln und gebe dadurch eine Garantie für seinen Bestand. Beatrice betrachtet das als mein Geheimnis, auf einmal wird mein Schweigen zum Ursprung und zum Ziel. Mein Schweigen ist der eigentliche Kandidat für etwas wirklich Umfassendes, für etwas, das den Raum, den der Sex aufspannt, umfangen kann.
Wir waren vom Weg abgewichen, hatten uns im Wald verirrt und fanden uns plötzlich auf einer Lichtung wieder. Beatrice schlug vor, geradeaus zu gehen, ich folgte ihr. Doch wir kamen den Bäumen vor uns nicht näher. Auch von den Bäumen hinter uns entfernten wir uns nicht. Gleich, welche Richtung wir einschlugen, immer blieben wir in der Mitte der Lichtung.
Ich versuchte, die Bäume zu fixieren, und nahm vor einem Stamm ein Gesicht im Profil wahr. Die Haut sah aus wie die Rinde des Baumstamms. Ich rief Beatrice etwas zu, in dem Augenblick, in dem sie sich hinwandte, war das Gesicht jedoch schon verschwunden.
Auf der Lichtung lagen mehrere Baumstämme am Boden, wieder sah ich ein Gesicht, jemand hockte neben den Baumstämmen. Diesmal bot sich das Gesicht nicht von der Seite, sondern von vorn dar. Es war das Gesicht eines uralten Mannes oder eines Neugeborenen. Ich machte Beatrice leise darauf aufmerksam, beide blickten wir hin, konnten jedoch nur noch eine Bewegung in den Büschen wahrnehmen. Wir liefen dem Wesen nach, das wir nie zu sehen bekamen, bis die Sonne unterging, aber wir erreichten die Grenzen der Lichtung nicht. Schließlich brach die Nacht herein, und wir rasteten auf der Lichtung. Uns gegenseitig wärmend, schliefen wir ein.
Am Morgen tastete ich um mich.Aber der Traum aus der Nacht nach dem Ausflug mit Beatrice war noch nicht zu Ende. Ich lag auf dem Boden der Lichtung, Beatrice ging zum Rand. Bis jetzt waren wir immer zusammengeblieben und hatten gemeinsam den Mittelpunkt der Lichtung gebildet. Nun entfernten wir uns voneinander. Ich würde weiter den Mittelpunkt der Lichtung bilden. Beatrice würde im Wald untertauchen. Auf einmal würde sie sich in einer anderen Lichtung wiederfinden. Und es gab keine Verbindung zwischen den beiden Lichtungen.
Plötzlich war Beatrice verschwunden.
Schwer atmend erreichte ich die Stelle, an der ich sie zuletzt gesehen hatte, sie lag auch nicht auf dem Boden. Ich rief nach ihr und hörte eine dumpfe Stimme, die aus dem Erdboden zu kommen schien – im selben Augenblick fiel ich auch schon durch ein Loch, das von Ästen verdeckt war, in die Tiefe.
In weichem Erdreich gelandet, griff ich um mich und berührte Beatrice. Sie sagte, sie könne nichts sehen, weil sie mit dem Gesicht zuerst aufgekommen sei, sie rieb sich die Erde aus den Augen. Meine Augen waren noch an die Helligkeit von draußen gewöhnt.
Als wir wieder etwas erkennen konnten, fanden wir uns von leblosen Körpern umgeben. Sie lagen auf dem Bauch, auf der Seite, mit gespreizten Beinen auf dem Rücken, sie waren an den Wänden aufgehängt und am Boden der Höhle aufgeschichtet. Dann wachte ich aus meinem Traum auf.
Ich habe getötet.
Gemordet.
Liquidiert und beseitigt.
Zusammen mit Laura.
Ich stand an der Spitze eines beispiellosen Polizeisystems, offen habe ich Ziele und Absichten einer neuen Qualität formuliert. Nur ich konnte die gestellte Aufgabe erfüllen, andere wären dazu nicht in der Lage gewesen. Selbstsicher sah ich mir bei meinem Experiment zu, niemals habe ich versucht, meine Triumphgefühle zu unterdrücken. Es gab kein Stichwort für mich in irgendeinem Lexikon, ich war eine fundamental andere Art von Mensch. Was ich tat, ich tat es mit ganzem Herzen.
Ich war das Polizeisystem. Kann ein solches System jeden Menschen in ein Monster verwandeln? Oder bietet es lediglich Menschen mit monströsen Neigungen die Gelegenheit, diese Neigungen auszuleben? Kann jeder Mensch ein Monster sein, und wird die Monstrosität unter bestimmten Umständen gewöhnlich?
Ganz allgemein wußte ich immer, was Laura und mich zusammengebracht hatte. Aber wirklich begriffen habe ich es erst, nachdem ich sie verlassen hatte. Was uns zusammenband, war zwar vorstellbar, aber unglaubwürdig. Vielleicht bewirkten auch die zahlreichen Belege dafür eine Art Immunisierung.
Gegenüber Beatrice habe ich Laura nie auch nur erwähnt. Jetzt muß ich Beatrice alles erzählen.
Beatrice wird mich fragen, welche Lehren ich daraus gezogen habe. Ich kann Laura nicht zum Maßstab für alle Frauen machen. Dann müßte ich allen anderen Frauen einen Mangel an Charakter vorwerfen, dann hätte keine Frau Kontur neben ihr, wären alle anderen Frauen wesenlos.
Wird Beatrice sagen, was ich mt einem Teil meines Wesens glaube und wogegen ich mich mit einem anderen Teil meines Wesens verwehre: Wenn Laura einzigartig ist, dann trage ich keine Verantwortung?
Laura muß jede Schilderung unwahr, anstößig und billig finden. Eine Beleidigung für sie, eine Beleidigung auch meiner selbst, ich verwandle etwas nie Dagewesenes in eine Seifenoper, in eine Prozession von falschen Gefühlen und in nackte Leiber, besprengt mit Blut. Nur Laura und ich wissen, wie es war, die anderen wußten es nicht und werden es nie wissen.
Bis dahin war ich Guggeis noch nie begegnet. Er nahm gerade mit seinen Begleitern an einem langen Tisch in einem Selbstbedienungsrestaurant Platz. Weil es nirgendwo sonst einen freien Stuhl gab, ging ich zum anderen Ende des Tisches.
In seinem Gefolge befand sich eine sehr junge Frau, wie ich einem Gesprächsfetzen entnahm, eine neue Lektorin, sie besuchte zum ersten Mal die Frankfurter Buchmesse. Sie kam aus der Schweiz, sprach jedoch Hochdeutsch, lediglich mit einer ihrer Herkunft gemäßen Färbung.
Ob er in der Paulskirche in der ersten Reihe der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels beiwohnt, in einem Fernsehstudio ein Interview gibt oder auf der Buchmesse am Stand seines Verlags mit Buchhändlern spricht, immer empfängt Guggeis in seinem Museum. Tageslicht leuchtet alle Geschosse aus, und doch sind in jedem Saal alle vier Wände vollständig nutzbar. Man kann die Säle auf die verschiedensten Arten betreten und verlassen, mit dem Besucherlift, über die Treppe, mit einem großen Lastenaufzug, über die Feuertreppe, alle Zugänge sind hinter Wänden verborgen. Für den Besucher gibt keine Ablenkungen wie zum Beispiel eine hübsche Aussicht oder elegante Details des Gebäudes, alles in dem Museum ist darauf angelegt, den Blick und die Energie des Besuchers auf das ausgestellte Werk und auf nichts anderes zu konzentrieren.
Guggeis redete auf die junge Lektorin ein, aber er sprach auch zu mir. Offensichtlich kannte er mich von Autorenfotos, später begrüßte er mich mit meinem Namen, gab zu erkennen, daß er Besprechungen meines letzten Buches gelesen hatte, und erkundigte sich höflich nach meinen weiteren Plänen.
Er kenne Menschen, die unendlich viel lesen, und zwar Buch für Buch, die er doch nicht als belesen bezeichnen möchte. Diese Menschen besitzen eine Unmenge von Wissen, doch ihr Gehirn kann nichts damit anfangen. Sie sind nicht dazu in der Lage, das Wertvolle vom Wertlosen zu sondern, das eine im Kopf zu behalten, das andere zu vergessen. Lesen ist kein Selbstzweck, vielmehr soll es helfen, den Rahmen auszufüllen, den Veranlagung und Befähigung um jeden Menschen ziehen. Das Lesen liefert den Baustoff und das Werkzeug für den Lebenslauf des Menschen, zugleich soll es ein Weltbild vermitteln. Der Inhalt des jeweils Gelesenen darf nicht in der Reihenfolge des Buches oder der Bücher im Gedächtnis gespeichert werden, er muß vielmehr den richtigen Platz als Element des Weltbilds einnehmen. Sonst entsteht ein wirres Durcheinander von angelerntem Zeug, das ebenso wertlos ist, wie es den unglücklichen Besitzer eingebildet macht. Jeder, der liest, glaubt, mit seiner Kenntnis der Literatur mehr vom Leben zu verstehen, in Wahrheit aber entfernen sich diejenigen, deren Gehirn den Lesestoff nicht verwalten kann, mit jedem neu gelesenen Buch weiter von der Welt, so lange, bis sie nicht selten selbst Bücher schreiben.
Alle Mitarbeiter von Guggeis lachten pflichtschuldigst. Wer stets den genauen Wortlaut, den Autor, den Titel und vielleicht sogar die Seitenzahl parat habe, dessen Gehirn folge nicht den Linien des Lebens, sondern stelle sich quer zu ihnen. Der sich auf die Kunst des richtigen Lesens versteht, sucht nach einem neuen Blick, den das Buch auf die Dinge wirft, in formaler oder inhaltlicher, in gefühlsmäßiger oder wissensbetonter Weise. Der neue Blick ergänzt oder verändert die Vorstellung des Lesers von dieser oder jener Sache, er macht sie deutlicher und richtiger.
Man kann mit der Besichtigung des Museums im Basement anfangen und ins oberste Geschoß hochsteigen oder aus dem obersten ins unterste Geschoß heruntersteigen, nichts spricht dagegen, in einem mittleren Geschoß zu beginnen. Jeder Saal kann völlig unabhängig, nur für sich betrachtet werden. Der Saal im zweiten Geschoß ist nicht besser zu verstehen, wenn vorher das erste oder das dritte Geschoß besichtigt wurden. Das bedeutet aber auch, daß man beim ersten Besuch des Museums in keinem der Säle errät, wie der nächste Saal aussehen wird, obwohl alle Säle nach demselben Prinzip gestaltet sind.
Die Kunst des Verlegens bestehe darin, die Aufmerksamkeit des Publikums nicht zu zersplittern, sondern immer auf einen einzigen Autor, auf ein einziges Buch zu konzentrieren. Hier wagte die neue Lektorin Widerspruch. Unter der sichtbar befriedigten Miene des Verlegers wußte sie den Umfang der Backlist des Verlags genauso anzugeben wie die exakte Anzahl der Neuerscheinungen in diesem Jahr. Außerdem konnte sie darauf hinweisen, daß in der Verlagsvorschau die Bücher grundsätzlich entsprechend der alphabetischen Reihenfolge der Nachnamen der Autoren beworben werden, auch der Nobelpreis ändere nicht den Anfangsbuchstaben des Autorennamens. Das geschehe doch nur deswegen, damit sich die Aufmerksamkeit des Publikums nicht auf einen Autor und ein Buch, sondern auf möglichst viele Autoren, am besten alle Bücher des Verlags richte.
Je einheitlicher sich das Bild eines Verlags darbiete, desto unwiderstehlicher werde die Anziehungskraft der Bücher sein, um so gewaltiger die Wirkung der Verlagswerbung. Guggeis hob die Stimme und blickte abwechselnd zu der jungen Lektorin und zu mir.
In keiner Weise strebe er an, seine Autoren gleichzuschalten. Aber zur Genialität des Verlegers gegenüber dem Publikum gehöre vor allem, aus den vielen Autoren einen Autor und aus den vielen Büchern ein Buch zu machen. Die Menschen seien unsicher, sie könnten sich nicht entscheiden. Der Leser müsse bereits zwischen den Büchern der anderen wählen. Bei seinem Verlag brauche sich der Leser nicht zu entscheiden, immer kaufe er ein Buch.
Der Verleger ist verpflichtet, beharrlich zu seinen Autoren zu stehen und ihre Bücher zu verteidigen. Aber wichtiger ist die Beharrlichkeit bezüglich des Programms. Nie darf er Zweifel daran aufkommen lassen, daß er ein Buch verlegt. Wenn sich hier Nachgiebigkeit und Unnachgiebigkeit abwechseln, wenn der Verleger schwankt, wird das Publikum das als einen Beleg dafür nehmen, daß es dem Verleger und dem Verlag an einer festen geistigen Grundlage fehlt. Und es wird die Bücher anderer Verlage kaufen.
Überhaupt solle man sich davor hüten, das Publikum etwa für dumm zu halten. Oft entscheide das Gefühl richtiger als der Verstand. Der Leser wisse genau, die Stabilität eines Verlags sei die Folge der Entschlossenheit des Verlegers, er beurteile die Wesensart des Verlags nach der Stärke des Verlegers.
Der Leser ist Bestandteil des Begriffs der Literatur: Wenn einer schreibt und nur sich selbst als Leser hat, dann ist das keine Literatur, sondern eine Geisteskrankheit.
Guggeis benutzt Spiegel nicht, um sich selbst zu spiegeln, um sich selbst zu vervielfältigen. Er stellt Spiegel gegeneinander, um ein Gefühl von Unendlichkeit zu erzeugen. Wenn Guggeis sich in etwas spiegelt, dann in dem Gefühl der Unendlichkeit. Im Spiegelsaal seines Museums kann man alles sehen, was dort ausgestellt ist, alle Personen, die sich in einiger Entfernung von einem selbst in dem Raum aufhalten. Das einzige, was man nicht sehen kann, ist das eigene Spiegelbild. Aber das stellt nicht das einzige Paradox im Spiegelsaal dar. Auf einmal werden die Treppenzugänge und die Lifts sichtbar, die die Architektur verbirgt. Die Spiegel verstecken, was sonst gegenwärtig ist, und zeigen, was ursprünglich unsichtbar war, sie stülpen die Struktur des Saals um wie einen Handschuh.
Die neue Lektorin fragte, an wen solle sich die Werbung für ein Buch richten? An den Leser, an den Buchhandel oder an die Rezensenten?
Jeder, der in einem Verlag anfange, gleich ob in der Auslieferung oder im Lektorat, Guggeis ging bereitwillig auf die Frage ein, bekomme immer dasselbe zu hören: Man müsse sich mit den Rezensenten gut stellen, erreichen, daß sie freundliche Dinge über das Buch, den Autor und den Verlag schrieben. Dann ordere der Buchhandel, kaufe der Leser. Das sei nicht falsch. Dennoch gelte, die Werbung für ein Buch habe sich ewig nur an den Leser zu richten.
Die Rezensenten sind meistens Germanisten, die Germanistik ist eine Wissenschaft, zumindest möchte sie eine sein. Die Werbung hat sich auf die Aufnahmefähigkeit des Durchschnittlesers einzustellen, nicht auf die geistige Höhe eines Germanistikstudiums oder einer Buchhändler- oder Verlagsausbildung. Je bescheidener der wissenschaftliche oder intellektuelle Ballast der Werbung ist, je ausschließlicher sie auf das Fühlen des Lesers Bezug nimmt, um so durchschlagender wird der Erfolg sein. Ein Vorschautext ist kein Prosastück, eine Anzeige kein Gedicht. Mit dem Rezensenten darf man nicht als Rezensenten sprechen, sondern man muß mit ihm reden wie mit dem Leser, nur dann wird er in seiner Besprechung etwas schreiben, was dem Leser etwas sagt. Genauso darf man mit dem Buchhändler nicht wie mit dem Buchhändler sprechen, sondern wie mit dem Leser, dann wird er das Buch auch dem Leser verkaufen. Nie soll man versuchen, jemanden zu belehren. Den Rezensenten nicht, weil er bereits alles weiß, den Buchhändler nicht, weil er keine Zeit hat, den Leser nicht, weil er schon von allen anderen belehrt wird.
Wirkungsvolle Werbung müsse völlig subjektiv sein und sich auf wenig beschränken, das immer wiederholt wird. Der größte Fehler, den man machen kann, besteht darin, für ein Buch objektiv zu werben, aufzuzeigen, warum das Buch gut ist, und zu behaupten, daß der unparteiische Leser gar nicht anders könne, als es gut zu finden. Genau das will der Leser nicht hören. In seiner Arbeit wird er beurteilt, in seiner Familie verurteilt, immer wieder nach angeblich objektiven Kriterien. Als Leser möchte er den Tyrannen spielen, den Daumen senken oder nach oben stellen, wie es ihm gefällt. Die Wissenschaft ist die Heimstatt des Objektiven, die Literatur diejenige des Subjektiven.
Das Museum bannt seine Besucher. Man kann Guggeis ewig zuhören.
Bei der Konzipierung der Werbung für ein Buch darf man sich niemals von denjenigen leiten lassen, die alles wissen, die alles kennen, die alles gelesen haben. Sie werden in kurzer Zeit aller Dinge überdrüssig, die Überschrift über ihrem Leben ist Abwechslung, niemals werden sie es fertigbringen, sich in die Köpfe anderer Menschen hineinzuversetzen, die dieses Bedürfnis nicht besitzen. Der Leser braucht nicht alles zu wissen und zu kennen, dafür hat er starke Gefühle. Die Reklame für ein Buch muß immer an diese Gefühle appellieren. Im Gegensatz zu Germanistikprofessoren ist der Leser in seinen Gefühlen stabil. Glaube ist schwerer zu erschüttern als Wissen.
Ein Verlagsprogramm wird nicht durch Aufklärungsarbeit durchgesetzt, sondern durch Gewinnung der Meinungshoheit. Der geborene Verleger feilscht und handelt um die Gunst des Lesers im Auftrag der Literatur. Leider nimmt die Öffentlichkeit sehr oft nur das Feilschen und Handeln wahr und nicht dessen Inhalt, so zieht es auch viele kleine Geister an, die meinen, sie hätten die geistige Ausrüstung, um Verleger zu spielen. Wer Bücher verlegt, muß ein Opfer bringen, um den Gott des Publikums günstig zu stimmen. Ohne verlegerische Tatkraft gibt es keinen Fortschritt in der Literatur. Nur der Verleger kann die letzte und schwerste Verantwortung tragen. Wenn jemand nicht fähig ist, ein Buch von tausend Seiten auf einen Punkt zu reduzieren, dann taugt er nicht zum Verleger.
Sosehr es notwendig ist, die Gunst des Lesers zu erringen, mit welchen Mitteln auch immer, sowenig darf es angehen, im Verlag zu handeln und zu feilschen. Niemals kann die Mehrheit in der Verlagskonferenz den Mann ersetzen. Sie ist nicht nur eine Vertreterin der Dummheit, sondern vor allem der Feigheit. Hundert schlechte Manuskripte ergeben kein gutes und zehn falsche Gutachten kein richtiges . . .
In diesem Augenblick meldete sich das Handy des Mannes neben Guggeis. Er erhob sich, um nicht am Tisch zu telefonieren, blieb dann jedoch unmittelbar neben seinem Stuhl stehen. Er hörte nur zu, sagte ein paarmal abgehackt ja und schließlich auf Wiederhören, ehe er sich betreten auf seinen Stuhl zurückfallen ließ. Guggeis hatte mitten in seiner Rede innegehalten und blickte den Mann mit dem schmalen Haarkranz und der spiegelnden Glatze scharf an, so daß der gar nicht anders konnte, als zu berichten.
Pototsching hat sich verletzt. Es ist im Anschluß an eine Ecke passiert. Er stürmte aus dem Tor, sprang, faustete den Ball in der Luft und ließ sich dann zu Boden fallen. Eine Routineaktion – nur explodiert üblicherweise dabei nicht die Schulter. – Er wird sechs Monate den rechten Arm nicht bewegen können.
Eine saublöde Verletzung für einen Torwart, bemerkte die neue Lektorin.
Wie weit ist er mit dem Buch? herrschte Guggeis den Mitarbeiter an, offensichtlich der Lektor Pototschings.
Der zuckte mit den Schultern und nahm die große runde Brille aus Naturhorn ab, um sie mit einem Stofftaschentuch zu putzen.
Guggeis wandte sich an die neue Lektorin. Pototsching schreibt mit der rechten Hand. Sie wissen, wie wichtig er für den Verlag ist?
Das stellte eine als Frage formulierte Zurechtweisung dar, schuldbewußt schlug die Lektorin die Augen nieder.
Der Lektor versuchte, seiner jungen Kollegin zu Hilfe zu kommen: Von der U15 bis zur U18 war Pototsching Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft. Sporadisch spielt er heute noch bei den Amateuren von Hertha BSC Berlin. In seinem Körper stecken neun Schrauben. Er hat sich vier Finger der rechten Hand gebrochen, den linken Daumen zweimal, das linke Handgelenk ebenfalls zweimal . . .