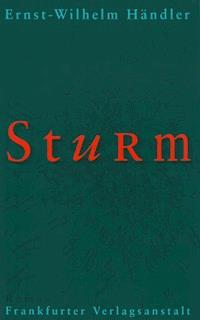Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jillian und Jacob Armacost betreiben die größte Galerie für Glaskunst New Yorks. Dabei sind sie ein denkbar ungleiches Paar: Während Jillian seit einem Kindheitserlebnis eine Passion für die Blütenlampen von Tiffany hat und mit Mitte Zwanzig bereits eine führende Expertin für Glas ist, treibt der fast dreißig Jahre ältere Frauenheld Jacob die Galerie mit einem absurden Kauf um ein Haar in den Ruin. Jillian trifft eine Entscheidung: Sie wird sich von Jacob trennen. Zuvor aber muss sie die Zukunft der Galerie sichern. Eine äußerst wertvolle Sammlung von Glasvasen in Italien erscheint als die letzte Rettung; ohne einen Moment zu zögern, reist sie nach Europa. Jacob, der nichts von ihren Plänen ahnt, ist unterdessen mit einer Kundin aus den besten Kreisen New Yorks an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze unterwegs, um auf seine Weise wieder an Geld zu kommen. Zur gleichen Zeit, als Jillian in Mailand und Venedig ihren größten Coup landet, wird Jacob in Mexiko entführt. Jillian und Jacob haben ihre Schicksale dem Glas anvertraut. Jillian spekuliert auf die Ewigkeit, Jacob auf ein intensives Jetzt. Durchsichtig und doch unnahbar, lebendig und doch unbewegt ist die Welt aus Glas. Sie bedeutet viel Geld für den, der erkennt, was er sieht. Doch besitzt der einzelne Mensch in einer Welt aus Glas noch eine Seele? Wilde Verfolgungsjagden durch die Straßen von Tijuana und erotische Eskapaden in San Diego und Venedig treiben die Handlung voran. Im neuen großen Roman von Ernst-Wilhelm Händler ergänzen sich "action" und "reflection" auf außerordentliche und spannende Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst-Wilhelm Händler
Welt aus Glas
Roman
Ernst-Wilhelm Händler in der Frankfurter Verlagsanstalt:
Stadt mit Häusern. Erzählungen
Kongreß. Roman
Fall. Roman
Sturm. Roman
Wenn wir sterben. Roman
Die Frau des Schriftstellers. Roman
1. Auflage 2009
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung und Umschlaggestaltung: Laura J Gerlach
Umschlagmotiv: Neo Rauch
eISBN: 978-3-627-02027-9
No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.
John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions
INHALT
Titelseite
Ernst-Wilhelm Händler in der Frankfurter Verlagsanstalt
Impressum
Auf der Flucht
Eine Flora im Dunkeln
Die Falle Tijuana
Shopping in Milano
Polizeikontrolle
Sales Whiz
Mögliches Ende
Die Vermessung der Welt
Trailer Trash
Die Unsichtbare I
Jacob, in der Sonne
Chuy
Shotgun Wedding
Test
Leave
Das Geld und die Wahrheit
Huitzilopochtli
Flunky
Die Kunst als Erlösung
»Hast du jemals richtig geliebt?«
Venedig sehen
Bilanz
Die italienische Schauspielerin
Das Sommerkleid
The Assignation
El Cártel
Fünftausend Lire für ein Lächeln
Was ist die Seele?
Die Unsichtbare II
Libertad
Golgatha
The Constitution of Liberty
Vergangen, vergessen, vorüber
Im Körper der anderen
Die Hochzeitsplanerin
Auf der Empore
Crucifixus Etiam
Wetterleuchten
¡NO VAYA UD!
Die andere Seite des Himmels
A Higher Echelon
Auf der Flucht
»Good bye Tijuana!«
Jacob Armacost schrie in den Fahrtwind.
Sie mußten schnellstens die Grenze erreichen!
Chuy war unmittelbar hinter ihnen. Er würde Madeline nichts tun. Aber er würde Jacob umbringen.
Fieberhaft kalkulierte Jacob: Zum Grenzübergang San Ysidro brauchte man gewöhnlich zehn Minuten, zum Grenzübergang Otay fast eine halbe Stunde. Bei San Ysidro wartete man mit dem Wagen um diese Tageszeit etwa zwei bis drei Stunden, bei Otay eine Stunde. Sie mußten mit ihrem Jeep die Taxispur nehmen und bis zur Grenze vorfahren, nur dann hatten sie eine Chance. Den Wagen würden sie einfach stehenlassen und an der Fußgängerschlange vorbei zur Immigration rennen.
Chuy trug seine Polizeiuniform. Auf mexikanischem Boden half ihnen niemand gegen einen mexikanischen Polizisten. An der Grenze zu den U.S.A. mußte Chuy begründen, warum er Jacob und Madeline verhaften wollte. Was Jacob getan hatte, konnte ihn das Leben kosten. Aber es war kein Vergehen. Sollten Chuy und seine Begleiter in Zivil vor den Augen der Immigration officers gegen Jacob und Madeline Gewalt anwenden, würde Jacob den amerikanischen Beamten seinen Ausweis hinwerfen. Dann mußten sie Meldung machen.
Chuy hatte das Blaulicht, nicht jedoch die Sirene des Polizeifahrzeugs eingeschaltet. Es war seine Privatfehde. Er fürchtete wohl, mit Blaulicht und Sirene würden ihm andere Polizeifahrzeuge zu Hilfe kommen. Seine Kollegen würden zwar gut verstehen, warum er Jacob an den Kragen wollte. Doch die Sache war wirklich nicht gerichtsfest, er konnte keine Zeugen gebrauchen. Weil die Sirene stumm blieb, machte der Mittagsverkehr auf dem Paseo de los Heroes Chuy nur sehr verspätet Platz.
Alle drei Spuren vor ihnen waren blockiert, Jacob wechselte auf die Standspur. Er überholte einige Fahrzeuge, danach drängte er sich wieder in die mittlere Fahrspur. Chuy konnte ihnen nicht folgen, er hing hinter einem Truck fest, der an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen wollte.
Bei diesem Manöver kam sich Jacob sehr cool vor.
Er nahm mehrere hastige Schlucke aus der Wasserflasche, die er immer mit sich führte.
Weniger cool war allerdings: Sie waren in der falschen Richtung unterwegs. Man brauchte nur vor dem Hotel in den Paseo de los Heroes links einzubiegen, man mußte immer geradeaus fahren, dann war man schon nach wenigen Kilometern bei San Ysidro. Aus einem unerfindlichen Grund staute sich der Verkehr heute in dieser Richtung, Jacob war nichts anderes übriggeblieben, als auf dem Platz vor dem Hotel die Statue des Cuauhtémoc zu umrunden und den Paseo de los Heroes in der Gegenrichtung zu nehmen. Die Spanier hatten dem Aztekenhäuptling die Füße verbrannt, trotzdem hatte er nicht verraten, wo das Gold versteckt war. Den Azteken hatte das nichts genützt.
Jacob wußte nicht, wie er den Paseo de los Heroes umfahren sollte, um nach San Ysidro zu kommen. Also nicht nach San Ysidro, sondern nach Otay. Dieser Grenzübergang lag unmittelbar neben dem Flughafen. Sie mußten sich immer nur geradeaus halten, dann kam nach Jacobs Erinnerung eine große Kreuzung, eine Brücke führte über das Flußbett des Rio Tijuana und eine Straße den Berg hoch zum Flughafen. Ab in die U.S.A.!
Durch den jaulenden Motorenlärm des Jeeps rief Jacob Madeline zu, sie solle den Stadtplan von Tijuana aufschlagen, der auf der Mittelkonsole lag. Sie reagierte nicht, er war gezwungen, sie anzuschreien. In ihrer Aufregung hielt sie den Plan verkehrt herum. Darauf mußte er sie erst hinweisen, das ging ebenfalls nur laut. Als sie den Plan drehte, stieß sie mit der linken Hand gegen den Rückspiegel und verstellte ihn.
Jacob konnte nicht mehr sehen, wie dicht Chuy hinter ihnen war. Während er den Spiegel justierte, erblickte er sich kurz selbst darin. Sein Gesicht war gerötet von der Sonne und der Anstrengung, seine mittellangen kräftigen blonden Haare wehten im Wind, alle Fenster waren offen. Er sah gar nicht aus wie jemand, der verfolgt wurde und um sein Leben fürchten mußte. Um seinen Mund spielte sogar die Andeutung eines Lächelns.
Bis auf zwei oder drei oberflächliche Querfalten in der Stirn hatte er überhaupt keine weiteren Falten. Seine Augenbrauen waren dunkler als seine Haare, so daß man auf den Gedanken kommen konnte, er habe seine Haare heller gefärbt. Er hatte keine grauen Haare. Das galt freilich nur so lange, wie er sich rasierte. Auf der Oberlippe und am Kinn waren die braunen von grauen Haaren durchsetzt. Früher hatte er sich nur alle zwei oder drei Tage rasiert, jetzt ließ er keinen Tag aus.
Sein schwarzes T-shirt war schweißnaß. Seine Lederjacke hätte er besser ausgezogen, dazu hatte er keine Gelegenheit gehabt. Er ging immer mit der kurzen schwarzen Lederjacke aus, in den Taschen sein Geld, seine Papiere und sein Telefon. Er haßte es, wenn er sich etwas in die Hosentaschen stecken mußte.
Als Chuy vor dem Hotel auf sie zugelaufen war und die Pistole aus dem Halfter zog, hatte Jacob keine Angst gehabt.
Er stieß Madeline auf den Beifahrersitz, knallte die Tür zu, lief zur anderen Seite, ließ sich in den Sitz fallen und fuhr los, ehe er die Fahrertür schloß.
Jacob wäre lieber allein gewesen. Madeline behinderte ihn. Sie war jedoch auch ein Schutz: Chuy konnte ihm erst gefährlich werden, nachdem er sie beide auseinandersortiert hatte.
Seit einiger Zeit träumte er, er gehe durch geschlossene Türen und Mauern hindurch. In New York hatte er das Haus in der Spring Street mit der Galerie verlassen, indem er durch die Wand vom Schlafzimmer in das Treppenhaus gelangt und durch die gesicherte Eingangstür auf die Straße getreten war. Dann hatte er Madeline abgeholt, ihre Wohnung hatte er ebenfalls durch die geschlossene Tür betreten. Wenn er jetzt nicht aufpaßte, würde er bald nicht nur in seinen Träumen ein Geist sein. Das war nicht mehr der Paseo de los Heroes, das war eine Ausfallstraße nach Nordosten. Sie mußten schon lange über die Kreuzung hinweg sein, an der man zum Flughafen abbog. Jacob hatte keine Schilder gesehen, die riesigen Trucks auf allen Spuren hatten ihm die Sicht versperrt. Chuy war dicht hinter ihnen und versuchte, sie zu überholen. Er wollte sich vor sie setzen, abbremsen und ihnen den Weg verstellen. Die Scheiben des Polizeifahrzeugs waren nur wenig getönt, Jacob konnte das Gesicht seines Verfolgers deutlich sehen. Er wirkte ziemlich entschlossen.
Jacob fuhr ganz nah auf den Truck vor ihm auf, so daß Chuy sich nicht vor ihnen hineindrängen konnte.
Chuy ließ sich zurückfallen. Als er neben Jacob war, ließ der sich ebenfalls zurückfallen. Dann beschleunigte er. Chuy hielt sich neben ihnen.
Der Verkehr verlangsamte sich, und Jacob bremste plötzlich stark. Der Truck hinter ihnen kam bedrohlich nahe, nicht ohne ohrenbetäubend zu hupen. Chuy bremste gleichfalls. Als Jacob nur noch im Schrittempo fuhr, tat Chuy, womit Jacob gerechnet hatte. Chuy beschleunigte kurz, überholte sie und stellte sich vor ihnen quer.
Im gleißenden Sonnenlicht war das Blaulicht kaum sichtbar, nach wie vor hatte Chuy die Sirene nicht eingeschaltet. Die lokale Polizei in Tijuana fuhr Chevrolet Suburbans, der Wagen war nicht lang genug, um beide Spuren vollständig zu blockieren.
Sowohl Jacob als auch Madeline waren angeschnallt. Jacob gab Gas und hielt auf die Schnauze des Chevy zu.
Der Aufprall war lauter, die Erschütterung weniger stark, als er gedacht hatte. Das Glas der Scheinwerfer zersplitterte, die Windschutzscheibe des Jeeps blieb ebenso wie die des Suburban unbeschädigt. Durch den Aufprall wurde das Polizeifahrzeug so weit zur Seite geschoben, daß sie vorbeikonnten. Jacob drückte das Gaspedal durch und stieg probehalber auf die Bremse, der Wagen gehorchte ihm.
Weiter vorn schaltete eine Ampel gerade auf Grün um. Es gab keine Abbieger, Jacob überholte alle Fahrzeuge auf der rechten Spur. Nach der Ampel war der Verkehr geringer, mit hoher Geschwindigkeit konnte er auf der Ausfallstraße weiterfahren.
Im Rückspiegel war Chuy nicht zu erblicken! Sie mußten umkehren, um die Grenze zu erreichen. Die nächste Kreuzung, bei der die Ampel auf Gelb stand, bot die Gelegenheit dazu. Mit quietschenden Reifen machte Jacob einen U-turn und fuhr in die Stadt zurück. Jetzt tauchte auch Chuy auf, der sie natürlich sah, aber an der Ampel aufgehalten wurde. Die Windschutzscheibe des Jeeps war doch beschädigt. Von der rechten unteren Ecke nahm ein Sprung seinen Ausgang, der sich langsam quer über die gesamte Fläche voranarbeitete. Jacob hoffte, daß die Scheibe halten und nicht blind werden oder zersplittern würde.
Er nutzte die Atempause, um Madeline zu beruhigen. Gleich seien sie an der Grenze. Zweifellos wäre sie in diesem Augenblick alles lieber gewesen als eine Mittdreißigerin, in Scheidung lebend und mit ihm zusammen auf der Flucht vor einem wildgewordenen Polizisten, in einem Land, in dem man auf nichts hoffen durfte. Sie sah jetzt sogar jünger aus, wie sich ihre Augen weiteten und in Tränen schwammen, ohne allerdings überzulaufen und das schwarze Makeup in Mitleidenschaft zu ziehen. Was hatte sie mit der Sache zu tun – wo hatte Jacob sie da hineingezogen! In ihrem Gesicht hielten sich der Schrecken und das Beleidigtsein darüber, daß man sie derart in Schrecken versetzte, die Waage. Sonst lagen ihre über die Schulter reichenden langen blonden Haare an ihrem Kopf an und unterstrichen ihre breiten Backenknochen. Jetzt bauschte der Fahrtwind die Haare auf, und ihre zur Flachheit neigenden Gesichtszüge bekamen auf einmal Charakter.
Seit Jacobs Ausflügen mit Pilar an die Grenze zwischen San Diego und Tijuana zog Madeline keinen BH mehr an. An dem kurzen geschlitzten Rock und dem knapp sitzenden Oberteil, beides in einem kleinteiligen pinkfarbenen Paisley-Muster, leistete der Fahrtwind in schöner Abwechslung Entblößungs- und Verhüllungsdienste. Irgendwie machte die Situation Madeline schlanker. Darauf hätte Jacob gern verzichtet, er war nicht wegen ihrer Figur oder wegen ihrer charaktervollen Gesichtszüge mit ihr nach Tijuana gekommen. Der Stau vor ihnen riß ihn aus seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. In jedem Fall mußten sie die nächste Ausfahrt nehmen. Auf einer Anhöhe rechts vor ihnen breitete ein riesiger weißer Christus seine Arme über die Fabriken und Highways unter ihm aus.
Sie gelangten auf eine Straße, die parallel zu der Einfallstraße verlief. Die dunkelblaue Halbkugel, auf der die Christus-Statue stand, war die Kuppel einer Kapelle. Chuy war nicht im Rückspiegel zu sehen, weil er sie bereits überholt hatte. Scharf zog er von links nach rechts herüber, um sie dazu zu zwingen, langsamer zu fahren. Jacob riß das Steuer rechts herum und bog ab. Ein Taxi wich ihnen geistesgegenwärtig aus. Sie hörten, wie das Polizeifahrzeug quietschend bremste, während sie die steile Straße bergan rasten.
Der Sprung in der Scheibe des Jeeps war genau in der Mitte von Jacobs Gesichtsfeld angekommen. Sie mußten es schaffen!
Jacob hielt sich immer links, aber alle Straßen bogen sich nach rechts. Anstatt der Grenze näher zu kommen, entfernten sie sich davon. Gezwungenermaßen umrundeten sie den Ortsteil auf der Anhöhe und langten schließlich bei dem großen weißen Christus an.
Chuy war nicht hinter ihnen.
In einem Reflex fuhr Jacob auf den Parkplatz vor der Kapelle mit der Christus-Statue. Doch der Gedanke, in der Kirche Unterschlupf zu suchen, war unsinnig. Kein Priester würde ihnen angesichts der uniformierten Gewalt Schutz bieten. Jacob dachte daran, ein Taxi zu rufen und sich damit zur Grenze bringen zu lassen. Aber Chuy hatte wahrscheinlich Zugriff auf den Taxifunk, wenn sie Pech hatten, war er selbst der Taxifahrer.
Mit durchdrehenden Rädern wendete Jacob auf dem Parkplatz. Die Engel auf dem Zaun sowie auf der Aussichtsterrasse über Tijuana bewachten nicht etwa das Anwesen.
Der Außenwelt den Rücken mit den spitzen Flügeln zukehrend, waren ihre Blicke ausnahmslos auf den großen weißen Christus gerichtet. Mit der rechten Hand führten sie eine Posaune zum Mund, mit der linken hielten sie eine Kugel hoch. Sie kümmerten sich nicht um die Einwohner der Stadt, sie verherrlichten den Gottessohn. Die Engel waren Klone, einer sah aus wie der andere.
In den Türmen und dem Schiff der Hauptkirche über der Kapelle mit der Christus-Statue leuchteten bunte Glasfenster. Jacob schüttelte sich. Das große Glasfenster in der überdachten Galerie neben der Hauptkirche stellte bestimmt die Himmelfahrt Mariens dar. Jacob ließ den Motor aufheulen.
Sie rasten die steile Straße zurück, die sie gekommen waren, bogen stadteinwärts ab und hatten den beschädigten Suburban wieder im Rückspiegel. Chuy kannte sich aus, er hatte am Ausgang des Ortsteils gewartet, in der Gewißheit, sie nicht zu verpassen.
Er setzte sich unmittelbar hinter sie. Aber er machte keinerlei Anstalten, sie zu überholen oder zu bedrängen.
Durch die Verfolgungsjagd erschöpft und um das Risiko eines Unfalls zu vermindern, fuhr Jacob jetzt etwas langsamer. Chuy tat es ihm gleich. Er konnte ruhig abwarten, bis sich eine Verkehrssituation ergab, die auch ohne sein Zutun verhinderte, daß Jacob weiterfahren konnte.
Jacob überlegte, ob er nicht versuchen sollte, Madeline zu überreden, sich ans Steuer zu setzen. Er mußte einen Zwischenspurt einlegen, mehrere Trucks zwischen sich und Chuy bringen und an einer Stelle halten, an der Chuy den Fahrerwechsel nicht mitbekam. Je später er ihn bemerkte, desto besser für Jacob. An einer unübersichtlichen Stelle würde er aussteigen und sich zu Fuß in Sicherheit bringen.
Madeline würde ihren Kopf hinhalten. Das wäre dann genau die Art und Weise, mit der er sich üblicherweise in seinem Leben aus der Affäre zog.
Er warf einen prüfenden Blick zu Madeline hinüber. Sie hatte die Haare mit Hilfe einer Spange zu einem Knoten geformt und am Hinterkopf befestigt. Der Fahrtwind zauste nur noch die über die Schultern herabhängenden Haare. Sie bewegte den Mund, sie legte die Stirn in Falten und gestikulierte verzweifelt mit den Händen, aber kein Ton kam über ihre Lippen. Sie sprach entweder mit dem Schicksal oder mit ihrem Mann. Jacob fand, das war in ihrem Fall ziemlich dasselbe. Sie schilderte, wie sie in diese mißliche Lage gekommen war, daß sie das alles nicht beabsichtigt hatte, und sie bat ihren Mann oder das Schicksal, sie aus der Gefahr zu erretten. Ihr Mann konnte ihr nicht helfen, auch das Schicksal erhörte sie nicht. Natürlich war sie unfähig, auch nur ein paar Yards am Steuer des Jeeps zurückzulegen. Der Riß in der Scheibe hatte inzwischen Gesellschaft bekommen. Am unteren Rand war das Glas an mehreren Stellen gesprungen. Die neuen Risse pflanzten sich schneller fort.
Mit Sicherheit waren es nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze. Jacob mußte vor einer Kreuzung halten. Eine Grünphase würde nicht genügen, um die Kreuzung zu überqueren. Im Rückspiegel sah Jacob, wie die Türen von Chuys Suburban aufgingen.
Jacob blieb nur noch eins, über den Bürgersteig zu fahren. Der war jedoch von den Schülerinnen einer ganzen Schule blockiert: keine jünger als zwölf, keine älter als sechzehn, trugen sie alle dieselben kurzen grauen Faltenröcke, dieselben weißen Blusen und dunkelblaue Pullover mit V-Ausschnitt oder Jacken. Manche hatten weiße Strumpfhosen an, manche weiße Kniestrümpfe, manche weiße Söckchen zu schwarzen Schuhen. Nicht ein einziges der Mädchen war blond.
Die Türen des Suburban standen offen, Chuy und seine Männer überlegten, ob sie die Verfolgung zu Fuß oder mit dem Wagen fortsetzen sollten.
Jacob drückte anhaltend auf die Hupe, bevor er das Lenkrad einschlug. Er fuhr viel langsamer über die Bordsteinkante, als es ihre Lage geboten sein ließ.
Als der Jeep auf sie zukam, gerieten die Mädchen keineswegs in Panik. Sie beeilten sich nicht einmal auszuweichen. Einige Mädchen lächelten Jacob sogar zu, während sie ihm Platz machten. Das veranlaßte ihn, ein zweites Mal energisch zu hupen und sich mit dem aus dem Fenster gestreckten linken Arm zu bedanken, nachdem er den Bürgersteig überwunden hatte. Nicht ohne Befriedigung stellte er fest, daß mehrere Mädchen zurückwinkten. Es waren die allerjüngsten, die älteren beachteten ihn nicht.
Jacobs Sicht wurde immer schlechter. Ein zusammenhängendes Netz von Sprüngen durchzog jetzt die Windschutzscheibe des Jeeps. Bald würde er gar nichts mehr sehen.
Die breite Straße wurde immer schmaler. Sie mündete schließlich in eine Straße mit nur einer Fahrspur in jeder Richtung. Jacob konnte nicht schneller fahren und nicht überholen. Chuy hatte keine Mühe, Anschluß zu halten.
Im Rückspiegel sah Jacob, daß Chuy und seine beiden Männer Masken aufgezogen hatten. Die mexikanische Polizei führte Razzien nur maskiert durch. Jacob erschrak nicht wenig. Die schwarzen Masken, die nur die Augen und die Nasenlöcher frei ließen, waren ein schlechtes Zeichen.
Das Ende der Verfolgungsjagd drohte schließlich in Form eines Kamerateams.
Auf der ansteigenden Straße parkte unübersehbar ein Konvoi von Vans. Mehrere Kameras waren aufgestellt, die alle La Mona fixierten. Das ungeliebte Wahrzeichen von Tijuana war die etwa sechzig Fuß hohe weiße Figur einer nackten Frau mit wehenden langen Haaren, die den rechten Arm nach oben streckte. Ein, wie nicht nur Jacob fand, verrückter Künstler hatte die Figur inmitten eines Wohngebiets errichtet, in dem sich heruntergekommene Häuser mit Hütten aus Holz und Wellblech abwechselten. Die Figur war aus mit einer Kunststoffschicht überzogenen Baustahlmatten geformt. In ihrem Inneren beherbergte sie begehbare Räume, den größten in der Gegend des Beckens, die Mexikaner liebten üppige Figuren. Zwischen den Brüsten tat sich in der weißen Haut eine dunkle Öffnung auf. Jemand winkte aus der Öffnung, eine der Kameras war auf die Öffnung gerichtet.
Dammit.
Die Wagenkolonne des Filmteams blockierte die Straße. Auf der Gegenfahrbahn kam ihnen eine ununterbrochene Reihe von Fahrzeugen entgegen.
Jacob mußte anhalten.
Es gab keine Fluchtmöglichkeiten mehr, auch nicht zu Fuß. Der Abhang rechts von der Straße fiel steil ab, links begrenzte eine geschlossene Gebäudereihe die Straße.
Jacob verfolgte im Rückspiegel, wie sich die Türen des Polizeifahrzeugs gemächlich öffneten und die Insassen langsam ausstiegen.
Chuy hatte eine Maschinenpistole umhängen, seine beiden Männer ebenso.
Die Maschinenpistolen waren ein ganz schlechtes Zeichen. Jacob hatte nackte Angst.
Eine Flora im Dunkeln
Jillian Armacost war sich sicher gewesen: Der Anruf der Unbekannten, die ihr eine große Sammlung von Martinuzzi-Gläsern in Mailand anbot, bedeutete die Rettung. Sofort hatte sie sich ins Flugzeug gesetzt.
Vasen in Amphorenform säumten den Eingang zu der Höhle: zuerst die Anfora pulegosa Vittoriale in Grün und Braun, eine ausladende Vase mit fünf rippenförmigen Henkeln übereinander auf jeder Seite. Dann eine fast zwanzig Zoll hohe schmale grüne Amphore mit weit vom Hals weggezogenen Henkeln, die am Korpus schlangenförmig ausliefen, eine eiförmige Amphore mit kurzen runden Henkeln am Hals und eine Vase, deren Korpus mit dem der Vittoriale identisch war und die zwei kleine rippenförmige Henkel sowie quadratische Applikationen hatte. Jillian wußte, die Vittoriale wurde so genannt, weil sich in der Stanza della Zambracca im Vittoriale, der Villa des Dichters Gabriele d’Annunzio am Gardasee, ein gleichartiges Exemplar befand. Napoleone Martinuzzi hatte diese Vasen Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre für Venini entworfen. Sie bestanden aus Vetro pulegoso, einer schaumartigen Glaspaste mit zahlreichen unregelmäßigen kleinen Luftbläschen. An den Mündungen der Amphoren, an den Henkeln und am Sockel waren im Glas hauchdünne Goldfolien aufgelöst, die Oberfläche irisierte.
Die Besitzerin der Sammlung ging voran, Jillian folgte ihr mit vorsichtigen Schritten.
Cindi Prescott gab an einer High school in Brooklyn Computerkurse. Ihre Großmutter war Italienerin gewesen. Von der Schwester der Großmutter hatte sie eine große Wohnung in dem Ende der zwanziger Jahre erbauten Eckhaus am Corso Buenos Aires im Zentrum Mailands geerbt. Die kinderlose Großtante stammte aus Mailand, hatte nach Turin geheiratet und war nach dem Tod ihres Mannes wieder nach Mailand gezogen.
Die Wohnung und sämtliche Einrichtungsgegenstände der Tante waren bereits verkauft. Bis vor wenigen Tagen hatte Cindi Prescott keine Kenntnis von der Existenz der Glassammlung gehabt. Erst der Pächter des Ladenlokals im Haus, er war im Alter der Tante, machte sie darauf aufmerksam, daß zu der Wohnung der Tante auch ein Raum gehörte, der unter dem eigentlichen Keller lag. Die Erbin hatte die Tante nicht öfter als drei- oder viermal gesehen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Wohnung und des Glasschatzes konnte die Lehrerin ihr Lehrerinnendasein beenden.
In der Mitte eines am Boden und an den Wänden mit einem beigefarbenen Mosaik verkleideten Kellerraums führte eine schmale steile Treppe zu dem Raum darunter. Als Jillian in den Rahmen aus sehr alten grünen Kacheln gestiegen war, der die Bodenöffnung mit der Treppe umgab, hatte sie das Gefühl gehabt, in eine andere Zeit einzutauchen.
Die Höhle schien aus Stein herausgehauen, man lief auf Felsboden. Am Eingang standen Wachskerzen in Wandvertiefungen, der Hauptraum wurde durch mannshohe Kerzenleuchter erhellt. Wenn die Höhle eine Dekoration war, dann eine sehr gelungene.
Vor einer auf dem Boden liegenden Kirchenkanzel sah sie weitere Pulegosi in Dunkelgrün und Schwarz mit schlangenförmigen Griffen, blaue Pulegosi mit runden und glatten Henkeln und eine prächtige hohe Vase in Pokalform mit abwechselnd gestreckten und sich ringelnden goldgesprenkelten Schlangen. Um einen mit rotem Samt überzogenen geschnitzten Sessel standen zahlreiche Vasen aus Vetro velato, das war mattes Glas, mit einer dünnen Schicht durchsichtigen glänzenden Glases überfangen, und aus Pasta vitrea, das war mattes, nicht überfangenes Glas. Das flackernde Kerzenlicht fiel auf rote Vasen, auf schwarze Vasen mit rotgeränderten Mündungen und Sockeln sowie roten Henkeln und auf Vasen in Grau- und Blautönen mit Blättern als Applikationen. Noch nie zuvor hatte Jillian Armacost eine größere und schönere Sammlung von Martinuzzi-Gläsern gesehen.
»Wie war Ihr Flug?«
Angesichts der überwältigenden Sammlung war Jillian nicht nach Konversation.
»Nopgrade. Aber ich habe die ganze Zeit geschlafen.«
Jillian ging in die Knie, um nach einer kleinen Vase aus transparentem amethystfarbenem Glas zu greifen. Die Vase hatte Amphorenform, rechts und links vom Hals waren auf dem Korpus jeweils zwei weitere Glasröhren aufgesetzt, zusammen mit dem Hals streckten sie sich nach oben wie die Finger einer Hand. Alle Mündungen und der Sockel waren mit Kristallglas verziert. Sie hütete sich, die Vase an einer der Mündungen zu fassen. Den Korpus mit der rechten Hand umfangend, die linke unter dem Sockel, drehte sie sich zum nächststehenden Kerzenleuchter hin. Es gab kein Durchlicht. Sie erhob sich und hielt das Glas unmittelbar vor den Kerzenständer. Gleichgültig schluckte es das Licht. Unter jeder Beleuchtung verriet es gleich viel oder gleich wenig von sich selbst.
Cindi Prescott nahm an, Jillian habe eine Abendmaschine genommen. Aber sie war mit einer Morgenmaschine gekommen.
Sie stellte die Vase auf den Boden zurück.
»Auf jeden Fall bin ich ausgeruht für das hier.«
Jillian Armacost war immer abends ausgeruht, denn sie schlief am Vormittag und ging erst nach Sonnenuntergang aus dem Haus. Dafür hatte sie Gründe.
Ihre schulterlangen glatten, nur an den Spitzen leicht gewellten Haare waren blondiert und gesträhnt, ihre dunkelgrünen Augen wirkten unter der Kerzenbeleuchtung fast braun. Sie hatte gerade und schmale, aber trotzdem kräftige Augenbrauen. Das ärmellose graue Baumwollkleid, es endete über den Knien, gab den Blick auf eine sehr helle Haut frei, die in seltsamem Gegensatz zu der trainierten Figur stand. Sie war siebenundzwanzig, aber sie sah aus wie siebzehn. Wie alle Kunden, die ihr zum ersten Mal begegneten, war auch die Erbin der Martinuzzi-Sammlung überrascht, daß Jillian Armacost, die wichtigste Glasgaleristin der Welt, so jung war.
Ein Krater bildete das Zentrum der Höhle. Die Kraterwülste waren kniehoch, der Krater war mit Sand aufgefüllt. Jillian stockte der Atem.
Aus dem Inneren des Kraters ragten vier mindestens acht Fuß hohe Piante grasse aus grünem Vetro pulegoso – Pianta grassa war die italienische Bezeichnung für Sukkulente – in die Höhe.
Jillian war nicht groß, ihre einfachen schwarzen Lederstiefel hatten flache Absätze. Aber sie hätte sich nicht träumen lassen, daß sie einmal vor einer Pianta grassa stehen würde, zu der sie hochblicken mußte.
Die Stämme und Äste der Pflanzen waren aus kelchartigen Teilen zusammengesetzt, aufgereiht auf nicht sichtbaren Gerüsten aus Eisenstangen. Sie standen auf Steinen nachgebildeten Holzsockeln, die wiederum in Gipsuntersätzen verankert waren. Jillian kannte derart große Piante grasse nur von Abbildungen. Wenn sie sich richtig erinnerte, waren genau diese vier Ausnahmeobjekte bei der Quadriennale d’Arte in Rom 1931 ausgestellt worden, sie galten als verschollen. Die großen Piante grasse waren äußerst unhandlich, zum Transport mußten sie mühsam in ihre Einzelteile zerlegt werden. Mit Sicherheit handelte es sich hier nicht um Fälschungen, denn das Wissen war verlorengegangen, wie man Vetro pulegoso mit der für die Stücke von Martinuzzi so charakteristischen Patina herstellte.
Die Pflanzen hatten auf Jillian gewartet.
Diejenige mit den spitzen feuerroten Knospen streckte ihr freundlich die beiden größeren der drei aus dem Bodenteil herauswachsenden Äste entgegen, nur der kleinere zeigte in eine andere Richtung. Die Pflanze mit den herabhängenden kugelförmigen blauen Knospen richtete sich stolz auf, als sie Jillian sah, und stellte ihre langen gezackten Blätter auf. Diejenige mit der großen gelben Knospe beugte sich teilnahmsvoll zu ihr herunter, die breiten, in den Stamm eingehängten Blätter wandten sich ihr zu, wie um sie zu berühren. Nur die Pflanze mit dem dicksten Stamm, die auch nicht knospte, nahm keine Notiz von ihr.
Um die vier großen Pflanzen waren zahlreiche kleinere gruppiert, der aufgeschüttete Krater glich einem Wüstengarten. Jillian hatte fast alle der kleineren Modelle schon einmal gesehen, aber niemals in solcher Zusammenballung: ein kerzenförmiger grüner Kaktus in einem grünen Topf, eine sich in spitzen länglichen Blättern fächerartig entfaltende blaue Pflanze in einem runden gerippten blauen Topf, eine wie ein Unterwassergewächs aussehende Pianta grassa in einem glockenförmigen weißen Topf, ein aus drei Elementen bestehender hoher schwarzer Kaktus in einem durchsichtigen Gefäß mit schwarzem Rand und einer Blüte aus durchsichtigem Glas, eine blaue Pflanze mit drei sich öffnenden Kelchen in einem kugelförmigen blauen Gefäß sowie kleinere rote, blaue und grüne Blätterpflanzen in konischen Gefäßen der gleichen Farbe, immer golden irisierend.
»Wie wollen Sie das Geld?«
Jillian fuhr mit dem Zeigefinger der rechten Hand über eins der Blätter der Pflanze mit der gelben Knospe. Das Blatt war genauso staubig, wie man es erwarten konnte.
»Ein Scheck, eine Überweisung, Cash, eine kleine Überweisung und einen großen Teil Cash oder umgekehrt? – In Dollar, in Euro, in Schweizer Franken?«
Cindi Prescott mochte zwischen dreißig und vierzig Jahre alt sein, ihre kurzen schwarzen Haare, die die Ohren frei ließen, waren über den Augenbrauen gerade abgeschnitten, sie hatte sich nicht geschminkt. Mit Interesse nahm Jillian die Schweißflecken zur Kenntnis, die sich auf dem pinkfarbenen Tenniskleid zwischen den Brüsten, um den Nabel und über den Hinterbacken abzeichneten. In der Höhle war es nicht heiß.
»Sie wollen alles kaufen?«
»Sie wollen doch alles verkaufen. Wenn Sie Cash möchten, wird das zwei große Kelly Bags oder drei große Birkin Bags voller Geld geben.«
Cindi Prescott hatte Jillians Galerie im Internet gefunden. Es lag nahe, auch mit Galeristen aus Mailand zu verhandeln, Maurizio Cocchi und Franco Deboni, der Autor des Standardwerks über Venini, hatten ebenfalls Websites. Der Verkauf einer solchen Sammlung war Vertrauenssache, die Erbin hatte sich lieber an eine New Yorker Galerie gewandt. Daran tat sie gut, die italienischen Galeristen verfügten nicht über die finanziellen Mittel, die Sammlung als Ganzes anzukaufen, sie konnten sie höchstens weitervermitteln.
Es gab immer die Möglichkeit, die Sammlung en bloc in ein Auktionshaus einzuliefern. Cindi Prescott konnte in Turin Semenzato, in London oder New York Christie’s oder Sotheby’s beauftragen. Eine Auktion mit solchen herausragenden Stücken wäre eine Sensation und ein ungeheurer Prestigegewinn für das betraute Auktionshaus. Christie’s oder Sotheby’s würden eine Garantiesumme bieten. Der Katalog würde die Besitzerin unsterblich machen. Aber gehörte ihr die Sammlung wirklich? Wenn Zweifel an ihrer Eigentümerschaft bestanden: Auktionen hatten den Nachteil, daß sämtliche Summen, die flossen, offengelegt wurden.
Mit ihrer Digitalkamera fotografierte Jillian die Stücke so, wie sie arrangiert waren, und machte sich anschließend einige Notizen. Sie schrieb auf der umgestürzten Kirchenkanzel.
Die Art, in der Jillian vom Geld sprach, hatte Cindi Prescott sichtlich angst gemacht. Mit hilflos herabhängenden Armen drückte sie sich in eine Vertiefung der Höhlenwand. Als Jillian sich zum Gehen bereit machte, trat sie so nah an Cindi Prescott heran, daß diese nicht nach rechts und nicht nach links ausweichen konnte.
Sie fragte Cindi Prescott, ob sie wisse, welchem Zweck die Höhle früher gedient habe. Die schüttelte den Kopf. Der Geschäftsinhaber hatte ihr lediglich erzählt, daß hier Zusammenkünfte stattgefunden hatten, zu denen immer auch Leute aus Turin gekommen waren. In Italien und besonders in Turin gab es eine Tradition von Satanskulten. Die Höhle konnte gut einer entsprechenden Gesellschaft als Veranstaltungsort gedient haben.
»Es sieht so aus«, Jillian wies auf den Krater, »als hätte man hier einen Höllenschlund zugeschüttet.«
Jillian fühlte sich wohl neben dem Höllenschlund. Sie kündigte an, innerhalb von vierundzwanzig Stunden ein Angebot für die Sammlung zu machen.
Während Cindi Prescott Jillian zum Ausgang der Höhle begleitete, drehte sie sich mehrmals nach dem Krater um. Es kam Jillian so vor, als müsse sie sich beherrschen, um nicht plötzlich loszulaufen, weg von dem Krater. Es war gut, daß sie Angst hatte. Sie würde die Sammlung nicht in eine Auktion geben oder anderen Galeristen anbieten.
Jillian Armacost mußte bis zum Ende des Jahres drei Millionen Dollar verdienen. Mit dem Kauf und dem Weiterverkauf der Sammlung würde sie einen gewaltigen Schritt zur Erreichung ihres Ziels tun.
Als sie sich verabschiedet hatte und auf die nächtliche Straße trat, sagte sie laut: »Hey, I’m one happy gal!«
Die Falle Tijuana
Wenn auf die Todesangst das Ereignis folgt, dem sie gilt, stellt sich danach eine ungeheure Gelassenheit ein. Aber Jacob und Madeline waren nicht tot. Gefesselt mit Polizeihandschellen und Klebeband, lagen sie zwischen getrockneten Blutlachen auf dem Boden eines von einem Schußwechsel verwüsteten Raums. Die Nachmittagssonne schien ihnen grell ins Gesicht.
Um Chuy keinen Vorwand zu geben, auf ihn zu schießen, war Jacob mit erhobenen Händen aus dem Jeep ausgestiegen. Madeline hatte sich ein Beispiel an ihm genommen. Chuy berührte seine Maschinenpistole nicht, seine beiden Männer richteten die ihren auf Jacob und Madeline. Ohne jeglichen Widerstand ließen sie sich die Handschellen anlegen und in den Suburban verfrachten. Chuy und ein Komplize nahmen sie in die Mitte, der andere Helfer setzte sich auf die Ladefläche.
Jacob hielt es für geraten, Chuy gar nicht erst anzusprechen.
Mit den Händen in Handschellen schob Madeline ihr Oberteil hoch und zog ihren Rock herunter. Sie versuchte auch, sich die Haare zu richten. An einer roten Ampel fragte sie Chuy höflich, sie sprach spanisch, was denn bitte gegen sie vorliege und was er weiter mit ihnen vorhabe. Der neben Madeline sitzende Maskierte gab ihr ansatzlos eine Ohrfeige. Sie schrie laut auf, der Mann holte aus und gab ihr eine zweite Ohrfeige. Madeline wimmerte, der Mann holte nochmals aus, sie zuckte zusammen, seufzte aber nur noch unterdrückt. Der Mann zog seine Hand zurück.
Sie hatten vor einem aus unverputzten Ziegelsteinen gemauerten Haus gehalten, dessen turmartige Strukturen im Obergeschoß es von fern wie eine kleine Kirche aussehen ließen. Sämtliche Fensterscheiben hinter den floralen Vergitterungen der Rundbogenfenster fehlten, in den Rahmen steckten nur noch Glassplitter.
Sie nahmen nicht die Eingangstür. Über die Garage und einen Innenhof, der einem Acker glich, betraten sie das Haus von hinten. Eine umgestülpte Sofagruppe mit zerrissenen Polstern versperrte ihnen den Weg. Die Theke der Einbauküche war mit leeren Bierflaschen vollgestellt.
Im Treppenhaus hing ein mehrstöckiger Lüster aus Schmiedeeisen. Angeschaltet beleuchtete er ein riesiges Wandgemälde. Auch im Dunkeln konnte man eine Kirche in einer einsamen Landschaft erkennen.
Die Wände waren innen gleichfalls nicht verputzt, der Boden und die Treppenstufen mit einer Art Cotto gefliest. Als Jacob im Treppenhaus kurz strauchelte, hielt er sich am Rand einer Aussparung in der Mauer fest. Die hellroten Ziegel unterhalb der Aussparung waren mit dunkelroten Flecken besprenkelt.
Vor ein paar Monaten hatte Jacob auf YouTube ein Video gesehen, das festhielt, wie das Militär ein Haus in Tijuana belagerte, in dem sich Mitglieder des Drogenkartells Arellano Félix verbarrikadiert hatten. Die Schießerei dauerte sehr lange. Der Kommentar informierte, daß alle im Haus befindlichen Personen, etwa ein halbes Dutzend, getötet worden waren.
Wenn Chuy die Absicht gehabt hätte, ihn und Madeline oder nur ihn zu erschießen, dann hätte er das im Innenhof oder in dem Parterreraum getan. Sie sollten hier nur zwischengelagert werden.
Chuys Komplizen brachten sie in einen Raum mit Blutfontänen an den Wänden. Das mußte das Zentrum des Widerstands gewesen sein. Hinter den verbeulten Eisenrahmen der Rundfenster hatten sich seitlich zusammenschiebbare Jalousien befunden, von ihnen waren nur noch kurze zerfranste Teile übrig. Die gewölbeartige Decke über ihnen zeigte Dutzende von Einschüssen.
Ungeduldig blickten die beiden Männer auf ihre Uhren. Offensichtlich hatten sie an diesem Tag noch etwas anderes vor, als Gringos in Angst und Schrecken zu versetzen. Während sie auf Chuy warteten, nahmen sie ihre Masken ab.
Schließlich zog der jüngere der beiden seine Pistole aus dem Halfter. Er kniete sich neben Madeline hin, stocherte mit dem Lauf der Pistole in ihrem Ausschnitt herum und zog ihn so weit herunter, daß er die Brustwarzen sehen konnte. Sie regten ihn nicht besonders auf. Sein Betätigungsfeld weiter nach unten verlagernd, hob er mit dem Pistolenlauf ihren Rock hoch, um ihr interessiert zwischen die Beine zu blicken. Madeline, die mit Verspätung begriffen hatte, daß es sich bei den Flecken an der Wand und auf dem Boden um Blut handelte, hatte seither jegliche lautliche Äußerung unterlassen. Den Pistolenlauf zwischen den Beinen, begann sie, wieder leise zu wimmern.
Jacobs Gesichtsausdruck entsprach wohl nicht dem, was der ältere der beiden von einem Gentleman in seiner Lage erwartete. Er trat Jacob in die Hüfte und fragte ihn in schwer verständlichem Englisch, warum er lache. Jacob gab zurück, er habe nicht gelacht. Der Mexikaner trat ihm noch einmal in die Hüfte. Jacob beteuerte, er werde nicht mehr lachen.
Während der jüngere den Pistolenlauf zwischen Madelines zusammengepreßten Beinen nach oben gleiten ließ, fragte er unbestimmt in die Runde, ob sie verheiratet seien. Sein Englisch war nicht besser als das seines Kollegen. Madeline blieb stumm, Jacob ließ sich klar und deutlich vernehmen, sie seien verheiratet, aber nicht miteinander. Zwischen den beiden Mexikanern entspann sich eine Diskussion.
Jacob konnte etwas Spanisch lesen, und er sprach ein paar Brocken Spanisch. Aber wenn Mexikaner unter sich sprachen, verstand er kein Wort. Sie redeten unglaublich schnell und verschluckten die Konsonanten.
Nach den Tritten in die Hüfte hatte Jacob sich vor Schmerzen gekrümmt, dabei war sein Telefon aus der Jackentasche gefallen. Als der ältere Mexikaner es sah, beschimpfte er Jacob, weil er ihm nicht gesagt hatte, daß er ein Telefon dabeihatte, und er trat ihm erneut in die Hüfte. Man hatte Jacob nicht gefragt.
Der Mexikaner durchsuchte Jacob und nahm auch sein Portemonnaie und seinen Reisepaß an sich, als Chuy den Raum betrat.
Chuy war in den Vierzigern, aber er sah deutlich älter aus. Das lag an den tiefen Falten auf der Stirn, unter den Augen und am Kinn. Allerdings hatte er kein einziges graues Haar, und es gab keine Anzeichen, daß seine Haare gefärbt waren. Seine Hautfarbe war eher dunkel, trotzdem hatte sein Gesicht nichts von einem Indio, es war das eines Spaniers. Seine Ohren waren außergewöhnlich groß. Der obere Teil des linken Ohrs fehlte, der Rand war gezackt, als wäre das Ohr oben abgerissen oder abgebissen worden. Die regelmäßigen weißen Zähne standen in starkem Kontrast zu der knollenförmigen Nase. Sein Körper hätte der eines Indios sein können, er war klein und hatte einen breiten Brustkorb. Sein großer Kopf und sein rechteckiges Gesicht ließen ihn größer scheinen, als er war.
Beim Sprechen bewegten sich immer seine Ohren mit. Das wirkte keineswegs lächerlich, vielmehr unterstrich es, was er sagte. Das Ohr, dessen oberer Teil abgerissen war, bedeutete keine Schwäche, sondern eine Drohung. In der ersten Aufwallung seines Zorns hätte Chuy ihn tatsächlich umbringen können. Aber dann hatte er es sich anders überlegt. Jacob glaubte, Chuy wollte jetzt aus der Sache zwischen ihnen beiden ein Geschäft auf eigene Rechnung machen.
Kidnapping war eine boomende Branche in Mexiko, die Zuwachsraten lagen weit über denjenigen beim Drogenhandel und beim Menschenschmuggel. Die Mexikaner waren auch Vorreiter beim Virtual kidnapping. Wie aus dem Call center wurden Reihen von Telefonnummern abtelefoniert. Eltern mit schulpflichtigen Kindern erhielten einen Anruf, ihr Sohn oder ihre Tochter befinde sich in der Hand von Kidnappern. Vom Tonband wurde die Stimme eines verängstigten Mädchens oder Jungen eingespielt, die weinend um Hilfe bat. Die Eltern wurden angewiesen, binnen zwei Stunden Geld oder Wertsachen an einer bestimmten Stelle zu deponieren, sonst würden sie ihr Kind nicht wiedersehen. Das Kind saß jedoch aufmerksam oder unaufmerksam in der Schule oder befand sich auf dem Schulweg. Immer wieder lieferten verängstigte Eltern Geldbeträge und Wertsachen ab, ohne sich vorher zu erkundigen, ob ihr Kind überhaupt entführt worden war.
Das hier war kein Virtual kidnapping. Chuy kannte Madelines Vermögensverhältnisse, oder besser, diejenigen von Madelines Mann. Er wußte, bei Madeline war etwas zu holen. Bei Jacob war nichts zu holen. Aber das konnte er noch nicht wissen.
Chuy mußte auch bekannt sein, daß Madeline in Scheidung lebte. Jacob hoffte, daß Chuy diese Information seinen Komplizen vorenthielt. So, wie sich die beiden gaben, würden sie sich nur schwer vorstellen können, daß ein Ehemann Lösegeld für seine Ehefrau zahlte, von der er sich gerade scheiden ließ. Sie würden ihn und Madeline auf der Stelle erschießen.
Jacob war nicht minder unwohl, wenn er an die Erfolgsaussichten der Lösegeldforderung für seine Person dachte. Es war unmöglich, die Gläser in der Galerie schnell zu Geld zu machen. Aber in einer Notsituation konnte man zumindest versuchen, sie zu beleihen. Was würde Jillian tun, wenn man von ihr Lösegeld verlangen würde?
Mem’ries
Light the corners of my mind
Misty water-colored memories
Of the way we were . . .
Das konnte doch nicht sein. Madeline sang.
Jacob drehte sich auf die Seite, die Bewegung tat seiner Hüfte nicht gut.
Madeline lag auf dem Rücken. Sie hatte die aneinandergefesselten Hände bis auf Brusthöhe angezogen. Zwar hielt sie sie nicht von sich weg, trotzdem wirkte es so, als würde sie in ein Mikrofon singen.
Ihr Vortrag war begleitet von einem künstlich dramatischen Ausdruck. Jacob wunderte sich, wie sie es fertigbringen konnte, den angesichts der Situation angebrachten natürlichen dramatischen Ausdruck zu überspielen.
Mem’ries
May be beautiful and yet
What’s too painful to remember
We simply choose to forget
So it’s the laughter
We will remember
Whenever we remember . . .
The way we were . . .
Sie wollte vergessen. Doch es war noch nicht vorüber. Es hatte ja noch nicht einmal richtig angefangen.
Jacob glaubte nicht, daß sich das we in dem Lied auf sie und ihn bezog.
In dieser Situation einen kitschigen Popsong zu singen bedeutete, sehr weit weg von der Realität zu sein. Wenn man eine zwar nicht ganz schlanke, aber doch sehr gepflegte Blondine war, dann lag die Erklärung nahe, daß es einigermaßen viel Geld war, welches diese Realitätsferne verursacht hatte. Chuy mußte zu dem Schluß kommen, daß Madeline beziehungsweise ihr Mann Geld genug hatten und zahlen würden.
Jillian hatte kein Geld. Für ihn, Jacob, würde niemand zahlen. Er war auf Madeline und ihren Mann angewiesen. Vorausgesetzt, das war eine Entführung.
Madeline sang zwar nicht wie Barbra Streisand, aber nahezu fehlerlos. Chuy und seine Helfer waren verstummt. Es war ihr tatsächlich gelungen, sich so etwas wie Respekt zu verschaffen, sofern dies unter den Umständen überhaupt möglich war. Sie, die vorher so rettungslos aufgelöst gewesen war, hatte plötzlich eine Art Stärke gezeigt. Sie hatte eindeutig ihre Position verbessert.
Als er seinen Blick auf die Wand gegenüber richtete, glaubte Jacob für einen Augenblick, dort seine vom Körper abgetrennte rechte Hand zu sehen, die in frischen Blutspuren herumwischte.
Wie um nachzuprüfen, ob sich seine Hand noch an seinem Arm befand, führte er sie in sein Gesichtsfeld. Da seine Hände aneinandergefesselt waren, brachte er sie in die gleiche Position wie vorher Madeline. Vor Verblüffung und Schrecken stand ihm der Mund offen. Chuy und seine Männer dachten, er wolle jetzt ebenfalls anfangen zu singen, und lachten verächtlich.
Shopping in Milano
Am nächsten Tag schlief Jillian unruhig, sie wachte schon am frühen Nachmittag auf. Sie hatte in einem Hotel unmittelbar an der Stazione Centrale Quartier bezogen. Es zeichnete sich vor allem durch seine niedrigen Decken aus, die Lobby wirkte wie das absurd große Wohnzimmer einer Etagenwohnung. Die Zimmerwände waren mit einem orangefarbenen Stoff bespannt, die Vorhänge ließen sich elektrisch öffnen und schließen. Tastete man im Dunkeln nach dem Lichtschalter neben dem Bett, geriet man unweigerlich auf den Schalter, der die Hausdame alarmierte. Von den drei Aufzügen war ständig mindestens einer außer Betrieb, Jillian hatte ein Zimmer im siebzehnten Stock, zu Stoßzeiten mußte sie jeweils minutenlang auf den Lift warten. Im Hotel waren viele Amerikaner und Japaner, aber wenige Italiener.
Die Nacht nach der Besichtigung der Sammlung hatte Jillian vor ihrem Notebook verbracht. Sie konnte die Sammlung nur vom möglichen Erlös her kalkulieren. Für die bildende Kunst gab es artprice.com, dort konnte man die Auktionsergebnisse aller versteigerten Werke aufrufen. Für die dekorative Kunst existierte nichts Vergleichbares, die Preisstruktur war bei weitem nicht so transparent wie bei der bildenden Kunst. Cindi Prescott konnte mit dem Internet umgehen, wenn sie sich bemühte, fand sie einzelne Preise, aus denen sie auf den Preisbereich schließen konnte, in dem sich die Objekte aus ihrem Besitz bewegten.
Die Vasen und Schalen sowie die kleinen Pflanzen ergaben zusammen eine Summe von zwei Millionen Dollar. Für die großen Piante grasse existierten keine Vorgaben, es gab keine Präzedenzfälle. Noch nie waren vergleichbare Objekte auf den Markt gekommen, und noch nie hatte ein Sammler für ein Martinuzzi-Glas einen Preis gezahlt, der auch nur halb so hoch war wie der, den Jillian für jede der großen Piante grasse ansetzte: eine halbe Million Dollar. Jillian würde zwei Millionen bieten. Höher würde sie nur gehen, wenn sie genügend Sicherheit auf der Verkäuferseite hatte. Mit einer entsprechenden Kaufzusage konnte sie sich auch vorstellen, die ganze Sammlung für zweieinhalb Millionen zu erwerben. Jeder Preis darüber war zu hoch.
Es machte keinen Sinn, die Sammlung auseinanderzureißen. Wer über die Möglichkeit verfügte, diese einzigartige Sammlung zu erwerben, würde auch bereit sein, einen Bonus für die Vollständigkeit zu zahlen. Drei Kunden kamen in Frage: Tom Benford, ein New Yorker Rechtsanwalt, Douglas Robinson, ein junger Erbe aus Miami, und Jonathan Bova, der Chief Financial Officer einer Firma in Los Angeles, die Fernsehfilme produzierte.
Sofort nach dem Aufwachen versuchte Jillian, die drei telefonisch zu erreichen. Sie kam nicht über die Sekretärinnen hinaus, die ihr jedoch alle einen Rückruf zusicherten.
Sie rief auch Cindi Prescott an und erklärte ihr, die Schätzung der Gläser dauere länger, als sie gedacht habe, sie werde sich in den nächsten Tagen melden. Der Erbin lag daran, das Geld unter der Hand zu bekommen. Was den Verkauf nicht erleichterte und den Spielraum für Jillian erweiterte: Cindi Prescott würde, wenn es zur Abschlußverhandlung kam, Jillians Preis akzeptieren.
Auf jeden Fall war es sinnvoll, sie erst einmal hinzuhalten. Jillian brauchte zusätzliche Sicherheit. Sie mußte mit den möglichen Käufern gesprochen haben, bevor sie ihr Angebot machte.
In New York besuchte Jillian niemals die Geschäfte auf der Fifth Avenue oder der Madison. Sie befürchtete, wenn Kundinnen oder Kunden sie dort sähen, würden sie annehmen, daß sie mit ihrer Galerie zu gut verdiente, daß ihre Preise überteuert waren.
Der Mainachmittag war wolkenverhangen, aber trocken. Jillian nahm ein Taxi und ließ sich zur Via Monte Napoleone fahren.
Sie brauchte eine Zeitlang, ehe sie begriff, in welcher Farbe die Inneneinrichtung des Prada store gehalten war. Kaum hatte Jillian das Geschäft betreten, war sofort eine ganz in Schwarz gekleidete Verkäuferin auf sie zugekommen. Jillian hatte abgewinkt, sie wollte sich nur umsehen. Sie überlegte, war es Grün, war es Grau, war es Blau, um dann zu dem logischen Schluß Türkis zu kommen. Im Erdgeschoß wurden die Schuhe und Taschen in jeweils zwei übereinanderliegenden waagrechten Aussparungen der Kulissenwände ausgestellt. Die indirekte Beleuchtung über den Taschen und Schuhen war heller als die Deckenbeleuchtung. Die Schuhe probierte man auf violetten Sofas an, die aussahen, als habe man zwei langgestreckte glatte Quader aneinandergestellt. Im ersten Stock hingen die Kleider in mannshohen Aussparungen der Kulissenwände.
Jillian las regelmäßig Harper’s Bazaar und die amerikanische Vogue. Die ausgestellten Teile wirkten zugleich vertraut und völlig unbekannt.
Der Überschuß an Raum in den Kulissenwänden machte die Taschen und die Schuhe größer, Jillian fühlte sich bombardiert. Aber sobald sie ihren Blick nicht mehr auf die Gegenstände richtete, schienen sich diese unendlich weit zu entfernen. Selbst die Teile in den in der Mitte der Räume aufgestellten Vitrinen wichen vor ihr zurück.
Das Geschäft von Dolce & Gabbana in der Via della Spiga war kein Geschäft, es sollte nichts verkauft werden. Die Kleidungsstücke hingen zwischen verspiegelten Raumteilern, historistischen, von Goldverzierungen strotzenden und mit grellen Stoffen oder mit Raubtierfellimitaten überzogenen hohen Sesseln, zwischen alten Amphoren, in denen Kakteen wuchsen und um die herum Palmen gepflanzt waren, und riesigen alten Spiegeln, die einfach an der Wand lehnten. Hier waren Fotografien aus verschiedenen Zeitschriften aneinander- und übereinandergelegt und Wirklichkeit geworden. Es ging nicht um Glamour, hier wurde das Nicht-Zusammenpassen angebetet, der formale Fehler. Natürlich gab es in dem Geschäft keine Fehler, und schon gar keine formalen. Die ausgestellten Teile mußten mit der Dekoration konkurrieren, es gelang ihnen. Jillian strich mit der Hand über die Rückenlehne eines Raubtiersessels. Die auf den Holzteilen viel zu dick aufgebrachte Goldfarbe hatte überall Risse und blätterte ab. Der Gedanke, daß es gar nicht möglich war, in einem Geschäft Glamour zu vermitteln. Die Überlegung, daß jeder Versuch, irgendeine Form der Vertrautheit zwischen den Teilen und den Kunden und den Kunden und den Teilen herzustellen, fehlschlagen mußte.
Sie versuchte, einen Weg zu nehmen, auf dem sie sich möglichst nicht in den Spiegeln sah. Tauchte sie in einem Spiegel auf, ging sie zurück, bis sie sich nicht mehr erblickte, und schlug eine andere Richtung ein. Nach mehreren Anläufen gelang es ihr, das gesamte Geschäft zu durchmessen, ohne sich selbst zu sehen.
Anders als nach dem Besuch im Prada store konnte sie sich nach dem Verlassen dieses Geschäfts an ein Teil erinnern, das sie gesehen hatte, an eine leuchtendrote Pelzjacke. Davor hatte ihr derart gegraut, daß sie sich abwenden mußte.
Aber sie konnte das Bild der roten Pelzjacke in den goldumrahmten Spiegeln nicht unterdrücken.
Jillian gelangte zur Via Manzoni. Von dieser bog sie wieder in die Via Monte Napoleone ein und ging zum Gucci store. Seit Tom Ford Gucci verlassen hatte, interessierte Gucci sie nicht mehr. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, das Geschäft zu betreten.
Um acht Uhr war sie im Nobu, dem japanischen Restaurant im Armani Megastore auf der Via Manzoni, mit Niccola Carofiglio verabredet, einem Galeristen aus Mailand, dem sie in der Vergangenheit Gallé-Gläser verkauft und von dem sie Venini-Gläser gekauft hatte. Sie traf ihn jedesmal, wenn sie sich in Italien aufhielt.
Die Mode, die Accessoires, die Möbel und die Bücher im Armani Megastore waren alle in das gleiche warme graue Licht getaucht, das schon den Gedanken an eine grelle Farbe zur Skurrilität werden ließ. Das Verhältnis von Ausstellungsstücken zu ungenutztem Raum war noch extremer als bei Prada. Aber hier profitierten die Teile als Teile nicht. In manchen Bereichen hatte Jillian das Gefühl, die Teile sollten gar nicht sich selbst präsentieren, vielmehr hatten sie lediglich die Funktion von Überschriften. Hier wurde die Pause, die Leere ausgestellt. Das Wirkliche wurde zum Phantom, das Erscheinen und das Verschwinden begegneten sich zwischen den Teilen, die Phantasie konnte sich entfalten. So, wie es der Designer wollte.
Lange blieb Jillian vor einer Kombination stehen, einer gerade geschnittenen weiten schwarzen Hose mit Bügelfalten und einer kurzen weißen Jacke mit langen Ärmeln und breiten Revers. Die weiße Jacke war schwarz gemustert, die schwarze Hose entlang der Bügelfalten weiß gemustert. Schwarz und Weiß waren keine Farben, wenn es Farben waren, dann nicht solche des Lebens. Jillian trug niemals weite Hosen. Es schien ihr völlig unvorstellbar, daß jemand, der diese Kombination anhatte, seinem Gegenüber nicht beständig in die Augen blickte, nicht versuchen würde, es an den Händen oder im Gesicht zu berühren, um sich Lebensenergie zuzuführen.
In so ausgesuchte Restaurants wie das Nobu ließ Jillian sich in New York nur von Kunden einladen. Das Nobu in Mailand erstreckte sich über zwei Etagen, Jillian hatte im ersten Stock reservieren lassen. Die Tische mit den bequemen Sitzbänken an den Wänden wurden nur für größere Gruppen vergeben. Da sie zu zweit waren, hatten sie einen Tisch in der Mitte zugewiesen bekommen.
Der verglaste untere Teil der Sushi-Bar war gelblich beleuchtet, die Deckenfluter waren ebenfalls gelb. Die raumhohen Schiebeeinheiten aus cremefarbenem Papier vor der Fensterverglasung ließen die abendliche Stadt lediglich ahnen. Die rötlichen Sesselpolster auf den Stühlen, Sitzbänken und Barhockern zogen das gelbe Licht magisch an. Das Licht irritierte Jillian derart, daß sie ihre Sonnenbrille aufsetzte.
Sie nahm Platz. Es war acht Uhr, Carofiglio war noch nie pünktlich gewesen. Sie bestellte einen grünen Tee.
Die anderen Gäste des Restaurants sahen nicht so aus, als hätten sie die Geschäfte auf der Via Monte Napoleone und der Via della Spiga nur besichtigt.
Carofiglio stand an der Bar, an einen Hocker gelehnt. Er trug ein schwarzes Jackett über einem einfachen weißen T-shirt, im Gegensatz zu den anderen Italienern hatte er es in seine Blue jeans gesteckt. Das Jackett verbarg, wie muskulös er tatsächlich war. Er hatte ein sehr regelmäßiges Gesicht, der Haaransatz bildete eine vollkommene Parallele zu den Augenbrauen, zum Mund und zu dem ebenfalls geraden Kinn. Sein dichtes schwarzes Haar ließ er nicht über die Ohren wachsen, auch ohne Scheitel wirkte es geordnet. Sie nahm die Sonnenbrille ab. Aber erst als sie eine entsprechende Geste machte, kam er an ihren Tisch.
»Come stai?«
Jillian verstand Italienisch. In Italien sprachen ihre Geschäftspartner italienisch mit ihr, sie antwortete in ihrer Muttersprache.
»I always feel terrific in the presence of a handsome man! – And this is not a fib!«
Es war geschwindelt. Genauso alt wie Jillian und homosexuell, war Carofiglio der offizielle Freund von Giuseppe Buonavolontà, einem sehr bekannten Galeristen aus Rom. Alle wußten, das Kapital für das Geschäft Carofiglios kam von Buonavolontà. Keiner wußte, daß Jillian mit Frauen schlief. Daß der einzige Mann, mit dem sie je geschlafen hatte, ihr Ehemann war. Jacob war genau doppelt so alt wie sie. Buonavolontà hatte etwa das Alter von Jacob.
Carofiglio hatte eine für einen Italiener betont unaufgeregte Stimme. Nichts in seinen Bewegungen, nichts darin, wie er sich kleidete, wie er sich gab, wies im geringsten auf seine Homosexualität hin.
Manchmal überlegte Jillian, es müsse vielleicht doch interessant sein, mit einem anderen Mann zu schlafen, um den Unterschied zu sehen. Sie hatte keine Angst, den Mann nachher nicht wieder loszuwerden. Im Gegenteil. Sie amüsierte sich bei der Vorstellung, einen in sie verliebten Mann dazu zu bringen, seine Lage neu zu durchdenken.
Während sie Höflichkeiten austauschten, gestand Jillian sich ein, Carofiglio war der einzige Mann außer Jacob, mit dem ins Bett zu gehen sie sich vorstellen konnte. Er sah gut aus, das war eine Vorbedingung. Jacob sah ebenfalls gut aus. Sie schlief auch nicht mit häßlichen Frauen. Was Carofiglio für sie anziehend machte, war das Gefühl, er hielt von der Welt ähnlichen Abstand wie sie selbst.
»Wie geht es Giuseppe?«
Jillian hatte Buonavolontà das letzte Mal vor drei Jahren gesehen.
Das Restaurant war klimatisiert, trotzdem hatten andere Männer ihre Jacken ausgezogen. Carofiglio machte keine Anstalten, dasselbe zu tun. Im Gegenteil, er schob die Schultern vor, als wäre ihm kalt.
»Giuseppe hat einem Banker in Tokio mehrere Gallé-Gläser verkauft. Der Banker hat ihn in den Celux Club im Louis Vuitton Omotesando Building mitgenommen.
»Die Mitgliedsgebühr beträgt zweitausend Dollar, auch wenn man nur einmal hineingeht. In dem Club kann man Produkte von Louis Vuitton kaufen, die noch nicht auf dem Markt sind, und limitierte Editionen von anderen Marken. Der Banker hat die Eintrittsgebühr für Giuseppe bezahlt. Während einer Lunch party mit einem Sake-Meister ist Giuseppe ohnmächtig geworden. Er lag drei Tage in Tokio im Krankenhaus. Die Ärzte fanden nichts, sein Herz war in Ordnung, der Blutdruck allerdings zu hoch. Die Ärzte rieten ihm, nicht mehr zu rauchen und abzunehmen.
»Er ißt jetzt kein Fleisch mehr, nur noch Fisch und Pasta, kein Dolce, nur noch Früchte, er trinkt jede Menge Wasser. Wenn er überhaupt Alkohol trinkt, dann Rotwein. Ab und zu genehmigt er sich allerdings eine Tafel Schokolade, aber nur Fondente.«
Vor ihrem geistigen Auge ließ Jillian alle Kunden paradieren, die dieselbe Anti-Entzündungs-Diät einhielten.
»Er nimmt Multivitaminpräparate, Kalzium und ein paar Baby-Aspirin . . . «
Carofiglio lächelte.
»Du weißt, wir haben ein Weingut in der Toskana, in der Nähe von Greve. Wir bewirtschaften es nicht selbst, die Weinberge sind an ein anderes Weingut verpachtet. Hinter dem Haus hat er ein Labyrinth angelegt. Genauer gesagt: den mit Steinen gezeichneten Grundriß eines Labyrinths.
»Er wandert stundenlang im Labyrinth. Nach welchem System, erklärt er mir nicht. Ich glaube, er legt alle im Labyrinth möglichen Wege zurück. Erst ganz am Schluß erreicht er den Mittelkreis.«
»Gehst du auch ins Labyrinth?«
Carofiglio schüttelte den Kopf.
»Wenn Giuseppe im Labyrinth ist, lese ich Zeitung. Neben dem Labyrinth, auf einer Bank im Schatten eines Baums.«
»Hat er im Labyrinth sein Telefon dabei?«
Die Italiener trennten sich nie von ihrem Telefon.
»Er gibt es mir, ich nehme die Anrufe entgegen. – Wenn es dringend ist, nimmt er den kürzesten Weg aus dem Labyrinth heraus. – Nie würde er über die Steine springen.«
In Jillians Vorstellung überlagerte sich das Bild, wie Buonavolontà unter einem wolkenlosen Himmel in seinem Labyrinth um dessen Mittelpunkt kreiste, mit demjenigen Jacobs, der in einer mexikanischen Wüste unter einer glühenden Sonne eine schnurgrade Spur zog.
»Was machst du in Europa?«
Den linken Arm auf das Rückenpolster des Stuhls abgestützt, bewegte Jillian den ganzen Körper hin und her.
»Ich bin an der größten Martinuzzi-Sammlung dran, die du je gesehen hast!«
Sie fuhr sich mit beiden Händen die Hüften entlang.
»In der Sammlung gibt es außerdem vier riesige Piante grasse. Für die Quadriennale von Rom 1931 angefertigt.«
Jillian hatte sich das Venini-Buch von Deboni besorgt, in dem die 1931 in Rom gezeigten Exemplare abgebildet waren. Bei den Piante grasse in der Höhle handelte es sich tatsächlich um die verschollenen Exemplare.
Carofiglio atmete durch den geöffneten Mund aus, es machte whoosh. Er schloß den Mund und atmete tief und hörbar durch die Nase ein, er hielt den Atem eine Zeitlang an, öffnete den Mund wieder und atmete noch lauter als vorher aus. Jillian fiel auf, daß er dabei die Spitze seiner Zunge von hinten gegen die Zähne oder gegen den Kiefer preßte. Die Prozedur wiederholte er ein halbes dutzendmal. »Eine Entspannungsübung, die ich von Giuseppe gelernt habe. Er macht das immer, wenn er aufgeregt ist oder sich gestreßt fühlt.«
Carofiglio erkundigte sich, wem die Sammlung gehöre. Jillian spielte mit offenen Karten. Sie antwortete, einer Amerikanerin aus Brooklyn. Cindi Prescott hatte keine Kontakte hier, wenn sie doch von sich aus Carofiglio ansprechen würde, konnte Jillian nichts dagegen tun.
»Hast du einen Sammler dafür?«
Jetzt zog Carofiglio doch seine Jacke aus. Das enge weiße T-shirt bildete jeden Muskel seines Oberkörpers ab. Als er nach seinem Becher mit dem grünen Tee griff, konnte Jillian sehen, wie er unter den Achseln schwitzte.
»Ja, ich habe einen neuen Sammler – er sammelt Keramiken von Gio Ponti, aber er hat schon so viele.«
»Hat er auch genügend Geld?«
»Er ist Rechtsanwalt und berät Berlusconi.«
»Vier Millionen Dollar. – Ich muß zweieinhalb Millionen zahlen, eine Million für mich, eine halbe Million für dich.«
Jillian hatte nicht vor, für den Deal mit Carofiglio zusammenzuarbeiten. Er war nicht dazu in der Lage, ihn zu finanzieren. Aber man wußte nie – vielleicht konnte er ihr tatsächlich hier einen Käufer für die Sammlung vermitteln. Sie sah, wie es in Carofiglio arbeitete. Um Fragen nach der Sammlung zu umgehen, die zu beantworten sie keine Lust hatte, fragte sie ihn, ob er noch male.
Carofiglios Vater war Chemiker bei der Montedison gewesen, Leiter einer Abteilung, die Pflanzenschutzmittel entwickelte. Als Kind hatte Carofiglio den Vater oft ins Friaul begleitet, wo dieser in den firmeneigenen Wäldern Versuche mit neuen Produkten überwachte. Der Vater erklärte dem Sohn die Wirkmechanismen der Pflanzenschutzmittel, aber der Sohn wollte nicht wissen, warum einzelne Organismen sich entwickelten oder nicht. Für ihn war alles eine Einheit. Die Bäume und die anderen Pflanzen des Walds, die Tiere, die ihn bevölkerten. Er beobachtete die Würmer, die Raupen, die Ameisen, die Mücken. Überall sah er Gemetzel, Krankheit und Tod. Ihn interessierten die Muster, die sich daraus ergaben. Der einzige Effekt des Unterrichts durch den Vater bestand darin, daß der Sohn tote Mäuse und tote Vögel aufsammelte und im Kühlschrank lagerte, sie eine gewisse Zeit herausnahm, sie wieder in den Kühlschrank zurücklegte und erneut herausnahm, um so die verzögerte Verwesung der Tierkadaver zu studieren.
Als Jillian ihn kennengelernt hatte, hingen die Wände seiner Wohnung voll mit seinen Bildern. Der dunkle Untergrund erinnerte an Schlamm, Asche oder geronnenes Blut. Alle Figuren hatten etwas Fliehendes, als versuchten sie eiligst, von der Bildfläche zu verschwinden. Carofiglio verwendete Pappstücke, Watte, Pflaster und medizinische Salben. Ein Bild war Jillian besonders im Gedächtnis haftengeblieben, der Garten eines Hauses war mit sich überlappenden Heftpflastern dargestellt.
»Nein, ich mache keine Bilder mehr.«
Carofiglio sagte nie, er male Bilder, er sprach immer davon, daß er Bilder mache.
»Ich habe nie etwas mit Farbe anfangen können. Farbe war für mich zu real, sie ließ zuwenig Platz für Träume. Einmal habe ich eine Tube Kadmiumgelb mit fünfundzwanzig Tuben Schwarz gemischt. Schwarz hat Tiefe. Schwarz ist wie ein Portal, das man durchschreitet. Man sieht das, wovor man Angst hat, man sieht das, was man liebt. Was in einem selbst ist, offenbart sich.
»Ich hatte die Bilder in meiner Wohnung aufgehängt. Nur Giuseppe kannte sie. Als ich meine Galerie eröffnete, wollte ich sie dort zeigen. Ich dachte darüber nach, wie die Kunden meine Bilder wohl finden würden. Da wurde mir plötzlich klar, daß jeder, der meine Bilder betrachtete, zu dem Schluß kommen mußte, das zentrale Thema meines Lebens sei Finsternis und Verwirrung.«
Jillian mußte an Buonavolontà denken. Er war Albino und unglaublich häßlich. Die oberste Schicht seiner Haut wirkte durchsichtig, als wäre die Haut wegen ihrer Verletzlichkeit durch eine zweite geschützt. Er hatte keine Haare auf dem Kopf, er mußte sich nicht rasieren, da wuchsen keine Haare. Seine großen und eckigen Ohren schienen im Gegenlicht ebenfalls durchsichtig zu sein. Riesige Wülste über den Augen beherrschten sein Gesicht, sie gingen in eine breite asymmetrische Nase über. Das Weiße in Buonavolontàs Augen war immer rotgeädert, die Pupillen schimmerten dunkelrot. Seine Lippen waren aufgedunsen und rissig, seine Zähne gesund, aber schief. Er hatte ungewöhnlich lange Eckzähne, die er absichtlich nicht richten ließ, ein regelmäßiges Gebiß hätte nicht zu seinem Gesicht gepaßt. Er war kräftig und nicht dick. Für einen Mann hatte er ungewöhnlich lange Fingernägel.
Buonavolontà war so häßlich, daß Jillian ihn auf eine Weise, über die sie sich selbst lieber keine Rechenschaft ablegen wollte, durchaus anziehend fand.
Sie verschränkte die Arme über dem Kopf.
»Und ist dein Leben Finsternis und Verwirrung?«
Carofiglio zuckte verächtlich mit den Schultern.
»Ich habe überlegt, ob ich nicht hellere, farbigere Bilder machen soll. Aber ich sehe immer wieder, daß Farbe auf Bildern billig und dumm aussieht. Die einzigen Farben auf Bildern, die mir gefallen, sind Erdtöne. Ich dachte daran, mehr Rot und mehr Gelb zu verwenden, Rot für Blut und Gelb für Feuer.«
Er atmete tief durch, ohne jedoch wieder seine Entspannungsübung zu machen.
»Ich habe keine Bilder mehr gemacht. Seit ich meine Galerie habe, ist mein Leben nicht mehr Finsternis und Verwirrung.«
Die Trambahnschienen in der Mitte der Via Manzoni reflektierten das Licht der Fahrzeuge, als wären in der Straße Lichtbänder verlegt. Vor dem Armani Megastore säumte eine Reihe von kugelförmig geschnittenen Buchsbäumchen den Bürgersteig. Jillian wartete, bis der Verkehr spärlicher floß, und paßte einen Moment ab, in dem weder auf ihrer Seite der Straße noch auf der anderen Fußgänger in der Nähe waren, und trat dann mit aller Kraft gegen den ihr am nächsten stehenden Topf. Die Spitzen ihrer Stiefel waren mit Eisen beschlagen. Der Topf zerbrach mit einem wie klagenden Geräusch, ehe er in sich zusammenfiel. Die Erde schien von den Wurzeln des Bäumchens regelrecht wegzustreben.
Carofiglio wollte sich in den nächsten Tagen bei ihr melden. Der Deal war eine Nummer zu groß für ihn. Jillian ärgerte sich, ihn überhaupt auf die Sammlung angesprochen zu haben.
Die Gäste, die den Armani Megastore verließen, nahmen den zerbrochenen Topf und den Baum mit dem lächerlich dünnen Stamm, der fern von der Erde lag, in die er eingepflanzt gewesen war, genausowenig zur Kenntnis wie die anderen Fußgänger auf der Straße.