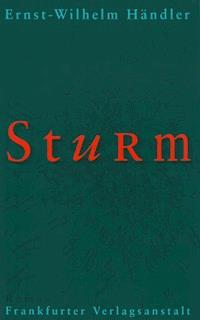Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einer süddeutschen Universität sollen die beiden philosophischen Institute aus Kostengründen zusammengelegt werden. Geld sowie Raum sind knapp und werden dringend für die Ökonomen benötigt. "Philosophen sind nicht unbedingt als Unternehmernachwuchs zu gebrauchen." Zwischen den beiden Instituten bestehen allerdings ausgeprägte Spannungen, sie "verkörpern sehr unterschiedliche Auffassungen von Philosophie." Der alte Professor, Leiter des Instituts Eins, ist ein akribisch und zurückgezogen arbeitender Gelehrter der alten Schule, während der Leiter des Instituts Zwei, der stromlinienförmige Karrierist Sonnabend, lieber interne Machtkämpfe führt und sich in Talkshows zeigt, als sich um seine Studenten zu kümmern. Ein junger Philosoph gerät in dieses schwer durchschaubare Geflecht von Ambitionen, Animositäten und Intrigen zwischen den Instituten und ihren Mitgliedern. Nach und nach begreift er den wirklichen Sinn von Fakultätssitzungen, Festschriften und Hausberufungen. In Gutachten und Diskussionen wird er schließlich selbst zum Ziel der Intrige. Höhepunkt des ersten Teil des Romans ist der internationale Philosophenkongress in Salzburg, auf dem die theoretischen Zweifel des jungen Philosophen in die persönliche Katastrophe münden. Er wendet sich von der Berufsphilosophie ab, um jetzt - im zweiten Teil des Romans - seinen eigenen "Kongress" zu veranstalten: in dem es nicht wie zuvor um die Theorie, die reine Erkenntnistheorie, sondern um das Leben, um die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Menschen geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KONGRESS
An einer süddeutschen Universität sollen die beiden philosophischen Institute aus Kostengründen zusammengelegt werden. Geld sowie Raum sind knapp und werden dringend für die Ökonomen benötigt. »Philosophen sind nicht unbedingt als Unternehmernachwuchs zu gebrauchen.« Zwischen den beiden Instituten bestehen allerdings ausgeprägte Spannungen, sie »verkörpern sehr unterschiedliche Auffassungen von Philosophie«. Der alte Professor, Leiter des Instituts Eins, ist ein akribisch und zurückgezogen arbeitender Gelehrter der alten Schule, während der Leiter des Instituts Zwei, der stromlinienförmige Karrierist Sonnabend, lieber interne Machtkämpfe führt und sich in Talkshows zeigt, als sich um seine Studenten zu kümmern.
Ein junger Philosoph gerät in dieses schwer durchschaubare Geflecht von Ambitionen, Animositäten und Intrigen zwischen den Instituten und ihren Mitgliedern. Nach und nach begreift er den wirklichen Sinn von Fakultätssitzungen, Festschriften und Hausberufungen. In Gutachten und Diskussionen wird er schließlich selbst zum Ziel der Intrige.
Höhepunkt des ersten Teil des Romans ist der internationale Philosophenkongress in Salzburg, auf dem die theoretischen Zweifel des jungen Philosophen in die persönliche Katastrophe münden. Er wendet sich von der Berufsphilosophie ab, um jetzt – im zweiten Teil des Romans – seinen eigenen »Kongress« zu veranstalten: in dem es nicht wie zuvor um die Theorie, die reine Erkenntnistheorie, sondern um das Leben, um die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Menschen geht.
PRESSESTIMMEN
»Wie Hermann Broch, der große österreichische Erzähler, Essayist, Forscher und lange Jahre eben auch Unternehmer, schreibt Händler abends, nachts, an Wochenenden, Feiertagen. Und er schreibt aus dem gleichen Interesse heraus: Wie Broch gilt Händler die Literatur als Instrument der Erkenntnis … Händler versteht sich offenbar, auf der Höhe des gegenwärtigen Wissenstandes, als Konstruktivist. Er geht mithin davon aus, dass es keine verbindliche Repräsentation der Gesellschaft mehr gibt. Hier setzt er literarisch an: erzählend. … Händler beschreibt unsere Gesellschaft, um sie zu begreifen. Das erstaunliche Ergebnis: Wir lesen und können mit Vergnügen feststellen, dass wir etwas begriffen haben. Denn der Weg ist das Ziel.«
DIE ZEIT
»Ein durch und durch bedeutendes Stück Literatur, angesiedelt jenseits jeder Illusionistik und weit jenseits jeder Postmoderne.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Ernst-Wilhelm Händler
Kongreß
Roman
L’univers transformé en après-midi de dimanche …
E.M. Cioran, Précis de décomposition
ERSTES BUCH
ES GIBT
MONTAG
Der Assistenzprofessor saß an seinem Schreibtisch und verbesserte den Probeabzug eines neuen Aufsatzes. Als es an der Tür klopfte, gab er keine Antwort, denn er wollte seine Arbeit nicht unterbrechen. Die Tür ging trotzdem auf.
»Störe ich.«
»Komm herein, aber laß bitte den Schirm draußen.«
Der Besucher trat zurück, spannte den Schirm auf und stellte ihn neben die Tür. Noch auf dem Gang zog er den Regenmantel aus, schüttelte ihn und stampfte mit den Füßen, um auch die Wassertropfen an Schuhen und Hosenbeinen abzuschütteln.
»Hier ist es aber kühl.«
»Das Institutsgebäude wird in den Sommermonaten grundsätzlich nicht geheizt. Ganz gleich, wie kalt es draußen ist.«
Der Assistenzprofessor blätterte in dem Probeabzug. Er war mit dessen Berichtigung nur langsam vorangekommen und würde sie in keinem Fall noch diesen Nachmittag zu Ende bringen.
»Möchtest du Kaffee.«
»Danke, ich trinke nie Kaffee.«
»Tee.«
»Gern.«
Der Assistenzprofessor ging zu seinem Bücherregal und nahm einen verbeulten Aluminiumtopf sowie einen Tauchsieder heraus. Er füllte den Topf über seinem Waschbecken, stellte ihn darunter auf den Boden und schloß den verkalkten Tauchsieder an die Steckdose an.
»Was macht der neue Professor.«
»Er hält eine Vorlesung und zwei Seminare über seine Sachen.«
»War er friedlich?«
»Er hat letzten Donnerstag sogar das Seminar des Professors besucht. Er war sehr höflich. Er weiß, daß der Professor ihn nicht wollte.«
»Aber er stand doch an der ersten Stelle der Berufungsliste.«
»Nicht wollen ist zu kraß ausgedrückt. Der Professor wollte die Stelle so gut wie irgend möglich besetzen. Es ergab sich jedoch, daß der angesehenste Kandidat seinen eigenen Forschungsvorhaben kühl bis ablehnend gegenübersteht. So daß er wohl hoffte, der Kandidat werde abwinken.«
»Wird er friedlich bleiben?«
Der Assistenzprofessor zog den Stecker des Tauchsieders aus der Steckdose und nahm Kaffeepulver und eine Schachtel mit Teebeuteln vom Regal. Der Besucher reichte ihm zwei Tassen aus dem Waschbecken.
»Hättest du vielleicht Zucker.«
»Ich trinke den Kaffee immer ohne alles. Ich muß erst nachsehen.«
Der Assistenzprofessor fand eine angebrochene Packung Würfelzucker zwischen zwei Bücherstapeln. Er blies den Staub von der Packung, ehe er sie dem Besucher gab.
»Der Professor ist in letzter Zeit sehr niedergedrückt.«
»Er bekommt doch eine Festschrift zu seinem sechzigsten Geburtstag.«
»Natürlich. – Ich glaube, er ist nicht ganz gesund. Vielleicht täusche ich mich auch, und es ist nur das Alter. Wenn er länger gesessen hat und sich dann erhebt, steht er erst eine Weile still und hält sich irgendwo fest.«
»Was machen deine Kongreßvorbereitungen.«
»Zu meinen Kongreßvorbereitungen komme ich gar nicht. Der Professor hat den Vorsitz der Abteilung – ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Jedenfalls der Abteilung, in der wir alle unsere Vorträge halten. Er stellt die Veranstaltungsfolge auf. Das heißt natürlich, daß ich die Veranstaltungsfolge aufstelle. Ich werde schon ein paar Tage vor Kongreßbeginn nach Salzburg fahren, ich muß auch die Verteilung der Veranstaltungen auf die verschiedenen Räume bewerkstelligen und die Drucklegung der Kongreßunterlagen überwachen. Ich finde kaum Zeit, meinen eigenen Vortrag niederzuschreiben. – Bevor ich es vergesse, worüber trägst du vor. Ich muß dich einplanen.«
»Ich weiß es noch nicht genau.«
»Ich brauche einen Titel.«
Die Tür öffnete sich ohne Vorankündigung, und ein etwa vierzigjähriger, mittelgroßer Mann mit lockigem, nicht sehr fülligem, fast fraulich geschnittenem Haar trat ein. Er war mit einem groben hellgrauen Wollpullover und einer ausgebeulten schwarzen Hose bekleidet. Um den Hals trug er einen sichtbar abgenutzten schwarzen Seidenschal, es war nicht zu erkennen, ob er unter dem Pullover ein Hemd anhatte oder nicht.
»Ich würde mich gern einen Augenblick mit Ihnen unterhalten.«
»Wir haben gerade von Ihnen gesprochen.«
Der Assistenzprofessor bedeutete dem neuen Professor, Platz zu nehmen. Der Assistenzprofessor stellte dem neuen Professor seinen ersten Besucher nicht vor.
»Trinken Sie Kaffee oder Tee.«
Der neue Professor machte eine abwehrende Handbewegung.
Der Freund des Assistenzprofessors trank seinen Tee aus.
»Ich muß jetzt gehen. Du gibst mir Bescheid, wann ich drankomme.«
»Ich brauche den Titel.«
»Regnet es noch?«
Der Assistenzprofessor blickte unwillig zum Fenster.
»Ich glaube ja.«
Der neue Professor sah zu, wie der Freund des Assistenzprofessors seinen Mantel überzog und sich verabschiedete. Er sprach erst, als sich die Tür geschlossen hatte.
»Ich habe ihn noch nie am Institut gesehen.«
»Er will sich habilitieren. Er hat keine Stelle, er lebt von seinem Vermögen.«
»Ein junger Privatgelehrter.«
»Gewissermaßen.«
»Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Vielleicht wissen Sie es auch schon, und Sie sprechen nicht darüber. Nachdem ich meinen Anstellungsvertrag unterschrieben hatte, rief mich die Sekretärin des Ministerialbeamten an, mit dem ich verhandelt hatte, und bat mich, ihr den Vertrag zurückzusenden, er enthalte einen formalen Fehler. Ich schickte die Unterlagen zurück. In dem neuen Vertrag waren einige Kleinigkeiten geändert, die mir nicht sehr wichtig erschienen, er war jedoch voller Schreibfehler. Ich rief die Sekretärin an und bat sie, mir eine Fassung ohne sinnentstellende Schreibfehler zuzusenden. Zum Beispiel sei ich nach der ersten Fassung am Philosophischen Institut Eins angestellt gewesen, in der jetzt vorliegenden Fassung sei die Eins weggelassen. Sie erwiderte beleidigt, das sei kein Schreibfehler, es gebe in Zukunft nur noch ein philosophisches Institut. Am Tag darauf rief mich der Beamte an, mit dem ich den Vertrag verhandelt hatte. Er gab sich zerknirscht, seine Sekretärin habe etwas durcheinandergebracht, natürlich sei und bliebe ich beim Philosophischen Institut Eins angestellt, er entschuldige sich auch für die vielen Schreibfehler seiner Sekretärin, sie sei zur Zeit überlastet, die endgültig richtige Fassung meines Vertrags gehe mir zu. Ich hatte sie bereits am nächsten Tag im Briefkasten. – Was wissen Sie?«
»Davon, daß es nur noch ein philosophisches Institut geben soll: gar nichts.«
»Ist der Gedanke so abwegig.«
»Leider nein.«
»Mein Eindruck war, die Sekretärin hat sich verplappert und das Ministerium will nur nicht, daß der Plan schon jetzt bekannt wird. – Ich habe einmal ein Buch vom Vorstand des Philosophischen Instituts Zwei in der Hand gehabt. Philosophische Essays.«
Der Assistenzprofessor erhob sich, um im Raum auf und ab zu gehen.
»Sonnabend in Tageszeitungen, Sonnabend in Wochenzeitungen, Sonnabend in Nachrichtenmagazinen, Sonnabend im Fernsehen. Kant hat gesagt, Hegel würde formulieren, Schopenhauer wäre der Auffassung, Nietzsche würde entgegenhalten, im Geiste Burckhardts gesprochen... Aber kein Sonnabend in Fachzeitschriften und kein Sonnabend auf Fachkongressen. Er ist aufgeklärt konservativ, und er ist christlich. – Sie dürfen den Einfluß der Kirche auf die Besetzung unserer Lehrstühle nicht unterschätzen. – Wenn die beiden Institute zusammengelegt werden, wird er alle Stellen mit seinen Zöglingen besetzen, mit Leuten, die genau wie er über alles und überall schreiben.«
»Hat es schon einmal offenen Streit gegeben?«
Der Assistenzprofessor fuhr mit der Hand durch seinen Schnurrbart und war deshalb nur schwer zu verstehen.
»Der Professor geht Sonnabend aus dem Weg. Er läßt sich auf keine Auseinandersetzung mit ihm ein. Der Professor würde unterliegen, der Professor weiß das und verhält sich danach. Es hat sich so eingespielt, daß wir machen, was wir wollen, und daß die anderen machen, was sie wollen. Jedes Institut entscheidet allein über seine Promotionen, Habilitationen, Einstellungen und Berufungen. – Sonnabend haßt den Professor. Weil der von allen deutschen Philosophen das mit Abstand höchste Ansehen im Ausland genießt. Und ausgerechnet dieser Philosoph lehrt an seiner Hochschule.«
»Sie werden etwas unternehmen.«
»Ich rede mit dem Professor.«
»Beziehen Sie sich nicht auf mich.«
»Ich sage ihm, ich hätte ein Gerücht gehört.«
»Sehen Sie Möglichkeiten, den Plan zu verhindern?«
»Wenn Sonnabend dahintersteckt – er hätte ja den größten Vorteil davon –, dann wird er sich alles gut überlegt haben. In diesem Fall können Sie voraussetzen, seine Aussichten sind günstig.«
»Falls ich helfen kann, tue ich das.«
»Danke. Aber Sie kennen die Verhältnisse nicht. – Bevor ich es vergesse, ich brauche den Titel Ihres Vortrags für den Kongreß.«
»Wahrheit.«
»Einfach Wahrheit?«
»Einfach Wahrheit. – Wann fängt der Kongreß an. Ich habe es nicht im Kopf.«
Der Assistenzprofessor setzte sich wieder.
»Der Kongreß beginnt in der letzten Juliwoche. Sobald ich die Veranstaltungsfolge zusammengestellt habe, gebe ich sie Ihnen. Ende November ist Redaktionsschluß für die Reinschrift der Vorträge. Was später kommt, wird nicht mehr berücksichtigt. Der Verlag besteht darauf. Wenn die Kongreßakten nicht zeitnah herauskämen, interessiere sich keiner mehr dafür. – Sie haben Ihren Vortrag sicher schon ausgearbeitet.«
Der neue Professor ergriff die vor ihm auf dem Tisch stehende Tasse und drehte sie in Gedanken zwischen beiden Händen. Als ihm zu Bewußtsein kam, daß er die Teetasse des vorhergehenden Besuchers in Händen hielt, stellte er sie mit einem lauten Geräusch auf den Tisch zurück.
»Ich komme im Augenblick wegen des Umzugs zu nichts. Das heißt, wir ziehen nicht um, wir behalten unsere Wohnung in Düsseldorf und nehmen hier eine zweite.«
»Die Schwierigkeiten habe ich nicht. Ich kann mir gerade eine Wohnung leisten.«
»Sind Sie verheiratet.«
»Ich bin verheiratet.«
»Sie haben Kinder.«
»Wir haben keine Kinder.«
»Ist Ihre Frau nicht berufstätig.«
»Meine Frau ist Griechin. Sie besitzt etwas Grund auf einer Insel, sie treibt dort während der warmen Jahreszeit ein wenig Landwirtschaft. Sie hat einen Abschluß in Mathematik, aber sie hat die Lust daran verloren.«
»Ich möchte nicht von meinem Gehalt leben müssen.«
»Wenn es eine Fakultät gibt, deren Mitglieder nie Nebeneinkünfte haben werden, dann ist das die philosophische.«
»Wer weiß, vielleicht bestellt man eines Tages philosophische Gutachten.«
»Worüber.«
»Über das Leben, das übrigbleibt, wenn die Technik eines Tages allen das Erwerbsleben abgenommen haben wird. Aber wahrscheinlich liegt dann die Nutte Psychologie auch schon im Bett dieses neuen Menschen. – Sie haben die Einladung zu unserem Fest erhalten.«
»Vielen Dank, ich komme gern.«
»Bringen Sie Ihre Frau mit.«
»Die ist auf ihrer Insel.«
»Wird der Professor kommen?«
»Er geht nicht auf Empfänge.«
Der neue Professor schickte sich an aufzustehen.
»Sagen Sie auch dem Privatgelehrten Bescheid.«
»Sie waren letzten Donnerstag im Seminar des Professors.«
Der neue Professor lehnte sich wieder zurück.
»Ich war überrascht, daß Sie sein Seminar vorbereiten. Dafür nimmt man sonst Assistenten.«
»Ich war sein Assistent. Ich bin der seltene Fall einer Hausberufung. Er hat mich gebeten, auch weiterhin seine Veranstaltungen über bestimmte Gegenstände zu begleiten.«
»Es liegt mir nicht, mich in Höflichkeiten zu ergehen, wenn sie zu weit aus der Wahrheit herausführen. – Ich war sehr enttäuscht. Ich hatte keinen Glanz erwartet, aber doch gediegenes Handwerk. Genauigkeit und auch Wachheit. Nichts von alledem. Ein zerfahrener Oberlehrer.«
»Er weiß ungeheuer viel.«
»Es gibt verschiedene Arten, jemandem etwas beizubringen. Man kann sein Wissen von der Welt ausbreiten, und man kann Vorgehensweisen vermitteln, wie jemand zu Wissen von der Welt kommt.«
»Er ist sonst nicht so zerstreut.«
Der Assistenzprofessor erwartete Gegenrede, die jedoch ausblieb.
»Er lebt mit seiner Schwester zusammen. Sie führt den Haushalt und nimmt ihm den Alltag ab. Er hält sich von allem fern, was nicht mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zu tun hat.«
»Und die Verwaltungsarbeit?«
»Erledige ich zusammen mit seiner Sekretärin. Wenn jemand eine Prüfung bei ihm ablegen will, vereinbare ich mit dem Betreffenden den Termin und bespreche den Prüfungsstoff. Der Professor bekommt einen Vermerk, wen er wann worüber prüft. Ich bin bei allen Prüfungen dabei. Er hat kein Gefühl dafür, was man von den Studenten erwarten kann und was nicht. Ich greife sanft ein, wenn er den Prüfling über- oder unterfordert. Was Magisterarbeiten oder Dissertationen betrifft, so bekommt er von dem für das betreffende Gebiet zuständigen Assistenten oder Professor einen fünfseitigen Gutachtensvorschlag. Die Schwierigkeit sind die Fakultätssitzungen. Was ich zu den einzelnen Tagesordnungspunkten weiß, schreibe ich ihm auf. Darüber hinaus kann ich ihm nicht helfen. – Er wird demnächst sechzig. Das ist natürlich ein Anlaß, sich über die irgendwann einmal bevorstehende Emeritierung Gedanken zu machen. Apropos – ich habe Sie noch nicht gefragt, ob Sie einen Aufsatz für die Festschrift zu seinem sechzigsten Geburtstag beisteuern wollen.«
»Wann ist Geburtstag.«
»Am neunundzwanzigsten Februar.«
»Dann habe ich noch Zeit.«
»Sie wollen etwas schreiben.«
»Ja.«
DONNERSTAG
Der Professor saß mit seiner Schwester auf der Terrasse zu Tisch. Es war ein ungewöhnlich warmer Frühsommermorgen. Sie nahm das Frühstück ein, er das Abendessen.
»Ich mache mir noch Kaffee. Soll ich dir noch eine Flasche Wein holen.«
»Nein danke. Ich trinke nichts mehr.«
»Möchtest du sonst noch etwas.«
»Nein danke.«
»Wirklich nicht?«
»Nein.«
Sie erhob sich und ging um den Tisch herum. Sie stellte sich hinter ihn, mit beiden Händen seine Stuhllehne umfassend.
»Ich bringe immer weniger auf den Tisch.«
»Ich habe keinen großen Hunger.«
Sie ging ins Haus. Als sie wiederkam, richtete sie das Wort an ihn, ohne sich zu setzen.
»Könntest du bitte für einen Augenblick deine Zeitung beiseite legen. Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
»Muß das jetzt sein. Ich bin sehr müde.«
»Wenn du nachmittags aufstehst, hast du keine Zeit, weil du ins Institut mußt. Jetzt ist die einzige Gelegenheit.«
Der Professor faltete die Zeitung zusammen, seine Schwester setzte sich auf den Stuhl neben ihm.
»Ich weiß, daß es für dich eine große Unbequemlichkeit bedeutet. Aber wir müssen einen neuen Heizkessel einbauen lassen. – Ich habe im letzten Winter dreimal die Handwerker dagehabt, weil die Heizung nicht in Ordnung war. Es war jedesmal eiskalt. Wir haben gesagt, im Sommer wird die Heizung überholt.«
Der Professor griff nach der Zeitung und nahm einen Teil heraus, um ihn dann doch nicht aufzuschlagen, sondern in seinen Schoß zu legen.
»Mit dem Heizkessel ist es nicht getan. Es hat keinen Sinn, und es ist wahrscheinlich technisch nicht einmal möglich, nur den Heizkessel auszutauschen. Die Heizung muß vollständig erneuert werden. Das bedeutet neue Heizkörper und neue Rohrleitungen. Im ganzen Haus. – Die elektrischen Leitungen müßten ebenfalls erneuert werden. Wir waren im letzten Jahr eine Nacht ohne Licht, wir haben die genaue Ursache bis heute nicht gefunden. Es hat in der Nacht stark geregnet, wahrscheinlich ist Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen, und es gab einen Kurzschluß.«
»Am Tag danach war das Licht wieder in Ordnung, und es ist seither nicht mehr ausgefallen.«
»Alle Wände müssen aufgemacht werden. Der Fußboden muß aufgerissen werden. Sie müssen unter das Parkett.«
»Wir können es nicht länger hinausschieben.«
»Wie soll ich schlafen, wenn wir Arbeiter im Haus haben.«
»Du müßtest dich eine Zeitlang umstellen. Du müßtest nachts schlafen und tagsüber im Institut arbeiten.«
»Ich kann tagsüber nicht arbeiten. Am Tag ist es zu hell und zu laut. Und schon gar nicht im Institut.«
»Die Heizung muß erneuert werden.«
Der Professor blätterte in dem Zeitungsteil auf seinem Schoß.
»Ich kann tagsüber nicht an meinem Buch arbeiten.«
»Wie sollen wir es sonst machen?«
»Bitte, unternimm noch nichts. – Laß mich darüber nachdenken.«
»Du weißt, ich tue nichts, ohne daß du dein ausdrückliches Einverständnis gibst.«
»Ich muß mich jetzt hinlegen.«
Der Professor legte den Zeitungsteil zusammen. Als er beim Aufstehen das linke Bein belasten wollte, knickte er ein und stützte sich für einen Augenblick mit der rechten Hand auf die Lehne des Stuhls, auf dem er gesessen hatte. Seine Schwester bemerkte es, sagte jedoch nichts.
»Ich stehe auf wie üblich.«
»Schlaf gut.«
»Danke.«
Acht Uhr war gerade vorbei, aber es war schon so warm, daß sie in ihrem leichten Morgenmantel und ihr Bruder im Hemd hatten draußen sitzen können. Wenn er ein Buch schrieb, schlief er in seinem Arbeitszimmer, das um einiges wärmer war als sein Schlafzimmer. Dabei vertrug er die Hitze nicht. Sie hatte wiederholt versucht, ihn zu überreden, er solle an besonders heißen Tagen doch in seinem Schlafzimmer schlafen. Es war ihr nicht gelungen, ihn zu überzeugen. Vor Abschluß der Niederschrift seines neuen Buches würde er nicht in sein Schlafzimmer zurückkehren.
Sie lehnte sich zurück und blickte auf das Haus ihrer Eltern und Großeltern, das sie mit ihrem Bruder bewohnte. Das dreistöckige Haus war um die Jahrhundertwende nach Plänen eines Schülers von Gabriel von Seidl errichtet worden. Auf der dem Garten zugewandten Südseite wies das Haus einen halbkreisförmigen, turmartigen Vorbau auf. Die beiden oberen Stockwerke befanden sich in dem weit heruntergezogenen Dach. Da das Grundstück in südlicher Richtung leicht abfiel, war das Parterre vom Garten aus gesehen eher ein Hochparterre. Eine verglaste Tür in der Mitte des Vorbaus führte auf einen schmalen, balkonartigen Absatz mit einer kleinen Brüstung. Die große Terrasse, auf der sie saß, befand sich ein halbes Stockwerk tiefer, man betrat sie durch eine Tür, die zu den von kleinen quadratischen Fenstern beleuchteten Wirtschaftsräumen unterhalb des Erdgeschosses führte, die über eine Treppe mit der Eingangshalle auf der Nordseite verbunden waren. Der Vorbau wies neben der Tür in der Mitte rechts und links jeweils ein großes, fast bis zum Boden gehendes Fenster in gleichen Größenverhältnissen wie die jeweils zwei Fenster rechts und links neben dem Vorbau auf. Der Vorbau war Teil des großen Salons, von ihr aus gesehen links davon befand sich das Speisezimmer, rechts neben dem großen Salon das Musikzimmer und daneben das Arbeitszimmer ihres Bruders. Auf der Höhe des ersten Stockwerks besaß der Vorbau eine zweite schmale Brüstung, die durch eine kleine, von zwei Fenstern eingerahmte Tür betreten werden konnte. Die jeweils zwei Dachgauben mit geraden, umgekehrt V-förmigen eingezogenen Dächern rechts und links daneben waren die Fenster der Schlafzimmer, dazwischen befand sich ein weiterer Salon. Der Vorbau war in der Form eines umgekehrten Blütenkelchs überdacht. Das Hausdach verlief vom First bis zum oberen Absatz flacher, auf der Höhe des ersten Stockwerks steiler.
Die Terrasse war mit quadratischen grauen Sandsteinplatten belegt. Der Sandstein war verwittert, die Platten wiesen Risse und Löcher auf und waren uneben, in den Ritzen und Sprüngen wuchs Moos. Zum Garten hin war die Terrasse von einer niedrigen Hecke begrenzt, eine Treppe mit zehn Stufen, so breit wie der Vorbau des Hauses, führte hinunter zu der Wiese. Die Stufen und das Geländer waren aus dem gleichen Sandstein wie die Platten der Terrasse. Zwei große verwitterte und deshalb unrund gewordene Kugeln bildeten den Abschluß der Treppenbegrenzung im Garten. Das Gras im Garten und auf dem Hang neben der Treppe stand hoch und war mit Disteln durchwachsen.
Das Haus war bis zur Unterkante des Erdgeschosses mit Efeu bedeckt. Auf der Seite des ebenerdigen Eingangs standen riesige alte Bäume. Im gleißenden Sonnenlicht waren die zahlreichen schwarzen Risse in der früher weißen und jetzt grauen Fassade deutlich sichtbar. Fensterstöcke und Fensterläden waren zwar regelmäßig gestrichen worden, aber die Farbe begann bereits wieder abzublättern. Das Dach hatte im letzten Winter sehr gelitten, zahlreiche Ziegel waren zersprungen und mußten ersetzt werden. Entlang der oberen Kante des Dachs bis hinauf zum First wuchs vereinzelt Moos.
*
Es war zehn Uhr morgens, und der Professor konnte nicht einschlafen. Er stand auf und trat zum Fenster, um die dicken, nach außen mit schwarzer, nach innen mit beiger Seide überzogenen Vorhänge zu öffnen. Die geschlossenen Fensterläden ließen an den Rändern so viel Licht in den Raum einfallen, daß alle Gegenstände deutlich erkennbar waren. Er setzte sich hinter den Schreibtisch. Er hatte die ganze Nacht an seinem Buch gearbeitet, mit nur einer Unterbrechung durch eine kurze Kaffeepause. War der Schmerz in seinem linken Bein oder die Aussicht, seinen Arbeitsrhythmus unter dem Druck der Umstände ändern zu müssen, der Grund dafür, daß er nicht einschlafen konnte. Früher war der Schmerz nur dann aufgetreten, wenn er sich nach längerer Pause bewegt hatte. Bei ruhig gelagertem Bein hatte er nichts gespürt. In letzter Zeit war der Schmerz jedoch auch in Ruhelage immer häufiger gegenwärtig. Dazu hatte der Schmerz seine Erscheinungsform gewechselt. Aus einem über die äußeren Muskelschichten des Oberschenkels verteilten leichten Stechen war ein dumpfes Pochen in dessen Innerem geworden, das jedoch mit längerer Ruhe gewöhnlich verebbte. Nicht so an diesem Tag. Er hatte sogar das Gefühl, das Pochen in seinem linken Oberschenkel habe noch zugenommen, seit er sich schlafen gelegt hatte.
Er wollte das Buch, an dem er schrieb, im Herbst an den Verlag senden, damit es im Frühjahr erscheinen konnte. Er erhoffte sich besondere Aufmerksamkeit dafür im Rahmen der zu erwartenden Erwähnungen seines Geburtstags. Wenn er seinen Arbeitsrhythmus beibehalten konnte, würde er keine Schwierigkeiten haben, den Termin einzuhalten. Wenn er jedoch gezwungen sein sollte, nachts zu schlafen und tagsüber im Institut zu arbeiten, dann würde das Buch, wenn überhaupt, nur langsame Fortschritte machen, die Wahrscheinlichkeit, es unter diesen Bedingungen rechtzeitig zu vollenden, war verschwindend gering. Er konnte im Institut nicht arbeiten. Er erledigte dort ausschließlich Dinge, die mit seiner Lehrverpflichtung zu tun hatten. Wirklich arbeiten konnte er nur während der Nacht, zu Hause, hier in seinem Arbeitszimmer.
Das Halbdunkel war durch den Stand der Sonne, die jetzt das Fenster unmittelbar beschien, zur gedämpften Helligkeit geworden. Sein Arbeitszimmer und das daran anschließende Musikzimmer, das nur noch als Bibliothek diente, waren von Richard Riemerschmid entworfen. Alles befand sich im ursprünglichen Zustand, nur die Bücher auf den Borden waren nicht mehr die seines Vaters, sondern diejenigen, die er für seine Arbeit benötigte. Das Arbeitszimmer war ein hoher, länglicher Raum mit einem großen Fenster auf die Südseite. Der Schreibtisch stand schräg vor dem Fenster, so daß der Arbeitende fast mit dem Rücken zum Fenster saß, das Tageslicht fiel über seine linke Schulter auf die Arbeitsfläche. Der Mittelteil des Schreibtisches war rechteckig, die beiden äußeren Teile waren leicht auf den Arbeitenden zugezogen. Auf der ihm zugewandten Seite befanden sich rechts und links je eine Tür, alle anderen Seiten waren mit über die ganze Höhe laufenden kassettenförmigen Vertiefungen verziert. Der Schreibtisch war in dunklem Nußbaumholz ausgeführt, die Vertiefungen mit Wurzelholz im Flammenmuster ausgelegt, die Arbeitsfläche mit in eine umlaufende Messingschiene gespanntem braunem Rindsleder überzogen. Hinter dem Schreibtisch befand sich ein hüfthoher, tiefer Einbauschrank mit drei Türen, die die gleichen kassettenförmigen Verzierungen aufwiesen wie der Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch lagen neben den Blättern der Niederschrift seines neuen Buches nur wenige aufgeschlagene Bücher. Dafür lehnten auf dem Einbauschrank etwa zwei Dutzend bis zu einem halben Meter hohe Bücherstapel an der Wand. Auf den Bücherstapeln lagen noch einmal Sonderdrucke und Broschüren. Einige Sonderdrucke waren heruntergefallen und klemmten auf halber Höhe zwischen den Bücherstapeln. Dahinter begann über dem Schrank ein Bücherregal mit sechs Borden, das mit einem Abstand von einem halben Meter zu der hohen Decke über die ganze Länge des Zimmers lief. In der Mitte des Raums war ein Bett längsseits in die Bücherwand eingebaut. Über dem Bett waren die drei unteren Bücherborde ausgespart, der freie Teil war mit einer Holzvertäfelung ausgekleidet. Dort hingen in vergoldeten Jugendstilrahmen zwei Ölportraits der Eltern seiner Mutter. Auf der dem Fenster abgewandten Seite setzten sich nach dem Bett Einbauschrank und Bücherregal wie hinter dem Schreibtisch fort. Die gegenüberliegende Wand wies ebenfalls auf der ganzen Länge Einbauschrank und Bücherregal auf, wobei jedoch der Einbauschrank nicht tiefer als die Bücherborde war. Der Eingang zu dem Zimmer befand sich gegenüber dem Schreibtisch, die Tür ging in das danebenliegende Musikzimmer auf. An der Fensterseite sowie an der ihr gegenüberliegenden Seite war der Raum mit einer brusthohen Holzvertäfelung mit kassettenförmigen Vertiefungen ausgekleidet. Zwischen Schreibtisch und Tür stand ein schmaler, hoher Schrank mit sieben gleich großen Schubladen. Der Schrank war ebenso wie der Schreibtisch, das Bett, die Bücherborde und die Holzvertäfelungen in dunklem Nußbaumholz ausgeführt. Der Boden wies ein helles Fischgrätparkett auf, vor dem Bett lag ein alter Buchara, der auf der dem Fenster zugewandten Seite deutlich breiter war. Der aus mannshohen, graugestrichenen, gußeisernen Rippen bestehende Heizkörper befand sich an der dem Fenster gegenüberliegenden Seite. Wenn die Heizung erneuert würde, müßte der alte Heizkörper durch einen modernen ersetzt werden. Um die Rohrleitungen auszutauschen, müßte man das Parkett aufreißen und die Holzvertäfelung demontieren.
Der Professor erhob sich und ging zum Bett zurück. Durch den Spalt zwischen den unvollkommen schließenden Fensterläden trat ein Lichtstrahl ein, der sich im Raum durch die ihn reflektierenden Staubteilchen abzeichnete und der das Zimmer wie eine Trennscheibe entzweischnitt. Während er auf der Bettkante saß und den Lichtstrahl betrachtete, öffnete sich geräuschlos die Tür.
Seine Schwester blickte ihn mit unbewegtem Gesichtsausdruck an. Sie war drei Jahre älter als er. Ihre Gesichtshaut wies fast keine Falten auf, die Lichtverhältnisse betonten jedoch die sich deutlich abzeichnenden Backenknochen. Sie hatte südländisches Haar, dichte, kurzgeschnittene Locken, jetzt ein Nebeneinander von pechschwarzen und schlohweißen Strähnen. Sie war schlank und großgewachsen. Die hohe Taille und der hohe Kragen des Morgenmantels unterstrichen ihre Größe.
»Ich habe gehört, wie du die Vorhänge aufgezogen hast.«
»Ich kann nicht einschlafen.«
»Ist es wegen – hat es mit dem zu tun, worüber wir beim Essen gesprochen haben.«
»Nicht nur. – Ich habe in letzter Zeit manchmal leichte Schmerzen im linken Oberschenkel.«
»Warum hast du nichts gesagt.«
»Es ist nicht schlimm. Nur ein leichtes Stechen, wenn ich länger laufe oder stehe.«
»Aber du kannst deswegen nicht schlafen.«
»Ich habe vorher noch nie im Ruhezustand Schmerzen gehabt. Sonst hätte ich etwas gesagt. – Es wird nichts Ernstes sein. Wahrscheinlich eine Zerrung.«
»Du solltest einen Arzt aufsuchen.«
»Ich habe gedacht, es geht von selbst wieder vorbei. – Vielleicht ist es auch eine Gefäßsache.«
Er blieb auf der Bettkante sitzen. Ihre Augen hatten sich mittlerweile an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Bis auf einen schmalen weißen Kranz hatte er keine Haare mehr auf dem Kopf. Das Fehlen der Haare ließ seinen Kopf rundlicher wirken, als er eigentlich war, und es unterstrich seinen weichen Gesichtsausdruck. Er besaß kleine Ohren. Er hatte die gleiche faltenlose Haut wie seine Schwester, ohne daß sich jedoch die Knochen darunter so deutlich abgezeichnet hätten wie bei dieser. Sein Mund hätte der Mund einer Frau sein können. Er war untersetzt, mit fast weiblichen Fettpolstern an Bauch und Brust, und mit unmuskulösen breiten Oberschenkeln und Oberarmen. Er trug einen leicht glänzenden, grau und blau gestreiften Schlafanzug.
»Was die Heizung betrifft, ich werde nichts unternehmen, bevor du nicht beim Arzt gewesen bist.«
»Ich möchte unbedingt, daß mein neues Buch zu meinem sechzigsten Geburtstag erscheint. Ich kann im Institut nicht daran arbeiten.«
»Ich möchte zu deinem sechzigsten Geburtstag einen Empfang geben. Ich hätte gern, daß das Haus in vorzeigbarem Zustand ist.«
»Derartige Veranstaltungen liegen mir nicht sehr.«
»Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ich werde alles so einrichten, daß du die Vorbereitungen überhaupt nicht bemerken wirst.«
»Ich bin dir dankbar für deine Mühe.«
»Du solltest jetzt versuchen zu schlafen.«
Sie ging um den Schreibtisch herum zum Fenster und zog die Vorhänge zu. Sie schob die Enden sorgfältig übereinander, damit kein Licht mehr einfallen konnte. Er hatte sich inzwischen wieder hingelegt. Als sie die Tür geschlossen hatte, war das Zimmer völlig dunkel.
*
Am Spätnachmittag blickte der Professor erschöpft dem Beginn seines Seminars entgegen. Er hatte nach dem Gespräch mit seiner Schwester einschlafen können, aber er war bereits nach kurzer Zeit wieder aufgewacht und hatte sich unruhig hin und her gewälzt. Es war ihm vorgekommen, als sei er nur noch wach gelegen. Trotzdem war er nicht aufgestanden, bevor der Wecker geklingelt hatte.
Vor ihm lagen drei Dissertationen, zusammen mit den entsprechenden Gutachtensvorschlägen, die seine Assistenten formuliert hatten. Er konnte sich nicht dazu entschließen, die Gutachtensvorschläge zu lesen und sich mit den Dissertationen zu befassen. Er war in Gedanken bei seinem Buch. Vielleicht würde ihm tatsächlich nichts anderes übrigbleiben, als zu versuchen, hier, im Institut, daran zu arbeiten. Er hatte in seinem Dienstzimmer noch nicht eine Zeile geschrieben, die nichts mit seiner Lehrverpflichtung zu tun gehabt hätte. Dabei war der Raum ruhig. Er befand sich am Ende des Flurs und ging nicht zur Straße, sondern auf den großzügigen, baumbewachsenen Innenhof hinaus. Seine Sekretärin hatte er auf der anderen Seite des Flurs untergebracht, so daß er das Geräusch der Schreibmaschine nicht hörte. In dem Raum neben seinem, der eigentlich für die Sekretärin vorgesehen war, hatte er den Logiker einquartiert, der wie er selbst fast nie im Institut arbeitete. Außerdem hatte er die Tür zum Gang sowie die immer verschlossene Durchgangstür zum Nebenraum auf eigene Kosten mit einem schallschluckenden Bezug versehen lassen. Er hatte die Einrichtung mit dem Schreibtisch, den Regalen und der Sitzgruppe aus hellem Holz in der Art eines Büros der fünfziger Jahre immer verabscheut. Er hatte jedoch nie auch nur mit dem Gedanken gespielt, den Raum so einzurichten, wie er sich ein zweckmäßiges Arbeitszimmer vorstellte. Die Stillosigkeit der Einrichtung, der billige Linoleumboden, die abgestoßenen Kanten der Möbel und die verschossenen blauen Polster hielten ihn zur Ökonomie an und mahnten ihn unablässig, nach Hause, zu seiner eigentlichen Arbeit zurückzukehren.
*
Nach dem Seminar sah sich der Professor einem Ministerialbeamten gegenüber, der ihn gemäß dem Vermerk der Sekretärin in einer Verwaltungsangelegenheit sprechen wollte. Der Beamte war großgewachsen, jedoch sehr hager, er ging gebeugt, und sein Gesicht war eingefallen. Er mußte kurz vor der Pensionierung stehen. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine dunkle Streifenkrawatte. Der Hemdkragen war ihm viel zu weit, und der Anzug schlotterte an ihm. Der Ministerialbeamte hatte die Zeit bis zu seinem Termin beim Professor in der Institutsbibliothek verbracht, wo er die Klappentexte und die Inhaltsverzeichnisse der aufliegenden Bücher des Professors überflogen hatte. Der Professor beantwortete gern eine auf seine wissenschaftliche Arbeit Bezug nehmende Frage.
»Eine rational rekonstruierte Theorie ist eine Menge von Theorieelementen, die alle Spezialisierungen eines Theoriekerns sind, desjenigen Theorieelements, das die für die Theorie grundlegenden Gesetze enthält. Ein Theorieelement ist ein geordnetes Paar aus einer mathematischen Struktur und einer Menge von beabsichtigten Anwendungen. Die mathematische Struktur besteht aus dem vollständigen Begriffsapparat der Theorie, der als Menge der potentiellen Modelle eines mengentheoretischen Prädikats dargestellt wird, aus den Gesetzen, die als Menge der Modelle eines mengentheoretischen Prädikats dargestellt werden, aus den Constraints, das sind anwendungsübergreifende Gesetze, und aus dem nichttheoretischen Begriffsapparat der Theorie. Die beabsichtigten Anwendungen der Theorie werden ausschließlich in nichttheoretischen Begriffen beschrieben. Ein Theorieelement verkörpert die folgende Behauptung: Zu jeder beabsichtigten Anwendung gibt es ein theoretisches Modell, das die nichttheoretisch beschriebene Anwendung enthält und das den Gesetzen und Constraints der in Frage stehenden Theorie genügt. Dies bedeutet, jede beabsichtigte Anwendung kann so in theoretischen Begriffen beschrieben werden, daß die Gesetze der Theorie Gültigkeit haben und daß für die Menge der beabsichtigten Anwendungen insgesamt die von der Theorie beschriebenen Constraints erfüllt sind...«
Der Ministerialbeamte, der zuletzt mit sichtbar wachsender Ungeduld zugehört hatte, unterbrach den Professor.
»Ich möchte Ihre Zeit nicht länger als unbedingt notwendig in Anspruch nehmen. Der Anlaß meines Besuchs sind Überlegungen zu einer unvermeidbar gewordenen Neuordnung des Lehrangebots.«
»Es geht um Stellenstreichungen.«
»Die Entwicklung und Verteilung des Kultusetats wird für einen längeren Zeitraum festgelegt. Auf der einen Seite gehen wir von einer bestimmten Steigerungsrate des Etats für die nächsten Jahre aus, auf der anderen Seite errechnen wir die Steigerungsraten bei den Personal- und Sachkosten. Wir müssen handeln, wenn wir sehen, daß der zur Verfügung stehende Etat die anfallenden Kosten nicht decken wird.«
»Was bedeutet das für mein Institut?«
»Es gibt jetzt zwei philosophische Institute. Das Philosophische Institut Eins mit Ihnen als Vorstand und das Philosophische Institut Zwei mit Ihrem Kollegen Sonnabend als Vorstand. Zwei Institute mit zwei Etats für zwei Bibliotheken, für die doppelte Anzahl von Lese- und Seminarräumen und für zwei Institutsvorstände. Es liegt auf der Hand, daß sich nicht unbeträchtliche Einsparungen erzielen lassen, wenn man die beiden philosophischen Institute zusammenlegt.«
Der Professor schwieg.
»Es ist nicht beabsichtigt, Stellen zu streichen. Professorenstellen auf keinen Fall. Aber wir können nicht an den Einsparungsmöglichkeiten vorbeigehen, die sich bei den Sachkosten ergeben.«
Der Professor schwieg weiter.
»Wie denken Sie über diese Möglichkeit.«
»Die beiden philosophischen Institute verkörpern sehr unterschiedliche Auffassungen von Philosophie...«
Der Ministerialbeamte fiel dem Professor ins Wort. Er machte mit beiden Armen weit ausholende Bewegungen, während sein Kopf vor- und zurückging.
»Aber Ihre Lehrinhalte bleiben selbstverständlich völlig unberührt. Sie alle werden in einem gemeinsamen Institut dasselbe, genau dasselbe machen wie jetzt auch, nur unter geringfügig anderen organisatorischen Voraussetzungen.«
»Was kann ich dazu sagen.«
»Wir wollen Ihnen nichts aufzwingen. Wie das Vereinigte Philosophische Institut aussehen soll, bleibt völlig Ihnen überlassen. Sie und Ihr Kollege vom jetzigen Philosophischen Institut Zwei sind in der Gestaltung des neuen Instituts völlig frei. Sie geben sich Ihre Verfassung.«
»Die Zusammenlegung ist unvermeidbar.«
»Die Möglichkeit der Kosteneinsparung liegt selten so auf der Hand wie in diesem Fall. Nur noch ein Institut bedeutet auch: Wir können etwa ein Drittel der Räume, die jetzt beide Institute zusammen belegen, anders nutzen. Wir benötigen die frei werdenden Räume dringend für die Ökonomen.«
»Philosophen sind nicht unbedingt als Unternehmernachwuchs zu gebrauchen.«
»Sie dürfen nicht denken, wir stellen weniger alltagsnahe Fächer grundsätzlich hintan. Aber wir stehen in diesem Fall einfach unter dem Diktat der Studentenzahlen.«
»Sie haben bereits mit dem Philosophischen Institut Zwei über das Thema gesprochen.«
»Ich habe natürlich zuerst Sie aufgesucht. Mit den anderen muß ich noch sprechen. – Sie sollten sich alle zusammensetzen und einen gemeinsamen Organisationsvorschlag erarbeiten. Das Ministerium wird sich nicht dagegenstellen.«
Der Professor blickte an dem Besucher vorbei und sagte nichts.
Der Ministerialbeamte griff nach seinem Aktenkoffer und erhob sich behend.
Der Professor gab ihm wortlos die Hand.
*
»Hast du noch Schmerzen?«
»Ich habe zwar nicht gut geschlafen, aber die Schmerzen waren nach dem Aufstehen weg.«
»Du warst so lange im Institut.«
Der Professor saß mit seiner Schwester zu Tisch. Sie aß belegte Brote, er nahm eine warme Mahlzeit ein.
»Ich habe Besuch bekommen. Von einem Ministerialbeamten. – Er hat mir eröffnet, daß die beiden philosophischen Institute zusammengelegt werden sollen. Stellenstreichungen seien angeblich nicht geplant. Es gehe um die Einsparung bei den Sachkosten. – Der Gedanke ist unerträglich. – Zur Kritik der politischen Utopie. Moralische Grundbegriffe. Die Frage Wozu?Gentechnik und philosophische Ethik. Bücher, die unter der Überschrift Sachbücher besprochen werden. Aufsätze in Tageszeitungen, Aufsätze in Wochenendbeilagen, Aufsätze in Illustrierten. Der kategorische Imperativ und die Neutronenbombe. Der Weltgeist und der ökologische Gedanke. Man stelle zu jeder beliebigen Frage zwei beliebige Philosophen einander gegenüber, und man zeige, von welchen anderen Philosophen sie beeinflußt worden sind, ob und wie sie sich wechselseitig beeinflußt haben, welche anderen Philosophen sie beeinflußt haben, wo sie sich einig sind, wo sie sich widersprechen, wer wo damals recht hatte, wer wo heute noch recht haben könnte. Es wird immer etwas dastehen, was dem Leser irgendwie philosophisch interessant erscheint, und was vor allem den Verfasser als umfassend gebildet ausweist.«
Der Professor spürte wieder das Pochen in seinem linken Bein.
»In Sonnabends Augen bin ich eine Art Ingenieur. Er verachtet mich und ich verachte ihn. Es gibt nichts, worüber ich mich mit ihm einigen könnte. Bei mir kämen seine Assistenten nicht einmal durch die Magisterprüfung. Ich bestehe darauf, daß jeder Anfänger eine Reihe von Grundkursen durchläuft, bevor er zu mir ins Seminar kommt. Er rät seinen Studenten vom Besuch der Grundkurse an meinem Institut ab. Meine Grundkurse machten sie voreingenommen. Das ist richtig. Meine Logikkurse machen die Studenten voreingenommen gegen seine Begriffsschluderei. Sonnabend hat den Erfolg in der Öffentlichkeit, weil er die Stellung innehat, von der die Öffentlichkeit meint, sie sei der Lohn für den Erfolg in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, und er hat die Stellung, weil die Narren im Ministerium – sie sind nur Demokraten! – meinen, der Erfolg in der Öffentlichkeit sei nicht denkbar ohne den Erfolg in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.«
»Was ist, wenn Sonnabend hinter den Zusammenlegungsplänen steckt.«
»Daran habe ich noch gar nicht gedacht. – Es wäre sehr gut möglich.«
»Er ist jünger als du. Sie können ihn nicht zum Institutsvorstand machen.«
»Ich werde in jedem Fall Vorstand und er Stellvertreter. Aber die Titel werden keine Rolle spielen. Wenn ich es mit ihm aufnehmen wollte, wäre ich gezwungen, für die Verwaltungstätigkeit viel mehr Zeit aufzuwenden.«
»Du mußt doch nicht alles selbst machen. Du kannst dir jemanden heranziehen, dem die Verwaltungstätigkeit mehr liegt als dir und der die Dinge in deinem Sinn regelt.«
»Das habe ich bereits getan. Aber ich kann mich bei Verhandlungen mit Lehrstuhlinhabern nicht durch einen Nichtlehrstuhlinhaber vertreten lassen.«
»Bevor du irgend etwas unternimmst, mußt du dich mit deinen Mitarbeitern besprechen. Vielleicht besitzt einer von ihnen Verbindungen, vielleicht wissen sie Rat. Und du solltest herausfinden, wer im Ministerium in bezug auf diese Angelegenheit wirklich das Sagen hat. An den mußt du herankommen.«
»Ich habe mich nicht dahin gedrängt, wo ich jetzt bin. Ich habe immer nur gearbeitet. Ich bin auf den Lehrstuhl berufen worden, damit ich weiterarbeite. Ich habe auf nichts und niemanden Einfluß genommen, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt bin.«
MONTAG
Der Freund des Assistenzprofessors verließ gegen vier Uhr nachmittags das Kino Nummer fünf eines aus sechs Vorführsälen bestehenden Schachtelkinos. Der Weg ins Freie führte durch ein Treppenhaus, in dem seine und die Schritte der beiden anderen Besucher, die denselben Film gesehen hatten, laut von den Steinstufen und den gelb gestrichenen Wänden widerhallten. Draußen regnete es in Strömen. Er spannte den Schirm auf und stand unschlüssig. Zu Hause wartete der Vortrag für den Kongreß auf ihn, mit dem er nicht weiterkam. Er beschloß, den Assistenzprofessor aufzusuchen, um mit ihm über seinen Vortrag zu sprechen. Der Assistenzprofessor lebte zusammen mit seiner Frau in einer Zweizimmerwohnung im Erdgeschoß eines einfachen Mietshauses aus den fünfziger Jahren in einer ruhigen Seitenstraße der Leopoldstraße. Der Freund des Assistenzprofessors läutete an der gläsernen Haustür, er war froh, als ihm geöffnet wurde. Die Wohnung ging zum Hof hinaus, sie befand sich am Ende eines langen Hausflurs ohne Fenster. Das Licht war ausgefallen, der Flur stand eine Handbreit unter Wasser. Die weit offen stehende Wohnungstür gab den Blick auf die überschwemmte Diele frei, von der es rechts der Reihe nach in die Küche, in das Bad und in das Wohnzimmer ging, hinter der geschlossenen Tür am Ende der Diele befand sich das Schlafzimmer. Der Boden der Diele war mit groben blaugrünen Teppichfliesen belegt, die sich im Wasser teilweise oder ganz von der Unterlage gelöst hatten, einige hatten sich mit der Fließrichtung des Wassers bis zur Türschwelle bewegt. Auf der linken Seite der Diele erstreckte sich über deren gesamte Länge ein vom Boden bis zur Decke reichendes Blechregal mit den Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und Niederschriften des Assistenzprofessors. Das erste Bord des Regals begann etwa dreißig Zentimeter über dem Boden, die unmittelbar auf dem Boden lagernden Bücher und Zeitschriften hatten sich mit Wasser vollgesogen und waren so aufgedunsen, daß sie, wieder trocken, kaum mehr zu gebrauchen sein würden.
Der Freund des Assistenzprofessors hörte ein Geräusch aus der Wohnung. Er klopfte am Türrahmen. Eine ihm unbekannte weibliche Stimme antwortete, er solle hereinkommen. Er betrat vorsichtig die Diele und sah in der Küche eine Frau in Arbeitskittel und Gummistiefeln, offensichtlich die Hausmeisterin. Sie hatte einen Wassereimer in der Hand, sie war enttäuscht, als sie den Besucher sah. Das Regenwasser floß mit den Hausabwässern in die Kanalisation. Ihr Mann hatte das verstopfte Rohr mittlerweile freigemacht. Die anderen Mieter im Erdgeschoß waren rechtzeitig verständigt worden, sie hatten das durch die Ausgüsse in Bad und Küche hochsteigende Wasser abgeschöpft. Die Frau des Assistenzprofessors war in Griechenland, der Assistenzprofessor selbst nicht zu Hause. Der Assistenzprofessor hatte ihr einen falschen Schlüssel dagelassen, man hatte die Wohnungstür aufbrechen müssen. Ob er ihr helfen könne, die Küchenmöbel von der Wand zu rücken. Er watete vorsichtig in die Küche.
Um die große Kokosmatte auf dem Küchenboden trocken zu legen, mußten der Küchentisch, der Kühlschrank, die Waschmaschine und eine Anrichte angehoben werden. Der Besucher zog Mantel sowie Pullover aus und legte beide zusammen mit dem Schirm auf den Küchentisch, den er vorher mit der Hand abwischte. Er stemmte der Reihe nach die Möbel so weit hoch, daß die Hausmeisterin die darunterliegende Kokosmatte hervorzerren konnte. Die Waschmaschine und die Anrichte waren schwer und erforderten mehrere Anläufe. Er hatte Wasser in den Schuhen und geriet ins Schwitzen. Seine Hose war ebenfalls naß geworden, weil die Hausmeisterin in ihren breiten Gummistiefeln mit jedem Schritt um sich spritzte. Als er die Anrichte hochstemmte, öffnete sich eine Tür, und ein Glas mit Linsen fiel auf den Boden und zersprang. Die Linsen verteilten sich, sogen sich voll Wasser und blieben im Geflecht der Kokosmatte hängen. Als diese endlich frei lag, hielten beide erst einmal schwer atmend inne. Dann trugen sie die schmutzstarrende, vom Wasser schwere Kokosmatte auf den Küchenbalkon und warfen sie, weil der trockene Teil des Balkons mit mannshohen Holzkisten vollgestellt war, über das Geländer, wo sie im strömenden Regen hing. Während die Hausmeisterin das Wasser in der Küche aufwischte, ging der Besucher, der sich unter Aufbietung aller Kräfte bemüht hatte, die schmutzige Kokosmatte möglichst weit weg von seinem Körper zu halten, in das Wohnzimmer. Es gab nur ein kleines Fenster gegenüber der Tür, mit Blick auf die Garageneinfahrt und die Mülltonnen. Rechts davon war der Arbeitsplatz des Assistenzprofessors, ein schmaler unaufgeräumter Tisch an der Wand, darüber einige ebenso unaufgeräumte Bücherborde.
In der Mitte des Arbeitstisches lag ein Block, dessen oberste Seite zur Hälfte beschrieben war, daneben ein Stapel beschriebener Blätter, der mit einem kleinen Flußpferd aus Onyx beschwert war. Darum herum Bücher, aus Zeitschriften herauskopierte Aufsätze und Niederschriften, viele davon aufgeschlagen. Neben dem Tisch stand auf dem Boden ein Rechner, der nicht angeschlossen war. Der Besucher ging alle Schriften durch, die auf dem Tisch lagen. Er fand mehrere Bücher und Aufsätze, die nach den Unterstreichungen und Anmerkungen für die Arbeit des Assistenzprofessors von Bedeutung sein mußten, die ihm selbst jedoch nicht bekannt waren. Auf den Bücherborden über dem Arbeitstisch entdeckte er weitere ihm nicht geläufige Titel. Er suchte aus dem übervollen Papierkorb ein Blatt heraus und schrieb auf dessen Rückseite hastig die Titel der Bücher und Aufsätze, die er sich in der Institutsbibliothek ansehen wollte. Er war froh, daß die Hausmeisterin, die immer noch die Küche saubermachte, ihn bei dieser Tätigkeit nicht überraschte. Er bemühte sich, nichts zu verrücken und alles so zu hinterlassen, wie er es angetroffen hatte.
Er rollte den schmutziggrauen Berberteppich vor der Sitzgruppe zusammen, hob ihn hoch, ließ das Wasser ablaufen und trug ihn durch die Küche an der Hausmeisterin vorbei auf den Balkon. Der Rechner stand ebenfalls im Wasser. Er hob ihn hoch und war unschlüssig, wo er ihn hinstellen sollte. Er setzte ihn zunächst auf dem Arbeitsstuhl ab. Schließlich schob er den Block sowie den Stapel beschriebener Blätter beiseite und stellte den Rechner in die Mitte des Arbeitstisches.
Die Hausmeisterin hatte inzwischen damit begonnen, das Wasser aus dem Wohnzimmer zu entfernen. Sie hatte das beige Cordsofa und den dazugehörigen Sessel an die Wand gekippt. Der Besucher zog Pullover und Mantel über, er wollte sich verabschieden. Aber die Hausmeisterin bat ihn zu bleiben. Sie mußte einige dringende Dinge erledigen, bevor um halb sieben die Geschäfte zumachten. Ihr Mann brachte ein neues Schloß, bis dahin konnte sie die Wohnung nicht abschließen. Der Besucher erklärte sich bereit zu warten, bis die Hausmeisterin von ihren Besorgungen zurück war.
Er stellte das Sofa wieder an seinen Platz und setzte sich hinein. Er begann, die auf einem Beistelltisch liegenden Zeitschriften durchzublättern. Unter diesen fand er ein schmales Buch mit einem griechischen Titel, auf dessen Umschlag fünf aufrecht gehende und wie Menschen bekleidete Flußpferde abgebildet waren. Er erinnerte sich, der Assistenzprofessor hatte ihm einmal erzählt, seine Frau verfasse bebilderte Geschichten. In den griechischen Text waren mit Blei- und Rotstift gezeichnete Bilder von Flußpferden in wechselnden Umgebungen eingearbeitet. Er hatte das Buch schon beiseite gelegt, als er zwischen zwei Zeitschriften kopierte Blätter entdeckte, die offensichtlich die Übersetzung des griechischen Textes enthielten. Er begann zu lesen, die Übersetzung in der rechten, das Buch in der linken Hand.
Die Große Malme, ein unförmiges Nilpferd in einem weiten weißen Gewand und mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf, schreibt ein Buch mit dem Titel Die Abenteuer von Kuni und Henriette. Lehrreiche Geschichten von hohem didaktischem Wert! Die Große Malme hatte nur den Titel ihres neuen Werks niedergeschrieben, als auch schon Kuni, ein schönes und strahlendes, gutmütiges Nilpferd in einem weißen Gewand mit roten Borten und einer großen roten Schleife um den Hals, mit einem Heiligenschein über dem Kopf und einem Feuerschwert in der Hand eine Anzeige in der Zeitung aufgab, daß die Große Malme eben dieses Werk verfasse. Die Große Malme hatte noch nie Geschichten aus dem Leben geschrieben. Sie sollte sehr bald erfahren, wie heikel und gefährlich es war, Nilpferde aus ihrer näheren Umgebung zu beschreiben. Die Anzeige liest der pensionierte fahrende Ritter Parsi, ein kleines nacktes Nilpferd in schwarzen Stiefeln. Er gibt sofort König Hug Bescheid, der im Altersheim Der Frühling residiert, und er sucht Kumbor, den Usurpator, auf. Kumbor, ein großes ganz nacktes Nilpferd, zieht gerade die Jalousie vor dem Schaufenster seiner Boutique herauf, in der er Kronen verkauft, die er Königen stiehlt. Parsi zeigt ihm stolz die Anzeige. Kumbor findet daran nichts Bemerkenswertes. Parsi erläutert, das Buch werde über ihn und sein Roß gehen. Kumbor weist verständnislos darauf hin, dort stehe aber, das Buch gehe über Kuni und Henriette. Parsi antwortet: Wenn Kuni und Henriette in ein Buch hineinpassen, dann passen auch ich und mein Roß hinein! Kumbor verständigt umgehend Philippine, ein kleines Nilpferd in Blue jeans und Turnschuhen, die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Wilhelmine ein Inselhotel führt. Philippine packt sofort ihre Koffer und wird dabei von Wilhelmine überrascht. Philippine erklärt Wilhelmine, sie müsse schnellstens die Große Malme aufsuchen, denn diese schreibe ein Buch über sie. Wie das Buch denn heiße? Die Abenteuer von Philippine? Nicht ganz, stammelt Philippine. Die Abenteuer von Kuni und Henriette