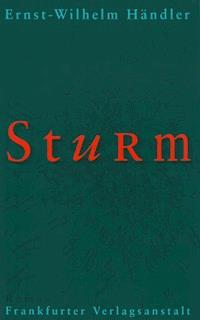Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Fall" schildert den Machtkampf in einem mittelständischen Unternehmen nach dem Tod des Firmengründers: Georg Voigtländer tritt die Nachfolge seines Vaters an. Der Mittdreißiger, der sein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung absolvierte, jedoch bereits keine Haare mehr auf dem Kopf hat, sieht sich am Beginn einer steil nach oben führenden Karriere. Nach den betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern macht Voigtländer alles richtig. Nur mißachtet er dabei sämtliche unausgesprochenen Gesetze. Sein Onkel, Anteilseigner wie er, interpretiert die Firmenzukunft weitaus privater. Er will seinem Sohn Friedrich eine möglichst hoch dotierte Geschäftsführerposition zuschanzen und trifft alle Vorbereitungen, um den lästigen Mitgesellschafter aus der Firma zu drängen. Georg, der unter diesem 'falschen Berufsleben' leidet, sucht Rettung in einer ganz anderen Welt: in der Welt der Bücher, zunächst im Lesen, dann im Schreiben. Über den Umweg der Literatur nimmt er endlich die Kälte und den sprachlosen Größenwahn des Geschäftslebens wahr und erkennt, welchen Anteil er daran hat. Doch die Fallhöhe ist lange erreicht - der Narr stürzt ins Bodenlose.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FALL
Fall schildert den Machtkampf in einem mittelständischen Unternehmen nach dem Tod des Firmengründers: Georg Voigtländer tritt die Nachfolge seines Vaters an. Der Mittdreißiger, der sein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung absolvierte, jedoch bereits keine Haare mehr auf dem Kopf hat, sieht sich am Beginn einer steil nach oben führenden Karriere. Nach den betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern macht Voigtländer alles richtig. Nur missachtet er dabei sämtliche, unausgesprochenen Gesetze. Sein Onkel, Anteilseigner wie er, interpretiert die Firmenzukunft weitaus privater. Er will seinem Sohn Friedrich eine möglichst hoch dotierte Geschäftsführerposition zuschanzen und trifft alle Vorbereitungen, um den lästigen Mitgesellschafter aus der Firma zu drängen. Georg, der unter diesem ›falschen Berufsleben‹ leidet, sucht Rettung in einer ganz anderen Welt: in der Welt der Bücher, zunächst im Lesen, dann im Schreiben. Über den Umweg der Literatur nimmt er endlich die Kälte und den sprachlosen Größenwahn des Geschäftslebens wahr und erkennt, welchen Anteil er daran hat. Doch die Fallhöhe ist lange erreicht – der Narr stürzt ins Bodenlose.
PRESSESTIMMEN
»Ernst-Wilhelm Händlers zweiter Roman kann zu den bedeutendsten Büchern der letzten Jahre gerechnet werden.«
FRANKFURTER RUNDSCHAU
»Fall ist ohne Zweifel gross angelegt, gross gedacht und von grossem Ernst. Der Autor nimmt die Aporien des modernen Erzählens wie die der modernen Welt wacker auf sich und setzt ihnen eine Sprache entgegen, deren Sätze klar, streng und effizient sind. Erzählerisches Fett hat da keine Chance.«
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
»Eine ungeheuer spannende Leseerfahrung.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Ernst-Wilhelm Händler
Fall
Roman
Worte sind Taten.
Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen
Um acht Uhr wird das Telefon läuten. Es wird ein junger Krankenhausangestellter am Apparat sein. Er wird mich fragen, ob ich der Sohn von Herrn Georg Voigtländer bin. Ich werde ja sagen. Er wird sagen, er muß mir leider eine sehr traurige Mitteilung machen. Dann wird er zunächst nichts sagen, und ich werde auch nichts sagen. Nach der Pause wird er fortfahren, daß soeben mein Vater verstorben ist. Ich werde sofort ins Krankenhaus fahren. Es ist Sonntagabend. Ich war, seit er am Dienstag eingeliefert wurde, jeden Tag morgens und abends bei ihm. Am Freitag hatte der behandelnde Arzt berichtet, die Herzrhythmusstörungen hätten sich unter der Medikation wesentlich gebessert. Mein Vater fragte schon, wann er das Krankenhaus wieder verlassen könne, man hatte ihm geantwortet, in etwa zwei bis drei Wochen, ob er dann wieder seinen Wein würde trinken können, in Maßen ja. Vormittags las er im Stuhl Zeitung. Nachmittags schien er in gedrückter Stimmung. Er saß auf dem Bett, ließ die Beine schlenkern und blickte auf die verschneite Parklandschaft und den vereisten Parkplatz vor dem Krankenhaus. Auf den Kirchturm mit der Uhr. Es wurde bereits dunkel. Wenn er hier jemals wieder herauskomme, werde er nicht mehr in die Firma gehen. Nie wieder. Als ich ihn verließ, sagte er, er sei sehr müde, er wolle schlafen, und er legte sich schon zurück, während ich mir den Mantel überzog. Wenn ich wiederkomme, wird er noch warm sein. Er wird auf dem Rücken liegen. Seine Haare sind in Unordnung. Er wird noch warm sein, aber er wird bereits nicht mehr so aussehen, als wäre noch Leben in ihm. Er ist zu bleich, als daß er noch leben könnte. Seine Nase ist zu groß, als daß er noch leben könnte. Seine Haut ist straff, aber nicht wie bei einem Lebenden, sondern wie bei einem Toten. Seine Gesichtszüge werden nicht von Schrecken erzählen. Die Augen werden geschlossen sein, er wird im Schlaf gestorben sein, nur der Mund wird offenstehen. Als ob er tief Luft holen wollte, aber auch, als ob es nichts geholfen hat. Und, als ob es ihm doch nichts ausmacht. Ich werde mein Schluchzen in der Bettdecke ersticken, und ich werde seine Hand halten, die warm ist, als ob er noch leben würde. Ich werde so lange an seinem Bett bleiben, bis die Schwestern unsicher werden und den behandelnden Arzt herbeirufen, der nun wirklich nichts mehr ausrichten kann. Er wird mir erklären, es tue ihm leid, aber mein Vater hatte keine günstige Prognose. Das Herz war vorgeschädigt, und es handelte sich um einen schweren, noch dazu wochenlang unbehandelten Infarkt. Bei einem Kuraufenthalt schwamm er eine dreiviertel Stunde im Thermalbad, in dem er sich – Bedingung: keine körperliche Anstrengung – höchstens zehn Minuten hätte aufhalten dürfen. Danach fühlte er sich unwohl und fuhr noch in derselben Nacht nach Hause. Er ging erst zwei Wochen später zum Arzt und weigerte sich zunächst, dem Arzt zu glauben, als der ihm sagte, er habe einen Herzinfarkt erlitten. Es kam dann zu einem Reinfarkt, wie er sich in diesem Alter, unabhängig von den besonderen Ausgangsbedingungen, in der Mehrzahl der Fälle ereignet. Ich werde Simon vom Telefon neben dem Krankenbett anrufen. Er wird in Tränen ausbrechen. Simon wird Heini anrufen. Heini wird nur »so« sagen. Dann werden sich die Schwestern die Gummihandschuhe überstreifen, meinem Vater den Schlafanzug ausziehen und ihn nackt, nur mit einem weißen Laken bedeckt, auf einem schmalen Metallwagen durch das Krankenhaus in den Kühlsaal fahren. Ich werde ihn bis zum Kühlsaal begleiten. Ich werde ihn nicht mehr berühren. Aber ich werde den Wagen, auf dem er liegt, nicht loslassen.
KORRIDOR
Die Gesellschafter der
Voigtländer OHG,
(unleserlich),
beschließen:
§1
Die Gesellschaft wird durch den Tod eines Gesellschafters nicht aufgelöst.
§2
Im Todesfall tritt an die Stelle
des Gesellschafters Georg Voigtländer sein Sohn
Georg Voigtländer
und an die Stelle
des Gesellschafters Heinrich Voigtländer sein Sohn
Friedrich Voigtländer
in die Gesellschaft ein.
(unleserlich), den 20. Dezember 1973
Georg Voigtländer
Heinrich Voigtländer
MASKENSPIEL DER GENIEN
Annette wollte mich unbedingt noch vor K.s Einladung sehen. Wir trafen uns am frühen Abend im Café Roma. Es war kein Tisch frei, wir mußten uns ans Buffett angelehnt unterhalten. Während hinter uns Bestecke und Gläser klapperten, während wir ständig unterbrochen wurden, weil sich immer wieder Kellner zwischen uns drängten, um Getränke abzuholen, und während wir Platz machen mußten, damit Gäste Kinderwagen vorbeischieben konnten, eröffnete mir Annette, daß sie sich von mir trennen wollte.
Sie hatte geträumt, sie wird in ein Krankenhaus eingewiesen. Dort sagt ihr der aufnehmende Arzt: Sie haben Schuld auf sich geladen, wir müssen Sie deshalb töten. Sie fragt nicht nach der Art der Schuld. Der Arzt erklärt ihr, sie verwenden Särge, die kürzer, dafür jedoch höher sind als die üblichen, so daß sich jeweils zwei Patienten, mit einander zugewandten Gesichtern aufeinander liegend, die Oberschenkel nach hinten abgewinkelt, einen Sarg teilen, der geschlossen und eingegraben wird. Ein zweiter Arzt bringt eine andere Vorgehensweise ins Spiel. Er will ihr erst ein Mittel spritzen, das entsetzliche Herzschmerzen verursacht, und ihr dann ein Messer ins Herz stoßen. Der zweite Arzt verläßt die Aufnahme, um kurz in der Literatur nachzulesen. Danach nimmt er seinen Vorschlag zurück. Ein dritter Arzt kommt hinzu. Es gebe eine Behörde, die die verfügte Tötung zurücknehmen kann. Sie soll die Behörde gemeinsam mit ihm aufsuchen. Er muß dort Sperma hinterlegen, sie Eizellen. Sie sprach im Traum kein Wort, wachte jedoch schreiend auf. Der erste Arzt sah aus wie K., der zweite wie ich.
Unsere gemeinsamen Aussichten sind ihr zu spärlich. Ein paar Mittwochabende, ein paar Sonntagnachmittage, niemals gemeinsame Ferien, nicht einmal ein gemeinsames vollständiges Wochenende. Sie wollte sich eigentlich schon nach den Weihnachtsferien von mir trennen. Ich wußte doch, daß sie tagsüber immer in der Fakultät zu erreichen war und daß K. am Neujahrstag nach Florida flog. Aber ich vermied es sorgsam, mich während der zwei Wochen meiner Abwesenheit auch nur einmal bei ihr zu melden. Um mich am Tag meiner Rückkehr spätabends mit ihr zu verabreden und anschließend auch noch mit ihr schlafen zu wollen. Obwohl sie mich ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, daß sie am nächsten Tag die Frühmaschine nach Frankfurt nehmen mußte, weil sie dort beim Sachverständigenrat zu tun hatte. Sie sei nicht bereit, diese Zumutungen länger hinzunehmen. In der Zwischenzeit war ein Tisch freigeworden, wir konnten uns endlich hinsetzen. Annette wollte nichts essen. Ob ich in den Weihnachtsferien Ski fuhr oder ob ich nicht Ski fuhr, ob ich abends ausging, oder ob ich nicht ausging, das spielt keine Rolle. Sie glaubte mir sogar, daß ich im Urlaub fast nur las und schrieb. Ich sei ein so genauer Leser. Wenn ich sie, Annette, so lesen würde, wie ich Bücher lese, dann würde sie sich nicht von mir trennen wollen. K. bezieht sie wenigstens in sein Leben ein. Er läßt sie an seinem Leben teilhaben. Ich dagegen schließe sie von meinem Leben völlig aus. Ich sei kalt und sprachlos.
Ich wollte etwas sagen, aber Annette ließ mich nicht zu Wort kommen. Man kann auch zu zweit Bücher lesen. Jeder kann sich ein Buch nehmen. Man muß nicht ein und dasselbe Buch lesen. Wenn einer ein Buch schreibt und wenn er es nicht vorzeigen will, bevor er es zu Ende geschrieben hat, dann kann er doch mit dem anderen darüber reden. Sie sei nicht bereit, alles das länger zu ertragen. Ich versuchte nicht, sie umzustimmen.
Nachdem Annette gesagt hatte, was sie hatte sagen wollen, war sie gelassener. Sie fragte mich nach der Bilanz. Ich sagte, die Firma schreibt eine schwarze Null. Wie der Plan für dieses Jahr aussieht. Ich sagte, er sieht ein positives Ergebnis vor. Ob das genügt, um die notwendigen Investitionen in neue Erzeugnisse zu finanzieren. Ich nahm meine Brille ab und sagte, auf lange Sicht nicht. Aber wenn das Ergebnis zu positiv ist, wird die Firma nicht umgewandelt. Sie sagte, wenn das Ergebnis nicht positiv genug ist, braucht die Firma nicht umgewandelt zu werden. Wie die Verhandlungen vorankommen. Ich sagte, wir stehen kurz vor dem Abschluß. Sie zündete sich eine Zigarette an und blies mir den Rauch ins Gesicht. Ich hätte wohl nicht damit gerechnet, daß sie sich von mir trennen will. Sie habe auch Zweifel, ob ich die Lage der Firma und meine Stellung in der Firma richtig beurteilte. Vielleicht lese und schreibe ich nur, um nicht zu sprechen. Was muß geschehen, damit ich spreche? Daß sie sich von mir trennt, reicht nicht. Sie sei sicher, eines Tages werde ich sprechen. Aber nicht mehr zu ihr.
Da Annette nicht von mir nach Hause gebracht werden wollte, verabschiedeten wir uns auf der Straße. Ich ging zielstrebig zu meinem in der Nähe geparkten Wagen. Wäre Annette mir gefolgt, sie wäre überrascht gewesen zu sehen, daß ich weinte.
Ich fuhr zum Café Stadtmuseum, ich wollte noch etwas trinken. Dort kam ich mit einer neuen Bedienung ins Gespräch. Die neue Bedienung hatte Kommunikationswissenschaften studiert, sie entwarf und strickte Pullover für einen Wolladen und für Bekannte. Es war nicht viel los, ich unterhielt mich mit ihr, als ob ich Annette widerlegen wollte, angeregt bis zur Sperrstunde. Sie hieß Barbara, ich brachte sie nach Hause, und sie lud mich auf ein Glas Rotwein zu sich ein.
Sie wohnte in einem Einzimmer-Appartement im sechsten Stock eines Fünfziger-Jahre-Hauses, die Aussicht auf den Innenhof wie bei Hitchcock. Viele Bücher, alle auf dem Boden, die Einrichtung bestand aus einer Matratze, einem rostigen Freischwinger, einem Liegestuhl und einem riesengroßen alten Schwarzweißfernseher. Sie hatte blonde Haare, der Schnitt war asymmetrisch, auf der einen Seite so kurz, daß die Haut durchschien, auf der anderen lange gewellte Strähnen, die seitlich wegstanden. Sie trug eine weiße Kunststoffbrille mit sehr starken Gläsern. Sie war schlank, außer den selbstentworfenen Pullovern zog sie grundsätzlich nur Second-hand-Kleidung an. Sie lachte viel.
Wir tranken einen schweren Bordeaux und hörten Platten der Knef. Es stellte sich heraus, daß sie Annette kannte, da Annette ihre einschlägigen Bedarfe in dem Wolladen deckte, für den sie arbeitete. Ich erzählte ihr, in welcher Beziehung ich zu Annette stand. Ich erzählte ihr nicht, daß sich Annette gerade von mir getrennt hatte.
Bevor wir miteinander ins Bett gingen, fragte sie mich, ob ich nicht ein schlechtes Gewissen gegenüber Annette hätte. Nach üblichem Beginn war auf einmal nichts mehr mit mir anzufangen. Eine ruhelose Nacht folgte. Mit dem heraufziehenden Tag, Barbara lehnte Jalousien und Vorhänge ab, wurde mir dann schlecht.
Am Morgen gingen wir im Englischen Garten spazieren. Es war kalt, aber sonnig. Sie kokettierte mit Außenseitergefühlen wegen ihrer Herkunft aus der Arbeiterklasse. Ihr Vater war, so ihr Ausdruck, Lackierer beim Siemens. Ich hörte mir erstaunt zu, wie ich von meinem falschen Berufsleben sprach. Sie mußte um zehn Uhr bei ihrem Freund sein, ich setzte sie rechtzeitig in der Nähe ab.
Am Abend waren K. und Annette die fast vollkommenen Gastgeber für einen Kollegen von K., für einen Vorstandsassistenten von BMW, der von der Firm angeworben werden sollte, und für mich.
Annette hatte ein dunkelblaues Kostüm an, ein kurzer Rock und eine kurze Jacke, dazu dunkelblaue Strümpfe und College shoes. Sie trug ihre Haare in einem kurzen Pagenschnitt und in einem helleren Braunton als gewöhnlich. Die rot-weiß gestreifte Seidenbluse war bis zum obersten Knopf geschlossen. Die breiten Revers des Kostüms über der schmalen Taille betonten ihre Brüste. Auch wenn der Vorstandsassistent dauernd hinsah, es machte sie nicht größer. Sie lief eine Spur zu geschäftig zwischen Küche und Eßzimmer hin und her.
Gleich wie man das Dutzend der einflußreichsten Männer des Lands definiert, die Vorstandssprecher der Deutschen Bank, von Daimler und von Siemens, der Vorstandsvorsitzende der Bundesbank, der Präsident des Sachverständigenrats und der Bundeskanzler sind bestimmt dabei, über den Rest kann man streiten, wenn Herman ze German seiner Sekretärin sagt, er möchte einen davon am Telefon, dann bekommt er ihn. Es gibt niemanden, der Macht hat in diesem Land, zu dem der Chef der Firm, K.s Chef, keinen Zugang hat.
Die einzige Lichtquelle im Raum war die tiefhängende Chromlampe über dem Eßtisch aus brasilianischem Granit. Sie tauchte alles, was auf dem Tisch war, in gleißendes Licht und ließ die Gäste darum herum im Halbdunkel. K. sprach zu mir, aber seine Worte waren natürlich für den Vorstandsassistenten bestimmt.
Die Firm berät jeden und seine Wettbewerber. Und den Bund, die Länder, die Gemeinden, Wohlfahrtsverbände, Museen, Orchester. Alle, bis auf die RAF. Die Firm bestimmt, mit welcher Strategie und mit welcher Organisationsstruktur man sich unter die Leute trauen kann und mit welcher nicht. Früher gab es auch andere Modemacher. Beziehungsweise es gibt sie heute noch. Aber die anderen haben den Anschluß verpaßt. Die anderen nehmen nur die Ziele ihrer Klienten ernst, die ihren eigenen Vorstellungen von deren Zielen entsprechen, und sie empfehlen nur solche Mittel, die sie anwenden würden, wenn sie selbst die Ziele verfolgten, die zu verfolgen sie ihren Klienten erlauben. Die Firm nimmt den Klienten nicht nach irgendeinem Maßstab ernst. Sie fummeln nicht an seinen Zielen herum. Sie betrachten das Ziel als fundamentales, an dessen Erreichung dem Klienten tatsächlich am meisten gelegen ist. Immer vorausgesetzt, es handelt sich nicht um ein Ziel, das gegen bestimmte ethische Nebenbedingungen verstößt, sie machen keine Wettbewerbsausspähungen. Es ist ihnen auch gar nicht möglich, noch etwas auszuspähen, sie wissen sowieso alles. Weil sie alle beraten. Sie erarbeiten für den Klienten Anweisungen, bei deren Befolgung er sein Ziel erreicht, indem sie alle Widerspiegelungen ihrer früheren Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Zielen und Mitteln einfließen lassen, aber nichts, gar nichts, was darüber hinausgeht. Wie etwa sich selbst. Sie verfolgen keine Interessen. Deswegen und nur deswegen sind ihre Erkenntnisse so mächtig. Ich erwiderte, nicht ihre Erkenntnisse, sie sind mächtig. Er gab an, sie hätten ihre ethische Zielsetzung nicht, weil sie mächtig sein wollten, sie seien deshalb mächtig, weil sie ihre ethische Zielsetzung hätten. Wie soll man es anfangen, diese Behauptung zu überprüfen. K. fragte zurück, was stellen sie denn mit ihrer Macht an. Ich antwortete, sie vermehren sie ständig. K. sagte, sie könnten sie ja auch mißbrauchen. Dann würden sie sie einbüßen. Sie mißbrauchen sie nicht, um sie nicht einzubüßen. K. sagte, sie sind so gebaut, daß sie sie gar nicht mißbrauchen können. Ich fragte, ob die Wettbewerber der Firm etwa ethische Zielvorstellungen haben. Ein Teil hat ethische Vorstellungen, ein anderer Teil hat nur die Vorstellung, durch Beratung Geld zu machen. Da die ethischen Vorstellungen der Wettbewerber der Firm die falschen sind, kommt beides aufs gleiche heraus. Die Firm berät nicht, um Geld zu machen. Sie machen zwar ziemlich viel Geld, da sie jedoch keine Zeit haben, darüber nachzudenken, wie sie es vernünftig ausgeben, verwenden sie es für die falschen Dinge und bezahlen die richtigen zu teuer. Geld hat für sie keine Bedeutung. Sie haben nicht nur die überlegene, sie haben die einzig vertretbare ethische Zielvorstellung: Dedication to clients.
Ich hatte, während K. sprach, abwechselnd K. und Annette angesehen. Als Annette die Vorspeisenteller abdeckte und den Hauptgang auftrug, blendeten mich die Platzteller aus Sterling-Silber so sehr, daß ich die Augen schließen mußte.
Ich sagte zu K., wenn sie ihre Klienten auf Maxi, Mini oder Midi festlegen, bringen sie zumindest ihren Geschmack ein. K. sagte, dann würden sie grundsätzlich nur Mini empfehlen. Herman ze German führe immer gern aus, daß man als Berater oft monatelang irgendwo vor Ort sitzen und jeden Tag und jeden Abend mit anderen Beratern auf engstem Raum zusammenleben muß. Da bedarf es starker Reize, um in ein anderes Lebensfeld einzuschwenken. Ich fragte, gibt es denn keine Beraterinnen. Beraterinnen tragen in der Regel fleischfarbene Strümpfe und ebensolche Unterwäsche. Ich sagte, alles andere wäre mit der ethischen Zielsetzung der Firm nicht vereinbar. Die Klienten verlangen, daß sich die Rocklänge ständig ändert. Jeder will der erste sein, der die neuen Röcke trägt. Wenn die Röcke niemals kürzer oder länger würden, welcher Lebensinhalt bliebe den Klienten. Sie empfehlen keine beliebige Rocklänge, sondern immer eine, die nach derjenigen der vergangenen Saison, nach der Figur der Klienten und nach deren Zielen die vernünftigste ist. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daß sich die Ziele der Klienten in überraschendem Ausmaß gleichen. Alle wollen jung, schön, klug, reich und berühmt werden. Da meldete sich zum ersten Mal der Vorstandsassistent zu Wort. Wenn er seine Zeitungen aufschlägt und die Unternehmensnachrichten durchgeht, findet er zwar alle Klienten der Firm, aber nur wenige können gerechtfertigt von sich behaupten, jung, schön, klug, reich und berühmt zu sein. K. erläuterte, die verbindliche Definition der Beratungsaufgabe beinhaltet niemals, den Klienten jung, schön, klug, reich und berühmt zu machen. Die Firm muß verhindern, daß der Klient alt, häßlich, dumm, arm und vergessen wird. Mehr wäre Klassenkampf, und Klassenkampf ist völlig out. Sie beraten auch Gewerkschaftsunternehmen. Wenn sich eine Organisation tatsächlich einmal Ziele setzt, die den Rahmen zu sprengen drohen, dann würden sie das Ihre tun, damit der Rahmen nichts abbekommt. Die Gefahr ist jedoch gering. Verfolgt eine Organisation Ziele, die mit den Zielen anderer Organisationen völlig unvereinbar sind, riskiert sie ihren Bestand. Eine Organisation besteht aus vielen, die von wenigen geführt werden. Zu jeder Organisation gibt es eine andere, mit ihr im Wettbewerb um Mitglieder stehende, an deren Ergebnis die Führung der ersten Organisation gemessen wird. Keine Organisation kann ihre Mitglieder keilen wie der Preußenkönig seine Rekruten. Ich wandte ein, wenn man in den Genuß wirkungsvoller Beratung kommen will, kann man zwar ruhig alt, häßlich, dumm, arm und unbekannt sein, aber eins darf man nicht sein: klein. K. erwiderte, die Kleinen schließen sich eben zu einem Verband zusammen. Diejenigen, deren Grundausstattung nicht einmal das ermöglicht – Alte, Kinder, Frauen, Nutten und Strichjungen –, finden in der Regel andere, die Sinn in ihr ödes Leben holen, indem sie gemeinsam für die ersteren sprechen. Die beraten sie dann. Wobei sie gern auf ein Honorar verzichten. Sie bekommen dafür Einladungen zu privaten Festen, auf denen sie wirklich geile Frauen kennenlernen (Annette war für einen Augenblick hinausgegangen). Eben alles reinster Luhmann. Ich sagte, auch der Preußenkönig ist Luhmann gewesen, und fragte, an wen sie sich halten, wenn sie eine Organisation beraten. Sie halten sich an denjenigen, der sie engagiert. Was machen sie, wenn zwei Leute sie zwar gemeinsam engagieren, aber von ihnen völlig Unterschiedliches erwarten. Zu den ethischen Nebenbedingungen, denen sie ihr Handeln unterwerfen, gehört auch, daß sie niemals eine Organisation im Sinn der ausschließlichen Verfolgung der Ziele eines einzelnen beraten. Sie verfolgen nur dann die Ziele eines einzelnen, wenn das die beste Vorgehensweise darstellt, um die Ziele der Organisation zu fördern. Sie würden niemals die Ziele eines einzelnen verfolgen, wenn das die Erreichung der Ziele der Organisation verhindert. Er hatte meine Frage nicht beantwortet. Wie sie sich orientieren, wenn ihnen zwei, die sie gemeinsam beauftragen, gegenläufige Ziele vorgeben. Dann fragen sie einen Dritten, was er von den gegenläufigen Zielen der beiden ersten hält. Wenn es sein muß, auch noch einen vierten und einen fünften. Einstweilen verpflichten sie sich zu gar nichts. Denn sie nehmen nur klar definierte Aufträge an. Wenn über Ziel und Inhalt der Beratung keine Einigung zustandekommt, verzichten sie dankend. Was übrigens häufiger vorkomme, als der Zeitungsleser denke. Es möge enden, wie es wolle, aber sie fummeln nicht an den Zielen der von ihnen beratenen Organisationen. Die Klienten stehen sowieso Schlange. Ich fragte K., was sie tun, damit die von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen auch in die Tat umgesetzt werden. K. antwortete mir darauf lachend: Wer gegen uns ist, stirbt.
Der Kollege von K. übernahm dessen Part und sprach zu dem Vorstandsassistenten. Obwohl sie weit mehr Bewerber haben, als sie nehmen können, ist das Wachstum der Firm durch die Verfügbarkeit brauchbarer Mitarbeiter begrenzt. Denn sie stellen sehr hohe Anforderungen an die jungen Consultants. Voraussetzung für die Einladung zu einem Erstinterview ist ein ausgezeichneter Hochschulabschluß. Die Fachrichtung des Abschlusses spielt keine Rolle, entscheidend ist nicht vorhandenes Wissen, sondern die Fähigkeit, sich in kürzester Zeit neues Wissen anzueignen und dieses zielführend anzuwenden. Dazu muß der Berater bereit sein, das Privatleben absolut hintanzustellen. Auf meine Zwischenfrage, ob das Vorliegen dieser Eigenschaften bei Bewerbern zuverlässig herauszufinden ist, antwortete K.s Kollege, die Eigenschaften sind testbar. Sie haben Fallbeispiele entwickelt, die sie mit den in die engere Wahl genommenen Bewerbern durchgehen. Dabei bekommt man ein Gefühl dafür, ob der Bewerber kreative Problemlösungen packt, und man kann schnell sagen, ob man mit dem Kandidaten gern in einem Team zusammenarbeiten würde oder nicht. Die Chemistry muß stimmen, sonst geht gar nichts. Was die Firm von anderen Consultinggesellschaften unterscheidet, ist das gemeinsame Selbstverständnis. Die Shared values. Dazu gehört auch, daß sie Spaß an dem Ganzen haben. Wenn sie keinen Spaß hätten, würden sie ihren schwierigen Job nicht machen.
Der Vorstandsassistent machte Anstalten zu gehen, aber K. überredete ihn noch zu einem Digestif, der auf dem Balkon eingenommen wurde. Die trockene Kälte unter dem Sternenhimmel tat uns allen gut. Keiner redete. Annette zündete sich, unter einem mißbilligenden Blick von K., eine Zigarette an. Sie hatte das Rauchen schon völlig aufgegeben. Wahrscheinlich rauchte sie auch während des Essens heimlich in der Küche. Als sich der Vorstandsassistent endgültig verabschiedete, bemerkte K., der von seinem Kollegen beschriebenen Aufnahmeprozedur müßten sich natürlich nur Berufsanfänger unterziehen. Der Kollege begleitete den Vorstandsassistenten. K. forderte mich auf, noch zu bleiben, worauf sich Annette sichtbar ungehalten zurückzog.
Ich sagte K., daß es mir schwerfiel, ihn als säkularisierten Priester in Anbetung eines gottlosen Gemeinwohls anzusehen. Als wir zusammen im Gymnasium waren, äußerte er einmal auf unserem gemeinsamen Weg von der Straßenbahnhaltestelle nach Hause, der einzige Sinn, den er für sein Leben sehe, sei das Ziel, möglichst viel Geld zu machen. Man könne gegen alles etwas sagen, das einzig Unangreifbare sei Geld. Ich hatte darauf geschwiegen. Ich hatte damals Caroline zu lange ergebnislos geliebt, und mir war klar, es würde sich weder etwas an ihren noch an meinen Gefühlen ändern. Ich war kein selbstmordtrunkener Jüngling, aber ich ging fest davon aus, daß der Mensch nicht auf der Erde ist, um glücklich zu sein. Ich erwog ernsthaft, mir seinen Vorsatz zu eigen zu machen. Es erschien mir so durchsichtig, mich umzubringen oder Bomben zu werfen und Leute zu erschießen. Jeder würde wissen, warum ich mich umbringe, jeder würde wissen, daß ich nur aus einem Grund Bomben werfe und Leute erschieße. Dagegen: Aus Rache ist er wirklich reich geworden –. K. fragte, was mir denn Caroline angetan hatte. Ob ich nie in den Spiegel geschaut hätte. Das muß ausgerechnet er, K., sagen, der noch genauso aussieht wie auf den Klassenbildern der gymnasialen Oberstufe. Wenn er noch dasselbe Gesicht wie als Obertertianer hat, bewertet er das als Erfolg. Als Obertertianer rechnete er nicht damit, daß er mit fünfunddreißig noch fast alle Haare auf dem Kopf haben werde und ich mich nicht mehr kämmen müsse. Sein Vater mußte immer nur für Minuten zum Friseur. Er, K., wäre damals nicht auf den Gedanken gekommen, sich über seinen fehlenden Erfolg bei Frauen zu beklagen. Er betrachtete sich im Spiegel. Dann setzte er sich hin und las ein Buch. Auf diese Weise las er viele Bücher, so lange, bis er eine Frau fand, die er mit den Büchern, die er gelesen hatte, beeindrucken konnte. Ich erwiderte, das Spiegelbild ist nicht zu ändern. Wenn es ihm gelungen sei, die Frau zu ändern, gratulierte ich ihm dazu. Ich dachte dabei an die Erwartungen, mit denen ich Caroline am Abend ihres siebzehnten Geburtstags aufsuchte, um ihr den Tod des Vergil zu überreichen, und daran, wie sie in dem Buch nicht einmal blätterte, sondern mich beschwor, zu ihrer Geburtstagsparty am Wochenende eine Krawatte anzuziehen. K. sagte, er weiß mittlerweile, wie man Geld macht. Er weiß insbesondere, wie er wesentlich mehr Geld machen könnte als durch seine Beratertätigkeit. Aber er will das Geld nicht mehr. Er hat an seiner jetzigen Tätigkeit so viel Spaß, daß er sie auch für sehr viel Geld nicht gegen eine andere eintauschen würde. Er kann sich keine andere Tätigkeit vorstellen, die abwechslungsreicher und vielseitiger wäre als seine Beratertätigkeit. Er ist jedoch sicher, er hätte keinen Spaß daran, wenn sie nicht einer ethischen Zielsetzung unterworfen wäre. Ich entgegnete, auch wenn er seine Macht nicht mißbraucht, oder sogar, wenn er sie überhaupt nicht gebraucht, wie kann er auseinanderhalten, ob es das Innehaben der Macht oder die Verfolgung der ethischen Zielsetzung ist, was ihm seine Tätigkeit so befriedigend macht, wo die Verfolgung der ethischen Zielsetzung notwendige und hinreichende Bedingung für das Innehaben der Macht ist. Kann er selbst überhaupt wissen, ob er die ethische Zielsetzung der Firm nur verfolgt, um in den Genuß des Gefühls zu kommen, die Macht auszuüben. K. fragte mich, warum ich um beinahe jeden Preis darauf aus sei, die Macht und die ethische Zielsetzung voneinander zu sondern, obwohl aus dem, was ich sage, folgt, dies ist nur möglich, wenn die ethische Zielsetzung aufgegeben wird. Was gewinne ich, wenn die ethische Zielsetzung aufgegeben wird. Was gewinne ich, wenn ich ihm nachweise, daß er an der Macht hängt, obwohl er es bis jetzt nicht einmal weiß. Ich fragte K., was verliert er, wenn dem so ist, und wenn er es nun weiß. Er muß darüber nachdenken. Falls er feststellen sollte, er verliert etwas, wird das Folgen für seine Tätigkeit haben. Er würde sich dann gezwungen sehen, bei jeder Beratung noch gründlicher als bisher zu hinterfragen, ob seine Vorschläge nicht doch in irgendeiner, wenn auch zunächst nur schwer erkennbaren Auswirkung der ethischen Zielsetzung der Firm zuwiderlaufen. Ich sagte, es ist wunderschön, in welchem Einklang er mit sich selbst steht. In dem Maß, in dem offenbleibt, ob er nicht doch ein paar tief verborgene eigensüchtige Ziele verfolgt, kann er gerechtfertigt behaupten, dieser Rest von Eigennutz fördert die ethische Zielsetzung der Firm sogar noch. Er gebe zu, sein Leben sehe insgesamt nicht danach aus, als ob er mit sich selbst im reinen sei. Was jedoch seine Tätigkeit für die Firm angehe, auf die er immerhin den größten Teil seiner Zeit verwende, so sei er es.
Einmal im Monat holte mich mein Vater von der Schule ab. Wir nahmen dann immer K. mit, der eine Straße weiter wohnte. K. erinnert sich noch an das cremefarbene Coupé (220 S) mit dem grauen Dach und den roten Ledersitzen. Immer wenn ich ihm sagte, daß mich mein Vater abholen würde, leuchteten meine Augen vor Freude. So K. letzthin anläßlich des Todestags meines Vaters.
SICHT
Dr. Andreas Krapp
Steuerberater
Herrn
Dipl.-Ing. Georg Voigtländer
19.12.1985
Betr.: Umwandlung der Voigtländer OHG in eine GmbH & Co KG
Sehr geehrter Herr Voigtländer!
Ihr Sohn bat mich, Ihnen die Beweggründe, die mich bereits im Jahr 1979 – ich verweise auf mein Schreiben vom 24.4.1979 – veranlaßt hatten, Ihnen und Ihrem Bruder dringend zu einer Änderung der Rechtsform Ihres Unternehmens zu raten, sowie die Überlegungen, die zu den nunmehr unterschriftsreifen Vertragsentwürfen geführt haben, zusammenfassend darzulegen.
Sie betreiben Ihr Unternehmen derzeit in der Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft. Dies bedeutet, Sie und Ihr Bruder haften für sämtliche erkennbaren und nicht erkennbaren Verbindlichkeiten und Risiken mit Ihrem gesamten – also auch mit Ihrem privaten – Vermögen. Diese Rechtsform ist nicht mehr zeitgemäß. Aus dem sozialen Bereich sind mit Kündigungsschutzbestimmungen, Abfindungsansprüchen bei Kündigungen und Sozialplänen bei Teilstilllegungen unabwägbare Forderungen auf mittelständische Unternehmen zugekommen.
Ich habe in den bisherigen Verhandlungen, in denen Sie durch Ihren Sohn vertreten waren, geraten, die Voigtländer OHG in eine GmbH & Co KG umzuwandeln.
Wir haben bereits im Jahr 1984 eine Voigtländer GmbH gegründet und in das Handelsregister eintragen lassen. Diese GmbH soll mit Wirkung vom 1.7. dieses Jahres in die bestehende OHG als persönlich haftende Gesellschafterin eintreten; zugleich wird Ihre und Ihres Bruders Rechtsstellung von derjenigen eines unbeschränkt haftenden Komplementärs in diejenige eines nur mit seinem Kapitalanteil haftenden Kommanditisten umgewandelt.
Für alle Verbindlichkeiten, die von dem Tag der Eintragung der Voigtländer GmbH & Co KG an entstehen, haften Sie nur noch mit Ihrer Einlage. Da diese erbracht ist, kann ein Zugriff auf Ihr weiteres Vermögen nicht mehr erfolgen. Für alle Verbindlichkeiten der Voigtländer OHG, die am Tag der Gründung der Voigtländer GmbH & Co KG bestehen, haften Sie und Ihr Bruder persönlich fünf Jahre weiter. Diese Nachfolgehaftung eines OHG-Gesellschafters ist gesetzlich geregelt und nicht abdingbar.
In den genannten Verhandlungen wurden für die bereits im Handelsregister eingetragene GmbH und die KG als Rechtsnachfolgerin der OHG Gesellschaftsverträge, Miet- und Darlehensverträge sowie Geschäftsführerdienstverträge erarbeitet.
Die wesentlichsten Regelungen sind folgende:
Gesellschafter der GmbH und der KG sind Sie und Ihr Bruder zu je 50%.
Nachfolgeberechtigt für den Anteil Ihres Bruders ist ein und nur ein leiblicher Abkömmling Ihres Bruders; nachfolgeberechtigt für Ihren Anteil ist ein und nur ein Abkömmling Ihres Vaters, des am 27.6.1937 verstorbenen Georg Voigtländer. Auch in der weiteren Folge können Ihr Anteil und der Anteil Ihres Bruders nur auf jeweils ein Mitglied des entsprechenden Familienstamms übertragen werden. Mit dieser Regelung soll eine zu Lasten des Unternehmens gehende Zersplitterung der Familieninteressen vermieden werden. Ihr Bruder beabsichtigt, seinen Anteil seinem Sohn, Herrn Friedrich Voigtländer, zu vererben; damit wird nach der obigen Regelung ausgeschlossen, daß die Töchter Ihres Bruders Unternehmensanteile erhalten. Die Erweiterung Ihres Familienstamms auf alle Abkömmlinge Ihres Vaters berücksichtigt die Möglichkeit, daß Ihr Sohn vor Ihnen versterben sollte.
Wenn ein Gesellschafter seinen Anteil veräußern will, muß er ihn zuerst den Mitgliedern seines Familienstamms anbieten. Falls sich unter diesen kein Kaufwilliger findet, muß er seinen Anteil den Mitgliedern des anderen Familienstamms anbieten. Erst wenn sich auch unter diesen kein Kaufwilliger findet, ist er in der Verfügung über seinen Anteil frei.
Zur Geschäftsführung und Vertretung der KG als Rechtsnachfolgerin der OHG ist künftig deren vollhaftende Gesellschafterin, die GmbH, berechtigt und verpflichtet.
Die Geschäftsführungsbefugnisse werden innerhalb des Gesellschaftsvertrags für die GmbH geregelt. Dort wird auch ein Katalog zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte formuliert: Die Geschäftsführer müssen z.B. für den Erwerb, für die Veräußerung und für die Belastung von Grundstücken, für Investitionsmaßnahmen ab einer bestimmten Größenordnung, für die Aufnahme von Darlehen ab einer bestimmten Größenordnung sowie zu weiteren nicht alltäglichen Geschäften die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der GmbH einholen.
Da die Gesellschafterversammlung lediglich zwei Personen umfaßt, die jeweils 50% der Stimmen halten, besteht die Gefahr von Pattsituationen. Aus diesem Grund soll die GmbH einen Beirat erhalten, der aus drei Mitgliedern besteht. Der Beirat überwacht und berät die Geschäftsführung. Des weiteren ist er oberstes Beschlußorgan, wenn in der Gesellschafterversammlung Beschlußvorlagen zu Angelegenheiten, über die mit einfacher Mehrheit abzustimmen ist, wegen Stimmengleichheit abgelehnt werden.
Die Mitglieder des Beirats werden mit einfacher Mehrheit gewählt. Ein gewähltes Mitglied des Beirats kann von der Gesellschafterversammlung nur einstimmig abberufen werden. Damit soll erreicht werden, daß das Unternehmen auch dann bewegungsfähig bleibt, wenn sich die Gesellschafter über bestimmte Angelegenheiten nicht einigen können.
Beide Familienstämme haben ein Sonderrecht zur Ernennung je eines Geschäftsführers. Über dieses Sonderrecht werden Ihr Sohn und Ihr Neffe als Geschäftsführer bestellt. Die Geschäftsführer werden jeweils allein vertretungsberechtigt sein. Sie sind jedoch, wie dargelegt, bei außergewöhnlichen Rechtsgeschäften im Innenverhältnis an die Zustimmung der Gesellschafterversammlung bzw. des Beirats gebunden.
Ich erlaube mir den Hinweis, daß Ihre und Ihres Sohnes Interessen als Gesellschafter und als Geschäftsführer in den vorliegenden Vertragsentwürfen, soweit dies im Rahmen einer 50%igen Beteiligung möglich ist, vollständig gewahrt sind und daß für Sie und Ihren Sohn gegenüber der derzeitigen Situation keine Verschlechterung eintritt.
Ich bin selbstverständlich gern bereit, alle Entwürfe mit Ihnen persönlich zu besprechen und erbitte hierzu gegebenenfalls Ihren Terminvorschlag.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Krapp
FLÜGEL
Ich stelle mir vor:
Ich wurde als fünftes von sechs Kindern des gegenwärtigen Pächters auf dem sich seit Jahrhunderten im Besitz der Muraus befindenden, in St. Pankraz zwischen Kirchdorf und Windischgarsten gelegenen sogenannten Reitbauerngütl geboren. Jetzt wohnen nur noch mein Vater, meine Mutter, meine jüngste Schwester und ihr Kind dort. Mein Vater, der auf die Sechzig zugeht, hat sich von seinen Ersparnissen ein kleines Haus in Spital am Pyhrn gekauft, das er zusammen mit meinem Bruder herrichtet. Meine älteste Schwester arbeitet als Bedienung am Wolfgangsee, sie hat zwei Kinder, sie ist jedoch ledig geblieben. Die zweitälteste Schwester ist die hübscheste. Sie lebt mit einem Krankenpfleger aus Deutschland, den sie in Hinterstoder kennenlernte, als sie dort ebenfalls als Bedienung arbeitete, in Köln. Sie ist verheiratet, doch sie bekommt keine Kinder. Der Mann der drittältesten ist Werkzeugmacher in einer Fabrik in Windischgarsten, die Brillengestelle herstellt. Sie hat zwei Kinder. Mein Bruder hat drei Kinder und ein Haus in Micheldorf. Mein Vater ist im Hauptberuf Sprengmeister. Seine Firma besteht aus ihm, meinem Bruder, dessen für die Buchhaltung zuständiger Frau, einem Ford-Transporter sowie einem völlig unnützerweise angemieteten kleinen Ladenlokal an der Hauptstraße von Windischgarsten. Im Schaufenster liegen ein paar vergilbte Farbfotos von Straßentrassen und von halbfertigen Tunnelbauten unter einem großen, ebenfalls vergilbten Schild mit der Aufschrift Sprengunternehmen. Das Reitbauerngut hat etwa einhundertzehn Hektar, davon werden zwanzig Hektar landwirtschaftlich, die Hauptfläche wird jagdlich genutzt. St. Pankraz liegt zwischen dem Toten Gebirge und dem Sengsengebirge. Das Tal ist eng, und es wird noch durch die fast zwanzig Meter tiefe Schlucht des Teichlflusses geteilt. Um von der Bundesstraße und dem Ortskern von St. Pankraz auf der anderen Seite zum Reitbauerngut herüberzugelangen, muß man einen in den Konglomeratfelsen geschlagenen, sehr abschüssigen Weg nehmen. Die uralte Holzbrücke über die Teichl ist erst vor wenigen Jahren durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt worden. Die Landwirtschaft des Reitbauernguts besteht aus etwa zwei Dutzend Milchkühen, den entsprechenden Weiden und Futterwiesen, aus Kartoffelfeldern sowie einem großen Gemüsegarten neben dem Stall. Meine Mutter führt die Milchwirtschaft allein. Mein Vater kommt nur im Winter, wenn der Straßenbau jahreszeitlich bedingt eingestellt ist, für längere Zeit, im Sommer nur tageweise nach Hause. Die Feldarbeit erledigt mein Bruder. Mein Vater hat die Berufsjägerprüfung abgelegt. Im Winter füttert er, während der Jagdsaison führt er die Jagdgäste durch das Revier. Dem Einfluß der Besitzer gemäß weist der Abschußplan für das an sich kleine Revier immer zwei Hirsche und zwei Gamsböcke auf. Obwohl Sprengmeister, ist mein Vater im höchsten Maß naturliebend. Ich weiß nicht, was er in dem kleinen Haus in Spital am Pyhrn machen wird, wenn er es hergerichtet haben wird. Als ich ihn bei einem meiner seltenen Besuche darauf ansprach, sagte er, er wolle nicht so enden wie der Pächter Baumschlager. Der Pächter Baumschlager hatte sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Kartoffelkeller erhängt. Er hatte damit gerechnet, daß nach dem Tod des damaligen Familienoberoberhaupts der Muraus, der Herren von Wolfsegg, das Reitbauerngut an ihn fallen würde. Keiner weiß, aus welchen Quellen sich seine Wunschvorstellungen speisten. Natürlich war das Reitbauerngut nur ein winziger, unbedeutender Bestandteil der riesigen Ländereien der Muraus, es geht die Sage, ein Familienmitglied habe es beim Spiel gewonnen, doch es bestand keinerlei Veranlassung, den Außenposten einem Pächter zukommen zu lassen, wenn dieser auch mehr für den Besitz getan hatte, als seine Pflicht gewesen war. Das im achtzehnten Jahrhundert aus Flußsteinen erbaute Wohnhaus des Reitbauernguts wird zur einen Hälfte von der Herrschaft und zur anderen vom Pächter genutzt. Es sucht den Schutz des Hangs, der die landwirtschaftlichen Flächen unter dem Bergwald in zwei Stufen teilt. Der Eingang ist in der Mitte der Längsseite des Hauses, am Eckpunkt des von der Teichl herkommenden, im Winkel von neunzig Grad abbiegenden, wieder zur Teichl hinführenden Wegs. Die grün-weiß gestreifte Tür mit dem riesengroßen Türschloß aus dem achtzehnten Jahrhundert öffnet sich in eine große Diele. Zur Linken eine Stube, die der Herrschaft als Küche und als Eßzimmer dient, sie hat Zugang zur Terrasse an der Stirnseite des Hauses. Dahinter das nicht beheizbare Schlafzimmer meiner Eltern. Unmittelbar rechts neben dem Eingang die Holztreppe zum ersten Stock, davor geht es in unsere Stube, die mit der Küche verbunden ist, am Ende der Diele die Speise. Im ersten Stock wiederholt sich die große Diele. Linker Hand das herrschaftliche Wohnzimmer und das herrschaftliche Bad, rechts von der Treppe das Schlafzimmer der Herrschaft, um die Treppe herum das nicht beheizbare Kinderschlafzimmer. In dem nicht mehr als vier Betten Platz haben. Der Altersunterschied führte dazu, daß niemals mehr als fünf von uns gleichzeitig im Haus schliefen, das fünfte nächtigte auf dem Diwan neben dem Kachelofen in der Stube. Meine Mutter verwahrte die Schlüssel zu den Zimmern der Herrschaft an einem Ort, den sie vor uns geheimhielt. Die Zimmer der Herrschaft sind mit wertvollen bemalten Bauernmöbeln aus dem vorigen Jahrhundert eingerichtet. Meine Mutter erzählte, die Gnädige suchte kurz vor meiner Geburt alle Bauernhöfe der Gegend auf, auch die entlegensten, und kaufte den Bauern die schönsten alten Möbel ab. Es war die Zeit, in der die Bauern miteinander wetteiferten, die modernste Küche zu besitzen, und sie fand die prächtigsten Kästen und Truhen nicht in den Wohnhäusern der Bauern, sondern in deren Heuschobern. Neben den Bauernmöbeln hatte die Gnädige ihre Zimmer mit Heiligenbildern und Heiligenfiguren ebenfalls aus der Umgebung geschmückt. Seit ich mich erinnern kann, wurde in den Zimmern der Herrschaft niemals etwas verändert. Die Gnädige kam in unregelmäßigen Abständen, nicht häufiger als drei- oder viermal im Jahr, und sie blieb nicht länger als eine Woche. Sie begrüßte uns alle mit Handschlag, verwechselte jedoch grundsätzlich die Namen meiner Schwestern und später die Namen von deren Kindern. Zwischen der augenfälligen Ankunft und der niemals angekündigten Abreise beschränkte sich der Umgang zwischen der Gnädigen und meiner Familie auf die notwendigen Haushaltsdienste. Sie empfing niemanden. Weder der Bürgermeister noch der Pfarrer waren jemals im Reitbauerngut. Wenn sie allein war, verließ sie ihr Wohnzimmer nur zum Einnehmen der bei uns bestellten Mahlzeiten und zu kurzen Spaziergängen. Wenn sie in Begleitung des italienischen Priesters war, unternahm sie längere Wanderungen im Revier und Ausflüge nach Kremsmünster und St. Florian. Als ich alt genug war, fiel mir die Aufgabe zu, die Einserhütte vorzubereiten. Die Einserhütte ist eine kleine, mit roten Eternitschindeln verkleidete Jagdhütte an der Grenze der zum Reitbauerngut gehörenden Jagd. Wenn man den steilen Jägersteig nimmt, benötigt man eine dreiviertel Stunde dorthin. Die Einserhütte ist auch über einen Bringungsweg erreichbar, der über zwei angrenzende Reviere führt, auf dieser Route benötigt man eineinhalb Stunden. Die Jagdgäste waren meist kleine Beamte aus Linz oder Wels, die den Muraus in irgendeiner den Hauptbesitz betreffenden baurechtlichen, forst- oder wasserwirtschaftlichen Genehmigungsangelegenheit einen Gefallen erwiesen hatten oder noch erweisen sollten. Die Jagdgäste saßen an und schossen unter Anleitung meines Vaters. Die Jagdgäste benützten die Hütte nie. Die Gnädige liebte die Jagdhütte wegen des Ausblicks, der sich von dort aus bot. Die Hütte liegt auf der Kuppe eines Wiesenhangs, von dem aus man nahezu das ganze Tal überblicken kann. Meine Aufgabe bestand darin, die Hütte zu beheizen und eine Jause bereitzuhalten, meist Speck- und Käsebrote sowie ein paar Flaschen Bier. Ich wartete oft vergebens auf Muraus Mutter und ihre Begleitung. Sie hatte jedoch ausdrücklich offengelassen, ob sie tatsächlich kommen würde oder nicht. Insbesondere wechselndes Wetter war dafür verantwortlich, daß ich nach vergeblichem Warten in den Abend hinein häufig auch die Nacht in einem der Stockbetten der Einserhütte verbrachte. Die Gnädige nahm zwar keinen Anteil für die Jagd, sehr wohl jedoch für die Wirtschaft. Sie überprüfte die Abrechnungen meines Vaters, leitete die bescheidenen Holzverkäufe in die Wege und genehmigte die Investitionen, soweit sie mein Vater von deren Notwendigkeit hatte überzeugen können. So wurde im Lauf der Jahre der Stall fast vollständig erneuert und mit einem modernen Anbau versehen, der die landwirtschaftlichen Geräte beherbergte, und es wurde ein neuer Holzweg gebaut, der die Teile des Forsts erschloß, die bislang nicht genutzt werden konnten, weil die Bringung des geschlägerten Holzes zu teuer gewesen wäre. Die wichtigste Neuerung war das Bad. Unser Bad. Die Gnädige entlohnte uns immer großzügig und beschenkte uns zu Weihnachten reichlich. Die Pakete kamen von einem Versandhaus und enthielten Haushaltsgeräte, Wäsche und Bekleidung sowie für mich und meine Geschwister das einzige Spielzeug, das wir je besitzen sollten. Aber sie wehrte sich jahrelang gegen das Bad. Wir hatten kein Bad, und natürlich durften wir das Bad der Herrschaft nicht benutzen. Wir wuschen uns in der Küche, an der Spüle, und unsere Toilette war auf der Diele, unmittelbar neben dem Eingang. Erst nach langem Bitten gestattete die Gnädige den Einbau eines Bads im hinteren Teil der Küche. Mein Vater mußte das Material beschaffen, seine Arbeit wurde nicht bezahlt. Manchmal ging Muraus Mutter ins Dorf. Sie nahm regen Anteil für die bekannte Beziehung der Frau des örtlichen Gendarmen zum Glöcklbauern. Der Glöcklbauer war nicht nur der reichste Bauer im Dorf, sondern auch der intelligenteste. Er war im Zweiten Weltkrieg erfolgreicher Stuka-Pilot gewesen. Wenn er im Wirtshaus zum Niesl vom Krieg erzählte, gab es an den Nebentischen keine Unterhaltung mehr. Den Gendarmen dagegen konnte man in seiner ganzen Schmächtigkeit und Kürze nur als Zwetschkenmännchen bezeichnen. Es war allen ein Rätsel, wie ausgerechnet er zu dieser Frau gekommen war, die wie keine andere die dörfliche Wunschvorstellung von Erotik verkörperte. Sie war stark, aber wohlproportioniert und vor allem mit einem bewundernswerten Dirndl-Dekolleté gesegnet, das besonders vorteilhaft zur Geltung kam, wenn sie sich mit den anderen Dorfbewohnern aus ihrem Küchenfenster herausgelehnt unterhielt. Sie betrieb eine kleine Gästepension. Laut Grundbuch gehörte das Haus zu gleichen Teilen ihr und ihrem Mann. Die Pension war ein Neubau, es hieß, der Glöcklbauer habe das Kapital aufgebracht. Wie alle anderen wußte auch die Frau des Glöcklbauern von der Liaison. Sie verließ niemals den Hof. Sie kümmerte sich jedoch auch nicht um die Wirtschaft, sondern las den ganzen Tag Heftromane. Der Sohn hatte nie die Absicht gehabt, den Hof zu übernehmen, er hatte sich früh mit seinem Vater überworfen und lebte in Wien. Keiner, auch nicht sein Vater, wußte wovon. Der Glöcklbauer übergab den Hof später an seinen Schwiegersohn. Ich weiß nicht, auf welche Weise und von wem Muraus Mutter von der Verbindung der Frau des Gendarmen mit dem Glöcklbauern erfahren hatte. Jedenfalls vermittelte sie der Frau des Gendarmen Sommergäste. Mir ist nicht bekannt, ob sie jemals den Glöcklbauern kennengelernt hat. Den Gendarmen kannte sie. Der trank. Nicht nur im Wirtshaus, während der Liebhaber seiner schönen, üppigen Frau sich mit dieser vergnügte. Sondern auch im Dienst. Alle wußten es, doch niemand nützte das Wissen aus. Man befürchtete, anstelle des Gesetzes würde sich der Glöcklbauer denjenigen vornehmen, der es wagen wollte, seine Idylle zu stören. Das Dorf konnte sich nicht genug darüber wundern, warum es zu keinen Weiterungen für den traurigen Gendarmen kam. Er wurde zwar nie befördert, aber auch nie gemaßregelt. Jahre später verriet mir der Bürgermeister, daß Muraus Vater, der den Gendarmen nicht kennengelernt haben konnte, sich an allerhöchster Stelle, beim damaligen Landeshauptmann, für den traurigen Gendarmen verwendet hatte. Die Gewohnheit, die Einserhütte vorzubereiten, behielt ich auch bei, während ich in Kremsmünster die Schule besuchte. Das hatte sich so ergeben. Ich kam mit zehn Jahren in das Stiftsinternat und litt nach kurzer Zeit – ich hatte vorher niemals auch nur eine Nacht außerhalb des Reitbauernguts verbracht – unter solchem Heimweh, daß ich weglief. Am Tag nach meiner Heimkehr, am Tag, nach dem mich mein Vater hart geschlagen hatte, traf auch Muraus Mutter ein. Sie ließ mich zu sich kommen. Sie erwähnte mit keinem Wort mein Ausreißen. Sie bat mich, an den nächsten Tagen immer die Jause auf die Einserhütte zu bringen. Am dritten Tag kam sie dann. Auch bei dieser Gelegenheit sprachen mich weder sie noch der italienische Priester auf mein Ausreißen an. Erst als sie sich verabschiedete, bat sie mich, nach Kremsmünster zurückzukehren. Sie versprach, der italienische Priester werde dafür sorgen, daß ich jedesmal dann, wenn sie ins Reitbauerngut komme, aus dem Internat genommen werden dürfe, um ein paar Tage zu Hause zu verbringen. So könne ich auch in Zukunft die Einserhütte vorbereiten. Sie komme nicht so oft, die wenigen Tage, die ich dadurch versäumte, könne ich, so schnell, wie ich lernte, ohne Schwierigkeiten nachholen. Ich kehrte nach Kremsmünster zurück, und es geschah alles so, wie sie gesagt hatte –
ZIEL
Prof. Dr. h. c. mult. Johannes Stumpfegle
Matthias Fegelein
Rechtsanwälte
Herrn
Dr. Georg Voigtländer
23.2.1989
Sehr geehrter Herr Dr. Voigtländer,
am heutigen Tag fand in unserer Kanzlei die Ihnen angekündigte Besprechung zwischen Ihrem Onkel, Heinrich Voigtländer, Ihrem Vetter, Friedrich Voigtländer, und mir statt.
Ich habe beiden Herren den Inhalt der letzten Unterredung zwischen Ihnen und mir in unserer Kanzlei mitgeteilt. Sie hatten dabei ausgeführt, aufgrund der in der jüngsten Zeit mit Ihrem Vetter geführten Gespräche sowie in Anbetracht von dessen Verhalten im Unternehmen seien Sie zu der festen Überzeugung gelangt, daß Ihr Vetter die für eine unternehmerische Tätigkeit notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen nicht mitbringe und daß Sie deshalb darauf bestehen müßten, in Ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit durch die Einräumung eines Stimmrechts von 51% bestärkt zu werden. Bei zu erwartender Ablehnung dieser Forderung würden Sie es vorziehen, von den bereits ausgehandelten Verträgen Abstand zu nehmen. Sie schlagen vor, eine GmbH & Co KG zu gründen, an der – entgegen der bisher vorgesehenen Regelung – auch die Töchter Ihres Onkels beteiligt sein könnten. Ihr Onkel und Sie sollen als Geschäftsführer der GmbH in das Handelsregister eingetragen werden, wobei Ihr Onkel diese Tätigkeit nicht auszuüben brauche; er könne Ihren Vetter zur Vornahme aller Handlungen bevollmächtigen, die für die tatsächliche Geschäftsführung erforderlich sind. Sie lehnten es jedoch ab, daß Sie und Ihr Vetter gleichberechtigt als Geschäftsführer der GmbH tätig werden.
Nach gründlicher Aussprache bin ich durch Ihren Onkel beauftragt worden, Ihnen folgendes mitzuteilen:
Ihr Onkel ist damit einverstanden, daß die OHG baldmöglichst, auch unter Änderung der bisherigen Verhandlungsergebnisse, in eine GmbH & Co KG umgewandelt wird. Vorrangig ist hier der in allen bisherigen Besprechungen betonte Gesichtspunkt der Haftungsbeschränkung der beiden persönlich haftenden Gesellschafter.
Für Ihren Onkel ist jedoch ein weiterer, nicht minder wichtiger Leitgedanke der Umwandlung seine Ablösung in der Geschäftsführung durch seinen Sohn. Ihr Onkel besteht darauf, daß Sie und Ihr Vetter zu gleichberechtigten Geschäftsführern ernannt werden.
Auf dieser Grundlage können die weiteren Gespräche über eine zweckmäßige Vertragsgestaltung für die GmbH & Co KG entweder wie bisher in der Kanzlei von Dr. Krapp oder in unserer Kanzlei geführt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Fegelein