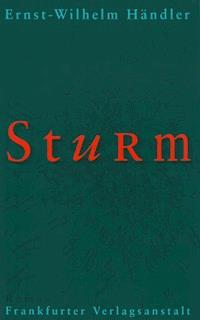22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Ernst-Wilhelm Händlers »Der absolute Feind« erhält ein Schriftsteller einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll über den erfolgsgewöhnten Berliner Galeristen Georg Voigtländer schreiben und herausfinden, warum dieser nach fünfjährigem Aufenthalt in einer kalifornischen Psychiatrie Galerist geworden ist. Auf Einladung Voigtländers besucht der Schriftsteller die Kunstmesse Art Basel in Hongkong und die Armory Show in New York, wo die Galerie jeweils vertreten ist, und die Biennale in Venedig. Er lernt die ungewöhnliche Familie Voigtländers kennen und setzt sich in Italien auf die Spur des Malers Schelchshorn, der für die Galerie offenbar von großer nichtkommerzieller Wichtigkeit ist, aber jetzt von einer Mega-Galerie umworben wird. Der Schriftsteller unternimmt alles, um sich in den Galeristen einzufühlen. Doch Georg Voigtländer wird nicht weniger rätselhaft. Macht er sein Leben zum Kunstwerk? »Die Gegenwartskunst als Ganzes lässt sich nur über das Ökonomische betrachten« Ernst-Wilhelm Händler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ernst-Wilhelm Händler
Der absolute Feind
Roman
Über dieses Buch
Ein Schriftsteller erhält von dem erfolgsgewöhnten Berliner Galeristen Georg Voigtländer einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll über diesen schreiben und herausfinden, warum Voigtländer nach fünfjährigem Aufenthalt in einer kalifornischen Psychiatrie Galerist geworden ist. Auf Einladung Voigtländers besucht der Schriftsteller die Kunstmesse Art Basel in Hongkong und die Armory Show in New York, wo die Galerie jeweils vertreten ist, und die Biennale in Venedig. Er lernt die ungewöhnliche Familie Voigtländers kennen und setzt sich in Italien auf die Spur des Malers Schelchshorn, der für die Galerie offenbar von großer nichtkommerzieller Wichtigkeit ist, aber jetzt von einer Mega-Galerie umworben wird. Der Schriftsteller unternimmt alles, um sich in den Galeristen einzufühlen. Doch Georg Voigtländer wird nicht weniger rätselhaft. Macht er sein Leben zum Kunstwerk?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ernst-Wilhelm Händler, 1953 geboren, lebt in Regensburg und München. Zuletzt erschienen seine Romane »Das Geld spricht«, »München« und »Der Überlebende« sowie Essays über ökonomische und künstlerische Themen. Mit »Die Produktion von Gesellschaft« und »Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument« hat er eine eigene Gesellschafts- und eine eigene Kulturtheorie vorgelegt. Ernst-Wilhelm Händler sammelt Kunst, seit er es sich leisten konnte, sein erstes Bild zu kaufen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Motti]
Kommen die Bilder [...]
Als das Flugzeug [...]
Robert Zoiss [...]
Jetzt Georg Voigtländer [...]
Frank Schelchshorn [...]
Wieder zu Hause [...]
Für welche Medien [...]
Ich war am Mittwoch [...]
Ne me parlez pas de Bonnard. Ce qu’il fait n’est pas de la peinture. Il ne va jamais au-delà de sa sensibilité.
Il ne sait pas choisir. Quand il peint un ciel, par exemple, il le peint d’abord bleu, plus ou moins comme il est. Puis il regarde d’un peu plus près et y voit un peu de mauve; alors il ajoute une touche ou deux de mauve, sans se compromettre. Et puis il se dit qu’il y a aussi un peu de rose. Donc, il n’y a pas de raison pour qu’il ne mette pas de rose. Le résultat est un pot-pourri d’indécision. S’il regarde assez longtemps, il finit par ajouter du jaune, au lieu de décider de quelle teinte devrait réellement être ce ciel. On ne peut pas travailler ainsi. La peinture n’est pas une question de sensibilité; il faut usurper le pouvoir; on doit prendre la place de la nature et ne pas dépendre des informations qu’elle vous offre.
Pablo Picasso
No one working in the art field expects his or her labor to be irreplaceable or even mildly important anymore.
Hito Steyerl, Duty Free Art
Kommen die Bilder an die linke Wand und die Skulptur vor die rechte Wand oder anders herum, fragte Carla. Solange man nicht weiß, wie man den Arm mit den Screens für das Video aufstellt, kann man ständig wieder von vorn anfangen, sagte Amrei. Carla ging in die Knie, um die krakeligen Beschriftungen der großen Kisten zu entziffern, die auf dem Gang bereitgestellt waren. Wie viele Screens sind es, fragte Amrei. Die Bilder und die Skulptur waren in Berlin, das Video in London, sagte Carla. Ihr langer schwarzer Mantel verteilte sich am Boden um sie. Acht Kisten stammen aus London. Entweder sind es vier Bildschirme, und der Arm ist aus vier Teilen zusammengesetzt, oder es sind acht Bildschirme, und die Teile des Armes und die Befestigungsseile sind bei den Bildschirmen dabei. Carla richtete sich auf und zog die Over-the-knee boots hoch.
In der Gangkreuzung stritten sich zwei chinesische Aufbauhelfer lautstark, es musste darum gehen, welche Richtung sie mit der Kiste auf ihrem Hubwagen einschlagen sollten. Amrei blickte sie mit ihrem aufmerksamen, ebenso verstörten wie entschlossenen Kindergesicht an, sie verstummten schlagartig.
Welche ist die maximale Höhe, die die Messeleitung erlaubt, fragte Amrei. Carla blickte nach oben. Die schwarz bemalte Hallendecke schien unendlich weit weg. Zwei Modulsysteme vermittelten zwischen der Unendlichkeit und den Nutzflächen. Ein quadratisch unterteiltes Rastersystem aus massiven Schienen, die Zwischenräume durch schmalere Schienen stabilisiert, ein daran befestigtes System von Käfigkonstruktionen für die verschiedenen Typen von Strahlern. Carla nahm die große dunkle Sonnenbrille ab, um ungeschützt ins Licht zu blicken. Sie schien über den Trennwänden ein verschwommenes feindliches Wesen zu fixieren. In einem Ton ruhiger, kalter Gereiztheit sagte sie, an den Käfigen für die Strahler darf man nichts weiter befestigen. Amrei hatte sich an den Scheitelpunkt der Eckkoje begeben. Wenn der Arm mit den Screens von rechts kommt, müssen die Fotos auf diese Seite und die Skulptur auf die andere. Wenn der Arm anders herum aufgestellt ist, umgekehrt. Man müsste wissen, wie die Besucherströme laufen, sagte Carla, aus welcher Richtung, auf welchem Gang mehr Leute kommen. Sie sollten auf die Fotos blicken. Zuerst blicken die Leute auf die Screens, sagte Amrei. Es ist egal, wo die Fotos hängen oder die Skulptur steht. Georg muss das entscheiden … Amrei scharrte mit dem rechten Fuß, um zu prüfen, wie glatt der graue Boden war, es gab ein sandiges Geräusch. In London war der Arm in den Boden geschraubt, das ist hier auf keinen Fall erlaubt. Ich hoffe, dass Gewichte dabei sind, damit der Arm sicher steht. Das wird kontrolliert. Sonst müssen wir den Arm gleich wieder abbauen.
Carla setzte die Sonnenbrille nicht mehr auf. Sie trug eine schulterlange weiße Perücke, die Haare über der Stirn auf Höhe der Augenbrauen abgeschnitten. Ihre Augen waren tiefschwarz konturiert, sie hatte Make-up, aber keinen Lippenstift aufgetragen. Die rechte Backe war leicht angeschwollen, unter dem Auge zeichnete sich ein dunkler Streifen ab. War das ein in Abheilung begriffenes blaues Auge? Auch die Lippen waren leicht geschwollen. Carla tat so, als ob sie sich eine Zigarette anzünden würde, aber sie hatte die Zigarette nur im Mund, sie hielt das Feuerzeug vor die Zigarette, ohne es zu betätigen. Sie setzte sich auf den Boden, lehnte sich mit dem Rücken an eine der Kisten und zog die Beine an. Ein Gabelstapler mit einer riesigen Kiste bremste scharf, weil der Fahrer den Galeriemitarbeiter, der aus der gegenüberliegenden Eckkoje auf den Gang getreten war, erst sehr spät gesehen hatte. Eine kleine Staubwolke zog an Carla vorbei. Es sah aus, als hätte sie die Zigarette tatsächlich angezündet, als hätte sie eine brennende Zigarette in der Hand.
Amrei hockte sich im Schneidersitz auf den Boden. Keine Faser ihres Körpers hatte auf die laute Bremsung und den Beinahe-Unfall reagiert. Du hältst es nicht mehr aus, fragte sie. Die gegenüber wissen auch nicht, wie sie ihre Bilder aufhängen sollen, sagte Carla. Sie hängen schon zum x-ten Mal um. Weißt du, was man macht, wenn man etwas nicht mehr aushält, sagte Amrei. Man ändert etwas. Das schwarz-weiße Muster an der Wand mit den monochromen Bildern, sagte Carla, das sind übrigens Menschen. Ich habe es nicht gleich gesehen. Das X-Muster ergibt sich, weil jeweils eine Reihe auf dem Kopf steht, die Arme und die Beine gehen ineinander über. Ändere etwas, sagte Amrei, zieh zu mir. Die Art, wie Amrei reglos unverwandt in eine ganz andere Richtung blickte, hatte etwas Maßloses, Anstößiges, Unschickliches.
Carla checkte ihre E-Mails. Die Fragen für den Katalog sind: How do you envision the relationship between the arts and politics in our globalized world, und: Which book influences / has influenced you and your activity most and why, las Carla vor. Iwan wird sagen, das wichtigste Buch für ihn ist Gras im Kopf. Er hat seine erste Ausstellung mit sechzehn veranstaltet, die Bedingung war, dass er ein Künstlerbuch dazu macht. Das war der Titel. An den Namen des Künstlers erinnert sich niemand. Amrei sagte, Gagosian hat die Fragen beim letzten Mal nicht beantwortet. Carla sagte, Gagosian beantwortet die Fragen nie. Amrei sagte, jedenfalls hat er angegeben, er habe dreihundertfünfzehn Mitarbeiter … Zwirner hat einhundertsechzig.
Ich hatte gedacht: In dem Augenblick, in dem Georg Voigtländer den Stand betrat, würde das Ganze still stehen – nicht nur Amrei und Carla, auch alles, was um den Stand herum war. Oder: Georg Voigtländer würde auf den Schauplatz stürmen, und alles würde zerbrechen, zersplittern, alles würde sich auflösen, verschluckt, aufgesogen werden von seiner Präsenz. Ich würde denken: nur nicht zerfallen, nur nicht mich auflösen. Aber kein Gestaltwechsel, sondern geschäftige Gleichgültigkeit. Lediglich die Stimmen von Carla und Amrei wellten sich.
Georg Voigtländer betrat den Stand, ohne zu grüßen. Amrei, Carla und Georg Voigtländer hatten sich wohl am Morgen im Hotel getroffen. Er fragte nach den aktuellen Ausgaben von Artforum, frieze, Monopol und Spike, er wollte die geschalteten Anzeigen kontrollieren.
Mit einem Air von Blasiertheit verfolgte Amrei, wie Carla die Zeitschriften aus dem kleinen Container holte, der alle für die Messe notwendigen Unterlagen enthielt. Doch dann erblickte sie etwas oder jemanden auf dem Gang. Amrei öffnete die Augen weit, sprang auf, ohne sich abzustützen, und rannte davon, die Arme vor sich gestreckt, als müsste sie auf der Flucht jemanden wegstoßen.
Normalerweise erzählen einem die Leute im Flugzeug von ihren Hunden, sagte Georg Voigtländer, während er in Artforum blätterte. Mein Nachbar hatte ein Terrarium mit schrecklichen Pfeilgiftfröschen. Ein Brasilianer, die Frösche gibt es nur in Südamerika. Angeblich reicht das Gift eines einzigen Frosches, um zwanzigtausend Mäuse zu töten. Indigene Jäger bestreichen die Pfeile ihrer Blasrohre mit dem Gift. Der Frosch produziert sein Gift nicht selbst, er verarbeitet Giftstoffe aus seiner Umgebung. Wenn er in Gefangenschaft ungiftige Nahrung erhält, ist der schreckliche Pfeilgiftfrosch nicht mehr schrecklich. Georg Voigtländer zeigte Carla eine Seite aus Artforum. Ich finde, der gelbe Hintergrund unserer Anzeige ist zu giftig. Die Frösche des Brasilianers sahen auch so aus. Wer hat die Probeabzüge gesehen? Carla antwortete: John. Batrachotoxin wirkt auf Proteine, die in der Zellwand als Schleuse für Natriumionen dienen, sagte Georg Voigtländer. Beim schrecklichen Pfeilgiftfrosch ist in diesen Proteinen ein bestimmter Aminosäurebaustein anders, deswegen ist das Batrachotoxin für ihn selbst ohne Wirkung. Warum ist die Anzeige nicht weiter vorne?
Ich habe gerade Maureen getroffen, von Pace, ich habe einen Haufen Dinge erfahren. Vor allem, dass Schelchshorn zu ihnen wechseln will. Aus dem Gleißen der Strahler über Carla und Georg Voigtländer war Carlas Bruder aufgetaucht. Das hat sie dir so gesagt?, fragte Carla. Sie hat es mir nicht so gesagt, sagte John. Sie hat gesagt, es werde eine Veränderung geben, über die wir nicht begeistert sein würden. Als sie mit den Einzelheiten weitermachen wollte, musste sie ans Handy. Ich habe nicht gewartet, sondern mich verabschiedet. Wie kommst du auf Schelchshorn?, fragte Carla. Ich habe ihn um neue Arbeiten für Miami gebeten, und er hat Ausflüchte benutzt. Er weiß nicht, ob er das schafft. Das hat er noch nie gemacht. Wenn wir etwas für eine Messe von ihm brauchten, hat er immer sofort zugesagt. Warum lächelst du?, fragte Carla. Ist das ein Grund für dich zu lächeln? Warum ich lächle?, wiederholte er. Weil mir das alles gleichgültig ist. Es bereitet mir sogar fast Vergnügen. Das ist nicht wahr, sagte Carla. Es ist wahr, sagte John. Das Gesicht von Carla wurde spitz und verzerrt, wie ein Gemälde, das man in einem Spiegel betrachten muss, um die wahren Dimensionen wiederherzustellen und zu erkennen, was dargestellt ist. John wurde durchsichtig.
Soll ich so – mit der Erzählung – mit dem Roman – mit dem Essay beginnen?
Oder so: Georg Voigtländer ist 66. Er ist alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Galerie Georg Voigtländer GmbH. Die Galerieräume befinden sich in Berlin-Mitte in der Oranienburger Straße. Siebzehn Personen sind fest angestellt, darunter Georg Voigtländers Sohn John, seine Tochter Carla und Amrei. Wie bei allen Galerien gibt es keine Angaben über die Höhe des Umsatzes. Man müsste in den Online-Pflichtbilanzen nachsehen. Aber man weiß nicht, ob alle Verkäufe über die GmbH laufen. Die durchschnittliche deutsche Galerie macht 250000 Euro Umsatz im Jahr. Das kann kein Maßstab für die Galerie Georg Voigtländer sein.
Die letzte Vernissage fand in den Räumen der Galerie statt. Der Künstler las aus seinem Buch vor. Es existiert eine MP4-Aufzeichnung: »Prior to Bob Dylan – there had been two types of people. – On the one hand, there had been the financiers of knowledge, or masters of wisdom and truth, such as Lloyd Blankfein and the guy from that Twilight movie – who opposed their theories to the ignorance of the mob. – On the other hand – there had been the middlemen of knowledge, who claimed to be able to sell their knowledge to all willing to pay. – Those include former Knicks great Anthony Mason and Heidi Klum. – But for Dylan – knowledge was not the ensemble of propositions and formulas that could be written, communicated, or sold ready-made. This is apparent at the beginning of any concert he gives. – Dylan always arrives late because he has been outside meditating, standing motionless and – On the other hand – applying his mind to itself – I understand that this critique of knowledge may seem entirely – negative. But on the other hand, it must be emphasized that knowledge and truth, as we have already discussed, cannot be received ready-made, but must be, in a sense, lived, by the individual himself. – The real challenge is therefore not what to know – but how to be. – Practical life is not necessarily directed toward other people, as some think – and it is not the case that practical thoughts are only those that lead to an – action – On the contrary, much more practical are those mental activities and reflections that have no other goal than to sharpen the mind – From this perspective, it is arguable that – Mitt Romney is a superb research administrator. His school engaged in an immense hunt for information in every area. His students and colleagues gathered all kinds of data, from – historical, – to sociological, – psychological and – philosophical. – All works – contain within them what they repulse. The notion of enjoying a work without interest must be shadowed by the most intense interest, and there is much to be said for the idea that the dignity of works depends on how they are snatched from the interests that hold them hostage. – In the past, wisdom was considered a mode of being. It was a state in which a person is, in a way, radically different from other people. If philosophy is that activity by means of which philosophers train themselves for wisdom, such an exercise must necessarily consist not merely in speaking and reflecting in a certain way, but also in being, acting, and seeing the world in a specific way. – For instance, he could abstain from things or else enjoy them with the same ease. He also always wants the same thing and not wants the same thing. He is self-sufficient – at least for Allen Iverson – and – Katie Couric because external things cannot disturb him. There is, in a sense, a profound – difference, which is not a lack of interest with regard to everything, but a conversion of interest and attention toward something other than – that which monopolizes the care and attention of other people. – This difference corresponds to a complete transformation of his relation to the world. Tori Black says that to look at the world attentively is already to construct a theory. – Knowhow? How? Know-how? Know-how? How? Know-how? How? Tell me. Know-how? How? Know-how? How? Know-how? – How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? – Tell me. Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Knowhow? How? Know-how? How? – Know-how? How? Knowhow? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? – How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Tell me. Know-how? How? Tell me. Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Tell me. Know-how? How? Knowhow? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? – How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Knowhow? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? – How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? – How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? How? Know-how? Tell me. How? Know-how? How? We shall see.«
Die vorletzte Vernissage hatte im Görlitzer Park stattgefunden. Der Manager des Görli, Cengiz Demirici, begrüßte alle Gäste mit Handschlag: »Hallo Chef! – Alles gut?« Und: »Hallo Chefin! – Alles gut?« Die jüngeren Vernissage-Besucher spielten mit den Kids Hacky sack. Einige Besucher halfen zwei alten Frauen beim Einsammeln von Flaschen. Die Besucherinnen machten Konversation mit den Parkläufern, Solo, Shpetim, Özcan, Mustafa. Ein ernsthaftes Sammlerehepaar führte eine lange Unterhaltung mit Solo, der sechs Sprachen spricht, fast jede Westafrikas. Ein Jungsammler, der zu viel Prosecco getrunken hatte – es gab Prosecco di Valdobbiadene –, sagte: »Weedweedweed«. Der Parkmanager hatte es gehört und sagte, das war einmal. »Kein Alkohol, kein Kiffen, keine Nasen oder irgendwas.« Für die Erlaubnis, seine Vernissage dort abhalten zu dürfen, hatte Georg Voigtländer eine fünfstellige Summe in den Görli-Fonds eingezahlt, der Fonds finanziert Parkprojekte. Die Bilder waren in vier Bauwagen ausgestellt. Es gab keine professionelle Security, Freunde von Shpetim regelten den Einlass, sie achteten darauf, dass sich nicht zu viele Besucher auf einmal in den Wagen aufhielten. Ein paar Vernissage-Gäste hatten Schlafsäcke mitgebracht, Campieren ist im Görli verboten, aber wer einen Schlafsack hat, darf im Park nächtigen.
Georg Voigtländer ist 36. Er ist als geschäftsführender Gesellschafter der Familienfirma Nachfolger seines verstorbenen Vaters Georg Voigtländer. Die elektrotechnische Firma gehört zur einen Hälfte Georg Voigtländer, zur anderen seinem Onkel Heinrich Voigtländer. Die Firma wird noch in der Form der Offenen Handelsgesellschaft betrieben, das ist nicht mehr zeitgemäß, die Gesellschafter haften mit ihrem vollen Privatvermögen, sie wandeln die Voigtländer OHG in eine GmbH & COKG um. Georg Voigtländer will seinen Cousin Friedrich Voigtländer, den Sohn von Heinrich Voigtländer, als Geschäftsführer loswerden. Georg Voigtländer gibt die Macht, sich selbst als Geschäftsführer unantastbar zu machen, aus der Hand. Die Gesellschafter verzichten auf die Vereinbarung eines Sonderrechts zur Bestellung von Geschäftsführern, im Falle der Uneinigkeit der Gesellschafter entscheidet der neugegründete Beirat über die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern. Der Vetter deklariert Privatausgaben als Firmenausgaben, Georg Voigtländer nimmt das als Anlass, um die Abberufung seines Vetters zu fordern. Georg Voigtländer ist überzeugt, dass sein Cousin als Geschäftsführer ungeeignet ist. Der Beirat sieht das anders, er misst dem Vorfall keine größere Bedeutung zu. Vielmehr beschließt der Beirat, Georg Voigtländer als Geschäftsführer abzuberufen. Georg Voigtländer fährt zum Flughafen, damals noch München-Riem, und nimmt das nächste Flugzeug nach Los Angeles. Er lässt sich mit einer Limousine nach Sunnyvale bringen und checkt im Psychiatry ward des El Camino Hospital ein. Er verbringt dort fünf Jahre.
Oder –
Als das Flugzeug in Chek Lap Kok landete, hatte ich das Gefühl, nicht an einem Ort, sondern an mehreren Orten gleichzeitig angekommen zu sein. Die Galerie hatte mir ein Business-Class-Ticket für einen Direktflug geschickt, ich war um zehn Uhr abends in München losgeflogen und erreichte Hongkong um halb vier Uhr nachmittags, in Hongkong war es sechs Stunden später als in München. Der Flughafen ist etwa vierzig Kilometer von der Stadt entfernt, eine im Meer aufgeschüttete Insel mit den Umrissen eines gigantischen Flugzeugträgers. Nach der Landung hatte ich die Empfindung, ich hielte mich zugleich auf dem Flughafen, auf Lantau Island, in Kowloon, in Wan Chai und in Sheung Shui in den New Territories auf. Lantau Island ist die größte der Inseln Hongkongs mit dem Berg, dessen englischer Name Ragged Peak ist. Wan Chai ist das Geschäftszentrum mit dem Convention and Exhibition Centre. Kowloon liegt Wan Chai auf der anderen Seite der Bucht gegenüber, in Kowloon wurde früher produziert, in Hochhäusern, die gewissermaßen vertikale Fabrikhallen darstellten. In Hongkong wird nicht mehr produziert, es gibt nur noch Finance, die Produktionsstätten, egal ob vertikal oder horizontal, sind alle abgerissen.
Erst als ich im Taxi saß, das mich auf das Festland brachte, verließ mich das Empfinden, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass die Stoßdämpfer des Taxis defekt waren und jede Bodenunebenheit durchdrang. Ich war ausdrücklich angewiesen worden, ein Taxi zu nehmen, die Kosten würden erstattet werden.
Obwohl es in Hongkong keine nennenswerte Kriminalität gibt, die der Besucher fürchten müsste – niemals wurde ich während meines Aufenthalts Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung –, schien die Stadt der Gewalt geweiht. Die Hochhäuser summarisch oder elliptisch, einfache Zeichen, weit davon entfernt, den bleifarbenen Himmel zu durchstoßen. Die Sonnenstrahlen kraftlos, unschlüssig, von ihrem eigenen Gewicht erdrückt. Die pointillierten Linien der Fenster Reihen von Augen ohne Lider und ohne Pupillen. Das Bremsen und Beschleunigen der Fahrzeugzusammenballungen wie ein vielfaches Atmen, aufsteigend das Quietschen von Lastwagenbremsen, Hundegebell. Schwache Schreie wie von in einer Menge zertrampelter Kinder und Frauen. Ich sah die erschütterte Luft: ein Gewirr pulsierender, sich kreuzender gestrichelter Linien. Ich hatte Angst, die Linien würden in meine Brust dringen, meine Lungen zusammenschnüren und pfeifend aus meinen Ohren wieder herauskommen.
Die Galerie hatte mich in einem Hotel in Wan Chai untergebracht, man erreichte die Ausstellungshallen über eine Fußgängerbrücke, die über eine achtspurige Straße führte. Auf der Theke der Rezeption stand ein Käfig, in dem ein Kanarienvogel tschilpend umherhüpfte. Es war kein Zierkäfig, das Gerüst und die Stäbe waren aus grobem, schwarz lackiertem Metall, der Gedanke an eine Grube lag nahe, in deren Stollen Vögel mitgeführt werden, die die Bergleute vor einer ansteigenden Methankonzentration warnen. Ich fuhr mit dem Lift nicht sofort zu meinem Zimmer, sondern zuerst in das oberste Geschoss, um das Spa zu besichtigen. In dem Augenblick, als ich eintrat, sprang ein Junge völlig angekleidet in den Pool.
Mein Anblick im Spiegel traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich war überzeugt gewesen, ich hätte meine Reise in gerader, starrer, feierlicher Haltung absolviert. Ich dachte, ich hätte am Flughafen, am Taxistand, an der Rezeption unter einem ehernen Panzer aus Arroganz und Reflexen agiert. Aber ich bot das lächerliche, obszöne Erscheinungsbild eines entnervten Reisenden, in dessen Gesicht sich die Angst widerspiegelte, ihm würde von einem Augenblick zum anderen eine brutale, schmutzige Sache widerfahren. Eine anstößige, schamlose Sache.
Georg Voigtländer hatte mir eine E-Mail geschrieben, der Verlag hatte sie weitergeleitet. Er sei einer meiner Leser. Wenn ich nach Berlin käme, solle ich mich bei ihm melden, er werde mir die Galerie zeigen. Es hatte sich gefügt, dass mich gerade eine Teilnehmerin an der Schreibwerkstatt Prosaschreiben des Literarischen Colloquiums Berlin als Tutor gewählt hatte. Ich hatte ihr Manuskript gelesen und würde mit ihr in zwei Sitzungen darüber sprechen. Das LCB bezahlte Fahrt, Hotel und ein Honorar, ich residierte in einem Ibis-Hotel in Mitte.
Ich traf an einem Herbstnachmittag in Berlin ein und rief in der Galerie an, ob Georg Voigtländer zu sprechen sei. Ohne Nachfrage, worum es gehe, bekam ich die beflissene Antwort, er werde mich schnellstmöglich zurückrufen. Es war ausgeschlossen, dass jedem möglichen Kunden sofort ein Rückruf des Chefs der Galerie zugesichert wurde. Das konnte nicht mir gelten. Hatte man mich mit einem potenten Sammler verwechselt? Keine fünf Minuten später rief die junge Frau zurück. Die Galerie sei für ein paar Tage geschlossen, es würden Handwerkerarbeiten durchgeführt. Georg Voigtländer wolle mich treffen, ich solle einen Vorschlag machen. Ich war enttäuscht, ich hätte gerne die Galerie gesehen, in einer kindischen Reaktion sagte ich, ich hätte ein enges Programm in Berlin. Die junge Frau machte den Vorschlag, Georg Voigtländer werde zu mir ins Hotel kommen. Wann es für mich passe. Weiter kindisch, gab ich an, ich hätte nur jetzt sofort Zeit, obwohl ich für den Rest des Tages nichts zu tun hatte. Zu meiner nicht geringen Verwunderung ging die junge Frau darauf ein. Georg Voigtländer werde in einer halben Stunde im Hotel sein.
Eine halbe Stunde war noch gar nicht vergangen, als Georg Voigtländer vor mir in der »Lobby« des Hotels stand, die Arme auf die Hüften gestützt. Ich hatte ihn nicht gleich bemerkt, ich war in den Tagesspiegel vertieft. Wenn ich unterwegs bin, lese ich lokale Zeitungen. Er hatte mich sofort erkannt, ich ihn gleichfalls, von uns beiden gibt es genügend Clips auf YouTube. Er trug Jeans, ein schwarzes Polo und eine dünne schwarze Moncler-Sommerweste.
Er setzte sich hin und blickte mich erst ein paar Sekunden stumm an. Dann zog er einen MP3-Player aus einer Tasche seiner Weste, legte ihn auf den Tisch und schaltete ihn ein. Ich hörte mich, wie ich aus dem Roman vorlas, der 2006 erschienen war. Georg Voigtländer erklärte, dass er meine Lesung im Herbst desselben Jahres im Literaturhaus in der Fasanenstraße besucht habe. Die Diskussion nach der Lesung war lebhaft gewesen, ich konnte mich nicht erinnern, dass er sich beteiligt hatte, ich war mir jedoch nicht hundertprozentig sicher. Ich hörte meine Stimme, sie war reglos, wie aus Erz gegossen, ich las eine Passage, die etwas Friedliches, Mustergültiges und Lehrreiches hatte, und ich verstand nicht, wie es zu den scharfen Ausschlägen der Balken auf dem MP3-Player kam, das Display zeigte die jeweilige Lautstärke an.
Ich musste mir nicht lange zuhören. Er nahm das Gerät wieder an sich, er schaltete es erst ab, als es schon fast wieder in seiner Westentasche verschwunden war. Er sagte, ich solle über ihn schreiben. Ehe ich irgendetwas sagen konnte, fuhr er fort, keine Biografie. Eine Erzählung, einen Roman oder einen Essay. Ich sagte, aber ich schreibe keine Reklame. Er sagte, beim Schreiben über Kunst gebe es keine Reklame oder alles sei Reklame, es sei das Gleiche. Er lade mich ein, zu Messen, zu Vernissagen, ich würde Zeuge von Gesprächen mit Künstlern und Künstlerinnen und bei Verhandlungen mit Sammlern und Sammlerinnen dabei sein. Ich würde Zugang zu allen Informationen haben, die mir nötig dünkten. Überhaupt keine Bedingungen. Wenn ich mich entschiede, doch nichts zu schreiben, werde er mir nicht böse sein. Er beanspruche keine Rechte an dem Manuskript. Er werde vorher eine von seiner Rechtsanwaltskanzlei aufgesetzte Erklärung unterzeichnen, dass er grundsätzlich darauf verzichte, wegen irgendeiner Persönlichkeitsrechtsverletzung in irgendeiner meiner Veröffentlichungen gegen mich vorzugehen. Seine Freundlichkeit war eine gänzlich andere als diejenige seiner Mitarbeiterin am Telefon. Es war die freundliche Bestimmtheit eines Vorgesetzten, der seinem Untergebenen einen Auftrag erteilt, der nicht zu dessen Standardrepertoire gehört.
Ich bin kein Kunstkritiker, ich bin auch kein Literaturkritiker. Ich habe lediglich zwei oder drei nachdrücklich eingeforderte Besprechungen von Romanen verfasst, deren Verfasser entweder nicht mehr unter den Lebenden oder sehr weit weg von mir und meinen Interessen waren. Wollte Georg Voigtländer, dass ich als eine Mischung aus Kunst- und Literaturkritiker, falsch: Literatur- und Kunstkritiker fungierte?
Ich fragte ihn, warum ich. Er ging nicht auf die Frage ein, sondern fragte seinerseits, ob ich schon einmal in Hongkong gewesen sei. Ich schüttelte den Kopf. Die Messe in Hongkong sei im März, die Galerie werde mir das Flugticket schicken und das Hotelzimmer reservieren, alle anderen Kosten trage ebenfalls die Galerie. Er nickte, als hätte ich ja gesagt und er würde unsere Abmachung bestätigen. Er erhob sich, wandte sich jedoch nicht sofort zum Gehen, sondern blieb stehen, als ob ich doch noch nicht ja gesagt hätte. Jetzt nickte ich. Das Ticket und alle notwendigen Unterlagen würden mir nächste Woche zugehen. Er beschloss die Unterredung mit dem Satz: »Erfinden Sie mich.« Er war aufgetreten, als hätte er niemals den geringsten Zweifel daran gehabt, dass ich in seinen Vorschlag einwilligen würde. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass er überheblich oder hoffärtig gewesen wäre.
Georg Voigtländer wollte keinen Dokumentaristen und keinen Hagiographen, der Anschluss an die Kunstwelt oder das Fehlen eines solchen spielte keine Rolle. Ich war für sein Vorhaben qualifiziert, weil ich das Thema Biografie in dem Roman, den er kannte, auf eine besondere Weise anging. So legte ich es mir jedenfalls zurecht. Der Ich-Erzähler im Roman, ein Schriftsteller, soll den Roman eines anderen Schriftstellers, der ein Bestseller-Autor ist und mit seinem Manuskript nicht weiterkommt, fertigschreiben. Der Bestseller-Autor eignet sich die Kindheit des nichtsahnenden Ich-Erzählers an. Er schreibt einen anderen Roman, dessen zentraler Bestandteil die Kindheit des Ich-Erzählers ist. Dieser Roman wird ein Bestseller, der von dem Bestseller-Autor angefangene und von dem Schriftsteller zu Ende geschriebene Roman erscheint nie. Der Plot meines Romans ist frei erfunden, aber die Kindheit, die dem Ich-Erzähler entwendet wird, ist offensichtlich meine Kindheit. Ich bezweifelte, dass Georg Voigtländer weitere Bücher von mir gelesen hatte.
Ich war mir sicher, dass Georg Voigtländer sich nicht dafür interessierte, wie der Ich-Erzähler in dem Roman eine Poetik aus seiner Handschrift entwickelt. Er behauptet, dass er beim Schreiben mit der Hand die Eigenschaften der Gegenstände kennenlerne. Ich habe nur meinen allerersten Roman mit der Hand geschrieben, es ist so mühsam, es geht so langsam. Wenn man umstellen will, muss man schnipseln, die Finger pappen vom Klebstoff, mit dem man die Schnipsel neu zusammenfügt. Ich diktiere die Rohfassungen meiner Romane, diktieren macht frei. Die weiteren Fassungen erstelle ich dann am Computer. Meine Essays schreibe ich von vornherein auf dem Computer. Für Essays bringt Freiheit nichts. Essays bestehen darin, dass man eine bestimmte Strecke geradeaus denken muss und dass man nicht poetisch wird, um logische Lücken aufzufüllen oder sie zu camouflieren.
Zuerst dachte ich an mich und dann an alles andere. Ich bin Schriftsteller. Die Konjunktion dieser beiden Sätze kommt mir fast wie eine analytische Wahrheit vor. Aber dann dachte ich an Georg Voigtländer und über mein Zusammentreffen mit ihm nach. Ein Galerist muss eine soziale Kreatur sein. Egal, ob der Galerist neue Arbeiten präsentiert oder ob er einmal verkaufte Arbeiten noch einmal verkauft, ob der Schwerpunkt der Primärmarkt oder der Sekundärmarkt ist. Ich malte mir als Galeristen jemanden aus, der sich keine Show in einer Galerie und keine Museumsausstellung entgehen lässt, der in unentwegtem Kontakt mit seinen Künstlern und Künstlerinnen und seinen Kunden und Kundinnen ist, der keine soziale Gelegenheit auslässt, bei der er potenzielle Käufer und Käuferinnen für seine Kunst interessieren kann – Jane Austen sagt: »Everything happens at parties.« Ein Galerist ist kein Beobachter erster oder gar zweiter Ordnung, er ist kein teilnehmender Beobachter, sondern ein beobachtender Teilnehmer. Ein Galerist weiß, wie man sich Freunde macht, sowohl bei den Künstlern und Künstlerinnen wie bei den Sammlern und Sammlerinnen, bei den Kuratoren und Kuratorinnen, die nicht-private Ausstellungen verantworten. Die Künstler, die Sammler, die Kuratoren sollen denken, dass der Galerist ihr Freund ist.
Gegenüber den Künstlern und Künstlerinnen muss der Galerist unterwürfig sein. Wenn der Künstler etwas will, muss der Galerist, ohne zu überlegen, sagen: »Gut!« Auch wenn der Wunsch des Künstlers absolut unrealisierbar oder viel zu teuer ist. Der Galerist muss ihn oder sie behutsam davon abbringen. Im Umgang mit den Sammlern und Sammlerinnen muss der Galerist entweder unterwürfig oder charmant sein. Unterwürfigkeit ist vor allem dann gefragt, wenn die Show weit davon entfernt ist, ausverkauft zu sein. Das angestrebte Gegenteil geringer Verkäuflichkeit ist die Warteliste. Es wird immer Wartelisten geben, auch wenn es keine Kunst mehr geben sollte, was unwahrscheinlich ist. Die Warteliste muss mit Charme verwaltet werden. Gesammelt wird, was knapp ist. Wer etwas verkaufen will, kann sich Unhöflichkeit nur dann leisten, wenn die Sache wirklich irre knapp ist. Aber so knapp ist Kunst niemals. Es gibt immer noch eine andere Arbeit, die irgendwie mit der zur Diskussion stehenden Arbeit vergleichbar ist. Außerdem: Wenn Kunst wirklich irre knapp ist, dann landet sie aller Voraussicht nach weder in der Galerie Georg Voigtländer noch in einer anderen Galerie, sondern bei Christie’s oder Sotheby’s.
Ein Galerist muss begeistert sein. Er lässt sich überwältigen – früher sagte man übermannen –: von den neuesten Arbeiten des Künstlers oder der Künstlerin, von seinen oder ihren Plänen, von der Sammlung des Sammlers oder der Sammlerin, von dessen oder deren Geschmack, Weitsicht etc. Der Galerist ist professionell naiv. Es ist nicht der Job des Galeristen, cool zu sein. Was nicht heißt, dass ein Galerist uncool sein darf. Die Kunden und Kundinnen sind in jedem Falle cool, die Künstler und Künstlerinnen dürfen sich aussuchen, ob sie cool oder uncool sein wollen.
Als Georg Voigtländer mich rekrutierte, war er cool. Das Gegenteil von unterwürfig, von Charme keine Spur, Freundschaft nein danke. Das glatte Gegenteil von the life of the party. Niemand würde auf den Gedanken kommen zu sagen: ›Georg Voigtländer is easily getting carried away.‹
Warum gab ich mir solche Mühe, mein Wunschbild eines Galeristen in allen Einzelheiten auszumalen? Kunst drückt Ideen aus. Ein Galerist verbindet bisher unverbundene Ideen, indem er deren Träger verbindet. Nicht nur Sammler mit Künstlern, von denen die Sammler noch keine Arbeiten gekauft haben, nicht nur Sammlerinnen mit neuen Arbeiten von Künstlerinnen, von denen sie bereits Arbeiten gekauft haben, Künstler mit Ausstellungsmachern, mit Museen, Sammler mit Museen, mit Ausstellungsmachern, Künstler, Sammler, Ausstellungsmacher mit Ideen, Ideen mit Ideen und und und. Das geht doch nur, wenn der Galerist ein Socialite ist. Soweit der offizielle Teil.
Der inoffizielle Teil: Als Schriftsteller bin ich schließlich auch ein Künstler. Georg Voigtländer machte mir nicht nur keine übertriebenen, sondern gar keine Komplimente für meine Literatur. Georg Voigtländer hatte einen Mitschnitt meiner Lesung, er wollte mich unbedingt treffen. Dann hätte er sich doch eine Spur unterwürfig, in Maßen begeistert, im Ansatz charmant zeigen können –
Ich glaubte Georg Voigtländer, dass es ihm nicht um Reklame ging. Für Reklame gibt es wirkungsvollere Lösungen als mich. Früher eröffnete ein Bildnis von Künstlerhand einen Blick in die Seele der dargestellten Person. Jedenfalls formulierte man das so. Auf diese Weise leistete die Kunst einen Beitrag, den Begriffsumfang von Seele festzulegen. Es kommt auch heute noch vor, dass ein Kunstwerk versucht, die Seelen von Personen zu vergegenwärtigen. Aber viel häufiger werden die Umstände und Nebenbedingungen vergegenwärtigt, unter denen sich die Seelen der Personen bilden und entwickeln. Oft spart die Inszenierung genau den Teil des Menschlichen aus, der früher im Zentrum stand. Ich kann ohne Hypothesen nicht leben: Georg Voigtländer glaubte nicht, dass die Kunst seiner Seele gerecht werden konnte. Georg Voigtländer versuchte es mit der Literatur.
Georg Voigtländers CV legte zwei Fragen mehr als nahe: Warum wurde er Galerist? Hier war eine Fallunterscheidung zu machen: Deutete etwas während seiner Zeit in der komplett nichtkünstlerischen Familienfirma auf diese Möglichkeit hin oder nicht? Brachte er etwas zur Entfaltung, was bereits angelegt war, oder hat er sich selbst vollständig neu erfunden? Unabhängig von der ersten Frage die zweite: Warum wurde er ein so erfolgreicher Galerist?
Georg Voigtländers Rausschmiss aus der Familienfirma hatte ein Trauma bedeutet. Aber dieses Trauma erklärte noch keineswegs das, was darauf folgte. Eine weitere Hypothese: Georg Voigtländer misstraute seinem eigenen Trauma. Dem begegnete ich mit großer Sympathie. Die Hauptfigur meines vorletzten Romans ist eine Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapie, die gerade ihre Praxis aufmacht. Sie hasst Die Ursache. Für sie ist Die Ursache eine Narretei, eine unsinnige Fixierung, eine Obsession. Irgendwie findet man bei jedem und bei jeder eine Mischung aus unguten Erinnerungen und einem nicht sehr gut funktionierenden Erinnerungsvermögen, das nennt man dann Trauma. Anschließend wird gemeinsam daran gebastelt, die Erinnerungen in einen einigermaßen logischen Ablauf zu bringen und sie in einem freundlicheren Licht erscheinen zu lassen. Was klagen die Inhaber und Inhaberinnen von Traumata, sie haben doch eine Beschäftigung! Jeder will die Ursache von etwas sein, wenn er oder sie das nicht schafft, muss es eine Ursache geben, warum ihm oder ihr das nicht gelingt. Die Ursache soll eine Therapie gegen das Dasein bilden. Aber es gibt keine Therapie gegen das Dasein. Mit Ursachen kommt man nicht um das Dasein herum.
Für die Kollegen und Kolleginnen der Therapeutin und die Klienten ist Die Ursache ein Schubladensystem. In irgendeiner Schublade endet jeder Klient, dafür sorgen schon DSM und ICD, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, und der Klient oder die Klientin. Die Gesellschaft und das Girokonto des Therapeuten oder der Therapeutin sind‘s zufrieden. Die Ursache ist ein anspruchsloses, unanstrengendes Gewerbe.
Die Therapeutin in meinem Roman hat keine Ziele, mit Zielen würde das Leben für sie jeden Reiz verlieren. Sie findet, dass allein das bloße Lebendigsein unglaublich anstrengend ist. Bereits das Nichtstun ist kräftezehrend, jedes Erleben ist strapaziös. Es bleibt offen, ob die minimale Anzahl der Klienten der Therapeutin einem kausalen Nexus zu ihrem Nicht-Glauben an Die Ursache oder ihrer Ausstrahlung geschuldet ist, dass das Lebendigsein für sie mit einer außergewöhnlichen Anstrengung verbunden ist.
Wusste Georg Voigtländer tatsächlich nicht, warum er Galerist geworden war? Hatte sich das einfach so ergeben? Oder wollte Georg Voigtländer den Grund einfach nicht wahrhaben? Ich sollte möglichst andere Gründe finden? Aber wie passte meine Ursachenverachtung mit meiner spontanen Bereitschaft zusammen, mich im Fall von Georg Voigtländer auf einen Ursachentrip zu begeben? Georg Voigtländers Ursache hatte eine andere Qualität – jedenfalls wollte ich das so haben.
Ich weiß, warum ich Schriftsteller geworden bin. Ich hatte den Mann ohne Eigenschaften wiedergelesen und daraufhin die Absicht begraben, akademischer Philosoph zu werden. Ich habe Philosophie studiert und wollte eigentlich eine Karriere als akademischer Philosoph machen. Aber das akademische Publikationssystem stieß mich ab. Der eigene Gedanke hat in der Regel einen höchstens einstelligen Prozentanteil am Gesamtumfang des Papers. Das Wichtigste ist die Antizipation von Einwänden. Das Verfassen eines philosophischen Papers weist unübersehbare Ähnlichkeiten mit der Konzeption eines Produktes auf: Produkte werden für Zielgruppen entwickelt, Papers für Zielgruppen geschrieben. Wer sind die Editors? Wer sind die Referees? Sie sorgen dafür, dass die Zielgruppen bekommen, was sie verdienen. Die Begutachtung ist anonym, aber man kennt den Kreis, aus dem die Gutachter kommen. Man weiß nicht ganz genau, was sie wollen, aber man weiß ziemlich genau, was sie nicht wollen. Es macht keinen Sinn, den Originalhelden zu spielen. Man muss die Dinge erwähnen, die den Gutachtern teuer sind. Dinge, über die die Gutachter die Nase rümpfen, dürfen nicht vorkommen. Den eigenen Gedanken muss man extrem vorsichtig einführen, am besten derart, dass er sich aus dem Wissen und den Einstellungen der Adressaten ergibt. Unablässig, unaufhörlich, unausgesetzt muss man auf mögliche Einwände eingehen.
Als Gymnasiast hatte ich den Mann ohne Eigenschaften gelesen. Ich habe sehr viele Romane gelesen, aber ich hatte nie die Absicht, Schriftsteller zu werden. Das Wiederlesen war eine Epiphanie: Ich sah Möglichkeiten, von denen ich nicht einmal geträumt hatte. Ich hatte erkannt: Literatur ist eine Möglichkeit, Philosophie zu betreiben.
Bei der Art Basel in Basel und bei der Art Basel Miami Beach gibt es Previews für die wichtigen Sammler und Sammlerinnen. Ein wichtiger Sammler oder eine wichtige Sammlerin ist jemand, der einen höheren sechsstelligen oder einen siebenstelligen Betrag ausgibt. Die VIP Preview bei der Art Basel Hongkong heißt nur so. Es ist keine exklusive, sondern eine inklusive Veranstaltung, es geht zu wie auf dem Oktoberfest am Samstagnachmittag. Jemand erklärte mir später, die Hälfte der Karten werde vom Messeveranstalter vergeben, die andere Hälfte von den Ausstellern. Die Messegesellschaft traue sich nicht, eine Selektion wie in Basel und Miami durchzuführen, die Hackordnung in der chinesischen Kunstwelt sei unklar, man wolle nicht das Risiko eingehen, wichtige Akteure zu verärgern.
Die Liste der Aussteller in den beiden Hallen des Hong Kong Convention and Exhibition Centre umfasste 248 Galerien. Wenn jede Galerie zweieinhalb Künstler beziehungsweise Künstlerinnen präsentierte, wurden 620 Künstler und Künstlerinnen gezeigt. Es ist nicht einfach, die Anzahl der auf einer Messe gezeigten Arbeiten zu schätzen. Oft bilden mehrere Objekte eine Arbeit, das gilt insbesondere für serielle Produktionen. Einige Galerien stellen nur zwei oder drei Großarbeiten aus, andere ein oder zwei Dutzend Arbeiten. Manche Arbeiten werden gar nicht präsentiert, sie bleiben in den Kabinen. Ich nahm als Durchschnitt zehn Arbeiten, das machte 2480 gezeigte Arbeiten.
Die Preview begann um zehn Uhr, ich würde zu spät kommen. Obwohl ich sonst nie zu spät komme. Als ich vom Frühstückstisch aufstehen wollte, war ich dazu nicht imstande. Ich spürte einen stechenden Schmerz im rechten Bein unterhalb der Kniekehle. Ich ließ mich auf den Stuhl zurückfallen, der Schmerz ebbte ab. Während des Fluges hatte ich einen Krampf gehabt, oder ich hatte geträumt, dass ich einen Krampf gehabt hätte. Ich konnte es danach nicht auseinanderhalten. Sonst habe ich nie muskuläre Probleme. Ich neigte dazu anzunehmen, dass ich nur geträumt hatte. Der Schmerz war derselbe, aber jetzt träumte ich auf keinen Fall.
Ich atmete tief durch, wartete eine Zeitlang und versuchte erneut, mich zu erheben. Der Schmerz war mindestens so schlimm wie beim ersten Mal. Ich ließ mich wieder zurückfallen. Schließlich glaubte ich, die Lösung gefunden zu haben. Ich stützte mich beim Aufstehen mit der linken Hand auf dem Tisch ab, ohne das rechte Bein zu belasten. Aber das nützte nichts. In dem Augenblick, als ich anfing, das rechte Bein zu strecken, wurde der Schmerz schlimmer denn je. Es war, als wäre ich angekettet und die Kette war mit Widerhaken in den Muskeln unterhalb der Kniekehle befestigt. Ich stöhnte und presste die Lippen aufeinander, um nicht laut zu schreien. Ich erwartete, dass sich jeden Augenblick meine Hose blutig durchtränken würde.
Ich fühlte mich wie ein Avatar mit einer Fehlfunktion. Der Avatar scannte seine Umgebung. Ein vielfältiges, trockenes, knackendes Rumoren von mechanischen Rechenmaschinen mit belastbaren Gelenken, um alles zu zermahlen, zu zerkauen und zu verschlingen. Üblicherweise gibt es in Hotels, die keine Resorts sind, jede Menge von Einzelgästen, die mit nichts und niemandem reden. Hier nur ein einziger Tisch mit nur einer Person: mein Tisch. Der Raum war angefüllt mit Unterhaltungen, keine einzige zu laut. Kein Tisch, an dem nicht gesprochen wurde. Niemand, der nichts mit Kunst zu tun hatte. Flugzeugladungen von Galeristen, Galerieangestellten, Sammlern, Museumsdirektoren, Kuratoren, Ausstellungsmachern, Kunsttouristen. Jede Stimme ging in eine andere Stimme über. Nur eine Geräuschart kontrapunktisch: das scharfe Scharren zurückgeschobener Stühle.
Ich nahm mir vor, beim nächsten Versuch keine Rücksicht auf die Schmerzen zu nehmen. Da ich damit rechnete, meine Schmerzäußerungen nicht in gewünschtem Ausmaß unterdrücken zu können, musste ich warten, bis sich das jetzt komplett besetzte Restaurant zumindest etwas geleert hatte. Das konnte nicht zu lange dauern, denn die Anwesenden hatten alle den gleichen Termin. Insbesondere war es sinnvoll, darauf zu warten, dass die Tische unmittelbar um mich herum nicht mehr besetzt waren. Ich beschloss, mir die Zeit zu vertreiben, indem ich mir Fragen überlegte, die ich bei Gelegenheit an Georg Voigtländer richten würde.
›Kennen Sie alle Werke aller Künstler und Künstlerinnen, die Sie vertreten?‹ Kaum hatte ich die Frage im Geist ausformuliert, zog ich sie auch schon zurück. Kein anderes menschliches Betätigungsfeld ist so gut dokumentiert wie Contemporary Art. Es gibt ständig mehr Galerien, ständig mehr Museen, ständig mehr Ausstellungen, ständig mehr Messen. Jede Institution und jedes Event produziert eine Dokumentation, einen Katalog, ein Buch, eine Broschüre, eine Online-Darstellung. Nie war es für Sammler und Sammlerinnen leichter, sich einen lückenlosen Überblick über das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin zu verschaffen. Die Gegenwart frisst die Gegenwart. Die Gegenwart frisst auch die Vergangenheit. Für die klassische Moderne und für alles, was davor war, wird die Dokumentation nachgeholt, den Task erledigen die großen Auktionshäuser. Auch früher kannten die Galeristen alle Werke ihrer Künstler, sie hatten sie im Kopf oder in Karteien, als Fotos oder Ektachrome. Eine falsche Analogie zur Literatur hatte zu der Frage geführt. Wenn man über einen Autor oder eine Autorin spricht, ist es nützlich zu wissen, wie viele und welche Bücher das Gegenüber gelesen hat. Da hilft das Internet mit den Auflistungen der Bücher des Autors oder der Autorin nicht.
›Welche Rolle spielt das Geld für Sie, für Ihre Künstler, für Ihre Sammler?‹ Auch diese Frage würde ich nicht stellen. Die Frage war wie eine Schacheröffnung, die zum schnellstmöglichen Verlust der Partie führt. Es gab nur eine Antwort: ›Meine Künstler und meine Sammler interessiert Geld nicht, und mich interessiert es schon überhaupt nicht. Meine Künstler, meine Sammler und mich interessiert nur eins: gute Kunst.‹
Aber die Antwort auf alle anderen Fragen, die mir einfielen, war ebenfalls: ›gute Kunst‹. Es blieben zwei Fragen übrig, die Georg Voigtländer nicht so leicht beantworten konnte: ›Haben Sie auch Künstler oder Künstlerinnen, die Sie nicht ausstehen können?‹ Und: ›Wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen die neuen Arbeiten eines Künstlers oder einer Künstlerin, den oder die Sie vertreten, nicht gefallen?‹ Die erste Frage konnte er noch mit ›gute Kunst‹ beantworten. Doch die zweite? Wahrscheinlich würde er den long run ins Feld führen. Das unerwartete Nebenprodukt meiner vergeblichen Bemühungen um ergiebige Fragen bestand darin, dass ich noch ein Stück besser zu verstehen glaubte, warum Georg Voigtländer gerade mich engagiert hatte: Er wollte ein Format haben, das ihn nicht zwang, aber und abermals mit ›gute Kunst‹ zu antworten.
Der Raum hatte sich völlig geleert, ich war der letzte Gast. Ohne Umstände unternahm ich es, mich zu erheben, und es gelang mir. Ich hatte keinerlei Schmerzen, jedoch eine merkwürdige Beziehung zu meinem rechten Bein: Unterhalb des Knies spürte ich es nicht mehr. Es war, als hätte man das Bein amputiert, keine Phantomschmerzen. Trotzdem konnte ich das Bein kontrollieren. Ich war imstande, problemlos aufrecht zu stehen und mich fortzubewegen. Beim Verlassen des Saals drehte ich mich um, als ob ich erwartete, dass an dem Platz, an dem ich das Frühstück eingenommen hatte, mein abgetrennter rechter Unterschenkel lag und die Kette oder Fessel mit den Widerhaken, die mir solche Schmerzen bereitet hatten.
Auf der Fußgängerbrücke, die das Hotel unmittelbar mit dem Convention and Exhibition Centre verband, floss der Fußgängerstrom nur in eine Richtung: zu dem Ausstellungskomplex. Nicht ein einziger Fußgänger nahm die Gegenrichtung. Alle waren dunkel angezogen, Schwarz, Grau, das verwaschene Dunkelblau von Jeans, kein einziges grelles T-Shirt, auch keine zurückhaltenden hellen Farben, nur das vereinzelte Weiß der Hemden und Blusen von Anzugträgern und Kostümträgerinnen. Mich dem Strom anpassend, ging ich viel schneller als gewöhnlich. Als ich auf meine Füße blickte, stellte ich erstaunt fest, dass ich nicht mehr ging, sondern langsam lief, in einer Art Trab, wie die anderen. Nach wie vor war mein rechter Unterschenkel taub. Die Brückenbenutzer konnten nicht alle das Convention and Exhibition Centre zum Ziel haben. Wohin strebten sie? Warum hatten sie es so eilig?
Die Rolltreppen, die wieder zum Ground level führten, hatten eine beachtliche Kapazität, trotz des Andrangs war der Stau nicht groß. Der Mann, der vor mir die Rolltreppe betreten sollte, ging auf einmal nicht weiter. Er ließ seine herunterhängenden Arme pendeln, er machte Tippelschritte auf der Stelle, er spreizte die Finger, es sah aus, als ob eine menschliche Gestalt den Kontakt zum Boden verloren hatte und vom Wind gezaust wurde. Ich konnte nicht sehen, ob es ein Chinese oder ein Europäer oder ein Amerikaner war. Die Rolltreppe war breit genug, so dass andere Fußgänger rechts und links an dem Mann vorbei gelangen konnten, aber diejenigen hinter mir drängten nach. Der Druck war erst gering und wuchs dann, erstaunlich erfolgreich leistete ich Widerstand. Auch dabei behinderte es mich nicht, dass mein rechter Unterschenkel taub war. Der Mann vor mir machte eine ausgreifende Bewegung mit dem rechten Bein, als ob er die Rolltreppe jetzt doch betreten wollte, aber dann zog er das Bein wieder zurück. Er vollführte die gleiche Bewegung mit dem linken Bein, um es ebenfalls zurückzunehmen. Schließlich ging er mit ganz kleinen Schritten unwiderruflich vorwärts, er kam mit dem vorderen Fuß auf die gerade herausfahrende Stufe der Rolltreppe, er verlor das Gleichgewicht, er schwankte gefährlich, trotzdem ging er weiter und kam schließlich auf der Rolltreppe zum Stehen. Er fuhr die Rolltreppe hinunter, als sei nichts gewesen. Ich betrat die Rolltreppe nicht sofort hinter dem komplett in Schwarz gekleideten Mann. Nach seinem Verhalten war es sinnvoll, Abstand zu halten. Damit verwirrte ich die Fußgänger unmittelbar hinter mir, die damit gerechnet hatten, dass ich unverzüglich weitergehen würde. Sie drängten sich nicht mehr an mir vorbei, sondern stießen mich auf die Rolltreppe.
In der Halle waren an der Decke Billboards aufgehängt. Von einem löste sich ohne erkennbaren Anlass ein Plakat, man hatte es unsachgemäß aufgeklebt oder fehlerhaft festgeklemmt. Das Plakat war in der Mitte gefaltet gewesen und faltete sich zurück, ein großes V, das flatterte. Ich musste an ein riesiges vogelähnliches Lebewesen denken, wie es sie auf der Erde nicht mehr gibt. Es kam erst auf den Mann in Schwarz vor mir zu, überlegte es sich dann jedoch anders, ging vom Sturzflug in einen langsamen Gleitflug über und peilte mich an. Ich hatte keine Angst, denn das Lebewesen war ja aus Papier. Der urzeitliche Vogel hatte den Mann vor mir und mich gemustert, beide hatten wir kein weiteres Interesse geweckt, er drehte sanft ab. Ich blickte dem Urvogel nach, er verschwand unter der Rolltreppe und strebte dort wohl einem Ausgang zu. Erst später wurde mir bewusst, dass die Angstlosigkeit unvernünftig gewesen war, die Kanten konnten mit Kleber verstärkt und vielleicht sogar scharf gewesen sein, auch hätten sich Befestigungsteile daran befinden können.
Auf dem Ground level bewegten sich die Menschen mit normaler Gehgeschwindigkeit fort. Sie verließen das Gebäude, wenn sie nur die Fußgängerbrücke benutzt hatten, oder verteilten sich in dem Gebäude, das auch Geschäfte und Büros beherbergte. Den Schildern gehorchend, bog ich links ab zu dem Gebäudeteil, der die Messehallen beherbergte. Als ich mich der Messe näherte, begannen die Menschen um mich herum wieder zu laufen.
Die Menschen waren die Grundmaterie in der Halle, sie war nicht verteilt und schon gar nicht zerstreut, das war nicht möglich, dazu waren es zu viele. Die Menschen verschmolzen mit dem Inhalt der Halle, sie konnten ihn nicht bedecken, aber sie konnten ihn verdecken. Sicher gab es an den Schienen für die Strahler auch Kameras. Hätte ich zu dem Überwachungsraum Zutritt gehabt, ich hätte mich von den Aufnahmen nicht losreißen können. Die Grundmaterie der Menschen dunkel, formlos, ohne menschliche Spuren. Die Objekte in den Abteilen und außerhalb, die nicht völlig verdeckt waren, sie waren Überbleibsel, wovon? Oder natürliche Auswüchse, wovon? Düsterer Schaum, trübe Kämme, lichtlose Wirbel – ich hätte die Bilder mit einer unbestimmt beschämten, vage schuldbewussten Faszination betrachtet, als würden sie die Antwort auf ein grundlegendes Geheimnis in sich tragen. Ich hätte mich ewig in die Betrachtung der gräulichen Weiten vertieft.
Die Gesprächsfetzen, die ich im Vorbeigehen mitbekam, signalisierten entweder schnatternde Schimpftiraden oder autoritäre Grabesklänge, letztere mit Nachhall wie Stimmen von Wahrsagern oder Orakeln. Als Kontrast das redselige Klirren von viel zu laut abgehörten Mailboxen. Aufgewühlt bis ins Allerinnerste – in meinem Leben war ich noch niemals so vielen Menschen so nahe gewesen wie in der knappen halben Stunde, in der ich mich vom Hotel in die Messehalle begeben hatte –, erreichte ich den Stand der Galerie Georg Voigtländer. Trotz meiner kreischenden Erregung hatte ich keinen Orientierungsfehler begangen und den Stand auf dem kürzest möglichen Weg erreicht.
– Ich habe die Schule geschwänzt und bin ins Museum gegangen.
– Ich habe Tagesausflüge gemacht, um Ausstellungen zu sehen.
– Ich erkundigte mich bei dem Buchhändler, der die Kunst Nachrichten hatte, nach bevorstehenden Vernissagen.
– Ich bezahlte einen Schulkameraden, dessen Eltern Einladungen zu Vernissagen bekamen, damit er die Einladungen aus der Post entwendete.
– Ich mischte mich uneingeladen unter die Vernissage-Gäste.
– Ich gab mich als der Sohn der Eltern aus, denen die Einladungen zu den Vernissagen galten.
– Ich habe mit siebzehn einen Siebdruck von Diter Rot gekauft. Man nannte das damals Serigraphie.
– Ich habe mit sechzehn eine Arbeit von Paul Thek gekauft.
– Ich habe mir das Geld von meiner Lieblingstante geliehen. Ich habe ihr gesagt, ich hätte mit dem Auto meiner Mutter ohne ihr Wissen eine Spritztour gemacht und es beschädigt, meine Mutter sei verreist, ich brauchte das Geld für die Reparatur, meine Mutter solle nichts merken.
– Mein Vater hatte immer sehr viel Bargeld bei sich. Ich habe das Geld aus seinem Portemonnaie in der aufgehängten Jacke genommen.
– Ich habe meiner Tante das Geld nie zurückgezahlt.
– Mein Vater hat nie gesagt, dass ihm Geld fehlte.
– Ein viereckiger Glaskasten mit Holzrahmen auf einem weißlackierten Sockel. In dem Glaskasten ein schwarzes Elektrokabel mit verschmorter Aufnahme, auf dem Sockel außerdem Lederbänder mit Schließen und US-amerikanische Identitätspapiere. Niemand, der die Arbeit bei mir zu Hause gesehen hat, kam auf den Gedanken, dass das eine Skulptur war. – Ich habe die Arbeit heute noch, sie steht zwischen –
– Ich habe die Arbeit in meinem Büro.
Der Mann mit dem Diter Rot war Georg Voigtländer, der Mann mit dem Paul Thek ein deutscher Sammler. Ich hatte mich nicht unmittelbar neben Georg Voigtländer und den Sammler gestellt, aber die Distanz so gewählt, dass ich gerade noch mithören konnte, was gesprochen wurde. Dazu fühlte ich mich berechtigt, denn Georg Voigtländer hatte schließlich von etwas wie einer umfassenden Zeugenschaft gesprochen.
Der Dialog wurde dadurch unterbrochen, dass Georg Voigtländer zu einem alten, verstaubten Nadeldrucker blickte, der plötzlich loszurattern begann. Auf dem grün-weiß gestreiften Endlospapier lasen Georg Voigtländer und ich, der deutsche Sammler hielt es nicht für notwendig, in die Richtung des Druckers zu blicken: Hello Mr, dann folgte ein chinesischer Name, in mehrfacher Wiederholung. Ich mutmaßte, dass der Drucker an ein Gesichtserkennungssystem angeschlossen war, das die Besucher des Standes identifizierte, natürlich nur die bekannten Kunden und Kundinnen der Galerie. Ich musterte den Stand und sah hoch, aber ich konnte keine Kameras entdecken.
Ich sollte, ich konnte über Georg Voigtländer schreiben, was ich wollte, wie ich wollte. In keiner Dimension gab es Beschränkungen, die Freiheitsgrade waren maximal, es lag an mir, sie zu reduzieren. Ich etablierte Beschränkungen durch Auswahl, jede Beschränkung war meine Beschränkung. Es war meine Entscheidung, ob Georg Voigtländer in dem, was ich schrieb, als Ursache figurierte oder ob er nur der oder ein Anlass war. Mit dem Entschluss zu Ursache oder Anlass war die Frage Roman oder Essay noch keineswegs entschieden. Georg Voigtländer konnte sowohl Ursache wie Anlass für einen Roman oder einen Essay bilden.
Meine erste Begegnung mit der Ursache lief sehr deutlich darauf hinaus, dass es für die Kunst keine Ursache gab oder besser geben sollte. Ich hatte einmal ein Buch über berühmte Ökonomen gelesen, die meisten waren Nobelpreisträger. Alle wollten eigentlich etwas anderes studieren. Sie hatten sich nie für Ökonomie interessiert, landeten dann aber genau dort. Ein Erweckungserlebnis? Fehlanzeige. Warum sollte das für die Kunst nicht stimmen. Der Unterschied zwischen der Kunst und der Ökonomie – als Theorie –: In der Kunst haben sich alle schon immer für Kunst interessiert. Angeblich. Iwan Wirth, der Gründer von Hauser & Wirth, der deutsche Sammler, Georg Voigtländer.
Ich hatte kein inhaltliches Konzept aufgestellt, an das ich mich halten wollte. Ich hatte mir jedoch ein formales Prinzip vorgegeben, das invariant war in Bezug auf die Art und Weise, wie ich über Georg Voigtländer schreiben wollte. Es lautete: Nenne keine Namen – abgesehen von den Namen der Handelnden. Ich habe den Namen Schelchshorn erwähnt. Hier habe ich nicht gegen mein Prinzip verstoßen, denn Frank Schelchshorn war ein Künstler der Galerie und würde zum Handelnden werden. Meinem Vorsatz folgend, habe ich den Verfasser des Mannes ohne Eigenschaften nicht genannt. Vorher ist mir allerdings schon Jane Austen durchgerutscht. Das ließe sich noch beheben. Aber die nächsten Namen sind dann Diter Rot und Paul Thek.
Der Anlass meines Prinzips war The Blazing World von Siri Hustved. Das Buch – a scathing portrait of the art world, so ein Blurb auf dem Buchumschlag – ist der Versuch einer Simulation eines Romans über Kunst. Eine nicht mehr junge, finanziell vorteilhaft verheiratete Künstlerin findet keine Anerkennung. Ihre Arbeiten werden ignoriert. Dieselben Arbeiten werden gefeiert, sobald sie als die Werke von drei Männern präsentiert werden. Einer der Männer, mit denen die Künstlerin zusammenarbeitet, bestreitet einen kreativen Anteil der Künstlerin an den Werken in seiner Ausstellung. Wer ist tatsächlich der Urheber beziehungsweise die Urheberin der Kunstwerke? Der Mann, der die Urheberschaft der Künstlerin an seinen Werken abstreitet, kommt in einer dieser Arbeiten, einer Mischung aus Skulptur und Performance, auf betont männlich dumme Weise ums Leben. The Blazing World – a polyphonic tour de force, ebenfalls der Buchumschlag – enthält genau XXX Namen von IRL existierenden oder existiert habenden Künstlern, Galeristen, Schriftstellern, Philosophen. Die lediglich zitiert werden. Ich habe nachgezählt und eine Excel-Datei erstellt. Ein Buch, das XXX Namen enthält, ist kein Roman, sondern eine Fleißarbeit. Etwas anderes wäre es, wenn es XXX fiktive Namen wären. Die Namen allein bedingen schon unwiderruflich thumbs down.
Ich finde, die letzten Schriftsteller, die Kunst beschreiben konnten, waren Samuel Beckett und Jean Genet, die Bilder von Bram van Velde und das Atelier Alberto Giacomettis. Nach dem Treffen mit Georg Voigtländer musste ich an Beckett und die Gucci-Tasche denken. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1971: Samuel Beckett blickt auf die Sonnenbrille in seiner rechten Hand, als wäre sie ein Mobiltelefon. Die Tasche, die Gucci in den späten sechziger Jahren Jackie-Bag taufte, nachdem Jackie Kennedy 1964 sechs Exemplare geordert hatte, ist ein runder, abgeflachter Sack mit einem Reißverschluss. Beckett hat den Riemen der Tasche über die linke Schulter gelegt. Es ist die einfachste Version der Tasche, ohne Muster und Applikationen, man kann nicht sagen, ob das Material Wildleder oder Stoff ist. Beckett trägt Cordhosen und einen dunklen Wollpullover mit Zopfmuster und V-Ausschnitt über einem schwarzen Rollkragenpullover. Es ist bekannt, dass er seine Haare mit Brylcreem in Form brachte. Die offensichtlich leere Tasche scheint nur auf diesem Foto auf, der Fotograf oder die Fotografin musste Beckett dazu gebracht haben, dass er mit der Tasche poste.
Beckett und Genet haben tatsächlich existierende Kunst beschrieben. Es macht keinen Sinn, als Schriftsteller Kunst, die nicht existiert, zu erfinden. Wenn die Kunst interessant wäre, dann gäbe es einen Künstler oder eine Künstlerin, die genau diese Kunst produzieren würde. Dann wäre der Schriftsteller oder die Schriftstellerin keiner oder keine, dann wäre er oder sie Künstler oder Künstlerin. Nicht existierende Kunst, die in Romanen beschrieben wird, ist ausnahmslos völlig uninteressant. Weil sie nur eine gänzlich überflüssige Variation von tatsächlich existierender interessanter Kunst ist.
Als John Voigtländer am Vortag den Namen Schelchshorn erwähnt hatte, da hatte ich mir vorgenommen, anstelle von Namen Variablen zu verwenden. Aber in dem Augenblick, in dem die Namen Diter Rot und Paul Thek zwischen Georg Voigtländer und dem Sammler fielen, wusste ich, dass ich in große Schwierigkeiten geraten würde. Bei der Wiedergabe des Gesprächs konnte ich die Namen Diter Rot und Paul Thek nicht einfach durch ein X und ein Y ersetzen. Paul Thek war kein Künstler aus der ersten Reihe, sondern ein Name für Eingeweihte. Wenn jemand erzählte, dass er im Jahr 1970 eine Arbeit von Paul Thek gekauft hatte, dann war ohne weitere Erläuterung klar: Der Käufer hatte sich für die absolute Avantgarde interessiert. Ersetzte ich in der Wiedergabe des Gesprächs von Georg Voigtländer mit dem Sammler den Namen Paul Thek durch ein Y, musste ich die entsprechende Information hinzufügen. Doch diese Art der Wiedergabe würde das Gespräch verfälschen. Wenn man der Konversation folgte und der Satz geäußert wurde, war sofort nach dem Ende des Satzes klar, was er bedeutete oder vielmehr bedeuten sollte. Eben, dass sich der Äußerer des Satzes extrem gut auskannte. Wenn ich Paul Thek durch Y ersetzte, dann war keine Richtung erkennbar, in die der Satz deuten sollte. Y konnte auch für Picasso stehen. Die unabdingbare Erklärung des Satzes ruinierte seine Akutheit.
Die einzige Möglichkeit, den Namen nicht zu nennen, bestand darin, die Konversation zwischen Georg Voigtländer und dem Sammler ersatzlos wegzulassen. Aber das war gleichermaßen eine Verfälschung des Romans oder Essays in progress. Nicht deshalb, weil es das erste Gespräch von Georg Voigtländer mit jemand anderem war, das ich verfolgte, oder weil es gewissermaßen mein erstes kommunikatives Messeerlebnis war. Georg Voigtländer hatte sich mit dem Sammler, mit dem Kunden, einen Wettstreit geliefert und verloren. Auch Diter Rot hatte im Jahr 1970 zur absoluten Avantgarde gehört, er war jedoch im deutschen Sprachraum durchaus bekannt gewesen. Der Sammler hatte einen Paul Thek gekauft, das war nicht zu toppen. Georg Voigtländer wollte, dass der Kunde gewinnt, wie ein Vater sich von seinem Kind beim Spiel besiegen lässt, um dem Kind ein Erfolgserlebnis zu vermitteln, welches das Kind anstachelt. Die Tokens dieser Verhaltensweise implizierten eine Bezugnahme auf ein konkretes Raum- und Zeitintervall und auf konkrete Handlungen. Teil der Bezugnahme sind konkrete Namen.
Georg Voigtländer war auch ein Social animal. Wenn ich dieses Gespräch nicht berücksichtigte, weil es Namen enthielt, dann würden im nächsten Gespräch andere Namen und im übernächsten Gespräch wieder neue Namen genannt werden. Ging ich auf alle diese Gespräche nicht ein, brauchte ich nichts zu schreiben. Ich verabschiedete mein Prinzip, keine Namen zu nennen und adoptierte eine Version von Ockham’s Razor: Nomina non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Ich würde Namen nur nennen, wenn das unumgänglich war, die Schranke für die Unumgänglichkeit jedoch möglichst hoch ansetzen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: