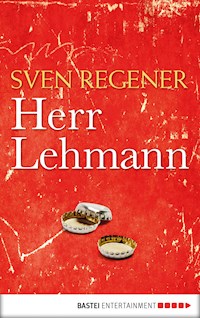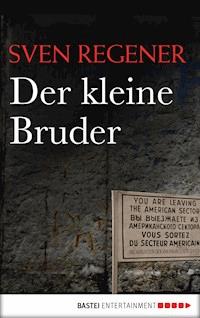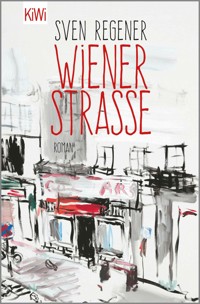18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Für die einen ist er ein lebendes Gesamtkunstwerk, das sich immer weiter vervollkommnet, für die anderen ein Popstar, der partout nicht lockerlässt, für die dritten wiederum ein unerschrockener Jäger des verlorenen Schatzes der Kulturindustrie: Andreas Dorau – viel bewundert, eigensinnig, genial. Und alle sind sich einig: Nichts ist so inspirierend wie dieser Meister der Exzentrik und des unauffällig Absurden, wenn er ausführlich, subtil und abgründig von sich und seinen Abenteuern nicht nur im Kunstbetrieb erzählt. Wer Sven Regeners Romane kennt, kann ahnen, warum er so viel Spaß daran hat, in Doraus schillerndes Universum einzutauchen und zu literarisieren, was dieser erzählt. Da gibt es einen Hypnosekönig, den Dorau aufsucht, um endlich zu erfahren, was er wirklich tief drinnen über seinen alten Freund Fred vom Jupiter denkt, die Panikattacke, die ihn als Adorno-Stimme in eine Verhaspelkatastrophe hineinrasen lässt, ein Musical namens König der Möwen, eine Frau mit einem Arm, ein Gitarrenalbum von einem, der Gitarren nicht ausstehen kann, einen Flaschenpfand-Stop-Motion-Trickfilm mit Feuergefahr und und und. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden: einen Helden wie Andreas Dorau, der den Sog des Erfolgs genauso kennt wie die Mühen der Ebene. Die Frau mit dem Arm ist der Roman eines Lebens, das keine Kompromisse kennt, oder wenn doch, dann nur solche, auf die sonst keiner gekommen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Ähnliche
Sven Regener / Andreas Dorau
Die Frau mit dem Arm
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sven Regener / Andreas Dorau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sven Regener / Andreas Dorau
Sven Regener ist Musiker (Element of Crime) und Schriftsteller. Seine Romane Herr Lehmann (2001), Neue Vahr Süd (2004), Der kleine Bruder (2008), Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt (2013), Wiener Straße (2017) und Glitterschnitter (2021) waren allesamt Bestseller. Sie wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt.
Andreas Dorau, Sohn eines Pfarrers, hat mit 15 zufällig einen der größten Independent-Hits der Neuen Deutschen Welle geschrieben: Fred vom Jupiter (1981). Dorau gilt seither als Erfinder des subversiven Elektropop-Schlagers und produziert ohrwurmverdächtige Songs mit miniaturartigen Dadatexten. 2015 erschien sein gemeinsam mit Sven Regener verfasstes Buch Ärger mit der Unsterblichkeit.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Für die einen ist er ein lebendes Gesamtkunstwerk, das sich immer weiter vervollkommnet, für die anderen ein Popstar, der partout nicht lockerlässt, für die dritten wiederum ein unerschrockener Jäger des verlorenen Schatzes der Kulturindustrie: Andreas Dorau – viel bewundert, eigensinnig, genial. Und alle sind sich einig: Nichts ist so inspirierend wie dieser Meister der Exzentrik und des unauffällig Absurden, wenn er ausführlich, subtil und abgründig von sich und seinen Abenteuern nicht nur im Kunstbetrieb erzählt.
Wer Sven Regeners Romane kennt, kann ahnen, warum er so viel Spaß daran hat, in Doraus schillerndes Universum einzutauchen und zu literarisieren, was dieser erzählt. Da gibt es einen Hypnosekönig, den Dorau aufsucht, um endlich zu erfahren, was er wirklich tief drinnen über seinen alten Freund Fred vom Jupiter denkt, die Panikattacke, die ihn als Adorno-Stimme in eine Verhaspelkatastrophe hineinrasen lässt, ein Musical namens König der Möwen, eine Frau mit einem Arm, ein Gitarrenalbum von einem, der Gitarren nicht ausstehen kann, einen Flaschenpfand-Stop-Motion-Trickfilm mit Feuergefahr und und und.
Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden: einen Helden wie Andreas Dorau, der den Sog des Erfolgs genauso kennt wie die Mühen der Ebene. Die Frau mit dem Arm ist der Roman eines Lebens, das keine Kompromisse kennt, oder wenn doch, dann nur solche, auf die sonst keiner gekommen wäre.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ich bin der eine von uns beiden
Der Hypnosekönig
Todesmelodien
Die Frau mit dem Arm
Goethe in Russland
Aus der Bibliothèque – das Gitarrenalbum
Kinder und Angst
Legasthenie und Lesungen 1: Vernunft!
Die Liebe und der Ärger der anderen
Der Bachelor
Legasthenie und Lesungen 2: Leichtsinn
König der Möwen 1: Leichtsinn und Hochmut
König der Möwen 2: Demut und Kompromiss
König der Möwen 3: Phantasie und Wirklichkeit
Video Consultant
Ich als DJ
Der Refrain (»Das Wesentliche«)
Meine Videos 1: Die drei bis vier Phasen
Meine Videos 2: Auf der Kippe
Merchandising
Das Jazzalbum
Hobbys und Freizeit
Freds Rückkehr
Werk- und Videoverzeichnis Andreas Dorau
Vorwort
Mein Name ist Andreas Dorau. Durch einen Welthit wurde dieser Name bekannt. Das nützt aber nichts. Am Ende trifft man doch nur Leute, denen der Name nichts sagt.
In Hamburg-Wandsbek, im Stadtteil Tonndorf, gibt es einen Doraustieg. Der ist aber nicht nach mir benannt, sondern nach meinem Vater, Fritz Dorau, der dort lange Jahre prägender Pastor war. Das ist unter dem Straßenschild extra vermerkt, darauf hatte meine Mutter bestanden. Sie wollte nicht, dass ich mich mit fremden Federn schmückte, sie kannte ihre Pappenheimer.
Udo Lindenberg, für den ich einige Videoproduktionen betreut habe, wollte bei unserer ersten Begegnung nicht glauben, dass Andreas Dorau mein richtiger Name sei. Er dachte, es handele sich um einen Künstlernamen, um eine Abwandlung von Andrea Doria, inspiriert durch seinen gleichnamigen Hit.
Der Doraustieg in Tonndorf ist übrigens eine Sackgasse.
Ich bin der eine von uns beiden
Das neue Jahrtausend fing an und es lief nicht gut für mich. Das Jahrtausend davor war ein inspirierender Spaziergang gewesen, erst neunhundertvierundsechzig Jahre Ruhe, dann sechsunddreißig Jahre Spaß und Freude, Major, Indie, Hit, Flop, Studium, Geld, kein Geld, Arbeit, keine Arbeit, Ausland, Inland, Japan, Sampling, Dance, Disque d’Argent, neue Haarfarbe, alles super. Aber kaum fing das neue Jahrtausend an, war irgendwie der Wurm drin, die Luft raus, das Getränk des Lebens schal geworden, die Hitmaschine lahmte, ich war raus, Schnee von gestern, es drängten junge Leute nach, ich hatte das Geld, die hatten den Spaß, ich hatte den Namen, die hatten die Zuversicht, ich hatte eine Vergangenheit, die hatten eine Zukunft.
So sah es jedenfalls für mich aus, denn ich kam nicht weiter. Ich hatte meinen Job bei der Plattenfirma aufgegeben und damit auch meinen geliebten Schreibtisch und mein geliebtes Telefon verloren, das schlug mir seelisch die Beine weg, ich war jetzt auf allen Ebenen Freelancer, als Künstler, als Video Consultant, als Telefonierender. Die Verbindlichkeiten und Strukturen, die ich bekämpfen konnte, waren weg. Ich hing in der Luft. Alle Türen standen mir weit offen, und es zog und war kalt. Nicht einmal die diebische Freude, ein geheimes Hintertürchen, ein halb geöffnetes Fenster, einen Schleichweg, einen Trampelpfad in eine andere Erlebniswelt gefunden zu haben, war mir vergönnt. Ich war wohlhabend und ich war am Ende, eine teuflische Kombination.
Natürlich machte ich weiter Musik, wenn man es denn so nennen möchte. Ich machte Musik, wie Störtebeker lief, nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hatte: ohne nachzudenken, rein mechanisch und eine große Schweinerei hinterlassend.
Musik machte ich mit Justus Köhncke. Wegen ihm hatte ich meine Plattenfirma verlassen, weil die ihn nicht als meinen Produzenten zulassen wollte. Mit ihm hatte ich zuvor »Die Menschen sind kalt« produziert, eine Single, bei der neue, revolutionäre Vocoderverfahren ins Spiel kamen. Von ihm versprach ich mir viel. Er lebte in Köln, deshalb musste ich dahin. Vielleicht verstärkte auch dies noch all mein Elend, dass ich mein geliebtes, konservatives, reformiert-evangelisches Hamburg gegen das hedonistische, schon mittags biertrinkende, katholische Köln eintauschte, zwar nur zum Musikmachen, aber Musik machen war ja das Einzige, was mich noch in der Spur und in Form hielt, jetzt, wo Telefon und Schreibtisch von anderen benutzt wurden. Aber egal, man kann es nicht auf Justus und nicht auf Köln schieben: Die musikalische Arbeit, wenn man es denn so nennen will, war damals eine uninspirierte Durchwurstelei, bei der man Samples und Spuren wahl- und willenlos übereinanderschichtete und sich das oft mittelmäßige Ergebnis gnadenlos schöntrank. Das ging lange Jahre so und wir waren dabei sogar noch sowas wie geheime Stars der Musikindustrie, unsere Aufnahmesessions sagenumwobene, moderne Legenden schürende Spekulationsobjekte, wir wurden von allen Seiten mit Geld und Vertragsangeboten bedrängt und machten immer weiter und weiter und begannen jeden Tag etwas später und öffneten das Bier jeden Tag etwas früher und fuhren zum Spaß weite Strecken mit dem Taxi, etwa von Köln nach Weilerswist und zurück, ohne Sinn, Plan und Verstand, aber mit der festen Absicht, auf diese Weise Steuern zu sparen, mit anderen Worten: Die Umstände hatten alles, was die Produktion einer Platte begünstigte, die später als legendäre Platte in die Geschichte eingehen würde, aber das tat sie nicht und das war auch besser so. Wichtiger war, dass die so entstehende Platte sieben Jahre brauchte, um ans Licht der Welt zu kommen, dabei wurde nicht nur Justus Köhncke aufgerieben, sondern nach ihm noch manch anderer Produzent verschlissen.
2005 wurde Mute Deutschland eröffnet, eine Dependance der legendären englischen Plattenfirma von Daniel Miller. Mit dabei war Charlotte Goltermann, die auch gleich als schwarzer Ritter um die Ecke kam, sich die Aufnahmen schnappte und bei Mute als LP unter dem Titel »Ich bin der eine von uns beiden« herausbrachte. Die Idee zu dem Titel war von mir, das Cover zeigte mich, wie ich ein Wildschwein umarmte, die Begründung war, Andreas und Dorau hätten sich getrennt, wegen künstlerischer Differenzen zwischen dem lautstarken hedonistischen (Kölner) Wildschwein Dorau und dem leisen sensiblen (Hamburger) Avantgardekünstler Andreas, einem ganz traurigen Geschöpf, das verloren aus der Wäsche schaute.
Die Umarmung ist nicht herzlich. Die beiden sind keine Freunde.
Mute wurde an die EMI verkauft, Mute Deutschland wurde aufgelöst, die EMI wurde zerschlagen, der Katalog in alle Winde verkauft, die Platte landete schließlich irgendwo, wechselte die Besitzer so oft und so beflissen wie das Flaschenteufelchen von Robert Louis Stevenson und kam genau wie dieses am Ende wieder zu mir zurück.
Gunther Buskies, mein aktueller Labelmanager, will diese Platte jetzt, während wir dies schreiben, wieder rausbringen. Ich sollte sie eigentlich zur Sicherheit vorher noch einmal hören, aber ich traue mich nicht.
So begann das dritte Jahrtausend für mich. Danach konnte es eigentlich nur besser werden. Davon erzählt dieses Buch.
Der Hypnosekönig
Mein Album »Ich bin der eine von uns beiden«, das 2005 bei Mute Records erschien, war eigentlich gerade durch, was in der Plattenfirmensprache so viel bedeutet wie »zwar erst neulich erschienen, aber schon Schnee von gestern«. Trotzdem hatte ich es irgendwie geschafft, Mute für ein Video zu dem Lied »Wir sind keine Freunde« Geld aus dem Kreuz zu leiern. Die zu meiner ganzen Situation ziemlich gut passende Handlung des Videos lässt sich so zusammenfassen: Ich bin Kapitän eines Luxusliners, ich hasse mich selber und will deshalb mein Schiff versenken. Aber in einem Anfall von Menschenfreundlichkeit lasse ich in letzter Sekunde noch die Leute von Bord, eine aufwendige, teure Szene, die mit vielen Statisten und Spezialeffekten gedreht wurde. Regie führte dabei Markus Gerwinat. Der Dreh fand frühmorgens im Hafen von Kiel statt, die Produktion hatte es geschafft, uns zwei Stunden Drehzeit auf einer großen Norwegenfähre zu ergattern. Wir mussten in genau den zwei Stunden drehen, in denen die alten Passagiere und Autos die Fähre verlassen hatten und die neuen Passagiere noch nicht an Bord gekommen waren. Das Video fand ich sehr gelungen und ich hatte keine Lust, es einfach irgendwo im Marketing für eine bereits abgefrühstückte Platte zu verheizen. Ich wollte eine große, glamouröse Veröffentlichung. Ich dachte an die Erstellung einer DVD mit all meinen Videos, die ich bis dahin gedreht hatte, eine Lebenswerk‑DVD quasi, und das Kapitänsvideo als krönender Abschluss dabei.
Mute hatte daran kein Interesse. Zum Glück hatten meine Freunde von der Bekleidungsfirma Carhartt auch ein Label, Combination Records, und sie fanden die Idee toll und hatten Lust auf das Projekt. Unsere Begeisterung war so groß, dass wir auch noch zusätzlich eine Dokumentation über mein Leben zu drehen planten, keine Videolebenswerkveröffentlichung ohne begleitende Dokumentation, dachten wir, und wir begannen eifrig mit den Dreharbeiten dafür. Das Team bestand aus Anne Schulte, Sönke Held und mir.
Mir war dabei natürlich wichtig, dass ich immer die totale Kontrolle über das Projekt hatte. Andere Leute mochten den Fehler gemacht haben, ihr Leben in fremde Hände zu legen, bei mir hieß es: mein Leben, meine Dokumentation, meine Kontrolle!
Daran hielt ich mich. Wir drehten und drehten. Wir filmten prägende Orte aus meinem Leben, den Doraustieg, der nach meinem Vater benannt ist, die Otto-Hahn-Gesamtschule, an der »Fred vom Jupiter« entstanden war, den ersten Proberaum von den Doraus und den Marinas und, und, und. Dazu sammelten wir alles an Material zusammen, was wir im Netz und in den Archiven über Andreas Dorau finden konnten, besuchten mit dem Hauptdarsteller von »Die Menschen sind kalt« das Grab von Horst Frank, transportierten historische Dorau-Bühnenbilder von hier nach dort und befragten außerdem viele Zeitzeugen.
Und hier stieß das Konzept der totalen Kontrolle an seine Grenzen. Unbeirrt bestand ich darauf, alle Interviews über mich und meine Vergangenheit mit allen Leuten, zu denen zum Beispiel Albert Oehlen, Wolfgang Müller, Kurt Dahlke, Jäki Eldorado, Hagar Groeteke, die einzige Marina, die mir persönlich nahestand, gehörten, selber zu führen, das heißt, den Leuten das Mikrofon vor die Nase zu halten und sie über mich auszufragen. »Wie habe ich damals auf dich gewirkt?« – »Wie fandest du mich?« – »War ich wirklich so anstrengend, wie die Leute manchmal gesagt haben?« – solche Fragen stellte ich ihnen, und ihre Antworten waren irgendwie eindimensional und flach, nett, aber nicht weiterführend, die Gespräche hatten nicht das erhoffte gewisse Etwas, sie kratzten höchstens an der Oberfläche, niemand rückte so richtig mit der Sprache heraus.
Nur ein Interview war wirklich erhellend, das war das mit Natalia Munoz, die damals als Dreizehnjährige an der Otto-Hahn-Gesamtschule mit mir in der Projektgruppe gewesen war. Sie und zwei Freundinnen hatten mit mir zusammen den Text von »Fred vom Jupiter« geschrieben – oder besser: das meiste davon –, während ich wohl nur den einen Satz beigesteuert hatte. Das wurde mir erst in diesem Interview wirklich klar, ich hatte mich aus irgendeinem Grund ganz anders an die Sache erinnert. Es kamen überhaupt ganz viele unangenehme Dinge zur Sprache, von denen ich nichts wusste oder nichts mehr zu wissen glaubte oder nichts mehr hatte wissen wollen, es wurde alles immer rätselhafter, die ganze Fred-vom-Jupiter-Geschichte versank in einem Nebel aus Zweifel, Vergessen und Verdrängen.
Wir mussten nachfassen und beschlossen, den Lehrer von damals zu finden und zu interviewen. Thomas Meir, unser Tonmann, der damals viel für RTL arbeitete, schlug auch gleich vor, ihn an seiner Haustür zu stellen und bei laufender Kamera mit unseren Fragen zu überrumpeln.
Das fanden wir anderen drei etwas zu heftig, wir versuchten erst einmal telefonisch Kontakt aufzunehmen. Sönke rief bei dem Mann an und dessen Frau ging ran. Die legte mitten in Sönkes erstem Satz auf, weil sie den Braten gerochen hatte. Es wurde immer geheimnisvoller. Der Weg zu weiter gehenden Informationen, zu Insiderwissen und knallharten Fakten schien allseits versperrt.
Sönke erwähnte dann zufällig den Werner-Herzog-Film »Herz aus Glas«, den hatte er gerade im Fernsehen gesehen, und in dem Film, so Sönke, spielten alle Schauspieler unter Hypnose, was zu erstaunlichen Ergebnissen, Erfahrungen und Geständnissen geführt habe.
Das wollte ich auch. Ich wollte selber hypnotisiert werden, um auf diese Weise der echten Wahrheit die Entstehung von »Fred vom Jupiter« betreffend auf die Spur zu kommen, um überdies mein eigenes Verhältnis zu diesem Lied ungeschminkt ergründen zu können und um mit meinen eigenen Worten aus meinem eigenen Mund zu hören, was ich damals eigentlich wirklich alles angestellt hatte.
Alle waren von der Idee begeistert. Sönke machte sofort einen Termin mit einem Hypnotiseur aus, der wohnte am Rande von Hamburg, war ein netter älterer Herr und überall als »der Hypnosekönig« bekannt.
Wir drehten einen Kameratest mit einem Assistenten von Sönke, der sofort in tiefe Trance fiel und bei einer sich anschließenden Befragung alle seine Geheimnisse auf das Peinlichste ausplauderte, es war fantastisch.
Dann war ich an der Reihe. Der Hypnosekönig sagte mir ein Wort und versicherte, dass ich jedes Mal, wenn ich in meinem Leben dieses Wort hörte, wieder in Trance fallen würde, das Wort laute »Mutabor«. Dann begann er mit der Hypnose und tat, was Hypnotiseure tun, er sagte suggestive Dinge, dass ich mich schwer fühlen würde und sowas. Das ging einige Zeit so, aber ich fiel nicht in Trance. Der Mann zog alle Register, er hypnotisierte, was das Zeug hielt, er mühte sich aus Leibeskräften, aber es ging einfach nicht. Das war mir unangenehm. Alle starrten mich an. Die Situation wurde immer peinlicher. Schließlich stellte er mir Fragen zu »Fred vom Jupiter«, und weil ich mich schämte und niemanden enttäuschen wollte, tat ich so, als sei ich in Trance, und murmelte etwas Unverständliches vor mich hin, von dem ich vermutete, dass es hypnotisierte Leute vor sich hin murmeln würden.
Irgendwann schnippte der Hypnotiseur mit den Fingern und ich sollte aufwachen, was natürlich kein Problem war. Ich fragte gleich scheinheilig, ob sie alles auch schön gefilmt hätten. Das hatten sie.
Auf dem Rückweg vom Stadtrand nach Hamburg hinein erzählte ich den anderen, dass ich gar nicht in Trance gewesen sei. Das hatten die auch gar nicht geglaubt. Meine Performance sei zu schlecht und meine Erzählungen seien zu banal gewesen. Was der Hypnosekönig gedacht hatte, weiß ich nicht, er hatte sich nichts anmerken lassen.
Combination Records wurde leider eingestellt, bevor die Dokumentation fertig war.
Was ich wirklich über »Fred vom Jupiter« denke, werde ich wohl nie erfahren.
Todesmelodien
Im Jahre 2007 starb meine Mutter. Das traf mich sehr, mehr, als es mich viele Jahre zuvor getroffen hatte, dass mein Vater starb. Als Muttersöhnchen hatte ich mit meiner Mutter ein viel engeres Verhältnis als mit meinem Vater, ich hatte sie in der letzten Zeit auch gepflegt und ihr Tod und das damit verbundene Vollwaisensein warfen mich um. Das war die härteste Zäsur in meinem Leben: Plötzlich gab es keine richtige Brücke in meine Vergangenheit mehr, niemand, den ich besuchen konnte und bei dem es sich wie Heimkommen anfühlte. Das Leben wurde kalt, ich konnte keine Mutter mehr anrufen und nach diesem und jenem fragen und von diesem und jenem erzählen, alle Leichtigkeit und Verantwortungslosigkeit war aus den Dingen des Lebens verschwunden, weil es niemanden mehr gab, der mir so selbstverständlich helfen würde. Meine Mutter hatte mir oft aus der Klemme geholfen, das würde nun nie mehr passieren. Ich hatte sehr große Angst davor, seelisch in ein tiefes schwarzes Loch zu fallen. Dazu kam, dass ich in der Zeit keinen Job hatte, deshalb auch nichts, was mich von den großen unangenehmen Fragen, die der Tod einer Mutter mit sich bringt, ablenken konnte.
Was blieb, war die Musik. Es gab, davon war ich überzeugt, nichts Besseres, um sich abzulenken und dabei womöglich auch noch etwas Gutes in die Welt zu bringen, ich brauchte nur eine Platte zu machen, dann ginge es mir gleich besser!