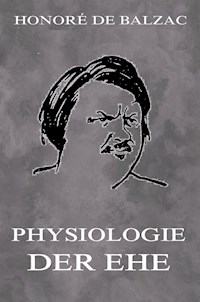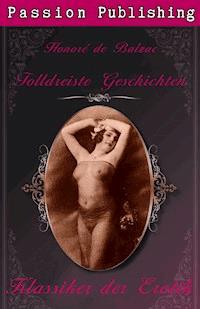2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Julie wünscht sich einen attraktiven Gatten in Uniform. Der Oberst d'Aiglemont entspricht genau ihrem Traumbild. Doch nach der Heirat ist die junge Frau bald enttäuscht von ihrem ungehobelten Ehemann. Sie trifft den Comte de Vandenesse… »Dass dieser Kampf innerhalb der Zivilisation nicht minder erbittert ist als der auf den Schlachtfeldern, dies als Erster bewiesen zu haben, ist der Stolz Balzacs: ›Meine bürgerlichen Romane sind tragischer als eure Trauerspiele!‹, ruft er den Romantikern zu. Denn das Erste, was diese jungen Menschen in Balzacs Romanen lernen, ist das Gesetz der Unerbittlichkeit.« (Stefan Zweig)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Ähnliche
Honoré de Balzac
Die Frau von dreißig Jahren
Roman
Aus dem Französischen von Hedwig Lachmann
FISCHER E-Books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
Gewidmet
dem Maler Louis Boulanger
1. Der erste Irrtum
Zu Anfang April des Jahres 1813 war den Parisern ein Sonntagmorgen angebrochen, an dem ihnen zum erstenmal im Jahre ihr Pflaster ohne Schmutz und ihr Himmel ohne Wolken entgegenleuchteten. Am Vormittag fuhr ein mit zwei feurigen Pferden bespanntes Kabriolett aus der Rue de Castiglione in die Rue de Rivoli und stellte sich hinter einer Reihe von Equipagen auf, die an dem neueröffneten Gitter in der Mitte der Terrasse der Feuillants standen. Der leichte Wagen wurde von einem anscheinend kränklichen und vergrämten Manne kutschiert, dem das ergrauende spärliche Haar über seinem gelblichen Schädel ein früh gealtertes Aussehen gab. Er warf die Zügel dem Lakaien zu, der zu Pferd seinem Wagen gefolgt war, und stieg ab, um einem jungen Mädchen herunterzuhelfen, dessen zierliche Schönheit die Aufmerksamkeit der Spaziergänger auf der Terrasse auf sich zog. Die Kleine ließ sich willig um die Taille fassen und schlang die Arme um den Hals ihres Führers, der sie auf das Trottoir niederließ, ohne die Garnitur ihres grünen Ripskleides im geringsten gedrückt zu haben. Ein Liebhaber hätte nicht mehr Sorgfalt anwenden können. Der Unbekannte mußte der Vater des Mädchens sein, das vertraulich seinen Arm nahm, ohne ihm zu danken, und ihn rasch in den Garten zog. Der alte Vater bemerkte die verwunderten Blicke einiger jungen Leute, und sein Gesicht erhellte sich für einen Augenblick. Obwohl er längst das Alter erreicht hatte, wo sich die Männer mit den trügerischer Freuden der Eitelkeit bescheiden müssen, lächelte er.
»Man hält dich für meine Frau«, sagte er dem jungen Mädchen ins Ohr. Er richtete sich stolzer auf und verlangsamte seinen Gang, was die Kleine sehr unwillig machte.
Er schien für seine Tochter kokett zu sein und mehr Gefallen als sie selber an den bewundernden Blicken zu haben, welche die Gaffer auf die kleinen in braunen Seidenstiefelchen steckenden Füße warfen, auf die feine Taille, die das reichbesetzte Kleid eng umschloß, auf den frischen Hals, den ein gesteifter Kragen nicht ganz verhüllte. Oberhalb der Stiefelchen hob sich das Kleid bisweilen von der Bewegung der Gehens und zeigte die Rundung eines feingeformten Beines, das ein durchbrochener seidener Strumpf bekleidete. Einige Spaziergänger überholten das Paar, um das junge Gesicht noch einmal zu sehen, das braune Locken umspielten, und dessen feine Röte von dem rosa Atlasfutter des Hutes und noch mehr von der Ungeduld, die in allen Zügen der hübschen Kleinen funkelte, erhöht wurde. Eine leise Schelmerei blitzte in ihren schönen schwarzen Augen, die mandelförmig geschnitten waren und unter ihren schön gezeichneten Brauen und langen Wimpern in einem feuchten Glanze schimmerten. Leben und Jugend strahlte aus dem trotzigen Gesichtchen und umfloß die anmutige, trotz des Gürtels unter der Brust noch unentwickelte Gestalt. Der Huldigungen nicht achtend, blickte das junge Mädchen mit einer gewissen Scheu auf das Schloß der Tuilerien, das offenbar das Ziel ihres eiligen Ganges war. Es war drei Viertel auf zwölf. Trotz der frühen Stunde kamen schon einige Frauen, die sich im Staat hatten zeigen wollen, vom Schloß und wandten den Kopf noch einmal mißmutig zurück, um ihr Bedauern auszudrücken, daß sie zu einem ersehnten Schauspiel zu spät gekommen waren. Ein paar unwillige Worte der enttäuschten Spaziergängerinnen waren von der hübschen Unbekannten aufgefangen worden und hatten sie merkwürdig beunruhigt. Der Alte beobachtete mehr neugierig als spöttisch die Zeichen der Ungeduld und Angst auf dem reizenden Gesicht seiner Gefährtin, und man konnte hinter seiner Sorge die Zeichen der väterlichen Eitelkeit nicht verkennen.
Dieser Sonntag war der dreizehnte des Jahres 1813. Zwei Tage später begab sich Napoleon auf jenen verhängnisvollen Feldzug, in dem er nacheinander Bessières und Duroc verlieren, die denkwürdigen Schlachten von Lützen und Bautzen gewinnen, sich von Österreich, Sachsen, Bayern und von Bernadotte verraten sehen und die schreckliche Schlacht von Leipzig ausfechten sollte. Die prachtvolle Parade, die der Kaiser abhielt, war die letzte von denen, die so lange die Bewunderung der Pariser und der Fremden erregt hatten. Die alte Garde wiederholte zum letztenmal die kunstvollen Bewegungen, deren glanzvolle Akkuratesse den Riesen selber in Erstaunen setzte, der sich zu seinem Zweikampf mit Europa rüstete. In die glänzende neugierige Bevölkerung, die sich vor den Tuilerien angesammelt hatte, schlich sich ein Gefühl der Trauer. Jeder schien die Zukunft zu erraten und zu ahnen, daß die Phantasie sich noch oft dieses Schauspiel vorzaubern würde, wenn diese heldischen Zeiten Frankreichs schon einen sagenhaften Charakter angenommen haben würden.
»Komm, laß uns rascher gehen, Vater!« sagte das junge Mädchen und zog den Alten mutwillig vorwärts, »ich höre die Trommler.« »Das sind die Truppen, die in die Tuilerien einziehen«, beschwichtigte er. »Oder die defilieren … es kommen schon alle zurück«, erwiderte sie mit kindlichem Unwillen, der den Alten lächeln machte. »Die Parade beginnt erst um halb ein Uhr«, sagte der Vater, der seiner ungestümen Tochter schon kaum mehr folgen konnte.
Nach den Bewegungen ihres rechten Armes zu schließen, hätte man meinen können, sie brauche das zum rascheren Laufen, ihre wohlbehandschuhte kleine Hand, die ungeduldig ein Taschentuch zerknitterte, war wie ein Ruder, das die Wellen teilt. Der alte Mann lächelte hin und wieder, doch zuweilen verdüsterte ein flüchtiger sorgenvoller Ausdruck sein abgezehrtes Gesicht. Seine Liebe für das schöne Geschöpf machte ihm die Gegenwart ebenso angenehm, wie sie ihm die Zukunft unsicher erscheinen ließ. Er schien sich zu sagen: ›Heute ist sie glücklich, wird sie es immer sein?‹ Denn die Alten sind nur zu sehr geneigt, der Zukunft ihrer Kinder ihre Sorgen als Mitgift mitzugeben. Als Vater und Tochter unter dem Säulengang des Pavillons angelangt waren, auf dessen Spitze die Trikolore flatterte und durch den die Spaziergänger auf ihrem Wege von dem Garten der Tuilerien in das Karussell hindurch müssen, riefen die Posten barsch: ›Kein Durchgang mehr!‹
Die Kleine stellte sich auf die Fußspitzen und konnte eine Unzahl geputzter Frauen sehen, die die beiden Seiten des alten Marmortores, aus dem der Kaiser herauskommen sollte, versperrten.
»Siehst du, Vater, wir sind zu spät von zu Hause weggegangen.«
Ihre betrübte, schmollende Miene bekundete, wie wichtig es ihr gewesen war, bei der Revue zugegen zu sein.
»Komm, Julie, laß uns gehen, du willst doch nicht zertreten werden!« »Ach nein, bleiben wir, Vater! Von hier aus kann ich immerhin noch etwas vom Kaiser zu sehen bekommen, wenn er im Feldzug umkäme, hätte ich ihn nie gesehen.«
Der Vater zuckte zusammen bei diesen egoistischen Worten, seine Tochter hatte Tränen in der Stimme. Er sah sie an, und es kam ihm der Gedanke, daß die Tränen unter ihren gesenkten Lidern wohl weniger von diesem Verdruß als von einem ersten Kummer herrührten, dessen geheimer Ursprung für einen alten Vater leicht zu erraten war. Plötzlich wurde Julie rot und stieß einen Ruf aus, den weder die Posten noch der Vater verstehen konnten. Ein Offizier, der aus dem Hof auf die Treppe zueilte, wandte sich hierbei rasch um, kam bis zu dem Tor, erkannte die junge Dame, die einen Augenblick von den großen langhaarigen Mützen der Grenadiere verdeckt gewesen war, und ließ sofort über sie und ihren Vater das Verbot, das er selbst erteilt hatte, aufheben. Dann zog er die entzückte Kleine sanft mit sich, ohne sich um das Murren der eleganten Menge, die das Tor belagerte, zu kümmern.
»Nun wundere ich mich nicht mehr, daß sie so zornig war und nicht zurückbleiben wollte, da du Dienst hattest«, sagte der alte Mann mit einem Ton, der zugleich ernst und neckend war.
»Herr Herzog, wenn Sie einen guten Platz haben wollen, dürfen wir jetzt nicht plaudern. Der Kaiser liebt es nicht, zu warten, und ich bin vom Feldmarschall zur Meldung befohlen.«
Während er sprach, hatte er mit einer gewissen Vertraulichkeit Julies Arm genommen und sie gegen das Karussell mit fortgezogen. Julie sah mit Erstaunen, wie sich eine endlose Menge in den kleinen Raum zwischen den grauen Mauern des Palastes und den von Ketten gezogenen Schranken, mit denen man inmitten des Hofes der Tuilerien große sandbestreute Vierecke abgegrenzt hatte, hineinzwängte. Der Kordon der Schildwachen, der den Weg für den Kaiser und seinen Generalstab freihalten sollte, hatte die größte Mühe, sich nicht von der erwartungsvollen, wie ein Bienenschwarm surrenden Menge durchbrechen zu lassen.
»Es wird wohl sehr schön werden«, sagte Julie mit einem Lächeln. »Geben Sie doch acht!« rief der Offizier und faßte Julie um die Taille, um sie mit ebensoviel Kraft als Raschheit neben einer Säule in Sicherheit zu bringen.
Ohne dieses rasche Verfahren wäre seine neugierige Verwandte mit dem Hinterteil des weißen Pferdes in Berührung gekommen, das einen Sattel aus grünem Samt und Gold trug und das der Mameluck Napoleons in nächster Nähe des Torbogens zehn Schritt hinter den übrigen Pferden am Zügel führte, welche auf die hohen Offiziere warteten, die dem Kaiser zur Begleitung dienten. Der junge Mann wies dem Vater und der Tochter neben der ersten Schranke, rechts von der Menge, ihren Platz an und empfahl sie mit einer Kopfbewegung den beiden alten Grenadieren, zwischen denen sie standen. Als der Offizier sich wieder dem Palast zuwandte, war ein Ausdruck von Glück und Freude auf seinem Gesicht dem plötzlichen Schrecken gefolgt, den das Zurückweichen des Pferdes hervorgerufen hatte. Julie hatte ihm geheimnisvoll die Hand gedrückt, sei es, um ihm für den kleinen Dienst zu danken, sei es, um ihm zu sagen: ›Endlich werde ich Sie zu sehen bekommen!‹ Sie hatte in Erwiderung des respektvollen Grußes, mit dem sich der Offizier vor seinem eiligen Verschwinden von ihr und ihrem Vater verabschiedete, sanft den Kopf geneigt. Der alte Mann, der die beiden jungen Leute absichtlich allein gelassen zu haben schien, hielt sich in gedrückter Stimmung im Rücken seiner Tochter, doch beobachtete er sie heimlich und suchte ihr eine anscheinende Sicherheit einzuflößen, indem er so tat, als ob er von dem Anblick des prächtigen Schauspiels, den das Karussell bot, ganz hingenommen wäre. Als Julie ihren Vater ängstlich anblickte, wie ein Schüler seinen Lehrer, antwortete er ihr sogar mit einem heiter-gütigen Lächeln, aber sein scharfes Auge war dem Offizier bis unter den Torbogen gefolgt, und keine Einzelheit dieser flüchtigen Szene war ihm entgangen.
»Welch herrliches Schauspiel!« sagte Julie leise und drückte ihrem Vater die Hand.
Der malerische und großartige Anblick, den das Karussell in diesem Augenblick gewährte, entlockte denselben Ausruf Tausenden von Zuschauern, die alle mit vor Bewunderung offenem Munde dastanden. Eine Masse Menschen, ebenso dicht gedrängt wie die, in der sich der Vater und die Tochter befanden, stand dem Schlosse gerade gegenüber und hielt den engen, gepflasterten Raum besetzt, der am Gitter des Karussells entlang läuft. Diese Menge umrahmte das riesenhafte Rechteck, das die Gebäude der Tuilerien und das damals neuerrichtete Gitter bilden, mit der Buntheit ihrer Frauentoiletten in farbigen Linien. Die Regimenter der alten Garde, welche Revue passieren sollten, füllten das weite Terrain und standen dem Palast gegenüber in zehn Reihen als imposante blaue Blöcke. Jenseits der Absperrung und in dem Karussell waren, auf andern parallelen Linien, mehrere Infanterie- und Kavallerieregimenter aufgestellt und bereit, durch den Triumphbogen zu defilieren, der die Mitte des Gitters ziert und auf dessen Spitze man zu jener Zeit noch die prächtigen Pferde von Venedig sah. Die Regimentsmusik, die am untern Ende der Galerien des Louvre postiert war, wurde von den diensttuenden polnischen Ulanen verdeckt. Ein großer Teil des sandbestreuten Karrees blieb leer. Er lag wie eine Arena für die Bewegungen dieser schweigsamen Truppenkörper bereit, deren Massen durch die militärische Kunst symmetrisch verteilt waren und die Strahlen der Sonne in den dreieckigen Spitzen von zehntausend Bajonetten auffingen. In dem leichten Wind bewegten sich die Federbüsche der Soldaten wie die Bäume des Waldes unter einem heftigen Sturm. Diese alten, stummen, glänzenden Truppen boten durch die Verschiedenheit der Uniformen, der Aufschläge, der Waffen und der Achselschnüre die mannigfaltigsten Farbenkontraste. Das riesenhafte Gemälde, das Miniaturbild eines Schlachtfeldes vor der Schlacht, war mit all seinen bizarren Begleiterscheinungen von den hohen, majestätischen Gebäuden, deren Unbeweglichkeit für die Soldaten und ihre Vorgesetzten vorbildlich zu sein schien, poetisch eingerahmt. Der Zuschauer verglich unwillkürlich die Menschenmauern und die Steinmauern. Die Frühlingssonne warf ihr Licht verschwenderisch über die weißen Mauern, die von gestern sind, und über jene, die Jahrhunderte so stehen, und beschien mit vollem Glanze die unzähligen gebräunten Gesichter, die alle von vergangenen Gefahren erzählten und die zukünftigen Gefahren schweigend erwarteten. Nur die Obersten jedes Regiments kamen und gingen an den Fronten dieser heldenmütigen Männer vorüber. Hinter den Massen der in Silber, Himmelblau, Purpur und Gold schimmernden Truppen konnten die Neugierigen die dreifarbigen Wimpel bemerken, die an den Lanzen von sechs unermüdlichen polnischen Reitern befestigt waren. Diese hatten, gleich den Hunden, die eine Herde durch das Feld leiten, die Aufgabe, sich zwischen den Truppen und den Neugierigen hin und her zu bewegen, um die letzteren zu verhindern, den winzigen Raum, der ihnen neben dem kaiserlichen Gitter zugebilligt war, zu überschreiten. Abgesehen von diesem Hin- und Hergehen, hätte man sich in Dornröschens Schloß versetzt glauben können. Der Frühlingswind, der über die langhaarigen Mützen der Grenadiere strich, machte die Unbeweglichkeit der Soldaten noch auffälliger, gleichwie das dumpfe Murmeln der Menge ihr Schweigen noch mehr hervorhob. Das Dröhnen eines Halbmonds oder ein versehentlicher leichter Schlag gegen eine große Trommel, den das Echo des kaiserlichen Palastes wiederholte, glich dem entfernten Rollen des Donners vor einem Gewitter. Ein unbeschreiblicher Enthusiasmus drückte sich in der Erwartung der Menge aus. Frankreich schickte sich an, Napoleon am Vorabend eines Feldzuges, dessen Gefahren von dem geringsten Bürger vorausgesehen werden konnten, Lebewohl zu sagen. Es handelte sich diesmal um Sein oder Nichtsein des französischen Kaiserreichs. Dieser Gedanke schien die bürgerlichen und die bewaffneten Volksmassen zu beleben, die sich gleicherweise schweigsam in dem Umkreis zusammendrängten, über dem der Adler und das Genie Napoleons schwebten. Diese Soldaten, die Hoffnung Frankreichs, diese Soldaten, Frankreichs letzter Blutstropfen, hatten auch einen großen Anteil an der unruhigen Neugierde der Zuschauer. Zwischen der Mehrzahl der Anwesenden und dem Militär wurde vielleicht ein Abschied auf ewig genommen. Alle aber, selbst die dem Kaiser durchaus feindlich Gesinnten, richteten glühende Wünsche für den Ruhm des Vaterlandes zum Himmel. Selbst jene Männer, die des Kampfes, der sich zwischen Europa und Frankreich entsponnen hatte, ganz und gar müde waren, hatten ihren Haß abgetan, als sie durch den Triumphbogen schritten, wohl wissend, daß am Tage der Gefahr Napoleon ganz Frankreich bedeutete. Die Schloßuhr schlug halb eins. In diesem Augenblicke hörte das Surren der Menge auf, und die Stille wurde so tief, daß man das Wort eines Kindes hätte hören können. Der alte Mann und seine Tochter, die ganz nur Auge waren, vernahmen jetzt den Klang von Sporen und ein Rasseln von Säbeln, das unter dem hohen Säulengang des Schlosses laut hallte.
Ein kleiner, ziemlich fetter Mann, in hohen Reiterstiefeln, mit einer grünen Uniform und einer weißen Hose bekleidet, erschien plötzlich mit einem Dreimaster auf dem Kopf, der ebenso seltsam war wie der Mann selbst, das breite rote Band der Ehrenlegion schmückte seine Brust, ein kleiner Degen hing an seiner Seite. Der Mann wurde von allen Augen auf einmal und von allen Punkten des Platzes aus gesehen. Sogleich schlugen die Trommeln den Fahnenmarsch, die beiden Orchester spielten einen Satz, dessen kriegerisches Thema von allen Instrumenten, von der sanftesten Flöte bis zur großen Trommel, wiederholt wurde. Bei diesem Aufruf zum Kampf erbebten alle Herzen; die Fahnen grüßten, die Soldaten präsentierten die Waffen mit einer einmütigen, gleichen Bewegung, in welcher die Gewehre von der ersten bis zur letzten Reihe des Karussells im selben Moment emporgehoben wurden. Kommandoworte schallten von Reihe zu Reihe wie Rufe eines Echos. Die begeisterte Menge rief: »Es lebe der Kaiser!« Kurz, alles bebte, flackerte, alles war erschüttert. Napoleon war zu Pferde gestiegen. Diese Bewegung hatte die schweigsamen Massen belebt, den Instrumenten eine Stimme gegeben, die Adler und die Fahnen zum Schwingen gebracht und auf allen Gesichtern Erregung hervorgerufen. Die Mauern der hohen Galerie dieses alten Palastes schienen mitzurufen: »Es lebe der Kaiser!« Es war nichts Menschliches mehr, es war ein Zauberwerk, ein Abbild der göttlichen Macht oder vielmehr ein vergängliches Bild dieser so vergänglichen Herrschaft. Der Mann, der von so viel Liebe, Begeisterung, Hingebung, Wünschen getragen wurde, für den die Sonne die Wolken vom Himmel gejagt hatte, saß auf seinem Pferde, drei Schritt vor der kleinen goldstrotzenden Schwadron, die ihm folgte, mit dem Feldmarschall zur Linken und dem diensttuenden Marschall zur Rechten. Inmitten all der Erregung, die er geweckt hatte, schien jeder Zug in seinem Gesichte völlig ungerührt.
»O Gott, natürlich! Bei Wagram mitten im Feuer, bei Moskau unter den Toten, er ist immer unerschütterlich, er!«
Diese Antwort auf zahlreiche Fragen gab der Grenadier, der neben dem jungen Mädchen stand. Julie war eine Weile in der Betrachtung dieser Gestalt versunken, deren Ruhe ein so großes, sicheres Machtgefühl anzeigte. Der Kaiser bemerkte Mademoiselle de Chatillonest und neigte sich gegen den Marschall Duroc, um eine Bemerkung zu machen, die ein Lächeln bei diesem hervorrief. Die Heerschau nahm ihren Anfang. Während das junge Mädchen seine Aufmerksamkeit bisher zwischen der unbewegten Miene Napoleons und den blauen, grünen und roten Reihen der Truppen geteilt hatte, beschäftigte sie sich in diesem Augenblick, inmitten der raschen, regelmäßigen Bewegungen der alten Soldaten, mit einem jungen Offizier, der zu Pferde durch die sich bewegenden Reihen jagte und mit unermüdlicher Geschäftigkeit zu der Gruppe zurückkehrte, an deren Spitze der schlichte Napoleon glänzte. Dieser Offizier ritt einen prächtigen Rappen und zeichnete sich, im Gegensatz zu der herausgeputzten Menge, durch die schöne himmelblaue Uniform des Ordonnanzoffiziers des Kaisers aus. Die Goldstickerei seines Rockes und der Reiherbusch seines schmalen, länglichen Tschakos funkelten so lebhaft in der Sonne, daß ihn die Zuschauer mit einem Irrlicht vergleichen mußten. Er war die sichtbar gewordene Seele des Ganzen, auf den Befehl des Kaisers dazu bestellt, die ›Bataillone zu beleben‹, zu führen, deren erhobene Waffen Blitze schleuderten, wenn auf einen Wink seiner Augen die Reihen sich teilten, sich wieder vereinigten, sich wie die Wellen eines Strudels im Kreise herumdrehten oder wie die langen, geraden, hohen Wellen, die der empörte Ozean ans Ufer trägt, auf ihn zukamen.
Als die Heerschau zu Ende war, ritt der Ordonnanzoffizier mit verhängtem Zügel heran und hielt vor dem Kaiser, um seine Befehle zu erwarten. In diesem Augenblick war er zwanzig Schritt von Julie entfernt, vor der kaiserlichen Gruppe, in einer Haltung, ähnlich der, wie sie Gérard dem General Rapp auf dem Gemälde ›Die Schlacht von Austerlitz‹ gegeben hat. Es war dem jungen Mädchen vergönnt, den Mann ihres Herzens in seinem vollen militärischen Glanze zu bewundern. Der Oberst Victor d’Aiglemont, der kaum dreißig Jahre zählte, war groß, gut gewachsen, schlank. Sein wohlproportionierter Körper kam nie besser zur Geltung, als wenn er seine Kraft dazu gebrauchte, ein Pferd zu zügeln, dessen geschmeidiger, eleganter Rücken sich dann unter ihm zu biegen schien. Sein männliches, wettergebräuntes Gesicht hatte den unerklärlichen Reiz, den eine vollkommene Regelmäßigkeit der Züge jungen Gesichtern verleiht. Seine Stirn war breit und hoch. Seine feurigen Augen, von dichten Brauen beschattet und langen Wimpern umrandet, bildeten zwei weiße Ovale zwischen zwei schwarzen Linien. Seine Nase hatte die graziöse Biegung eines Adlerschnabels. Das Rot seiner Lippen trat unter den Krümmungen des unvermeidlichen schwarzen Schnurrbarts kräftig hervor. Seine breiten Backen von lebhafter Farbe zeigten braune und gelbe Töne, die auf außerordentliche Kraft deuteten. Es war eins von jenen Gesichtern, denen die Tapferkeit ihr Gepräge verliehen hat, der Typus, auf den der Künstler heute aus ist, wenn er einen der Helden des kaiserlichen Frankreich darstellen will. Das schweißgetränkte Pferd, dessen unruhig hin- und hergehender Kopf äußerste Ungeduld ausdrückte, stand, die beiden Vorderfüße gespreizt und auf einer genauen Linie gehalten, unbeweglich da und ließ die langen Haare seines dichten Schweifes flattern; seine Hingebung versinnbildlichte auf eine greifbare Art die seines Herrn für den Kaiser. Julie empfand eine Regung von Eifersucht, als sie ihren Geliebten so beflissen sah, die Blicke Napoleons aufzufangen, während er sie noch nicht angesehen hatte. Plötzlich hat der Herrscher ein Wort gesprochen. Victor drückt die Flanken seines Pferdes und galoppiert von dannen; aber der Schatten einer Schranke auf dem Sande erschreckt das Pferd; es scheut, weicht zurück und bäumt sich so jäh auf, daß der Reiter in Gefahr scheint. Julie stößt einen Schrei aus, sie erbleicht; alle Augen richten sich auf sie, sie sieht niemanden; ihre Augen sind auf das wilde Pferd gerichtet, das der Offizier züchtigt, während er davonjagt, um die Befehle Napoleons weiterzugeben. Diese verwirrenden Szenen hatten Julie in solche Spannung versetzt, daß sie sich unbewußt an den Arm ihres Vaters geklammert hatte, dem sie so unwillkürlich durch den mehr oder weniger lebhaften Druck ihrer Finger ihre Gedanken mitteilte. Als Victor nahe daran gewesen war, von dem Pferd abgeworfen zu werden, hatte sie sich noch fester an ihren Vater geklammert, als ob sie selbst in Gefahr wäre zu fallen. Der Greis betrachtete mit finsterer, schmerzlicher Unruhe das erhitzte Gesicht seiner Tochter, und über seine wie im Krampf zusammengezogenen Züge glitt ein Ausdruck von Mitleid, Eifersucht und Bedauern. Doch als der ungewohnte Glanz in Julies Augen, der Schrei, den sie ausgestoßen hatte und die zuckende Bewegung ihrer Finger ihm vollends ihre heimliche Liebe enthüllt hatten, mußten sich ihm wohl traurige Zukunftsbilder offenbaren, denn sein Gesicht spiegelte die Ahnung künftigen Unheils. In diesem Augenblick schien die Seele Julies in die des Offiziers übergegangen zu sein. Unter einem Gedanken, der an Grausamkeit alle bisherigen übertraf, krampfte sich das leidende Gesicht des Alten zusammen, als er d’Aiglemont, der an ihnen vorbeiritt, einen Blick des Einverständnisses mit Julie, deren Augen feucht schimmerten und deren Gesicht von brennender Röte übergossen war, tauschen sah. Er führte seine Tochter, ehe sie sich dessen versah, in den Garten der Tuilerien.
»Aber Vater«, sagte sie, »die Regimenter auf der Place du Carrousel werden noch weiter exerzieren.« – »Nein, mein Kind, alle Truppen defilieren.« – »Ich glaube, Sie irren sich, lieber Vater, Monsieur d’Aiglemont sollte sie vorrücken lassen.« – »Aber ich habe Schmerzen und will nicht mehr bleiben.«
Julie konnte ihrem Vater leicht Glauben schenken, als sie auf dieses von väterlichen Kümmernissen bedrückte Gesicht einen Blick geworfen hätte.
»Haben Sie große Schmerzen?« fragte sie gleichgültig, denn sie war ganz mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. »Ist nicht jeder Tag ein Geschenk für mich?« erwiderte der alte Mann. »Wollen Sie mich wieder traurig machen, weil Sie von Ihrem Tode sprechen? Ich war so heiter. Verjagen Sie rasch Ihre bösen, schwarzen Gedanken!« – »Ach!« rief der Vater mit einem Seufzer, »verwöhntes Kind! Gerade die besten Herzen sind doch oft recht grausam! Daß man euch das Leben weiht, nur an euch denkt, für euer Behagen sorgt, seine Neigungen euren Launen opfert, euch vergöttert, das Blut für euch hingibt, ist das denn gar nichts! Ihr nehmt alles unbekümmert hin. Man müßte allmächtig sein wie Gott, damit ihr einem immer euer Lächeln und eure herablassende Liebe zuteil werden laßt. Dann kommt schließlich ein anderer – ein Geliebter, und raubt uns euer Herz!«
Erstaunt sah Julie ihren Vater an, der langsam ging und glanzlose Blicke auf sie richtete.
»Ihr versteckt euch sogar vor uns«, fing er von neuem an, »aber vielleicht auch vor euch selber …« – »Aber wie können Sie das sagen, Vater!« – »Ich meine, Julie, daß Sie Geheimnisse vor mir haben. Du liebst!« sagte er lebhaft, als er sah, daß seine Tochter errötet war; »ach, ich hoffte, du würdest deinem alten Vater treu bleiben bis zu seinem Tode; ich hoffte, dich glücklich und strahlend bei mir zu behalten, so wie du noch vor kurzem warst. Solange mir dein Geheimnis unbekannt war, hätte ich an eine ruhige Zukunft für dich glauben können. Aber jetzt ist es unmöglich, daß ich eine Hoffnung auf Glück für dich mit mir fortnehme, denn du liebst noch mehr den Offizier als den Cousin. Ich kann nicht mehr daran zweifeln.« – »Warum soll ich ihn denn nicht lieben dürfen?« rief sie mit lebhafter Neugierde. »Ach, meine Julie, du würdest mich nicht verstehen«, sagte der Vater mit einem Seufzer. »Sagen Sie es nur!« erwiderte sie mit leisem Trotz. »Gut also, höre mich an, mein Kind! Die jungen Mädchen machen sich oft edle, berückende Bilder zurecht, ganz ideale Gestalten, und bilden sich phantastische Ideen über die Männer, die Gefühle, die Welt; dann statten sie in ihrer Unschuld irgendeinen Charakter mit allen Vollkommenheiten aus und vertrauen ihm; sie lieben in dem Mann ihrer Wahl diese eingebildete Gestalt. Aber später, wenn sie sich nicht mehr von dem Unglück losmachen können, verwandelt sich die trügerische Erscheinung, die sie so reich begabt haben, ihr erster Abgott, in ein abscheuliches Skelett. Julie, lieber sähe ich dich in einen Greis verliebt als in diesen Oberst. Ach, wenn du dich nur zehn Jahre älter sehen könntest, würdest du meiner Erfahrung Gerechtigkeit widerfahren lassen! Ich kenne Victor: seine Fröhlichkeit ist ohne Geist, eine Kasernenlustigkeit; er ist ohne Talent und verschwenderisch. Er ist einer von denen, die der Himmel erschaffen hat, um am Tage vier Mahlzeiten einzunehmen und zu verdauen, zu schlafen, die erste beste zu lieben und sich zu schlagen. Er versteht das Leben nicht. Sein gutes Herz, denn ein gutes Herz hat er, wird ihn vielleicht dazu bringen, einem Unglücklichen, einem Kameraden seine Börse zu geben; aber er ist leichtfertig, er hat nicht die Feinheit des Herzens, die dem Glück einer Frau Opfer bringt; er ist unwissend, egoistisch … es gibt da sehr viele Aber.«
– »Nun, Vater, er muß doch wohl etwas Geist und Begabung haben, da man ihn zum Oberst gemacht hat.« – »Meine Liebe, Victor wird sein ganzes Leben Oberst bleiben. – Ich habe noch keinen gesehen, der mir deiner würdig erschienen wäre«, sagte der alte Vater mit einem gewissen Enthusiasmus.
Er hielt einen Moment inne, sah seine Tochter an und fügte hinzu: »Meine liebe, arme Julie, du bist noch zu jung, zu zart, zu schwächlich, um die Leiden und Mühseligkeiten der Ehe zu ertragen. D’Aiglemont ist von seinen Eltern verwöhnt worden, ebenso wie du von deiner Mutter und mir verwöhnt worden bist. Wie ist es denkbar, daß ihr beide euch solltet verstehen können, da jeder von euch seinen eigenen Willen hat, der mit dem des anderen unvereinbar ist? Du wirst dich entweder tyrannisieren lassen oder selbst Tyrann sein. Das eine wie das andere bringt die gleiche Summe von Unglück in das Leben einer Frau. Doch du bist sanft und bescheiden, du wirst dich also zuerst beugen. Du hast«, sagte er mit zitternder Stimme, »eine Herzensanmut, die verkannt werden wird, und dann …« Er beendete den Satz nicht, die Tränen überkamen ihn. »Victor«, fing er nach einer Pause wieder an, »wird die unschuldigen Regungen deiner jungen Seele verletzen. Ich kenne die Soldaten, meine Julie; ich habe unter ihnen gelebt. Es ist selten, daß das Herz dieser Leute stark genug ist, um über die Gewohnheiten Herr zu werden, die sie inmitten all des Unglücks, das sie umgibt, und in den Zufällen ihres abenteuerlichen Lebens angenommen haben.« – »Sie wollen sich also meinen Gefühlen entgegensetzen und mich für Sie und nicht für mich verheiraten?« versetzte Julie in einem Ton, der zwischen Ernst und Scherz die Mitte hielt. »Dich für mich verheiraten?« rief der Vater mit einem Ausdruck des Staunens, »für mich, dessen freundlich warnende Stimme du bald nicht mehr hören wirst! Ich habe immer gesehen, daß die Kinder die Opfer, die ihnen ihre Eltern auferlegen, einem eigennützigen Gefühl zugeschrieben haben. Heirate Victor, meine Julie! Eines Tages wirst du seine Nichtigkeit, seine Liederlichkeit, seinen Egoismus, sein fehlendes Zartgefühl, seine Unfähigkeit zur Liebe und soundsoviel anderes Ungemach, das er dir bereiten wird, bitter beweinen. Dann erinnere dich, daß unter diesen Bäumen die prophetische Stimme deines Vaters vergeblich an dein Ohr getönt hat!«
Der Alte schwieg, er hatte gesehen, wie seine Tochter mit trotziger Abwehr den Kopf schüttelt hatte. Die beiden schritten auf das Gitter zu, wo ihr Wagen hielt. Während dieses schweigsamen Ganges prüfte das junge Mädchen verstohlen das Gesicht ihres Vaters und gab ihre schmollende Miene allmählich auf. Der tiefe Schmerz, der auf dieser zu Boden geneigten Stirn eingegraben war, machte einen lebhaften Eindruck auf sie.
»Ich verspreche Ihnen, Vater«, sagte sie mit sanfter und bewegter Stimme, »Ihnen nicht mehr von Victor zu reden, bevor Sie von den Vorurteilen, die Sie gegen ihn hatten, abgekommen sind.« Der Alte betrachtete seine Tochter mit Erstaunen. Zwei Tränen rollten aus seinen Augen über seine gefurchten Wangen. Er konnte Julie vor der Menge, die sie umgab, nicht umarmen, aber er drückte ihr zärtlich die Hand. Als er den Wagen bestieg, waren alle sorgenvollen Gedanken, die seine Stirn umwölkt hatten, verflogen. Die traurige Haltung seiner Tochter beunruhigte ihn weit weniger als die unschuldige Freude, deren geheime Ursache sie bei der Revue verraten hatte.
In den ersten Märztagen des Jahres 1814, knapp ein Jahr nach dieser Revue des Kaisers, fuhr eine Kalesche auf dem Wege von Amboise nach Tours. Beim Verlassen des aus Nußbäumen gebildeten grünen Doms, unter welchem das Postgebäude von La Frillière versteckt lag, rollte der Wagen mit solcher Geschwindigkeit dahin, daß er im Nu an der Brücke, die über die Cise ging, bei der Mündung dieses Flusses in die Loire, anlangte, und dort anhielt. Infolge der ungestümen Eile, zu der ein junger Postillion auf Befehl seines Herrn die vier raschesten Pferde der Poststation angefeuert hatte, war einer der Zugriemen gerissen. So hatten die beiden Personen, die sich im Innern der Kalesche befanden, durch einen Zufall Muße, bei ihrem Erwachen eine der schönsten Landschaften, die die verlockenden Ufer der Loire bieten können, zu bewundern. Zu seiner Rechten umfaßt der Reisende mit einem Blick alle Krümmungen der Cise, die sich wie eine silberne Schlange durch die Wiesen windet, wo das junge Gras in smaragdener Färbung sprießt. Zur Linken erscheint die Loire in ihrer ganzen Pracht. Auf der weiten, vom frischen Morgenwind leichtgekräuselten Wasserfläche, die dieser majestätische Fluß entfaltet, bricht sich die Sonne in unzähligen Facetten. Grünende Inseln liegen verstreut wie die gefaßten Edelsteine eines Halsbandes. Auf der anderen Seite des Flusses breiten die schönsten Landschaften der Touraine, so weit das Auge reicht, ihre Herrlichkeiten aus. In der Ferne ist der Blick nur von den Hügeln des Cher begrenzt, dessen Gipfel sich zu dieser Stunde in scharfen Umrissen von dem durchsichtigen Blau des Himmels abhoben. Durch das zarte Laubwerk der Inseln gesehen, scheint Tours, im Hintergrund des Bildes, sich wie Venedig aus dem Schoß des Wassers zu heben. Die Glockentürme seiner alten Kathedrale ragen in die phantastischen Gebilde eines weißlichen Gewölks hinein. Jenseits der Brücke, auf der der Wagen hielt, erblickt man längs der Loire bis gegen Tours eine Felsenkette, die die Natur aus einer Laune dahingestellt zu haben scheint, um den Fluß einzudämmen, dessen Fluten unaufhörlich den Stein aushöhlen – ein Schauspiel, das stets das Staunen der Reisenden hervorruft. Das Dorf Vouvray liegt wie eingebettet in den Schlünden und Aushöhlungen dieser Felsen, die von der Brücke der Cise eine Biegung machen. Von Vouvray bis Tours hat in den steilen Klüften dieser zerrissenen Hügel ein Winzervolk seine Wohnstätten. An mehr als einer Stelle sind drei Stockwerke hohe Häuser in den Felsen eingehöhlt und durch gefährliche, gleichfalls in den Stein gehauene Treppen miteinander verbunden. Oben von einem Dach aus läuft ein junges Mädchen im roten Unterrock in ihren Garten. Der Rauch eines Kamins steigt zwischen den sprossenden Reben und Ranken eines Weinbergs auf. Pächter arbeiten auf beinahe senkrecht abfallenden Feldern. Eine alte Frau sitzt mit ihrem Spinnrad ruhig auf einem eingestürzten Felsblock unter einem blühenden Mandelbaum und lächelt über das Erschrecken der Reisenden, die zu ihren Füßen vorüberziehen. Sie kümmert sich ebensowenig um die Risse, die in den Felsen klaffen, wie um die überhängenden Reste einer alten Mauer, deren Steinschichten nur noch von den krausen Wurzeln eines Efeumantels festgehalten werden. Der Hammer der Küfer tönt durch die in luftiger Höhe eingebauten Kellergewölbe. Das Land ist überall bestellt und fruchtbar, obwohl die Natur dem menschlichen Fleiß die Erdscholle versagt hat. Nichts ist entlang der Loire dem reichen Panorama vergleichbar, das die Touraine hier den Augen des Reisenden auftut. Das dreifache Bild dieser in ihrer Mannigfaltigkeit kaum angedeuteten Szenerie bereitet der Seele ein Schauspiel, das sie für immer in ihr Gedächtnis einprägt; und wenn ein Dichter dies in sich aufgenommen hat, so werden ihm seine Träume auf eine märchenhafte Weise immer wieder diese romantischen Eindrücke hervorzaubern.
Im Augenblick, wo der Wagen auf der Brücke der Cise angelangt war, tauchten zwischen den Inseln der Loire mehrere weiße Segel auf und die harmonische Landschaft zeigte sich in einer neuen Schönheit. Der starke Duft der Weiden, die den Fluß begrenzen, vermischte sich mit dem Hauch der feuchten Brise. Die Vögel ließen ihr vielstimmiges Konzert ertönen. Der eintönige Gesang eines Ziegenhirten klang melancholisch dazwischen, während die Rufe der Schiffer eine ferne Regsamkeit ahnen ließen. Ein weicher Dunst, der launisch um die in die weite Landschaft gestreuten Bäume hing, lieh dem Bilde noch einen besonderen Reiz. Das war die Touraine in ihrer ganzen Pracht, der Frühling in seiner ganzen Herrlichkeit. Dieser Teil Frankreichs, der einzige, den die fremden Armeen nicht antasten sollten, war zu jener Zeit der einzig ungestörte, und machte den Eindruck als ob er die Invasion nicht fürchte.
Ein Kopf mit einer Soldatenmütze guckte aus der Kalesche, sobald sie stehengeblieben war; und sogleich öffnete ein ungeduldiger Offizier eigenhändig den Wagenschlag und sprang auf die Straße, um den Postillion zur Rede zu stellen. Doch die Geschicklichkeit, mit der dieser Mann aus der Touraine die zerrissene Zugleine wieder instand setzte, beschwichtigte den Obersten Comte d’Aiglemont, der an den Wagenschlag zurücktrat und die Arme streckte, um die steifen Muskeln biegsam zu machen. Er gähnte, betrachtete die Landschaft und legte die Hand auf den Arm einer jungen Frau, die sorgfältig in einen Pelzmantel eingehüllt war.
»Wach auf, Julie«, sagte er mit heiserer Stimme, »sieh dir die Landschaft an! Sie ist prachtvoll.«
Julie steckte den Kopf aus dem Wagen. Sie trug eine Marderpelzmütze, und der pelzgefütterte Mantel, in den sie eingewickelt war, verbarg ihre Gestalt so völlig, daß man nur das Gesicht sehen konnte. Julie d’Aiglemont glich schon nicht mehr dem jungen Mädchen, das damals freudig und glücklich zu der Revue in die Tuilerien geeilt war. Ihr zartes Gesicht hatte die rosigen Farben eingebüßt, die es ehedem hatten so blühend erscheinen lassen. Ihr schwarzes, von der Feuchtigkeit der Nacht aufgelöstes Haar ließ das matte Weiß des Gesichts hervortreten, dessen Lebhaftigkeit erstarrt schien. Ihre Augen glänzten allerdings in einem übernatürlichen Feuer; doch unterhalb der Lider zeigten die müden Wangen violette Töne. Sie ließ ihre Blicke gleichgültig über die Landschaften des Cher, der Loire mit ihren Inseln, über Tours und die langen Felsen von Vouvray schweifen, dann sank sie schleunigst wieder in die Polster des Wagens zurück, ohne das entzückende Tal der Cise ansehen zu wollen, und sagte mit einer Stimme, die im Freien außerordentlich schwach klang: »Ja, es ist wunderbar.«
Sie hatte, wie man sieht, über ihren Vater gesiegt – zu ihrem Unglück.
»Julie, möchtest du nicht hier leben?« – »Oh, hier oder anderswo«, sagte sie leichthin. »Fehlt dir etwas?« fragte sie der Oberst d’Aiglemont. »Keineswegs«, erwiderte die junge Frau mit erzwungener Lebhaftigkeit. Sie blickte ihren Mann lächelnd an und fügte hinzu: »Ich möchte schlafen.«
Plötzlich ertönte der Galopp eines Pferdes. Victor d’Aiglemont ließ die Hand seiner Frau los und wandte den Kopf nach der Biegung, die der Weg an dieser Stelle macht. Sobald der Oberst von Julie wegblickte, schwand der heitere Ausdruck, den sie ihrem blassen Gesicht gegeben hatte, als wäre ein heller Schein plötzlich erloschen. Da sie weder den Wunsch hatte, die Landschaft wiederzusehen, noch die Neugier zu wissen, wer jener Kavalier sei, dessen Pferd so wild dahergaloppierte, drückte sie sich in die Ecke des Wagens und hielt die Augen starr auf das Hinterteil der Pferde gerichtet, ohne irgendein Gefühl zu verraten. Sie hatte den stumpfen Blick eines bretonischen Bauern, wenn er die Predigt seines Pfarrers hört. Ein junger Mann auf einem kostbaren Pferde kam plötzlich aus einem Wäldchen von Pappeln und blühendem Hagedorn hervor.
»Das ist ein Engländer«, sagte der Oberst. »Ach Gott, ja, Monsieur le Général«, erwiderte der Postillion; »es ist einer von den Kerlen, die, wie man sagt, Frankreich fressen wollen.«
Der Unbekannte war einer jener Reisenden, die sich auf dem Kontinent befunden hatten, als Napoleon in Erwiderung der Verletzung des Völkerrechts durch das Kabinett von Saint-James, nach dem Bruch des Vertrags von Amiens, alle Engländer festnehmen ließ. Diese Gefangenen, die den Launen der kaiserlichen Macht unterstellt waren, blieben nicht alle an den Orten, wo sie festgenommen worden waren, noch an denen, die sie anfangs nach Belieben wählen konnten. Die meisten von denen, die zu dieser Zeit die Touraine bewohnten, waren aus den verschiedensten Teilen des Reichs, wo ihr Aufenthalt die Interessen der kontinentalen Politik hätte gefährden können, dorthin transportiert worden. Der junge Gefangene, der hier seine Vormittagslangeweile spazieren führte, war solch ein Opfer der bürokratischen Macht. Vor zwei Jahren hatte er auf Befehl des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten Montpellier, wo er sich zur Zeit des Friedensbruchs aufhielt, um Heilung von einem Lungenleiden zu erlangen, verlassen müssen. Im Augenblick, da der junge Mann in dem Comte d’Aiglemont einen Offizier erkannte, suchte er dessen Blicken auszuweichen und wandte den Kopf auffällig genug den Ufern der Cise zu.
»Alle diese Engländer sind unverschämt, als ob die Erde ihnen gehörte«, brummte der Oberst; »nun, Soult wird sie schon zwiebeln!«
Als der Gefangene an der Kalesche vorbeiritt, warf er einen Blick hinein. Trotz der Flüchtigkeit dieses Blicks konnte er auf dem nachdenklichen Gesicht der Comtesse der Melancholie gewahr werden, die ihm einen so unbeschreiblichen Reiz verlieh. Es gibt viele Männer, die durch den bloßen Anblick des Leidens einer Frau mächtig bewegt werden; in ihren Augen scheint der Schmerz eine Bürgschaft der Treue oder der Liebe zu sein. Julie, die ganz in die Betrachtung eines Kissens in ihrem Wagen versunken war, achtete weder auf das Pferd noch auf den Reiter. Der Riemen war rasch und fest ausgebessert worden. Der Comte stieg wieder in den Wagen. Der Postillion bemühte sich, die verlorene Zeit wieder einzuholen, und fuhr in raschem Trab auf dem Damm dahin, den die überhängenden Felsen begrenzen, in deren Schoß die Weine von Vouvray reifen und auf denen so viele hübsche Häuser emporragen. In der Ferne konnte man die Ruinen der berühmten Abtei von Marmontiers, den Zufluchtsort des heiligen Martin, erblicken.
»Was will dieser pergamentene Mylord eigentlich von uns?« rief der Oberst, nachdem er sich vergewissert hatte, daß der Reiter, der seinem Wagen von der Cisebrücke an folgte, tatsächlich der junge Engländer war.
Da der Fremde damit, daß er auf dem Damm spazieren ritt, kein Gebot der Höflichkeit verletzte, lehnte sich der Oberst in seine Ecke des Wagens zurück, nachdem er dem Engländer noch einen drohenden Blick zugeworfen hatte. Aber er konnte trotz seiner unwillkürlichen Feindseligkeit nicht umhin, die Schönheit des Pferdes und die Anmut des Reiters zu bewundern. Der junge Mann hatte ein typisch britisches Gesicht mit so feinem Teint und so glatter, weißer Haut, daß man meinen konnte, es gehöre einem schönen jungen Mädchen. Er war blond, schmal und groß. Sein Anzug hatte jenes Gepräge von Sorgfalt und Reinlichkeit, das die Fashionablen des prüden England auszeichnet. Es hatte den Anschein, als ob er mehr aus Schamhaftigkeit als vor Vergnügen beim Anblick der Comtesse errötet war. Ein einziges Mal hob Julie die Augen auf den Reisenden; aber es war auf Veranlassung ihres Mannes, der wünschte, daß sie die Beine eines reinrassigen Pferdes bewundern sollte. Dabei begegneten ihre Augen denen des schüchternen Engländers. Von da an ließ er sein Pferd einige Schritte hinter der Kalesche hertraben, anstatt daneben zu reiten. Die Comtesse hatte den Fremden kaum angesehen. Sie bemerkte an Pferd und Reiter keine der Vollkommenheiten, auf die sie aufmerksam gemacht worden war, und sank mit einer leichten Bewegung der Augenbrauen, die eine Zustimmung bedeuten sollte, in den Wagen zurück. Der Oberst schlief wieder ein, und die beiden Gatten kamen nach Tours, ohne ein Wort gewechselt zu haben und ohne daß die reizenden Bilder der wechselnden Landschaft, durch die sie fuhren, ein einziges Mal Juliens Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten. Während ihr Mann schlummerte, betrachtete ihn Julie hin und wieder. Bei dem letzten Blick, den sie ihm zuwarf, fiel durch einen Stoß des Wagens ein Medaillon, das sie an einer Trauerkette um den Hals trug, auf ihren Schoß und zeigte der jungen Frau plötzlich das Bild ihres Vaters. Bei diesem Anblick rollten die bisher unterdrückten Tränen aus ihren Augen. Vielleicht hatte der Engländer die feuchtglänzenden Spuren, die diese Tränen einen Augenblick auf den blassen Wangen der Comtesse zurückließen, die jedoch in der Luft schnell trockneten, gesehen. Der Oberst d’Aiglemont war vom Kaiser beauftragt worden, dem Marschall Soult, der Frankreich gegen die Invasion der Engländer im Béarn zu verteidigen hatte, Befehle zu überbringen, und benutzte die Gelegenheit, seine Frau den Gefahren zu entziehen, die Paris damals bedrohten, und sie nach Tours zu einer alten Verwandten zu bringen. Alsbald rollte der Wagen über das Pflaster von Tours, über die Brücke und in die Grande Rue und hielt vor dem alten Palast, den die ehemalige Marquise de Listomère-Landon bewohnte.
Die Marquise de Listomère-Landon war eine von den schönen, alten Frauen mit blassem Gesicht, weißen Haaren und feinem Lächeln. Ihr Kleid und ihr Kopfputz gehörten einer längst vergessenen Mode an. Siebzigjährige lebende Abbilder des Zeitalters Ludwigs XV., sind diese Frauen fast immer zärtlich, als seien sie noch verliebt; sie sind weniger gottergeben als fromm, aber doch nicht so fromm, wie sie scheinen, und sie haben immer einen Duft von Puder à la maréchale an sich. Sie können gut Konversation treiben, noch besser plaudern, und lachen eher über eine Reminiszenz als über einen Scherz. Die Gegenwart mißfällt solchen Frauen. Als eine alte Kammerfrau der Marquise (denn sie sollte bald wieder diesen Titel führen dürfen) den Besuch eines Neffen, den sie seit dem Beginn des Spanischen Krieges nicht gesehen hatte, meldete, nahm sie rasch ihre Brille ab, klappte ihr Lieblingsbuch, die ›Galérie de l’Ancienne Cour‹, zu und begab sich dann mit einer gewissen Behendigkeit auf die Freitreppe, deren Stufen die beiden Gatten eben herabstiegen.
Die Tante und die Nichte warfen sich einen raschen Blick zu. »Bonjour, liebe Tante«, rief der Oberst, indem er die alte Dame hastig umarmte; »ich bringe Ihnen meine junge Frau, daß Sie sie in Schutz nehmen. Ich vertraue Ihnen meinen Schatz an. Meine Julie ist weder kokett noch eifersüchtig, sie ist sanft wie ein Engel. Und ich hoffe, sie wird hier nicht schlimmer werden«, unterbrach er sich. »Taugenichts!« sagte die alte Tante und warf ihm einen spöttischen Blick zu.