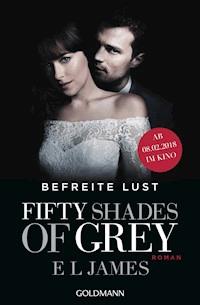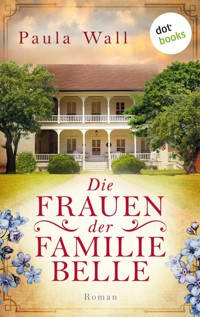
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Ein Liebesroman, der den Südstaatencharme der 30er Jahre versprüht: »Die Frauen der Familie Belle« von Paula Wall jetzt als eBook bei dotbooks. Ein ganz besonderer Zauber geht von den Frauen der Familie Belle aus: Die schöne Angela bringt die Männer reihenweise um den Verstand, denn mit ihrer Gabe, den Menschen bis auf den Grund der Seele zu schauen, weckt sie tiefe Sehnsüchte … Ihre Tante Charlotte sieht das gar nicht gern, denn schließlich muss der gute Ruf der Familie gewahrt bleiben! Doch als auch ihr eines Tages die Liebe begegnet – ausgerechnet in Gestalt des neuen Pfarrers des kleinen Städtchens –, da zögert sie selbst nicht und verführt ihn auf höchst ungewöhnliche Weise … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Frauen der Familie Belle« von Paula Wall ist ein sinnlicher Liebesroman voller Herz und mit einer Prise Frechheit. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein ganz besonderer Zauber geht von den Frauen der Familie Belle aus: Die schöne Angela bringt die Männer reihenweise um den Verstand, denn mit ihrer Gabe, den Menschen bis auf den Grund der Seele zu schauen, weckt sie tiefe Sehnsüchte … Ihre Tante Charlotte sieht das gar nicht gern, denn schließlich muss der gute Ruf der Familie gewahrt bleiben! Doch als auch ihr eines Tages die Liebe begegnet – ausgerechnet in Gestalt des neuen Pfarrers des kleinen Städtchens –, da zögert sie selbst nicht und verführt ihn auf höchst ungewöhnliche Weise …
Über die Autorin:
Paula Wall wurde in Tennessee geboren und ist in Alaska aufgewachsen. Sie hat in den USA zwei viel beachtete Sammlungen von Essays veröffentlicht und wurde für ihre amüsanten Kolumnen zur »Humor Columnist of the Year« gekürt. Heute lebt sie in der Nähe von Nashville, Tennessee. Mit ihren Romanen feierte sie international große Erfolge.
Paula Wall veröffentlichte bei dotbooks »Die Frauen der Familie Belle« und »Die Geheimnisse der Schwestern Wilde«.
Die Website der Autorin:
www.paulawall.com/
***
eBook-Neuausgabe November 2019
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2004 by Paula Wall
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »The Rock Orchard« bei Atria Books.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2005 bei Knaur Verlag. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/muratart, John Wollwerth, Jeffrey M. Frank, Helena Ohman, kraphix, kboonjit, Rakopton Tanyakami LPN, Nikki Zalewski, BK Foto, lisima
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-697-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Frauen der Familie Belle« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Paula Wall
Die Frauen der Familie Belle
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriela Schönberger
dotbooks.
Für Sheila,meine Freundin,Schwester und Muse.
Danksagungen
Mein größter Dank gebührt folgenden Menschen: Aaron Priest, meinem weisen Salomon; Emily Bestler, der besten aller (amerikanischen) Lektorinnen und wahren Südstaatenschönheit; Lucy Childs und Sarah Branham, meinen beiden Schutzengeln; Deborah Lovett –wenn sie keine Antwort wusste, dann konnte ich die Frage vergessen; Nanette Noffsinger-Crowell, die mich wie eine Kompassnadel immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte; und all den unbekannten Helden bei meinem ursprünglichen amerikanischen Verlag Atria, die dieses Buch tatsächlich auf den Markt gebracht haben.
Und nicht zu vergessen: die Andacht um sieben Uhr morgens in St. Paul, der Coffee and Tall Tale Club und Mutter Wall, der ich den Mut und die Begeisterung verdanke, eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen.
Und dir, Bill, danke ich für ... du weißt schon, was!
Vorwort
Nur weil eine Frau etwas besonders gut kann, heißt das noch lange nicht, dass sie damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen sollte. Wenn dem so wäre, dann müssten die weiblichen Mitglieder der Familie Belle allesamt als Freudenmädchen arbeiten. Es ist allgemein bekannt, dass die Damen harte Männer wie Butter in der heißen Bratpfanne schmelzen lassen können – und dass sie ebenso begabt sind, diesen Prozess wieder umzukehren.
Die Belles leben auf einem Felsvorsprung in einem Haus, das den Fluss überblickt, und es kommt einem so vor, als seien seine Besitzer ihres Geldes schon lange überdrüssig. Geißblatt rankt sich um die Säulen der Veranda wie Fäden um eine Spule, und wild wie Unkraut wuchernde Rosen bohren sich in den Verputz wie Ungezieferlarven. Es wird für immer ein Geheimnis bleiben, wo der Rasen des Anwesens endet und der angrenzende Friedhof beginnt. Menschen wie die Belles haben kein Problem, in enger Nachbarschaft mit den Toten zu leben.
Es ist schon einige Jahre her, da hat die Historische Gesellschaft große Anstrengungen unternommen, unsere langweilige kleine Stadt in eine Touristenattraktion zu verwandeln. Man hat eine Messingplakette am Tor zum Anwesen der Belles anbringen lassen und das alte Haus zu einer historischen Sehenswürdigkeit deklariert.
»Bellereve«, steht auf der Plakette zu lesen, »wurde im Jahr 1851 von Colonel Bedford Braxton Belle für seine Braut Musette erbaut. Während des Bürgerkriegs war darin ein Lazarett für Soldaten beider Armeen untergebracht, die in der Schlacht um Fort Donelson verwundet worden waren.«
Geschichte sollte man niemals wörtlich nehmen. Entweder glorifizieren die Leute sie, oder sie reden sie schlecht. Zumindest verleihen sie ihr eine gewisse Färbung. Was die Plakette verschweigt, ist die Tatsache, dass auf den Ziegelsteinen die Fingerabdrücke unzähliger Sklaven eingebrannt sind und dass das Blut der verwundeten Soldaten durch die Zimmerdecke sickert und wässrig rote Tropfen wie Tränen von den Kronleuchtern fallen, wenn es zu regnen beginnt – ganz gleich, wie oft das Haus verputzt und neu gestrichen wird.
Die Plakette klärt den Besucher auch nicht darüber auf, dass Musette franko-kanadischer Abstammung und die zweite Frau von Bedford Braxton Belle war. Seine erste Frau war zwar weder tot noch von ihm geschieden, aber Musette hatte eine Art an sich, die jeden Mann um den Verstand brachte und ihn vergessen ließ, dass zu Hause bereits eine Frau auf ihn wartete.
Musette hatte schwarzes Haar und schwarze Augen und konnte die Zukunft besser lesen als die meisten Männer die Zeitung. Und wenn ihr nicht gefiel, was sie sah, setzte sie alles daran, es zu ändern.
»L'avenir n'est pas taillé dans la pierre«, pflegte sie zu sagen, während sie langsam die Karten umdrehte, »seulement votre épitaphe.«
Was nichts anderes heißt, als: »Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, nur unsere Grabinschrift.«
Man sagt, Musette konnte ihre Hand in den Fluss stecken und den exakten Tag vorhersagen, an dem er gefrieren würde. Sie konnte einem Neugeborenen die Hand auf das Herz legen und sah sein ganzes Leben vor sich. Musette sagte Feuersbrünste, Überschwemmungen und Wirbelstürme voraus, und einen Monat, bevor die Yankee-Soldaten die Grenze des Staates Tennessee überschritten, wies sie die Dienstboten an, jedes Bettlaken, jeden Unterrock und jeden Kopfkissenbezug im Haus in Streifen zu zerreißen und zu Verbandszeug aufzurollen.
Trotz ihrer hundertprozentigen Trefferquote wollte Bedford Braxton Belle jedoch nicht auf sie hören, als sie ihm vorhersagte, dass Alkohol sein Ende bedeuten würde. Ein Pferd lässt sich brav an die Tränke führen, aber ein sturer Esel braucht seinen Whiskey unverdünnt. Musette verlor ihren Mann in der Schlacht von Franklin durch den Schuss eines Soldaten der Unionsarmee. Er war gerade dabei, sich an einem Persimonenbaum zu erleichtern. Wie tröstlich, zu wissen, dass er von alledem nichts mitbekam.
Braxton Belle hauchte sein Leben mehr oder weniger sang- und klanglos aus. Aber die wenigsten Männer sind zum Helden geboren. Die meisten hinterlassen als Zeichen ihrer irdischen Existenz nur einen Stein an der Stelle, an der ihre Knochen verscharrt sind.
Musette trug für den Rest ihres Lebens Schwarz, aber das stand ihr ohnehin am besten. Und es verging nicht ein Tag, an dem sie nicht die welken Blätter von Braxtons Grab fegte und seinen granitenen Grabstein küsste. Die Geschichte mag einen gewöhnlichen Mann vergessen, aber Frauen haben ein Gedächtnis wie Fliegenpapier.
Wenn Frauen lieben, dann ohne Sinn und Verstand. Musette sollte niemals mehr einen anderen Mann lieben, wenn sie auch nichts dagegen hatte, die Liebe anderer Männer zu erhören. Man sagt, sie hieß mehr Männer bei sich willkommen als die Freiheitsstatue im Hafen von New York. Ungeachtet der Tatsache, dass jede Ehefrau, Witwe und ledige Jungfer in der Stadt um ihr frühes Ableben betete, wurde Musette steinalt und starb friedlich im Schlaf. Man begrub ihren Körper auf dem Friedhof neben dem Haus, das den Fluss überblickt, aber ihr Geist schwebt weiter in der Luft wie das Parfüm einer heimlichen Geliebten.
An Musettes Grab ist eine weiße Marmorstatue zu bewundern, die so real wirkt, dass man schwören möchte, ihre Augen sehen einen an und ihre steinernen Brüste heben und senken sich im Rhythmus unirdischer Atemzüge. Nackt, wie Gott sie schuf, blickt die marmorne Musette dem männlichen Betrachter herausfordernd in die Augen, ohne fromm den Blick zu senken. Ihr gegenüber stehen zwei Engel, voll bekleidet, die Hände zum Gebet gefaltet, und schicken einen flehenden Blick gen Himmel, als wollten sie sagen: »O Herr, wir können nichts dafür.«
Was der eine als Kunst betrachtet, ist für den anderen eine Zumutung. Und so ist auch die tote Musette – nicht viel anders als zu ihren Lebzeiten – den meisten ein Dorn im Auge. Über hundert Jahre lang fühlten diejenigen, die in der Statue eine Beleidigung ihres ästhetischen Empfindens sahen, sich bemüßigt, einen verbissenen Kampf darum zu führen, dass die steinerne Musette entfernt, zumindest aber ihre Blößen bedeckt werden sollten.
Aber Geld schlägt Moral immer. Als ein Kunstprofessor aus Nashville den Moosbelag vom Sockel der Statue gekratzt hatte und den Namen »Rodin« in den Stein gemeißelt fand, geriet das Gleichgewicht der Kräfte ins Wanken. Die historische Gesellschaft ließ flugs eine Messingplakette anbringen und deklarierte Musette ebenfalls zur Historischen Sehenswürdigkeit. Jetzt eilen Experten von nah und fern herbei, um darüber zu debattieren, ob die steinerne Musette tatsächlich ein echter Rodin aus Paris oder ein echter Bodin aus Memphis ist, dessen Familie seit Menschengedenken für die Herstellung exklusiver Grabsteine bekannt ist.
Wo immer die Wahrheit auch liegen mag – und in unserer Gegend ist sie bekanntlich sehr flexibel –, viele junge Männer haben ihr Wissen über die weibliche Anatomie der Betrachtung von Musette Belles Statue zu verdanken, so wie nicht wenige ihrer Vorfahren diese am lebenden Modell studieren konnten. Selbst im Tod gelingt es Musette noch, die braven Bürger von Leaper's Fork zu schockieren, und ihre weiblichen Nachkommen bemühen sich nach Kräften, ihrem Erbe gerecht zu werden.
Musette gebar Solange, die wiederum Charlotte und Odette das Leben schenkte. Und Odette gebar Angela und die Dixie. Wenn es etwas gibt, das die Belle-Damen lieben, dann, sich fortzupflanzen.
Manche Frauen verkaufen ihren Körper wie Huren ihre Eheringe. Manche benutzen Sex als Waffe. Aber es gibt Frauen, die, wie Jesus, einen Mann durch die bloße Kraft ihrer Berührung heilen können. Jeder Mann, der vom Bett eines weiblichen Mitglieds der Familie Belle aus den Sonnenaufgang sieht, wird schwören, in dem Moment von den Toten auferstanden zu sein.
KAPITEL 1
Im Jahr 1920 wurde Odette Belles Heißluftballon von einem Blitz getroffen und fiel vom Himmel wie eine angeschossene Taube. Niemand war überrascht. Gott hatte sie seit Jahren im Visier. Welche Gefühle Odette für den Herrn gehegt haben mochte, auf dem sie gerade rittlings hockte, darüber kann man nur spekulieren.
Einige Zuschauer behaupten, Odette den ganzen Weg nach unten lachen gehört zu haben. Eigentlich mehr ein kehliges Meckern, das einem Mann zu verstehen gibt, dass er gerade eben den Sex seines Lebens verpasst hat.
Die Anwälte, die sich um Odettes Nachlass kümmerten, losten feierlich mittels gezogener Streichhölzer aus, wer ihren persönlichen Besitz ihrer nächsten Familienangehörigen überbringen sollte. Gestärkt mit einem Gläschen illegal gebranntem Whiskey, machte sich der Anwalt, der verloren hatte, auf den Weg und händigte Odettes uneheliches Balg Charlotte Belle auf einem Kissen aus, ehe er um sein Leben rannte.
»Welcher Mensch, der noch alle Sinne beisammen hat, würde mir schon ein Kind anvertrauen?«, fragte Charlotte ungläubig.
Charlotte Belle hatte seit dreiundzwanzig Jahren für allgemeines Kopfschütteln und Raunen gesorgt. Man hielt sie für einen kaltherzigen Vamp, der sich nichts dabei dachte, anderen Frauen die Ehemänner wegzunehmen. In Wahrheit konnte sie mit domestizierten Männern nichts anfangen – es sei denn, sie hatte keine andere Wahl. Und selbst dann stahl sie keine fremden Männer, sondern lieh sie sich nur mal kurz für eine Spritztour aus.
»Es ist doch immer das Gleiche: Die einen hinterlassen den Saustall, den die anderen dann wieder wegräumen dürfen«, seufzte Charlotte und blies langsam den Rauch ihrer Zigarre über den Kopf des Kindes.
Charlotte hatte keine Zeit für schwache Männer oder törichte Frauen. Vor allem aber verabscheute sie langweilige Menschen. Da sie die Erfahrung gemacht hatte, dass die meisten Menschen langweilig waren, konnte sie nur mit wenigen etwas anfangen. Und Odette hatte zur Kategorie der törichten Frauen gehört.
Charlotte hatte von ihrer Halbschwester seit acht Jahren weder etwas gehört noch gesehen, nur hin und wieder war ihr ein stornierter Scheck aus ihrem gemeinsamen Treuhandvermögen unter die Augen gekommen. Selbst nach Belle-Maßstäben war Odette wirklich wild gewesen. Wie sie es geschafft hatte, lange genug in der Missionarsstellung auszuharren, um schwanger zu werden, war allen ein Rätsel.
»Wenn dieses Baby genauso töricht ist wie seine Mutter«, sagte Charlotte, »sollten wir der Welt einen Gefallen tun und es wie einen jungen Hund im nächsten Teich ersäufen.«
Den Kopf leicht geneigt, die Hände vor der Schürze gefaltet, betrachtete Charlottes Haushälterin kritisch das Kind. Der Säugling, der mit sich und der Welt vollkommen zufrieden schien, nuckelte genüsslich an einem Zipfel des Kopfkissens, als wäre der in Karamell getaucht. Lettie zweifelte nicht daran, dass die Vorliebe des Kindes für Bettwäsche ein Vorbote kommender Ereignisse war.
»Eine echte Belle. Die hat bei ihrer Geburt bestimmt schon mit dem Arzt geflirtet.«
»Gewöhn dich besser nicht an sie«, befahl Charlotte streng, als ob Lüsternheit eine bei Kindern allgemein geschätzte Eigenschaft wäre. »Sie ist hier nur auf der Durchreise.«
Charlotte verbrachte ihre Abende im Poor Man's Country Club und ihre Tage schlafend im Bett, wo sie sich von ihren Nächten erholte. Sie liebte ihren Whiskey pur und sah es am liebsten, wenn ihre Liebhaber früh am Morgen wieder aus dem Haus verschwanden. Das Letzte, was sie wollte, war ein Kind, weder ein eigenes noch ein fremdes.
Es dauerte fast einen Monat, bis sie eine Verwandte fanden, die sich bereit erklärte, ihre Nichte bei sich aufzunehmen.
»Du willst sie Maude Meeks ausliefern?«, schnaufte Lettie ungläubig. »Ich würde diesem Aasgeier nicht einmal einen Stein zur Pflege überlassen.«
Charlotte tat den Einwand der alten Frau mit einer Handbewegung ab, reckte entschlossen das Kinn vor und setzte ihre Unterschrift unter den Scheck. Nichts schmerzte Charlotte jedoch mehr, als sich von ihrem ererbten Vermögen zu trennen.
Lettie drückte das Baby an ihre Schulter und betrachtete missbilligend den Scheck.
»Schon erstaunlich, was Herzensgüte heutzutage für einen Preis hat. Da käme es billiger, sie zu behalten.«
»Alte Frau, damit wollen wir gar nicht erst anfangen«, drohte Charlotte, schob den Scheck in einen Umschlag und fuhr mit der Zunge über den gummierten Rand. »Wir werden doch nicht jeden streunenden Hund bei uns aufnehmen, den man uns auf die Veranda legt.«
»Na, dann kannst du sie wenigstens noch einen Moment halten, während ich ihre Sachen hole«, sagte Lettie und legte Charlotte das Baby in den Arm, noch ehe diese protestieren konnte.
»Herr im Himmel!« Charlotte hielt das rosa Flanellbündel auf Armeslänge von sich gestreckt, als versuchte ihr Körper, es abzustoßen.
Lettie blieb an der Tür stehen, verschränkte die Arme vor der Brust und musterte die beiden. Man hätte sie für Mutter und Tochter halten können, aber Charlotte hätte ihr Junges bestimmt schon gleich nach der Geburt aufgefressen.
»Ihr zwei seid aus demselben Holz geschnitzt«, bemerkte sie schließlich. »Nichts als Ärger, von der Wiege bis ins Grab.«
»Teufel aber auch«, sagte Charlotte und schielte auf das Kind hinunter. »Damit sehe ich ja aus wie eine Heilige.«
»Ich schätze, dein frommer Cousin von der Kirche Jesu wird ihr eine Höllenangst einjagen«, meinte Lettie auf dem Weg aus dem Zimmer und rümpfte die Nase.
Lettie war Baptistin. Charlotte hatte die Beobachtung gemacht, dass Baptisten und Anhänger der Church of Christ sich zwar einig waren, wenn es darum ging, was man als guter Gläubiger zu tun oder zu lassen hatte, sonst aber kein gutes Haar aneinander ließen.
Sobald Lettie außer Sichtweite war, zog Charlotte die oberste Schublade ihres Schreibtisches heraus, räumte sie aus und legte den Säugling hinein. Das Kind, das sich seine kleine Faust in den Mund gesteckt hatte, blickte Charlotte aus brennenden, schwarzen Augen an.
»Nimm es nicht persönlich«, sagte Charlotte und nahm eine lange, dünne Zigarre aus ihrem Humidor. »Es geht hier rein ums Geschäft.«
Die Frauen der Familie Belle besaßen nicht nur Talent für die Liebe, sondern auch fürs Geschäft. An einem guten Tag gelang es ihnen sogar, beides zu vereinen. Dunkle Samtvorhänge verhüllten die Fenster von Charlottes Arbeitszimmer, und seidene Fransentücher dämpften den Schein der Tiffanylampen. Charlottes Mahagonischreibtisch war so groß wie ein Doppelbett, und es war nichts Außergewöhnliches, dass sie geschäftliche Besprechungen in ihrem Seidenpyjama abhielt. Wenn ein Mann Charlottes Arbeitszimmer betrat, verspürte er den sofortigen Drang, seine Krawatte zu lockern.
Für Männer ist Geschäft gleich Krieg, für Charlotte war es wie Sex. Am Ende einer jeden Verhandlung sollten die Beteiligten befriedigt auseinander gehen.
Charlotte entfachte ein Streichholz an der Unterseite der Armlehne, hielt die Zigarre in die Flamme und drehte sie. Dann schüttelte sie die Flamme aus, lehnte sich zurück und betrachtete das Baby in der Schublade. Das Kind lag vollkommen reglos da, als spürte es, dass die Waagschale seines Schicksals auf der Kippe stand.
Charlotte hatte nicht einen mütterlichen Zug an sich. Sie empfand nicht das Geringste beim Anblick eines Säuglings. Und sie verspürte keinerlei sentimentalen Drang, Hilflosen zu helfen. Charlotte war in erster Linie Geschäftsfrau. Sie blickte auf das Kind hinunter und sah ein enormes Startkapital mit einer hohen Verlustwahrscheinlichkeit und einer nur schwer berechenbaren Rendite.
Aber es stellte sich die Frage, wer eines Tages ihr Vermögen übernehmen sollte, wenn sie einmal das Zeitliche segnete. Charlotte hatte ihr sattes Erbe nicht in ein unanständig hohes Vermögen verwandelt, um es dann irgendwelchen schmarotzenden Verwandten zum Verschleudern in den Rachen zu werfen.
»Ach, Scheiße!«, knurrte Charlotte.
»Ssch!«, spuckte das Baby als Erwiderung.
Mit gerunzelter Stirn beugte sich Charlotte über die Schublade.
»Was hast du gesagt?«
Höchstwahrscheinlich war es nur ein Niesen oder sonst ein Geräusch gewesen, das Säuglinge so von sich geben, aber Charlotte sah darin ein Zeichen. Wenn überhaupt jemals ein Kind in ihre Fußstapfen treten sollte, dann eines, dessen erste Kommunikationsversuche aus einem unanständigen Wort bestanden.
»Lettie!« Charlottes Stimme hallte durch das alte Haus, während sie den Scheck zerriss. »Das verdammte Ding bleibt!«
Lettie konnte sie nicht hören. Sie war oben auf dem Speicher und staubte gerade die Wiege ab.
KAPITEL 2
Falls das Kind bereits einen Namen gehabt haben sollte, so hatte der Anwalt, der es brachte, vergessen, diesen zu erwähnen, als er hinaus zu seinem Studebaker um sein Leben rannte. Windeln mitzubringen, hatte er ebenfalls vergessen, was zu diesem Zeitpunkt ein größeres Versäumnis war.
»Wie gefällt dir der Name ›Hope‹?«, fragte Lettie, während sie dem Baby die Flasche gab.
Charlotte bemühte sich nach Kräften, Lettie zu ignorieren. Jeden Nachmittag von eins bis drei verbrachte Charlotte auf ihrer Chaiselongue. Aber sie hielt kein Nickerchen, wie sie immer wieder betonte. Nur weil eine Frau auf dem Rücken liegt und die Augen geschlossen hält, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht arbeitet.
»Charity ist auch ein guter Name«, plapperte Lettie weiter. »Aber eigentlich hatte ich immer schon eine Vorliebe für Faith.« Nach jahrzehntelangem Zusammenleben mit Charlotte war Lettie daran gewöhnt, die gesamte Konversation allein zu bestreiten. »Aber da wäre natürlich auch noch Patience.«
Charlotte runzelte kurz die Stirn auf ihrer Chaiselongue. Der Name brachte eine Saite bei ihr zum Klingen. Geduld, Hartnäckigkeit – das waren Charakterzüge in einem Menschen, die ihr am meisten imponierten.
»Nein, das klingt mir zu sehr nach Quäkern«, verwarf Charlotte den Vorschlag.
»Chastity«, konterte Lettie.
Glaube, Liebe, Hoffnung – und jetzt auch noch Keuschheit. Charlotte wusste, dass es höchste Zeit war, sich einzumischen, bevor das Kind als Plattitüde durchs Leben lief.
»Wir werden sie Angela nennen«, verkündete sie kurz entschlossen. »Angela Belle.«
»Die Schwester deiner Urgroßmutter hieß Angela.« Lettie hob das Kind an ihre Schulter und klopfte ihm auf den Rücken. »Sie trug eine Hühnerkralle um den Hals, und wenn Vollmond war, tanzte sie nackt auf dem Friedhof.«
»Man ist keine echte, blaublütige Belle, wenn man nicht vollkommen verrückt ist«, sagte Charlotte mit einem Anflug von Stolz.
Lettie blickte auf die kindliche Sirene hinunter, die sie auf dem Arm trug. Angela. Dieses Wesen hatte absolut nichts Engelhaftes an sich. Im Gegenteil, dunkel verhangene Schlafzimmeraugen und ein schwellender Kussmund verhießen nichts Gutes.
Lettie stand jetzt seit drei Generationen im Dienst der Belles. Sie war fest entschlossen, wenigstens aus einer Angehörigen dieser Familie eine respektable Dame zu machen, bevor sie starb.
»Gut, dann bleibt es bei Angela«, erklärte Lettie, und damit war die Sache erledigt.
KAPITEL 3
Charlotte entschied sich für einen antiautoritären Erziehungsstil, zog ihre Nichte mit Grapefruitsaft groß und ließ sie halb nackt mit den Jungen ihres Handwerkers herumtoben.
»Angela Belle!«, ertönte Letties Ruf von der Veranda. »Du kommst augenblicklich herein und ziehst dir ein Hemd an!«
»Boone Dickson hat auch keines an!«, brüllte Angela zurück.
»Sie tanzt dir auf der Nase herum«, brummte Charlotte hinter ihrer Zeitung.
Tag für Tag las Charlotte ihrer Nichte den Wirtschaftsteil der Zeitung vor, und Angela hörte so gebannt zu, als verstünde sie jedes Wort. Kirchgänger, die am Sonntag am Haus vorbeikamen, sahen die beiden auf der vorderen Veranda sitzen und schüttelten die Köpfe. »Sie sollte das Kind lieber in die Kirche schicken«, mokierten sie sich und wiederholten ihren Kommentar, wenn sie nach dem sonntäglichen Abendgottesdienst ein zweites Mal vorbeigingen.
An Angelas erstem Schultag sollte es mit ihrer Freiheit fürs Erste vorbei sein. Lettie schrubbte ihre schwarzen Füße mit Bimsstein und Bürste und brachte es irgendwie fertig, dem Kind Spitzensöckchen und Lackschuhe an die Füße zu zwängen. Heftig um sich tretend, fluchte Angela wie ein Leichtmatrose, während Lettie mit einem Kamm ihr Haar zu bändigen suchte.
»Scheiße!« Angela wich mit zusammengebissenen Zähnen zurück, Tränen liefen über ihre Wangen.
Als Lettie endlich mit ihr fertig war, war die Verwandlung perfekt.
»Du siehst aus wie eine kleine Dame«, strahlte Lettie und klatschte in die Hände. »Und jetzt bemüh dich und benimm dich auch so.«
Den ganzen Tag sahen Charlotte und Lettie auf die Uhr. Als Angela schließlich den Gehsteig entlanggeschlendert kam, standen sie bereits am Tor.
»Wo sind deine neuen Schuhe?«, fragte Lettie und starrte auf die schmutzigen, nackten Füße.
»Ich habe die verdammten Dinger verschenkt«, erwiderte Angela, fasste sich unter den Rock und zerrte an der kratzigen Spitzenunterwäsche.
»Wem hast du sie gegeben?«, wollte Charlotte wissen.
»KyAnn Merriweather.«
»Was hat KyAnn Merriweather getan, um deine Schuhe zu verdienen?«
»Ihre Füße haben geblutet.«
»Wieso haben sie geblutet?«
»Weil sie barfuß auf eine zerbrochene Bierflasche getreten ist.«
»Tja, so ist es eben, wenn man in Stringtown wohnt«, höhnte Charlotte.
Ein Bettler, der an Charlottes Tür klopfte und um ein Almosen bat, bekam einen Besen in die Hand gedrückt. Charlotte war reich geboren und würde noch reicher sterben. Für eine Frau, die in ihrem ganzen Leben noch nicht einen Tag wirklich hart gearbeitet hatte, war sie kompromisslos, was die Arbeitsmoral anderer Leute betraf.
»Es gibt einen Grund, weshalb die Reichen reich und die Armen arm sind«, pflegte Charlotte zu sagen. »Und Geld hat damit absolut nichts zu tun.«
Das Einzige, das Charlotte noch mehr als ein um Almosen bettelnder Mensch irritierte, war ein Mensch, der auf diese Bitte auch noch einging. Wohltäter begingen in ihren Augen Hochverrat an der Menschheit. Schließlich hatten die Gründerväter der amerikanischen Geschichte nicht ihre Abhängigkeit, sondern ihre Unabhängigkeit erklärt.
Im Kapitalismus gilt – wie in der Natur – das Recht des Stärkeren. Wohltäter haben im Gegensatz dazu nur das Überleben des Schwächeren im Sinn. Ginge es nach diesen Weltverbesserern, würde – und das war Charlottes feste Überzeugung – der amerikanische Adler bald zu einer gurrenden, um Brosamen bettelnden Taube mutieren. Unnötig, hinzuzufügen, dass Charlotte im New Deal auch nur einen Riesenbeschiss für die Reichen sah.
»Besteuere, und du bekommst weniger, subventioniere, und du bekommst mehr«, predigte Charlotte ihrer Nichte.
Aber nichts, was Charlotte sagte oder tat, konnte ihre Nichte von ihrer ökonomischen Evolutionstheorie überzeugen. Jeden Tag kehrte Angela mit weniger aus der Schule zurück, als sie dort hingetragen hatte. Sie verschenkte ihr Pausenbrot, ihre Büchertasche und ihre Haarschleifen. Als sie anfing, auch noch ihre Kleider zu verschenken, schob Lettie dem rasch einen Riegel vor.
»Keine hübschen Kleider mehr für dich«, erklärte Lettie und stopfte den Lumpen, mit dem Angela nach Hause gekommen war, in den Lumpensack.
Das war kein Problem für Angela.
Merkwürdigerweise stellte auch die Schule für Angela nicht das geringste Problem dar, im Gegenteil, ihr flog alles nur so zu. Ihre Hausaufgaben hatte sie bereits gelöst, noch ehe der Lehrer sie vollständig aufgegeben hatte, und sie las doppelt so viele Bücher, wie eigentlich verlangt waren. Ihr Geschichtsverständnis war so ausgeprägt, als hätte sie alles selbst miterlebt. Am überraschendsten war jedoch, dass sie sich vor die Klasse hinstellen und mit einer Leidenschaft und Klarheit deklamieren konnte, als wollte sie einer Sarah Bernhardt Konkurrenz machen.
»Auf dem Kirchhof von Cambridge«, las Angela vor, mit kerzengeradem Rücken, das Buch in der Hand. »Von Henry Wadsworth Longfellow.«
»Im Dorf, auf dem Kirchhof, da liegt sie,Staub in den sterngleichen Augen.Leer, ohne Atem, Gefühl oder Regung ...War einst eine Dame von Rang sie,verblendet von Ruhm,Pomp und Tand dieser Welt? ...Und im Jenseits? Was nützt euch ein Blickauf die schrecklichen Seiten des Buches,um ihr Versagen und ihre Fehler zu richten?Ah, dann werdet anderen Kummer ihr haben,mit eurer eigenen Not und Verzweiflung,euren eigenen geheimen Sünden und Ängsten!«
»Jawohl«, seufzte Lehrer Hobbs, die Hand aufs Herz gelegt. »Das war einfach schön. Was kannst du uns denn nun über dieses Gedicht sagen, Angela?«
Angela drückte das Buch fest an ihre Brust und richtete ihre dunklen, gefühlvollen Augen auf einen Ort in weiter Ferne, den außer ihr niemand sehen konnte.
»Diese tote Frau hat geglaubt, dass ausgerechnet ihre Scheiße nicht stinkt«, sagte Angela feierlich. »Aber wir dürfen sie nicht verurteilen, da wir alle geboren sind, um zu sterben.«
Obwohl Angela von allen Schülern im County am besten vorlesen konnte, schickte man doch lieber Sue Ellen Parker zum Lesewettbewerb des Staates Tennessee.
»Angela ist ein außergewöhnlich kluges und gutherziges Mädchen«, erklärte Lehrer Hobbs vorsichtig, »aber ihre ... wie soll ich sagen ... kecke Art bereitet uns doch manchmal große Sorgen.«
»Ich weiß, ich weiß«, musste Charlotte zugeben und zog an ihrer Zigarre. »Wir haben keine Ahnung, woher sie das hat.«
Keiner hatte die Nerven, es ihr ins Gesicht zu sagen, aber die meisten Leute machten Angelas Umgang mit anderen Kindern für ihre Probleme verantwortlich. »Wenn man sich dauernd mit weißem und schwarzem Pack herumtreibt, dann färbt das irgendwann mal ab«, hieß es.
Mit schwarzem Pack war KyAnn Merriweather gemeint.
Nach dem Tod von KyAnns Mutter wollte die neue Frau ihres Vaters keine Erinnerung an ihre Vorgängerin im Haus haben. Aber KyAnn war nun mal der offensichtlichste Nachlass der Verstorbenen. Die Folge war, dass KyAnn mehr Zeit bei den Belles als in ihrem eigenen Zuhause verbrachte.
»Die Kinder vermehren sich hier ja wie Karnickel«, knurrte Charlotte.
Wer nun auf wen abfärbte, darüber konnte man geteilter Meinung sein. Beide Mädchen hatten den Teufel im Leib, und in Letties Augen gab es nur eines, das sie retten konnte – die Kunst des Backens. Lettie war überzeugt, dass eine Frau, die einen Biskuitkuchen nicht ohne Kochbuch backen konnte, sogar in der Hölle keinen Fuß auf den Boden bekam.
»Wir beginnen mit Maisbrot«, beschloss Lettie und hob die zwei Mädchen auf Milchkästen. »Man muss klein anfangen.«
Lettie band den beiden Geschirrtücher um die Hüften und drückte jeder einen Holzlöffel in die Hand. Die reinste Verschwendung, dachte KyAnn, da die Geschirrtücher um vieles sauberer waren als die Kleider, die sie und Angela trugen.
»Der Teig muss glatt und das Fett heiß sein«, erklärte Lettie, während sie ein Ei in die Schüssel schlug. »Das ist das Geheimnis eines guten Maisbrots.«
Anschließend schloss Lettie KyAnns kleine, braune Finger um den Holzlöffel und bewegte ihre Hand kreisförmig in der Schüssel.
»Und jetzt rühr«, sagte sie.
KyAnn begriff nicht ganz, wozu das gut sein sollte. »Wozu soll ich kochen können?«, wollte sie wissen. »Frauen kochen«, entgegnete Lettie bestimmt. »Männer essen.«
Lettie hatte leider unterschätzt, welche Koordination von Hand und Auge vonnöten war, um eine Schüssel voller Teig umzurühren. Einmal kräftig gerührt, und schon tropfte der Maisbrotteig vom Küchentisch, und KyAnns Schüssel sauste wie ein Kreisel auf den Fußboden.
»Du musst die Schüssel mit einer Hand festhalten, während du mit der anderen rührst!«, herrschte Lettie sie an.
Drei Stunden später war das Haus voller Rauch. Fett tropfte von den Wänden, und auf dem Hof hinter der Küche stapelte sich verbranntes Maisbrot. Die beiden Mädchen sprangen wie zwei Tennisspieler hin und her und schlugen mit Holzspachteln nach dem heißen, spritzenden Fett, als würden sie Bienen vertreiben.
»Scheiße!«, zischte Angela bei jedem Knall.
Als endlich jedes Mädchen erfolgreich seinen ersten Maiskuchen gewendet hatte, standen Lettie die Tränen in den Augen. Was hier geschehen war, war ebenso ein Wunder wie Helen Kellers erstes geschriebenes Wort.
KAPITEL 4
Es war die Rede davon, Angela in der Stadt zur Schule zu schicken, aber irgendwie kam Charlotte nie dazu, dies in die Wege zu leiten. Während die anderen kleinen Mädchen vom Hügel lernten, welche Gabel man wann benutzt und wie man Walzer tanzt, verbrachte Angela ihre Nachmittage beim Schwimmen im Lick Creek und die Abende auf der Veranda, wo sie sich anhörte, wie Lettie in ihrem Schaukelstuhl schnarchte und Charlotte laut mit der Abendzeitung haderte.
»New Deal, du meine Fresse!«, schnaubte Charlotte beim Überfliegen der Schlagzeilen.
Angela und KyAnn saßen mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, kratzten ausgiebig ihre Flohstiche und starrten auf die Karten, die zwischen ihnen ausgebreitet lagen. KyAnn warf den Gummiball in die Luft und vertauschte die Karten so schnell, dass Angela kaum die Bewegungen ihrer Finger sehen konnte, bevor der Ball wieder aufsprang.
»Du solltest die Madison-Farm kaufen«, sagte Angela eines Tages aus heiterem Himmel.
»Und wieso sollte ich das tun?«, fragte Charlotte hinter ihrer Zeitung.
»Miss Madison sagt, dass Judge Lester von der Bank sie sonst nimmt.«
»Es ist nicht meine Aufgabe, die Leute zu retten, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht«, erwiderte Charlotte trocken.
Charlotte gehörte bereits die Hälfte des Countys. Sie brauchte keinen weiteren Grundbesitz.
»Außerdem kann man mit dem Land nichts anfangen.«
Charlotte blätterte die Zeitung um und faltete sie in der Mitte.
»Liegt zu weit draußen und ist zu hügelig für Farmland.«
Der Ball prallte leise auf den Boden der Veranda. Das Kinn auf die Brust gepresst, murmelte Lettie leise im Schlaf. Nach ein paar Minuten senkte sich die Zeitung auf Charlottes Schoß.
»Andererseits liegt die Farm am Fluss und auf dem Weg nach Nashville.«
Charlotte starrte in die Ferne und zog an ihrer Zigarre.
»Wenn da eine gute Straße durchginge ...«
»Wenn die Farm dir gehören würde«, unterbrach Angela Charlottes Überlegungen, »könnten die Madisons dort wohnen bleiben.«
Charlotte betrachtete ihre Nichte verblüfft, deren Instinkt zum Geldverdienen komplett zunichte gemacht wurde von ihrem unerklärlichen Drang, das Geld wieder auszugeben. Vielleicht war sie als Kind doch auf den Kopf gefallen.
Angela schüttelte die Karten in ihren gefalteten Händen und ließ sie auf den Boden fallen. Und Charlotte ging in ihr Arbeitszimmer, um den Madisons ein Angebot für ihren Grund und Boden zu machen.
***
In dem Sommer, in dem Angela vierzehn Jahre alt wurde, begann sie mit der Massenproduktion von Konserven. Sie und KyAnn kauften körbeweise Gemüse und Obst auf dem Bauernmarkt am Stadtplatz, schleppten alles in die Küche und machten sich ans Schälen, Schnipseln und Bohnenbrechen.
Charlotte, die nicht einmal Wasser in einem Teekessel erhitzen konnte, verstand die Welt nicht mehr.
»Woher, um Himmels willen, hat sie das nur?«, fragte sie, während sie und Lettie Angela dabei zusahen, wie sie mit einem Kochlöffel in einem Topf voller blubbernder, dicker Brombeermarmelade rührte.
»Muss ein väterliches Erbe sein«, mutmaßte Lettie, die Arme vor der Brust verschränkt.
»Odette war nie sehr anspruchsvoll gewesen«, erwiderte Charlotte kopfschüttelnd.
Gegen Ende des Sommers war der hintere Teil der Veranda nicht mehr zu betreten, so viele Dosen mit Tomaten, Mais und grünen Bohnen stapelten sich dort. Auf den Fensterbrettern reihten sich Steinguttöpfe mit eingemachten Gurken und Gläser voller Gelees, Marmeladen und anderem eingemachten Obst aneinander wie Motive auf einem Buntglasfenster. Charlotte konnte nachmittags kein Auge mehr zutun, so viele Gummidichtungen platzten.
»Dieses Kind wird einmal eine prachtvolle Ehefrau abgeben«, bemerkte Lettie zufrieden.
»Darauf würde ich nicht wetten«, meinte Charlotte und schnupperte anerkennend an einem Glas mit Marmelade. »Gib mir doch mal die Kekse.«
Als Charlotte irgendwann im Winter in der Speisekammer nach einem Glas Marmelade suchte, fand sie keines mehr. Schließlich erfuhr sie, dass ihre Nichte und KyAnn Merriweather sich ihren Wagen »ausgeliehen« und an die Armen in Stringtown Lebensmittel verteilt hatten.
Charlotte schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Es gibt kein Heilmittel für ein blutendes Herz«, stöhnte sie.
KAPITEL 5
Die Leute, die Dr. Adam Montgomery das alte Lester-Haus verkauften, warnten ihn erst dann vor den Nachbarn, als das Geschäft abgeschlossen war. Mittlerweile hatte er Angela Belle jedoch auf dem umlaufenden Balkon des Hauses gesehen und war ihr rettungslos verfallen.
»Die Belles gehören zu den ältesten und reichsten Familien im County«, erklärte Ann Lester, als sie bei Dr. Montgomery auf der Veranda saß und an ihrem Eistee nippte.
»Ihr Geld setzt schon langsam Moos an, so alt ist es«, fügte ihr Mann nickend hinzu.
»Aber meinen Sie, es würde ihnen einfallen, auch nur einen Groschen an die Kirche oder für karitative Zwecke zu spenden?«
»Nein, eher schneiden die sich die Pulsadern auf, als dass sie auch nur einmal ihre Brieftasche zücken würden.«
»Und ich muss schon sagen, auch ihre übrige Moral« – Ann Lester zwirbelte ihre Perlenkette – »lässt allerhand zu wünschen übrig.«
»Mit einem Wort: weißes Pack mit Geld«, verkündete Judge Lester.
Mit Urteilen über andere war Judge Lester immer schnell bei der Hand. Und das, obwohl er in einer Bank arbeitete. Schon erstaunlich, wie viel Weitsicht seine Eltern bewiesen hatten, als sie ihn Judge – Richter – nannten.
»Geld allein ist eben immer noch keine Garantie für Klasse«, fasste Ann Lester zusammen.
Dr. Adam Montgomery, dessen Geld so neu war, dass die Tinte auf den Banknoten noch nicht trocken war, wusste genau, was sie meinte.
Das von ihm erworbene Haus hatte einem alten, unverheirateten Onkel von Judge Lester gehört, der im Schlaf und mit einem Lächeln auf dem Gesicht verstorben war, neben sich im Bett seine Haushälterin und auf dem Nachttisch eine Dreiviertelliterflasche Jack Daniel's. Zum Glück hatte Judge die Flasche gefunden, bevor der Sheriff kam, sodass der Name Lester unbefleckt geblieben war. Als Nachkomme einer langen Reihe moralisch zweifelhafter Männer legte Judge großen Wert auf Diskretion.
Die Lesters verkauften das alte Haus an den jungen Arzt samt allem Inventar und allen Alkoholvorräten. Das Dach leckte, die Dielenbretter knarrten, und die muffigen Räume waren dunkel wie ein Grab, aber von der Ferne sah das alte Haus prachtvoll aus. Für Adam Montgomery war eine hübsche Fassade ohnehin wichtiger als das, was eventuell dahinter steckte.
Adam Montgomery hatte blondes Haar und dunkelblaue Augen, die man als nachdenklich hätte bezeichnen können. Er hatte einen perfekten Körper und trug seinen maßgeschneiderten Anzug mit unnachahmlicher Eleganz. Mit seinem Gardemaß brauchte er nur leicht das Kinn zu heben und konnte auf alle herabsehen.
Er zog in das alte Lester-Haus, ohne die geringsten Änderungen vorzunehmen. Bis auf den Buchstaben »L« an dem Türklopfer aus Messing ließ er alles beim Alten, und selbst dazu benötigte er noch beinahe ein Jahr.
Wenn die Leute an dem alten Haus vorbeispazierten und Dr. Montgomery zufrieden auf der vorderen Veranda sitzen sahen, eine Zigarre zwischen den Fingern, ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß, dann schüttelten sie nur den Kopf. Alle hielten es für ein schlechtes Omen, dass ein junger, lediger Mann das Haus eines alten Hagestolzes gekauft hatte. Aber wann immer die Freude über sein Junggesellendasein ihn zu überwältigen drohte, ließ Adam seine Taschenuhr aufschnappen und betrachtete so lange das Bild seiner feinsinnigen Verlobten, bis die Euphorie verebbte.
Die Zukunft des jungen Paares war bereits bis ins Kleinste geplant. Adam sollte sich ein Haus suchen, es einrichten, die lukrative Arztpraxis des alten Doktors, der in den Ruhestand ging, übernehmen und dann seine zukünftige Braut nachholen. Und Dr. Montgomery war nicht gewillt, von diesem Plan auch nur ein Jota abzuweichen. Die Route, die sein Lebensschiff einschlagen sollte, stand schon lange fest. Umwege waren keine vorgesehen.
Als er nun Angela Belle – flach auf dem Rücken liegend, die Knie angezogen und japsend wie ein Jagdhund – in seinem Blumenbeet vorfand, war er vollkommen hilflos.
»Mein Gott«, stöhnte Dr. Montgomery und fiel auf die Knie, »Sie bekommen ja ein Kind!«
Mit siebzehn musste Angela feststellen, dass sie schwanger war. Charlotte machte dafür voll und ganz ihre philanthropische Natur verantwortlich.
Wäre gerade irgendwo ein Krieg im Gange gewesen, hätte Lettie Angela einen Ring an den Finger gesteckt und jedem erklärt, dass der Vater des Kindes Dienst am Vaterland leistete. Und zur rechten Zeit hätte sie ihn dann sterben lassen und ihm vielleicht sogar noch einen Orden verliehen. Aber es herrschte kein Krieg, zumindest keiner, der in Leaper's Fork wichtig gewesen wäre. Und so wussten alle, dass Angela Belle Mutter wurde, aber keinen Vater für das Balg hatte.
Wie sie in diesen Schlamassel geraten war, war kein Geheimnis. Angela war wild wie eine streunende Katze. Wer derjenige war, welcher, das hätten alle gerne gewusst. Nur eines war sicher – Angela hatte jede Möglichkeit auf ein ehrbares Dasein von Anfang an im Keim erstickt, auch wenn Ehrbarkeit nicht unbedingt einen sonderlich hohen Stellenwert bei den Belles besaß.
Wenn in diesen Zeiten ein junges Mädchen in Schwierigkeiten war, ging sie fort, um das Kind in einer anderen Stadt oder – wenn die Familie wirklich viel Geld hatte – auch auf einem anderen Kontinent zur Welt zu bringen. Es kam gar nicht so selten vor, dass das junge Mädchen und seine Mutter nach einer Weile wieder zurückkehrten und allen den Säugling als neuen Bruder oder neue Schwester vorstellten. Vielleicht aber auch nicht. Doch eine Familie, die etwas auf sich hielt, brachte ihre Bastarde nicht zu Hause zur Welt, vor allem nicht in einem Blumenbeet.
Der Schmerz raubte Angela den Atem. Sie grub ihre Finger wie Wurzeln in die schmutzige Erde, warf den Kopf zurück und lachte wie eine Irre. Neben ihrer lockeren Moral hatte Angela auch das heisere Lachen der Belles geerbt. Hätte der Satan eine Geliebte mit Humor, würde sie bestimmt lachen wie eine Belle. Dr. Montgomery starrte Angela mit offenem Mund an. Da man in Harvard den Umgang mit von Dämonen besessenen Frauen nicht gelehrt hatte, war er mit seinem Latein am Ende.
»Jetzt tun Sie doch was!«, fauchte sie ihn an.
Er zog seine Jacke aus und breitete sie ordentlich über ihre nackten Knie. Angela sah Adam an, als hätte er den Verstand verloren. Zugegeben, es war ihre erste Geburt, aber sie hegte doch den Verdacht, dass unter diesen Umständen mehr als diese Geste gefordert war.
Adam hatte bisher immer nur einen flüchtigen Blick auf sie erhascht, doch selbst aus der Ferne hatte sie ihn hart auf die Probe gestellt mit ihrem dunklen Haar, den schwarzbraunen Augen und Lippen, an denen man sich nicht satt sehen konnte. Adam war ein glühender Anhänger der modernen Dreifaltigkeit aus Kirche, Vaterland und Klasse. Aber wie er jetzt so im Dreck kniete, schwand sein Glaube in Windeseile dahin. Seine Augen wanderten über Angelas Körper, und er spürte, wie eine große Hitze in ihm hochstieg. Er wollte diese Frau mit Haut und Haaren besitzen. Sie sollte ihm allein gehören.
»Ich dachte, Sie sind Arzt«, keuchte sie und riss ihn aus seinen nebulösen Gedanken.
Das hatte er allen Ernstes vergessen.
»Ich werde rasch meine Tasche holen«, murmelte er und wollte aufstehen.
»Was ist denn in dieser verdammten Tasche Wichtiges drin?«
Sein Mut, hätte die ehrliche Antwort gelautet. Doch jetzt war nicht der geeignete Zeitpunkt für peinliche Enthüllungen.
Adam war alles andere als ein begnadeter Arzt. Er besaß einfach kein Gespür für den Umgang mit Kranken. Er war jetzt schon seit über einem Monat in Leaper's Fork, hatte aber noch immer keinen Patienten ohne den alten Doktor an seiner Seite behandelt. Der Geruch nach Jod verursachte ihm Übelkeit, der Anblick von Blut ließ seine Knie schlottern, und bei Notfällen erstarrte er vollends. Mit einem Wort – Kranke machten ihn krank.
Adam war aus demselben Grund Arzt geworden, aus dem er alles im Leben tat – wegen des sozialen Aufstiegs. Die Tatsache, dass er nicht in die Oberschicht hineingeboren worden war, betrübte ihn zutiefst. Sein Stiefvater war begüterter Abstammung, seine Mutter nicht. Seinen leiblichen Vater hatte er nie kennen gelernt, und so empfand er auch keine Schuldgefühle, als er erfuhr, dass er früh verstorben war. Wäre sein Vater noch am Leben gewesen, hätte Adam Montgomery an ebendem Tag, an dem Angela Belles Fruchtwasser in seinem Blumenbeet versickerte, am Wurstkessel gestanden.
Als Sohn eines Metzgers gibt es nur drei Möglichkeiten, dem Schlachthaus zu entkommen – Wirtschaft, Jura oder Medizin. Für Jura fehlte Adam der Biss, für eine Karriere als Geschäftsmann das Rückgrat. So blieb nur noch Medizin. Adam hatte kein Problem, menschliches Leid als Erfolgsleiter zu benutzen. Er wünschte sich nur, das Geschäft wäre nicht so blutig.
Aber Angela Belle hatte nicht viel Verständnis für Menschen, die als Beobachter durchs Leben gingen. Auch dann nicht, wenn sie nicht gerade einen Zeppelin zur Welt brachte. So packte sie Adam mit ihren schmutzstarrenden Fingern an seiner gestärkten weißen Hemdbrust und zog ihn zu sich herab.
»Sie schaffen das!«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich weiß, dass Sie das schaffen!«
Erfüllt vom Glauben einer Frau, krempelte Adam seine Ärmel hoch und tat so, als sei er ein Mann.
»Pressen!«, befahl er ihr, als die Zeit gekommen war.
»Ich kann nicht!«, schrie sie und warf den Kopf in seinem Lilienbeet hin und her.
»Natürlich können Sie das!«, brüllte er.
Adam Montgomery hegte nicht den geringsten Zweifel, dass Angela Belle den Mond aus seiner Umlaufbahn katapultieren könnte, wenn sie es sich in den Kopf setzte. Keine Frau, die er jemals getroffen hatte, konnte so viel aus sich – und anderen – herausholen.
KAPITEL 6
Angelas Tochter kam mit schokoladenbraunen Augen und weichen, schwarzen Locken zur Welt. Ihre Haut hatte die Farbe gerösteter Mandeln, und sie roch süß wie ein Marzipanriegel. Als Angela ihr Kind schließlich in den Armen hielt, verschmolzen die beiden zu einer untrennbaren Einheit. Die junge Mutter konnte sich gerade noch bremsen, das Neugeborene nicht wie eine Katze abzuschlecken.
Trotz der Bedenken ihrer nächsten Umgebung schlüpfte Angela in die Mutterrolle, als hätte sie nie etwas anderes getan. Sie schleppte das Baby überall mit sich herum und dachte sich nichts dabei, selbst auf den Stufen des Gerichtsgebäudes ihre Brust zu entblößen und ihr Kind zu stillen.
Der Anblick der stillenden Angela führte bei den meisten Männern der kleinen Stadt zu quasi religiöser Verzückung, nur die Frauen waren nicht so leicht zu bekehren. Ann Lester berief eine Krisensitzung des Wohltätigkeitsvereins Christlicher Frauen ein, um bei Gurkensandwich und Früchtetee dieser Blasphemie ein Ende zu setzen.
»Die Katzen versammeln sich miauend vor den Mülltonnen«, höhnte Charlotte, die mit Lettie auf der vorderen Veranda saß und die Wagenkolonne vorfahren sah.
Sobald zwei oder mehrere Mitglieder des WCF zusammenkamen, lief Charlotte Gefahr, vollends zur Heidin zu werden.
»Ohne Christen wäre es besser bestellt um das Christentum«, murmelte sie in ihre Zeitung.
»Schütte doch das Kind nicht immer gleich mit dem Bad aus«, schimpfte Lettie.
Dann verdrehte sie die Augen gen Himmel und sprach ein stummes Gebet für Charlottes heidnische Seele, mit der Bitte, der Herr möge doch in Bälde einen Blitz herabsenden.
Obwohl die Frauen des Wohltätigkeitsvereins alles daransetzten, dass es verboten wurde, einem Kind in der Öffentlichkeit die Brust zu geben, brachte es nicht ein Stadtrat über sich, das Wort »Brust« in der öffentlichen Anhörung auszusprechen. Da man das Füttern von Säuglingen jedoch kaum verbieten konnte, wurde der Antrag fallen lassen.
KAPITEL 7
An dem Tag, an dem Adam endgültig die Nachfolge des alten Doktors antrat, erbte er auch dessen efeuumrankte Praxis aus rotem Backstein, seine Patienten, seine Krankenschwester und die Usambaraveilchen seiner Krankenschwester. Adam hatte ein Problem mit Veilchen.
Es gab kein Fensterbrett in den sonst recht spartanisch eingerichteten Praxisräumen, auf denen nicht diese niedrigen, kleinen Blumen wucherten. Weiße Veilchen zierten das Fenster im Behandlungszimmer, und lilafarbene Blüten starrten Adam an, wenn er vor der Toilettenschüssel stand.
Adam sah sich nun mal als Arzt, dessen Räume eine geschmackvolle Palme oder ein feinblättriger Philodendron zierten. Usambaraveilchen waren einfach nicht mit seinem Selbstbild zu vereinbaren. Sie passten einfach nicht zu ihm.
»Und außerdem schmutzen sie«, bemerkte er missbilligend und mit Blick auf die abgestorbenen Blüten auf dem Fußboden und auf die Wasserränder auf den Fensterbrettern.
»Alles, was lebt, macht Dreck«, erwiderte Schwester Marshal tadelnd.
Schwester Marshal war lange Zeit Schulkrankenschwester gewesen, aber diese Arbeit hatte sie zu wenig gefordert. Sie war für die Front geboren. Ein Tag ohne Blut war eine Vergeudung ihrer Talente.
Schwester Marshal führte die Praxis wie ein Feldlazarett. Im Wartezimmer standen vier unbequeme Stühle und ein Spucknapf aus Messing. An den rau verputzten Wänden hing nicht ein Bild, und als einzige Zeitschrift lag der Farmer-Almanach aus. Ihr Wartezimmer war nicht dafür gedacht, dass es sich die wartenden Patienten hier gemütlich machten.
Schwester Marshals einzige Leidenschaft neben der Medizin galt ihren Usambaraveilchen, die sie mit überraschender Zärtlichkeit pflegte, jeden Wildwuchs sofort entfernte und sie regelmäßig wie ein Uhrwerk düngte.
In Adams Augen waren Veilchen ein Ausbund an Spießbürgerlichkeit. Jedes Mittelklassehaus in Leaper's Fork hatte einen solchen Blumentopf auf dem Küchenfenster. Adam konnte sich nicht überwinden, sich an die Pflanzen zu gewöhnen, andererseits fehlte ihm der Mut, Schwester Marshal anzuweisen, die Veilchen aus dem Haus zu entfernen.
So blieb ihm keine andere Wahl, als die verhassten Gewächse umzubringen.
Jeden Freitagnachmittag füllte Schwester Marshal zwei große Einmachgläser mit Leitungswasser und Pflanzendünger und stellte sie auf die Küchentheke, damit sich der Inhalt über das Wochenende setzte. Jeden Freitagabend, kaum dass Schwester Marshal gegangen war, schüttete Dr. Montgomery Gift in das Wasser.