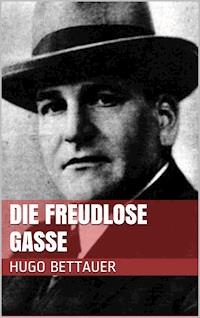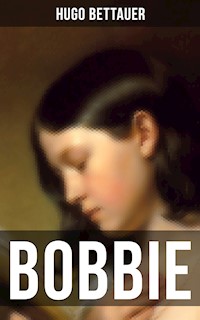1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Hugo Bettauers Roman "Die freudlose Gasse" entführt die Leserschaft in das Wien der 1920er Jahre und beleuchtet die komplexen gesellschaftlichen Verhältnisse sowie die emotionale Entbehrung seiner Protagonisten. In einem eindringlichen und oft entlarvenden Stil beschreibt Bettauer das Leben in der großen Stadt, wo der aufkommende Kapitalismus auf tiefe Existenzängste und soziale Isolation trifft. Der Roman ist ein eindringliches Portrait der menschlichen Kondition und thematisiert nicht nur die inneren Kämpfe der Charaktere, sondern auch die gesellschaftlichen Umstände, die ihre Lebenswege bestimmen. Die Verwendung von Symbolik und sozialkritischen Elementen verleiht dem Werk eine besondere Gewichtung im literarischen Kontext dieser Epoche. Hugo Bettauer, ein bedeutender österreichischer Schriftsteller und Zeitungsredakteur, war bekannt für seine kritische Auseinandersetzung mit sozialen Missständen und sein Eintreten für die menschlichen Grundrechte. Seine eigenen Erfahrungen in einer von politischen Umbrüchen und wirtschaftlichen Krisen geprägten Zeit beeinflussten maßgeblich seine schriftstellerische Tätigkeit. Bettauers Engagement für progressive Ideen und seine Beobachtungen der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit spiegeln sich in "Die freudlose Gasse" wider, wo er die Schattenseiten der scheinbar glanzvollen Metropole Wien aufdeckt. Dieses Werk ist unabdingbar für Leser, die sich für die Verknüpfung von individueller Tragik und gesellschaftlicher Realität interessieren. Bettauers fesselnde Prosa und sein unerschütterlicher Blick auf die menschliche Natur machen "Die freudlose Gasse" zu einer zeitlosen Lektüre. Es lädt dazu ein, die vielschichtigen Emotionen und Konflikte der Charaktere nachzuvollziehen und regt zur Reflexion über die eigene Existenz in einer oft unbarmherzigen Gesellschaft an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die freudlose Gasse
Inhaltsverzeichnis
Melchiorgasse 55.
Inhaltsverzeichnis
Das Haus Nr. 55 in der Melchiorgasse, die sich im VII. Wiener Bezirk bis zum Gürtel erstreckt, entstammt der Jahrhundertwende. Wurde also zu einer Zeit gebaut, da Hausbesitzer sein einen Lebensberuf bedeutete. Man war Hausherr wie man Advokat oder Fabrikant war. Die Frau des Hausbesitzers war die Hausbesitzersgattin, der Sohn ein Hausherrensohn. Unter allen Großstadtdrohnen war der Hausbesitzer die stärkste und brutalste. In anderen Städten war ein Haus sichere Kapitalsanlage, in Wien oft ausschließlicher Erwerb. Es galt aus einem Haus so viel Profit wie möglich herauszuschlagen, also mit schlechtem Material zu bauen, mit jedem Quadratzentimeter Raum zu sparen, Öfen aufzustellen, die nichts kosteten und auch nicht heizten, die Luft und das Licht in Kabinette zu verwandeln, aus einem Loch, das kaum für eine Speisekammer genügen würde, ein Schlafzimmer zu machen. Moderner Wohnungsluxus, wie ihn andere Städte haben, gab und gibt es in Wien nicht, beschränkte sich auf einige Dutzend Mietpaläste, die nur für die ganz Reichen in Betracht kommen.
Das Haus Nr. 55 in der Melchiorgasse ist der Typus des neueren Wiener Miethauses mit finsteren Korridoren, stockdunklen Nebenräumen, abgestohlenen Badezimmern, schäbigem Talmiluxus und einer Fassade voll von abscheulichen, angeklecksten Ornamenten aus Kalk und Mörtel.
Dieses Haus betrat an einem Spätherbstabend, da es schon recht dunkel war, ein großer, kräftiger Herr, der, vielleicht um sich vor dem feuchten Nebel zu schützen, den Kragen seines eleganten, hochmodernen englischen Ulsters so hoch aufgeschlagen hatte, daß er den schwarzen Spitzbart und die untere Partie des Gesichtes bedeckte. Hastig, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, stürmte er die Treppe ins Mezzanin, sperrte eine Türe auf, deren Schild den Namen Barbara Merkel enthielt, querte das total dunkle Vorzimmer und blieb vor einer kleinen Türe, die in die Küche der Wohnung führte, zögernd stehen. Mit halblauter, gepreßter, wie es schien verstellter Stimme rief er:
“Frau Merkel!”
Eine schlampige, beleibte Frau mit vorgetriebenem Bauch öffnete die Türe, aus der dem Herrn der Geruch von ranzigem Fett entgegenschlug.
“Alles in Ordnung, Herr Doktor, das Bett hab‘ ich frisch überzogen, die Kopfpolster auch. Aber bitt‘ schön, Herr Doktor, das Waschen kostet ja jetzt so viel Geld, ich tät schon bitten, etwas zuzulegen.”
Der Herr, der im dunklen Vorzimmer stehen geblieben war, brummte knurrend: “Schon recht, am Ersten werde ich das schon machen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn es zweimal hintereinander läutet, so werde ich öffnen und Sie lassen sich nicht blicken.” “Aber Herr Doktor, auf mich können Sie sich verlassen, wie auf den lieben Herrgott, bei mir sind schon so viele Damen aus-und eingegangen, ich kümmere mich um keine und wenn ich einer auf der Treppe begegnet bin, hab‘ ich immer weggeschaut. Diskretion, das ist Ehrensache bei mir. Das hat auch der letzte Herr vor Ihnen, der was Beamter im Finanzministerium war, so gerühmt. Er ist immer mit der Frau von einem Notar aus der Inneren Stadt gekommen – jetzt fällt mir der Name nicht ein, gleich wer ich‘s wissen – und – –”
Der große Herr mit dem Spitzbart unterbrach den Redestrom der diskreten Zimmervermieterin und wollte sich zurückziehen. Frau Merkel rief ihm nach:
“Herr Doktor, bitt‘ schön, nicht wahr, vor zehn Uhr gehen Sie weg? Es ist wegen der Hausmeisterin. Das Luder tät sonst zum Mietamt laufen und mich anzeigen, damit man mir das Zimmer anfordert oder mich gar ganz hinausschmeißt.” “Jawohl, so wie wir es ausbedungen haben: vor zehn Uhr sind wir wieder fort.”
Der Herr zog sich nun endlich in das gemietete Absteigequartier zurück, knipste das Licht an, sperrte hinter sich die Türe ab und begann, nachdem er Rock und Hut abgelegt, sich vor dem großen Schrankspiegel sorgfältig des falschen Spitzbartes zu entledigen. Ohne Zwicker, bartlos, hätte höchstens ein sehr kundiger Detektiv in ihm den Herrn von vorhin erkannt. Er trug Frack und Lackstiefel, sah sehr distinguiert aus, wenn auch die Perlen in der Hemdbrust dem Anschein nach nicht echt waren.
Bart und Zwicker steckte er in die weiten Taschen des Ulsters, dann zündete er den kleinen Gasofen in der Ecke des großen, mit billiger Eleganz möblierten Zimmers an, setzte eine Zigarette in Brand und ging ungeduldig auf und ab. Die gerunzelte Stirne, das nervöse Kauen an den langen wohlgepflegten Fingernägeln, die zusammengekniffenen Lippen deuteten auf innere Unruhe und schwere Gedanken.
Das Rattern eines Autos wurde vernehmbar, der Herr sperrte auf, trat in das finstere Vorzimmer, lauschte hinaus. Jetzt zweimal ein schrilles Tönen der Klingel, der Herr ohne Bart öffnete die Wohnungstür, flüsterte “Grüß Gott, Lia”, nahm die Eintretende am Arm und führte sie in das Zimmer. Frau Merkel, die durch das Schlüsselloch der Küchentür schaute, konnte zu ihrem Bedauern nicht das mindeste von der fremden Dame sehen und begab sich wieder zu ihren Kochtöpfen.
Die schlanke, junge Frau riß den kostbaren Chinchillapelz auf.
“Du, mir ist ganz heiß vor Angst geworden, wie ich aus dem Auto stieg und die Treppe hinauf lief. Wenn mich nur niemand gesehen hat!” Sie wickelte den dichten Schleier von dem Goldhütchen, ließ den Pelz von den Schultern auf den Teppich gleiten und stand nun in ihrer ganzen jugendlichen Schönheit vor dem Mann, um dessen Hals sie die nackten Arme schlang. Das goldgestickte schwarze Seidenkleid floß weich von den schneeweißen Schultern zu den schwarzen Seidensandalen. Die fleischfarbenen Seidenstrümpfe umschlossen die schlanken feinen Beine, die wie nackt aussahen.
Sie war von jener seltenen halborientalischen Schönheit, die auf empfindsame Männer aufpeitschend und erregend wirkt. Reiche, tiefschwarze Haare umrahmten das ovale Gesicht, dessen Elfenbeinteint in grellem, aber um so wirksameren Kontrast zu den brennrot gefärbten Lippen und den grauen feuchten Augen stand. Der junge Leib war von schlanker Fülle, die vollen weichen Arme mädchenhaft und doch irgendwie lasziv und unkeusch in ihrer Wirkung.
Brennende, wilde Küsse, girrendes Lachen. Die Frau löste sich aus der Umschlingung.
“Vorsichtig, wir dürfen uns nicht derangieren. In zwei Stunden spätestens muß ich bei Rosenows sein. Mein Mann glaubt, ich sei in der Oper. Er war sehr gekränkt darüber, daß ich nur einen Sitz bekam und allein gehe. Aber ich sagte ihm, ich müsse unbedingt die Jeritza in ‚Toska‘ hören.”
“Wird er dich nicht abholen?”
“Nein, ich habe ihm gesagt, ich würde wahrscheinlich schon nach dem zweiten Akt fortgehen, um nicht so spät zu Rosenows zu kommen. Er hat mir versprochen, schon um neun Uhr dort zu sein und mein eventuelles Späterkommen zu entschuldigen. Du mußt natürlich auch spätestens um halb zehn dort sein, es wäre zu auffällig, wenn wir beide nach Beginn des Soupers kämen.”
Der Mann zog das junge Weib, das nun die lange, köstliche Perlenschnur, die glitzernden Armbänder und die mit haselnußgroßen Smaragden und Diamanten versehenen Ringe abstreifte, wieder an sich.
“Du, rasch, laß uns die kurze Zeit, die uns bleibt, ausnützen.”
Sie huschte errötend zur Türe, knipste das Licht ab, man hörte das Rascheln von Seide, das leise Poltern von Schuhen, zwei Gestalten verkrampften sich in der Dunkelheit zu einer, taumelten zum Ruhelager. – – –
Der Herr mit dem Spitzbart, Zwicker und hochgeschlagenen Rockkragen öffnete eine Spalte der Küchentüre. Frau Merkel, neben dem Herd sitzend, taumelte aus leichtem Schlummer empor.
“Es ist neun Uhr, ich geh‘ jetzt, Frau Merkel. Die Dame ruht sich noch ein wenig aus, wird aber auch vor zehn Uhr fortgehen. In ein paar Tagen kommen wir wieder.”
“Küß‘ die Hand, Herr Doktor! Die Herrschaften werden schon mit mir zufrieden sein. Sauber und diskret, da können Sie sich darauf verlassen! Ein Fabrikant aus Mariahilf, der was bei mir gemietet gehabt hat, wissen Sie, der die Möbelfabrik hat, der ist immer mit der Mizzi Lorian vom Raimund-Theater gekommen und hat gesagt – –”
Der Herr erfuhr nicht, was der Fabrikant gesagt hatte, denn er eilte schon die Treppe hinunter auf die Straße, deren Finsternis ihn verschlang.
Das große Souper.
Inhaltsverzeichnis
Bei Generaldirektor Rosenow ist Gesellschaft. Mehr als hundert Gäste sind zum Souper geladen. Die große, schloßähnliche Villa in der Pötzleinsdorfer Allee strahlte im Glanz der elektrischen Kronleuchter, auch die Bogenlampen im Park, der die Villa umgibt, leuchten blau und erhellen auf hundert Meter die ganze Gegend. Ein Auto nach dem anderen fährt vor das Gartenportal, vor dem zwei livrierte Diener die Gäste in Empfang nehmen. Ein dritter Diener geleitet sie die gedeckte Gartentreppe zur Villa hinauf, wo sie von Zofen der Pelze und Mäntel entledigt werden. In der mächtigen Halle begrüßt Generaldirektor Jonas Rosenow zappelnd, aufgeregt, jovial, ehrfurchtsvoll oder schäkernd seine Gäste, und führt sie zu einem Tisch, auf dem jeder Herr, jede Dame die Tischkarte findet. Dann betritt man den ersten, in Empire gehaltenen Salon, in dem die Frau Rosenow die Honneurs macht. Der dicken kleinen Dame mit rundem, freundlichem Gesicht fällt das nicht leicht. Von Zeit zu Zeit wirft sie einen flehenden Blick auf die schlanke, hohe, magere Gestalt neben ihr, die ihr dann beispringt. Es ist dies die verwitwete Gräfin Stuppach, jetzt Hausdame bei Rosenows.
Generaldirektor Rosenow hatte noch im Jahre 1918 Rosenstrauch geheißen und eine kleine Wechselstube in der Taborstraße gehabt, in der auch Klassenlose, Theaterkarten und Versatzzettel verkauft wurden. Das kleine Männchen hatte aber Blick für die Möglichkeiten der Zeit, wurde von Tag zu Tag reicher, kaufte und verkaufte mit fabelhafter Geschicklichkeit Häuser und Güter, übersiedelte bald aus der Pazmanitengasse, in der er seit seinem Zuzug aus Bielitz gewohnt, nach dem Palais in der Pötzleinsdorfer Allee, gründete mit anderen zusammen die Mitteleuropäische Kreditbank, wurde ihr Generaldirektor und gab nun auf Veranlassung seiner Tochter Regina, die eben im kleinen Biedermeiersalon den um sie versammelten Herren den neuesten Schlager von Leopoldi und Wiesenthal, “Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir”, vorsang, die erste große Gesellschaft. Geschickt hatte das schlanke, pikante Mädchen, das die Eltern an Wuchs, Bildung und Geist hoch überragte, bei der Einladung unter die führenden Bank-und Finanzgrößen ein Dutzend Schriftsteller, Maler, Musiker und sogar einen Journalisten gestreut.
Dieser, Otto Demel, Redakteur des “Wiener Herold”, war eben im türkischen Rauchsalon von Herren umringt, die von ihm die neuesten Nachrichten aus dem Deutschen Reich hören wollten. Demel, einer der geistvollsten Causeure der Wiener Journalistik, gefürchtet wegen seiner boshaften Witze, aber bei den Lesern beliebt wegen seiner tiefgründigen Beleuchtung alltäglicher Dinge, erstattete kurz Bericht und fragte dann launig:
“Also, wie ist das, meine Herren? Wird die Börse morgen flau sein oder fest? Werde ich mit den fünfundzwanzig Eos-Aktien, die ich besitze, Milliardär werden oder muß ich als armer Mann sterben?”
Nathan Großkopf, ein kahlköpfiger, asthmatischer Riese, den man auf etliche hundert Milliarden schätzte, erwiderte achselzuckend:
“Wenn ein Mensch von Ihrer Begabung und Ihrem Geist noch nicht Milliardär ist, so beweist das nur, daß Geist und Klugheit zwei ganz verschiedene Dinge sind. Aber, wenn Sie es mir gestatten, kaufe ich morgen für Sie hundert Alpine –”
“Ich gestatte nicht, womit ich zwar noch nicht beweise, daß ich Geist habe, wohl aber, daß ich nicht klug bin. Meine Herren, Sie haben keine Ahnung, wie wohl das tut, unter so vielen klugen Menschen der einzige zu sein, der nur Geist und kein Geld besitzt.”
Großkopf und einige andere Herren lächelten ein wenig verächtlich und verließen den Raum, in dem der Journalist mit dem Rechtsanwalt Doktor Leid und einem großen, schlanken Mann von kaum dreißig Jahren, Egon Stirner, einem Beamten der Mitteleuropäischen Kreditbank, zurückblieb. Otto Demel hatte beobachtet, daß Dr. Leid in Zwischenpausen von kaum einer Minute auf seine Uhr sah. Er legte den Arm um die Schulter des blassen, ersichtlich ermüdeten und nervösen Rechtsanwaltes, dessen große Kanzlei als die bestgehende von Wien galt, und sagte scherzend:
“Wo ist denn deine schöne Frau? Ich wette, daß du nur deshalb so nervös bist, weil sie nicht ununterbrochen neben dir steht! Mensch, du bist jetzt doch schon drei Jahre verheiratet – höchste Zeit, die Flitterwochen zu beenden.”
Verlegen wehrte der Rechtsanwalt ab:
“Lia ist in der Oper, bei ‚Tosca‘, und hat mir versprochen, schon nach dem zweiten Akt fortzugehen. Es wäre doch peinlich, wenn ihr Platz an der Tafel leer bliebe und sie dann inmitten des Soupers hereinkäme.”
Egon Stirner lachte hell auf.
“Peinlich! Einem Mann wäre das peinlich! Aber einer schönen, jungen Frau? Für die ist es ein geradezu herrliches Gefühl, einen vollen Saal zu betreten und alle Augen auf sich gerichtet zu wissen.”
“Nicht übel beobachtet,” meinte Deme], “Sie sind entschieden Frauenkenner, Herr Stirner. Wie ich deine schöne Frau kenne, wird es ihr wirklich ein Hochgenuß sein, allein in ihrer ganzen imponierenden Lieblichkeit in den Speisesaal zu rauschen.”
Leid lächelte geschmeichelt, aber es zuckte dabei um seine Mundwinkel. Hatte denn irgend jemand, sein bester Freund, Otto Demel, mit eingeschlossen, eine Ahnung, wie er Lia liebte und –wie er um sie bangte? Wußte jemand etwas von den Qualen, die er litt, wenn er fühlte, wie sich Lia innerlich immer mehr von ihm entfernte, in seinen Armen kalt wie Eis blieb, sich in seiner Gesellschaft langweilte, müde und verdrossen war, wenn aber andere Männer kamen, ihr Temperament lichterloh aufflammen ließ?
Ein sanft abgetönter Gongschlag rief die Gäste aus den zwanzig oder mehr Zimmern in den Speisesaal, in dem zwei lange Tafeln schneeweiß unter Gold, Silber, Blumen und Kristallglas schimmerten.
Doktor Leid überzeugte sich, daß seine Frau noch immer nicht da war. Er eilte zur Hausfrau, um eine Entschuldigung vorzubringen.
“Jammerschad,” klagte Frau Sabine Rosenow, “jammerschad, das Essen wird ihr kalt werden.” Sie war in diesem Augenblick eben nicht die Milliardärsgattin, sondern die brave Hausfrau aus Bielitz, die bei dem Gedanken zitterte, daß Jonas, ihr Gatte, oder Regi, das Töchterl, eine kalte Suppe bekommen könnte. Gräfin Stuppach, der ob dieser Bemerkung sich die grauen Haare sträubten, rettete die Situation. Sie lächelte verbindlich und sagte:
“Frau Generaldirektor beliebt natürlich nur zu scherzen. Herr Doktor, Ihre Frau Gemahlin ist willkommen, wann immer sie auch erscheinen wird. Selbstverständlich wird für verspätete Gäste nachserviert.”
Das kleine Streichorchester, das auf der Galerie des mächtigen, im altenglischen Stil gehaltenen Speisesaales untergebracht war, begann zu spielen, lautlos, auf Gummisohlen einherhuschend, trugen die Diener die köstlichen Speisen auf, weniger lautlos schmatzten, schlürften, unterhielten sich die Gäste. Rubinroter, grünlichgelber, goldgelber Wein funkelte in den Gläsern.
Doktor Leid bemühte sich vergeblich, seine Tischnachbarin zu unterhalten. Gesprächsstoff wäre genug vorhanden gewesen, da er innerhalb weniger Jahre dreimal ihre schmerzlose Scheidung erwirkt hatte. Aber er war zerstreut, immer flog sein Blick nach dem leeren Platz hinüber, der für seine Frau bestimmt war, und seine Gedanken gingen zurück auf die Zeit, da er sich in Lia verliebt hatte.
Er vierzig, sie zwanzig. Er, der vielbeschäftigte Anwalt mit einem für diesen Beruf exorbitant hohen Einkommen, sie ein armes Tippmädel, aus kleinem jüdischen Haus, das eben durch Protektion in seiner Kanzlei untergekommen war.
Dr. Leid pflegte nur mit seinen zahlreichen Konzipienten zu verkehren, dem weiblichen Personal schenkte er kaum einen Blick, wenn er durch die Schreibzimmer ging. Aber einmal traf es sich, daß er nach Kanzleischluß zurückkehrte, um noch einen vergessenen Brief zu diktieren. Es war niemand mehr anwesend, als das neue Fräulein, Lia Holzer, die sich eben auch zum Fortgehen anschickte. Dr. Leid diktierte ihr den Brief direkt in die Maschine, und da er nicht wollte, daß die Reinemachefrauen zuhören, beugte er sich zu ihr hinab. Sog das Aroma des jungen schönen Mädchens ein, sah die schwellenden Formen der mädchenhaften Büste, wurde verwirrt, atmete schwer, vergaß weiter zu diktieren. Und wie sie sich aufrichtete, um ihn fragend anzublicken, berührte die atlasweiche Haut ihrer Wange sein Gesicht, versenkte sich sein Blick in ihre großen, feuchten Augen, in denen das Temperament eines jungen, leidenschaftlichen Weibes mühsam verhalten glühte.
Innerhalb weniger Tage ging die Saat dieses unbedeutenden Geschehnisses auf. Bevor ein Monat um war, schied Lia Holzer wieder aus der Anwaltskanzlei, aber nicht als Entlassene, sondern als Braut ihres Chefs. Bald fand die Hochzeit statt und es kamen Wochen, während der sich Dr. Leid wieder als Jüngling fühlte und dachte, daß das größte Glück der Welt ihm zu eigen geworden sei. Bedenken über den großen Altersunterschied verscheuchte er mit triftigen Argumenten. Sein Lebensernst, seine restlose Liebe zu Lia, nicht zuletzt sein Reichtum würden ausgleichend wirken. Und dann – Lia würde ihm Kinder schenken und als Mutter unlöslich mit ihm verknüpft sein.
Aber Lia bekam kein Kind, wollte keines bekommen. Stürzte sich in den Strudel des gesellschaftlichen Lebens, tanzte nachmittags im Trocadero, im Bristol-Grillroom, im Tabarin, während er in der Kanzlei arbeitete, schmollte, wenn er spät abends todmüde nicht mehr in Gesellschaft gehen wollte, gähnte, wenn er ihr von seinen beruflichen Erlebnissen erzählte, ließ die guten Bücher, die er ihr brachte, ungelesen umherliegen, hatte nur Toiletten, Nachmittagstees, Autofahrten, Theater und Bälle in ihrem schönen Köpfchen. Ob sie ihn auch betrog? Unwillig, empört über diesen Gedanken, zuckte Leid empor. Lächerlich! Sie flirtete, wie es alle Frauen tun, kokettierte mehr sogar als andere, aber ihn betrügen? Nein, daran zu glauben hatte er wahrhaft keine Ursache. Neuerdings befand sich dieser ihm wenig sympathische Egon Stirner oft in ihrer Gesellschaft, und erst gestern war es ihm abends im Imperial, wo sie gemeinsam zu Dritt gespeist hatten, gewesen, als würde zwischen den beiden ein bedeutsamer Blick ausgetauscht werden. Aber nein, ein Flirt und nichts weiter! Und vom Flirt zum Ehebruch war ein weiter Weg, den seine Lia nie beschreiten würde.
Wo sie nur blieb? Nun könnte sie schon hier sein, auch wenn sie bis zum Schluß der Vorstellung geblieben wäre. Seine Nachbarin tröstete ihn: “Bitt‘ Sie, die Jeritza wird sich zwanzigmal nach jedem Aktschluß verneigen müssen. Sicher dauert die Vorstellung bis nach zehn Uhr.”
Die erste Tischrede wurde gehalten. Ein ehemaliger Minister, jetzt Verwaltungsrat bei der Mitteleuropäischen Kreditbank, sagte monoton und stammelnd sein Sprüchlein auf, verglich Jonas Rosenow mit einem aufgehenden Stern und seine Gattin mit einem Veilchen, das gern im Verborgenen blüht, aber um so intensiver duftet. Worauf der Journalist furchtbare Gesichter schnitt, um nicht herausplatzen zu müssen.
Der Hausherr, schwitzend vor Aufregung, erwiderte. Als er sagte, er wisse die Ehre zu schätzen, so illustre Gäste an seiner fürstlichen Tafel versammelt zu sehen, fiel Gräfin Stuppach beinahe in Ohnmacht. Demel konnte sich nicht mehr zurückhalten und lachte hellauf und sogar Dr. Leid vergaß seine trüben Gedanken und lächelte dem Freund, der ihm gegenüber saß und der Tischherr seiner Frau hätte sein sollen, vergnügt zu.
Dann aber packte ihn wieder seine Nervosität. Es war halb elf Uhr und Lia noch immer nicht hier. Das ging nicht mit rechten Dingen zu, es mußte etwas geschehen sein. Vielleicht war sie unpäßlich geworden, vielleicht ein Brand im Opernhaus ausgebrochen. Erinnerungen an den Ringtheaterbrand, von dem seine Eltern ihm so oft erzählt, tauchten auf. Er konnte sich nicht länger beherrschen, sprang auf und verließ, eine Entschuldigung gegen seine Tischdame vor sich hinmurmelnd, den Speisesaal, und zum Telephon zu eilen und seine Wohnung anzurufen.
Nein, die gnädige Frau sei nicht zu Hause. Sie sei doch in großer Toilette, dem neuen goldgestickten schwarzseidenen Kleid, nach der Oper gefahren, um sich von dort direkt nach Pötzleinsdorf zu begeben. Leid läutete ungeduldig ab. Die Schweißtropfen standen ihm auf der hohen klugen Stirne, als er in den Speisesaal zurückkehrte. Und nun begann sich seine Unruhe den übrigen Gästen mitzuteilen. Von allen Seiten wurde er gefragt, wo denn seine Frau bleibe. Einige Herren zischelten einander frivole Witze zu, Frauen lächelten mehr mokant als teilnahmsvoll. Otto Demel aber wurde von aufrichtiger Besorgnis ergriffen, während der neueste Flirt der schönen Frau Lia, Egon Stirner, ersichtlich bekümmert war.
Elf Uhr. Die Unterhaltung im Saal war dank des reichlichen Weingenusses so überlaut geworden, daß man kaum die Musik hörte. Schon stand man ungeniert auf, um mit entfernter Sitzenden anzustoßen, hier und dort wurde ein Champagnerkelch ausgegossen, schrille kleine Schreie bewiesen dem Kundigen, daß die Zote und die Erotik ihre Rechte forderten. Leid aber saß totenbleich, gelähmt da, fühlte sich von den neugierigen Blicken wie durchbohrt.
Otto Demel trat auf ihn zu, legte den Arm um seine Schulter.
“Ich werde jetzt die Redaktion anrufen, vielleicht hat sich in der Oper etwas ereignet, was das Ende der Vorstellung verzögert hat. Ganz gut möglich, eine lndisposition, ein Versagen des eisernen Vorhanges oder so etwas.”
Es verging einige Zeit, bevor Demel zurückkehrte. Lächelnd beruhigte er den Freund.
“Die Oper war tatsächlich recht spät aus, weil man der Jeritza unaufhörlich Ovationen dargebracht hat. Immerhin müßte deine Frau schon hier sein. Aber die Sache ist mir jetzt ganz klar. Lia wollte nicht gegen Ende des Soupers erscheinen und wird mit Bekannten irgendwo rasch speisen gegangen sein. Du wirst sehen, gleich ist sie hier.”
Laut, so daß es auch die weiter abseits Stehenden hören konnten, fuhr er fort:
“Ein sehr romantischer und interessanter Mord hat sich, wie mir der Nachtredakteur erzählte, ereignet. In der Melchiorgasse 55 wurde kurz nach zehn Uhr in einem Absteigequartier die Leiche einer bildschönen jungen Frau gefunden. Das schwarzseidene, goldgestickte Abendkleid und der Chinchillapelz lassen auf beste Gesellschaft schließen. Mehr weiß man noch nicht.”
Doktor Leid war aufgesprungen, wie im Traum wiederholte er die Worte “Schwarzseidenes, goldgesticktes Kleid, Chinchillapelz – – –.” Dann schrie er gellend auf:
“Das ist Lia!” Und stürzte ohnmächtig zusammen.
Mord!
Inhaltsverzeichnis
Eine Panik entstand in dem Saal. Mit einem schrillen Riß unterbrach das Orchester sein Spiel, gellende Schreie ertönten, alles drängte zu dem wie leblos auf dem Teppich liegenden Rechtsanwalt, so daß der Journalist und ein als Gast anwesender Arzt, berühmt und beliebt als erfolgreicher Bekämpfer des Kindersegens, nur mühsam zu Dr. Leid gelangen konnten. Er wurde in ein anderes Zimmer getragen, während die Gäste aufgeregte Gruppen bildeten und schreiend, gestikulierend das furchtbare Ereignis besprachen.
Frauen waren unter der Schminke sehr bleich geworden. Dunkle Treppen, Zimmer mit dicht verschlossenen Vorhängen tauchten vor ihnen auf, sie sahen sich selbst, verschleiert, angsterfüllt, mit fiebernden Nerven wie von Furien verfolgt durch schmutzige, verwahrloste Straßen eilen – – –
Und Männer sprachen jetzt im Flüsterton über die Verderbtheit der Zeit und warfen scheue, verlegene Blicke auf ihre Frauen, in denen die stumme Frage lag: “Auch du? – – –”
Rechtsanwalt Leid war in dem Schlafzimmer, in das er getragen worden war, wieder zu sich gekommen. Um ein Jahrzehnt gealtert lag er da, resigniert, schweigend, verfallen. Demel, über ihn gebeugt, sprach ihm Trost zu:
“Vielleicht täuscht du dich, vielleicht ist sie es nicht! Noch hast du keine Gewißheit.”
Mit einer müden Geste wehrte Leid ab:
“Sie ist es, ich weiß es. Arme Lia, ich war doch wohl zu alt für sie, zu schwer und ernst. Sie hat Feuer und Flamme gebraucht und ich bin ein ausgebrannter Krater. Lieber Freund, geh‘ hin, sieh‘, daß ihrer Leiche kein Schmerz zugefügt wird. Ich aber fühle mich wieder ganz wohl und werde dich im Hotel Bristol, wo ich mir ein Zimmer nehmen werde, erwarten. Mein Heim betrete ich nie wieder.”
Erschüttert wandte sich Demel ab, um den Wunsch des Freundes zu erfüllen. Wäre auch ohne diese Aufforderung nach der Mordstätte geeilt, denn schon regte sich der Journalist in ihm, der Zeiten-und Sittenschilderer, dem dieser Mord Symbol und Mysterium zugleich zu sein schien.
Als Otto Demel eines der für die Gäste bereitgestellten Automobile bestieg, um nach der Melchiorgasse zu fahren, drängte sich Egon Stirner an seine Seite.
“Bitte, Herr Redakteur, nehmen Sie mich mit! Ich bin so erschüttert, daß ich es gar nicht in Worten ausdrücken kann. Diese liebe, schöne, lebenslustige Frau – gestern noch habe ich mit ihr und Doktor Leid im ‚lmperial‘ gespeist und heute – nein, es ist nicht auszudenken.”
Das Auto sauste schon die Währingerstraße abwärts. Gedankenlos fragte der Journalist:
“Sind Sie mit den Leids gut bekannt?”
“Mein Gott, gut bekannt? Vor ein paar Wochen, an einem schönen Septembertag, lernte ich sie in der Krieau in Gesellschaft unseres Generaldirektors und dessen Gattin kennen und bin seither noch etlichemale mit ihnen zusammengetroffen. Öfters eigentlich mit Frau Lia, die als leidenschaftliche Tänzerin nachmittags immer im Pavillon, im Tabarin oder Bristol zu treffen war. Nun, da ich auch gern tanze, verbrachte ich oft eine Stunde in ihrer Gesellschaft.”
“Da würden Sie ja, falls die Ermordete wirklich mit Frau Lia identisch sein sollte, vielleicht einiges zur Eruierung des Mörders beitragen können. Der Kreis, in dem man ihn zu suchen hat, kann nicht allzu groß sein. Sicher ein Mann, äußerlich wenigstens der guten Gesellschaft angehörend, sicher einer, der, wie Sie, mit ihr getanzt hat.”
Das Auto nahm scharf die Kurve in die Schwarzspanierstraße und es verging wohl eine Minute, bevor Stirner zögernd antwortete.
“Natürlich umringte immer eine ganze Schar von Männern die schöne Frau. Einige von ihnen kenne ich, viele waren Ausländer, die mir nicht einmal dem Namen nach bekannt sind. Und dann: Frauen pflegen ihre Geheimnisse gut zu hüten – – –”
Das Automobil war in der Melchiorgasse angelangt und hielt vor dem Haus Nr. 55, vor dem trotz der vorgerückten Nachtstunde eine große Menschenmenge angesammelt war.
Beklommen murmelte der Journalist:
“Der Polizeipräsident ist da. Ich kenne seinen Wagen. Natürlich, es handelt sich ja um einen sensationellen Fall.”
Vor dem geschlossenen Haustor, das von zwei Polizisten bewacht wurde, verabschiedete sich der Bankbeamte von dem Journalisten.
“Ich habe hier ja nichts zu tun. Ich gehe ins Café Payr und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nachher einen Sprung hinein machen würden. Sie können sich denken, daß ich mehr als gespannt bin.”