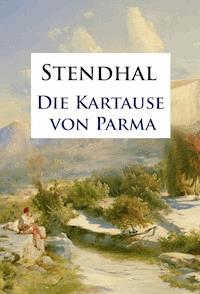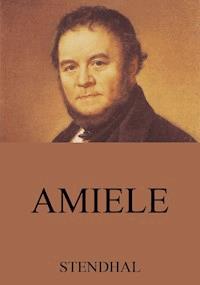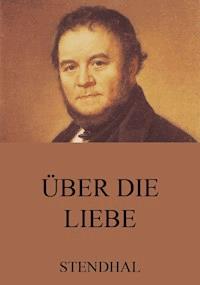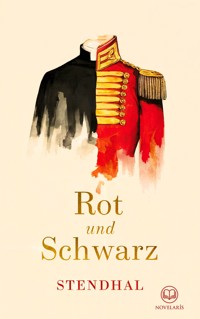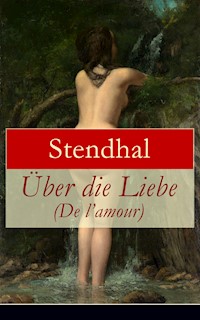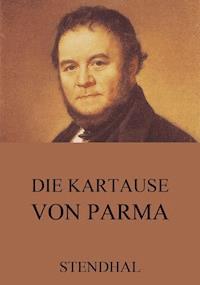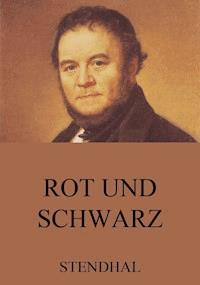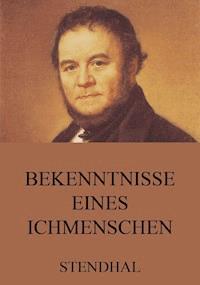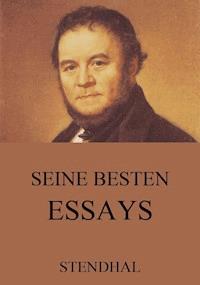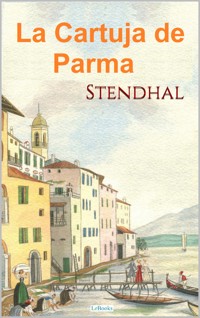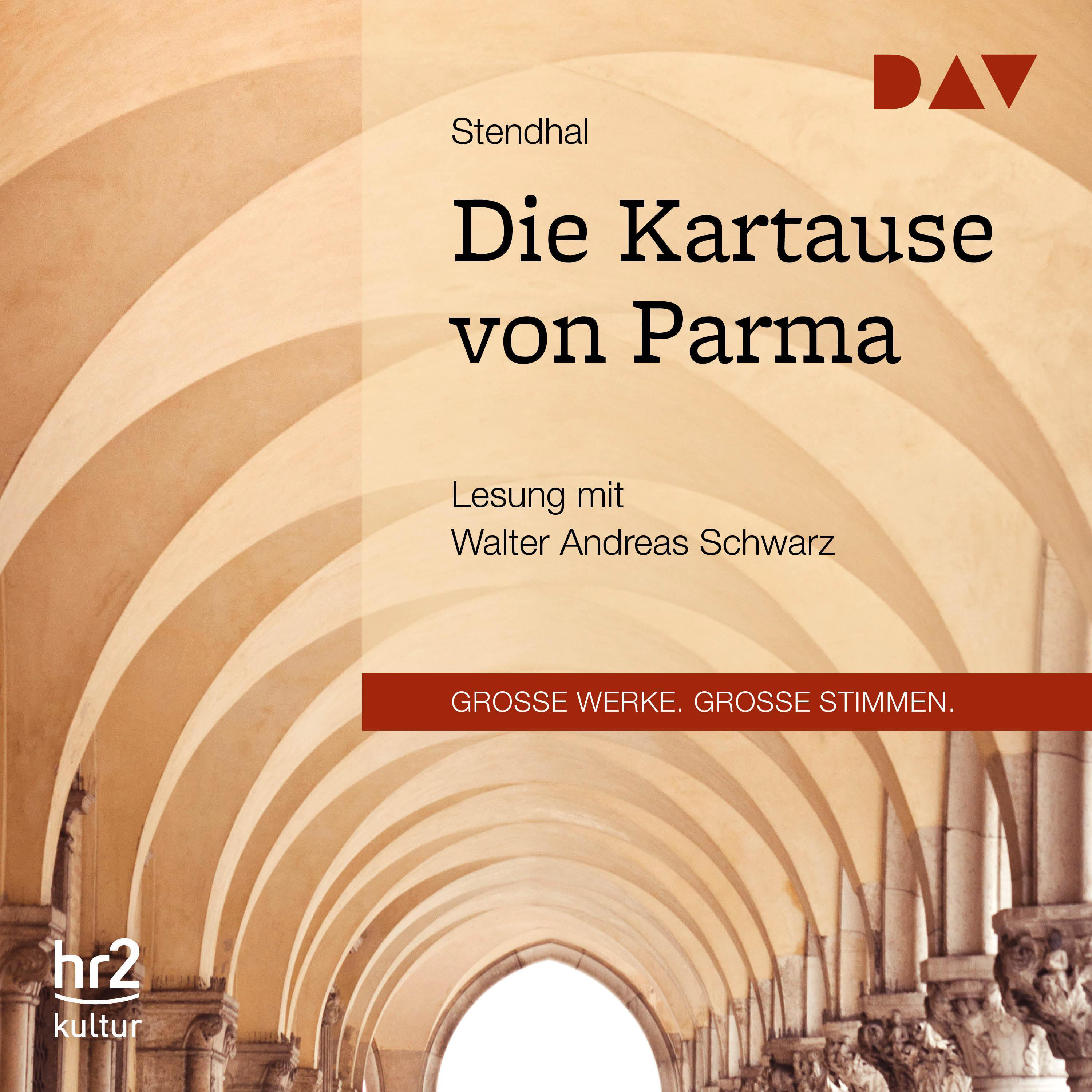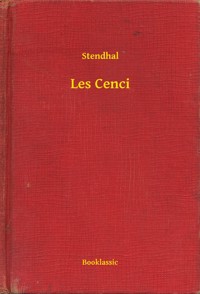1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stendhals Werk "Die Fürstin von Campobasso und andere Erzählungen" präsentiert eine Sammlung von fesselnden Kurzgeschichten, die die Leser in die Welt des französischen Romantizismus des 19. Jahrhunderts eintauchen lassen. Der literarische Stil des Autors zeichnet sich durch seine prägnante Prosa und tiefgründige Charakterisierung aus, die dazu beitragen, die Emotionen und Motive seiner Figuren eindringlich darzustellen. Diese Erzählungen reflektieren Stendhals Interesse an psychologischer Tiefe und gesellschaftlichen Fragen, die während seiner Zeit relevant waren, und bieten einen faszinierenden Einblick in das soziale Leben und die Beziehungen dieser Ära. Die unterschiedlichen Geschichten in diesem Band bieten dem Leser eine vielseitige Auswahl an Themen, die von Liebe und Eifersucht bis hin zu Macht und Intrigen reichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Fürstin von Campobasso und andere Erzählungen
Books
Inhaltsverzeichnis
Der Liebestrank
Inhaltsverzeichnis
In einer dunklen regnerischen Nacht des Sommers 182* kam der junge Leutnant Liéven vom 96. Regiment, das in Bordeaux steht, aus dem Kaffeehause. Er hatte sein gesamtes bares Geld verspielt, und da er ein armer Schlucker war, so ärgerte er sich über seine Torheit.
In dieser Stimmung schritt er – es mochte etwa zwei Uhr sein – durch die Stille einer der ödesten Gassen des Stadtviertels Lormond, als er plötzlich Lärm hörte. Krachend flog eine Haustür auf; ein menschliches Wesen stürzte heraus und fiel ihm gerade vor die Füße. Es herrschte aber eine derartige Stockdunkelheit, daß er sich alle diese Vorgänge nur aus den Geräuschen zusammenreimen konnte. Die zu vermutenden Verfolger der Person blieben offenbar im Hause zurück, weil sie die Tritte des Vorüberkommenden vernommen hatten.
Der Offizier lauschte einen Augenblick. Er hörte Stimmengeflüster hinter der Türe; indessen zeigte sich niemand. Der ganze Vorfall war ihm widerwärtig, dennoch hielt er es für seine Pflicht, dem am Boden liegenden Menschen aufzuhelfen.
Jetzt erst nahm er wahr, daß dieser nur ein Hemd anhatte, und trotz der tiefen Dunkelheit kam es ihm vor, als erkenne er langes aufgelöstes Haar. Es war also ein weibliches Wesen. Das war eine Entdeckung, die dem Leutnant durchaus nicht behagte.
Es war der Wiederaufgerichteten sichtlich nicht möglich, ohne fremde Hilfe zu gehen. Abermals mußte sich der Offizier die Pflichten der Menschlichkeit vorhalten. Am liebsten wäre er auf und davon gelaufen. Er überdachte, welche Unannehmlichkeiten er am morgigen Tage auf dem Polizeiamte haben werde. Wenn seine Kameraden von der Geschichte erführen, war er ihren Witzen ausgesetzt. Am Ende konnte gar ein ironischer Bericht in die Tageszeitungen kommen.
»Ich werde das Frauenzimmer vor die nächste Haustüre setzen«, nahm er sich vor. »Dann klingle ich und mache mich schleunigst aus dem Staube.«
Schon war er im Begriff, dies auszuführen, da hörte er, daß die Aufgefundene auf Spanisch etwas sagte. Von dieser Sprache verstand er keine Silbe. Aber vielleicht gerade darum erwuchs ihm aus den wenigen bedeutungslosen Worten, die ihm ins Ohr drangen, ein märchenhaftes Hirngespinst. Mit einem Male dachte er nicht mehr an die Polizei noch an sonst welche mißlichen Dinge. Die Wahrscheinlichkeit war, daß er eine von Trunkenbolden mißhandelte Dirne vor sich hatte; aber seine Phantasie zauberte ihm die romantische Pforte zu einem seltsamen Liebesabenteuer vor.
Liéven stützte Leonore – so hieß die junge Frau – und sagte ihr ein paar Trostworte.
»Hoffentlich ist sie nicht mordshäßlich«, dachte er dabei im stillen.
Dieser Zweifel gab ihm seine Besonnenheit zurück. Seine romanhaften Ideen verflogen. Jetzt machte er tatsächlich den Versuch, die Unglückliche an der nächsten Türschwelle sitzen zu lassen. Aber darauf ließ sich die Fremde nicht ein.
»Nehmen Sie mich noch ein Stück mit!« bat sie mit einem stark fremdländischen Akzent.
»Haben Sie etwa Angst vor Ihrem Manne?« fragte er.
»Nein, nein! Ich bin meinem Manne davongelaufen, meinem Mann, der mich anbetete, meinen von aller Welt geachteten Mann, um zu meinem Geliebten zu gehen. Der hat mich auf das Roheste behandelt, nicht mein Mann ….«
Bei diesen Worten vergaß der Offizier vollends das Polizeiamt und die etwaigen unangenehmen Folgen eines fragwürdigen Abenteuers.
»Man hat mich ausgeplündert, Herr Leutnant«, fuhr Leonore alsbald fort. »Aber ich merke eben, daß mir dieser Ring mit einem kleinen Diamanten verblieben ist. Zweifellos würde ich in irgendeinem Gasthof Aufnahme finden. Nur fürchte ich, dort zum Gespött zu werden, denn ich muß Ihnen gestehen: ich habe nichts auf dem Leibe als mein Hemd. Wenn Zeit dazu wäre, würde ich Sie auf den Knien bitten, mich aus Barmherzigkeit irgendwo anders unterzubringen und mir von der ersten besten Frau ein abgetragenes altes Kleid zu kaufen. Sobald ich nur halbwegs etwas anhabe, geleiten Sie mich bis zur Tür einer kleinen Herberge. Weiter will ich Ihre edelmütige Hilfe dann nicht in Anspruch nehmen. Jetzt aber bitte ich Sie herzlich: lassen Sie eine Unglückselige nicht im Stich!«
Alles das brachte sie in mangelhaftem Französisch vor.
»Gnädige Frau«, sagte der junge Offizier in einem Tone, der ihr Mut machte. »Ich will alles tun, was Sie wünschen. Zunächst ist es für uns beide die Hauptsache, daß wir keiner Patrouille in die Arme laufen, die nicht von meinem Regiment ist. Mein Name ist Liéven, Leutnant bei den 96ern. Wenn man uns auf die Wache brächte, müßten wir bis zum Morgen dort verbleiben – und morgen amüsiert sich ganz Bordeaux über uns.«
Er spürte, wie Leonore, der er seinen Arm gereicht hatte, erbebte.
»Sie fürchtet sich vor einem Skandal«, dachte er bei sich. »Das spricht für sie.« Und laut fügte er hinzu: »Ziehen Sie, bitte, meinen Mantel an. Ich werde Sie zu mir führen.«
»Du mein Gott!« stöhnte sie.
Er redete ihr zu:
»Gnädige Frau, ich werde kein Licht anstecken. Das verspreche ich Ihnen bei meiner Ehre. Sie sollen unumschränkte Herrin meines Zimmers sein. Ich selbst werde sofort wieder fortgehen und erst morgen früh um sechs Uhr wiederkehren. Das muß ich allerdings unbedingt, denn um diese Zeit kommt mein Bursche. Der wäre imstande, so lange an die Tür zu klopfen, bis ihm aufgemacht wird … Seien Sie unbesorgt, Sie haben es mit einem Ehrenmanne zu tun.« Bei sich dachte er noch: »Ob sie wohl hübsch ist?«
Vor seinem Hause angelangt, schloß er die Haustür auf. Wo die Treppe begann, stolperte die Fremde, der es schwer fiel, sich im Dunkeln an einem ihr neuen Orte zurechtzufinden.
Beim Hinauftappen flüsterten die beiden. Im ersten Stock erschien die Wirtin, keine unüble Frau, in ihrer Türe, eine kleine Lampe in der Hand.
»Schämen Sie sich nicht, ein Weibsbild in mein Haus mitzubringen!« zeterte sie.
Liéven blies ihr rasch das Licht aus.
»Ruhe, Frau Saucède!« gebot er ihr. »Oder ich ziehe morgen früh aus. Sie sollen zehn Franken bekommen, wenn Sie keinem Menschen etwas erzählen. Ich werde gleich wieder gehen.« Leise flüsterte er ihr noch zu: »Es ist die Frau Oberst!«
Im Scheine des Lichts hatte er einen flüchtigen Blick auf seine Begleiterin geworfen und ein wunderschönes Gesicht erblickt.
Die Stube des Leutnants lag im zweiten Stock. Beim Aufschließen der Türe zitterte Liéven die Hand.
»Ich bitte einzutreten, gnädige Frau!« sagte er zu der Frau im Mantel und Hemd. »Drinnen auf dem Tische finden Sie Streichhölzer. Zünden Sie sich den Leuchter an! Dann schließen Sie die Türe von innen. Ich betrachte Sie als meine Schwester … Und, wie gesagt, früh um sechs komme ich wieder. Die nötigen Kleider bringe ich Ihnen mit.«
»Jesus Maria!« rief die schöne Spanierin.
Der junge Mann ging.
Als er am andern Tage an der Tür klopfte, fühlte er sich tollverliebt. Er hatte seinen Burschen vor dem Hause abgelauert, damit die Fremde nicht zu zeitig geweckt werde. Sodann hatte er ihr in der Nachbarschaft ein Stübchen gemietet und die nötigen Kleider sowie einen Hut besorgt.
Leonore kam an die Türe, öffnete aber nicht.
»Wenn Sie befehlen, werde ich Sie nie sehen!« sagte er ihr durch die Türe.
»Sie sind ein edler Mensch«, war die Antwort. »Aber ich bitte Sie doch, die Kleider, die Sie mir so gütig bringen, vor der Türe niederzulegen. Wenn Sie gegangen sind, hole ich mir alles herein.«
»Leben Sie wohl, gnädige Frau!« sagte Liéven und schickte sich an wieder zu gehen.
Bei all ihrem Kummer war Leonore entzückt über diesen prompten Gehorsam. Fast im Tone vertrauter Freundschaft sagte sie darauf:
»Wenn Sie können, Herr Leutnant, so kommen Sie in einer halben Stunde wieder!«
Als er sich wieder einstellte, fand er in der Tat eine bildschöne Frau, wie er noch nie in seinem Leben einer gleichen begegnet war. Seine Freude stieg ins Grenzenlose. Entzückt schaute er ihre Arme, ihren Hals, ihre Hände, und vor allem ihre großen schwarzen sprechenden Augen. Es funkelte Energie in ihnen, ungewöhnliche harte Energie. Es lag etwas Unerbittliches in ihnen, nur durch Leid und Verzweiflung etwas gemildert. Das Alter der jungen Frau schätzte er auf höchstens zwanzig Jahre.
Liéven war ein junger Mann aus guter Familie, der sich noch zwingen mußte, vor Frauen, in die er verliebt war, Mut zu haben. Er war also voll Ehrerbietung und machte in seinem armseligen Hauswesen die Honneurs so gut er nur konnte. Keins von beiden sagte etwas. Aber die unverhohlene große Bewunderung des jungen Offiziers bereitete Leonoren bei ihrem Herzeleid Vergnügen.
»Sie sind mein Wohltäter«, begann sie endlich. »Und ich hoffe, trotz Ihrer und meiner Jugend bleiben Sie zu mir so ritterlich wie bisher.«
Der maßlos verliebte Offizier stotterte ein paar sinnlose Worte, aber er bewahrte so viel Selbstbeherrschung, daß er sich das Glück versagte, offen von seiner Liebe zu reden. Übrigens lag in Leonorens Augen etwas so Gebieterisches, und trotz ihrer ärmlichen Kleidung war ihre Vornehmheit so unverkennbar, daß er schon dadurch zur Besonnenheit ermahnt ward.
»Es geschieht mir schon recht«, schalt er sich. »Ich bin ja immer der größte Narr der Welt!«
Er ergab sich seiner Schüchternheit und verlor sich in die himmlische Wollust, Leonore anzuschauen, ohne etwas dabei zu sagen. Es war das beste, was er tun konnte; denn dieses Verhalten beruhigte die schöne Spanierin allmählich. Es war freilich sehr drollig, wie die beiden einander so schweigsam anblickten.
Nach geraumer Zeit geleitete Liéven Leonore nach dem Zimmer, das er für sie gemietet hatte. Seine Erregung, aber auch sein Glück, verdoppelte sich, als sie zu ihm sagte:
»Wie wird das enden?«
Mit dem höchsten Ungetüm erklärte er ihr:
»Um Ihnen einen Dienst zu erweisen, ginge ich durchs Feuer! Ich habe das Zimmer übrigens auf den Namen von Frau Leutnant Liéven gemietet. Sie gelten somit für meine Frau.«
»Für Ihre Frau?« unterbrach sie ihn fast ärgerlich.
»Entweder mußte ich so sagen oder Sie müßten sich ausweisen können. Haben wir einen Paß? Nein!«
Dieseswirbereitete ihm innige Freude. Er hatte der Unbekannten hundert Franken für den Ring eingehändigt, den sie ihn zu verkaufen gebeten hatte. So viel war er ungefähr wert. Als das Frühstück gebracht wurde, bat sie ihn, sich mit an den Tisch zu setzen.
Nach dem Frühstück sagte sie zu ihm:
»Sie haben sich mir sehr hochherzig erwiesen. Verlassen Sie mich jetzt gütigst! Ich werde Ihnen immerdar von Herzen dankbar sein.«
»Ich gehorche Ihnen«, erwiderte Liéven und erhob sich. Das Herz stand ihm still.
Mit einem Male wurde die Fremde nachdenklich. Da sagte sie:
»Bleiben Sie! Sie sind noch sehr jung, aber schließlich bedarf ich eines Beschützers. Wer weiß, ob ich noch einmal einen so ritterlichen Mann finde. Sollten Sie übrigens Gefühle für mich hegen, auf die ich keine Rechte mehr habe, so dürfte die Erzählung meines Vergehens Ihre Verehrung rasch zerstören und jede Teilnahme an mir Verworfenen in Ihnen töten. Ich bin die schlimmste Sünderin, noch dazu eine, die ihre Schuld niemandem zuschieben kann. Ich darf mich über keinen Menschen beklagen, am wenigsten über Don Gui Ferrandez, meinen Mann.
»Hören Sie mich an!
»Mein Mann ist einer jener unglücklichen Spanier, die vor zwei Jahren hier in Frankreich Zuflucht gesucht haben. Wir sind beide aus Cartagena. Er sehr reich, ich blutarm. Am Abende vor meiner Hochzeit sagte er mir unter vier Augen: ›Ich bin mehrfacher Millionär und meine Liebe zu dir ist die tollste Leidenschaft meines ganzen Lebens. Wäge und wähle! Wenn ich dir als Gatte zu alt bin, so will ich deiner Familie gegenüber alle Schuld des Bruches auf mich nehmen.‹ Das war vor vier Jahren. Ich war fünfzehn Jahre alt und hatte nichts im Sinne als den Kummer darüber, daß die Meinen durch die Revolution der Cortes in tiefe Armut geraten waren. Ich liebte meinen Bräutigam nicht, aber ich heiratete ihn.
»Wahrscheinlich haben Sie geglaubt, als Sie mich heute nacht halbnackt in einer so armseligen Gasse fanden, Sie erbarmten sich einer Dirne. Ach, ich bin viel schlechter als das. Ich bin eine Verbrecherin.
»Kaum war ich Don Guis Frau, als seine Eifersucht mehr und mehr zutage trat. Zunächst hatte er ja keinen Anlaß, aber offenbar ahnte er die Möglichkeit. Er ahnte meine Verderbnis. Ich war so töricht, mich über den Argwohn meines Mannes zu ärgern. Meine Eigenliebe war verletzt. Ach, ich Unglückliche!«
Sie brach in Tränen aus.
»Und wenn Sie sich auch der größten Verbrechen beschuldigen,« sagte Liéven, »ich bleibe Ihnen ergeben immerdar bis in den Tod. Wenn wir polizeiliche Verfolgung zu erwarten haben, so sagen Sie mir das rasch, damit ich Ihnen unverzüglich alles zur Flucht vorbereiten kann.«
»Flucht?« wiederholte sie. »Wie soll ich durch dieses Land kommen, dessen Sitten und Gebräuche ich nur mangelhaft kenne, dessen Sprache ich nur radebreche, wie Sie hören? Dies und andre Dinge müssen mich verraten. Der erste Schutzmann, der meinen Paß sehen will, wird mich verhaften. Ohne Zweifel sucht mich die hiesige Polizei bereits. Mein Mann wird eine hohe Belohnung ausgesetzt haben, damit man mich findet. Lassen Sie mich, Herr Leutnant! Gehen Sie!«
Aber nach einem Moment des Zögerns fuhr sie fort:
»Ich will noch freimütiger mit Ihnen reden. Ich bete einen Andern an. Einen Mann, der nicht mein Gatte ist. Und was für einen Mann! Einen Unmenschen, den Sie verachten würden. Er hat schlecht an mir gehandelt. Aber er braucht mir nur ein einziges Wort der Reue zu sagen, so fliege ich in seine Arme, nein, nein: so liege ich zu seinen Füßen!
»Sie haben mich nicht danach gefragt, aber in meiner Schmach und Schande will ich wenigstens meinen Wohltäter nicht belügen und betrügen. Ich achte Sie, ich bewundere Sie, ich bin voll inniger Dankbarkeit zu Ihnen. Aber niemals könnte ich Sie lieben!«
Liéven wurde sehr traurig. Schließlich sagte er tonlos: »Gnädige Frau, deuten Sie die Traurigkeit, die mit einem Male mein Herz ergriffen hat, nicht falsch! Ich denke nicht daran, Sie im Stiche zu lassen. Ich überlege mir nur, wie wir den Nachforschungen der Polizei am besten entgehen können. Am sichersten scheint mir: Sie bleiben vorläufig hier in Bordeaux versteckt. Nach einiger Zeit aber werde ich Ihnen eine Schiffskarte verschaffen, und zwar sollen Sie an Stelle einer Dame reisen, die Ihnen gleichaltrig ist … wenn sie auch nicht so schön ist wie Sie …«
Als er dies sagte, hatten seine Augen alles Feuer verloren.
Leonore fuhr fort zu erzählen:
»Don Gui Ferrandez wurde der Partei verdächtig, die Spanien vergewaltigt. Eines Tages verließen wir zu Schiff Cartagena und all unsere Liegenschaften. Trotzdem ist mein Mann immer noch sehr reich. Er besitzt hier in Bordeaux, wo er sein Geschäft weiterführt, ein prächtiges Haus. Aber wir leben gänzlich für uns. Mein Mann wünscht durchaus nicht, daß ich geselligen Umgang suche. Seit den letzten zwei Jahren schützt er politische Gründe vor. Er dürfe nicht mit Liberalen verkehren. Ich habe seitdem keine zwei Besuche gemacht. Ich kam vor Langerweile beinahe um. Mein Mann ist ein anständiger großmütiger Mensch. Nur mißtraut er aller Welt. Er ist ein fürchterlicher Schwarzseher.
»Zu unserm Unglück gab er vor etwa einem Vierteljahr meiner Bitte nach, eine Loge imVariétézu mieten. Er wählte die ungünstigste, die Proszeniumsloge, damit ich den Blicken der jungen Herren im Zuschauerraum entzogen wäre. Man sieht von ihr aus fast nur die Bühne. Unter anderem trat eine neapolitanische Voltigeurtruppe auf …. Ach, wie werden Sie mich verachten!«
»Gnädige Frau«, entgegnete Liéven, »ich höre Ihnen aufmerksamst zu, aber ich denke dabei eigentlich nur an mein eigenes Leid. Der, den Sie lieben, der ist glücklicher als ich.«
»Jedenfalls haben Sie von dem berühmten Mayral gehört …«, fuhr Leonore mit niedergeschlagenen Augen fort.
»Dem spanischen Kunstreiter?« fragte Liéven erstaunt. »Gewiß, ganz Bordeaux ist zu ihm hingelaufen. Ein geschickter und schmucker Bursche!«
»Ja, und ich bildete mir ein, er sei auch kein gemeiner Mensch. Wenn er seine Kunststücke am Pferde zeigte, schaute er unverwandt zu mir hin. Wir besuchten die Vorstellung öfters. Eines Tages, als mein Mann gerade hinausgegangen war, trat er dicht an meine Loge und sagte auf spanisch: ›Ich bin Kapitän der Armee des Marquesito. Ich bete Sie an!‹
»Von einem Kunstreiter geliebt zu werden, das ist etwas Abscheuliches. Aber es ist eine Schande, dies nicht als abscheulich zu empfinden. In den nächsten Tagen gewann ich es über mich, das Theater zu meiden. Ich war tief unglücklich.
»Eines Tages sagte meine Kammerjungfer zu mir: ›Gnädige Frau, Herr Ferrandez ist ausgegangen. Dieser Brief ist für die gnädige Frau abgegeben worden.‹ Es war ein Liebesbrief von Mayral. Er erzählte mir seine Lebensgeschichte. Er sei ein armer Offizier, durch Not gezwungen, als Artist aufzutreten. Mir zuliebe wolle er dies Handwerk aber gern aufgeben. Sein wahrer Name sei Don Rodrigo Pimentel.
»Von neuem besuchte ich dasVariété. Ich glaubte an Mayrals Leidensgeschichte. Ich las seine Briefe voll Entzücken. Schließlich schrieb ich ihm auch welche. Ich habe ihn leidenschaftlich geliebt, so leidenschaftlich, daß mich nichts ernüchtern konnte, selbst die traurigsten Entdeckungen nicht …«
Wiederum begann Leonore heftig zu weinen.
»Ich sehnte mich danach, mit ihm sprechen zu können. Einen Argwohn hatte ich freilich. Wenn er wirklich Offizier vom Korps des Marquesito gewesen wäre, so hätte er stolzer und selbstbewußter sein müssen. Er schrieb mir mehrfach, er fürchte, daß ich ihn nicht ernst nähme, da er nur ein armer Kunstreiter sei.
»Vor etwa acht Wochen bekam mein Mann die Nachricht, eins seiner Schiffe sei bei Royan an der Strommündung festgefahren. Sofort entschloß er sich, am nächsten Tage an Ort und Stelle zu reisen. Abends im Theater machte ich Mayral ein längst verabredetes Zeichen. Daraufhin holte er sich, während wir noch in der Loge saßen, bei unsrer Pförtnersfrau, die von ihm bestochen war, einen Brief, den ich dort niedergelegt hatte. Als er dann auftrat, sah ich, daß er voller Freude war. Ich hatte die Schwachheit gehabt, ihm zu schreiben, daß ich ihn in der nächsten Nacht in einem nach dem Garten zu gelegenen Zimmer des Erdgeschosses erwartete.
»Mein Mann fuhr gegen Mittag mit dem Dampfschiff nach Royan. Es war ein heißer Tag, mitten im Hochsommer. Abends erklärte ich meiner Kammerjungfer, ich wolle im Erdgeschoß, im Schlafzimmer meines Mannes, schlafen. Dort merke man die gräßliche Hitze nicht so sehr.
»Es war gegen ein Uhr nachts. Ich lauerte auf Mayral. Da klopfte es plötzlich stark gegen die Tür. Es war mein Mann. Auf halbem Wege nach Royan hatte er sein Schiff erblickt, das ruhig die Gironde hinauf nach Bordeaux zu steuerte.
»Mein Mann trat in das Zimmer, merkte aber nichts von meinem Schrecken und meiner Verwirrung. Er lobte nur meinen guten Einfall, das kühlere Zimmer zum Schlafen gewählt zu haben, und legte sich neben mich zur Ruhe.
»Stellen Sie sich meine Aufregung vor. Zum Unglück war auch noch Vollmond. Es dauerte keine Stunde, als ich Mayral draußen im Garten kommen hörte. Die Fenstertür des anstoßenden Kabinetts stand offen. Ich hatte vergessen, sie nach der überraschenden Ankunft meines Mannes zu schließen. Ebenso war die Tür vorm Kabinett in das Schlafzimmer weit auf.
»Es war hell wie am Tage. Ich höre, wie Mayral das Kabinett betritt. Schon steht er dicht am Bett, an der Seite, wo ich liege. Zum Glück sagt er kein Wort. Ich mache mit dem Kopf ein Zeichen. Mehr wage ich an der Seite eines eifersüchtigen Gatten nicht.
»Es mißlingt mir, Mayral begreiflich zu machen, daß unerwartet ein Zwischenfall eingetreten ist. Endlich aber sieht er, daß neben mir jemand schläft. Er zieht den Dolch.
»Vor Schreck fahre ich in die Höhe. Mayral flüstert mir ins Ohr: ›Ihr Liebster! Ich verstehe. Ich komme zur rechten Zeit. Oder wollten Sie sich den Spaß machen, einen lumpigen Voltigeur zum Narren zu haben? Passen Sie auf! Dem Kerlchen da werde ich’s besorgen!‹ – ›Es ist mein Mann!‹ beteuerte ich und hielt ihm die Hand fest. – ›Ihr Mann? Den habe ich doch mittags in das Dampfschiff nach Royan einsteigen sehen. Unsereiner ist nicht so blöd, alles zu glauben. Steh jetzt auf und komm mit in das Kabinett nebenan! Ich will es! Sonst wecke ich das Murmeltier da. Dann werde ich ja gleich wissen, wer es ist. Ich bin stark und behend und habe einen Dolch. Wenn ich auch nur ein armseliger Gaukler bin, werde ich ihm doch beibringen, welch übel Ding es ist, mich zum Narren zu halten. Ich muß dich haben. Zum Donnerwetter! Dann ist er der Geprellte.‹ – In diesem Augenblick wachte mein Mann auf. Schlaftrunken fragte er: ›Wer sagt da, er müsse dich haben?‹ – Mayral hatte sich neben mich in das Bett gelegt und hielt mich fest umschlungen. Bei meines Mannes halbwacher Bewegung duckte er sich aber vorsichtig nieder. Ich reckte einen Arm aus, als sei ich durch die Worte meines Gatten erwacht, und sagte ihm allerlei, woraus Mayral merkte, daß es wirklich mein Mann und kein zweiter Liebhaber war. Endlich schlief Gui wieder ein. Er glaubte geträumt zu haben. Ich versprach Mayral alles, was er wollte. Sein blanker Dolch lag auf dem Bette und funkelte im Mondenlichte. Mayral verlangte, ich solle mit ihm in das Kabinett nebenan gehen. ›Ich glaube schon, es ist dein Mann. Aber eine alberne Rolle spiele ich trotzdem‹, knirschte er wütend.
»Als ich ihm in das Kabinett folgen wollte, erwachte mein Mann von neuem, aber er faßte nicht den geringsten Argwohn. Verliebt, wie er allezeit in mich war, küßte und liebkoste er mich und schloß mich in seine Arme.
»Mayral, der im Kabinett stand und lauschte, bildete sich ein, mehr aus gekränkter Eitelkeit denn aus Liebe, ich hätte ihn nur hergelockt, damit er Zeuge der Liebkosungen meines Mannes sein sollte. Jeden Augenblick dachte ich, er müsse mit dem Dolche in der Hand ins Gemach treten und meinen Mann ermorden. Er ist zu allem fähig.
»Erst nach einer Stunde ging er. Ehe er im Garten verschwand, stieß er aus Wut mit dem Dolchgriff eine der großen Scheiben der Fenstertüre des Kabinetts entzwei.
»Ich erbebte. Mein Mann sprang aus dem Bett. Er fand nichts. Mayral war geräuschlos geflohen.
»Ich schrieb Mayral mehrere Briefe. Er antwortete nicht. Ja, er würdigte mich imVariétékeines Blickes …«
Sie hielt inne.
»Gewiß ermüde ich Sie«, fuhr sie fort, in Gedanken verloren. »Sie sollen aber bis auf das Letzte wissen, wie verworfen und schlecht ich bin.
»Vor acht Tagen kündete Mayrals Truppe ihre Abreise an. Ich war wahnsinnig verliebt in diesen Mann, der mich seit drei Wochen, seit dem Tage des verunglückten Stelldicheins in unserm Hause, nicht mehr beachtete und es unter seiner Würde hielt, mir auf meine Briefe zu antworten. Am vergangenen Montag lief ich nun dem besten aller Ehemänner weg. Ja, ich bestahl ihn noch, ich, die ich ihm kein bißchen Mitgift zugebracht hatte, nichts als mein treuloses Herz! Ich steckte die Diamanten ein, die er mir nach und nach geschenkt hatte, dazu aus seinem Schreibtische drei oder vier Rollen mit je fünfhundert Franken. Ich fürchtete, Mayral könnte sich verdächtig machen, wenn er Diamanten verkaufte …«
An dieser Stelle ihres Berichtes wurde Donna Leonora über und über rot. Liéven war bleich und fassungslos geworden. Jedes einzelne Wort von ihr drang wie ein Dolchstoß in sein Herz, und doch geschah es, in seltsamer Bizarrerie, daß die Liebe, die sein Herz durchglühte, mit jedem ihrer Worte mächtiger ward. Seiner nicht mehr Herr, erfaßte er Leonorens Hand. Sie entzog sie ihm nicht.
»Was bin ich für eine niedrige Kreatur!« dachte er bei sich. »Ich bin selig, diese Hand halten zu dürfen, während Leonore offen von ihrer Liebe zu einem Andern mit mir spricht! Sie läßt mir ihre Hand aus Gleichgültigkeit oder aus Zerstreutheit. Ach, ich bin ein Mensch ohne das geringste Feingefühl!«
Leonore erzählte weiter, gänzlich mit sich selbst beschäftigt:
»Am letzten Dienstag, also vor vier Tagen, frühmorgens um zwei Uhr, bin ich entflohen. Am Abend vorher beging ich die Niederträchtigkeit, meinem Manne und dem Pförtner einen Schlaftrunk zu verabreichen … In dem Haus, aus dem ich heute nacht stürzte, als Sie gerade vorbeikamen, wohnte Mayral. Als ich in jener Nacht zu ihm kam, fragte ich ihn: ›Glaubst du nun, daß ich dich liebe?‹ Ich war glückselig. Als ich ihm am andern Morgen meine Diamanten und mein Geld zeigte, entschloß er sich, seine Truppe zu verlassen und mit mir nach Spanien zu entfliehen. Aber du mein Gott! Ich merkte an seiner Unkenntnis gewisser Eigentümlichkeiten, die wir Spanier haben, daß er keiner war. Ich mußte mir sagen: Offenbar bin ich im Begriffe, mein Schicksal an das eines obskuren Artisten zu hängen. Pah! Was tut’s? Wenn er mich nur liebt! Er ist nun einmal der Herr meines Lebens. Ich will seine Dienerin, sein treues Weib sein! Er soll seinen Beruf behalten. Ich bin jung. Wenn es sein muß, erlerne ich auch sein Handwerk. Wenn wir einmal nichts mehr verdienen, weil wir alt geworden sind, dann sterbe ich ihm zur Seite im Elend. Zu beklagen bin ich auch dann nicht. Denn ich habe gelebt und geliebt … Toll war ich! Wahnsinnig! Pervers!«
Liéven verteidigte sie:
»Man darf nicht vergessen, daß Sie bei Ihrem altersschwachen Ehemanne vor Langerweile umkamen. Er ließ Sie ja nirgends hin. In meinen Augen rechtfertigt dies so manches. Sie sind erst neunzehn Jahre alt, er neunundfünfzig. Wie viele Frauen gibt es hierzulande, die hochgeachtet sind und doch viel Schlimmeres begangen haben – und in der Tiefe ihres Herzens keine so edelmütige Reue verspüren wie Sie!«
Diese und ähnliche Redensarten schienen die schwerbedrückte Leonore sichtlich ein wenig zu erleichtern. Sie fuhr fort:
»Drei Tage bin ich bei Mayral geblieben. Jeden Abend verließ er mich und ging in seine Vorstellung. Gestern abend sagte er zu mir beim Weggehen: ›Es wäre nicht unmöglich, daß die Polizei eine Hausdurchsuchung macht. Ich will deshalb dein Geld und deine Diamanten bei einem sicheren Freunde unterbringen.‹ Um ein Uhr nachts kam er heim, später als sonst. Ich hatte auf ihn gewartet und war vor Angst beinahe gestorben, daß er beim Voltigieren verunglückt sein könnte. Er gab mir einen Kuß, verließ aber mein Zimmer sehr bald wieder. Zu meinem Glück hatte ich die Kerze wieder angezündet, die er mir bei Weggang ausgeblasen hatte. Lange nachher, als ich bereits im Schlafe gewesen war, trat ein Mann an mein Bett. Ich merkte es sofort. Es war nicht Mayral. Ich griff nach meinem Dolch. Der Feigling bekam Angst, warf sich mir zu Füßen und bat mich um Erbarmen. ›Wenn Sie mir etwas tun,‹ jammerte er, ›so kommen Sie auf das Schafott!‹ Der Mensch widerte mich an. ›Mit was für Pack habe ich mich eingelassen!‹ sagte ich mir. Ich hatte genügend Geistesgegenwart, ihm zu erklären, daß ich in Bordeaux die besten Beziehungen hätte und daß ich ihn dem Staatsanwalt ausliefern würde, wenn er mir nicht sofort die volle Wahrheit eingestehe. ›Sehr gern‹, gab er mir zur Antwort. ›Ich habe Ihnen nichts geraubt, weder Ihr Geld noch Ihre Brillanten! Mayral hat Bordeaux eben verlassen. Er flieht mit der ganzen Beute nach Paris. Mit ihm die Frau unseres Direktors. Er hat sie ihrem Manne für fünfundzwanzig Ihrer schönen Goldfüchse abgekauft. Mir hat er zwei gegeben. Hier sind sie. Ich gebe sie Ihnen zurück, wenn Sie sie mir nicht aus Anstand lassen. Er hat mir das Geld gegeben, damit ich Sie solange wie möglich hier festhalte. Er braucht zwanzig bis dreißig Stunden Vorsprung.‹ – ›Ist er Spanier?‹ fragte ich. – ›Er … Spanier? Er ist aus San Domingo. Dort ist er durchgebrannt, nachdem er seinen Herrn gemordet und ausgeraubt hat.‹ – ›Warum ist er heute nacht noch einmal zurückgekommen?‹ fragte ich weiter. ›Sagen Sie mir das, oder mein Onkel bringt Sie ins Zuchthaus!‹ – ›Ich zauderte, hierher zu gehen und Sie zu bewachen. Da redete Mayral mir vor, Sie seien ein sehr schönes Weib. ›Du legst dich einfach statt meiner in ihr Bett‹, sagte er. ›Das gibt einen Mordsspaß! Sie hat mich früher einmal veralbert. Jetzt veralbern wir sie.‹ Als ich das hörte, machte ich mit. Aber da ich keinen rechten Schneid hatte, hat er die Postkutsche vor der Tür halten lassen und ist mit heraufgekommen, um Sie in meinem Beisein zu umarmen. Als er bei Ihnen im Bett war, habe ich mich daneben versteckt gehalten …‹«
Leonore begann zu schluchzen und vermochte nicht mehr zu sprechen. Endlich berichtete sie weiter:
»Der junge Artist erzählte mir sodann eine Menge ebenso wahre wie für mich schmerzliche Einzelheiten aus Mayrals Lebensführung. Ich war in Verzweiflung. Vielleicht hat er mir einenLiebestrankeingegeben, denn ich bin nicht fähig, ihn zu hassen. Auch heute noch nicht. Ich bete ihn an …«
Sie unterbrach sich und starrte versonnen vor sich hin.
»Seltsame Verblendung!« dachte Liéven bei sich. »Eine so kluge junge Frau glaubt an Liebeshexerei!«
»Schließlich verließ mich der junge Mensch plötzlich, kam aber nach etwa einer Stunde mit einem seiner Kollegen wieder. Ich mußte mich zur Wehr setzen und wir gerieten in ein Handgemenge. Vielleicht wollten sie mir ans Leben, obgleich sie angeblich etwas ganz andres von mir forderten. Es gelang mir, die Haustüre zu erreichen. Ohne Sie hätten sie mich wahrscheinlich noch auf der Straße verfolgt.«
Je mehr Liéven sah, daß Leonore wahnsinnig in den Verbrecher verliebt war, um so mehr wuchs seine eigene Leidenschaft. Sie weinte viel. Er küßte ihr die Hände. So ging es Tag um Tag.
Einmal, als er ihr seine Liebe in verschwommenen Worten andeutete, fragte sie ihn:
»Mein einziger bester Freund, was glauben Sie? Wenn es mir gelänge, Mayral zu beweisen, daß ich niemals die Absicht gehabt noch den Versuch gemacht habe, ihn zum Narren zu halten: glauben Sie, daß er mich dann wieder lieben könnte?«
»Ich habe sehr wenig Geld«, erwiderte der Offizier. »Aus Langerweile bin ich Spieler geworden. Aber der Bankier, der mir das Geld auszahlt, das mir mein Vater hin und wieder schickt, leiht mir vielleicht drei-bis vierhundert Franken, wenn ich ihn sehr darum bitte. Schlimmstenfalls verschreibe ich mich Tod und Teufel. Für Sie tue ich alles. Mit dem Gelde können Sie nach Paris reisen.«
Leonore warf sich ihm um den Hals.
»Heilige Madonna!« rief sie aus. »Warum kann ich Sie nicht lieben! Und Sie, Sie verzeihen mir meine grauenhafte Tollheit?«
»Ganz und gar! Ich würde Sie trotzdem mit Freuden zur Frau nehmen und Ihnen mein ganzes Leben weihen und der glücklichste Mensch auf Erden sein!«
»Aber wenn mir eines Tages Mayral von neuem begegnete: ich wäre so toll und so schlecht, Sie im Stiche zu lassen und ihm zu Füßen zu fallen.«
Liéven wurde zornesrot.
»Es gibt nur ein Mittel, mich zu heilen«, beteuerte er unter wilden Küssen. »Den Tod!«
»Nein!« bat sie. »Töte dich nicht, mein Freund!«
Leutnant Liéven ward nicht mehr gesehen.
Leonore ist in das Kloster der Ursulinerinnen gegangen.
Philibert Lescale
Inhaltsverzeichnis
Irgendwie hatte ich ihn kennengelernt, den hünenhaft langen alten Herrn Lescale, einen der reichsten Pariser Handelsherren. Er besaß ein Zweiggeschäft in Marseille und mehrere Schiffe auf dem Meere. Kürzlich ist er gestorben. Er war durchaus kein trübseliger Mensch; aber wenn es ihm einmal beikam, zehn Worte an einem Tage zu reden, so war das ein Wunder. Gleichwohl liebte er fröhliche Gesellschaft und setzte z. B. Himmel und Hölle in Bewegung, um an unsern kleinen in aller Stille abgehaltenen Sonnabend-Abendessen teilnehmen zu können. Er war der geborene Geschäftsmann; in schwierigen Angelegenheiten hätte ich seinen Rat eingeholt.
Kurz vor seinem Tod erwies er mir die Ehre, mir einen drei Zeilen langen Brief zu schreiben. Es handelte sich um einen jungen Mann, dessen Wohl ihm am Herzen lag, der aber seinen Namen nicht trug. Er hieß Philibert.
Sein Vater hatte ihm erklärt: »Mache was du willst. Es kümmert mich wenig. Begehe große Dummheiten; nur will ich sie nicht erleben! Du hast zwei Brüder. Ich werde mein Vermögen dem von euch dreien vererben, der am wenigsten ein Tor ist, und den beiden andern ein Jahresgeld von 2000 Franken.«
Philibert war in der Schule immer ein Musterschüler gewesen; folglich hatte er beim Eintritt ins Leben von nichts eine Ahnung. Drei Jahre war er Husarenoffizier; dann machte er zwei Reisen nach Amerika. Vor der zweiten hatte er sich eingebildet, in eine Secondadonna verliebt zu sein, eine Erzschelmin, wie mir schien, fähig, ihren Liebhaber in Schulden zu stürzen, zu allerlei Torheiten zu verleiten und ihn am Ende gar durch irgendwelche kleine Schandtat hinter Schloß und Riegel zu bringen. Dies verhehlte ich dem Vater nicht.
Herr Lescale ließ Philibert, den er acht Wochen lang nicht gesehen, kommen und sagte zu ihm: »Wenn du Paris verlassen und nach Neu-Orleans fahren willst, gebe ich dir 15000 Franken, zahlbar an Bord. Du wirst auf der Reise mein bevollmächtigter Vertreter sein.«
Der junge Mann reiste ab, und man trug zu seinem Leidwesen Sorge, daß sein Aufenthalt in Amerika länger währte als seine Liebessehnsucht. Erst die Nachricht vom Tode seines Vaters rief ihn zurück. Der Ärmste hatte sich für fünfundsechzig Jahre alt ausgegeben, war aber in Wahrheit neunundsiebzig. In seinem Testament erkannte er seinen Sohn an und vermachte ihm ein Vermögen, das 40000 Franken im Jahre eintrug. Fernerhin, für den Fall, daß er seine Besitztümer bis auf den letzten Taler durchbrächte, war bestimmt, daß ihm einer der Freunde des alten Lescale jeden Monat 200 Franken zu zahlen habe, und falls er im Schuldengefängnis säße, 300 Franken.
Philibert machte mir einen Besuch. Er sah sehr gerührt aus, und da er mich ernstlich um meine Meinung bat, sagte ich zu ihm: »Bleiben Sie zunächst hier in Paris, jedoch unter einer Bedingung: werden Sie Legitimist und schimpfen Sie jederzeit auf die jetzige Regierung; schenken Sie Ihre Huld einer jungen Dame von der Oper und bemühen Sie sich, sich nur bis zur Hälfte zu ruinieren! Befolgen Sie diesen Rat, so bleiben wir gute Freunde, und in acht Jahren, wenn Sie zweiunddreißig sind, werden Sie ein vernünftiger Mann sein.«
»Ich werde dies, wenigstens in einer Hinsicht, von Stund an sein!« antwortete er mir. »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich niemals mehr denn meine 40000 Franken im Jahre ausgeben werde. Aber warum soll ich der Opposition angehören?«
»Das macht sich gut, besonders wenn einer sonst nichts zu tun hat!«
Was ich da erzähle, ist weiter nicht welterschütternd; ich will es nur aufzeichnen, weil es eine wahre Geschichte ist. Philibert beging in der Folge manche Dummheit; in der Hauptsache aber befolgte er meine Weisungen. Allerdings, im ersten Jahre verjuchheite er 60000 Franken, was ihn dermaßen reute, daß er in diesem Jahre keine 2000 Franken im Monat braucht.
Aus freien Stücken ist er daran gegangen, Latein und Mathematik zu studieren. Angeblich will er eines Tages eine große Fahrt auf einem eigenen Schiffe antreten, um Amerika noch einmal zu besuchen und dann Indien. Mit einem Worte, trotz seinem unerwarteten Reichtume kann ein hochangesehener Mann aus ihm werden, und wenn er dies je liest, wird er schmunzeln.
Ich habe ihm in einzelnen Dingen noch etliche belanglose Ratschläge erteilt, die von Erfolg gewesen sind. Er wohnt in einer der entlegensten Straßen im Vorort Saint-Germain, überaus geschätzt vom Torwart des Hauses. Den Armen gibt er 3000 Franken. Er hält sich nur drei Pferde, die er aber persönlich in England ausgesucht hat. Er ist in keiner Leihbibliothek abonniert und liest nie ein Buch, das ihm nicht selbst gehört und nicht prächtig eingebunden ist. Er hat nur zwei Dienstboten, mit denen er kein Wort spricht, deren Lohn er aber alle Jahre um ein Viertel erhöht. Schon drei-oder viermal hat man ihn zu einer Heirat verlocken wollen, worauf ich ihm eröffnet habe: falls er sich vor seinem 36. Lebensjahre vereheliche, entzöge ich ihm meine Gunst und Gnade. Immer hoffte ich, er werde endlich die erwartete große Dummheit begehen. Ich hatte schon allzusehr meinen Narren an ihm gefressen. Er ist ein wunderhübscher, nur sehr schweigsamer Mensch. Meinen Fingerzeigen gemäß ist er immer schwarzgekleidet, als hätte er Trauer. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit habe ich ihm gesagt, er solle sich über den Hingang einer Dame vomBâton-Rougebei Neu-Orleans untröstlich stellen. Da wollte er sogar seiner Geliebten von der Oper den Laufpaß geben, aber ich fürchte die Leidenschaften und habe ihn ersucht, sie zu behalten.
Am liebsten weilt er auf seinem Landgute, das er sich auf meine Veranlassung nahe bei Compiègne am Waldrande gekauft hat. Was ich dabei im Auge hatte, das war die gute Gesellschaft, genauer gesagt, die Ehrbarkeit der Besitzer der sechs oder sieben benachbarten Schlösser. Sämtliche Drohnen der Umgegend blasen Loblieder auf Herrn Philibert Lescale. Er ist hilfreich und gut – und gestattet aller Welt, ihn für dumm zu halten. Bei den Damen hat er unbegreifliches Glück; aber insgeheim liebt er eine einzige, die er zweimal in der Woche zu sehen bekommt. Die Komödie, die ihm die andern Frauen vorspielen, findet er langweilig, zu wenig lustig. Kurzum: Philibert Lescale ist ein vortrefflicher Mensch, ein lieber Kerl, wie man zu sagen pflegt.
Nachschrift, zwei Jahre später:
Es war meinerseits eine große Dummheit, den braven Philibert zu veranlassen, der Sängerin nicht den Laufpaß zu geben. Ihretwegen hat er soeben ein Duell gehabt, mit einem angeblichen russischen Fürsten, der ihm eine Kugel durch die Stirn gejagt hat. Daran ist er gestorben.
Der russische Fürst, ein verschuldeter Abenteurer, weder Fürst noch Russe, hat die schöne Gelegenheit benutzt, um aus Frankreich und seiner Opernloge schleunigst zu verschwinden.
Ernestine, oder die Entstehung der Liebe
Inhaltsverzeichnis
Übertragen von Franz Kessel
Eine Frau von viel Geist und einiger Erfahrung behauptete eines Tages, die Liebe entstünde nicht so plötzlich wie man sage. »Ich glaube, sieben ganz verschiedene Epochen bei der Entstehung der Liebe wahrzunehmen.« Und, um ihr Wort zu beweisen, erzählte sie die folgende Anekdote. Man war auf dem Lande, es regnete in Strömen, man war äußerst glücklich zuzuhören.
In einer vollkommen gleichmütigen Seele, einem jungen Mädchen, das ein einsames Schloß in entlegener Landschaft bewohnt, erregt das geringste Erstaunen tiefste Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, ein junger Jäger, den sie unvermutet im Walde beim Schloß bemerkt.
Mit einem so einfachen Ereignis begann das Mißgeschick Ernestines von S… Das Schloß, das sie allein mit ihrem alten Oheim, dem Grafen von S… bewohnte, war im Mittelalter nahe dem Ufer des Drac auf einen der ungeheuren Felsen gebaut, die den Lauf dieses Bergstromes einengen, und beherrschte eine der schönsten Landschaften der Dauphiné. Ernestine fand, daß der junge Jäger, dessen Anblick ihr der Zufall bot, vornehm aussah. Sein Bild erschien mehrere Male in ihren Gedanken; denn woran sollte man denken in dieser alten Ritterburg? Sie lebte dort inmitten einer gewissen Herrlichkeit; sie gebot über eine zahlreiche Dienerschaft. Aber seit zwanzig Jahren, seit Herr und Untergebene alt waren, geschah dort alles immer zur nämlichen Stunde; immer begann die Unterhaltung damit, alles was geschieht zu tadeln und sich über die einfachsten Dinge zu betrüben. An einem Frühlingsabend, der Tag ging zur Neige, war Ernestine an ihrem Fenster; sie schaute auf den kleinen See und den Wald jenseits; die außergewöhnliche Schönheit der Landschaft mochte dazu beitragen, sie in eine dunkle Träumerei zu versenken. Plötzlich sah sie den jungen Jäger wieder, den sie einige Tage zuvor bemerkt hatte; er war wieder in dem Wäldchen jenseits des Sees; er hielt einen Blumenstrauß in der Hand; er blieb stehn wie um sie anzusehn; sie sah, wie er einen Kuß auf die Blumen drückte und dann den Strauß mit einer Art zarter Ehrerbietung in das Astloch einer großen Eiche am Seeufer legte.
Wieviel Gedanken erweckte diese eine Handlung! Gedanken von sehr lebhaftem Interesse im Vergleich mit den eintönigen Eindrücken, die bis zu diesem Augenblick Ernestines Leben erfüllt hatten! Ein neues Dasein beginnt für sie; wird sie es wagen, den Strauß aufzusuchen? »Gott! welcher Unverstand,« sagt sie sich zitternd, »und wenn im Augenblick, wo ich mich der großen Eiche nähere, der junge Jäger aus dem nahen Gehölz heraustritt! Welche Schande! Was würde er von mir denken?« Dieser schöne Baum war gleichwohl das gewohnte Ziel ihrer einsamen Spaziergänge; oft setzte sie sich auf die gigantischen Wurzeln, die, über das Gras aufsteigend, rings um den Stamm ebensoviel natürliche Bänke bildeten, beschattet von dem breiten Laubdach.
In der Nacht konnte Ernestine kaum ein Auge schließen; am nächsten Tag, seit fünf Uhr früh, kaum daß die Morgenröte erschienen ist, steigt sie in den Giebeln des Schlosses umher. Ihre Augen suchen die große Eiche jenseits des Sees; kaum hat sie sie gefunden, so bleibt sie unbewegt und wie außer Atem stehn. Das heftige Glück der Leidenschaften folgt auf die gegenstandslose und fast mechanische Zufriedenheit der ersten Jugend.
Zehn Tage vergehn. Ernestine zählt die Tage! Nur einmal hat sie den jungen Jäger gesehn; er hat sich dem geliebten Baum genähert, und er hielt einen Blumenstrauß, den er an den Platz des ersten legte. – Der alte Graf von S… bemerkt, daß sie ihr Leben damit zubringt, eine Voliere zu warten, die sie im Dach des Schlosses eingerichtet hat; so kann sie, an einem kleinen Fenster hinter geschlossenen Läden sitzend, die ganze Breite des Waldes jenseits des Sees überblicken. Sie ist ganz sicher, daß ihr Unbekannter sie nicht bemerken kann, und so denkt sie ungehindert an ihn. Ein Gedanke kommt ihr, der sie beunruhigt: Wenn er glaubt, daß man seine Blumensträuße gar nicht beachtet, wird er daraus schließen, daß man seine Huldigung geringschätzt, die schließlich nur eine einfache Höflichkeit ist, und wenn anders er das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird er nicht mehr erscheinen. Vier Tage verstrichen wieder, aber wie langsam! Am fünften kommt das junge Mädchen zufällig bei der großen Eiche vorbei und kann der Versuchung nicht widerstehn, einen Blick auf das kleine Astloch zu werfen, in das sie die Sträuße hat niederlegen sehn. Sie war mit ihrer Gouvernante und hatte nichts zu fürchten. Ernestine dachte nur welke Blumen zu finden; zu ihrer unbeschreiblichen Freude sieht sie einen Strauß der seltensten und reizendsten Blumen; er ist von blendender Frische; nicht ein Blatt der köstlichsten Blumen ist verwelkt. Kaum hat sie das mit einem flüchtigen Blick bemerkt, so läuft sie leicht wie eine Gazelle durch diesen ganzen Teil des Waldes hundert Schritt in der Runde. Sie hat niemanden gesehn; sicher, nicht beobachtet zu werden, kommt sie wieder zur großen Eiche und getraut sich nun mit Wonne den reizenden Strauß zu betrachten. O Himmel! da ist ein kleines Stück Papier, kaum sichtbar; es ist an die Schleife des Straußes geheftet. »Was haben Sie, meine Ernestine?« sagt die Gouvernante, aufgeschreckt von dem leisen Schrei, der diese Entdeckung begleitet. – »Nichts, Liebe, Gute, ein Rebhuhn ist vor meinen Füßen aufgeflogen.« – Vor zwei Wochen wäre Ernestine noch nicht auf den Gedanken gekommen, zu lügen. Sie nähert sich mehr und mehr dem reizenden Strauß, und mit feuerroten Wangen, ohne den Mut, anzufassen, liest sie, was auf dem kleinen Stück Papier steht:
»Seit einem Monat bringe ich jeden Morgen einen Blumenstrauß her. Wird dieser hier so glücklich sein, bemerkt zu werden?«
Alles ist bezaubernd an dem hübschen Briefchen; die englische Handschrift, in der die Worte aufgesetzt sind, ist von elegantester Form. Seit sie vor vier Jahren Paris und das modischste Kloster des Faubourg Saint-Germain verlassen, hat sie nichts so Hübsches gesehn. Plötzlich errötet sie heftig; sie nähert sich ihrer Gouvernante und drängt, ins Schloß zurückzukehren. Statt das Tal hinaufzugehn und den See zu umkreisen, wählt Ernestine, um schneller heimzukommen, den Pfad zur kleinen Brücke, der in gerader Linie zum Schloß führt. Sie ist in Gedanken, sie gelobt sich, nicht wieder dorthin zu gehn. Denn nun hat sie entdeckt, daß es schließlich eine Art Liebesbrief ist, was man an sie zu richten wagt. Allerdings, der Brief war nicht geschlossen, sagt sie sich ganz leise. Von diesem Augenblick an ist ihr Leben von einer schrecklichen Bangigkeit bewegt. Was denn! Kann sie nicht, auch nur von weitem, den geliebten Baum wiedersehn gehn? Das Pflichtgefühl erhebt Einspruch dagegen. »Gehe ich auf das andere Seeufer,« sagt sie sich, »so kann ich mich nicht mehr auf das verlassen, was ich mir selbst gelobt habe.« Als sie um acht Uhr hörte, wie der Pförtner das Gitter der kleinen Brücke schloß, befreite dies Geräusch, das ihr alle Hoffnung nahm, ihre Brust von einer gewaltigen Last; jetzt konnte sie nicht mehr gegen ihre Pflicht verstoßen, auch wenn sie die Schwäche hätte, es zu wollen.
Am nächsten Tage kann sie nichts einer düstern Träumerei entreißen; sie ist niedergeschlagen, blaß; der Oheim bemerkt es; er läßt die alte Kutsche anspannen; man fährt durch die Umgegend, man kommt bis zur Auffahrt des Schlosses von Madame Dayssin, drei Meilen weit. Bei der Rückfahrt gibt der Graf von S… den Befehl, im Wäldchen jenseits des Sees zu halten; die Kutsche kommt auf die Wiese; er will den gewaltigen Eichbaum wiedersehn, den er immer nur denZeitgenossen Karls des Großennennt. »Dieser große Kaiser kann ihn gesehn haben,« sagt er, »als er unsre Berge überschritt, um in die Lombardei zu ziehn und den König Desiderius zu besiegen«, und der Gedanke an ein so langes Leben scheint den fast achtzigjährigen Greis zu verjüngen. Ernestines Gedanken sind weit entfernt von den Betrachtungen ihres Oheims; ihre Wangen glühen; sie wird also doch noch einmal bei der alten Eiche sein; sie hat sich gelobt, nicht in das kleine Versteck zu schauen. Instinktiv, ohne zu wissen, was sie tut, wendet sie die Augen hin, sieht den Strauß, erbleicht. Es sind schwarz gefleckte Rosen. – »Ich bin sehr unglücklich, ich muß fort für immer. Die, welche ich liebe, geruht nicht, meine Huldigung zu bemerken.« – Diese Worte stehn auf dem Stück Papier, das am Strauß befestigt ist. Ernestine hat sie gelesen, ehe sie Zeit hatte, sich ihren Anblick zu verwehren. Sie ist so schwach, daß sie sich an den Baum lehnen muß; und bald fließen ihre Tränen. Am Abend sagt sie sich: »Er wird fortgehn für immer, ich werde ihn nicht mehr sehn!«
Am nächsten Tag, am hellen Mittag, wie sie in der Augustsonne mit dem Oheim unter den Platanen am See auf und ab geht, sieht sie am andern Ufer den jungen Mann auf die große Eiche zukommen; er ergreift seinen Strauß, wirft ihn in den See und verschwindet. Ernestine kommt es vor, als habe Enttäuschung in seiner Gebärde gelegen; bald zweifelt sie nicht mehr daran. Sie wundert sich, daß sie einen Augenblick zweifeln konnte; es ist klar, er sieht sich verschmäht, er wird fortreisen; nie wird sie ihn wiedersehn.
An diesem Tage ist man sehr in Sorge auf dem Schloß, wo sie allein sonst einige Heiterkeit verbreitet. Der Oheim erklärt, daß sie entschieden unpäßlich sein muß; eine tödliche Blässe, eine Art Krampf in den Zügen haben dieses harmlose Gesicht entstellt, in dem sich noch jüngst die sanften Empfindungen der ersten Jugend malten. Am Abend, als die Stunde des Spaziergangs gekommen ist, hat Ernestine nichts dagegen, daß der Oheim ihn auf die Wiese jenseits des Sees richtet. Sie blickt im Vorbeigehn mit trübem Auge, das die Tränen kaum zurückhalten kann, auf das kleine Versteck drei Fuß über dem Boden und ist sicher, nichts zu finden; sie hat ja gesehn, wie der Strauß in den See geworfen wurde. Aber welche Überraschung! Sie erblickt einen neuen Strauß. – »Aus Mitleid mit meinem großen Unglück nehmen Sie gnädig die weiße Rose.« – Während sie noch einmal diese wunderlichen Worte liest, hat ihre Hand, ohne daß sie es weiß, die weiße Rose mitten aus dem Strauß losgemacht. – »Er ist also sehr unglücklich,« sagt sie sich. In diesem Augenblick ruft sie der Onkel, sie folgt ihm, aber sie ist glücklich. Sie hält ihre weiße Rose in ihrem Batisttüchlein, und der Batist ist so fein, daß sie die ganze Zeit, die der Spaziergang noch dauert, die Farbe der Rose durch das zarte Gewebe sehn kann. Sie hält ihr Tuch so sorgsam, damit sich die geliebte Rose nicht entblättert.
Kaum heimgekommen, läuft sie die steile Treppe hinauf zu ihrem kleinen Turm im Winkel des Schlosses. Endlich wagt sie, ungehindert, diese angebetete Rose zu betrachten und durch süßquellende Tränen hindurch ihre Blicke zu sättigen.
Was wollen diese Tränen sagen? Ernestine weiß es nicht. Könnte sie das Gefühl, das sie fließen läßt, erraten, so hätte sie den Mut, die Rose, die sie eben mit soviel Sorgfalt in das Kristallglas auf ihrem kleinen Mahagonitisch getan hat, zu opfern. Aber wenn anders der Leser den Kummer hat, nicht mehr zwanzig Jahre alt zu sein, so wird er erraten, daß diese Tränen, weit entfernt, Schmerzenstränen zu sein, die unzertrennlichen Begleiter des unerwarteten Anblicks eines höchsten Glückes sind; sie wollen sagen: »Wie süß ist es, geliebt zu werden!« – In einem Augenblick, wo der Schauer des ersten Lebensglücks ihr Urteil verwirrte, hat Ernestine das Unrecht begangen, diese Blume zu nehmen. Aber noch ist sie nicht so weit, diese Inkonsequenz einzusehen und sich vorzuwerfen.
Wir, die wir weniger Illusionen haben, erkennen die dritte Periode der Entstehung der Liebe: das Erscheinen der Hoffnung. Ernestine weiß nicht, daß ihr Herz sich beim Anblick dieser Rose sagt: »Jetzt ist es sicher, daß er mich liebt.«
Aber kann es wahr sein, daß Ernestine schon bei der Liebe angelangt ist? Verstößt dies Gefühl nicht gegen alle Regeln des gesunden Menschenverstandes? Wie! Sie hat den Mann, um den sie jetzt glühende Tränen vergießt, nur dreimal gesehn! Noch dazu über den See hin, auf große Entfernung, vielleicht fünfhundert Schritt. Und weiter: wenn sie ihn träfe ohne Gewehr und ohne Jagdanzug, sie würde ihn vielleicht nicht wiedererkennen. Sie kennt weder seinen Namen noch seinen Stand und doch nähren sich all ihre Tage von leidenschaftlichen Gefühlen, deren Ausdruck ich abzukürzen gezwungen bin, denn ich habe nicht den nötigen Raum für einen Roman. Diese Gefühle sind immer nur Variationen der Idee: »Welches Glück, geliebt zu werden.« Oder sie untersucht die andere, noch viel wichtigere Frage: »Kann ich hoffen, wahrhaft von ihm geliebt zu werden? Sagt er mir am Ende nur zum Scherz, daß er mich liebe?« Obgleich sie in einem Schloß wohnt, das Lesdiquières gebaut hat und der Familie eines der tapfersten Gefährten des berühmten Connotable angehört, machte sich Ernestine nicht diesen andern Einwurf: »Er ist vielleicht der Sohn eines Bauern aus der Umgegend.« Warum? Sie lebte in tiefer Einsamkeit.
Sicherlich war Ernestine weit davon entfernt, die Natur der Gefühle, die in ihrem Herzen herrschten, zu erkennen. Hätte sie voraussehen können, wohin diese sie führten, so hätte sie eine Möglichkeit gehabt, ihrer Herrschaft zu entfliehen. Eine junge Deutsche, eine Engländerin, eine Italienerin hätte die Liebe erkannt; unsere weise Erziehung hat sich dafür entschieden, vor jungen Mädchen das Vorhandensein der Liebe zu leugnen, und so fühlte Ernestine über die Vorgänge in ihrem Herzen nur eine unklare Besorgnis; wenn sie tief nachdachte, sah sie in ihnen nur einfache Freundschaft. Sie hatte die eine Rose genommen, weil sie fürchtete, wenn sie es nicht tat, den neuen Freund zu betrüben, ihn zu verlieren. »Und außerdem,« sagte sie sich, nachdem sie lange darüber nachgesonnen, »man darf nicht unhöflich sein.«
Ernestines Herz ist von den heftigsten Gefühlen bewegt. Vier Tage lang, die der jungen Einsiedlerin wie vier Jahrhunderte vorkommen, hält eine unerklärliche Furcht sie zurück; sie verläßt das Schloß nicht. Am fünften Tage zwingt sie ihr Oheim, der sich immer mehr um ihre Gesundheit beunruhigt, ihn in das Wäldchen zu begleiten; sie befindet sich vor dem verhängnisvollen Baum; sie liest auf dem Stückchen Papier, das in dem Blumenstrauß verborgen ist:
»Wenn Sie diese gefleckte Kamelie zu nehmen geruhen, werde ich am Sonntag in der Kirche Ihres Dorfes sein.«
Ernestine sah in der Kirche einen äußerst einfach gekleideten Mann, der fünfunddreißig Jahre alt sein mochte. Sie bemerkte, daß er nicht einmal einen Orden trug. Er las, und indem er sein Gebetbuch auf eine bestimmte Art hielt, ruhten seine Augen fast unablässig auf ihr. Damit ist schon gesagt, daß während des ganzen Gottesdienstes Ernestine außerstande war, an irgend etwas zu denken. Sie ließ, als sie den alten Herrschaftsstuhl verließ, ihr Gebetbuch fallen und wäre beinah selbst umgesunken, als sie es aufhob. Sie errötete heftig über ihr Ungeschick. »Er wird mich so linkisch finden,« sagte sie sich sogleich, »daß er sich schämen wird, sich mit mir abzugeben.« In der Tat, seit dem Augenblick, an dem dieser kleine Unfall geschah, sah sie den Fremden nicht mehr. Umsonst hielt sie sich dann, als sie in den Wagen gestiegen war, damit auf, unter die kleinen Burschen des Dorfes einige Geldstücke zu verteilen; sie erblickte in den Gruppen von schwatzenden Bauern vor der Kirche denjenigen nicht, welchen sie während der Messe niemals voll anzusehn gewagt hatte. Ernestine, die bisher die Aufrichtigkeit selbst gewesen war, gab vor, ihr Schnupftuch vergessen zu haben. Ein Bedienter ging in die Kirche zurück und suchte lange unter dem Kirchenstuhl der Herrschaft dies Schnupftuch, das er natürlich nicht finden konnte. Aber der Aufenthalt, den diese kleine List herbeiführte, war nutzlos; sie sah den Jäger nicht wieder. »Es ist klar,« sagte sie sich, »Fräulein von C… sagte mir einmal, daß ich nicht hübsch wäre und daß ich etwas Gebieterisches und Zurückstoßendes im Blick hätte; nun fehlte mir nur noch Ungeschicklichkeit; er verachtet mich ohne Zweifel.«
Traurige Gedanken quälten sie während zwei oder drei Besuchen, die ihr Oheim vor der Rückkehr ins Schloß machte.
Kaum war sie gegen vier Uhr heimgekommen, so lief sie in die Platanenallee am Seeufer. Das Gitter nach der Landstraße war geschlossen wegen des Sonntags; glücklicherweise bemerkte sie einen Gärtner, den sie rief und bat, das Boot loszumachen und sie ans andere Seeufer zu rudern. Sie stieg hundert Schritt von der großen Eiche ans Land. Das Boot fuhr am Ufer entlang und blieb immer für ihre Sicherheit nah genug. Die unteren, fast wagerechten Zweige der gewaltigen Eiche erstreckten sich beinah bis zum See. Mit festem Schritt und einer Art düster entschlossener Kaltblütigkeit näherte sie sich dem Baum, mit einer Miene, als ginge sie in den Tod. Sie war fest überzeugt, nichts in dem Versteck zu finden: in der Tat sah sie nur eine welke Blume, die zu dem Strauß von gestern gehört hatte: – »Wäre er mit mir zufrieden gewesen,« sagte sie sich, »so hätte er nicht versäumt, mir mit einem Blumenstrauß zu danken.«
Sie ließ sich zum Schloß zurückbringen, stieg eilends hinauf in ihren kleinen Turm, und dort angelangt und sicher, nicht überrascht zu werden, brach sie in Tränen aus. »Fräulein von C… hatte ganz recht,« sagte sie sich, »um mich hübsch zu finden, muß man mich von fünfhundert Schritt Entfernung sehn. Da in diesem Land von Liberalen mein Oheim nur mit Bauern und Pfarrern verkehrt, müssen meine Manieren etwas Derbes, vielleicht Rohes bekommen haben. Ich werde im Blick einen gebieterischen und zurückstoßenden Ausdruck haben.« Sie nähert sich dem Spiegel, um diesen Blick zu beobachten; sie sieht dunkelblaue Augen in Tränen schwimmen. – »In diesem Augenblick,« sagte sie sich, »kann ich nicht die herrische Miene haben, die mich immer hindern wird, zu gefallen.«
Man läutete zum Essen; sie hatte viele Mühe, ihre Tränen zu trocknen. Endlich erschien sie im Salon; sie traf dort Herrn Villars, einen alten Botaniker, der alljährlich acht Tage bei Herrn von S… verbrachte, zum großen Kummer der zur Gouvernante erhobenen Bonne, die während dieser Zeit ihren Platz am Tisch des Herrn Grafen einbüßte. Alles lief gut ab, bis der Champagner gebracht wurde; man stellte den Kühler neben Ernestine. Das Eis war längst geschmolzen. Sie rief einen Diener und sagte: »Bringen Sie frisches Wasser und tun Sie Eis hinein, schnell.« – »Dieser kleine herrische Ton steht dir recht gut«, sagte lachend der gute Oheim. Bei dem Wortherrischfüllten sich Ernestines Augen mit Tränen, die sie nicht verbergen konnte; sie mußte den Salon verlassen, und als sie die Tür schloß, hörte man, wie Schluchzen sie erstickte. Die alten Herren waren ganz bestürzt.
Zwei Tage danach kam sie an der alten Eiche vorbei; sie näherte sich und sah in das Versteck, wie um die Stätten wiederzusehen, wo sie glücklich gewesen war. Wie groß war ihr Entzücken, als sie dort zwei Blumensträuße fand! Sie ergriff sie und die kleinen Zettel und lief zum Schloß zurück, ohne sich Sorgen zu machen, ob etwa der Unbekannte, im Wald verborgen, ihre Bewegungen beobachtet hatte, ein Gedanke, der sie bis zu diesem Tag niemals verlassen hatte. Sie kam außer Atem, konnte nicht weiter und mußte halbwegs auf der Landstraße stehen bleiben. Kaum hatte sie etwas Atem geschöpft, so fing sie wieder zu laufen an mit der ganzen Schnelligkeit, deren sie fähig war. Schließlich fand sie sich in ihrem kleinen Zimmer, nahm die Sträuße aus dem Schnupftuch, und ohne die kleinen Briefe zu lesen, begann sie, die Sträuße mit Hingerissenheit zu küssen, eine Bewegung, über die sie errötete, als sie sie bemerkte. »Ach! nie wieder will ich eine herrische Miene haben,« sagte sie sich, »ich will mich bessern.«
Schließlich als sie diesen hübschen aus den seltensten Blumen zusammengestellten Sträußen genugsam ihre ganze Zärtlichkeit bezeugt hatte, las sie die Briefchen. (Ein Mann hätte damit begonnen.) Das erste war vom Sonntag, um fünf Uhr; es sagte: »Ich mußte mir die Freude versagen, Sie nach dem Gottesdienst zu sehen; ich war nicht allein; ich fürchtete, man könnte in meinen Augen die Liebe lesen, die mich für Sie entflammt.« – Sie las dreimal die Worte:die Liebe, die mich für Sie entflammt, dann erhob sie sich und ging vor ihren Spiegel, um zu sehen, ob sie eine herrische Miene hätte. Sie fuhr fort:»Liebe, die mich für Sie entflammt. Wenn Ihr Herz frei ist, so nehmen Sie gütigst dieses Briefchen aus dem Baume fort; es könnte uns kompromittieren.«
Das zweite Briefchen, vom Montag, war mit Bleistift und sogar ziemlich schlecht geschrieben; aber Ernestine war schon fern von der Zeit, wo die hübsche englische Handschrift ihres Unbekannten Zauber besaß für ihre Augen; sie hatte schon zu ernste Angelegenheiten, um auf diese Kleinigkeiten zu achten.
»Ich bin gekommen. Ich habe das Glück gehabt, daß jemand in meiner Gegenwart von Ihnen sprach. Man hat mir gesagt, daß Sie gestern über den See gefahren sind. Ich sehe, daß Sie nicht so gütig waren, das Briefchen zu nehmen, das ich zurückließ. Es entscheidet über mein Schicksal. Sie lieben, aber nicht mich. Es war Tollheit in meinem Alter mich an ein Mädchen Ihres Alters zu heften. Leben Sie wohl für immer. Ich will nicht noch das neue Mißgeschick haben, lästig zu sein, nachdem ich so unglücklich war, Sie allzulange mit einer Leidenschaft zu beschäftigen, die in Ihren Augen vielleicht lächerlich ist.« –Eine Leidenschaft!sagte Ernestine und hob die Augen zum Himmel. Dieser Augenblick war sehr süß. Dieses junge Mädchen von bemerkenswerter Schönheit und in der Blüte der Jugend rief entzückt: »Er würdigt mich seiner Liebe; ach mein Gott! wie bin ich glücklich!« Sie fällt auf die Knie vor einer reizenden Madonna Carlo Dolcis, die einer ihrer Ahnen aus Italien mitgebracht hat. – »Ach ja, ich werde gut und tugendhaft sein!« ruft sie mit Tränen in den Augen. »Mein Gott, zeige mir doch nur aus Gnade meine Fehler, damit ich mich bessern kann; jetzt bin ich zu allem fähig.«
Sie erhob sich und las die Briefchen zwanzigmal durch. Der zweite besonders versetzte sie in glückselige Verzückungen. Bald bemerkte sie eine Wahrheit, die schon seit langer Zeit in ihrem Herzen bestand: nie hätte sie sich einem Mann von weniger als vierzig Jahren verbunden fühlen können. (Der Unbekannte sprach von seinem Alter.) Sie erinnerte sich, in der Kirche kam er ihr, da er ein wenig kahl war, wie vierunddreißig oder fünfunddreißig vor. Aber sie konnte dieser Vorstellung nicht sicher sein; sie hatte so wenig hinzusehn gewagt! und sie war so verwirrt gewesen! Während der Nacht schloß Ernestine kein Auge. Nie im Leben hatte sie sich ein ähnliches Glück vorgestellt. Sie erhob sich und schrieb auf englisch in ihr Gebetbuch: »Niemals herrisch sein. Dies gelobe ich am 30. September 18.. «
In dieser Nacht entschied sie sich mehr und mehr zu der Wahrheit: man kann unmöglich einen Mann von unter vierzig Jahren lieben. Sie träumte so viel von den guten Eigenschaften ihres Unbekannten, daß ihr in den Sinn kam, er habe außer dem Vorzug seiner vierzig Jahre wahrscheinlich auch noch den, arm zu sein. In der Kirche war er so einfach gekleidet, kein Zweifel, er war arm. Nichts konnte ihrer Freude über diese Entdeckung gleichkommen. »Niemals wird er die dumme und fade Miene unserer Freunde, der Herren Soundso, haben, wenn sie zu Sankt Hubertus herkommen, meinem Oheim die Ehre erweisen, seine Rehe zu töten, und uns bei Tisch die Heldentaten ihrer Jugend erzählen, ohne daß man sie darum bittet.«