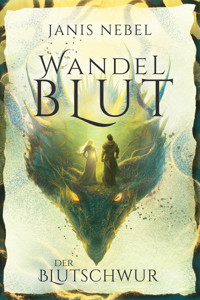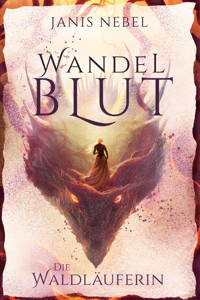5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Manche sagen, die Gabe sei ein Segen. Andere nennen sie einen Fluch. Für Merle ist sie das dunkelste Geheimnis ihrer Familie. Merles behütetes Leben gerät aus den Fugen, als sie herausfindet, dass ihre Mutter eine Gabenträgerin ist. Aus Angst, dass sie diese furchterregende Fähigkeit geerbt haben könnte, läuft sie von zuhause fort. Doch der Weg durch das Reich des Roten Königs ist voller Gefahren. Als Merle in die Hände von Soldaten fällt, kommt ihr unerwartet ein Fremder zur Hilfe – mit silbern schimmernden Augen. Er fasziniert sie, doch er verbirgt etwas. Und warum fühlt sie sich in seiner Nähe so merkwürdig? Merle stürzt in eine Welt aus Rebellion, Magie und Geheimnissen. Schon bald steht nicht nur ihr Leben auf dem Spiel. Sie muss herausfinden, wer sie wirklich ist – und was sie bereit ist, für die Liebe zu riskieren. Abgeschlossene YA-Fantasy Trilogie. ---- DIE MERLES FLUCH TRILOGIE: Band 1: Die Gabe des Roten Königs , Band 2: Im Bann des Roten Königs , Band 3: Der Turm des Roten Königs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Gabe des Roten Königs
Über die Autorin
Janis Nebel wurde 1985 in Bayern geboren und studierte Archäologie und Geographie. Danach arbeitete sie als Archäologin in Rettungsgrabungen an verschiedenen Orten Süd- und Mitteldeutschlands. Nach einem kurzen Abstecher in die Welt der Wirtschaft und den Büroalltag zog sie 2017 nach Frankreich und erfüllte sich dort den lange gehegten Traum, einen Roman zu schreiben. Ihr Debüt „Die Gabe des Roten Königs“ erschien 2019.
Mehr zur Autorin: https://janisnebel.com
Bücher von Janis Nebel
Die Merles Fluch-Trilogie:
Band 1 | Die Gabe des Roten Königs
Band 2 | Im Bann des Roten Königs
Band 3 | Der Turm des Roten Königs
Wandelblut-Saga
Band 1 | Die Waldläuferin
Band 2 | Der Asrenkrieger
Band 3 | Der Blutschwur
Band 4 | Der Abschlussband ist in Arbeit und erscheint voraussichtlich 2025!
Trage dich in Janis Nebels Newsletter ein, um das Erscheinungsdatum zu erfahren, sobald es feststeht!
Jetzt anmelden!
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Im Bann des Roten Königs | Band 2 der Merles Fluch Trilogie
Mehr von Janis Nebel
Danksagung
Kapitel1
Der Hirsch brach aus dem Gebüsch und sprang über die Wasserfläche. Kaum hatten seine Hufe die Grasbüschel am anderen Ufer berührt, da sank er schon bis zur Schulter ein. Das Moor verschluckte ihn. Es war seine Hölle.
Merle spürte seine Panik wie ihre eigene. Der Hirsch kämpfte mit aller Kraft gegen den Sog an, versuchte sich zu befreien. Sie wollte ihm helfen, ihn an seinem Geweih aus dem Schlamm ziehen. Aber er war zu weit draußen. Sie würde selbst dabei untergehen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie sich das edle Tier verzweifelt abmühte und doch nur immer tiefer sank. Am Ende ragte nur noch sein glänzendes Auge und das weit aufgerissene Maul heraus. Und dann schloss sich das ölige Wasser über ihm und füllte seine Lungen. Eine Weile warf das Moor noch Wellen, als würde sich darunter eine riesige Schlange winden.
Merle wandte den Blick ab. In ihrem Kopf sah sie noch immer den toten Leib am Grunde liegen. Lautlos und in ewigem Schrecken erstarrt. Sie war selbst der Hirsch. Das Moor war auch ihre Hölle.
Ein Schrei zerriss die Stille.
Merle zuckte zusammen. Das Echo vibrierte als schmerzhaft hoher Ton in ihren Ohren. Einen Moment dachte sie, es wäre Teil ihres Albtraums. Aber sie war wach. Hatte sie etwa selbst geschrien? Peinlich berührt klappte sie ihren Mund zu. Doch der Schrei setzte von Neuem ein. Er kam von unten.
Hastig stürzte Merle aus dem Bett, riss die Tür ihrer kleinen Dachkammer auf und rannte die Treppe hinunter. Die Küchentür zum Kräutergarten stand offen. Ihre nackten Füße klatschten auf die unebenen Steinplatten, als sie hinausstürzte.
Zwischen der Minze und der Petersilie war ihre Mutter in die Knie gegangen. Dunkle Erde klebte an ihrer Schürze. Ihr Korb war zu Boden gefallen. Merles Vater Carl stand über sie gebeugt und hielt ihre dünnen Handgelenke gepackt. Zwischen ihren Fingern blitzte eine Klinge auf.
„Bel!“ Er schüttelte sie. „Komm zu dir! Lass das Messer fallen!“
Aber Merles Mutter kreischte bloß und versuchte sich loszureißen.
„Vater!“ Einen schrecklichen Moment lang fürchtete Merle, ihre Mutter könnte ihn verletzt haben.
„Nimm ihr das Messer ab. Mach schnell!“, keuchte Carl und bog die Arme seiner Frau nach unten. Neben Carls breiten Händen wirkten sie dünn wie Stöcke.
Merle zögerte. Wie immer kostete es sie große Überwindung, sich ihrer Mutter zu nähern. Bels helle Haut war von roten Flecken bedeckt, und ihre Augen waren so weit verdreht, dass man nur noch das Weiße darin sehen konnte. Sie röchelte, als würde sie ersticken, und ein Speichelfaden hing aus ihrem Mundwinkel.
„Mach schon!“, drängte ihr Vater. „Bevor sie sich noch etwas antut.“
Merle packte die schlanken Finger ihrer Mutter und bog sie einen nach dem anderen auf, bis sie ihr das Messer entwinden konnte. Danach brach Bels Gegenwehr zusammen. Sie wurde schlaff in Carls Armen.
Merle trat einen Schritt zurück. „Was ist passiert?“, fragte sie atemlos.
Ihr Vater drückte Bels Körper an sich und kniete sich neben sie. Strähnen seiner dunklen Locken hatten sich aus dem kurzen Zopf in seinem Nacken gelöst und fielen ihm ins Gesicht.
„Ich habe keine Ahnung“, erwiderte er und untersuchte die Arme seiner Frau. Sie waren von feinen weißen Narben bedeckt. Aber es gab keinen frischen Schnitt. Ihr Vater atmete auf. Sein faltiges Gesicht war von dunklen Ringen unter den Augen gezeichnet. Vermutlich hatte er wieder kaum geschlafen. „Sie wurde früh wach, stand auf und ging hinaus, um im Garten zu arbeiten. Und dann kam plötzlich der Anfall.“
Merle beobachtete besorgt, wie er Bel sanft den Speichelfaden vom Kinn tupfte. Er war kein großer Mann, aber er war stark, mit breitem Kreuz und kräftigen Armen, wie es sich für einen Schmied gehörte. Bei ihm hatte Merle sich immer geborgen gefühlt. Aber nun hatte sie den Eindruck, seine Schläfen würden immer schneller ergrauen und die Falten in seinem Gesicht tiefer und tiefer werden.
„Die Anfälle kommen häufiger in letzter Zeit“, meinte sie besorgt und bückte sich, um den Korb und die verstreuten Blätter und Stängel einzusammeln.
Carl nickte müde. Er hob Bel auf und trug sie so vorsichtig ins Haus, als könnte seine Frau dabei zerbrechen. Ihre langen vorzeitig ergrauten Locken hingen von seinem Arm wie eine zerfledderte Fahne im Wind.
„Mach Tee, Merle“, sagte er über die Schulter. „Den starken, du weißt schon. Ich glaube, den hat sie jetzt nötig.“
Merle blickte ihm nach und seufzte. Sie wusste wohl, von welchem Tee er sprach. Es war ein weißes Pulver, so stark, dass es Bel für einige Stunden ruhigstellen würde. Harri brachte es regelmäßig aus Dalsburg mit, wenn er die neuen Messer abholte, die ihr Vater geschmiedet hatte. Im Gegenzug ließ er ihnen Lebensmittel da. Außer ihm, seinem Ziehsohn Skip und gelegentlich seiner Frau Selma kam so gut wie kein Besuch auf den Bruch. Der Hof im Moor, der Merles Zuhause war, lag einfach zu abgelegen.
Die Tür der Speisekammer quietschte leise, als Merle sie öffnete. Es roch nach Käse und Geräuchertem. Mit knurrendem Magen stellte sie sich auf die Zehenspitzen und holte den Schlüssel aus dem Versteck hinter dem Balken. Dann schloss sie die Kiste mit dem Pulvervorrat auf. Es war nicht mehr viel übrig. Überhaupt war die Speisekammer recht leer. Das Getreide war längst ausgegangen. Vom Salz war nur noch ein Fingerhut voll da, und Fleisch hatten sie vor zehn Tagen zum letzten Mal gegessen. Zum Frühstück blieb nur noch der halbe Laib Käse und etwas trockenes Brot. Nicht viel, um drei Personen satt zu machen. Von denen noch dazu zwei hart arbeiteten.
Der Herbst fing gerade erst an, und der Garten warf noch einiges ab. Es würde heute also wieder Gemüsesuppe zu Mittag geben. Aber wenn Harri nicht bald mit neuen Vorräten kam, müssten sie sich etwas einfallen lassen. Merles Magen knurrte noch einmal, und sie blickte verstohlen auf den Käse. Es konnte noch Stunden dauern, bis Carl ihre Mutter wieder allein lassen durfte. Sie schnitt ein Stück davon ab und schob es sich in den Mund. Noch ein Apfel, das musste genügen. Den Rest ihrer Portion wickelte sie für später in ein Tuch.
Das Teewasser über dem Herdfeuer begann zu kochen, und Merle goss das Pulver mit ein paar Blättern Kamille auf. Dann trat sie an die Tür der Kammer. Drinnen hörte sie das leise Murmeln ihres Vaters.
Sie klopfte. „Der Tee ist fertig.“
„Stell ihn vor die Tür. Ich hole ihn gleich.“ Carl räusperte sich. „Und könntest du vielleicht …“
„Ja, ja“, unterbrach ihn Merle. Sie wusste, dass er sie nun bitten würde, die Hühner rauszulassen und das Schwein zu füttern. Die Arbeit auf dem Hof war ihr vertraut. „Bin schon auf dem Weg.“
Oben in ihrer Kammer zog sie sich Arbeitskleidung an. Sie bestand aus abgelegten Sachen ihres Vaters, die ihr viel zu groß waren. Aber das störte sie nicht. Es konnte sie sowieso niemand sehen. Bequem und praktisch waren sie allemal.
Sie beschloss die Arbeit so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und dann ins Moor zu gehen, um ein paar Vogelfallen aufzustellen. Mit etwas Glück würden sie so am Abend ein wenig Fleisch auf dem Teller haben.
* * *
Es war eine Drossel. Bei ihrem panischen Versuch, sich zu befreien, hatte sich die präparierte Rosshaarschlinge um ihren Hals gewunden und sie erwürgt. Die roten Vogelbeeren hingen noch in der Falle und das weiche Gefieder des Vogels bauschte sich leicht im Wind.
Merle hatte schon Hunderte Vögel in ihren Fallen erlegt, aber jedes Mal tat es ihr leid. Das Erwürgen war ein qualvoller Tod. Doch es half nichts. Sie brauchten das Fleisch. Und keine Jagdmethode war so effektiv wie das Fallenstellen. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wann wieder Vorräte aus der Stadt kommen würden.
Sie steckte den toten Vogel in ihren Leinensack. Dann präparierte sie die Falle neu. Es war fast Mittag. Über dem Moor lag nur noch ein dünner Nebelschleier. Bald hätte er sich aufgelöst, und die trüben Teiche würden das Licht des Himmels widerspiegeln. Vorsichtig suchte sich Merle ihren Weg durch das morastige Gelände, tastete mit ihrem langen Stab voraus und sprang geschickt von einer Vegetationsinsel zur nächsten. Sie vermied die ebenen, von kurzen Gräsern bedeckten Flächen, denn der Anblick war trügerisch. Darunter versteckten sich bodenlose, feuchte Tiefen.
Den Hirsch von heute Morgen, gab es nicht nur in ihren Albträumen. Merle war noch sehr jung gewesen, als ihr Vater dieses jammervolle Schauspiel genutzt hatte, um sie die Angst vor dem Sumpf zu lehren. Es war eine grausame Lektion gewesen, aber sehr wirksam. Seither fürchtete Merle das Wasser. Und beim Spielen hatte sie stets darauf achtgegeben, sich vom Moor fernzuhalten.
Sie verstand inzwischen, warum Carl es getan hatte. Zwischen seiner Arbeit als Messerschmied, der Bewirtschaftung des Hofs und ihrer unberechenbaren Mutter war wenig Zeit geblieben, um die Tochter zu beaufsichtigen.
Jahre waren vergangen, ehe Merle es gewagt hatte, die morastigen Flächen wieder zu betreten. Doch wenn man mitten im Moor lebte, blieb einem irgendwann nichts anderes übrig. Ohne die Fähigkeit, es zu überwinden, war der Bruch ein Gefängnis.
Also hatte Merle nach und nach diese karge Landschaft zu lesen gelernt. Jede Pflanze, jeder Stein, jede Oberflächenform gab einen Hinweis darauf, was sich darunter befand. Sie wusste jetzt, wohin sie den Fuß setzen durfte. Und dennoch war sie auf der Hut. Das Moor veränderte ständig seine Gestalt. Es war ein trügerischer Freund. Merle hatte den armen Hirsch nie vergessen.
Langsam arbeitete sie sich aus dem sumpfigen Tal heraus auf einen Hügel, von dem aus man die Weite der grasigen Fläche überblicken konnte. Wind zerzauste ihre Locken, die sich aus dem Band in ihrem Nacken befreit hatten. Sie strich sie fahrig hinter die Ohren und fluchte, als die frische Brise sie gleich wieder losriss. Es wurde Zeit, die Haare wieder kurz zu schneiden. Sie begannen ihr auf die Nerven zu fallen. Zu lang zum Offenlassen, zu kurz zum Zusammenbinden. Doch jedes Mal, wenn sie in den letzten Wochen die Schere angesetzt hatte, war ihr Skip in den Sinn gekommen.
„Warum lässt du deine Haare nicht lang wachsen?“, hatte er gefragt, als er vor ein paar Wochen hier gewesen war. „Wie die Mädchen in der Stadt. Dort läuft keine herum, deren Zopf nicht bis zur Hüfte reicht.“ Sanft hatte er ihr eine geringelte Strähne aus dem Gesicht gestrichen, und Merle war unter seinen Fingern erstarrt. Nicht aus Angst, sondern aus Unsicherheit. Er tat manchmal Dinge, die sie verwirrten.
Sie schüttelte den Kopf. Ihr graute bei dem Gedanken, welche Arbeit es machen würde, ihren wilden Lockenkopf zu entwirren, wenn die Haare noch länger wurden. Und noch viel mehr störte es sie, dass lange Haare sie ihrer Mutter ähnlicher machen würden, als sie es ohnehin schon war.
„Vermutlich laufen deine Stadtmädchen nicht den ganzen Tag im Moor herum“, hatte sie Skip trocken geantwortet. „Und Holzhacken und Vögelrupfen müssen sie wahrscheinlich auch nicht.“
Skip lachte. Er lachte immer, wenn sie ihm solche Antworten gab. Seine Finger hatten dabei ihre Wange berührt.
Er war nur vier Jahre älter als Merle und ihr bester Freund. Eigentlich war Skip auch ihr einziger Freund, denn Merle hatte nie einen anderen gleichaltrigen Spielgefährten gehabt. Früher waren sie stundenlang zusammen im Wald unterwegs gewesen. Und im Sommer waren sie im See geschwommen. Oder besser, Skip war geschwommen. Merle hatte sich nur ein wenig nass gespritzt und am Ufer auf ihn gewartet. Sie sah im Wasser stets die Tiefen des Moores und all die toten Lebewesen, die an seinem Grund lagen. Sie hatte immer ein ungutes Gefühl gehabt, wenn Skip sich in die Wellen warf und mit seinen langen dürren Armen hindurchpflügte.
In der Ferne konnte Merle den dunkelgrünen Streifen des Waldrands erkennen. Sie war weit gegangen heute, doch es hatte sich gelohnt. Ihr Leinensack war gut gefüllt mit Pilzen, essbaren Wurzeln und fünf toten Vögeln. Sie würden am Abend reichlich zu essen haben.
Bei diesem Gedanken grollte Merles Magen. Das karge Frühstück lag schon Stunden zurück. Sie stieg noch ein Stück höher auf den trockenen Hügel und pflückte an dornigen Sträuchern ein paar Brombeeren. Einige aß sie bereits im Gehen, die restlichen legte sie vorsichtig in ein kleines Tuch. Sie würde sie ihren Eltern mitbringen.
Dann setzte sie sich auf einen Felsen und packte einen Apfel, eine harte Scheibe Brot und ein Stück Käse aus. Gierig begann sie zu essen und dachte dabei sehnsüchtig an Selmas süßes Gebäck, das Skip ihr immer mitzubringen pflegte. Merle hatte sich insgeheim oft gewünscht, die fürsorgliche Selma als Mutter zu haben. Sie kam aber nur selten mit.
„Jemand muss sich in Dalsburg um die Geschäfte kümmern“, antwortete Harri, wenn sie ihn nach seiner Frau fragte.
Seit Jahren war es Merles größter Wunsch, in die Stadt zu fahren. Sie wollte etwas von der Welt sehen. Das ferne Dalsburg erschien ihr wie ein märchenhafter Ort, voll mit Genüssen, Verlockungen und Abenteuern. Skip ließ keine Gelegenheit aus, es vor ihr in immer schöneren und geheimnisvolleren Bildern auszumalen. Aber er hatte in den letzten Jahren auch andere Geschichten erzählt, die Merle beunruhigten. Es war von Soldaten die Rede, von Überfällen und Gewalt. Vom Roten König, der die Menschen mit seiner furchtbaren Gabe in Angst und Schrecken versetzte.
„Der Rote König ist wie ein Blutegel, der von der Lebensenergie anderer Menschen lebt“, grollte Skip. „Begabte sind Monster, keine Menschen. Auch wenn sie so aussehen. Es ist eine Schande, dass es Leute gibt, die sie wie Götter verehren.“
Die Augen ihres Freundes verdunkelten sich, wenn er das sagte, und Merle wusste, dass er an seine Eltern dachte. Nicht an Harri und Selma, sondern an seine richtigen Eltern. Skip sprach darüber nicht gern und wechselte meist bald das Thema.
Auch zu Hause war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den Namen des Königs und das Wort „Gabe“ nicht in den Mund nehmen durfte. Bel ertrug es nicht und glitt sofort in ihre irren Anfälle ab, wenn man nicht aufpasste. Skip war der Einzige, der Merles Fragen beantwortete. Dementsprechend fieberte sie jedem seiner Besuche ungeduldig entgegen. Und jedes Mal bat Merle ihren Vater, doch einmal mit in die Stadt fahren zu dürfen.
Aber die Antwort war immer dieselbe: „Nein, Merle. Du bist zu jung. Es ist zu gefährlich. Und außerdem … deine Mutter braucht dich hier.“
Ihre Mutter brauchte sie? Merle warf wütend einen Stein den Hang hinunter und sah zu, wie er gegen die Felsen schlug und zersprang. Ihre Mutter nahm doch kaum Notiz von ihr. Sie lebte fast völlig in ihrer eigenen Welt, die niemand verstand.
Zornig nahm Merle noch einen Stein und warf ihn mit voller Wucht in einen mannshohen Strauch, der sie vor dem Wind abschirmte. Ein unterdrückter Schrei antwortete.
Erschrocken sprang sie auf und griff nach ihrem Stab. Wenige Meter vor ihr schälten sich zwei halbwüchsige Jungen aus dem Gesträuch. Ihre Haltung war geduckt, lauernd. Einen Augenblick war Merle steif vor Schreck und starrte einfach zurück. Dann legte sie ihre Hände fester um den Stab.
„Was wollt ihr?“, fragte sie barsch.
„Die Frage ist wohl eher, was willst du?“, fragte der kleinere von beiden zurück. Seine vorstehenden Zähne und der rote Schopf erinnerten Merle an ein Eichhörnchen. „Du bist auf dem Land unseres Vaters. Wir haben beobachtet, wie du gewildert und hier Vögel gefangen hast.“
Merle ließ den Stock ein wenig sinken. Die beiden mussten aus Rieding sein. Das Dorf lag gleich hinter dem nächsten Hügel. Natürlich wusste sie, dass Wilderei verboten war. Aber jeder im Moor tat es. Normalerweise wurde es toleriert.
„Das … das tut mir leid. Ich wollte euch nicht treffen. Das mit dem Stein … “
„Bist du nicht die vom Bruch?“, fragte der andere neugierig. „Die Tochter der Verrückten?“
Ja, genau, dachte Merle sarkastisch. Die Verrückte, mit der niemand etwas zu tun haben will. Aber sie schwieg.
„Gib uns den Sack mit den Vögeln und den Käse“, setzte der Kleine mit dem Eichhörnchengesicht hinzu. „Dann lassen wir dich laufen.“
Merle presste die Lippen zusammen und hob den Stab.
„Nein“, sagte sie leise. Die beiden waren ziemlich dürr und noch nicht größer als sie. Sie würde mit ihnen fertig werden.
Doch da traf sie etwas so hart am Kopf, dass es in ihren Ohren dröhnte. Merle ließ sich zur Seite fallen. Lichter tanzten vor ihren Augen. Sie schüttelte sich, um die Dumpfheit zu vertreiben, und rappelte sich auf. Wo war ihr Stab? Ihr schwindelte und um ein Haar hätte sie das Gleichgewicht verloren. Ihr Stab war fort.
„Das soll dir eine Lehre sein, du Gabenbalg“, sagte ein dritter, größerer Junge mit dichten schwarzen Augenbrauen. Er musste sich von hinten an sie angeschlichen haben. Eine Steinschleuder baumelte von seiner Hand, und er winkte grinsend mit Merles Moorstab.
Die anderen beiden Jungen bückten sich lachend und griffen nach dem Proviantsack. Dann biss jeder herzhaft von ihrem Käse ab.
Merle fühlte sich benommen. Diese verdammten Bengel! Es hatte sie den ganzen Vormittag gekostet, die Vögel zu fangen und die Wurzeln zu sammeln. Sollten sie doch ihre eigenen Fallen bauen! Sie stürzte nach vorn, um den Jungen ihren Sack wieder zu entreißen.
Aber der mit den dichten Augenbrauen hieb ihr so hart mit ihrem eigenen Stab in den Magen, dass ihr die Luft wegblieb. Merle keuchte und krümmte sich.
„Na, na“, sagte er und hob belehrend den Zeigefinger. „Bleib zurück! Wag es nicht, uns anzufassen mit deinen dreckigen Hexenfingern.“
„Kannst froh sein, dass wir dich ungeschoren davonkommen lassen“, setzte das Eichhörnchen hinzu und schob sich den Rest von Merles Käse zwischen die Lippen. „Das nächste Mal, wenn wir dich erwischen, verpfeifen wir dich bei der Patrouille!“
Merle taumelte zurück. Die drei lachten. Der älteste Junge schleuderte ihren Stab den Abhang hinunter, wo er weit entfernt in einen Tümpel platschte. Dann zogen die drei schwatzend davon und nahmen keinerlei Notiz mehr von Merle.
Sie fluchte. Diese verdammten Flegel hatten ihren Käse und ihr Abendessen gestohlen und machten sich auch noch über sie lustig. Zornig hob sie einen Stein auf und schleuderte ihn hinter ihnen her. Doch sie waren längst außer Reichweite. Sie merkten es nicht einmal, als der Stein spritzend in einen Teich hinter ihnen klatschte.
Merle fühlte etwas Feuchtes an ihrer Schläfe kitzeln und wischte mit der Hand darüber. Ihre Finger waren tiefrot. Es war Blut. Sie fluchte noch einmal, band ihr Halstuch ab und wischte sich damit über das Ohr. Es brannte und pochte. Und als sie mit ihren Fingern durchs Haar tastete, fand sie eine schmerzhafte Beule. Schnaubend band sie sich das Halstuch um den Kopf. Dann stieg sie den Hügel hinunter und angelte im Tümpel nach ihrem Stab.
Kapitel2
Es war bereits später Nachmittag, als Merle die kleine Lichtung erreichte, in deren Mitte das graue Haus aus dunklen Basaltsteinen stand. Es hatte ein mit Schieferplatten gedecktes Dach und kleine Fenster mit hölzernen Läden. Sie waren einmal rot gestrichen gewesen. Aber das Wetter und die Zeit hatten die Farbe verblassen und teilweise abplatzen lassen. Nun wirkten sie ebenso grau und verwittert wie die Basaltblöcke der Hauswand. Aus dem Kamin stieg Rauch auf, und aus der danebenstehenden Scheune tönten helle Hammerschläge. Ihr Vater arbeitete noch.
Merle trat durch das hohe Scheunentor in die wabernde Hitze des Schmiedeofens. Carl stand vor dem Amboss und hämmerte mit gezielten Schlägen auf ein rot glühendes Stück Metall ein. Er trug ein Schweißband um die Stirn, und eine speckige Lederschürze reichte von seiner breiten Brust bis zu den Schienbeinen. Dunkle Schweißflecken zeichneten sich auf seinem Hemdrücken ab. Die Brauen konzentriert zusammengezogen, beugte er sich über einen Rohling.
Merles Vater war ein besonnener Mann. Nur wenn er schmiedete, dann musste man sich möglichst unauffällig bewegen. Das hatte Merle von klein auf gelernt. Das Einzige, was ihn aus der Haut fahren ließ, war nämlich, wenn er in seiner Konzentration gestört wurde.
Sie trat leise näher und sah zu, wie er den Erl absetzte und die Klinge ausschmiedete. Immer wieder hielt er sie in die Glut, um sie nicht auskühlen zu lassen. Es war eine schmale Klinge, vermutlich ein Speisemesser. Alle Messer, die ihr Vater herstellte, waren Alltagsgegenstände. Denn das Tragen von Waffen war in Teria nur den Soldaten und dem König erlaubt. Auch das Waffenschmieden wurde streng kontrolliert und war nur in den Kasernen gestattet. Patrouillen ritten ständig durchs Land und wachten darüber, dass die Gesetze eingehalten wurden.
„Nimm den Blasebalg“, brummte Carl, ohne aufzusehen. „Das Feuer ist nicht heiß genug.“
Merle lächelte und begann das Kohlebett zu richten. Dann heizte sie dem Feuer ordentlich ein, bis ihr selbst der Schweiß von der Nase tropfte. Sie liebte es, ihrem Vater zur Hand zu gehen. Schon einige Male hatte sie ihn gebeten, sie als Schmiedin auszubilden.
Aber Carl hatte immer abgewehrt. „Das ist nichts für Mädchen. Oder willst du Arme haben wie ich?“ Er spielte mit seinen Muskelbergen, und Merle musste trotz ihrer Enttäuschung lachen. Der wahre Grund, warum er sie nicht ausbilden wollte, war ihrer Meinung nach, dass sonst all die anfallenden Arbeiten liegen blieben. Waschen, Putzen, das Versorgen der Tiere, Kochen … um all diese Dinge kümmerte sich meist Merle. Ihre Mutter war nicht imstande, die Hausarbeit zuverlässig zu erledigen. Das Einzige, womit sie sich beschäftigte, war ihr Kräutergarten.
Carl legte letzte Hand an. Das Öl zischte und rauchte, als er den legierten Stahl hineintauchte, um ihn zu härten. Mit einem Tuch trocknete er die Klinge vorsichtig ab. Erst dann wischte er sich den Schweiß vom Kinn. Sein gefurchtes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. „Gute Jagd gehabt?“, fragte er, ohne von seinem Werk aufzusehen.
Merle presste die Lippen zusammen. „Nicht viel zu holen“, sagte sie.
Ihr Vater runzelte die Stirn und sah nun doch hoch. „Das wäre das erste Mal. Sonst bringst du doch immer was mit. Und wenn es nur Wurzeln sind.“
Merle zögerte. „Es war … schwierig heute.“ Nachdenklich strich sie sich das Haar aus der Stirn und wollte noch etwas hinzufügen.
„Grundgütiger! Was ist passiert? Dein ganzes Gesicht ist ja voller Blut!“ Carl nahm ihr Kinn zwischen seine schwieligen Hände. Sie rochen nach Ruß und Eisen.
„Es ist nichts“, sagte Merle. „Ich bin gestürzt. Du weißt doch, dass Kopfwunden immer teuflisch bluten. Aber es ist nicht schlimm.“ Langsam löste sie das Tuch, das sie sich um den Kopf gebunden hatte.
Carl rieb sich erschöpft die Stirn. „Es gehört sich einfach nicht, dass ein junges Mädchen allein durchs Moor streift. Das ist zu gefährlich …“
Merle unterbrach ihn. „Ich weiß, was ich tue, Vater. Es war nur ein Unfall. Es wird nicht wieder vorkommen.“ Sie zögerte, ehe sie fortfuhr. „Außerdem … kannst du nicht alles allein machen.“ Ein bitterer Ton hatte sich in ihre Stimme geschlichen.
Carls Miene wurde finster. „Deine Mutter ist krank, Merle. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie … solche Probleme hat.“
Und da war es wieder. Er duldete keine Kritik an Bel. Das Leben könnte so einfach sein, wenn nicht ständig ihr nächster Anfall drohen würde. Wenn man nicht immer auf das achtgeben müsste, was man sagte. Das Leben auf dem Bruch war ein Balanceakt zwischen mühsam aufrechterhaltenem Alltag und einer Kette von Katastrophen.
Merle presste die Lippen zusammen und trat zu einem mit Wasser gefüllten Eimer. Darüber gebeugt wusch sie sich das Gesicht und rieb die verkrusteten Blutreste an ihrem Ohr fort.
„Besser?“
Carl zog die Augenbrauen hoch. „Du hast noch Blut im Haar.“
Merle fuhr mit den Fingern durch die struppigen Strähnen. Schüppchen getrockneten Blutes rieselten heraus. „Es wird schon gehen.“ Sie wandte sich um. „Ich ziehe mich nur rasch um, und dann kümmere ich mich ums Abendessen.“
„Pass auf, dass sie es nicht sieht“, warnte Carl. „Du weißt, sie mag kein Blut.“
Merle nickte und strebte aus der Scheune hinaus. Mit federnden Schritten ging sie auf das Haus zu. Im Gehen öffnete sie den Knoten, der einen Teil ihrer braunen Locken in Schach gehalten hatte, und ließ sie über ihr Gesicht fallen. Sie waren nur knapp kinnlang, jedoch so dicht und buschig, dass sie zu allen Seiten abstanden wie ein Dornenstrauch. Sie öffnete die Tür und trat in den Flur.
Es herrschte Stille. Einen Moment glaubte sie, ihre Mutter würde schlafen, und atmete erleichtert aus. Doch dann hörte sie das Knarren eines Dielenbretts und leise tappende Schritte in der Kammer. Merle setzte hastig ein Lächeln auf und vergewisserte sich, dass ihre Haare die Wunde verdeckten. Dann rief sie: „Bin zurück, Mutter!“
Die Tür öffnete sich. Bel stand in ihrem Hausgewand und mit nackten Füßen vor ihr. Sie und Merle hatten die gleiche Größe, den gleichen mädchenhaft schlanken Körper und die gleichen wilden Locken. Nur die Haare ihrer Mutter waren fast vollständig ergraut und reichten bis zur Hüfte. Sie umgaben die kleine Frau wie ein Schleier. Merle war stämmiger und dunkler, ihr Gesicht weniger weich. Bel wirkte neben ihr mager, mit ihren knochigen Armen und Schultern. Ein Windhauch hätte sie zum Wanken gebracht.
Sie tastete suchend nach Merles Handgelenk und drückte es. Ihr Griff war so sanft wie das Streicheln einer Feder. Merle widerstand dem Reflex, sich der Berührung zu entziehen. Sie mochte es nicht, wenn ihre Mutter sie anfasste. Bels Augen lagen tief in den Höhlen, und sie lächelte abwesend. Sie musste ihren Mittagstee bereits getrunken haben. Merle schluckte ihren Widerwillen hinunter und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
„Leg dich wieder hin, Mutter. Du bist müde.“
Bel würde keine Antwort geben. Sie sprach nie auch nur ein einziges Wort. Nur wenn sie ihre Anfälle hatte, dann schrie sie heiser und unartikuliert.
Merle hasste die Stille zwischen ihnen und wollte sich umwenden, um die steile Treppe zu ihrer kleinen Dachkammer hinaufzugehen. Ihr war kalt. Sie musste sich das Blut abwaschen und trockene Socken und Schuhe anziehen.
Doch ihre Mutter hielt sie fest und zog sie zu sich heran. Sie legte die dünnen Arme um Merles Schultern und drückte sie an sich. Merle versteifte sich. Sie kam sich wie einer von zwei gleichgepolten Magneten vor, die sich nicht berühren wollten. Sie versuchte Bel von sich zu schieben.
„Alles in Ordnung, Mutter. Ich gehe nur rasch hinauf, um mir trockene Sachen anzuziehen.“
Bel lächelte. Sie strich ihr über die Wange, und Merle schauderte, als die kühlen Finger ihr Gesicht berührten. Wieder bitzelte es auf ihrer Haut, als würde sie die Nähe ihrer Mutter tatsächlich nicht vertragen. Sie riss sich zusammen. Vorsichtig wendete sie das Gesicht ab, löste sich aus der Umarmung und drehte sich zur Treppe.
„Ich komme gleich wieder“, sagte sie und wollte nach oben gehen. Doch plötzlich wurde Merles Handgelenk mit festem Griff gepackt.
Alarmiert schaute sie noch einmal zurück. „Was ist los, Mutter?“
Bels Augen waren nun weit aufgerissen. Keine Spur mehr von Müdigkeit. Durch Merles Wirbelsäule fuhr ein kalter Windstoß. Bitte nicht, dachte sie und hielt sich am Treppengeländer fest, als würde ihr gleich der Boden weggezogen. Bel hob ihre fast durchscheinende Hand und zeigte auf Merles Hals. Merle blickte am grau verwaschenen Kragen ihres alten Hemdes hinunter. Ein einzelner Blutstropfen war darauf gefallen und hatte sich bereits bräunlich verfärbt.
„Es ist nichts, Mutter. Ich … ich habe nur …“
Weiter kam sie nicht, denn Bels Blick wurde nun von den blutverklebten Strähnen ihres Haars angezogen. Merle erstarrte. Bel hob langsam zitternd ihre andere Hand, um Merles Haare zurückzustreichen, ihre Augen starr und riesig wie dunkle Moorseen.
Merle wusste, was nun kam. Sie hatte es Hunderte Male erlebt. Ihr Griff um das Treppengeländer wurde so fest, dass ihre Knöchel knackten. Vielleicht konnte sie sie noch beruhigen.
„Mutter, es ist nur ein Kratzer. Nichts Schlimmes. Bitte setz dich und …“
Ihre Stimme versagte und schlug in einen entsetzten Schrei um. Ihr Handgelenk brannte plötzlich wie Feuer. Sie wollte sich von dem Griff losreißen, doch ihre Mutter ließ nicht locker. Das Brennen durchstieß ihren Arm und schoss hinauf in ihren Kopf wie eine brausende Feuerwalze. Ihre Muskeln, ihre Adern, ihre Haut, alles brannte. Merle konnte nichts anderes mehr sehen als die weit aufgerissenen Augen ihrer Mutter, in denen ein merkwürdiges Licht glomm, wie eine Fackel im Nebel.
Dann zerriss etwas, und Merle stürzte zu Boden, steif wie ein gefällter Baum. Ihr Körper wurde von Krämpfen geschüttelt. Sie bekam keine Luft mehr. Ihre Muskeln gehorchten ihr nicht länger. Sie konnte nur daliegen und die Krämpfe ertragen.
Carl war auf einmal da. Er packte Bel und drängte sie in die Kammer zurück. Dabei warf er Merle einen besorgten Blick zu. Sie versuchte ihm zu sagen, dass alles in Ordnung sei, dass er gehen könne. Aber ihr Mund bewegte sich nicht, und ihre Stimme brachte nur ein leises Röcheln hervor.
Die Tür der Kammer schloss sich. Ihr Vater musste sie am Boden liegen lassen, um dafür zu sorgen, dass Bel nicht das ganze Haus verwüstete. Merle verstand das. Sie blieb allein auf dem Flur zurück.
Kapitel3
Es dauerte, bis ihre Muskeln sich so weit entspannt hatten, dass sie sich aufsetzen konnte. Die Schreie ihrer Mutter waren einem leisen Wimmern gewichen, begleitet von der tiefen Stimme ihres Vaters, der beruhigend auf sie einredete. Merle durfte die Kammer nicht betreten. Diese Momente zwischen ihren Eltern waren zu intim. Und außerdem, wenn sie sich heute noch einmal ihrer Mutter zeigte, würde alles nur von vorne losgehen. Erst morgen oder übermorgen würde Bel sie wieder ansehen können.
Aber was war geschehen? Was hatte Bel getan? Warum konnte Merle sich nicht bewegen? Hatte sie sich das Licht in Bels Augen nur eingebildet? Das war nicht der übliche Ablauf.
Merle kämpfte mit dem Gefühlschaos in ihrem Kopf und bemühte sich durchzuatmen. Ganz ruhig, sagte sie sich. Beruhige dich! Ein Muskel nach dem anderen entspannte sich. Ein letzter Krampf schüttelte sie. Dann wischte sie sich eine Träne von der Wange. Bloß nicht in Panik geraten. Sicher gab es eine Erklärung.
Die Anfälle ihrer Mutter hatte sie Hunderte Male gesehen. Nicht Bel hatte sich diesmal anders verhalten, sondern Merle hatte etwas dabei erlebt, was sie normalerweise nicht erlebte. Dieses Brennen an ihrem Handgelenk … Sie suchte nach Brandmalen. Aber ihre Haut war unverletzt und wies nicht einmal eine Rötung auf. Doch ihre Muskeln schmerzten, und ihr Kopf dröhnte, wie nach dem Aufprall des Steins, den der Junge auf sie geschleudert hatte. Mit Grauen erinnerte sie sich an das Feuer, das sie von innen verschlungen hatte. War es das, was ihre Mutter sah, wenn sie die Anfälle hatte? Wurde Merle nun selbst verrückt?
Mit einem Zittern schüttelte sie diesen Gedanken ab. Nein, es war unmöglich. Merle hatte nie zuvor etwas Derartiges gespürt. Verrücktheit war nicht erblich. Sie presste die Lippen zusammen und stand mit wackligen Beinen auf. Dann wartete sie, bis die Welt aufhörte, sich zu drehen, und stieg hinauf in ihre Kammer.
* * *
Es war ein kleines Zimmer unter dem Dach, mit einer winzigen Fensterluke, durch die das warme Licht des Abends fiel. Obwohl Merle nicht viele Dinge besaß, herrschte in ihrer Kammer stets Unordnung. Ihre Schuhe standen überall im Raum verteilt. Ihre schmutzige Wäsche lag auf dem Boden, auf dem Bett und auf der Truhe, der Stapel der sauberen Laken war umgekippt und versperrte die Tür. Merle musste zweimal dagegendrücken, bis sie die Tür weit genug aufhatte, um sich durch den Spalt zu zwängen.
Das Einzige, was immer ordentlich aufgeräumt auf dem Brett über ihrem Bett stand, waren eine Landkarte von Teria und ihr einziges Buch Die Geografie und Gesteinskunde Terias. Obwohl Merle das Moor noch nie verlassen hatte, kannte sie die Landkarte von ganz Teria auswendig. Im letzten Jahr hatte Skip sie ihr zu ihrem sechzehnten Geburtstag geschenkt. Er hatte den Bibliothekar wochenlang bearbeiten müssen, damit er die Erlaubnis dafür bekam, sie zu kopieren. Seither verging kein Abend, an dem Merle die Karte nicht studierte, sich die Details darauf einprägte und sich in ihrer Fantasie ausmalte, wie jeder Ort in Wirklichkeit aussehen mochte.
Das Buch beschrieb die Entstehung der Erde. Wie Berge sich hoben und wieder senkten und welche Kraft Wind und Wasser in Jahrtausenden auf jegliches Material ausübten. Plötzlich war jeder Hügel für Merle interessant geworden, jeder Stein sagte ihr etwas über die Vergangenheit, und wenn sie in die Landschaft sah, begann sie zu verstehen, dass die Erde sich ständig veränderte. Genau wie ein Lebewesen. Merle liebte dieses Buch. Die Landkarte neben sich auf dem Tisch ausgebreitet, reiste sie in Gedanken durch die Erdgeschichte.
Von Skip hatte sie auch gelernt, Strecken zu berechnen und die Reisedauer zu bestimmen. Von Dalsburg bis zum Meer brauchte man sieben Tage auf dem Fluss und zwölf zu Fuß. Eine Reise von der Hauptstadt zum Bruch dauerte etwa sechs Tage, umgekehrt nur fünf, weil es dann meist bergab ging.
Merle strich liebevoll über den ledernen Buchrücken und ließ sich auf dem Hocker vor ihrer Kommode nieder. Sie zog die hohen Lederstiefel aus, an denen noch der schwarze Schlamm des Hochmoors klebte. Er war fast trocken und bröckelte auf den Boden. Sie warf die Stiefel achtlos in eine Ecke, zog dann die nassen Socken aus und schleuderte sie hinterher. Ihre Füße waren schrumpelig, und sie begann sie zu massieren. Dann suchte sie sich in ihrem Kleiderchaos ein paar saubere Sachen zusammen, zog sie an und wandte sich dem kleinen fleckigen Spiegel zu, der über der Kommode hing.
Sie betrachtete ihr ovales Gesicht mit den wilden Locken, die nach allen Richtungen abstanden. Ihre linke Schläfe und das Ohr waren von getrocknetem Blut fleckig, und auch ihre Haare waren verklebt. Es hatte stärker geblutet, als sie vermutet hatte. Kein Wunder, dass ihre Mutter den Anfall bekommen hatte. Sie hätte auf die Warnung ihres Vaters hören sollen. Vorsichtig teilte sie die Strähnen und tastete nach der Kopfwunde. Sie musste auf der linken Seite sein, oberhalb des Ohrs.
Merle stutzte und fuhr sich noch einmal mit den Fingern durch die Locken. Sie konnte in dem trüben Spiegel nicht viel erkennen, doch sie sah wie geronnenes Blut aus ihren Haaren auf die Kommode rieselte. Es müsste doch zumindest ein Grind oder eine kleine Beule zu ertasten sein. Doch da war absolut nichts.
Irritiert ließ Merle die Hände sinken. Hatte sie sich vielleicht alles nur eingebildet? Aber nein, unmöglich. Da war der Blutfleck auf dem Hemd und das Blut in ihren Haaren und auf ihrer Haut. Ihre Mutter hatte es gesehen und auch ihr Vater. Es hatte verdammt wehgetan, als der Stein sie getroffen hatte. Eine so schnelle vollständige Heilung war einfach unmöglich.
Merle zog ihr Hemd aus und wusch sich Gesicht und Haare in der großen Schüssel. Das Wasser färbte sich braun von all dem geronnenen Blut und den Schlammspritzern aus dem Moor. Sie tastete noch einmal durch die vom Wasser geglätteten Haare. Nichts.
Merle griff nach einem Leinentuch, rubbelte damit kräftig über ihren Kopf, in der Hoffnung, dass sich die Wunde durch die grobe Behandlung wieder öffnen würde. Aber es gab kein Blut, keine Beule und nichts, was auf eine Verletzung hindeutete. In ihrem Magen begann sich eine kalte Dunkelheit auszubreiten. Was, wenn es doch erblich ist?Was, wenn ich es auch …?
Ihre Gedanken wurden unterbrochen vom Knarzen der Dielenbretter. Eine Tür wurde unten geöffnet und geschlossen. Ihre Mutter musste eingeschlafen sein. Sie hörte, wie ihr Vater mit schweren Schritten die Stufen hinaufstieg und vor ihrer Tür stehen blieb. Ein leises Klopfen ertönte.
„Komm rein“, sagte Merle.
Die Tür öffnete sich. Carl setzte sich mit einem schweren Seufzen auf Merles Truhe und blickte auf seine großen Hände. Die Falten um den Mund und auf der Stirn schienen noch tiefer geworden zu sein. Als er aufblickte, stand in seinen Augen Traurigkeit und tiefe Erschöpfung.
„Es tut mir leid“, sagte Merle. „Ich dachte nicht, dass sie es so schnell erkennen würde. Sonst hätte ich besser aufgepasst.“
„Es ist nicht deine Schuld“, erwiderte Carl. „Sie schläft jetzt. Ich habe ihr noch etwas Tee gegeben.“
Merle nickte. Ein kurzes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Ihr Vater gab die Schuld niemals seiner Frau. Und Merle hatte es satt, daran zu rühren. Er sprach nicht gern über Bels Leiden. Eigentlich wurde darüber nie offen gesprochen.
Aber heute war es nicht wie immer gewesen. Merle fürchtete sich. Warum fand sie ihre eigene Wunde nicht mehr?
Sie rieb sich fröstelnd über den Arm. „Vater, ich … ich muss dich etwas fragen.“
Carl blickte sie müde an. „Was denn?“
Merle öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Wie sollte sie es sagen, wie das Unmögliche formulieren?
„Ich … ich weiß, dass Mutter sehr krank ist. Aber ich weiß nicht, was sie genau hat. Kannst du … könntest du es mir nicht erklären? Das, woran sie leidet?“
Carls Augen waren immer schmaler geworden. „Warum fragst du das, Merle?“
„Weil ich Angst habe. Sie ist meine Mutter. Habe ich kein Recht zu erfahren, was mit ihr ist? Ist es vielleicht … heilbar? Die Anfälle werden immer häufiger in letzter Zeit, und … ich habe das Gefühl, es wird schlimmer …“
Carl hob die Hand und Merle verstummte. „Es ist unheilbar“, sagte er. „Ob es sich verschlimmern oder verbessern wird, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich habe Hoffnung, dass sie eines Tages …“
Nun war es an ihm zu verstummen. Seine Stimme war immer rauer geworden, und schließlich versagte sie ganz. Merle sah, dass er mit den Tränen rang, und es tat ihr weh, ihn so zu sehen. Aber sie musste es wissen.
„Vater, ich habe Angst … dass ich genauso werde wie sie, dass ich sie vielleicht von ihr geerbt habe, diese Krankheit.“
Carl blinzelte und blickte sie nun schärfer an. „Wieso glaubst du das? Ist etwas passiert, von dem ich nichts weiß?“
Die Kälte in Merles Magen erfasste ihr Herz. Er hat nicht abgestritten, dass ich es haben könnte. Sie schluckte schwer und hatte das Gefühl zu ersticken.
„Ich … ich glaube, ich habe gesehen, was sie sieht, wenn sie diese Anfälle hat. Es hat … gebrannt. Und ich dachte, ich würde sterben. Sie hielt mein Handgelenk gepackt, und es brannte und breitete sich in meinem ganzen Körper aus …“ Merle zuckte hilflos die Schultern und versuchte das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen. „Aber ich bin nicht verletzt“, flüsterte sie und zeigte auf ihr Handgelenk. „Es ist nicht verbrannt. Und ich glaube … ich glaube, ich werde verrückt, weil ich auch die Wunde an meinem Kopf nicht mehr finden kann … und … und …“ Ihre Stimme versagte vollständig.
Ihr Vater schwieg. Auf seinem Gesicht hatte sich eine Leere ausgebreitet, die Merle nicht zu deuten wusste. Dann stand er auf und kam zu ihr hinüber. Sanft legte er seine großen Hände auf ihren Kopf und begann ihr durch die Haare zu fahren.
Er sucht die Verletzung, begriff Merle und hielt still. Er wird eine Erklärung für alles haben, beruhigte sie sich. Mein Vater weiß immer eine Lösung.
Nach einer Weile trat er zurück und setzte sich wieder auf die Truhe.
„Du bist nicht verrückt“, sagte er ruhig. „Die Wunde ist fort. Verheilt.“
„Aber … aber wie ist das möglich?“
„Sie hat dich angefasst, sagst du? Und dann hat es gebrannt?“
Merle nickte.
„Nachdem ich euch getrennt habe, war sonst nichts mehr, das du mir sagen wolltest?“
Merle schüttelte den Kopf. „Mein ganzer Körper tat weh. Wie richtig schlimmer Muskelkater. Und ich konnte mich nicht bewegen. Aber nachdem die Krämpfe nachgelassen hatten, war alles normal.“
Carl rieb sich die Hände. „Du bist nicht verrückt“, wiederholte er. „Ich … wir …“ Er klappte den Mund auf und zu, als wollten die Worte nicht über seine Lippen. „Es ist wahr … wir haben dir jahrelang verschwiegen, woran deine Mutter leidet. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber du musst wissen, es geschah zu deinem Schutz. Alles, was wir wollten, war, dass du ein sicheres und glückliches Leben führen kannst. Deshalb haben wir nichts gesagt.“ Er schniefte und rieb sich die Stirn. „Aber ich glaube, jetzt ist der Augenblick gekommen, an dem du die Wahrheit erfahren musst.“
Er hob den Blick. „Deine Mutter ist nicht verrückt, wie die Leute sagen.“ Er suchte nach Worten. „Sie ist nicht verrückt, aber sie leidet unter … einem Fluch.“
„Einem Fluch?“ Merle stutzte. Machte sich ihr Vater über sie lustig? Sie presste die Lippen zusammen und stand auf. „Was soll das, Vater? Warum lügst du mich an? Ein Fluch, was soll das sein? Das sind Hirngespinste. Flüche gibt es nicht. Sie ist krank! Und ich möchte wissen, was es ist, weil ich Angst habe, es vielleicht auch selbst zu bekommen. Womöglich ist es ansteckend, verstehst du? Es ist wirklich wichtig, dass ich es weiß.“
Carl schüttelte den Kopf. „Nein, es ist keine Krankheit. Es ist ein Fluch, wie ich dir gesagt habe. Manche nennen es auch … eine Gabe.“
Merles Mund klappte auf. Sie starrte ihren Vater fassungslos an. Ihr Gehirn schien sich verknotet zu haben. Dann begann sich etwas zusammenzufügen, was nicht zusammenkommen durfte. „Eine Gabe … du meinst DIE Gabe? Die Donidengabe? Die Gabe des Roten Königs?“
Ihr Vater stand nun ebenfalls auf. „Merle, beruhige dich!“
Doch ihr lag nichts ferner. Blankes Entsetzen hatte sie erfasst. Ihre Mutter, eine Begabte. Und noch viel schlimmer! Hitze brodelte in ihr, als sie begriff. „D-die Wunde! Sie hat meine Wunde mit ihrer Gabe …“
„Sie hat dich geheilt“, sagte Carl leise. „Das ist ihre Gabe. Sie kann Wunden heilen. Deshalb ist deine Kopfwunde verschwunden.“
Merle öffnete und schloss ihren Mund, wie ein Fisch auf dem Trockenen. „Warum habt ihr es mir nie gesagt?“, brachte sie dann heraus.
„Deine Mutter wollte es nicht. Es sind schlimme Dinge deswegen geschehen. Wir wollten dem Ganzen ein Ende machen.“
„Indem ihr so tut, als gäbe es die Gabe nicht? Indem ihr jedem glauben macht, Mutter sei geisteskrank?“
„Die Gabe zu haben, ist gefährlich. Viele Menschen sind deswegen gestorben. Und viele sterben noch immer deswegen. Eine Geisteskranke wird ausgelacht und bemitleidet, aber sie wird nicht verfolgt oder getötet.“
Merle dachte nach. Ja, es stimmte. Begabte lebten gefährlich, denn sie wurden von allen gejagt. In Dalsburg gab es sogar ein Kopfgeld, wenn man einen Begabten an den König auslieferte. Skip hatte ihr davon erzählt. Es war eine allgemein akzeptierte Wahrheit, dass die Gabe böse war. Alle mussten mithelfen, sie zu beseitigen. Die Donidenanhänger glaubten, nur in den Händen des Königs und dessen Familie könnte sie Gutes bewirken. Andere meinten, die Gabe sollte vollständig verschwinden.
Zuvor hatte Merle gegenüber ihrer Mutter vor allem Scham empfunden, einen undefinierbaren Widerwillen. Vielleicht auch Wut. Nun aber spürte sie Ablehnung. Und es wurde noch stärker, als sie sich ins Bewusstsein rief, dass sie selbst Opfer dieser widerwärtigen Fähigkeit geworden war. Merle fühlte sich beschmutzt.
„Deshalb sind wir hier, oder?“, fragte sie. „Du hast sie versteckt.“
Carl nickte. „Als du noch sehr klein warst, kamen wir hierher. In der Stadt wurde es zu gefährlich. Es sind … schreckliche Dinge passiert. Wir mussten fliehen, uns verstecken. Sonst hätten sie sie geholt.“
Merle schüttelte den Kopf. „Vater, wie… wie konntest du nur… Ich meine sie … sie ist ein …“ Das Erste, was ihr in den Sinn kam, waren Skips Worte. „… ein Monster! Wie konntet ihr …“
Es klatschte, als seine Hand Merles Wange traf. Es war so schnell gegangen, dass sie es nicht hatte kommen sehen. Merle erstarrte. Diese Ohrfeige hatte wehgetan. Nicht so sehr auf der Haut, aber im Herzen.
„Sei still!“, flüsterte Carl. „Wie kannst du so über deine Mutter reden? Du verdankst ihr dein Leben!“
Merle hielt sich die brennende Wange. Sie spürte, wie ihr vor Wut der Schweiß ausbrach. „Du verteidigst sie auch noch? Die Gabe ist schlecht! Der Rote König tötet Tausende mit seinem Hexenwerk und tyrannisiert die Menschen. Nur wegen seiner Gabe, können die Rebellen nichts gegen ihn ausrichten.“
Carl stand mit aufgerissenen Augen vor ihr, als hätte sie ihm einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt. Ihre Worte hatten ihn ebenso tief getroffen wie seine Ohrfeige Merle. Langsam ließ er die Hand sinken. Seine Schultern sackten nach unten. „Du glaubst das wirklich, oder?“
Dann, ganz langsam, quoll ein freudloses Lachen aus seiner Brust. „Wer hat dir das erzählt, hä? Dein Freund Skip? Oder die Leute im Dorf? Und ich dachte, wir könnten dich hier vor solchem Unsinn bewahren.“ Er schüttelte den Kopf und rieb sich die Augen.
Merle wurde nur noch wütender. „Ihr wolltet mich in völliger Unwissenheit lassen! Aber ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was in der Welt geschieht!“
Carl sank auf die Truhe zurück und fuhr sich müde durchs Haar. „Du hast recht, du hast ja recht.“ Er seufzte tief. „Ich … ich wollte dich nicht ohrfeigen. Ein Mann sollte niemals gegen eine Frau die Hand erheben. Bitte, verzeih mir.“
Er meinte es ernst. Das konnte sie daran sehen, wie er seine Finger wand und sich auf die Lippen biss. Er war ein stolzer Mann und gestand selten Fehler ein. Aber wenn es nötig war, tat er es. Sie selbst brauchte wesentlich länger als er, um ihren Zorn so weit niederzukämpfen, bis sie ein schmallippiges Nicken zustande brachte.
Doch es genügte Carl. Er kannte seine Tochter. „Hör zu, Merle. Wir dachten, du würdest dir so ein eigenes Urteil bilden können. Wir dachten, du könntest hier ohne Angst aufwachsen und die Gabe als das kennenlernen, was sie ist. Eine Fähigkeit, die … die zum Guten wie zum Schlechten gebraucht werden kann.“
„Wie kann ein Kind ohne Angst aufwachsen, wenn es glaubt, eine Verrückte als Mutter zu haben? Eine, die im einen Moment normal scheint und sich im nächsten schreiend auf dem Boden wälzt“, warf ihm Merle grollend vor.
„Es ist doch auch schwer für sie. Am schwersten vielleicht sogar … Sie war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der sie sprach und ganz normal leben konnte.“
Merle schüttelte den Kopf. Sie wollte das nicht hören. Die Wut hatte sie wieder voll im Griff. „Ich will fort von hier.“
„Das ist doch Unsinn, Merle.“
„Kannst du nicht verstehen, dass ich ein Leben ohne diese … diese Sache im Hintergrund führen will? Ich dachte, Mutter sei verrückt. Und nun stellt sich heraus, dass sie eine Begabte ist. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ich kann nicht länger hierbleiben.“
„Oh, Merle. Wie kannst du so etwas sagen. Sie liebt dich. Wir haben dich immer geliebt und das Beste für dich gewollt.“
„Dann lass mich gehen“, flehte sie. „Zwing mich nicht, weiterhin mit ihr unter einem Dach zu leben.“
In Carls Augen schien alles Leid dieser Welt versammelt zu sein. Seine Lippe zitterte. „Es ist zu gefährlich. Wenn du gehst, bist du in großer Gefahr.“
„Nein“, beharrte Merle. „Sie ist in großer Gefahr. Ich aber nicht. Ich bin keine Begabte. Niemand muss wissen, woher ich komme. Ich werde euch nicht verraten, das verspreche ich.“
„Du verstehst mich nicht. Es ist auch für dich gefährlich, denn vielleicht …“, Carl rang mit sich und schien dann eine Entscheidung zu treffen. Seine Stimme war nun fester. „Es kommt nicht infrage. Du bleibst hier. Du bist zu jung.“
„Ich bin schon siebzehn Jahre alt. Es gibt Frauen, die in meinem Alter heiraten und ihr erstes Kind zur Welt bringen. Ich könnte zu Harri und Selma ziehen. Dann wäre ich nicht allein. Und außerdem wüsstest du, dass ich in guten Händen bin.“
„Nein. Du bist zu jung. Glaube mir, Merle, es ist viel zu gefährlich. Wenn du in zwei Jahren immer noch gehen willst, dann soll es so sein. Aber warte noch bis dahin. Bitte, du musst mir vertrauen.“
Merle erkannte, dass er in dieser Sache nicht nachgeben würde. Es hatte keinen Sinn, weiter mit ihm zu diskutieren. Doch wie konnte sie ihm trauen? Ihm, der sie jahrelang belogen hatte?
Merle erwiderte seinen Blick, und in ihrem Geist begann eine Idee Gestalt anzunehmen. Schließlich sagte sie ruhiger: „Gib mir ein wenig Zeit, Vater. All das ist neu für mich. Ich muss darüber nachdenken.“
Carl nickte, und ein schwaches Lächeln erschien auf seinen Lippen. „Tu das, Tochter. Auch ich werde nachdenken. Ich weiß, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Vielleicht hätten wir es dir früher sagen sollen. Ich möchte, dass wieder alles gut wird, dass es zwischen uns keine Geheimnisse mehr gibt.“ Schwache Geräusche drangen von unten herauf. Carl zögerte. „Ich muss mich um deine Mutter kümmern. Lass uns morgen darüber sprechen.“
Merle nickte. Sie sah ihm nach, als er ihr Zimmer verließ, und wusste, sie würde ihn an diesem Tag nicht wiedersehen. So war es immer nach einem Anfall.
Merle ließ sich auf ihr Bett fallen und blickte zu den staubigen Balken des Dachgestühls hinauf. Zwei Jahre waren eine lange Zeit. Zwei Jahre mit ihrer Mutter, einer Gabenträgerin, waren noch länger. Zu lang. Sie war alt genug, um die Welt kennenzulernen, und sie hatte keine Lust, noch mehr Zeit auf diesem abgelegenen Hof mitten im Moor zu vergeuden. Aber ihr Vater würde sie nicht gehen lassen. Jetzt noch weniger als vorher.
Doch was erwartete er von ihr? Dass sie sich an die Anwesenheit einer Begabten gewöhnte? Das Leben mit ihrer Mutter war so schon schwer genug. Er konnte doch unmöglich von ihr erwarten, dass alles so weiterginge wie zuvor. Ihre Mutter hatte die Gabe! Merle wusste nicht einmal, ob man sie unter diesen Umständen noch als Mensch bezeichnen konnte.
„Ich will so nicht leben“, flüsterte sie in die Stille ihres Zimmers und wusste nicht, ob sie die Gabe ihrer Mutter meinte oder das einsame Moor. Ihr Leben sollte nicht hier enden. Es wurde Zeit, dass sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nahm.
Sie griff ins Regal und breitete die Landkarte vor sich aus.
Kapitel4
Es war dunkel und kalt. Über das Moor pfiff ein schneidender Wind, der den Nieselregen mit sich riss und in Merles Gesicht peitschte. Obwohl sie nicht weiter als drei Meter sehen konnte, wusste sie genau, wo sie sich befand. In ihrem Kopf sah sie eine exakte Karte des Moors, mit allen Wegen und Pfaden, mit den Teichen und dem Morast.
Auf den langen Stab gestützt, sprang sie über ein schlammiges Loch hinweg. Sie hatte nicht viel mitgenommen: eine Decke, ein wenig zu essen, eine Lederflasche mit Wasser, ihr Buch und ihre Karte. Ein paar Münzen klimperten in ihrem Säckchen am Gürtel. Den Wollschal hatte sie um Kopf und Hals geschlungen, und über ihrer Lederweste trug sie eine alte Jacke ihres Vaters, die ihr bis über die Knie reichte.
In der Ferne flackerte ein kleines Licht hinter dem Regenvorhang. Das Dorf Rieding. Dort musste sie hin, wenn sie die Straße nach Dalsburg erreichen wollte. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Sonne aufging.
Als sie bei den ersten Häusern ankam, war die Dämmerung schon weit fortgeschritten. Mit triefender Kleidung und halb verhülltem Gesicht stakte sie aus dem Moor, während die Bewohner sie misstrauisch beäugten. Inständig hoffte sie, nicht auf die drei Jungen zu stoßen, die ihr gestern ihre Vögel gestohlen hatten.
„Du bist früh auf den Beinen, Kleines“, rief eine zahnlose Bäuerin, die genauso gebeugt dastand wie die verkrüppelten Bäume, die sich auf der Hochfläche gegen den Wind stemmten. Merle kannte sie, weil sie ihr einmal eine entlaufene Kuh eingefangen und aus dem Moor zurückgetrieben hatte. Carl kaufte hin und wieder Käse und Butter bei ihr.
„Ist etwas passiert?“, fragte die Alte neugierig. „Geht es deinem Vater gut?“
Merle zog den durchweichten Wollschal vom Gesicht. „Alles in Ordnung, Frau Margarethe.“
Die Alte blickte sie mit schief gelegtem Kopf an. „Brauchst du etwas, Kind? Möchtest du etwas kaufen?“ Hinter sich spürte Merle nun auch andere Blicke.
Sie schüttelte wieder den Kopf und klammerte ihre Finger ein wenig fester um ihren Stab. „Nein, danke. Ich … ich bin auf dem Weg zu Freunden.“
„Ah, du hast eine Anstellung gefunden?“, fragte die Alte weiter. Hinter ihr trat ein Mann aus dem Stallgebäude und spuckte in den Misthaufen. Es war offensichtlich, dass er nur kam, um zu hören, was Merle zu sagen hatte.
Merle nickte. Sie wurde rot und ging weiter. Die Aufmerksamkeit war ihr unangenehm. Sie fürchtete, jeden Moment einen Stein an den Kopf geworfen zu bekommen, und aus den Augenwinkeln sah sie die Riedinger hinter ihr einen Kreis in die Luft malen. Es war ein altes Schutzzeichen gegen das Böse.
Sie beeilte sich, das Dorf zu verlassen. Vor ihr erstreckte sich ein holpriger Dammweg aus ausgetretenen Steinen und Baumstämmen. Es war eine der wenigen befestigten Straßen, die über das Moor führten und die Reisende für gewöhnlich nahmen, wenn sie die Hochfläche überqueren mussten.
Erst als sie den Waldrand erreicht hatte, blickte Merle zurück. Ihr Moor lag in trüben Nebelschwaden da. Der Wind trieb sie in Fetzen um die wenigen felsigen Hügel. Wie viel Zeit mochte wohl verstreichen, ehe sie es wiedersehen würde? Wochen? Monate? Jahre? Vielleicht kehrte sie auch nie mehr zurück. Merle schluckte ihre schwermütige Stimmung hinunter und wandte sich ab.
Der Weg verlief nun bergab in bewaldete Täler. Laut ihrer Landkarte führte er in die ferne Ebene, deren Zentrum Dalsburg war, die Stadt des Roten Königs. Dalsburg war als Roter Punkt eingetragen. Der Pfad, dem sie folgte, würde sich immer mehr verbreitern und schließlich zu einer befestigten Straße werden, auf der auch schwere Fuhrwerke fahren konnten. Das symbolisierte die durchgezogene Linie. Sie war diesen Weg noch nie bis zu seinem Ende gegangen.
Aber ein wenig kannte sie sich noch aus. An den steilen Hängen wuchsen Kastanienbäume mit schmackhaften Früchten. Merle sammelte sie manchmal im Herbst in Säcken und brachte sie nach Hause, um damit das Schwein zu füttern. Aber unten im Tal, wo der Pfad über einen Bach führte, war sie stets umgekehrt. Heute machte sie dort Rast, wie um sich endgültig zu verabschieden, und trank noch einmal von dem eiskalten Wasser. Sie setzte sich auf einen glatt gewaschenen Fels am Rande des Bachbetts und blickte nachdenklich in die spiegelnde Wasseroberfläche.
Noch gestern war ihr alles so richtig erschienen. Sollte sie wirklich gehen? Ihr Heim, ihren Vater verlassen? Wie würde ihre Mutter darauf reagieren? Sie hatte immer wieder klare Momente, und es hatte Zeiten gegeben, oder besser Augenblicke, in denen Merle gespürt hatte, dass Bel sie liebte, wie eine Mutter ihre Tochter lieben sollte. Hatte ihr Vater doch recht, und die Gabe war etwas ganz anderes als Hexerei?
Aber dann schob sich ein anderes Bild in den Vordergrund. Merle sah sich selbst, wie sie weinte, weil ihre Mutter sie grob von sich gestoßen hatte und auf dem Weg ins Haus schreiend zusammengebrochen war. Sie sah all die einsamen Tage und Nächte, in denen sie vor der Tür der elterlichen Kammer gekauert und darauf gewartet hatte, dass jemand von ihr Notiz nehmen würde. Sie hatte dabei der sanften Stimme ihres Vaters gelauscht, der hinter der Tür auf Bel einredete, und sich vorgestellt, dass sie es wäre, die er gerade tröstete.
Merle erinnerte sich auch daran, wie sie einmal gemeinsam Rieding besucht hatten, ihre Mutter, ihr Vater und sie. Es war wie ein Festtag für Merle gewesen. Sie hatte ihr einziges Kleid angezogen und ihre Haare zu einem Zopf geflochten. Freudig war sie vom Wagen gesprungen und hatte nichts anderes im Sinn gehabt, als andere Kinder zu finden, um mit ihnen zu spielen.
Doch stattdessen hatten die Menschen von Rieding das Kreiszeichen in die Luft gemalt. Die Kinder hatten Merle bis zum Rand des Moores verfolgt und mit Steinen nach ihr geworfen. „Moorhexe“, „Irrenkind“, „Vogelscheuche“, war ihr aus höhnisch verzogenen Mündern hinterhergeschleudert worden.
Ihr Vater hatte alle Mühe gehabt, die Mutter wieder auf den Wagen zu hieven, um sie zurück nach Hause zu bringen. Es war das letzte Mal gewesen, dass Bel den Hof verlassen hatte. Merle musste etwa acht Jahre alt gewesen sein.
Nachdenklich tastete sie nach der blauen Glasperle, die sie an einer Lederschnur um den Hals trug. Glatt und körperwarm schmiegte sie sich an ihre Haut unter dem dicken Kragen ihrer Lederweste. Skip hatte ihr diese blaue Perle zu ihrem fünfzehnten Geburtstag geschenkt. Das war mehr als zwei Jahre her. Damals hatte sie nicht recht gewusst, was sie mit diesem nutzlosen Ding anfangen sollte.
„Weil Mädchen Schmuck tragen“, hatte er erklärt und die Perle auf eine Lederschnur gefädelt. Seither trug Merle sie um den Hals. Und ihre blauen Lichtreflexe im Sonnenlicht erinnerten sie an Skips Augen. Sie fühlte sich weniger allein, wenn sie die Perle betrachtete.
Später hatte Skip ihr von den wenigen Erinnerungen berichtet, die er an seine eigenen Eltern hatte. Seine Familie war von der Gabe zerstört worden, denn es waren Soldaten des Gabenkönigs gewesen, die Skips Eltern getötet hatten. Merles Mutter war noch am Leben, aber die Gabe hatte – wie sie jetzt wusste – immer zwischen ihnen gestanden. Die Bande, die zwischen Mutter und Kind herrschen sollten, hatte Merle nie kennengelernt, weil ihre Mutter eine Begabte war.Wie wunderbar müsste es sein, in einer Welt zu leben, die nicht davon heimgesucht wurde.
Merle erhob sich. Wenn sie noch länger hier herumsäße und nachdächte, würde sie nie in Dalsburg ankommen. Entschlossen packte sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammen. Dann machte sie einen mächtigen Satz über den Bach.
Nun war sie weiter von zu Hause entfernt als je zuvor.
* * *
Der nächste Tag war hart. Es regnete beinahe ununterbrochen, und in der folgenden Nacht fror Merle so sehr, dass ständig ihre Zähne klapperten. Ihre Kleidung konnte bei dem feuchten Wetter nicht vollständig trocknen. Alles war klamm, und die Temperaturen sanken bis knapp über den Gefrierpunkt.
Merle hatte ein kleines Feuer entfacht und sich nahe daran in ihrer Decke zusammengerollt. Doch es half nicht viel. Sie schlief zwar ein, schreckte aber bald wieder zitternd hoch, mit gefühllosen Füßen und Fingern. Dann legte sie Holz nach, damit das Feuer nicht ausginge, und dachte wehmütig an ihr warmes Bett, ehe sie wieder wegdöste.