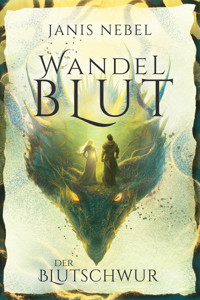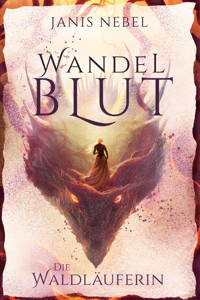
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sieben Jahre in Dunkelheit. Verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, kehrt Mitja aus dem Straflager zurück. Er ist an Körper und Seele gezeichnet, aber er hat nichts vergessen. Denn der Mann, der ihn einst verriet, herrscht nun über das Land. Und Mitja ist gezwungen, ihm zu dienen. Doch dann begegnet er einer seltsamen Waldläuferin mit goldenen Augen – Augen, die er aus jener Nacht kennt, in der sein Leben zerbrach. Neri hat gelernt, zu überleben. Seit der Ermordung ihrer Familie lebt sie versteckt im Wald – halb Mensch, halb etwas anderes. Denn ihresgleichen wird gefürchtet und gejagt. Doch als ein Fremder sie entdeckt und verschont, gerät ihr Weltbild ins Wanken. Kann sie einem Menschen vertrauen? Und was geschieht, wenn er erfährt, wer – oder was – sie wirklich ist? Zwei gebrochene Seelen. Ein grausamer Fürst. Drei Leben, verwoben in Verrat, Schuld und uralter Magie – und ein Geheimnis, das die sieben Fürstentümer in den Abgrund stürzen könnte. *** Düstere High Fantasy mit Dark Fantasy-Vibes, sagenumwobenen Drachen, mythischer Wandlermagie und einer verbotenen Liebe zwischen zweien, die eigentlich Feinde sein sollten. Für Fans von moralisch grauen Figuren, emotional tiefgründigen Geschichten, Slowburn, Star-Crossed Lovers und finsteren mittelalterlichen Welten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DIE WALDLÄUFERIN
WANDELBLUT 1
JANIS NEBEL
IMPRESSUM
Copyright © 2024 by Janis Nebel
Erweitertes Korrektorat: Uwe Raum-Deinzer
© Buchsatz und Gestaltung der Fantasy-Landkarte: Janis Nebel - janisnebel.com
© Covergestaltung: Janis Nebel - janisnebel.com
Für die Erstellung des Buchcovers wurden sowohl Stockdaten als auch KI-generierte Bilddaten verwendet. Alle Kompositbilder wurden im Rahmen des Cover-Gestaltungsprozesses umfassend überarbeitet, verändert und individualisiert.
Alle Rechte sind vorbehalten. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und sonstigen Begebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Impressum
Ines Büttel
Oberer Geisberg 1
96129 Strullendorf
Germany
https://janisnebel.com
ISBN: 9783759224217
ÜBER DIE AUTORIN
Janis Nebel wurde 1985 in Bayern geboren und studierte Archäologie und Geographie. Danach arbeitete sie als Archäologin in Rettungsgrabungen an verschiedenen Orten Süd- und Mitteldeutschlands. Nach einem kurzen Abstecher in die Welt der Wirtschaft und den Büroalltag zog sie 2017 nach Frankreich und erfüllte sich dort den lange gehegten Traum, einen Roman zu schreiben. Ihr Debüt „Die Gabe des Roten Königs“ erschien 2019.
Mehr zur Autorin: https://janisnebel.com
BÜCHER VON JANIS NEBEL
Die Merles Fluch-Trilogie:
Band 1 | Die Gabe des Roten Königs
Band 2 | Im Bann des Roten Königs
Band 3 | Der Turm des Roten Königs
Wandelblut-Saga
Band 1 | Die Waldläuferin
Band 2 | Der Asrenkrieger
Band 3 | Der Blutschwur
Band 4 | Der Abschlussband erscheint 2025!
Trage dich in Janis Nebels Newsletter ein, um das Erscheinungsdatum zu erfahren, sobald es feststeht!
Jetzt anmelden!
INHALT
1. Der Fürst
2. Die Fremden
3. Geschichten von Göttern
4. Die Waldkatze
5. Träume
6. Die Maskierten
7. Die Verwandlung
8. Nishkas Haut
9. Der Bogen
10. Alles ist anders
11. Der Fremde
12. Alte Freunde
13. Das Bändchen
14. Die Lichtung
15. Die Jagd
16. In der Nacht
17. Die Augen
18. Die Waldläuferin
19. Wenn der Rabe fliegt
20. Jenseits des Waldes
21. Besuch
22. Die dunkelste aller Nächte
23. Das Urteil
24. Ganz unten
25. Zwei Wiedersehen
26. Der Fürst von Aheelia
27. Flügel
28. Zwei Männer am Feuer
29. Ein Gespräch
30. Freund und Feind
31. Blut und Feuer
32. Hoch über dem Fluss
33. Das Mädchen
34. Er
35. Spuren im Schnee
Epilog: Unter der Haferkrippe
Der Asrenkrieger – Band 2 der Wandelblut-Saga
Mehr von Janis Nebel
DER FÜRST
MITJA, GEGENWART
„Nummer 3782!“, erscholl die Stimme des Aufsehers scharf wie ein Peitschenhieb zwischen den nackten Felsen des Steinbruchs. Das helle Klopfen und Schlagen Hunderter Meißel, Hämmer und Steinpickel verstummte fast augenblicklich. Nur noch ein paar Steinbrocken polterten die steilen Wände hinunter und platschten in den trüben See, der sich weit unten aus dem aufsteigenden Grundwasser gebildet hatte.
„Nummer 3782!“, erklang es noch einmal.
Ungewohnte Stille trat im Steinbruch ein. Alle warteten. Der oberste Aufseher wurde schnell wütend, wenn man nicht sofort zu ihm eilte. Und es brachte ihn zur Weißglut, wenn die Sträflinge einfach weiterklopften und er deshalb gezwungen war, über den Lärm der Arbeiter hinwegzubrüllen.
Ilija, der damit beschäftigt gewesen war, einen Keil in die vorgemeißelte Sollbruchstelle zu schlagen, richtete sich auf. „Das bist doch du, Mitja?“, flüsterte er. „Drei sieben acht zwei?“ Ilijas Blick wanderte nervös hinunter zu Mitjas linker Hand.
Der zog sich den feuchten Lappen vom Gesicht, den er sich gegen den beißenden Staub vor Mund und Nase gebunden hatte.
Wieder schallte der Ruf. „Drei-sieben-acht-zwei! Beweg deinen müden Arsch gefälligst hier rauf! Und zwar sofort!“ Die Stimme des Aufsehers klang nun gereizt.
Mitja rieb den Staub aus den Augenwinkeln und wischte mit dem Lappen über seinen linken Handrücken. Die Zahlen 3782 waren dort in unordentlicher Schrift und schon etwas verblasstem Schwarz zu lesen. Natürlich kannte er die eintätowierte Nummer nach all der Zeit in- und auswendig. Aber warum wurde er zum Aufseher zitiert? Er hatte doch gar nichts ausgefressen.
Angst packte ihn. Er musste sich beeilen, um den Aufseher nicht noch mehr zu verärgern. Den Schmerz in seinem linken Knie ignorierend, stand er auf. Dann schob er sich an den anderen Sträflingen vorbei über den schmalen Absatz der Felsterrasse bis zu einer Leiter, die hinauf auf den Hauptweg führte. Hunderte Augenpaare folgten ihm dabei. Mitja wusste, was sie dachten: Armer Hund! Ob wir den jemals lebend wiedersehen?
Er erreichte die breite Steinstufe des Hauptwegs, der sich in der gigantischen Höhle des Steinbruchs bis nach unten zum See schraubte. Als er über die Kante hinaufkletterte, sah er schon die fettig glänzenden Stiefel des Aufsehers dort stehen. Ungeduldig tippte dieser mit der Lederpeitsche gegen seinen Oberschenkel. Der hölzerne Griff war dunkel verfärbt, vollgesogen mit altem und frischem Blut. Auch Mitjas Blut musste darunter sein. Er hatte mit dieser Peitsche schon mehrfach nähere Bekanntschaft geschlossen.
Mit gesenktem Haupt trat er vor den Aufseher, der ihm gerade bis zum Kinn reichte, und hielt ihm, ohne dazu aufgefordert zu werden, die linke Hand hin, damit dieser die darauf eintätowierte Nummer lesen konnte. Mitja kannte den vorgeschriebenen Ablauf.
„Mitkommen!“, befahl der Aufseher, und Mitja hinkte in einigem Abstand hinter ihm her den Hauptweg hinauf, vor und hinter ihm jeweils zwei Unteraufseher.
Um ihn herum setzte das Schlagen und Klopfen, das Brechen und Poltern wieder ein. Die mitleidigen Blicke seiner Mitsträflinge folgten ihm, bis er oben über den Absatz des senkrechten Schachtes hinaus war. Dort gab es zwar weniger Staub, dafür aber sammelte sich der Rauch unzähliger Fackeln und Lampen, bevor er durch die unzureichenden Lüftungsschächte abziehen konnte.
Als sie aus dem Stollensystem hinaus in die Tundra traten, traf Mitja der eisige Wind so unvermittelt, dass er unter seinem schweiß- und staubverklebten Hemd zu zittern begann. Er folgte dem Aufseher bis in eines der Langhäuser, das den Sträflingen als Baracke diente. Beim Hineingehen erkannte er mehrere davor festgebundene Pferde mit prächtigem Lederzeug. Das Straflager schien hohen Besuch zu haben.
Mitja wurde noch enger in der Brust. Wenn der König oder einer seiner Fürsten-Vertreter hier war, bedeutete das meist nichts Gutes. Entweder er brachte neue Sträflinge – und das war für die alten wahrlich keine gute Nachricht, denn es bedeutete so lange gestreckte Rationen, bis die Schwächsten von ihnen weggestorben waren –, oder der Fürst war gekommen, um die geplanten Exekutionen zu bestätigen. Und da Mitja nirgends neue Sträflinge erblicken konnte, vermutete er Letzteres.
Doch warum er? Er hatte keinen Ärger mehr gemacht, die vielen Peitschenhiebe, von denen die Narben auf seinem Rücken zeugten, hatten ihn eines Besseren belehrt. Mitja war es nun zufrieden, wenn er des Abends auf seine Pritsche fallen konnte, den Magen zumindest halbwegs voll mit dem madigen Getreidebrei, den sie hier gewöhnlich vorgesetzt bekamen. Die am Anfang seiner Sträflingszeit gehegte Wunschvorstellung, einer seiner Freunde würde herbeieilen, um ihn aus dem Straflager herauszuholen, hatte er schon vor vielen Wintern aufgegeben.
Im Inneren der Baracke hatte man die Pritschen zur Seite geschoben und einen der langen Tische, an denen die Sträflinge sonst zu essen pflegten, quer gestellt. An dieser schartig-fleckigen Tafel saß nun ein einzelner Mann mit sorgfältig gestutztem Bart. Er trug ein prächtiges blaues Obergewand mit goldbesticktem Saum, dazu edle Lederstiefel, Armschutze und einen goldbeschlagenen Brustpanzer. An seinem Gürtel hing eines der berühmten Asren-Schwerter, die nur von den Fürst-Königen und ihren Kriegern geführt werden durften.
Die Klinge funkelte blau im dämmrigen Licht der Baracke. Vor vielen Jahren hatte Mitja schon einmal eine solche Klinge gesehen. Aber das kam ihm jetzt vor wie die Szene aus einem anderen Leben.
Der Mann, der am Tisch saß, hatte den Mantel aus Fellen grauer Wölfe neben sich über die Stuhllehne geworfen. Nun blickte er Mitja und den Aufsehern entgegen, einen dampfenden Weinpokal in der Hand und einen Teller vor sich, auf dem die halb abgezausten Knöchlein eines gebratenen Schneehuhns lagen.
Mitja konnte seine Augen kaum von dem Teller abwenden. Wie lange war es her, dass er zum letzten Mal Fleisch gekostet hatte? Echtes Fleisch! Nicht nur die aus Knochen gekochte Brühe, mit der der Sträflingsfraß an guten Tagen angereichert wurde. Das Wasser lief ihm im Munde zusammen, und der Geruch des Fleisches schien plötzlich alles andere zu überdecken.
Der Aufseher trat vor die Tafel und verneigte sich vor dem Sitzenden. „Sträfling 3782, mein Fürst!“ Er winkte Mitja heran, der mit gesenktem Kopf vortrat.
Der Fürst betrachtete ihn und blätterte dann in einem Folianten, den einer seiner Schreiberlinge vor ihm abgelegt hatte. Ein anderer stellte ein Tintenfass und eine Schreibfeder daneben.
„Sträfling 3782?“ Der Fürst hob fragend die Augenbrauen.
Mitja nickte und zeigte seinen tätowierten Handrücken.
Der Fürst sah auf das Geschriebene in dem Folianten und las laut: „Demetrius, Sohn von Raik und Anchelika aus dem Fürstentum Aheelia?“
Mitja blickte auf. Es war lange her, dass ihn jemand bei seinem Geburtsnamen genannt hatte: Demetrius. „Ja“, bestätigte er mit rauer Stimme.
Der Fürst oder König – Mitja wusste es nicht genau – ließ sich gegen die Stuhllehne zurücksinken und betrachtete ihn. „Wie alt bist du, Demetrius?“
Mitja war verwirrt. „Ich … ich weiß es nicht, mein Fürst.“
„Du weißt es nicht?“ Erstaunt zog der Fürst die Stirn in Falten. „Weißt du denn wenigstens, wie lange du schon hier im Straflager bist?“
Mitja räusperte sich. „Nein, mein Fürst. Ich habe aufgehört, die Winter zu zählen.“
Schweigen trat ein. Dann sagte der Fürst: „Ich will es dir also sagen, Demetrius. Es sind sieben Winter! Du bist seit sieben Wintern hier. Und da du sechzehn Winter alt warst, als man dich verurteilt hat, zählst du nun dreiundzwanzig Winter.“
Mitja blinzelte erstaunt. Sieben Winter? Nur? Er fühlte sich wie ein Greis. Als stünde er bereits mit einem Bein im Grabe.
„Warum bist du im Straflager, Demetrius?“
Mitja wagte es, dem Fürsten kurz in die Augen zu blicken. Er wirkte wohlgesonnen, beinahe amüsiert.
Mitja hustete zweimal, um seine Kehle vom Staub des Steinbruchs zu befreien. „Ich wurde … ich wurde für den Mord an einem freien Mann verurteilt.“ Er befeuchtete seine von der Kälte aufgesprungenen Lippen. „Und … und für den Mord an einer freien Frau.“
„Verurteilt wozu?“, fragte der Fürst.
„Zum Tode“, antwortete Mitja.
„Und doch lebst du noch. Wie kommt das?“
„Ich weiß nicht, mein Fürst.“
Der Fürst schnaubte belustigt. „Ich will dir auch das sagen. Der Herrscher deines Fürstentums hat damals ein gutes Wort für dich eingelegt und erbeten, dass du, anstatt enthauptet zu werden, den Rest deines Lebens im Straflager verbringen und deine Kräfte damit dem König in Demut zur Verfügung stellen sollst.“ Er blätterte ein paar Seiten zurück und ließ seinen Blick über die Tabellen in seinem Folianten wandern. „Es ist hier außerdem vermerkt, dass du vor fünf Wintern einen recht ansehnlichen Brocken Asren zutage gefördert hast. Ist das wahr?“
Mitja entsann sich kaum noch des fingernagelgroßen, blau schimmernden Steins, den er damals in der Hand gehalten hatte. Aber er nickte.
Der Fürst betrachtete ihn forschend. „Kennst du unser Gesetz, Demetrius? Die Sträflinge in Asren-Minen betreffend?“
„Nein, mein Fürst.“
Der Fürst seufzte. „Nicht viele überleben sieben Jahre in den Steinbrüchen“, sagte er. „Um genau zu sein, hatten wir den letzten …“ Er blätterte ein paar Seiten zurück. „… vor dreizehn Wintern. Es gibt eine Klausel in unserem Gesetzbuch, die besagt, dass das Straflager einem Todesurteil gleichkommt. Wer jedoch nach sieben Jahren in den Asren-Steinbrüchen noch lebt, der hat eine zweite Chance verdient. Denn er hat dann jedem Fürstentum eines seiner Lebensjahre geopfert.“
Mitja blickte auf.
Der Fürst lächelte jetzt. „Demetrius“, sagte er. „Die Götter haben dir eine zweite Chance geschenkt. Du bist frei.“
„Was?“ Mitja konnte nicht fassen, was er da hörte.
„Du bist frei“, wiederholte der Fürst. „Du kannst gehen, wohin du willst. Aber bedenke: Eine dritte Chance wird es nicht geben. Solltest du mir, einem anderen Fürsten oder dem König noch einmal als ein Schuldiger unter die Augen treten, wirst du deinen Kopf verlieren. Hast du das verstanden?“
Mitja nickte, obgleich er nichts begriffen hatte.
Der Fürst langte nach der Schreibfeder, tauchte sie in das Tintenfass und machte einen Vermerk in den Folianten. „Es scheint da jemanden zu geben, der dich nach all der Zeit noch immer nicht vergessen hat“, sagte er, während er schrieb. „Jemanden, der mich jedes Jahr erneut auf diese Siebenjahresklausel hingewiesen und eine Prüfung der betreffenden Fälle eingefordert hat.“ Einer der Gehilfen reichte dem Fürsten eine Schriftrolle, auf der bereits etwas aufgesetzt stand. Der Fürst machte sein Zeichen darunter, tropfte blaues Wachs daneben und drückte seinen blau funkelnden Siegelring darauf.
„Mit Erfolg“, sagte er und lächelte. „Dein Freibrief. Mögen die Götter mit dir sein, Demetrius.“
Damit erhob er sich, griff nach seinem Mantel aus Wolfsfell und warf ihn sich über die Schultern. Seine Schreiberlinge packten eilig Tintenfass, Feder und Folianten zusammen. Auf dem Tisch verblieben lediglich die gesiegelte Schriftrolle, ein leerer Weinbecher und der Teller mit den abgezausten Knochen.
„Barabas“, sagte der König im Hinausgehen zum Aufseher. „Sorge dafür, dass Demetrius eine Reiseausrüstung bekommt, damit er ziehen kann, wohin er will.“
Der Aufseher verneigte sich, und die Asrenfibel, die ihn als Krieger der sieben Fürstentümer auswies, funkelte dabei an seinem Gewand. „Ja, Fürst.“
Die Gesellschaft verließ die Baracken. Man hörte ihre Stimmen, das nervöse Scharren und Schnauben der Pferde und schließlich den sich entfernenden Hufschlag.
Mitja stand noch immer am selben Fleck, ungläubig auf die Schriftrolle blickend, seinen Freibrief. Er trat an den Tisch und wollte das Pergament in die Hand nehmen, entsann sich dann jedoch der Fleischreste auf dem Teller. Hastig griff er zuerst nach den fettigen Knochen und stopfte sie in seine Hosentaschen. Dann leckte er sich verstohlen die Finger und nahm schließlich die Schriftrolle in die Hand, als handelte es sich um etwas sehr Zerbrechliches.
Ein Unteraufseher kam herein und ließ ein Bündel vor Mitjas Füße fallen. „Deine Ausrüstung“, sagte er barsch. „Jetzt mach, dass du verschwindest.“
„Jetzt?“, fragte Mitja und bückte sich nach dem kleinen Bündel. Es war sehr leicht. „Aber … wo soll ich denn hin?“
„Nicht mein Problem“, sagte der Unteraufseher, packte ihn am Oberarm und schubste ihn aus der Baracke. „Du hast hier im Lager nichts mehr verloren. Barabas hat befohlen, dass wir die Hunde auf dich hetzen sollen, wenn du bis zur Nacht nicht verschwunden bist.“
„Es ist Winter!“, beschwerte sich Mitja. „Wir sind hier mitten im Nirgendwo! Ich erfriere, wenn ich die Nacht dort draußen verbringen muss.“
„Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Das ist nicht mein Problem. Wenn dir an deinem Leben liegt, dann rate ich dir, die Beine in die Hand zu nehmen. In drei Stunden geht die Sonne unter.“ Seine Augen waren mitleidlos. Mitja wusste, dass die Sträflinge für die Aufseher nichts anderes als Sklaven waren. Selbst ihre Pferde und Hunde behandelten sie besser. Der gesiegelte Freibrief würde ihm hier nichts nützen.
Mitja schulterte also das Bündel und schob die Schriftrolle unter sein verschwitztes Hemd. Dann wandte er dem Lager den Rücken zu und hinkte in die eisige Tundra hinaus.
DIE FREMDEN
NERI, VOR ELF WINTERN
Neris Vater liebte es, mit seinen Händen Arbeiten zu tun, die großer Aufmerksamkeit bedurften – und keiner Gesellschaft. Er sprach selten, und wenn man sich in seiner Nähe aufhielt, war es unmöglich, seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Auch dann, wenn man ihn weder hörte noch sah. Er hatte etwas an sich, das die Luft mit Schwere erfüllte, mit einer Dichte, die man nicht ignorieren konnte.
Manchmal legte sich diese Dichte auf seine Umgebung nieder wie Morgentau auf Gräser. Und genau wie die Grashalme sich neigten, spürte auch Neris Wahrnehmung diese Last. Und nicht nur sie. Die Hühner stoben dann gackernd vor ihm davon, und die Raben in den Bäumen begannen Warnrufe auszustoßen. Für Neri jedoch fühlte es sich tröstlich an, wenn die Dichte ihres Vaters die Luft erfüllte, denn dann wusste sie, dass sie nicht alleine war.
Ihre Mutter dagegen machte diese Dichte unruhig. Wenn sie sie wahrnahm, schimpfte sie oft und wurde fahrig. Neri vermutete, dass ihr Vater deshalb stets in den Wald verschwand, sobald sich die Dichte manifestierte. Er wollte ihre Mama nicht ängstigen. Und wenn er nach vielen Stunden zurückkehrte, war die Schwere wieder von ihm abgetropft, genau wie der Tau, der unter Sonne und Wind verdunstet war. Meist brachte ihr Vater dann auch Fleisch mit: ein Reh, einen Hasen, ein Rebhuhn, manchmal sogar ein Wildschwein. Die Tage nach der Dichte waren fett und üppig.
Neri wusste, dass ihre Eltern sich innig liebten. Das konnte sie sehen, wenn sie sich im Vorübergehen küssten oder am Abend auf der Bank vor dem Haus ihre Hände hielten. Auch in der Nacht, wenn sie glaubten, dass Neri schon schliefe, und zärtlich in ihrem Schlaflager flüsterten. Aber während der langen Sommertage und der noch längeren Winternächte wurde das Schweigen manchmal drückend. Und wenn Neris Mutter es nicht mehr aushielt, dann fing sie an zu singen, um es zu brechen. Sie sang von Maiden, die auf ihre Geliebten warteten, von Kindern, die nicht einschlafen konnten, weil der Winterwind heulend ums Haus strich. Und manchmal auch von Festen, von Zusammenkünften vieler Menschen, von Musik und Tanz – alles Dinge, die Neri nur aus diesen Liedern kannte. Obwohl es freudige Geschichten waren, klangen sie mit der Stimme ihrer Mutter irgendwie traurig.
Einmal hatte die Mutter geistesabwesend ein Lied gesungen, das von einem Krieger handelte, der auszog, um eine Bestie zu töten, die ihm die Verlobte geraubt hatte. Neri war davon begeistert. Sie hatte sich jede Strophe eingeprägt, und die Melodie war ihr tagelang im Kopf herumgegangen. Doch als sie Mama am nächsten Abend bat, das Lied noch einmal für sie zu singen, stimmte die Mutter stattdessen ein altes Wiegenlied an.
„Nein!“, rief Neri und stampfte mit dem Fuß auf. „Nicht das! Ich möchte das andere Lied hören. Das mit der Bestie und dem Krieger!“
Da verstummte die Mutter, und Neri spürte, wie die Luft um das Feuer immer dichter wurde. Sie blickte zu ihrem Vater hinüber, der in den Schatten der Wohnküche auf einer Bank saß und an einer neuen Tierfigur schnitzte. Mitten in der Bewegung hatte er innegehalten und starrte nun auf die halb fertige Schnitzerei, als hielte er besagte Bestie in den Händen.
Mama räusperte sich. „Nicht jetzt, Neri!“
Sie sagte es mit jenem Unterton in der Stimme, der Neri aufhorchen ließ. Ihr Vater legte Messer und Figur beiseite und verließ wortlos das Haus.
Die Mutter sah ihm nach und winkte Neri zu sich. „Wenn Papa zu Hause ist, dürfen wir dieses Lied nicht singen“, erklärte sie. „Wir dürfen nicht einmal darüber sprechen. Verstehst du, Kind?“
„Warum denn nicht?“, fragte Neri.
„Weil Papa dieses Lied nicht mag.“ Mama strich ihr sanft die langen honigblonden Strähnen aus dem Gesicht. Es war die gleiche Haarfarbe wie ihre eigene. Nur an der Schläfe trug ihre Mutter stets einen dünnen geflochtenen Zopf. Und nur eine Strähne davon war dunkelbraun wie das Haar ihres Vaters. „Es stimmt ihn traurig“, sagte Mama. „Und du willst Papa doch nicht traurig machen, oder, Neri?“
Sie schüttelte den Kopf. Nun fühlte sie sich schuldig, denn nichts wollte sie weniger, als ihre Eltern traurig zu machen.
Sie sprachen nie wieder von diesem Lied. Nur in Gedanken und mit ihren Spielfiguren stellte Neri manchmal heimlich die Szenen daraus nach, wenn sie wusste, dass ihr Vater nicht daheim und ihre Mutter woanders beschäftigt war. Vergessen hatte sie dieses Lied jedoch nie.
Eines Tages im Herbst, als die fallenden Blätter wehmütig raschelten, fragte Neri ihre Mutter, woher sie all diese Lieder denn kenne. Seit Neri denken konnte, lebten sie ja auf dieser Lichtung tief in den Wäldern des Waldfürstentums Aheelia.
Die Mutter lächelte und sagte, wie immer nicht ohne eine gewisse Traurigkeit in ihrem Ton: „Na, von meiner Mutter. Und von meiner Großmutter. Als ich ein Kind war, haben sie mir genauso vorgesungen, wie ich dir nun vorsinge.“
„Aber wo sind sie denn jetzt?“, fragte Neri, entzückt von dem schier unvorstellbaren Gedanken, ihre Mutter könnte einmal ein Kind wie sie gewesen sein und eine eigene Mutter und sogar eine Großmutter gehabt haben. „Kommen sie uns bald einmal besuchen?“
Das Lächeln im Gesicht der Mutter erstarb. „Nein, sie werden uns nie besuchen kommen.“
„Aber warum nicht?“ Neri musste sich beherrschen, um nicht vor Aufregung auf und ab zu hüpfen. „Das wäre doch ganz wunderbar!“
„Ja, das wäre es wohl“, bestätigte die Mutter. „Aber sie können nicht zu uns kommen. Sie wissen ja gar nicht, wo wir sind.“
„Dann … dann sagen wir es ihnen einfach!“, schlug Neri vor.
„Das können wir nicht.“
„Oh bitte! Ich würde sie so gerne kennenlernen!“
Wieder schüttelte Mama den Kopf. Alle Fröhlichkeit war nun aus ihrem Gesicht verschwunden. „Oh, auch ich wünschte, wir würden bei ihnen leben wie ganz normale Leute.“ Sie sagte es leise, fast wie zu sich selbst.
„Mama?“ Neri legte die Hand auf den Arm ihrer Mutter. Sie spürte, dass es dieser nun gar nicht gut ging, und wollte sie trösten.
Doch ihre Mama stand auf. „Geh und hole ein paar Scheite Holz aus dem Schuppen.“
Diesen Ton kannte Neri. Wenn sie sich nicht beeilte, würde Mama böse werden. Also eilte sie hinaus. Aber eines war ihr in diesem Gespräch klar geworden: Es schien Mama unglücklich zu machen, über die Vergangenheit zu sprechen, über ihre eigene Mutter und Großmutter. Für Neri waren dies fremde Frauen, geheimnisvolle Schemen, nach denen sie sich sehnte, ohne zu begreifen warum.
Das Leben in der Abgeschiedenheit der Lichtung tief in den Wäldern war offenbar nicht das, was ihre Mutter sich wünschte. Aber dennoch blieb sie dort. Das wunderte Neri manchmal, vor allem als sie älter wurde und die Traurigkeit schon tiefe Falten in das liebe Gesicht ihrer Mutter gegraben hatte.
Doch nicht lange danach bekam Neri eine erste Ahnung davon, warum ihre Mutter nicht fortgehen wollte.
* * *
Es war am Beginn von Neris zehntem Winter. Die Felle von Hase, Fuchs und Hermelin waren bereits weiß geworden, als Neri auf der Bank vor dem Haus saß und Bienenwachs in ihre Stiefel einrieb, gegen die Nässe und damit das Leder trotz der frühwinterlichen Feuchtigkeit weich und geschmeidig blieb.
Vom Wald her schallten plötzlich Stimmen auf die Lichtung. Fremde Stimmen von Männern, die sich so laut unterhielten, dass jedes Tier im Umkreis von fünfhundert Schritten die Flucht ergreifen musste. Neri, die nur die Geräusche des Waldes und die Stimmen ihrer Eltern gewohnt war, zuckte zusammen. Die Männer waren zu dritt und ritten mit ihren Pferden so selbstverständlich auf die Lichtung, als gehörte sie ihnen.
„He, Mädchen!“, rief einer sie an. „Hole den Herrn dieses Hauses! Wir verlangen achtbare Kost und eine Unterkunft für die Nacht, wie es Brauch in den Fürstentümern ist!“ Er hatte eine unangenehm laute Stimme, und sein dunkler Bart stand struppig von seinen Wangen ab. Seine Begleiter wirkten ebenso ungepflegt. Es waren grobschlächtige Männer, gekleidet in Felle und Leder, so wie Neri und ihre Eltern.
„Hast du nicht gehört? Oder bist du schwachsinnig, Kleine?“, fragte ein anderer. Seine hellen Augen hatten etwas Stechendes. Und obwohl er lächelte, machte er Neri Angst.
Der Dritte lachte verhalten. „Würde mich nicht wundern, hier draußen. Und so wie ihr staunend das Maul aufklafft, kann sie ja nicht viel im Kopf haben.“ Er war der größte der drei.
Neri schloss ihren Mund. Der strenge Geruch von Männerschweiß und ungewaschenem Haar stieg ihr in die Nase. Und dann war da noch etwas Scharfes, Beißendendes, das sie nicht kannte. Ehe die drei noch etwas sagen konnten, flitzte sie flink wie ein Wiesel davon. Sie rannte zu ihrer Mutter, die unten am Bach auf den Steinen kniete und die Wäsche auswrang. Das Rauschen des Gewässers war so laut, dass sie die Fremden nicht gehört haben konnte.
„Da ist jemand!“, rief Neri atemlos und zeigte zurück zur Lichtung, die von hier aus nicht zu sehen war.
Mama richtete sich auf, die Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt. Sie knotete die hochgebundenen Röcke auf, um sie herunterzulassen, und strich sich die graue Schürze glatt. „Waldläufer?“
Neri nickte. Ihr Herz trommelte in den Ohren, und es war nicht nur wegen des schnellen Laufs. Wie lange war es eigentlich her, dass sie zuletzt Fremde gesehen hatte? Einen ganzen Winter schon? Oder gar zwei? Es kam so selten vor, dass Menschen sich bis zu ihnen hinaus verirrten. Meist waren es Fallensteller oder Reisende, die versehentlich vom Hauptweg abgekommen und auf einem der Trampelpfade gelandet waren, die zur Lichtung von Neris Eltern führten.
Mama ging mit schnellen Schritten auf das Haus zu.
Neri folgte ihr auf dem Fuße und zupfte sie am Rock. „Aber Papa ist doch nicht da!“, gab sie zu bedenken und versuchte nach der Hand ihrer Mutter zu greifen. Aber Mama schien Neri nicht zu hören. Sie ging einfach weiter.
Auf der Lichtung angekommen blieb sie jedoch abrupt stehen. „Das sind ja drei!“ Jetzt klang sie verunsichert. Waldläufer waren fast immer allein unterwegs. Aber jetzt war es zu spät. Die drei Männer hatten sie bereits bemerkt.
„Na so was! Wer hätte gedacht, dass sich in Aheelias Wäldern solche Schönheiten herumtreiben?“, plärrte der Große. Obwohl es ein Kompliment war, hinterließ die Bemerkung ein ungutes Gefühl in Neri.
„Gute Frau!“, sagte der mit der lauten Stimme schmeichlerisch und nahm seine Mütze vom Kopf. „Wie es Brauch ist, bitten wir um Kost und ein Quartier für die Nacht.“ Er grinste breit und zeigte seine Zahnlücken. Neri wünschte, ihr Vater würde bald heimkommen.
Die Mutter richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. „Seid willkommen!“, sagte sie und schritt auf die Männer zu. „Wir haben nicht viel anzubieten, aber wir wollen euch gerne bewirten. Ich rate euch jedoch, die Nacht nicht in diesem Tal zu verbringen, sondern weiter hinunter nach Osten zu reiten. Dort werdet ihr bald auf eine Straße stoßen, die –“
„Das wissen wir, Frau!“, unterbrach sie der mit dem struppigen Bart.
Die Mutter presste die Lippen aufeinander und schob sich an den Männern vorbei ins Haus. Die drei folgen ihr. Neri betrat als Letzte die große Wohnküche, mit der offenen Feuerstelle. Verunsichert blieb sie neben der Tür stehen, ohne sie zu schließen, und beobachtete, wie es sich die drei Fremden am Tisch bequem machten, während die Mutter in der Glut stocherte, um sie anzufachen, und dann einen Kessel darüber hängte. Aus einer Kanne goss sie Wasser hinein.
„Was soll das denn werden, Frau?“, fragte der Große. „Willst du uns nur warmes Wasser anbieten?“
Die Mutter richtete sich steif auf. „Ich werde einen Kräutertee zubereiten, wenn es genehm ist. Dazu gibt es Eintopf.“ Sie wandte sich an Neri. „Schließ die Tür, Kind. Du lässt ja die Kälte herein.“
Neri tat es und half ihrer Mutter dann mit dem schweren Kessel und den Speisen.
„Tee, hä?“, fragte der mit der lauten Stimme. „Hast du nichts Stärkeres? Bier oder Met?“
Die Mutter schüttelte den Kopf. „Wir haben keinen Alkohol im Haus.“
„Soll das ein Scherz sein? Wir Waldläufer sind doch alle gestandene Trinker!“ Die drei lachten und klopften sich auf die Schenkel.
Die Mutter lachte nicht mit. Sie griff nach dem großen Kessel, den Neri ihr reichte, und hängte ihn neben den kleineren.
„Und wie sieht es mit Fleisch und Brot aus? Du denkst doch wohl nicht, dass dein verkochtes Gemüse uns satt macht.“
„Es ist alles, was wir haben“, sagte die Mutter, nun hörbar eingeschnappt. „Wenn es den Herren nicht genehm ist, können sie ja anderswo um Speise und Trank bitten.“
Die Augen des Bärtigen funkelten belustigt. „Im Umkreis von einem Tagesritt gibt es kein anderes Haus in diesen Wäldern. Das weißt du so gut wie ich, Frau.“
Die Mutter schwieg.
„Vielleicht sollten wir uns die magere Kost mit etwas Spaß versüßen“, schlug der Große vor. „Der Abend ist ja noch lang.“
Die drei tauschten Blicke. Neri bemerkte, wie die Bewegungen ihrer Mutter hektischer wurden. Die Fremden schwiegen nun, die glänzenden Augen auf den Rücken ihrer Mutter gerichtet.
„Neri, decke den Tisch“, sagte Mama und rührte im mittlerweile dampfenden Eintopf.
Neri ging zum Schrank und holte Schüsseln, Löffel und Becher heraus. Die Männer beachteten sie nicht, als sie das irdene Geschirr vor ihnen verteilte. In der stehenden warmen Luft der Wohnküche war der Gestank der drei so durchdringend, dass Neri die Nase rümpfte.
Die Mutter kam mit dem heißen Eintopf, begab sich von einem zum anderen und schöpfte mit der Kelle eine kräftige Portion in ihre Schüsseln. Als sie zurück zum Feuer gehen wollte, hielt der Letzte sie am Arm fest.
„Wie heißt du eigentlich, Frau?“, fragte er.
Die Mutter machte sich von ihm los. „Emina.“
„Emina!“ Der Mann grinste. Einer seiner Schneidezähne war abgebrochen. „Setz dich doch zu uns, Emina.“
Mama schüttelte den Kopf und hing den Kessel wieder über das Feuer. Sie strich sich den geflochtenen Zopf mit der dunklen Haarsträhne hinters Ohr. „Mein Mann wird bald nach Hause kommen“, sagte sie wie nebenbei.
Die Fremden erwiderten nichts, wurden jedoch schweigsamer. Während sie aßen, machten sie dennoch ungewohnt viel Lärm. Sie schnieften, rülpsten und schlürften, während die Mutter die Kräuter aus dem Tee abschöpfte und ihn mit etwas von dem wertvollen Honig versüßte, der aus den Bienenstöcken hinter dem Haus stammte. Als die Männer mit dem Essen fertig waren, goss sie ihnen süßen Tee in die Becher.
„Und der Nachtisch?“, fragte der Große.
„Ich habe sonst nichts.“
Er umfasste ihre Taille und zog sie zu sich heran. „Nun, das würde ich nicht sagen. Du hast doch einiges zu bieten.“
Mama schubste den Fremden von sich. Er haschte nach ihr, sie widersetzte sich, und in dem kurzen Handgemenge schwappte der heiße Tee aus dem Kessel und dem Bärtigen in den Schoß.
Fluchend sprang er auf. „Verdammt, Frau! Pass doch auf!“ Er wischte hektisch über seine nasse Hose.
Auch die anderen beiden waren nun aufgestanden, der eine nahm der Mutter den Kessel aus der Hand und stellte ihn auf den Tisch. „Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben genug von deinem Tee.“
Der Bärtige drängte sie vom Tisch ab in Richtung der abgehängten Bettstatt ihrer Eltern. „Ziere dich nicht so wie eine Jungfer!“, sagte er dabei.
Angst zeichnete sich nun in Mamas Gesicht ab. „Ist das etwa euer Dank für die erwiesene Gastfreundschaft?“ Ihre Wangen waren gerötet, und Neri hörte das Zittern in ihrer Stimme.
„Mama!“, rief sie und wollte sich an ihre Seite drängen. Doch einer der drei Männer stieß sie so grob weg, dass Neri gegen die Sitzbank prallte.
„Verschwinde, Balg!“, knurrte er, ohne sie anzusehen.
„Geh bitte, Neri!“, sagte nun auch Mama, die mit dem Rücken gegen die Trennwand stand. Die drei hatten sie umzingelt.
„Aber, Mama!“ Neri wollte ihre Mutter auf keinen Fall alleine lassen.
Sie sah zu, wie der Große Mama gegen die Wand drückte und die anderen versuchten, ihr die Röcke hochzuschieben. Die Mutter wand sich. Als der Bärtige ihr das Mieder aufriss, begann sie zu schreien.
Neri fürchtete sich, wie sie sich in ihrem ganzen Leben noch nie gefürchtet hatte. Und doch war es ihr unmöglich davonzurennen. Diese Männer taten ihrer Mutter weh! Mitgerissen von einer Mischung aus Zorn und Angst, sprang sie den ihr am nächsten Stehenden an und grub ihre Zähne tief in seinen Unterarm. Der Mann schrie auf und schleuderte sie von sich. Neri polterte mit dem Rücken gegen die Wand. Die Luft blieb ihr weg, aber sie rappelte sich auf und wollte sich erneut auf den Mann stürzen, als plötzlich die Haustür so heftig aufgerissen wurde, dass sie gegen die Holzwand knallte.
Neris Vater stand im Raum. Er schien das Haus bis in die hintersten Ecken auszufüllen, und seine Wut prickelte auf Neris Haut, als wäre sie in die Brennnesseln gefallen. Sie ging unter dem Tisch in Deckung. Noch nie hatte sie ihren Vater so zornig gesehen. Als die drei Fremden ihn erblickten, rissen sie entsetzt die Augen auf und ließen von ihrer Mutter ab. Sie drängten sich alle gleichzeitig an ihm vorbei und stürmten aus dem Haus. Nach einem kurzen Blick auf Mama setzte Papa ihnen nach.
Neri hörte die Schreie der Männer, erst auf der Lichtung, dann weiter weg im Wald. Schließlich war es still. Nur das Schluchzen der Mutter war noch zu hören, die an der Wand herabgeglitten war und das Gesicht in die Hände drückte. Neri krabbelte zu ihr hin und schmiegte sich an sie.
Als Papa zurückkehrte – zerkratzt, verschwitzt und mit schmutzig braunen Flecken auf Hemd, Hose, Gesicht und Armen –, war er wieder wie immer, der schweigsame Ruhepol ihrer kleinen Familie. Doch in seinen Augen glomm noch ein kleines Feuer, als er sich vor Mama hinhockte und ihr das wirre Haar aus dem Gesicht strich. „Haben sie euch etwas angetan?“
Mama schüttelte den Kopf und schniefte.
Papa beugte sich vor und küsste sie sanft auf die Wange. Dann zog er sie auf die Beine. Neri wuschelte er durch die Haare.
Das war alles. Mama richtete ihre Frisur und begann aufzuräumen, Papa stellte die Möbel wieder zurecht, wusch sich Gesicht und Arme und zog ein sauberes Hemd an. Neri ging früh schlafen.
Aber etwas hatte sich verändert. Nächtelang plagten sie Albträume. Die Angstschreie ihrer Mutter, die furchteinflößenden Männer ließen nicht mehr von ihr ab. Sie hatten ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Fremden in ihr geweckt. Neri hatte nie zuvor die Erfahrung gemacht, dass jemand seine körperliche Überlegenheit ihr oder ihrer Mutter gegenüber auszunutzen versuchte. Mit einem Mal fühlte sie sich bedroht. Der Einzige, der sie vor solchen Gefahren schützen konnte, war Papa. Flucht schien ihr keine wirkliche Alternative. Sie machte sie nur noch schutzloser. Aber Waffen? Ja, Waffen! Neri begriff plötzlich, dass Werkzeuge und Jagdinstrumente auch dazu dienen konnten, Leib und Leben zu verteidigen.
Am nächsten Morgen rückte sie einen Schemel an die Wand, stieg darauf und streckte sich, um den Bogen ihres Vaters von der Halterung zu nehmen. Papa, der gerade am Tisch seine Morgenmahlzeit einnahm, hielt im Kauen inne und hob die Augenbrauen. „Was soll das denn werden?“
Neri legte den Bogen vor ihrem Vater auf den Tisch. „Ich will lernen, damit zu schießen“, verlangte sie.
Papa kaute weiter und senkte den Blick auf den Teller. „Nein.“
„Warum denn nicht?“
„Du bist zu jung.“
„Bin ich nicht“, beharrte Neri.
„Du bist ein Mädchen.“
„Na und?“
Ihr Vater schüttelte den Kopf.
Aber Mama hielt überraschend zu ihr. „Was schadet es denn, Karew? Zeig es ihr doch.“
Papa seufzte. Und weil Neri ihm keine Ruhe mehr ließ, ging er schließlich mit ihr hinaus, stellte ein Riedbündel als Ziel auf und spannte die Sehne in den Bogen. Dann reichte er Neri die Waffe zusammen mit einem Pfeil. Sie versuchte, den Bogen so zu halten, wie sie es bei ihrem Vater gesehen hatte. Aber die Spannkraft der Sehne war zu stark, und ihr erster Pfeil trudelte durch die Luft wie eine angeschossene Ente.
Papa schwieg. Seiner Miene war deutlich anzusehen, was er davon hielt. Neri gab jedoch nicht auf. Und nachdem Papa einige Male ihre Haltung korrigiert und ihr erklärt hatte, wie sie ihr Ziel anvisieren sollte, wurde sie mit jedem Schuss ein wenig besser. Von Zielsicherheit, selbst auf kurze Distanz, war sie jedoch noch immer weit entfernt. Bald schmerzten ihr die Arme. Und wenn sie nun zu zielen versuchte, zitterten ihre Muskeln so sehr, dass sie den Pfeil wieder sinken ließ.
Papa drückte ihr die Schulter. „Mach dir nichts draus, Kleines. Dieser Bogen ist viel zu groß für dich, und die Pfeile sind zu lang.“
„Kannst du mir nicht einen passenden Bogen bauen, Papa?“
„Bauen?“ Ihr Vater lachte. „Der Bogenbau ist eine Kunst!“ Er strich mit den Fingern über das geölte Holz seiner Waffe. „Ich habe es nie gelernt. In Aheelia gibt es einen Bogenbauer, von dem alle sprechen. Aber ich zweifle daran, dass er Bögen für Kinder herstellt. Und selbst wenn …“
Er sprach nicht weiter, aber Neri wusste bereits, dass alles, was von anderen Menschen gemacht wurde und seinen Weg zu ihnen in den Wald fand, seinen Preis hatte. Sie wollte ihren Vater nicht in Verlegenheit bringen und bemühte sich um ein Lächeln, das ihre Enttäuschung aber kaum verbarg.
* * *
Einige Tage später saß Neri auf dem Vorplatz des Hauses und spielte mit ihren geschnitzten Tierfiguren.
„Schau mal, was ich gefunden habe!“, rief Papa plötzlich vom Waldrand herüber.
Neri sprang auf und rannte zu ihm. In seinen Händen hielt er, in ein Tuch gewickelt, einen riesigen schwarzen Vogel. Nur Hals und Kopf, mit einem kräftigen Schnabel und lebhaften dunklen Augen, schauten aus dem Bündel hervor.
Neri quietschte vor Entzücken. „Was ist das?“, rief sie.
Der Vogel zuckte ängstlich in seinem Bündel und stieß ein lautes Krächzen aus.
„Schrei nicht so herum, du erschreckst ihn ja“, rügte Papa. „Es ist ein Rabe. Er ist verletzt und kann nicht fliegen. Wir werden ihn bei uns behalten und gesund pflegen.“
Der Rabe plusterte die Federn an Hals und Kopf. Der Schnabel stand nun leicht geöffnet, und Neri konnte seine Zunge sehen.
„Wie heißt er denn?“, fragte sie.
„Das weiß ich nicht“, gab Papa zurück und klang ein wenig traurig dabei. „Er hat es vergessen.“
„Vergessen? Wie kann man denn seinen eigenen Namen vergessen?“, fuhr Neri auf.
„Ja, das ist eine schlimme Sache, wenn einem das passiert.“ Papa strich dem Raben über die Federn. „Merk dir das, Neri. Pass auf, dass dir dein Name niemals entfällt. Hörst du?“ Er wandte sich ihr zu. „Und wenn es doch geschieht, dann tust du gut daran, wenn es jemanden gibt, der dich an ihn erinnern kann.“
Neri lachte. „Na, dann ist’s ja gut, dass ich dich und Mama habe. Aber ich glaube, mir würde so etwas nie passieren. Meinen eigenen Namen vergessen … also wirklich!“ Sie lachte noch einmal.
Ihr Vater lachte nicht. Aber er wuschelte ihr durchs Haar und sagte: „Nein, dir passiert so etwas sicher nicht. Niemals, mein Kind.“
„Warum geben wir dem Raben nicht einfach einen neuen Namen?“, fragte Neri. „Und wenn er den dann auch vergisst, können wir ihn immer daran erinnern.“
Nun lächelte ihr Vater. „Wenn du magst. Wie soll er denn heißen?“
Neri dachte nach. Dann rief sie: „Finneas! Wie der Junge aus Mamas Geschichte, der immer vergisst, wie er nach Hause zurückfindet.“ Es war ein Kindermärchen, über das Neri sich jedes Mal furchtbar aufregte, wenn ihre Mutter es erzählte. Denn es war ihr einfach unerklärlich, wie man den Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. Wenn man sich verlief, dann ging man doch einfach die eigene Fährte wieder zurück. Das wusste sie selbst mit ihren zehn Wintern schon.
Finneas indessen blieb. Selbst nachdem sein Flügel geheilt war, hielt er sich meist in der Nähe der Lichtung auf. Mit ihm auf der Schulter saß Papa von nun an viele laue Sommerabende lang schweigend auf der Bank vor dem Haus. Neri durfte die beiden dann nicht stören.
Aber sobald der Rabe fortflog und ihr Vater ins Haus zurückkehrte, fragte sie stets: „Und?