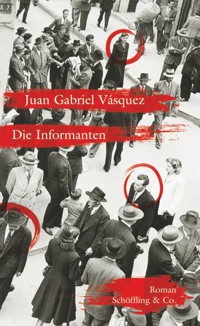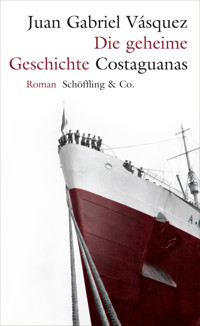
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ende des 19. Jahrhunderts scheint die Welt einen neuen Mittelpunkt zu bekommen, weit weg von ihren bisherigen Zentren: In Panama, dem äußersten Zipfel Kolumbiens, wird ein Kanal gebaut, der die Weltmeere verbinden soll. Frankreich und die Vereinigten Staaten stürzen sich auf diesen Ort, der bis dahin nur für sein entsetzliches Klima und unzählige Tropenkrankheiten bekannt war. Hier ringen Europa und die USA um Reichtum und Macht. Doch nicht nur die Weltpolitik, auch Joseph Conrad, der seefahrende Romancier, entdeckt diesen Ort für sich. Ließ er sich von der Geschichte Kolumbiens und dem Bau des Panamakanals zu seinem Roman Nostromo inspirieren? In Konkurrenz mit ihm tritt José Altamirano, gebürtiger Kolumbianer, dessen Leben inmitten von Katastrophen und politischen Umbrüchen einen tragikomischen Gegenpart zu dem des weltberühmten Schriftstellers bildet. Altamirano, der sich schuldig fühlt an der Niederlage seines Landes, zieht alle Register, um den großen Romancier zu überbieten. Eine Hommage an die Tradition des Abenteuerromans vom Autor von Die Informanten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
Erster Teil
I. Froschbäuche, Chinesen und Bürgerkriege
II. Die Offenbarungen der Antonia de Narváez
III. Joseph Conrad bittet um Hilfe
Zweiter Teil
IV. Die geheimnisvollen Gesetze der Refraktion
V. Sarah Bernhardt und der französische Fluch
VI. Im Bauch des Elefanten
Dritter Teil
VII. Tausendeinhundertachtundzwanzig Tage oder das kurze Leben eines gewissen Anatolio Calderón
VIII. Die Lektion der großen Ereignisse
IX. Die Bekenntnisse des José Altamirano
Anmerkung des Autors
Zitatnachweise
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
Für Martina und Carlota,die mit ihrem Buch unter dem Arm auf die Welt kamen.
Ich möchte Dir von dem Werk erzählen, an dem ich gerade arbeite. Ich wage meine Kühnheit kaum einzugestehen, denn es spielt in Südamerika, in einer Republik, die ich Costaguana nenne.
Joseph ConradBrief an Robert Cunninghame Graham
Erster Teil
Es gibt niemals einen Gott in einem Land, in dem die Menschen sich nicht selber helfen.
Joseph ConradNostromo
I. Froschbäuche, Chinesen und Bürgerkriege
Sagen wir es rundheraus: Der Mann ist tot. Nein, das reicht nicht. Ich will genauer sein: Der Romancier ist tot (mit Betonung auf »der«). Sie wissen, wen ich meine. Nein? Also noch einmal: Der große Romancier der englischen Sprache ist tot. Der große Romancier der englischen Sprache ist tot, ein gebürtiger Pole, erst Seemann, dann Schriftsteller. Der große Romancier der englischen Sprache ist tot, ein gebürtiger Pole, erst Seemann, dann Schriftsteller, der vom verhinderten Selbstmörder zum lebenden Klassiker wurde, vom gemeinen Waffenschmuggler zum Juwel der britischen Krone. Meine Damen und Herren: Joseph Conrad ist tot. Ich empfange die Nachricht wie etwas Vertrautes, wie einen alten Freund. Und dann wird mir, nicht ohne einen Anflug von Trauer, bewusst, dass ich mein ganzes Leben lang auf sie gewartet habe.
Während ich zu schreiben beginne, liegen alle Londoner Tageszeitungen (ihre mikroskopischen Buchstaben, das Gewirr ihrer schmalen Spalten) aufgeschlagen auf dem grünen Leder meines Schreibtischs. Durch die Presse, die so unterschiedliche Rollen in meinem Leben gespielt hat, es mal zu ruinieren drohte, mal seinen bescheidenen Glanz hervorhob, erfahre ich von dem Infarkt und seinen näheren Umständen, von der Krankenschwester Vinten, die eben noch bei ihm gewesen war, vom Schrei, den man im unteren Stockwerk hört, vom Körper, der aus dem Lesesessel kippt. Die sensationslüsternen Zeitungen lassen mich an der Beerdigung in Canterbury teilnehmen, die aufdringlichen Reporter zeigen mir, wie die Leiche in die Grube gesenkt und der Grabstein aufgestellt wird, dieser Grabstein mit all seinen Fehlern (ein falsch gesetztes c, ein vertauschter Vokal bei einem der Vornamen). Heute, am 7. August 1924, während man in meinem fernen Kolumbien den hundertfünften Jahrestag der Schlacht von Boyacá feiert, wird hier in England mit feierlichem Pomp das Hinscheiden des großen Romanciers beklagt. Während man in Kolumbien des Sieges der Unabhängigkeitskämpfer über die Streitkräfte des spanischen Imperiums gedenkt, wird hier, in der Erde dieses anderen Imperiums, für immer der Mann begraben, der mich bestohlen hat …
Aber nein.
Noch nicht.
Noch ist es zu früh.
Zu früh, um die Art und Weise des Diebstahls zu erklären, zu früh, um zu erklären, welches Gut gestohlen wurde, welches Motiv der Dieb hatte, welchen Schaden sein Opfer erlitt. Schon höre ich Fragen aus dem Parkett aufsteigen. Was kann ein berühmter Romancier mit einem armen, namenlosen Kolumbianer im Exil gemein haben? Geduld, werte Leser. Verlangen Sie nicht, anfangs schon alles zu erfahren, bohren Sie nicht, fragen Sie nicht, denn in dieser Geschichte wird der Erzähler ganz wie ein guter Familienvater nach und nach für das Nötige Sorge tragen … Mit einem Wort: Überlassen Sie alles mir. Ich werde entscheiden, wann und wie ich erzähle, was ich erzählen möchte, wann ich verschleiere, wann ich enthülle, wann ich mich aus Lust an der Freude in den Winkeln meines Gedächtnisses verliere. Ich werde Ihnen von unvorstellbaren Morden und unvorhersehbaren Galgentoden erzählen, von eleganten Kriegserklärungen und schlampigen Friedensschlüssen, von Bränden und Überschwemmungen, von intrigierenden Schiffen und verschwörerischen Zügen, und alles, was ich erzähle, wird Ihnen und mir selbst gewissermaßen Glied für Glied die Kette der Ereignisse erklären, die zu der Begegnung führten, die meinem Leben vorherbestimmt war.
Ja, genau, diese leidige Sache mit dem Schicksal trägt bei all dem ihr Quäntchen Verantwortung. Conrad und ich, die wir unzählige Meridiane voneinander entfernt auf die Welt kamen und von unterschiedlichen Hemisphären geprägt wurden, wir hatten eine gemeinsame Zukunft, die selbst dem größten Skeptiker auf Anhieb hätte ins Auge springen müssen. Wenn derlei geschieht, wenn zwei Menschen, die an so fern liegenden Orten geboren werden, dazu bestimmt sind, einander zu treffen, lässt sich ihre Route a posteriori verfolgen. In den meisten Fällen kreuzen sich die Wege nur einmal. Franz Ferdinand begegnet in Sarajevo Gavrilo Princip, und Opfer seiner Schüsse werden er, seine Frau, das 19. Jahrhundert und alle Gewissheiten des damaligen Europas. General Uribe Uribe begegnet in Bogotá zwei Bauern, Galarza und Carvajal, und stirbt kurz darauf nahe der Plaza de Bolívar, eine Axt im Schädel und auf den Schultern die Last mehrerer Bürgerkriege. Auch Conrad und ich sind nur an einem Punkt zusammengetroffen, wären uns jedoch um ein Haar schon viel früher begegnet. Dazwischen liegen siebenundzwanzig Jahre. Das gescheiterte Treffen, zu dem es beinahe gekommen wäre, aber nicht kam, gehört ins Jahr 1876, in die kolumbianische Provinz Panama; die andere Begegnung – die wahrhaftige, unselige – gehört in die letzten Novembertage des Jahres 1903 und hierher, in dieses imperiale Babel, ins dekadente London, in diese Stadt, in der ich schreibe und wo mich voraussichtlich der Tod einholen wird, in die Stadt des grauen Himmels und des Kohlegeruchs, in die ich aus Gründen kam, die zu erklären nicht einfach, aber unerlässlich ist.
Ich kam nach London, wie so viele Leute von so vielen Orten, auf der Flucht vor der Geschichte, die mir das Schicksal zugedacht hatte, oder vielmehr vor der Geschichte des Landes, das mir das Schicksal zugedacht hatte. Anders gesagt, ich kam nach London, weil mich die Geschichte meines Landes verstoßen hatte. Oder noch besser, ich kam nach London, weil hier seit langem schon keine Geschichte mehr stattfand, nichts passierte mehr in diesen Breiten, alles war schon erfunden und getan, jede Idee gedacht, alle Imperien errichtet, alle Kriege gefochten, so dass ich für immer sicher sein würde vor dem Schrecken der großen Augenblicke, die das kleine Leben bestimmen können. Herzukommen war somit ein legitimer Akt der Selbstverteidigung. Diejenigen, die über meine Taten zu urteilen haben, sollten das berücksichtigen.
Denn auch ich bin ein Schuldiger in diesem Buch, auch ich stelle mich der Anklage, obwohl der geduldige Leser noch einige Seiten vor sich hat, bevor er entdeckt, wessen ich mich beschuldige. Ich, der ich vor der großen Geschichte hierher floh, springe nun ein ganzes Jahrhundert zurück, um meiner kleinen Geschichte auf den Grund zu gehen, denn ich will versuchen, die Wurzeln meines Unglücks freizulegen. In jener Nacht, der Nacht unserer Begegnung, hörte Conrad eben diese Geschichte von mir, und nun, liebe Leser – Leser, die Sie mich richten werden – sind Sie an der Reihe. Auf diesem Fundament ruht mein Bericht: Alles, was Conrad erfuhr, sollen auch Sie erfahren.
(Aber da ist noch jemand anderes … Eloísa, auch für dich sind diese Erinnerungen, diese Bekenntnisse. Auch du sollst zu gegebener Zeit über meinen Freispruch oder meine Verurteilung befinden.)
Meine Geschichte beginnt im Februar 1820, fünf Monate, nachdem Simón Bolívar siegreich in die Hauptstadt meines jüngst befreiten Landes eingezogen war. Jede Geschichte hat einen Vater, und diese beginnt mit der Geburt des meinen. Don Miguel Felipe Rodrigo Lázaro del Niño Jesús Altamirano. Miguel Altamirano, unter Freunden bekannt als letzter Renaissancemensch, kam in Santa Fe de Bogotá zur Welt, dieser schizophrenen Stadt, die im Folgenden mal Santa Fe, mal Bogotá oder sogar Dieser-beschissene-Ort genannt werden wird. Während meine Großmutter kräftig an den Haaren der Hebamme zog und Schreie ausstieß, die die Sklaven zusammenzucken ließen, wurde nur ein paar Schritte entfernt das Gesetz verabschiedet, kraft dessen Bolívar in seiner Eigenschaft als Landesvater dem frisch gebackenen Land einen Namen gab, so dass es nun feierlich getauft war. Die Republik Kolumbien – ein schizophrenes Land, das im Folgenden mal Neugranada, mal Vereinigte Staaten von Kolumbien oder sogar Dieser-beschissene-Ort genannt werden wird – war damals ein Wickelkind und die Leichen der erschossenen Spanier noch frisch, doch die Geburt meines Vaters begleitet ansonsten kein historisch markantes Ereignis, nur diese überflüssige Taufzeremonie. Ja, ich gestehe, ich war versucht, seine Geburt mit der Unabhängigkeit zusammenfallen zu lassen, wozu man sie nur ein paar Monate hätte vorverlegen müssen. (Und ich muss mich fragen: Wer hätte sich daran gestört? Mehr noch: Wer hätte es gemerkt?) Ich hoffe, dieses Bekenntnis erschüttert nicht Ihr Vertrauen in mich. Ich weiß, meine richtenden Leser, ich neige zu Revisionismus und Mythisierung, weiß, ich verzettele mich hier und da, aber ich werde immer schnell in den heimischen Stall der Erzählung und auf den engen Pfad der Genauigkeit und Wahrheit zurückkehren.
Mein Vater war – ich sagte es bereits – der letzte Renaissancemensch. Ich kann nicht behaupten, er hätte blaues Blut gehabt, denn dieser Farbton war in der neuen Republik nicht mehr salonfähig, aber was durch seine Adern floss, war, sagen wir, rotblau oder vielleicht purpurn. Sein Hauslehrer, ein zarter, kränklicher Mann, der seine Erziehung in Madrid genossen hatte, erzog meinen Vater mit Don Quijote und Garcilaso. Aber der junge Altamirano, der mit zwölf bereits ein ausgewachsener Rebell war (von miserablem literarischen Gespür), sperrte sich mit aller Kraft gegen die Literatur der spanischen Zuwanderer, gegen die Stimme der Besatzung, und mit Erfolg. Er lernte Englisch, um Thomas Malory zu lesen, und eines der ersten Gedichte, die er veröffentlichte, ein von Romantik triefendes, sentimentales Machwerk, das Lord Byron an die Seite von Simón Bolívar stellte, unterschrieb er mit »Lancelot vom See«. Mein Vater erfuhr später, dass Byron tatsächlich an der Seite von Bolívar hatte kämpfen wollen und ihn nur der Zufall am Ende nach Griechenland geführt hatte. Von da an verdrängte seine Begeisterung für die Romantiker, ob aus England oder woher auch immer, nach und nach alles, was die ältere Generation verehrt, geachtet und ihm als Erbe hinterlassen hatte.
Das war nicht weiter schwierig, denn mit zwanzig war unser Anden-Byron bereits Waise. Seine Mutter hatten die Pocken dahingerafft, seinen Vater (weit eleganter) das Christentum. Mein Großvater, ein angesehener Oberst, der gegen die Dragoner mehrerer spanischer Regimenter gekämpft hatte, führte gerade ein Kommando in den südlichen Provinzen, als die fortschrittliche Regierung die Schließung von vier Klöstern anordnete, und so erlebte er die ersten Aufstände derer, die die Religion mit dem Bajonett verteidigten. Monate später durchbohrte ihn eines dieser römisch-katholischen Bajonette, eine dieser Stahlspitzen, die sich dem Kreuzzug verschrieben hatten. Die Nachricht seines Todes erreichte Bogotá, als auch die Stadt sich auf die Attacke der revolutionären Christenkrieger vorbereitete. Bogotá oder Santa Fe war jedoch ebenso gespalten wie der Rest des Landes, und mein Vater sollte diesen Augenblick nie vergessen. Vom Fenster der Universität aus sah er eine Prozession von Hauptstädtern, die einen Christus in Generalsuniform trugen, hörte sie schreien: ›Tod den Juden‹, wunderte sich, dass sie seinen durchbohrten Vater damit meinten, und kehrte dann zum Alltag der Hörsäle zurück, um zuzuschauen, wie ein Kommilitone ein spitzes, scharfes Instrument in die frisch eingetroffenen Leichen der Scharmützel tauchte. Denn nichts, nichts auf der Welt begeisterte unseren Anden-Byron damals mehr, als Zeuge der faszinierenden Fortschritte der Medizin sein zu dürfen.
Er hatte sich für Jura eingeschrieben, da das der Wille meines Großvaters gewesen war, aber bald schon widmete er den Gesetzbüchern nur noch die Vormittage. Wie ein Don Juan mit zwei Geliebten unterwarf er sich der Strapaze, um fünf Uhr früh aufzustehen, sich verschiedene Straffälle und Möglichkeiten des Besitzerwerbs erklären zu lassen, damit er sich nach dem Mittagessen einem geheimen zweiten Leben widmen konnte. Mein Vater hatte für den exorbitanten Preis von einem halben Real einen Hut mit Medizinerabzeichen erstanden, um nicht von der Aufsicht entdeckt zu werden, verschwand Tag für Tag bis fünf Uhr nachmittags in der medizinischen Fakultät und verbrachte die Zeit damit, jungen Männern, nicht älter und nicht intelligenter als er, bei ihren gewagten Forschungsreisen durch die Terra incognita des menschlichen Körpers zuzuschauen. Mein Vater wollte sehen, wie sein Freund Ricardo Rueda es fertigbrachte, ganz allein und heimlich die Zwillingsmädchen einer andalusischen Zigeunerin auf die Welt zu bringen, oder wie er den Neffen von Don José Ignacio de Márquez, Professor für römisches Recht an der Universität, am Blinddarm operierte. Währenddessen kam es ein paar Straßen weiter zu Eingriffen, die nicht chirurgischer Natur waren, jedoch kaum weniger schwerwiegende Folgen hatten, denn zwei Männer nahmen mit einer Gänsefeder in der Hand in den Samtsesseln eines Ministeriums Platz und unterzeichneten den Mallarino-Bidlack-Vertrag. Laut Artikel 35 gestand das Land, das sich nun Neugranada nannte, den Vereinigten Staaten das alleinige Recht zu, den Isthmus der Provinz Panama zu passieren, wogegen sich die Vereinigten Staaten unter anderem dazu verpflichteten, in innenpolitischen Angelegenheiten strikte Neutralität zu wahren. Und hier beginnt das Chaos, hier beginnt …
Aber nein.
Noch nicht.
Noch ein paar Seiten, dann werde ich mehr über dieses Thema berichten.
Der letzte Renaissancemensch erwarb sich zwar den Titel eines Rechtsgelehrten, aber gleich sei gesagt, dass er diesen Beruf niemals ausübte. Zu sehr nahm ihn das aufwändige Werk von Aufklärung und Fortschritt in Anspruch. Er war bald dreißig und noch nie mit einer Freundin gesehen worden, während die Liste der von ihm gegründeten Zeitungen, ob benthamianisch, revolutionär, sozialistisch oder girondistisch, ins Endlose wuchs. Kein Bischof, den er nicht beleidigt hätte, keine achtbare Familie, die ihm nicht den Zutritt zu ihrem Haus, das Werben um ihre Töchter untersagt hätte. (Im Mädchenpensionat La Merced, das man für besonders vornehme Fräulein gegründet hatte, war sein Name tabu.) Nach und nach perfektionierte mein Vater die heikle Kunst, sich Feindschaften einzuhandeln und Türen zu verschließen, und die Bogotaer Gesellschaft beteiligte sich bereitwillig am geballten Türschluss. Das bekümmerte meinen Vater nicht. Doch das Land, in dem er lebte, war nicht wiederzuerkennen, seine Grenzen hatten sich verschoben oder würden es tun, es hatte seinen Namen geändert, seine Staatsverfassung war trügerisch wie Weiberherzen, und die Regierung, für die mein Großvater gestorben war, hatte sich für ihn, einen Leser Lamartines und Saint-Simons, in das reaktionärste aller Geschwüre verwandelt.
Auftritt Miguel Altamirano, Aktivist, Idealist, Optimist. Miguel Altamirano, nicht nur liberal, nein, radikal und antiklerikal. Bei den Wahlen von 1849 gehörte mein Vater zu denen, die Stoff für die Leinwände kauften, die überall in Bogotá mit der Aufschrift »Es lebe López, der Schrecken des konservierten Gestern« aufgehängt wurden. Er gehörte zu denen, die vor dem Kongressgebäude zusammenliefen, um (erfolgreich) die Männer einzuschüchtern, die einen neuen Präsidenten wählen gingen. Nachdem López, der Kandidat der jungen Revolutionäre, gewählt worden war, gehörte er zu denen, die – in der gerade aktuellen Zeitung, ich weiß nicht mehr welcher, ob in El Mártir oder La Batalla – die Vertreibung der Jesuiten forderten. Die Reaktion der reaktionären Gesellschaft: Achtzig Mädchen in weißem Kleid und mit Blumen in der Hand versammelten sich vor dem Regierungspalast, um dagegen zu protestieren. In seiner Zeitung nannte mein Vater sie »Instrumente des Obskurantismus«. Zweihundert Damen von untadeliger Herkunft wiederholten die Demonstration, und mein Vater verteilte eine Streitschrift mit dem Titel Züchte Jesuiten, dann kratzen Mütter dir die Augen aus. Je mehr Monate ins Land gingen und je mehr die Pfarrer jenes Neugranadas, ihrer Rechte und Privilegien beraubt, in die Defensive gerieten, desto sturer wurden sie. Mein Vater trat daraufhin der Freimaurerloge Stern von Tequendama bei. Die Geheimsitzungen gaben ihm das Gefühl, sich verschwören zu können (ergo, am Leben zu sein), und da seine Oberen ihm die körperlichen Prüfungen ersparten, fühlte er sich in der Freimaurerei wie ein Fisch im Wasser. Es gelang ihm, für den Tempel der Loge zwei junge Priester zu katechisieren, und seine Aufseher belohnten diesen Erfolg mit vorzeitiger Beförderung. In jener kurzen Spanne fand mein Vater, ein junger Soldat auf der Suche nach Schlachten, die eine, die ihm anfangs als nebensächlich, fast belanglos erschienen war, jedoch auf Umwegen sein Leben verändern sollte.
Im September 1852, während auf ganz Neugranada eine kleine Sintflut niederging, erfuhr mein Vater durch einen ehemaligen Kommilitonen der medizinischen Fakultät, liberal wie er, aber weniger streitlustig, von der jüngsten Attacke gegen den Gott Fortschritt. Pater Eustorgio Valenzuela hatte sich zum geistigen Wächter von Bogotás Universität aufgeworfen und übereifrig verboten, Menschenleichen zu pädagogischen, anatomischen und akademischen Zwecken zu gebrauchen. Die angehenden Chirurgen sollten an Fröschen, Ratten oder Kaninchen üben, sagte der Pater, aber der menschliche Leib, das geheiligte Gefäß der Seele, von Gottes Hand und Willen erschaffen, sei unantastbar und müsse geachtet werden.
Mittelalter!, schrie ihm mein Vater aus irgendeinem Druckerzeugnis entgegen. Verfaulter Papist! Aber es war zwecklos. Pater Valenzuela gebot über ein solides Netz von Getreuen, und bald schon sorgten die Pfarrer der Nachbardörfer Chía, Bosa und Zipaquirá dafür, dass die Studenten der sündigen Hauptstadt nicht auf andere Leichenhallen zurückgreifen konnten. Die Zivilverwaltung der Universität wurde von den Vätern der (guten) Familien unter Druck gesetzt und hatte der Erpressung, ehe sie es sich versah, bereits nachgegeben. Auf den Seziertischen häuften sich die aufgeschnittenen Frösche – der weiße, schwammige Bauch gespalten von der violetten Linie, die das Skalpell zog –, und in der Küche wanderte die eine Hälfte der Hühner in den Suppentopf, die andere in die Ophthalmologie. Das Leichenembargo wurde Gesprächsstoff der Salons und eroberte binnen weniger Wochen weite Teile der Zeitungen. Mein Vater rief einen neuen Materialismus aus und zitierte in mehreren Manifesten verschiedene seiner Gewährsmänner: »Auf dem Seziertisch«, sagten einige, »ist meine Skalpellspitze noch nie auf die Seele gestoßen.« Die Wagemutigeren behaupteten (nicht selten anonym): »Die alte Dreifaltigkeit hat ausgedient: Laplace ist an die Stelle des heiligen Geistes getreten.« Die mehr oder weniger freiwilligen Anhänger Pater Valenzuelas riefen daraufhin den alten Spiritualismus aus und warteten mit ihrer eigenen Ladung an Zeugen und Parolen auf. Sie konnten ein unumstößliches Argument vorweisen: Pascal und Newton waren gläubige, praktizierende Christen gewesen. Und sie konnten einen billigen, aber umso wirksameren Spruch loslassen: Zwei Kelche Wissenschaft machen einen Atheisten, drei Kelche einen Gläubigen. So schritt die Geschichte fort (oder eben nicht).
Die ganze Stadt war ein einziges Gerangel unter Aasgeiern. Auf die Choleratoten, die seit dem Vorjahr ab und an das Hospital San Juan de Dios verließen, hatten ebenso die radikalen Studenten wie die Kreuzzügler Pater Valenzuelas ein gieriges kaufmännisches Auge geworfen. Sobald einer der Patienten, die mit Erbrechen und Krämpfen eingeliefert worden waren, allzu viel Durst oder Kälte verspürte, machte die Nachricht die Runde, und die politischen Kräfte rüsteten sich. Pater Valenzuela kam zur letzten Ölung und zwang mittendrin den Kranken (mit bläulicher Haut, die Augen tief im Schädel versunken), ein Testament zu unterschreiben, in dem die hieb- und stichfeste Klausel zu lesen war: »Ich sterbe in Christus. Ich verweigere meinen Leib der Wissenschaft.« Mein Vater veröffentlichte einen Artikel, in dem er die Pfarrer beschuldigte, den Kranken die göttliche Vergebung zu versagen, wenn sie die vorgefertigten Testamente nicht unterschrieben; die Pfarrer beschuldigten ihrerseits die Materialisten, denselben Kranken statt der göttlichen Vergebung den Brechweinstein vorzuenthalten. Inmitten dieses Streits der Aasfresser hielt keiner inne, um sich zu fragen, wie die Krankheit auf zweitausendsechshundert Meter über dem Meeresspiegel hatte klettern können oder woher sie gekommen war.
Da griff, wie so oft in der Geschichte und besonders in meiner, der Zufall ein und zwar in Gestalt eines Fremden, eines Mannes aus Anderswo. (Das schürte nur die Ängste der Spiritualisten. Als Gefangene dieser unzugänglichen Hochebene, zehn Tagesreisen – doppelt so viele im Winter – von der Karibikküste entfernt, hatten es sich Pater Valenzuelas Getreue hinter ihren Scheuklappen bequem gemacht, und alles, was von außen kam, verdiente eingehendes Misstrauen.) Damals sah man, wie mein Vater sich mit einem Herrn traf, der nicht aus der Stadt stammte. Man sah die beiden aus dem Observatorium kommen, gemeinsam die Kommission für Hygiene und Gesundheit besuchen oder auch ins Haus meiner Großeltern treten, wo sie auf dem verwilderten Teil des Grundstücks, inmitten von Nesseln, fern von den Dienstboten geheime Gespräche führten. Aber die Dienstboten, die aus zwei Witwen, freigelassenen Sklavinnen, mit ihren halbwüchsigen Söhnen bestanden, verfügten über Künste, die mein Vater nicht bedacht hatte, und so erfuhren die Nachbarn, die Straße, das ganze Viertel, dass der Mann mit stolpernder Zunge sprach (Beelzebubs Werk, laut Valenzuela), dass er Besitzer eines Zuges war und der Universität von Bogotá so viele tote Chinesen anbot, wie sie nur kaufen wollte.
»Wenn hiesige Tote verboten sind«, wurde mein Vater zitiert, »nimmt man eben auswärtige. Wenn christliche Tote verboten sind, greift man zu anderen.«
Das schien den alten Spiritualismus in seinen schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen.
Unter den Argwöhnischen befand sich Priester Echavarría von der Kirche Santo Tomás, jünger als Valenzuela und viel, ja, sehr viel tatkräftiger.
Und der Fremde?
Der Mann aus Anderswo?
Ein paar Worte über diese Gestalt oder vielmehr ein paar Richtigstellungen. Er sprach nicht mit stolpernder Zunge, sondern mit Bostoner Akzent, war nicht Besitzer eines Zuges, sondern Repräsentant der Panama-Eisenbahngesellschaft, und war nicht gekommen, um der Universität tote Chinesen zu verkaufen, sondern … Ja, schon gut, er war tatsächlich gekommen, um der Universität tote Chinesen zu verkaufen, zumindest war das eine seiner Missionen als Botschafter in der Hauptstadt. Muss ich das Offensichtliche aussprechen: dass seine Botschaft auf fruchtbaren Boden fiel? Mein Vater und die Materialisten standen mit dem Rücken an der Wand, oder das Gegenlager hatte sie vielmehr dorthin getrieben, und sie waren verzweifelt, versteht sich, denn das war mehr als ein Streit in der Presse, es war eine entscheidende Schlacht im langen Kampf des Lichts gegen die Finsternis. Den Mann von der Eisenbahngesellschaft – Clarence mit Namen, Sohn von Protestanten – hatte die Vorsehung geschickt. Die Vereinbarung kam nicht sofort zustande, sie erforderte so einige Briefe, so einige Genehmigungen, so einige Anreize (Valenzuela sagte: Bestechungen). Aber im Juli trafen aus Honda – wohin sie aus Barranquilla gekommen waren und zuvor aus Colón, der brandneuen Stadt, die erst vor wenigen Monaten gegründet worden war – fünfzehn Eisfässer ein. In jedem davon befand sich ein zusammengeschnürter chinesischer Kuli, der kürzlich an der Ruhr oder an Malaria gestorben war, ja sogar an der Cholera, die für die Bewohner Bogotás bereits der Vergangenheit angehörte. Von Panama aus reisten noch viele namenlose Leichen vielen Zielen entgegen und sollten es auch weiterhin tun, bis die Arbeiten an der Eisenbahnstrecke aus dem Sumpf, in dem sie gerade steckten, in ein Gebiet vorgestoßen waren, wo ein Friedhof errichtet werden konnte, der den Attacken des Klimas bis zum jüngsten Gericht standhielt.
Und die toten Chinesen hatten eine Geschichte zu erzählen. Keine Sorge, Eloísa, das ist keines der Bücher, in denen die Toten sprechen, die schönen Frauen in den Himmel aufsteigen oder die Pfarrer vom Boden abheben, wenn sie ein heißes Getränk zu sich nehmen. Aber eine Ausnahme sei mir hoffentlich gestattet und hoffentlich nicht nur eine. Die Universität bezahlte für die toten Chinesen eine Summe, die niemals bekannt wurde, jedoch nach Meinung mancher drei Pesos pro Toten nicht überstieg, was heißt, dass sich eine Näherin mit drei Monatslöhnen eine Leiche hätte leisten können. Alsbald durften also angehende Chirurgen ihre Skalpelle in gelbe Haut tauchen. Und wie die Chinesen dort lagen, kalt und bleich in ihrem Wettlauf gegen die Verwesung, begannen sie von der Panama-Eisenbahn zu erzählen. Sie sagten Dinge, die inzwischen alle Welt weiß, die damals jedoch für die meisten der dreißigtausend Hauptstädter taufrische Neuigkeiten waren. Der Schauplatz verlagert sich jetzt (räumlich) Richtung Norden und (zeitlich) ein paar Jahre zurück. So gelangen wir ohne weitere Tricks, allein kraft meiner Territorialhoheit über diesen Bericht, nach Coloma, Kalifornien. Es ist das Jahr 1848. Genauer, der 24. Januar. Der Zimmermann James Marshall hat den langen, gewundenen Weg von New Jersey zurückgelegt, um das Ende der Welt zu erobern und dort ein Sägewerk zu errichten. Beim Graben entdeckt er etwas Glänzendes in der Erde.
Und die Welt verfällt dem Wahnsinn. Auf einmal wird sich die Ostküste der Vereinigten Staaten bewusst, dass der Weg zum Gold über diesen Isthmus, über die dunkle Provinz dieses dunklen Landes führt, das ständig seinen Namen ändert, durch dieses Stückchen mörderischen Urwald, dessen besonderer Segen darin besteht, der schmalste Punkt Zentralamerikas zu sein. Kein Jahr vergeht, und schon nähert sich der Dampfer Falcon der panamaischen Bucht Bahía Limón und schwenkt feierlich in die Mündung des panamaischen Chagres ein, an Bord Hunderte von Gringos, die wie ein mobiles, kakophonisches Orchester Pfannen, Gewehre und Pickel schwenken und immer wieder laut schreiend fragen, wo zum Teufel der Pazifik liegt. Manche finden es heraus, einige davon erreichen ihr Ziel. Andere bleiben auf der Strecke, vom Fieber dahingerafft – nicht dem des Goldes, sondern dem anderen, ebenfalls gelb – neben ihren dahingerafften Maultieren, tote Männer und Maultiere, Rücken an Rücken im grünen Schlamm des Flusses, besiegt von der Hitze dieser Sümpfe, zu denen die Bäume keinerlei Licht durchlassen. Ja, genau, diese korrigierte Version eines Eldorado, diese Goldroute, die da eröffnet werden soll, ist ein Weg ohne Sonne, wo in der Hitze die Körper erschlaffen, wo der Finger, mit dem man durch die Luft fährt, trieft, als hätte man ihn in einen Fluss getaucht. Dieser Ort ist die Hölle, aber eine Hölle aus Wasser. Indessen ruft das Gold, und man muss etwas tun, um die Hölle zu durchqueren. Ein Vogelblick auf mein Land verrät mir: Während mein Vater in Bogotá die Vertreibung der Jesuiten fordert, schlägt sich im panamaischen Urwald, Schwelle für Schwelle, toten Arbeiter für toten Arbeiter, das Wunder der Eisenbahn seine Schneise.
Und die fünfzehn chinesischen Kulis, die auf den langen Seziertischen der Universität Bogotás gelandet sind, wo einem unaufmerksamen Studenten gezeigt wird, an welcher Stelle sich die Leber befindet und wie lang der Dickdarm ist, die fünfzehn Chinesen, die bereits dunkle Flecke auf dem Rücken aufweisen (wenn sie rücklings liegen) oder auf der Brust (wenn das Gegenteil der Fall ist), diese fünfzehn Chinesen sagen unisono und voll Stolz: Wir sind dabei gewesen. Wir haben uns eine Schneise durch den Urwald geschlagen, haben in den Sümpfen gegraben, haben Schienen und Schwellen verlegt. Einer der fünfzehn Chinesen erzählt seine Geschichte meinem Vater, und mein Vater, der sich über den Rigor Mortis beugt und mit der Neugier des Renaissancemenschen untersucht, was sich unter einer Rippe befindet, hört aufmerksamer zu, als ihm bewusst ist. Und was befindet sich unter der Rippe? Mein Vater verlangt eine Pinzette, die kurz darauf mit einem Bambussplitter wieder aus dem Körper auftaucht. Da erklärt dieser geschwätzige, unverschämte Chinese meinem Vater, mit welcher Geduld er den Stecken gespitzt, mit welch handwerklichem Geschick er ihn in den Morast gestoßen und mit welchem Schwung er sich auf das spitze Ende geworfen hat.
Ein Selbstmörder?, fragt mein Vater (zugegeben, keine sehr intelligente Frage). Nein, erwidert der Chinese, er habe sich nicht selbst umgebracht, die Melancholie habe ihn getötet und vor der Melancholie die Malaria … Es habe ihn umgebracht, seine kranken Gefährten zu sehen, die sich mit den Seilen für den Schienenbau erhängten, die den Aufsehern Pistolen stahlen, um sich zu erschießen, es habe ihn umgebracht, zu sehen, dass man im Sumpf unmöglich einen anständigen Friedhof anlegen konnte und dass die Opfer des Urwalds deshalb in Eisfässern in alle Himmelsrichtungen verschickt wurden. Ich, sagt der Chinese mit schon fast bläulicher Haut und fast unerträglichem Gestank, ich, der ich als Lebender an der Panama-Eisenbahn gebaut habe, helfe als Toter, sie zu finanzieren, ebenso wie die anderen neuntausendneunhundertachtundneunzig toten Arbeiter, ob Chinesen, Schwarze oder Iren, die in diesem Moment die Universitäten und Hospitäler der Welt bereisen. Ach, wie eine Leiche doch herumkommt …
All das erzählt der tote Chinese meinem Vater.
Aber irgendwie hört mein Vater etwas Anderes.
Mein Vater hört keine private Tragödie, sieht im toten Chinesen nicht den namen- und obdachlosen Arbeiter, der kein Grab gefunden hat. Er begreift ihn als Märtyrer und die Geschichte der Eisenbahn als wahrhaftiges Epos. Zug gegen Urwald, Mensch gegen Natur … Der tote Chinese ist ein Bote der Zukunft, eine Vorhut des Fortschritts. Der Chinese erzählt ihm, dass sich auf jenem Schiff, der Falcon, auch der cholerainfizierte Passagier befunden habe, der direkte Verantwortliche für die zweitausend Toten in Cartagena und die mehreren Hundert in Bogotá, aber mein Vater bewundert diesen Passagier, der alles hinter sich ließ, um durch den mörderischen Urwald dem Ruf des Goldes zu folgen. Der Chinese erzählt meinem Vater von den Spelunken und Bordellen, die in Panama nach dem Eintreffen der Fremden aus dem Boden schossen; für meinen Vater ist jeder betrunkene Arbeiter ein Ritter der Tafelrunde, jede Hure eine Amazone. Die siebzigtausend Eisenbahnschwellen sind siebzigtausend Prophezeiungen der Vorkämpfer. Die Bahnlinie, die den Isthmus durchquert, ist der Nabel der Welt. Nein, der tote Chinese ist nicht bloß ein Bote der Zukunft, er ist ein Verkündigungsengel, denkt mein Vater, herabgestiegen, um das welke Laub seines eigenen tristen Lebens in Bogotá mit der vagen, doch leuchtenden Verheißung eines besseren Lebens aufzurühren.
Die Verteidigung hat das Wort: Es war kein Akt des Wahnsinns, dass mein Vater dem toten Chinesen die Hand abschnitt. Es war kein Akt des Wahnsinns – mein Vater hatte sich noch nie zuvor so maßlos bei Verstand gefühlt –, dass er sie von ein paar Fleischern aus Chapinero säubern ließ und zum Trocknen in die Sonne (die so seltene Sonne Bogotás) legte. Er ließ sie mit Bronzeschräubchen auf einem kleinen Sockel befestigen, der wie Marmor aussah, und stellte sie ins Bücherregal neben eine zerfledderte Ausgabe von Engels’ Der deutsche Bauernkrieg und ein Bild meiner Großmutter mit Kamm im Haar, eine Ölminiatur aus der Schule von Gregorio Vásquez. Der sanft gestreckte Zeigefinger deutete mit jedem seiner fleischlosen Glieder in die Richtung, die mein Vater einzuschlagen hatte.
Die Freunde, die ihn damals besuchen kamen, sagten, ja, es stimme tatsächlich, Handwurzel und Mittelhand wiesen zum Isthmus wie ein Moslem, der sich in Richtung Mekka verbeugt. Doch so gern ich meinen Bericht dorthin stürmen ließe, wohin der dürre, knöcherne Finger zeigt, ich muss mich vorher anderen Vorfällen im Leben meines Vaters widmen, der eines schönen Tages im Jahr des Herrn 1854 auf die Straße trat und aus dem Mund von Zeugen erfuhr, dass er exkommuniziert worden war. So viel Zeit war seit der Schlacht um die Leichen vergangen, dass es dauerte, bis er das eine mit dem anderen in Verbindung brachte. An einem Sonntag, als mein Vater in seiner Freimaurerloge gerade den Titel eines Großmeisters pro tempore erhielt, nannte der Priester Echavarría von der rügenden Kanzel der Kirche Santo Tomás herab seinen Namen. Miguel Altamirano schachere mit den Seelen der Toten, und sein Kompagnon sei der Teufel. Miguel Altamirano, verkündete Pfarrer Echavarría vor seiner Hörerschaft aus Gläubigen und Eiferern, sei offizieller Feind Gottes und der Kirche.
Mein Vater nahm die Sache den Umständen und der Vorgeschichte entsprechend von der scherzhaften Seite. Wenige Meter vom pompösen Kirchenportal entfernt befand sich die bescheidenere und vor allem unheilige Tür der Druckerei. Am selben Sonntag übergab mein Vater zu später Stunde seine Kolumne für El Comunero. (Oder war es El Temporal? Genauigkeit mag hier überflüssig sein, aber dennoch quält es mich, dass ich der Spur der Blättchen und Zeitungen, die mein Vater herausgab, nicht zu folgen vermag. La Opinión? El Granadino? La Opinión Granadina oder El Comunero Temporal? Zwecklos. Leser, die Sie mich richten werden, verzeihen Sie meine Vergesslichkeit.)
Also welcher Zeitung auch immer, mein Vater übergab seine Kolumne. Das Folgende ist keine wörtliche Wiedergabe, sondern aus dem Gedächtnis zitiert, doch ich glaube, es gibt recht gut den Geist seiner Worte wieder: »Ein ewig gestriger Schwarzrock, einer dieser Raben, die aus dem Glauben Aberglauben und aus dem christlichen Ritus sektiererisches Heidentum machen, hat sich das Recht angemaßt, mich zu exkommunizieren, obwohl es ihm an einem bischöflichen Urteil und vor allem an gesundem Menschenverstand mangelt«, schrieb er für die gesamte Gesellschaft Bogotás. »Der Unterzeichnete hat in seiner Eigenschaft als Doktor irdischen Rechts, als Sprecher der öffentlichen Meinung und Verteidiger zivilisierter Werte weitreichende und hinlängliche Befugnisse von Seiten der Gemeinschaft empfangen, die er repräsentiert und die beschlossen hat, es dem Raben mit gleicher Münze heimzuzahlen. Und so wird Priester Echavarría, den Gott nicht selig haben möge, kraft dieser Zeilen exkommuniziert und ausgeschlossen aus der Gemeinschaft zivilisierter Menschen. Von der Kanzel in Santo Tomás herab hat er uns aus seiner Gesellschaft ausgestoßen, wir stoßen ihn von der Kanzel Gutenbergs herab aus der unseren aus. Beschlossen und verkündet.«
Die restliche Woche verlief ohne Vorfälle. Aber am folgenden Samstag trafen sich mein Vater und seine radikalen Genossen im Café Le Boulevardier, in der Nähe des Kreuzgangs der Universität, mit den Mitgliedern einer spanischen Theatertruppe, die damals auf Tournee durch Lateinamerika war. Das aufgeführte Werk, eine Art Der Bürger als Edelmann, bei dem ein von Zweifeln geplagter Seminarist an die Stelle des Bürgers trat, war vom Erzbistum verurteilt worden, Anlass genug für den Einsatz von El Comunero oder El Granadino. Mein Vater, (ebenfalls) zuständig für die Sparte Vermischtes, hatte die Schauspieler zu einem langen Interview eingeladen. Das Interview war an dem Abend bereits beendet – der Redakteur steckte sein Notizheft und den Waterloo-Federhalter weg, den ihm ein Freund aus London mitgebracht hatte –, und die Versammelten unterhielten sich von Brandy zu Brandy über die Geschichte mit Pfarrer Echavarría. Die Schauspieler stellten eigene Mutmaßungen über die Sonntagsmesse an, begannen schon, ganze Reales auf den Inhalt der nächsten Predigt zu wetten, als ein heftiger Regenguss niederging und die Leute sich auf der Straße wie die Hühner unter der Dachtraufe und im Türeingang zusammendrängten und ungeniert den Zutritt zum Café behinderten. Drinnen roch es allmählich nach nassem Poncho, und unter den triefenden Hosen und Stiefeln wurde der Boden des Cafés schlüpfrig. Da befahl auf einmal eine Sopranstimme meinem Vater, er solle aufstehen und seinen Platz abgeben.
Mein Vater war Priester Echavarría noch nie von Angesicht zu Angesicht begegnet, die Nachricht seiner Exkommunikation hatte ihn über Dritte erreicht, und der Streit war bis zu diesem Augenblick nicht über die gedruckte Seite hinausgegangen. Als er aufblickte, sah er eine lange, völlig trockene Soutane und einen schwarzen, jetzt geschlossenen Regenschirm vor sich, die Spitze ruhte in einer Pfütze, die so silbrig glänzte wie Quecksilber, der Griff trug mühelos das Gewicht der femininen Hände. Der Sopran sprach erneut: »Der Platz, Ketzer.« Ich muss glauben, was mein Vater mir Jahre später erzählen sollte: dass er nicht etwa aus Frechheit eine Antwort schuldig blieb, sondern weil ihn diese Vaudeville-Szene – der Pfarrer, der ein Café betritt, der trockene Pfarrer unter all den nassen Leuten, der Pfarrer, dessen Frauenstimme seine herausfordernden Gebärden untergräbt – so sehr überraschte, dass es ihm die Sprache verschlug. Echavarría interpretierte sein Schweigen als Verachtung und lud nach: »Der Platz, Gottloser.«
»Wie bitte?«
»Der Platz, Gotteslästerer. Der Platz, jüdischer Mörder.«
Daraufhin schlug er meinem Vater mit der Schirmspitze einmal leicht gegen das Knie, vielleicht auch zweimal. Da war alles zu spät.
Wie ein Springteufel schnellte mein Vater hoch und fegte mit einer Handbewegung den Regenschirm beiseite (sein Handteller wurde nass und ein wenig rot). Echavarría stieß empört ein »Wie können Sie es wagen« oder dergleichen aus. Während dieser noch sprach, hatte sich mein Vater, wohl in einer flüchtigen Sekunde der Vernunft, bereits umgedreht, weil er seine Jacke nehmen und hinausgehen wollte, ohne sich nach seinen Gefährten umzublicken, und so sah er die Ohrfeige des Pfarrers nicht kommen, sah auch nicht – das sollte er oft wiederholen und inständig bitten, ihm zu glauben – seine eigene Hand, die ein Eigenleben entwickelte, sich ballte und mit dem ganzen Schwung herumgerissener Schultern auf das empörte, geschürzte Mündchen zuflog, auf die bartlose, gepuderte Lippe von Priester Echavarría. Der Kiefer gab ein dumpfes Krachen von sich, die Soutane schwang nach hinten, als schwebte sie, die Stiefel unter der Soutane verloren in der Pfütze ihren Halt, und der Schirm fiel zu Boden, nur einen winzigen Augenblick vor seinem Besitzer.
»Das hättest du sehen sollen«, sagte mir mein Vater lange Zeit danach am Meeresufer, mit einem Glas Brandy in der Hand. »In dem Moment hörte man das Schweigen, nicht den Regen.«
Die Schauspieler standen auf. Die radikalen Genossen standen auf. Und jedes Mal, wenn ich mich an diese Geschichte erinnere, muss ich denken: Wäre mein Vater allein gewesen oder nicht in einem Universitätslokal, hätte er es mit einem rasenden Mob aufnehmen müssen, entschlossen, ihn für die erlittene Beleidigung aufzuspießen. Aber trotz vereinzelter, anonymer Beschimpfungen aus der Menge im Saal, trotz der vernichtenden Blicke der zwei Unbekannten, die Echavarría auf die Beine halfen, ihm seinen Schirm gaben, seine Soutane ausklopften (samt einem unnötigen Klaps auf die klerikalen Hinterbacken), geschah nichts. Echavarría verließ Le Boulevardier unter Flüchen, die noch niemand in Santa Fe de Bogotá aus dem Mund eines Geistlichen vernommen hatte, und unter Drohungen, die eines Matrosen aus Marseille würdig gewesen wären, doch damit war dieser Schlagabtausch vorüber. Mein Vater fasste sich ans Gesicht, stellte fest, dass seine Wange heiß war, verabschiedete sich von seinen Begleitern und ging im Regen nach Hause. Zwei Tage später klopfte es in aller Frühe, noch bevor es hell geworden war, an seiner Tür. Das Dienstmädchen öffnete und sah niemanden. Der Grund war offensichtlich: Mit dem Klopfen hatte niemand Einlass begehrt, sondern ein Hammer hatte etwas angenagelt.
Die anonyme Schmähschrift trug kein Impressum, doch der Inhalt war glasklar: Alle Gläubigen, die diese Zeilen läsen, seien angehalten, dem Ketzer Altamirano Gruß, Brot, Wasser und Feuer zu verweigern; der Ketzer Miguel Altamirano werde als vom Teufel besessen erachtet, und es sei tugendhaft und gottgefällig, ihn bedenkenlos umzubringen wie einen Hund.
Mein Vater riss das Blatt ab, ging wieder ins Haus, holte den Schlüssel zur Rumpelkammer und nahm sich eine der beiden Pistolen, die mit der Truhe meines Großvaters in seinen Besitz gelangt waren. Als er auf die Straße trat, war er besorgt, wollte alle verräterischen Spuren beseitigen, die Papierfetzen, die noch am Türholz unter dem Nagel hafteten, aber gleich darauf merkte er, dass es vergebens war, denn der gleiche Anschlag begegnete ihm an die zehn, fünfzehn Mal auf seinem kurzen Weg zur Druckerei, wo La Opinión hergestellt wurde. Schlimmer noch, ihm begegneten anklagende Finger und Rufe, die mächtige Staatsanwaltschaft der Katholiken, die ihn bereits ohne jeden Prozess zu ihrem Feind erklärt hatten. Mein Vater war es zwar gewohnt, Aufmerksamkeit zu erwecken, aber nicht, Groll zu erregen. Die Ankläger (mit baumelnden Kreuzen am Hals) beugten sich über die Holzbalkone, und dass sie ihn nicht anzuschreien wagten, war keine Erleichterung für meinen Vater, sondern verhieß ihm ein noch finstereres Schicksal, als öffentlich in Ungnade zu fallen. Er betrat mit dem zerknüllten Papier in der Hand die Druckerei und fragte die Besitzer, die Brüder Acosta, ob sie die Druckmaschine identifizieren könnten, von der es stammte: ohne Erfolg. Er verbrachte den Nachmittag im Handelsclub, versuchte herauszubekommen, was die Genossen dachten, und erfuhr, dass die radikalen Gruppen bereits eine Entscheidung getroffen hatten. Sie wollten mit Feuer und Schwert antworten und jede Kirche niederbrennen, jeden Geistlichen töten, wenn auf Miguel Altamirano irgendein Anschlag verübt werden sollte. Das stärkte ihm den Rücken, stärkte aber auch das Gefühl, dass ein Unglück über der Stadt hing. So machte er sich bei Nachteinbruch zur Kirche Santo Tomás auf, um Pfarrer Echavarría aufzusuchen, im Glauben, dass zwei Männer, die Beleidigungen ausgetauscht haben, ebenso einfach Entschuldigungen austauschen können. Doch die Kirche war leer.
Oder beinahe.
Denn in den letzten Reihen befand sich ein Bündel oder etwas, was mein Vater beim Eintreten, solange die Netzhaut mit all ihren Stäbchen und Zapfen braucht, um sich nach dem abrupten Übergang vom Hellen ins Dunkle an die neuen Lichtverhältnisse anzupassen, für ein Bündel gehalten hatte. Nachdem er eine Runde durch die Gänge in Richtung Altarraum gemacht, sich dann auf der Suche nach der Tür zur Pfarrei in Bereiche vorgewagt hatte, in denen er bereits ein Unbefugter war, nachdem er zwei kleine, ausgetretene Steinstufen hinuntergegangen war und mit einem behutsamen, höflichen Fingerknöchel zweimal geklopft hatte, setzte sich mein Vater auf eine Bank mit Blick auf den Goldglanz des Altars und wartete, auch wenn er keine genaue Vorstellung hatte, mit was für Worten er diesen Fanatiker überzeugen sollte. Da hörte er jemanden sagen: »Er ist es.«
Er drehte sich um und sah, dass sich das Bündel in zwei teilte. Der eine Teil wandte ihm in Gestalt einer Soutane, die nicht Pater Echavarrías war, den Rücken zu und verließ die Kirche, der andere setzte sich in Gestalt eines Mannes mit Poncho und Hut in Bewegung, eine gewaltige Glocke auf Beinen, und ging durch den Mittelgang in Richtung Altarraum. Mein Vater stellte sich vor, dass ihn unter dem Strohhut, aus diesem Schwarz, aus dem bald menschliche Züge auftauchen würden, die Augen des Mannes unverhohlen musterten. Mein Vater blickte um sich. Von einem Ölgemälde herab überwachte ihn ein bärtiger Mann, der seinen Zeigefinger (reichlich in Fleisch und Haut gehüllt, nicht wie der Finger seiner Knochenhand zu Hause) in die offene Wunde Christi legte. Ein anderes Ölbild zeigte einen Mann mit Flügeln und eine Frau, die einen ebenso fleischigen Finger in ihr Buch legte. Mein Vater erkannte Maria, aber der Verkündigungsengel war kein Chinese. Und keiner von ihnen schien bereit, ihm beizuspringen. Der Mann im Poncho kam indessen lautlos näher, als glitte er auf einem Ölfilm dahin. Mein Vater sah, dass er Hanfschuhe trug, sah die hochgekrempelten Hosen und sah unter dem Ponchosaum die dreckige Spitze eines Messers schweben.
Keiner der beiden sprach ein Wort. Mein Vater wusste, dass er den Mann nicht an Ort und Stelle töten konnte, und nicht etwa, weil er mit seinen vierunddreißig Jahren noch niemanden getötet hatte (immer gibt es ein erstes Mal, und mein Vater wusste nicht schlechter als andere mit der Pistole umzugehen), sondern weil ihm bei einem Mord ohne Zeugen von vornherein eine Verurteilung sicher war. Die Leute mussten es mit eigenen Augen sehen, mussten die Provokation, den Angriff, die legitime Selbstverteidigung bezeugen. Er stand auf, trat in den Seitengang und ging in langen Schritten aufs Portal zu. Anstatt ihm zu folgen, kehrte der Mann im Poncho im Mittelgang um, und sie schritten parallel zueinander Bankreihe für Bankreihe ab, während mein Vater überlegte, was er tun sollte, sobald ihnen die Bankreihen ausgingen. Er zählte sie rasch: sechs Reihen, fünf, vier.
Drei Reihen.
Jetzt zwei.
Jetzt eine.
Mein Vater steckte die Hand in die Tasche und spannte die Pistole. Als beide auf das Portal zugingen und aus den Parallelen aufeinander zulaufende Geraden wurden, schob der Mann den Poncho beiseite, und die Messerhand holte aus. Mein Vater hob die gespannte Pistole, zielte mitten auf die Brust, dachte an die traurigen Konsequenzen dessen, was er im Begriff war, zu tun, dachte an die Schaulustigen, die auf den Knall hin in die Kirche strömen würden, dachte an das Gericht, das ihn kraft der Aussagen eben dieser Schaulustigen wegen Mordes verurteilen würde, dachte an meinen vom Bajonett durchbohrten Großvater und an den vom Bambusstecken durchbohrten Chinesen, dachte an das Erschießungskommando, das ihn vor einer einfachen Lehmmauer durchlöchern würde, und sagte sich, dass er weder für das Gericht noch für den Richtplatz geschaffen und es Ehrensache war, den Angreifer zu töten, den folgenden Schuss jedoch auf die eigene Brust abzufeuern.
Dann schoss er.
»Dann schoss ich«, erzählte mir mein Vater.
Aber es war nicht der Knall aus seiner Pistole, den er hörte, der Schuss schien ein einzigartiges Echo hervorzurufen, einen noch nie dagewesenen Widerhall, denn im gleichen Augenblick erreichte ihn von der benachbarten Plaza de Bolívar aus das Dröhnen anderer Schüsse aus einer Unzahl anderer Waffen. Mitternacht war schon vorbei, der 17. April war angebrochen, und der ehrenwerte General José María Melo hatte soeben einen Militärputsch durchgeführt und sich zum Diktator der armen, verirrten Republik ernannt.
Ja, genau, der Engel der Geschichte rettete meinen Vater, wenn auch, wie man noch sehen wird, nur vorübergehend, indem er einfach den einen Feind gegen den anderen austauschte. Mein Vater schoss, aber niemand hörte den Schuss. Als er auf die Straße lief, waren alle Türen verschlossen, alle Balkone verwaist, die Luft roch nach Pulver und Pferdemist, und in der Ferne waren Schreie, dröhnende Absätze auf dem Pflaster und natürlich die unentwegten Schüsse zu hören. »Ich wusste es sofort. Die Geräusche kündigten einen Bürgerkrieg an«, sollte mir mein Vater später im Orakelton sagen … Er gefiel sich in solchen Posen, und oftmals legte er mir während unseres (nicht allzu langen) Zusammenlebens eine Hand auf die Schulter, sah mich an, zog eine feierliche Braue hoch und verkündete, dass er dieses vorhergesagt, jenes prophezeit habe. Er erzählte mir von irgendeinem Vorfall, den er aus der Ferne miterlebt hatte, und sagte dann: »Das hat man doch meilenweit gegen den Wind gerochen.« Oder: »Ich begreife nicht, wie sie das nicht merken konnten.« Ja, das war mein Vater: ein Mann, der so sehr von den großen Ereignissen gebeutelt worden war – manchmal die Oberhand behielt, doch meistens unterlag –, dass er ab einem bestimmten Alter diesen merkwürdigen Abwehrmechanismus entwickelte, der darin besteht, Ereignisse vorherzusagen, viele Jahre, nachdem sie geschehen sind.
Aber gestatten Sie mir eine kleine Anmerkung, einen neuen Einschub. Von jeher bin ich der Ansicht gewesen, dass die Geschichte meines Landes in dieser Nacht zumindest unter Beweis stellte, wie viel Sinn für Humor sie besitzt. Ich habe vom großen Geschehen geredet. Ich nehme die Lupe und schaue es mir näher an. Was sehe ich? Welchem Umstand hat mein Vater seine unverhoffte Straflosigkeit zu verdanken? In aller Schnelle: General Melo verlässt in einer Januarnacht betrunken ein Militärbankett, und als er die Plaza de Santander erreicht, wo sich seine Kaserne befindet, trifft er auf einen Gefreiten mit Namen Quirós, einen armen, leichtsinnigen Jungen, der sich zu dieser Nachtzeit ohne Genehmigung auf der Straße herumtreibt. Er erteilt ihm die entsprechende Rüge, mit dem Gefreiten gehen die Pferde durch, er gibt eine unverschämte Antwort, und General Melo fällt keine bessere Strafe ein, als auf der Stelle blankzuziehen und ihm mit einem Säbelhieb die Gurgel durchzuschneiden. Heftiger Skandal in der Bogotaer Gesellschaft, heftige Verurteilung von Militarismus und Gewalt. Der Staatsanwalt erhebt Anklage, gleich wird der Richter den Haftbefehl gegen den Angeklagten unterschreiben. Melo kombiniert tadellos: Die beste Verteidigung ist nicht der Angriff, sondern die Diktatur. Als Kommandant benutzt er sein Veteranenheer für die eigenen Zwecke. Wer kann ihm das zum Vorwurf machen?
Nun gut, obwohl das Folgende billiger Klatsch ist – das typische Geschwätz: unser Nationalsport –, ich will es, caveat emptor, dennoch erzählen. Denn in anderen Versionen kehrt der Gefreite Quirós, nachdem er in einen Straßenkampf verwickelt worden war, spät in die Kaserne zurück und ist bereits verwundet, als er auf Melo trifft. Wieder andere behaupten, Quirós habe von den Anschuldigungen gegen den General erfahren und ihn auf seinem Totenbett aller Schuld entbunden. (Ist das nicht eine hübsche Version? Voll der Mystik einer Meister-Schüler-, einer Mentor-Schützling-Beziehung. In ihrer Ritterlichkeit hat sie meinem Vater bestimmt gefallen.) Aber sieht man von den unterschiedlichen Erklärungen ab, eines ist unbestreitbar: General Melo mit seinem angeklatschten Haar und dem Mona-Lisa-Gesicht mit Doppelkinn war das Instrument, das die Geschichte benutzte, um sich schiefzulachen über das Schicksal unserer jungen Republiken, dieser unausgereiften Erfindungen, für die man kein Patent bekommen hatte. Mein Vater hatte getötet, aber diese Tat verschwand im Nichts, als ein anderer Mann, der seinerseits verhindern wollte, als gemeiner Krimineller vor Gericht gestellt zu werden, beschloss, im Sturm diese großartigen Bollwerke zu Fall zu bringen, von denen jeder Kolumbianer mit Stolz spricht: Freiheit, Demokratie und Institutionen. Und der Engel der Geschichte, der mit seiner phrygischen Mütze im Parkett sitzt, krümmt sich vor Lachen, bis er vom Stuhl fällt.
Richtende Leser, ich weiß nicht, wer als Erster die Geschichte mit einem Theater verglichen hat (mir fällt dieses Verdienst nicht zu), aber fest steht, dass der fragliche Findige nicht die Tragikomik unseres kolumbianischen Stücks kannte, ein Werk mittelmäßiger Dramatiker, ausgestattet von stümpernden Bühnenbildnern, auf die Bühne gebracht von schlampigen Regisseuren. Kolumbien ist ein Stück in fünf Akten, das irgendjemand in klassischen Versen zu schreiben versuchte, und doch kam nur plumpe Prosa heraus, aufgeführt von Schauspielern mit übertriebener Gestik und miserabler Artikulation … Nun gut, zurück zur kleinen Bühne (wie es noch oft geschehen wird) und zu meiner Szene: Türen und Balkone sind verrammelt, die Straßen um den Regierungspalast gleichen einer Geisterstadt. Niemand hat den Schuss gehört, der durch die kalten Steinmauern hallte, niemand hat meinen Vater aus der Kirche Santo Tomás kommen, niemand hat ihn als Schatten durch die Straßen zu seinem Haus eilen und ihn dort zu so fortgeschrittener Stunde eintreten sehen, mit einer noch warmen Pistole in der Tasche. Die kleine Tat wurde durch das große Geschehen ausgelöscht, der winzige Tod irgendeines Mannes aus dem Viertel Egipto durch die drohenden Schatten der Superlativtode, Kulturerbe unserer Heiligen Jungfrau der Schlachten. Aber wie schon gesagt, mein Vater wechselte nur den Feind, denn nachdem der kirchliche Verfolger beseitigt war, saß meinem Vater der militärische im Nacken. Im neuen Bogotá Melos und seiner Putschgenossen wurden Radikale wie mein Vater wegen ihrer erstaunlichen Fähigkeit gefürchtet, Chaos zu stiften – nicht umsonst hatten sie sich auf Revolutionen und politische Aufstände spezialisiert –, und es waren noch keine vierundzwanzig Stunden vergangen, seit der Mann im Poncho oder vielmehr seine Leiche in der Kirche Santo Tomás zu Boden gegangen war, als in der gesamten Stadt schon die Verhaftungswelle anrollte. Radikale, Studenten oder Kongressmitglieder erhielten bewaffneten und wenig liebenswürdigen Besuch von Melos Männern. Die Gefängnisse füllten sich, mehrere Anführer fürchteten bereits um ihr Leben.
Mein Vater erfuhr davon aus dem Mund seiner Genossen. Ein Oberleutnant des abtrünnigen Heers kam mitten in der Nacht und weckte ihn mit ein paar Kolbenschlägen am Fensterrahmen. »In dem Augenblick dachte ich, jetzt ist mein Leben zu Ende«, sollte mein Vater mir lange danach erzählen. Aber so war es nicht. Das Gesicht des Oberleutnants zeigte eine Grimasse, die zwischen Stolz und Schuld schwankte. Mein Vater öffnete schicksalsergeben die Tür, aber der Mann trat nicht ein. Bevor der Tag anbreche, sagte der Oberleutnant, werde ein Trupp kommen und ihn verhaften.
»Und woher wissen Sie das?«, fragte mein Vater.
»Weil es mein Trupp ist«, sagte der Oberleutnant, »ich habe den Befehl gegeben.«
Und er verabschiedete sich mit dem Freimaurergruß.
Erst da erkannte ihn mein Vater. Er war Mitglied des Sterns von Tequendama.