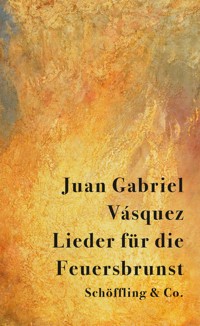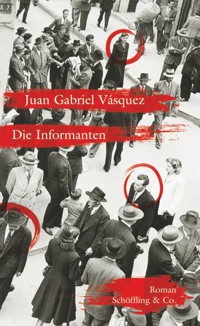21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Im Oktober 2016 besucht der kolumbianische Regisseur Sergio Cabrera eine Retrospektive seiner Werke in Barcelona. Es ist eine schwere Zeit für ihn: Sein Vater Fausto ist vor Kurzem gestorben, seine Ehe ist zerrüttet, und sein Land hat gerade ein Abkommen zurückgewiesen, das nach fünfzig Jahren kriegerischer Gewalt endlich Frieden ermöglicht hätte. Das Wiedersehen mit seinen Filmen und der katalanischen Hauptstadt lenken den Blick zurück auf sein Leben und das seines Vaters. Sie entstammen einer Familie von Antifaschisten, die im Spanischen Bürgerkrieg das Land verlassen und in Südamerika neu anfangen müssen. Durch ihre sozialistische Gesinnung zieht es sie nach China, wo sie alles lernen, was sie für den Kampf gegen die Ungerechtigkeit brauchen. Doch nicht erst als sie sich der kolumbianischen Guerilla anschließen, merken sie, welche Opfer sie dabei bringen müssen. Basierend auf der wahren Geschichte einer Familie von Rebellen, die sich am Ende um ihre tiefsten Überzeugungen betrogen sehen, erzählt Juan Gabriel Vásquez von politischen Erschütterungen mit erschreckend heutiger Resonanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
Erster Teil: Begegnung in Barcelona
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
Zweiter Teil: Die Revolution in den Hotels
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
Dritter Teil: Licht und Rauch
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Epilog
Anmerkung des Autors
Nachweise
Autor:innenporträt
Übersetzer:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Für Sergio Cabrera und Silvia Jardim Soares Für Marianella Cabrera
Denn in unseren Augen sollte ein Roman die Geschichte eines Menschen oder Ereignisses sein, und jede Geschichte eines Menschen oder Ereignisses sollte ein Roman sein.
Ford Madox Ford
Erster Teil
Begegnung in Barcelona
I
Wie mir Sergio Cabrera selbst erzählt hat, war er seit drei Tagen in Lissabon, als er telefonisch vom Schwächeanfall seines Vaters erfuhr. Der Anruf überraschte ihn am Rand der breiten, gepflasterten Parkwege der Praça do Império, wo seine Tochter Amalia, damals fünf Jahre alt, ein widerspenstiges Fahrrad zu bändigen versuchte, das sie gerade geschenkt bekommen hatte. Sergio saß neben Silvia auf einer Steinbank, entfernte sich aber Richtung Parkausgang, als könnte er sich in der Nähe eines anderen Menschen nicht auf die Einzelheiten des Vorfalls konzentrieren. Anscheinend hatte Fausto Cabrera in seiner Wohnung in Bogotá auf dem Sofa Zeitung gelesen, da war ihm in den Sinn gekommen, der Riegel an der Haustür sei nicht vorgeschoben, und beim hastigen Aufstehen war ihm schwindlig geworden. Nayibe, seine zweite Frau, war ihm nachgegangen, er solle sich wieder setzen, sich keine Sorgen machen, der Riegel sei bereits vorgeschoben, und sie konnte den Sturz noch abfedern, bevor Fausto der Länge nach zu Boden ging. Sofort rief sie ihre Tochter Lina an, die für ein paar Tage in Madrid war, und Lina erzählte es nun Sergio.
»Der Notarzt kommt wohl gleich«, sagte sie. »Was sollen wir tun?«
»Warten«, sagte Sergio. »Wird schon alles gut werden.« Aber überzeugt war er nicht davon. Zwar besaß Fausto seit eh und je eine beneidenswerte Gesundheit und die physische Kraft eines zwanzig Jahre Jüngeren, hatte jedoch gerade ereignisreiche zweiundneunzig Jahre vollendet, und in einem solchen Alter ist alles ernster: Die Krankheiten sind bedrohlicher, die Unfälle bedenklicher. Er stand weiterhin um fünf Uhr morgens für seine Tai-Chi-Übungen auf, doch mit immer weniger Energie und immer mehr Zugeständnissen an den Verschleiß seines Körpers. Da er keinen Funken seiner Geistesschärfe verloren hatte, ärgerte ihn das besonders. Das Zusammenleben mit ihm war, nach Sergios spärlichen Informationen, aufreibend und schwierig geworden, und deshalb hatte niemand widersprochen, als er verkündete, er wolle nach Peking und Shanghai reisen. Es war eine dreimonatige Reise an Orte, an denen er glücklich gewesen war, und seine ehemaligen Schüler vom Fremdspracheninstitut würden ihn mit Ehrungen überhäufen. Was sollte es da für Probleme geben? Ja, eine so lange Reise in einem so fortgeschrittenen Alter mochte vielleicht nicht vernünftig sein, aber niemand hatte Fausto Cabrera je davon überzeugen können, etwas nicht zu tun, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Also fuhr er nach China, nahm die Ehrungen entgegen und kehrte nach Kolumbien zurück, rechtzeitig zu seiner Geburtstagsfeier. Und jetzt, wenige Wochen nach seiner Rückkehr vom anderen Ende der Welt, hatte er auf der Strecke zwischen Sofa und Haustür einen Schwächeanfall erlitten und klammerte sich ans Leben.
Und es war nicht irgendein Leben. Fausto Cabrera besaß Rang und Namen, in Theaterkreisen (aber auch bei Film und Fernsehen) sprach man mit dem Respekt von ihm, den Pioniere einflößen, mochten ihn auch immer Kontroversen begleitet haben und Freunde und Feinde sich die Waage halten. Er hatte als Erster die Stanislawski-Methode nicht nur auf Theaterrollen, sondern auf das Rezitieren von Gedichten angewandt; er hatte in Medellín und Bogotá Schulen für experimentelles Theater gegründet und war so kühn gewesen, die Stierkampfarena Santamaría in die Bühne eines Molière-Stücks zu verwandeln. Ende der Vierzigerjahre hatte er durch seine Radiosendungen das Verständnis der Hörer für Lyrik erweitert, und als das Fernsehen nach Kolumbien kam, wurde er zu einem der ersten Regisseure des Fernsehtheaters und zu einem seiner renommiertesten Darsteller. Seinen Ruf in der Theaterszene nutzte er später in turbulenteren Zeiten als Fassade und engagierte sich für den kolumbianischen Kommunismus, was ihm viel Hass einbrachte, bis auch diese Jahre wieder in Vergessenheit geraten waren. Jüngeren Generationen war er vor allem durch eine Filmrolle im Gedächtnis: In Sergios bekanntestem Film Die Strategie der Schnecke, der ihn als Regisseur vielleicht am meisten befriedigt hatte, spielte Fausto den spanischen Anarchisten Jacinto, der im Herzen Bogotás einen kleinen Volksaufstand anführt. Er stellte ihn so natürlich dar, schien so tief in die Haut des Protagonisten geschlüpft zu sein, dass es Sergio, wenn er über den Film sprach, gern so zusammenfasste: »Er hat eben sich selbst gespielt.«
Als er jetzt mit Silvia den Park verließ, auf der einen Seite das Hieronymitenkloster, auf der anderen die Wellen des Tejo, und dabei Amalia im Blick behielt, die weiter vorn mit dem Fahrradlenker kämpfte, fragte sich Sergio, ob er ihn in letzter Zeit nicht öfter hätte besuchen sollen. Einfach wäre es zwar nicht gewesen, denn in seinem eigenen Leben konkurrierten gerade zwei Dinge um Zeit und Aufmerksamkeit und ließen ihm kaum Raum für andere Sorgen: eine Fernsehserie das eine; das andere der Versuch, seine Ehe zu retten. Die Serie handelte vom Leben des Journalisten Jaime Garzón, ein Freund und Kampfgefährte, dessen brillante Politsatiren 1999 ein jähes Ende gefunden hatten, als ihn Killer der extremen Rechten eines frühen Morgens in seinem Pick-up niederschossen, während er an der Ampel auf Grün wartete. Und Sergios Ehe schien gerade auf einen Schiffbruch zuzusteuern, dessen Gründe weder Sergio noch seiner Frau ganz klar waren. Silvia war Portugiesin und sechsundzwanzig Jahre jünger als er; sie hatten sich 2007 in Madrid kennengelernt und einige harmonische Jahre in Bogotá verbracht, bis etwas nicht mehr lief, wie es sollte. Aber was war es? Sie konnten es nicht mit Gewissheit sagen, doch eine vorübergehende Trennung schien ihnen die beste Option zu sein oder zumindest die am wenigsten schädliche, und so war Silvia nach Lissabon gereist, als kehrte sie nicht in ihr Land oder ihre Sprache zurück, sondern als wäre sie dort nur zu Besuch, um einem Unwetter zu entkommen.
Sergio ertrug das Leben ohne sie, so gut er konnte, war sich jedoch bewusst, dass die Trennung ihn mehr belastete, als er sich eingestand. Da bot sich die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte, ohne es zu wissen: Die Filmoteca de Catalunya veranstaltete eine Retrospektive seiner Filme, und die Organisatoren luden Sergio für ein langes Wochenende nach Barcelona ein, von Donnerstag, den 13. Oktober, bis zum folgenden Sonntag. Es ging um die Eröffnung, eine dieser Feiern mit Cava und Live-Musik, endlosem Händeschütteln und Lobeshymnen, bei denen er seine natürliche Schüchternheit immer gewaltsam überwinden musste, sich jedoch nie verweigerte, denn ihm schien, keine noch so große Scheu rechtfertigte Undankbarkeit. Außerdem sollte Sergio drei Tage lang die Vorführung seiner Filme begleiten und anschließend mit einem interessierten, gebildeten Publikum diskutieren. Eine perfekte Gelegenheit. Sergio beschloss sofort, die Einladung nach Barcelona zu nutzen und auf einen Sprung nach Lissabon zu reisen, ein paar Tage mit Frau und Tochter zu verbringen und die zerbrochene Familie zu kitten oder zumindest die Gründe für den Bruch wirklich zu verstehen. Die Filmoteca buchte den Flug nach seinen Wünschen.
Als sich Sergio am 6. Oktober zu Bogotás Flughafen aufmachte, war der Anschlussflug nach Lissabon am nächsten Tag bereits gebucht. Am Gate rief er seinen Vater an. Nie hatte er das Land verlassen, ohne sich telefonisch von ihm zu verabschieden. »Wann kommst du wieder?«, fragte Fausto. »In zwei Wochen, Papa«, sagte Sergio. »Gut, gut«, sagte Fausto. »Dann sehen wir uns, wenn du zurück bist.« »Ja, dann sehen wir uns«, sagte Sergio und dachte, dass sie hier Sätze wiederholten, die sie sich tausendmal bei tausend identischen Telefongesprächen gesagt hatten, und dass diese einfachen Worte nicht mehr ausdrückten, was sie früher einmal ausgedrückt hatten. Sie waren entwertet, wie Münzen, die nicht mehr im Umlauf sind. Auf Barcelonas Flughafen El Prat erwartete ihn einer der Veranstalter der Retrospektive, denn Sergio hatte angeboten, in seinem Handgepäck das nötige Material mitzubringen: vor allem Festplatten mit den Filmen, aber auch Fotos von den Dreharbeiten und sogar ein Originaldrehbuch, das die Filmoteca in einer Vitrine ausstellen wollte. Der Veranstalter war ein dünner junger Mann mit Bart, dicker schwarzer Hornbrille und sah in seinem T-Shirt wie die Karikatur eines Strafgefangenen aus, er nahm den Koffer mit einer Miene unerschütterlichen Ernstes entgegen und fragte Sergio, ob er allein hier sein werde oder noch jemand mitkomme. »Um ein Doppelzimmer zu buchen«, erklärte er. »Wenn das der Fall sein sollte.«
»Mein Sohn kommt«, sagte Sergio. »Er heißt Raúl. Aber die Filmoteca weiß Bescheid.«
Das hatte Sergio vor ein paar Tagen entschieden. Selbst ohne Beziehungsprobleme hätte Silvia ihn nicht begleiten können, denn die Arbeit ließ ihr keine Luft, und zudem wechselte Amalia gerade an eine neue Schule. Also war nichts selbstverständlicher, als Raúl einzuladen, den einzigen Sohn seiner vorigen Ehe, der gerade das letzte Schuljahr absolvierte und in jeder Mail fragte, wann sie sich wiedersehen würden. Seit zwei Jahren hatten sie sich nicht getroffen, denn Raúl lebte mit seiner Mutter in Marbella, abseits von Sergios Reiserouten. Daher würde Raúl am Donnerstagnachmittag nach der Schule das Flugzeug Richtung Barcelona nehmen, gerade rechtzeitig für die Eröffnung, fast drei ganze Tage mit seinem Vater verbringen und ihm noch unbekannte Filme sehen und die bekannten nun mit Klang und Bild eines Kinosaals. Außerdem war Raúl – als wäre all das nicht Grund genug – noch nie in Barcelona gewesen, und die Vorstellung, ihm seine Filme und die Stadt zu zeigen, war für den Vater ein seltsam verführerischer Gedanke. Daran dachte Sergio, als er kurz vor neun Uhr abends in Lissabon landete und beim Ausgang auf Silvias Gesicht stieß. Ihr strahlendes Lächeln gab ihm die Illusion, nach Hause zurückgekehrt und nicht auf Besuch zu sein. Da sah er, dass auch Amalia ihn empfing, und obwohl es schon spät für sie war, brachte das Mädchen die Energie auf, die Arme auszubreiten und sich an seinen Hals zu hängen, und da begriff Sergio, warum dieser Umweg der Mühe wert gewesen war.
Die Wiederbegegnung war so schön, dass ihr nicht einmal die fehlgeleiteten Koffer etwas anhaben konnten. Von den drei, die Sergio in Bogotá aufgegeben hatte, war nur einer wohlbehalten eingetroffen, und die Frau an der gelben Theke bot als einzige Lösung an, Montagfrüh noch einmal zum Flughafen zu kommen. Doch keine Auseinandersetzung, kein Zwischenfall konnte Sergios Glück trüben, seine Familie wiederzusehen. Am Samstagmorgen ließ er sich weitaus früher, als nach der Zeitverschiebung ratsam gewesen wäre, von Amalia bei der Hand nehmen und durch das Viertel Benfica führen, das sich für sie auf die Rua Manuel Ferreira de Andrade und ihre wichtigste Attraktion beschränkte: die Konditorei Califa. Er kaufte ihr ihre Lieblingskroketten, brachte sie zur Geburtstagsfeier einer Freundin, hörte sich ihre portugiesischen Lieder an und versuchte, sie zusammen mit ihr zu singen, und der Sonntag verlief gemeinsam mit Silvia ähnlich. Abends sagte er zu seiner Frau: »Ich bin so froh, dass ich gekommen bin.« Und das stimmte aufs Wort.
Der Anruf seiner Halbschwester Lina war wie ein frontaler Zusammenstoß mit der kruden Realität. Am Morgen hatte er mit Silvia die fehlgeleiteten Koffer am Flughafen abgeholt und auf dem Rückweg ein Fahrrad in Grellrosa für Amalia gekauft, mit batteriebetriebenem Frontlicht und einem Fahrradkorb für ihre Puppe, dazu einen Helm, Ton in Ton mit dem Rahmen. Deshalb waren sie zum Park der Praça do Império vor dem Hieronymitenkloster gefahren, wo die Nachricht sie erreichte. Es war ein Tag mit blank gefegtem Himmel, der Tejo glitzerte weiß; das Pflaster leuchtete so stark, dass Sergio die Augen schmerzten und er sich eine Sonnenbrille aufsetzen musste, als sie zu Silvias Auto gingen. Doch sein Schritt war nicht mehr leicht wie vorhin, das luftige Glück des neuen Fahrrads, die Befriedigung, die ihm der konzentrierte Mund des Mädchens bereitete, als es seinen geraden Kurs beibehalten wollte, waren mit einem Mal zerplatzt.
Es war sieben Uhr abends, als sie die Rua Manuel Ferreira de Andrade erreichten. Vor der Nummer 19 lud Sergio die schweren Koffer aus und schleifte sie unten zur Loggia, während Silvia ums Karree fuhr, auf der Suche nach einem Parkplatz. Da vibrierte wieder das Handy in seiner Tasche, und auf dem Bildschirm erschien dieselbe Nummer, die vorhin angerufen hatte. Sergio nahm den Anruf an und wusste zugleich, was Linas Stimme sagen würde, jedes einzelne Wort, denn es gibt nicht allzu viele, um zu sagen, was Lina sagte. Als Frau und Tochter kamen, saß er immer noch zwischen grün gekachelten Säulen auf dem Marmorboden der Loggia, wie gelähmt, obwohl der kalte Luftzug ihm ins Gesicht wehte, das Telefon noch in der Hand, die traurigen Koffer neben ihm wie zwei Schoßhunde, und doch mit dem Gefühl, dass eine Verkettung von Zufällen ihm gewogen gewesen war, denn er hätte diese Nachricht an keinem anderen Ort der Welt empfangen wollen und in keiner anderen Gesellschaft.
Während Amalia sich auf dem Fahrrad entfernte, griff er nach Silvias Hand und sagte: »Er ist eben gestorben.«
Oben in der Wohnung schloss er sich zuerst in Silvias Schlafzimmer ein, um seine Schwester Marianella anzurufen. Während langer Telefonsekunden weinten beide gemeinsam, ohne ein Wort sagen zu müssen, teilten nur das entsetzliche Gefühl, dass ein ganzes Leben – nicht nur das von Fausto Cabrera – ein Ende gefunden hatte. Marianella war zwei Jahre jünger als Sergio, aber aus Gründen, die sie sich nie zu erklären versucht hatten, war es ein fast inexistenter, willkürlicher Unterschied, vielleicht weil ihre Charakterzüge ihn ausglichen. Die jüngere Schwester war immer die Kühnere gewesen, rebellischer, widerständiger; der ältere Bruder schien dagegen mit dem Laster der Grübelei und Unschlüssigkeit geboren worden zu sein. Aber sie hatten so viel zusammen erlebt, so viel anderes als das, was ihnen in die Wiege gelegt worden war, dass sie von klein auf eine besondere Loyalität füreinander empfanden: die Loyalität derer, die wissen, dass ihr Leben für andere immer unbegreiflich bleiben wird und sie nur glücklich sein können, wenn sie es akzeptieren und sich nicht dagegen auflehnen. Sergio versuchte aus der Ferne die Trauer seiner Schwester zu lindern, und ihm fiel kein besserer Weg ein, als ihr alles zu sagen, was er über den Tod seines Vaters wusste. Er erzählte ihr von dem Sofa, auf dem er Zeitung gelesen hatte, wie er trotzig aufgestanden war, um die bereits verriegelte Haustür zu verriegeln, von der Ohnmacht in den Armen seiner Frau. Er erzählte ihr, dass Fausto es nicht einmal bis in den Notarztwagen geschafft hatte, denn als die Sanitäter kamen, zeigte er schon keine Lebenszeichen mehr. Die Todesurkunde war gleich vor Ort ausgestellt worden, im eigenen Wohnzimmer, und jetzt warteten sie auf die Leute vom Bestattungsinstitut.
Das hatte ihm Lina erzählt und mit einem seltsamen Satz geendet, zugleich kryptisch und etwas geschwollen: »Er ist aufrecht gestorben, Sergio. Wie er gelebt hat.«
Es war Montag, der 10. Oktober 2016. Die Eröffnungszeremonie in der Filmoteca war für Donnerstag, den 13. vorgesehen, abends um halb acht. Nach dem Gespräch mit Marianella wirbelten Sergio mathematische Berechnungen durch den Kopf, Flugzeiten, Zwischenlandungen, vor dem Computer verglich er die möglichen Routen zwischen Spanien und Kolumbien. Obwohl er die Zeitverschiebung gegen sich hatte, stellte er fest, dass es mit etwas Beeilung nicht unmöglich war, nach Bogotá zu reisen, zum letzten Mal das Gesicht seines Vaters zu sehen, mit Nayibe zu sprechen, Marianella zu umarmen und mit höchstens einem Tag Verspätung wieder zurück in Barcelona zu sein und an der restlichen Retrospektive teilzunehmen, seine Filme zu sehen und Publikumsfragen zu beantworten. Doch nach dem Abendessen mit Silvia und Amalia legte sich Sergio auf das graue Sofa vor dem ausgeschalteten Fernseher und wusste nicht, wann genau ein Gefühl in ihm hochkam, das er noch nie verspürt hatte. Hier, in dieser fremden Wohnung mit den Holzböden, war seine Familie, die Familie, die ihm bereits einmal entglitten war; in Barcelona erwartete ihn Raúl, und diese Reise hatte plötzlich die Gestalt einer Wiederbegegnung angenommen. Vielleicht hatte Sergio all das im Sinn, als er eine Entscheidung traf, die ihm damals nicht so merkwürdig zu sein schien, wie sie ihm später vorkam.
»Ich fliege nicht«, sagte er zu Silvia.
Er würde nicht nach Bogotá fliegen, nicht zum Begräbnis seines Vaters gehen. Seine Verpflichtungen gegenüber der Filmoteca, würde er jedem erklären, der Erklärungen verlangte, ließen ihm nicht genügend Zeit, hin und zurück zu fliegen; er dürfe die Arbeit und das Geld nicht geringschätzen, die die Veranstalter in die Hommage gesteckt hatten. Ja, das war die Lösung. Es tut mir so leid, würde er der Frau seines Vaters sagen, ohne zu lügen. Er hatte eine herzliche Beziehung zu ihr, die jedoch in all den Jahren des Umgangs miteinander niemals der Vertrautheit nahe gekommen war. Sie würde Sergio dort nicht brauchen; und aus Gründen, für die es keine klaren Worte gab, fühlte er sich nicht wirklich willkommen in Bogotá.
»Bist du sicher?«, fragte Silvia.
»Bin ich«, sagte Sergio. »Ich habe es mir reiflich überlegt. Und mein Platz ist bei den Lebenden, nicht bei den Toten.«
In Kolumbien brachten alle Medien die Nachricht von Fausto Cabreras Tod. Als Sergio am Mittwoch aus aschgrauem Mittagshimmel in Barcelona eintraf, quollen die kolumbianischen Zeitungen schon über von der Lebensgeschichte seines Vaters. Las man die Meldungen, hätte man den Eindruck haben können, im ganzen Land gebe es keinen einzigen Schauspieler, der nicht gemeinsam mit ihm Unterricht bei Maestro Seki Sano genommen hätte, keinen einzigen Theatergänger, der nicht bei Der eingebildete Kranke in der Stierkampfarena gewesen wäre, keinen einzigen Kollegen, der ihn nicht angerufen und beglückwünscht hätte, nachdem er vom Kulturministerium den Preis für sein Lebenswerk bekommen hatte. Die Radiosender kramten alte Aufnahmen von Fausto hervor, der Gedichte von José Asunción Silva oder León de Greiff rezitierte, und aus irgendeinem Winkel des Internets kam wieder ein Artikel zum Vorschein, den Sergio einige Jahre zuvor in ABC in Madrid veröffentlicht hatte. »Seine Herkunft«, hatte er dort geschrieben, »ehrt nicht etwa, wer sein Leben lang zu beweisen versucht, dass sein Land das bessere ist, sondern wer das Land groß zu machen versucht, das ihn aufnimmt; eben so ehrt man am besten das Land, in dem man das Licht der Welt erblickt hat.« Die sozialen Netzwerke trugen das Ihre bei. Aus ihren Kloaken krochen anonyme Gestalten oder hochtönende Pseudonyme – Patriot, Fahnenträger, Großkolumbianer –, die an Fausto Cabreras kämpferische Vergangenheit und seine Beziehung zur maoistischen Guerilla erinnerten und erklärten, der einzig gute Kommunist sei ein toter Kommunist. Auf Sergios Handy trafen laufend Anrufe von unterdrückten oder unbekannten Nummer ein und auf WhatsApp Gesuche oder Bitten, die er mit aller Höflichkeit, derer er fähig war, zurückwies. Er wusste, er konnte sich nicht für immer verstecken, aber ein paar Stunden lang – je mehr, desto besser – wollte er die Erinnerung an seinen Vater für sich allein behalten, all die Erinnerungen – die guten wie die anderen –, die bereits über ihn hereinbrachen.
Die Filmoteca de Catalunya hatte ihn in einem Luxushotel an der Rambla del Raval untergebracht, einer dieser Orte, an denen die Wände Fenster und alle Lichter verschiedenfarbig sind, doch ihm blieb keine Zeit, das Zimmer zu genießen. Die Veranstalter führten ihn gleich mittags zum Willkommensessen in ein Restaurant im Viertel. Auch wenn sie es nicht erwähnten, merkte Sergio doch, dass alle Bescheid wussten. Sie hatten die bemühte Miene derer, die das Terrain sondieren, um zu sehen, wie viel Mitgefühl erlaubt ist und wann man die Grenze zum Lächeln überschreiten darf. Der Programmdirektor, ein liebenswürdiger Mann mit großen Augen und randloser Brille, dessen buschige Brauen sich fast zärtlich anhoben, wenn er vom Kino sprach, unterbrach vor dem Dessert das Tischgespräch, dankte Sergio für seine Anwesenheit und stellte dann klar, dass sie zwar glücklich über sein Kommen seien, es ihm jedoch freistehe, nach Kolumbien zu fliegen, wenn ihm das lieber sei. Die Retrospektive sei bereits organisiert, die Filme befänden sich in der Filmoteca, die Ausstellung sei aufgebaut, und wenn Sergio die Teilnahme absagen wolle, um bei seiner Familie zu sein und seinen Vater zu beerdigen, hätten sie volles Verständnis dafür. Sergio hatte sich bereits ein Bild von ihm gemacht: Octavi Martí hatte mehrere Kino- und Fernsehfilme gedreht und sprach von den großen Regisseuren mit der Vertrautheit, die nur die besitzen, die sie wirklich verstanden haben. Manchmal schien es, als hätte er alle Filme der Welt gesehen oder als Filmkritiker über jeden von ihnen geschrieben. Sergio mochte ihn sofort, doch das war nicht der einzige Grund für seine Antwort.
»Nein, ich bleibe«, sagte er.
»Du könntest fliegen und für die Abschlussveranstaltung zurückkommen, wenn du magst. Am Ende gibt es einen Cocktailempfang, du redest mit den Leuten und fertig.«
»Danke«, sagte Sergio. »Aber abgemacht ist abgemacht.«
Gegen Ende des Mittagessens setzte sich auf den Stuhl zu seiner Rechten, der beim Kaffee rätselhafterweise geräumt worden war, eine junge Frau mit einer Mappe, deren Inhalt – mehrere Seiten wohlgeordneter Information – sie ihm mit allzu geduldiger Lehrerinnenstimme erklärte. Nacheinander ging sie mit ihm all die Interviews durch, die der Geehrte in den nächsten Tagen geben sollte, eine lange Liste, in Zeitung, Radio und Fernsehen. Auf der weißen Seite schienen sie ein breiter Fluss zu sein, den Sergio wie bei der militärischen Ausbildung seiner Jugend zu durchschwimmen hatte. Die Mappe enthielt auch das Programm der Retrospektive:
13. Oktober: Alle gehen fort (2015). Gesprächsrunde und Fragen des Publikums.
14. Oktober: Aufstand im Stadion (1998). Gesprächsrunde und Fragen des Publikums.
15. Oktober: Die Strategie der Schnecke (1993). Gesprächsrunde und Fragen des Publikums.
16. bis 19. Oktober: Verlieren ist eine Frage der Methode (2004), Ilona kommt mit dem Regen (1996), Techniken des Duells (1989) und Adler jagen keine Fliegen (1994). Vorführungen ohne Teilnahme von Sergio Cabrera.
Sergio dachte, dass man hätte hinzufügen können: Vorführungen in einer Welt, in der es meinen Vater nicht mehr gibt. Dieser Gedanke erschütterte ihn, denn Fausto Cabreras Gespenst war in jedem dieser Filme gegenwärtig, und in vielen nicht als Gespenst, sondern leibhaftig: als spanischer Anarchist, als Portier in einem Hafenhotel, als Pfarrer, der ein Begräbnis zelebriert. Seit seinem ersten Kurzfilm – über Alexander von Humboldts Reise durch Kolumbien – hatte er keinen Film beendet, ohne sich zu fragen, was sein Vater darüber denken würde; und nie hatte er sich Gedanken darüber gemacht, wie es sein würde, diese Filme in einer neuen, verwaisten Welt zu sehen, oder ob die Filme sich womöglich verändern, wenn die Welt draußen, die nicht gefilmte Welt, sich so gewaltsam verändert hat: ob Einzelbilder oder Dialogzeilen sich verändern, wenn der Mensch nicht mehr da ist, der sie in mehr als einer Hinsicht möglich gemacht hat. Während er mit der jungen Frau über das Programm sprach, trat Octavi Martí zu ihnen. Ihm war aufgefallen, dass die ersten drei Filme, die in Sergios Gegenwart vorgeführt werden würden, eine umgekehrte Chronologie beschrieben: vom jüngsten zum ältesten. War das Absicht gewesen?
»Nein, aber es ist gut so«, sagte Sergio mit einem Lächeln. »Ein Blick zurück, nicht wahr? Also eine echte Retrospektive.«
Vom Restaurant ging er direkt ins Hotelzimmer. Der barcelonesische Nachmittag war der kolumbianische Morgen: der Morgen des Begräbnisses. Er wollte mit Marianella sprechen, für die es ein besonders trauriger Moment war. Nach einer Reihe unüberwindbarer Konflikte war die Beziehung zu ihrem Vater in letzter Zeit getrübt gewesen und dann ganz abgebrochen. Deshalb lag Zorn in ihrem Weinen, als sie den Anruf beantwortete, denn nach dieser schmerzlichen Entfernung hätte sie das Sterben des Vaters gern begleitet. Doch niemand hatte ihr rechtzeitig Bescheid gesagt, und sei es nur, damit sie ihr Recht auf Besorgnis ausüben konnte; man hatte sie auch nicht ins Haus des Vaters eingeladen, damit sie an den Todesriten teilnahm. »Sie haben mir nicht Bescheid gegeben«, klagte Marianella. »Sie sagen, ich hätte Papa in den letzten Jahren alleingelassen, allein im Alter … Sie verstehen gar nichts, Sergio, sie wissen nichts, verstehen nichts.« Die unterschwelligen, nie ausgesprochenen Spannungen, die es in allen Familien gibt, die Missverständnisse und Worte, die nicht gesagt werden oder zur Unzeit, die falsche Vorstellung, die wir uns davon machen, was sich im Kopf oder in der Seele des anderen abspielt: Dieses komplexe Netz aus Schweigen verschwor sich jetzt gegen die Gelassenheit, und traurig sagte Marianella, dass auch sie nicht an dem Begräbnis teilnehmen werde.
»Nein, das ist unmöglich«, sagte Sergio. »Du bist da, du musst hingehen.«
»Und du?«, sagte sie. »Warum bist du nicht hier?«
Sergio wusste keine Antwort. Mit wolkigen Begründungen schaffte er es schließlich, seine Schwester zu überreden: Da ihre Mutter vor neun Jahren gestorben und Sergio nicht im Land sei, vertrete sie nun die Familie, müsse sie repräsentieren.
An dem Nachmittag gab er sein erstes Interview in der Hotelhalle. Die Journalistin erklärte ihm, es sei für eine Sonderseite – die Rückseite von La Vanguardia – und sie beginne immer mit einem kurzen biografischen Resümee, sodass Sergio sich plötzlich eine Art Polizeiprotokoll erstellen sah: sechsundsechzig Jahre alt, drei Ehen, vier Kinder; in Medellín geboren, hat in China gelebt und in Spanien gearbeitet; Atheist. Es überraschte ihn nicht, dass die erste Frage nach diesem Verhör keine Frage war, sondern eine Beileidsbekundung: »Das mit Ihrem Vater tut mir leid.« Unvorbereitet traf ihn dagegen seine Antwort, nicht nur, weil sie auch für ihn unerwartet kam, sondern weil er das unangenehme Gefühl hatte, mehr als nötig gesagt zu haben, als würde er jemanden denunzieren.
»Ja, danke«, sagte er. »Er ist heute gestorben, und ich werde nicht an seinem Begräbnis teilnehmen können.«
Das war natürlich gelogen, eine willkürliche Verschiebung um achtundvierzig Stunden, die dort, im grellfarbenen Sessel der Hotelhalle, nicht von Bedeutung sein mochte. Sie würde der Journalistin kaum auffallen, und wenn doch, würde sie es problemlos der Benommenheit des Schmerzes zuschreiben, dieser Orientierungslosigkeit, nachdem man gerade einen Angehörigen verloren hat. Aber warum? Warum hatte er gelogen? Er fragte sich, ob er sich womöglich doch für seine Entscheidung schämte, nicht zum Begräbnis zu gehen, als wäre die Scham eine Reisegefährtin, die verspätet aufbricht und uns einholt. Die Journalistin wollte mehr über seinen Vater wissen, Sohn einer Offiziersfamilie, die Francos Staatsstreich nicht unterstützt hatte, Republikaner im kolumbianischen Exil. Sergio beantwortete weiterhin gewissenhaft die Fragen, doch dieser Verrat an seinen eigenen Gefühlen ließ ihm keine Ruhe.
»Ach, dann hat er hier gelebt?«, fragte die Journalistin. »Hier, in Barcelona?«
»Ja, wenn auch nicht lang«, sagte Sergio.
»Und wo genau?«
»Das weiß ich nicht«, gab Sergio zurück. »Das hat er mir nie erzählt. Er hat sich wohl nicht daran erinnert.«
Er gab noch zwei weitere Interviews und entschuldigte sich dann bei der Filmoteca, er sei müde, werde allein essen und dann schlafen gehen. »Besser, viel besser«, sagten sie, »denn morgen beginnt die wirkliche Arbeit.« Er ging auf sein Zimmer, dessen dicke Scheiben den Lärm der Grüppchen erstickten, die unter den Palmen tranken, und wollte sich hinlegen, die Augen schließen und ein wenig ausruhen. Doch es gelang ihm nicht. Er dachte an die Fragen, die man ihm gestellt und die er so gut wie möglich beantwortet hatte, sosehr er sich bewusst war, dass es kaum Schwereres gab, als über den Film zu reden, denn Worte verwirrten alles und führten nur zu Missverständnissen; und doch war er jetzt dankbar für diesen Zwang, der ihn vom Schmerz ablenkte und die Traurigkeit in Schach hielt. Er hatte Wendy Guerras Roman gelobt, auf dessen Geschichte einer seiner Filme beruhte, hatte Erklärungen zu Aufstand im Stadion gegeben, eine Komödie, in der Guerilleros und Polizisten einen Waffenstillstand vereinbaren, um ein Fußballmatch zu sehen, hatte von Verlieren ist eine Frage der Methode und seiner Freundschaft mit dem Romancier Santiago Gamboa gesprochen. Und unzählige Male hatte er bei den Fragen über Die Strategie der Schnecke seinen Vater erwähnen müssen, der den Bürgerkrieg eben hier, in Barcelona, erlebt hatte, bevor die Jahre des Exils oder seiner Irrfahrt begannen, die ihn am Ende nach Kolumbien geführt hatte. Aber wo, in welcher Gegend der Stadt hatte er gelebt? Sein Vater hatte es ihm nie gesagt, oder Sergio hatte es vergessen.
Er konnte nicht einschlafen. Die Müdigkeit, wenn sie überhaupt da gewesen war, hatte sich aus seinen Augen verflüchtigt. Vielleicht waren es die letzten Ausläufer des Jetlags, denn seit seiner Ankunft aus Kolumbien waren kaum fünf Tage vergangen, vielleicht lief Strom durch seinen schlaflosen Körper, jedenfalls konnte Sergio nicht im Bett bleiben. Er zog sich eine Jacke über, denn die Temperatur war jäh gesunken, sah sich die Prospekte im Zimmer an, fand ein paar Werbefotos, die ihm gefielen, und ging nach einigen Minuten auf die Dachterrasse, suchte sich einen freien Stuhl und blickte in diese beginnende Nacht, die Nacht der Altstadt, die sich bis zum Meer erstreckte. Der Himmel war klar geworden, und eine Böe wirbelte die Servietten durcheinander. Sein hoher Barstuhl stand vor einem Glastisch, und er hatte das Gefühl, fast auf die Straße zu stürzen. Er wusste nicht, was zuerst kam, die Kellnerin mit dem Glas Rotwein oder diese unbequeme Frage, doch da war sie wieder: Wenn er erklären müsste, warum er nicht nach Bogotá gefahren war, um zum letzten Mal das Gesicht seines Vaters zu sehen, was würde er sagen? Natürlich, um bei Silvia und Amalia zu bleiben; um sich hier in Barcelona mit seinem Sohn Raúl zu treffen. Gut, aber war das alles? War da nicht noch etwas anderes?
Unten leuchteten allmählich die Lichter des Viertels auf, zu seiner Linken zog die Lichtschnur der Ramblas den Blick an und führte ihn zum Hafen, zur unsichtbaren Kolumbussäule. Am Himmel waren die Lichter der Flugzeuge zu sehen, die sich El Prat näherten. Er zog sein Handy hervor – das weiße Licht störte das Halbdunkel der Bar und ließ die Nachbarn aufblicken – und sah seine WhatsApp-Nachrichten durch. Er zählte siebenundzwanzig Beileidsschreiben, bevor er auf eine Zeile von Silvia stieß: Wie geht es dir? Er antwortete: Gut. Ich will es dir nicht verheimlichen, ich denke an dich. Ich will, dass das funktioniert. Und sie: Wichtig ist jetzt, dass du an deinen Papa denkst. Denkst du an ihn? Und er: Ich erinnere mich an einiges, ja. Doch es waren verschwommene Erinnerungen, die sich nicht zeigen wollten oder sich dagegen sträubten, unangenehme Erinnerungen, die ihn da mitten in der ruhigen Nacht als Andeutungen überfielen, in dieser Einsamkeit, die am nächsten Tag, wenn Raúl kommen würde, auf immer verloren wäre. All die Konflikte, schrieb Sergio. Obwohl wir so viel zusammen gemacht haben, in China, in der Guerilla, im Kino, im Fernsehen, ist die Bilanz der Erinnerungen, sosehr ich sie schönreden möchte, nicht positiv. Er blickte auf. Ein weiteres Flugzeug flog vorüber, doch diesmal musste es näher sein, denn man konnte in der Ferne sein Rauschen hören. Und doch weiß ich und sage es, sooft ich kann, dass ich ein Schüler meines Vaters bin. Nie hätte ich tun können, was ich getan habe, wenn ich nicht in seiner Welt aufgewachsen wäre. Er ließ das Handy sinken und sah wieder auf, das Flugzeug durchpflügte immer noch den tiefen Himmel, flog Richtung Süden, dem Flughafen oder dem Ort entgegen, an dem Sergio den Flughafen vermutete. Da vibrierte das Handy (bestimmt hatte Silvia geantwortet), doch Sergio sah nicht auf den Bildschirm, sein Blick, der dem Flugzeug oder seinen winzigen Lichtern gefolgt war und nun die Stadt mit ihren niedrigen Häusern erfasste, stieß nun auf etwas anderes: auf die Umrisse eines Berges, der sich am Horizont ausstreckte wie ein schlafendes Tier, darüber der glühende Glanz der Festung. Er spürte, dass etwas in seiner Brust in Unordnung geriet, obwohl er sich sicher war, noch nie auf dieser oder einer ähnlichen Terrasse in Barcelona gewesen zu sein, doch einen Grund musste es geben für diese unerwartete Emotion, die ihn überfiel, als er feststellte, dass man von hier, von der Hotelterrasse aus, den Montjuïc sehen konnte.
II
Von der Dachterrasse konnte man den Montjuïc sehen. Fausto, damals dreizehn, stieg gern mit seinem Bruder Mauro aufs Dach und sah sich den Himmel und das ferne Meer an und Francos Flugzeuge dort oben, die die widerständige Stadt überflogen. Der Bürgerkrieg war vieles zugleich: ein Pfarrer, der im Viertel vom Kirchturm auf die unbewaffnete Menge schießt, aber auch dieses Pfeifen einer rolligen Katze, das eine Bombe kurz vor dem Aufprall von sich gibt, und ebenso das Beben der Explosion, das man im Magen spürt wie ein Grimmen in den Eingeweiden. Der Krieg bedeutete für die Brüder, sich unter dem Esstisch zu verstecken, wenn die Umrisse einer feindlichen Junkers über den Himmel wanderten. Dann lernten sie, bei Sirenengeheul in den Luftschutzbunker zu flüchten; doch bald schon wurden die Sirenen alltäglich, und sie gaben die Gewohnheit auf. Dann versteckte sich im Bunker nur noch Pilón, der Wolfshund der Familie. Fausto hörte Bomben, die anderswo niedergingen – nah oder fern, aber anderswo –, und als er die Erwachsenen danach fragte, erfuhr er, dass die Flugzeuge von den Balearen kamen, die bereits an Franco gefallen waren, doch zugleich beruhigte man ihn, Barcelona werde niemals in die Hände der Faschisten fallen. Warum nicht? Weil sein Vater das sage.
Er hieß Domingo Cabrera. Zu Kriegsbeginn besaß er noch einen durchtrainierten Körper, war außerdem Hobbydichter und Gitarrenspieler mit einer guten Stimme und dem Gesicht eines Filmschauspielers. Er war ein Abenteurer. Mit sechzehn hatte er das Provinzleben auf den Kanaren leid gehabt, seine Habseligkeiten gepackt und das nächste Schiff nach Amerika genommen. Er hatte gerade einmal genug Geld zusammengekratzt, um an Bord gelassen zu werden, musste sich die Überfahrt aber im Schweiße seines Angesichts verdienen, in seinem Fall buchstäblich, denn zur Empörung und Faszination der Passagiere organisierte er gemeinsam mit einem Gefährten auf dem Deck Schaukämpfe im Freistilringen. Auf dieser abenteuerlichen Reise machte er Station in Kuba, arbeitete auf den Feldern Argentiniens und verwaltete eine Hazienda in Guatemala, wenige Kilometer von Antigua entfernt. Dort lernte er den spanischen Oberst Antonio Díaz Benzo kennen, vom König persönlich dorthin geschickt, damit er eine Militärakademie eröffnete. Und damit änderte sich sein Leben.
Im Kuba-Krieg wurde er zu einem Helden, an dessen Uniform kein weiterer Orden mehr Platz gefunden hätte. Was dann kam, hatte niemand vorhergesehen: Domingo, der junge Draufgänger, verliebte sich in Julia, die Tochter des Offiziers, und schlimmer noch, die Offizierstochter verliebte sich in den jungen Draufgänger. Julia Díaz Sandino war eine Aristokratin aus Madrid und eingefleischte Monarchistin. Eine unwahrscheinlichere Beziehung war kaum denkbar. Doch man bedachte nicht, dass die Monarchistin auch eine eifrige Leserin spanischer Dichtung war, Lope de Vega rezitierte, solange es kein obszönes Gedicht war, und den Guatemalteken vom Nicaraguaner Rubén Darío erzählte, als stammte der aus Madrid. Das frischgebackene Ehepaar kehrte nach Las Palmas auf die Kanaren zurück. Dort, in einem Haus in der Calle Triana mit Blick aufs Meer, in einem Zimmer, dessen Fensterrahmen in der Salzluft abblätterten, kamen ihre Kinder auf die Welt – Olga, Mauro und Fausto –, und dort wären sie ihr Leben lang geblieben, wäre dieses Leben nicht aus heiterem Himmel aus dem Gleis geraten.
Eines Abends, sie hatten den kleinen Fausto gerade zu Bett gebracht, klagte Julia zum ersten Mal über Halsschmerzen. Man schrieb sie dem Herbstanfang zu – gewiss habe sie etwas aufgeschnappt –, doch die Schmerzen wurden mit den Tagen immer stärker, dann fast unerträglich. Binnen Wochen hatte ein Arzt einen aggressiven Krebs diagnostiziert und gab ihr eine aufrichtige Empfehlung: Sie solle lieber in die Hauptstadt reisen, dort habe man eine neue Behandlung entdeckt.
»Was für eine?«, fragte Domingo.
Der Arzt antwortete fachmännisch.
»Die Trigeminuspunktion«, sagte er. »Der Name ist sogar hübsch.«
Es herrschten schwere Zeiten, als sie in Madrid eintrafen. Die Monarchie unter Alfonso XIII. wurde schon seit Monaten vom Gespenst der Republik bestürmt, und obwohl man es noch in Schach hielt, bezweifelte niemand, dass sich in Spanien etwas ändern würde. Doña Julia litt mit ihrem König, denn in ihrer Familie gab es die übermächtige Gestalt des heroischen Oberst, der im Kuba-Krieg das Territorium der Krone verteidigt hatte, aber zugleich litt sie auch mit ihrem Bruder Felipe Díaz Sandino, einem der großen Piloten der spanischen Luftfahrt. Der Luftwaffenkommandeur Díaz Sandino von Aire de Cataluña zählte zu den Persönlichkeiten, die ihr Familienwappen auf die Brust tätowiert zu tragen scheinen, und das Wappen enthielt zehn unheilverkündende Wörter: Lebe das Leben, auf dass es lebendig bleibe im Tod. Julia wäre stolz auf ihn gewesen und hätte diesen Stolz an ihre Familie weitergegeben, hätte Onkel Felipe, der die Cabreras jeden zweiten Tag besuchte, nicht drei Fehler gehabt: Zum einen war er überzeugter Republikaner, zum anderen war er an einer Verschwörung zum Sturz des Königs beteiligt, und zum Dritten hatte er Domingo überzeugt, sich den Verschwörern anzuschließen.
1930 warteten sie eines Nachts vergebens auf Domingo, der gewöhnlich früh nach Hause kam, um sich um seine krebskranke Frau zu kümmern. Niemand wusste etwas, niemand hatte ihn tagsüber gesehen, niemand konnte versichern, dass nichts Beunruhigendes geschehen war. In Madrid wehte bereits der Wind des Umsturzes, und in einer solchen Stadt kann es zu ernsten Vorfällen kommen, ohne dass man davon erfährt. So gingen sie zu Bett – Fausto sollte sich später erinnern, dass ihm die üblichen Worte seiner Eltern damals, nein, da passiere nichts weiter, das seien Erwachsenengeschichten, schon immer als Lüge vorgekommen waren –, und sie hatten gerade zwei Stunden geschlafen, als sie von Kolbenschlägen an der Tür geweckt wurden. Es waren drei Sicherheitsbeamte, die nicht den Hut abnahmen oder ihre Pistolen wegsteckten, sondern gewaltsam wie in das Haus eines Verbrechers eindrangen und nach Felipe Díaz Sandino fragten, Türen auftraten und unter die Betten sahen. Als sie sich davon überzeugt hatten, dass Onkel Felipe nicht da war, fragten sie nach dem Hausherrn. Julia sah einen nach dem anderen an.
»Der ist auch nicht da«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen.«
»Nun, dann sagen Sie ihm, Señora, sobald Sie ihn sehen«, sagte einer der Beamten, »dass wir ihn in der Zentrale erwarten.«
»Und wenn ich ihn nicht sehe?«
»Das werden Sie«, sagte der Mann. »Das werden Sie, kein Zweifel.«
Sie sah ihn in der Morgendämmerung. Domingo kam so leise, dass Fausto seine Rückkehr erst bemerkte, als er die Mutter weinen hörte. Er brachte keine guten Nachrichten: Die Polizei hatte sie beide verfolgt, Domingo und Onkel Felipe, und nachdem sie sich stundenlang versteckt hatten und von Haus zu Haus, von Café zu Café geflüchtet waren, um ihre Verfolger abzuschütteln, hatte man sie eingeholt. Domingo hatte entwischen können, aber Onkel Felipe war festgenommen worden, wegen Verschwörung gegen König Alfonso XIII., und saß im Militärgefängnis.
»Gut, gehen wir ihn besuchen«, sagte Doña Julia.
»Was redest du da«, schimpfte Domingo. »Du bist krank.«
»Dafür bin ich nicht zu krank«, sagte sie. »Wir gehen sofort. Und zwar alle.«
Fausto war sechs, als er zum ersten Mal ein Gefängnis betrat. Für Olga und Mauro war es bloß ein düsterer, hässlicher Ort, auf Fausto dagegen wirkte das Gefängnis verkommen und gefährlich, und Onkel Felipe litt dort, weil er ein gerechter Mann war oder gegen die Ungerechtigkeit kämpfte. Aber das entsprach nicht den Tatsachen. Der Ort war weder verkommen, noch gab es klaustrophobische Gänge, und Onkel Felipe hatte auch keine Foltern oder Misshandlungen erlitten. Die Militärgefängnisse, vor allem für adlige Offiziere mit Orden an der Brust, waren eher bequeme Orte. Aber all das war Fausto egal. Die Tage im Gefängnis machten Onkel Felipe zu seinem Helden. Die Familie besuchte ihn während seiner Haft jede Woche, und Fausto umarmte Onkel Felipe, als käme er gerade aus dem Krieg zurück. Julia flehte ihren Bruder an: »Sag ihm, dass alles gut wird, bitte, der Junge bekommt kein Auge zu. Sag ihm, dass sie dich nicht foltern, dass sie dich gut behandeln und du bald frei sein wirst.« Onkel Felipe ging sogar noch weiter: »Ich werde bald frei sein, Fausto«, sagte er ihm, »und wenn ich draußen bin, ist Spanien eine Republik.«
An diese Worte musste Fausto später denken, als er die Leute auf der Straße feiern sah. Onkel Felipe wurde auf den Schultern durch Madrid getragen, man hielt mit der einen Hand sein Bein, wedelte mit der anderen eine dreifarbige Fahne und schmetterte die Riego-Hymne, während Doña Julia in ihrem Zimmer weinte und jammerte, die Welt gehe unter. Über Monate wurden die Tischgespräche unerträglich, denn Julia war nicht in ihrer Überzeugung zu erschüttern, dass die Familie zur Hölle verdammt war, wie ihr auch der Pfarrer bestätigte, den sie möglichst oft anschleppte. Domingo und Onkel Felipe hatten sich zu einem Bündnis zusammengetan, das eher einer Mafia glich. Dank Onkel Felipe hatte Domingo nun eine halbe Stelle im Innenministerium, wurde jedoch abends zu etwas anderem: zum Geheimagenten für den Nachrichtendienst. Fausto und seine Geschwister hatten strenge Anweisungen, nicht über diese Tätigkeit zu reden, denn – erklärte man ihnen – die Wände hätten Ohren.
An dem Tag, an dem sein Vater mit der Nachricht zu ihm kam, war er vormittags allein zu Hause gewesen, durch die Zimmer gestreift und schließlich vor dem Schrank stehen geblieben, in dem Domingo seine Sachen aufbewahrte. Wie durch ein Wunder war er nicht abgeschlossen. Die Gelegenheit wollte sich Fausto nicht entgehen lassen. Er fand darin die Blechmarke eines Inspektors, fand eine Waffe ohne Magazin, zog sie aus dem Etui und streichelte sie gerade, im Kopf gefährliche, gewalttätige Szenen, als sein Vater plötzlich die Tür öffnete. Sein Gesicht war verzerrt von Emotionen, und mit einer Stimme, die Fausto an ihm nicht kannte, verlangte er oder bat eher: »Komm dich verabschieden.« Er brachte ihn in ein anderes Zimmer. Fausto sah dort im Bett einen Körper, ein Gesicht unter einer weißen Binde, die nur die geschlossenen Augen frei ließ. Er küsste die Binde und würde später denken, das kalte Gesicht seiner Mutter nicht mit den Lippen berührt zu haben war keineswegs ein Trost gewesen, sondern eine verpasste Gelegenheit, die er immer bereuen würde.
Der Tod seiner Mutter war Vorbote für anderes Unheil. Als einige Jahre später der Krieg ausbrach, war sich Fausto nicht sicher, ob es für seine Mutter besser gewesen war, das nicht mehr erlebt zu haben, doch zugleich hatte er die unbehagliche Gewissheit, dass der Krieg anders für ihn gewesen wäre, weniger entsetzlich und weniger einsam, wenn er auf sie hätte zählen können. Inzwischen suchte er Trost in ihren Büchern, von denen manche bereits auseinanderfielen, so zerlesen waren sie, während andere noch unbeschnitten waren. So entdeckte er Bécquer (zerlesen) und Pedro Salinas (unbeschnitten), García Lorca (unbeschnitten) und Manuel Reina (zerlesen). Domingo hatte nichts dagegen einzuwenden, ja schenkte ihm hin und wieder einen neuen Band, denn jedes Heilmittel war recht, wenn es den Schmerz seines Sohnes linderte. So las Fausto die Gedichte von Die eingeladenen Inseln, darunter auch Manuel Altolaguirres Gedicht an seine tote Mutter. In diesen an sich vielleicht beunruhigenden Versen lag etwas beinahe Friedliches.
Lieber wär es mir gewesen,
Waisenkind zu sein im Tod,
dass du dort mir fehltest,
drüben, im Geheimnisvollen,
und nicht hier, im Wohlbekannten.
Unterdessen waren die Cabreras zu einer Familie non grata geworden. Onkel Felipe, der Franco kennengelernt, mit ihm in Afrika gekämpft und Orden erhalten hatte, der in Afrika berühmt dafür gewesen war, aus dem Schützengraben zu springen und, wie es hieß, den feindlichen Kugeln zu trotzen, blieb der Republik, für die er gekämpft hatte, treu ergeben. In einer Zeit, in der sich das Gros der Armee auf die Seite der Putschisten stellte, war diese Treue selbstmörderisch. »Dein Onkel ist ein mutiger Mann«, sagte der Vater zu Fausto. »Denn man braucht echten Mut dafür, nicht das zu tun, was alle über kurz oder lang vergeben hätten.« Doch in Madrid wurde das Leben der Familie immer schwieriger. Nach Julias Tod, deren bloße Gegenwart die Angriffe der Monarchisten oft entschärft hatte, galt das Haus der Cabreras nur noch als ein Nest von Aufwieglern, und die königstreuen Offiziere, die Francos Rebellion unterstützten, bedrängten sie schamlos. Die Lage wurde schnell unhaltbar. Als Domingo eines Abends mit seinen Kindern am Esstisch saß, kam Onkel Felipe überraschend vorbei und sagte:
»Wir gehen. Um unser aller Sicherheit willen.«
»Wohin?«, fragte Domingo.
»Nach Barcelona, da habe ich Freunde«, sagte Felipe. »Dann sehen wir weiter.«
Eine Woche später stieg Fausto zum ersten Mal in seinem Leben in ein Flugzeug. Es war eine Junkers G24 der republikanischen Luftwaffe, gesteuert von Oberst Felipe Díaz Sandino – seinem geliebten Onkel, seinem kühnen Onkel, dem Retter der Familie –, und in den neun Sitzen fand die Familie problemlos Platz. Onkel Felipe wusste, dass sein Schicksal besiegelt war, denn die Offiziere, die Franco den Rücken kehrten, wanderten auf eine schwarze Liste und wurden wütender verfolgt als Kommunisten, und so wollte er die Seinen erst in Sicherheit bringen und dann seinen Krieg weiterkämpfen. Domingo wurde Leiter seiner Eskorte, und die Sicherheit von Onkel Felipe, der für die Putschisten zu einem Ärgernis geworden war, hätte nicht in besseren Händen sein können. Als Olga einmal fragte, was denn die Arbeit ihres Vaters sei, erklärte Onkel Felipe: »Er sorgt dafür, dass man mich nicht umbringt.«
»Und wenn sie stattdessen ihn umbringen?«, fragte Olga.
Darauf wusste der Onkel keine Antwort.
Die Cabreras ließen sich in einer Wohnung mit Meerblick und Fenstern nieder, die vom Boden bis zur Decke reichten, und von der Dachterrasse oben sah man den Montjuïc. Die Familie setzte ihr Leben im bombardierten Barcelona fort. Fausto ging in die Schule und entdeckte, dass es ihm gefiel, und entdeckte auch, wie frustrierend es war, nicht damit angeben zu können, der Neffe von Felipe Díaz Sandino zu sein, dem republikanischen Helden, der die Bombardierung der franquistischen Stellungen in Saragossa befehligt hatte. Viel später sollte Fausto erfahren, was damals geschehen war: Onkel Felipe hatte in einer Kontroverse über die Kriegsführung einem seiner politischen Vorgesetzten die Stirn geboten (in einem so elenden Krieg, in dem die schlimmsten Feinde der Republikaner manchmal Republikaner waren). Der Streit wurde so hitzig, dass er sich nur durch einen politischen Schachzug abkühlen ließ, und so nahm Onkel Felipe einen diplomatischen Posten in Paris an, wo er sich bei anderen europäischen Ländern um Unterstützung für die republikanische Sache bemühen wollte. Nach seiner Ernennung machten ihm Barcelonas Arbeitergewerkschaften ein unerwartetes Geschenk: einen Hispano-Suiza T56, in La Sagrera hergestellt, mit 46 PS und Platz für fünf Personen. Als er bei den Cabreras damit vorfuhr, sagte er, so viele Pferdestärken sei eine Verschwendung, um bis Paris zu gelangen, benötige er nur drei Pferde.
So erfuhr Fausto, dass Onkel Felipe ihn und seinen Bruder Mauro mitnehmen würde, während die anderen in Barcelona bleiben sollten. Nie klärte sich auf, wer das entschieden hatte und ob die Reise zusammen mit Faustos Vater geplant worden war oder nur mit seiner Zustimmung, doch als sie im Hispano-Suiza die Pyrenäen überquerten und Fausto sah, mit welch respektvoller Miene der Gendarm die Papiere dieses Diplomaten der Republik entgegennahm, fühlte er sich während der restlichen Fahrt so sicher wie nie zuvor in seinem Leben. Onkel Felipe schien die Schlüssel der Welt zu besitzen. Während der ersten Tage in Paris führte er sie in die besten Restaurants, denn Fausto und sein Bruder sollten alles essen, was ihnen der Krieg verwehrt hatte, und dann erreichte er ihre Aufnahme ins Lycée Pothier, ein Internat für wohlhabende Leute in Orléans. Der halbwüchsige Fausto verbrachte dort seine Tage damit, sich mit den Franzosen zu prügeln, die ihn ohne ersichtlichen Grund schief ansahen; und damit, den Sex zu entdecken oder eher die Sexfantasien mit fünfzehnjährigen Mädchen, die ihn nachts besuchen kamen, um Spanisch zu lernen. Fausto ließ sie Verse von Paul Géraldy aufsagen und revanchierte sich mit ganzen Gedichten von Bécquer, die er in der Bibliothek seiner Mutter wie nebenbei auswendig gelernt hatte, diese Verse mit ihrer ansteckenden Musikalität, in denen alle Pupillen unerklärlich blau waren und alle Liebenden sich fragten, was sie nicht alles für einen Kuss geben würden. In Interviews mit französischen Zeitungen räumte Felipe Díaz Sandino unterdessen ein, ja, auf seiner Seite habe es auch Exzesse gegeben, doch es sei ein gewaltiger moralischer Irrtum, sie mit den Exzessen der Putschisten zu vergleichen: mit den Nazi-Flugzeugen, die wehrlose Dörfer niedermähten, zum Beispiel, während die sogenannten demokratischen Länder wegsahen und nicht bedachten, dass die Niederlage der Republik auf lange Sicht auch die ihre sein würde.
Seine diplomatische Mission war von kurzer Dauer. Aus Spanien kamen entmutigende Nachrichten, und die französische Regierung, verstrickt in die Bewältigung einer schweren Wirtschaftskrise, belagert von den Nationalisten von La Cagoule, die Gewerkschaftler umbrachten oder Staatsstreiche planten, schien weder Zeit noch Geduld zu haben, auf seine Rufe zu hören. Da kämpfte man besser den Kampf in Spanien weiter. Doch als sie nach Barcelona zurückkehrten, entdeckte Onkel Felipe, dass die franquistischen Zeitungen inzwischen seine Flucht und Ergreifung gemeldet hatten. Er erlebte, was nur wenige erleben: in der Landespresse das Foto des eigenen Leichnams zu sehen, dazu die Nachricht von seiner Erschießung. Als er sich dort erschossen auf der Plaça de Catalunya sah und als Verräter und Roter geschmäht, befiel Onkel Felipe zum ersten Mal die Gewissheit, dass der Krieg verloren war.
Auch Fausto und Mauro trafen auf ein verändertes Leben: Domingo hatte eine Frau kennengelernt. Eines Abends versammelte er seine drei Kinder und verkündete, er werde heiraten. Josefina Bosch war Katalanin, viel jünger als er und kam den Kindern ihres Mannes allzu nah, wenn sie mit ihnen sprach, als könnten sie nur so ihren Akzent mit den störrischen l verstehen, bei dem sie die Lippen kaum auseinanderbrachte; am wohlsten schien sie sich in Gesellschaft der Hunde zu fühlen. Sie war so spröde, dass Fausto sich fragte, ob er nicht in Frankreich hätte bleiben können, und zum ersten Mal empfand er so etwas wie Groll auf Onkel Felipe, denn das durfte man einem Jungen nicht antun, der gerade zum Leben erwachte, durfte ihn nicht zurück in ein Land im Krieg schicken, zurück in eine Stadt, die wieder von Flugzeugen bombardiert wurde und nicht einmal von spanischen, zurück zu einer Familie, geflickt wie ein zerbrochenes Stück Porzellan.
Nach Domingo und Josefinas Hochzeit zogen die Cabreras in eine größere Wohnung unweit der Plaça de Catalunya. Tagsüber schrillten unablässig die Sirenen, doch in der neuen Wohnung konnte man nicht aufs Dach steigen und die Flugzeuge sehen. Die Stadt lebte in Angst. Fausto sah es in Josefinas Gesicht, merkte es bei den Gesprächen mit seinen Geschwistern und spürte es jedes Mal in der Luft, wenn sein Vater sie mit zu Tante Teresa nahm. Kaum eine Woche war seit dem Umzug vergangen, als wieder einmal die Sirenen gellten und die Familie, die beim Mittagessen saß, keine Zeit mehr hatte, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Explosion erschütterte das Gebäude so stark, dass ein Fenster zerbrach, die Suppe aus den Tellern schwappte und Fausto vom Stuhl fiel. »Unter den Tisch!«, schrie Domingo. Es mochte eine nutzlose Maßnahme sein, doch alle gehorchten. Olga klammerte sich an den Arm ihres Vaters, und Josefina, immer noch ein Stück Brot im Mund, umfasste Fausto und Mauro, die laut weinten. »Sieh nach, ob sie verletzt sind«, sagte Domingo zu ihr, und sie hob ihre Kleider an und tastete Bauch, Brust und Rücken ab, und Domingo tat ein Gleiches mit Olga. »Nichts passiert, nichts passiert«, sagte er dann. »Bleibt hier, ich bin gleich wieder da.« Nach ein paar Minuten kam er mit den Nachrichten zurück: Italienische Bomber seien vorübergezogen, hätten ihre Wut an Barcelona ausgelassen, und eine Bombe habe zufällig einen Lastwagen mit Dynamitladung an der Ecke getroffen. Josefina hörte geduldig zu, kam dann unter dem Tisch hervor und klopfte ihr Kleid aus.
»Gut, nun wissen wir Bescheid«, sagte sie. »Jetzt können wir zu Ende essen, es ist noch Suppe da.«
Wenige Tage später versammelte sich die Familie, um Entscheidungen zu treffen. Der Krieg steuerte auf eine Niederlage zu, und Barcelona war das bevorzugte Ziel der Faschisten. Die Italiener würden nicht aufhören, mit ihren Savoia-Bombern die Stadt zu verheeren. Onkel Felipe entschied für alle: »Es ist Zeit, dass ihr Spanien verlasst. Hier kann ich euch nicht mehr beschützen.« Also packten sie ihre Sachen in den Hispano-Suiza und brachen eines Morgens Richtung französische Grenze auf. Fausto, eng an seine Geschwister gedrängt, musste während der Fahrt an Verschiedenes denken: an seine tote Mutter, an Gedichte von Bécquer und Géraldy, an fünfzehnjährige Französinnen und auch an seinen Vater, der zurückgeblieben war, um Onkel Felipe zu beschützen. Doch vor allem dachte er an den Onkel: Oberst Felipe Díaz Sandino, Republikaner, Verschwörer und Kriegsheld. Von da an sollte Onkel Felipe für Fausto bedeuten: So werde ich sein. Er sollte bedeuten: So will ich sein, wenn ich groß bin. Sollte bedeuten: Lebe das Leben, auf dass es lebendig bleibe im Tod.
Die Szene wirkte wie das Bühnenbild einer schlechten Theateraufführung: eine Straße, ein paar Bäume, eine Sonne, die alles in ein weißes Licht tauchte. In dieser dürftigen Kulisse befanden sich Josefina und die Cabreras in einem Hispano-Suiza, fünf Kilometer vor der französischen Grenze, mitten im Nirgendwo. Doch sie waren nicht allein. Viele andere Insassen vieler Wagen warteten wie sie und viele weitere Männer und Frauen, die zu Fuß mit geschulterten Koffern unterwegs waren. Sie flohen vor dem Krieg, ließen ihr Zuhause, vor allem ihre Toten mit diesem Wagemut oder dieser Verzweiflung hinter sich, mit der sich selbst der Feigste in die Ungewissheit des Exils stürzt. Die Grenze war geschlossen, und man konnte nur warten; doch während sie warteten, während die zähen Stunden des ersten Tages verstrichen, dann des zweiten, wurden die Essensvorräte knapp und die Frauen nervöser, da ihnen vielleicht etwas bewusst wurde, was die Kinder nicht ahnten. Manches Warten ist entsetzlich, weil kein Ende ersichtlich, keine Macht zu sehen ist, die ihm ein Ende bereiten oder dafür sorgen kann, dass etwas eintritt, was die Welt wieder in Bewegung setzt: zum Beispiel, dass die Behörden – aber welche, wo sind sie? – den Befehl geben, die Grenze zu öffnen. Fausto und sein Bruder Mauro fragten sich gerade, wer den Befehl dazu geben konnte und warum er sich bis jetzt geweigert hatte, da war ein Wispern in der Luft zu hören, aus dem Wispern wurde ein Brausen, und bevor es die Familie hatte identifizieren können, flog ein Jagdflieger über sie hinweg und beschoss sie mit Maschinengewehren.
»In Deckung!«, schrie jemand.
Aber es gab keine. Fausto flüchtete hinter den Hispano-Suiza, doch kaum hatte sich der Flieger entfernt, da kam ihm der Verdacht, dass der Angriff noch nicht zu Ende war, und ihm wurde klar, wenn ein Flugzeug von einer Seite kam, wurde das Hinten beim Rückflug zum Vorne. Und so war es: Der Flieger drehte in der Luft und näherte sich aus entgegengesetzter Richtung. Da kroch Fausto unter den Hispano-Suiza, presste das Gesicht auf die Erde, und während sich Steine in seine Haut bohrten, hörte er wieder das Brausen und die Maschinengewehre, hörte Josefinas Schrei, einen Schrei der Angst und Wut: »Scheißkerle!« Dann trat wieder Stille ein. Der Angriff war vorüber, ohne Tote zu hinterlassen: nur ängstliche Gesichter überall, weinende Frauen, Kinder, die an Wagenrädern lehnten, Einschusslöcher – dunkle Augen, die uns anblicken – in einigen Karosserien. Aber keine Toten. Auch keine Verwundeten. Es war fast ein Wunder.
»Aber wir haben doch nichts getan!«, rief Fausto. »Warum schießen sie auf uns?«
Josefina antwortete: »Weil sie Faschisten sind.«
Sie schliefen mit der Angst vor einem weiteren Angriff. Zumindest Fausto hatte Angst, eine ganz andere Angst, da sie sich unter freiem Himmel befanden. Am nächsten Tag sagten sie sich, dass gar keine Entscheidung die schlechteste ist, und machten sich auf den Weg. Sie fuhren die Grenze enlang, von einem Kontrollposten zum nächsten, bis sie eine Bewegung in der Menge sahen, eindeutig erkennbar, weil diese Bewegung das Gegenteil von Verzweiflung oder Niederlage ist: weil wir darin den Überlebenswillen erkennen. Einer aus der Familie erkundigte sich und erhielt die erhoffte Antwort:
»Gerade haben sie die Grenze geöffnet.«
»Sie haben sie gerade geöffnet«, sagte Fausto.
»Ja, geöffnet«, sagte Josefina.
Da sahen sie die nächste Schwierigkeit. Die Gendarmen hatten den Durchgang freigegeben, trennten jedoch Männer von Frauen und Kindern.
»Was ist los?«, fragte Fausto. »Wohin werden die gebracht?«
»In die Konzentrationslager«, sagte Josefina. »Scheißfranzosen.«
Sie winkte Fausto heran, sprach mit ihm, den Blick ins Weite gerichtet, die Brauen hochgezogen, und Fausto begriff, dass er nicht auf ihre Augen, sondern auf die Hände achten sollte: die Hände, die ihm ein Portemonnaie überreichten, als offenbarten sie ein Geheimnis.
»Versuch, mit ihnen zu reden«, sagte sie.
»Mit wem?«
»Mit den Gendarmen. Du sprichst doch Französisch, oder? Also.«
Fausto und Mauro bahnten sich einen Weg durch die Menge und fanden die Tür zu einem Büro. Sie wollten hineingehen, da sie zu Recht glaubten, dass jenseits dieser Tür die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden, aber die Gendarmen warfen sie kurzerhand hinaus. »Die behandeln uns wie Aussätzige«, sagte Mauro. »Scheißkerle.« Da fiel Fausto ein Mann in elegantem Anzug auf, der mit seinem Hut in der Hand auf und ab ging, und die Art, wie er den Hut hielt, verlieh ihm eine gewisse Autorität. Fausto packte seinen Bruder beim Arm, und sie gingen hinter dem Mann mit dem Hut her, hängten sich an seine Fersen, so dicht, dass sie ihm ein Bein hätten stellen können.
Zwei Gendarmen versuchten sie aufzuhalten. »Wo geht ihr hin?«, fauchte einer.
Fausto antwortete in makellosem Französisch: »Was heißt, wohin? Dahin, wohin mein Onkel geht.«
Der verwirrte Gendarm sah seinen Gefährten an. »Na, wenn ihr zum Monsieur gehört …«, sagte der andere.
Fausto schloss hastig zu dem Mann mit Hut auf und ließ ihn dann allein weitergehen: Sie hatten das Hindernis überwunden. »Und jetzt?«, fragte Mauro. »Jetzt suchen wir ein Büro«, sagte Fausto. Das war nicht schwer. Ein Tumult, ein Wogen von Körpern drängte sich hinten vor dem Gebäude. Einer der Körper trug Uniform, ein massiger Mann mit weißem Haar und Schnurrbart, etwas weniger weiß als das Haar, und an ihn wandte sich Fausto. »Man hat uns gesagt«, erklärte er mit aller Selbstsicherheit, die seine halbwüchsige Stimme hergab, »wir sollen mit Ihnen reden.« Und er erzählte ihm ihre Geschichte.
Er erzählte von seinem Onkel, Held des Widerstands gegen den Franquismus. Erzählte von seiner republikanischen Familie, die verzweifelt dieses Land verlassen wollte, in dem die Faschisten Frauen und Kinder bombardierten. Sagte, er sei in Paris zur Schule gegangen und seine Werte seien die der Republik. »Wir können keine Ausnahmen machen«, entgegnete der Offizier. Das einzige Ergebnis all der Worte waren das Vordringen in ein Büro und eine blitzschnelle Anhörung bei einem Büroangestellten, bis Fausto Josefinas Portemonnaie aus der Tasche und daraus das Bündel Geldscheine zog. Er legte es auf seine flache Hand und hielt sie ihnen entgegen. Der Offizier blickte zum Büroangestellten.
»Machen wir eine Ausnahme«, sagte er.
Fausto übergab das Geld und erhielt im Gegenzug eine Genehmigung, zum Bahnhof weiterzugehen. Minuten später fanden sie sich alle vereint am Schalter und erkundigten sich mit einem Lächeln nach dem nächsten Zug. Josefina bezahlte die Fahrkarten.
»Wo fahren wir hin?«, fragte Fausto Josefina. »Wohin fährt der Zug?«
»Von mir aus nach Sibirien«, sagte sie.
Aber es war nicht Sibirien, es war Perpignan. Fausto sollte keinerlei Erinnerung an die Stadt bewahren, denn die Tage verbrachten die Cabreras in einer Absteige, beunruhigt, da sie keine Nachricht von Domingo oder Onkel Felipe hatten. Aber sie konnten nichts weiter tun, als ihren Aufenthaltsort zu übermitteln und ein Lebenszeichen von sich zu geben. Sie hatten vereinbart, für den Briefverkehr eine Adresse einer Familie in Orléans zu benutzen, die sie während Faustos Zeit auf dem Lycée Pothier kennengelernt hatten. Mehrere Tage später erhielten sie Nachricht: Die Männer waren ins Konzentrationslager Argèles-sur-Mer verschafft worden, aber Onkel Felipe hatte Kontakte aus seiner Zeit als Militärattaché in Paris genutzt und ihre Freilassung erwirkt. In dem Brief teilte ihnen Onkel Felipe mit, sie sollten sich alle in Bordeaux treffen. Dort werde die ganze Familie entscheiden, was zu tun sei.