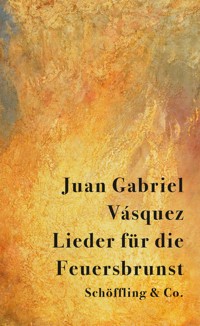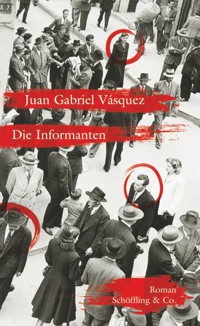15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kolumbien 1948: Der liberale Politiker Jorge Eliécer Gaitán wird in Bogotá auf offener Straße ermordet. Sein Tod stürzt Kolumbien in die tiefste Krise seiner Geschichte. Jahrzehnte später wird ein Mann verhaftet, als er versucht, den Anzug Gaitáns aus einem Museum zu stehlen. Überzeugt von einer Verschwörung und besessen von der Suche nach der Wahrheit hinter der Ermordung Gaitáns bedrängt er auch den Schriftsteller Juan Gabriel Vásquez. Hängt das Attentat auf Gaitán mit dem auf John F. Kennedy zusammen? Und welche Verbindung gibt es zu den Attentaten auf Erzherzog Ferdinand in Sarajevo und Rafael Uribe Uribe in Kolumbien?Die Gestalt der Ruinen deckt ein komplexes Geflecht von Anhängern und Gegnern der Demokratie auf und fragt nach dem Spielraum der Literatur zwischen Investigation und Skepsis. In seinem schonungslosen Roman verknüpft Juan Gabriel Vásquez die leidenschaftliche Erforschung all dessen, was unsere Freiheit gefährdet, mit klugen autobiografischen Reflexionen: Geschichte und Politik spiegeln sich im eigenen Leben und Schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
I. Der Mann des unheilvollen Datums
II. Reliquien berühmter Toter
III. Ein verletztes Tier
IV. Warum macht dich das stolz?
V. Die große Wunde
VI. Die Ermittlung
VII. Wer sind sie?
VIII. Der Prozess
IX. Die Gestalt der Ruinen
Anmerkung des Autors
Danksagung
Zitat- und Bildnachweis
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
Thou art the ruins of the noblest man
Shakespeare, Julius Caesar
I. Der Mann des unheilvollen Datums
Zum letzten Mal hatte ich Carlos Carballo gesehen, als er gerade in einen Polizeiwagen kletterte, die Hände in Handschellen auf dem Rücken, den Kopf eingezogen; am Bildschirmrand gab eine Textzeile Auskunft über die Gründe seiner Verhaftung: Er hatte versucht, den Anzug eines ermordeten Politikers zu stehlen. Es war ein flüchtiges Bild, zufällig aufgeschnappt in den Abendnachrichten, zwischen der aggressiv gellenden Werbung und den Sportmeldungen, und mir war, das weiß ich noch, in den Sinn gekommen, dass Abertausend Zuschauer diesen Augenblick mit mir teilten, aber nur ich ehrlich behaupten konnte, dass ich nicht überrascht war. Der Schauplatz war Jorge Eliécer Gaitáns ehemaliges Haus, inzwischen ein Museum, in das Jahr für Jahr scharenweise Besucher einfallen, die für einen Moment symbolisch eintauchen wollen in das berühmteste Attentat der kolumbianischen Geschichte. Den besagten Anzug hatte Gaitán am 9. April 1948 getragen, als Juan Roa Sierra, ein junger Mann mit diffusen Nazi-Sympathien, der mit dem Rosenkreuzerorden geliebäugelt hatte und ein Zwiegespräch mit der Jungfrau Maria pflegte, vor seinem Büro auf ihn gewartet und aus nächster Nähe vier Schüsse auf ihn abgefeuert hatte, mitten auf einer belebten Straße Bogotás, am helllichten Mittag. Die Kugeln durchschlugen Sakko und Weste, und die Leute, die das wissen, besuchen das Museum nur, um diese hohlen, dunklen Kreise zu sehen. Carlos Carballo, hätte man denken können, war einer dieser Besucher.
Das geschah an einem Mittwoch, in der zweiten Aprilwoche 2014. Carballo war anscheinend gegen elf Uhr morgens in dem Museum eingetroffen, mehrere Stunden lang in dem Haus umhergestreift wie ein Kirchgänger in Trance, hatte vielleicht mit geneigtem Kopf vor den Strafrechtsbüchern gestanden, den Dokumentarfilm gesehen, in dem wieder und wieder die Bilder der brennenden Straßenbahnen, der wütenden Leuten mit geschwungenen Macheten gezeigt werden. Er hatte gewartet, bis sich die letzten Schüler in ihren Uniformen verzogen hatten, war in den ersten Stock hinaufgegangen, wo in einer Vitrine der Anzug ausgestellt wird, den Gaitán am Tag seiner Ermordung getragen hatte, und das dicke Glas splitterte unter dem Schlagring. Er schaffte es noch, die Hand auf die mitternachtsblaue Sakkoschulter zu legen, aber mehr nicht: Der Wächter aus dem ersten Stock, vom Knall alarmiert, zielte mit der Pistole auf ihn. Carballo merkte, dass er sich an den Scherben geschnitten hatte, und leckte sich die Fingerknöchel wie ein Straßenköter. Aber er wirkte gefasst. So beschrieb es im Fernsehen eine junge Frau in weißer Bluse und Schottenrock:
»Als hätte man ihn dabei erwischt, wie er etwas an die Wand malt.«
Alle Zeitungen berichteten am nächsten Morgen von dem vereitelten Diebstahl. Alle waren überrascht, auf ihre heuchlerische Weise, dass Gaitáns Mythos sechsundsechzig Jahre nach der Tat immer noch die Emotionen hochkochen ließ, und einige verglichen zum x-ten Mal Gaitáns Ermordung mit der Kennedys, die sich im letzten November zum fünfzigsten Mal gejährt hatte und noch immer jeden wie am ersten Tag in Bann schlug. Alle riefen uns, als wäre das nötig gewesen, die erstaunlichen Folgen des Attentats in Erinnerung: die Stadt, in Brand gesetzt von den protestierenden Massen, die Scharfschützen auf den Dächern, die wild und wahllos auf alles schossen, die Bürgerkriegsjahre im Land. Überall servierte man die gleichen Fakten, mal mehr, mal weniger differenziert, dramatisiert, bebildert, etwa von der wütenden Menge, die eben den Mörder gelyncht hat und den halbnackten Leichnam über das Pflaster der Carrera Séptima schleift, zum Präsidentenpalast. Aber nirgendwo fand ich eine Vermutung darüber, so vage sie auch sein mochte, warum jemand, der nicht den Verstand verloren hat, in ein bewachtes Haus eindringt und gewaltsam die durchlöcherte Kleidung eines berühmten Toten entwenden will. Niemand stellte sich diese Frage, und unser mediales Gedächtnis vergaß nach und nach Carlos Carballo. In der Flut der alltäglichen Gewalt, die nicht einmal Zeit für die Frustration übrig lässt, verblich dieser harmlose Mann für die Kolumbianer wie ein Schatten am Abend. Niemand dachte mehr an ihn.
Seine Geschichte will ich hier, neben anderen, erzählen. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihn gekannt hätte, aber wir waren so vertraut miteinander, wie es nur die sein können, die einander täuschen wollten. Doch für diese Geschichte (die, wie ich ahne, weit ausholen und doch zu kurz greifen wird) muss ich erst von dem Mann erzählen, der uns bekannt gemacht hat, denn was mir anschließend passiert ist, kann man nur verstehen, wenn ich erläutere, wie Francisco Benavides in mein Leben trat. Als ich gestern im Zentrum Bogotás noch einmal die Schauplätze besucht habe, an denen sich einige Ereignisse dieser Schilderung abgespielt haben, und überprüfen wollte, ob mir bei ihrer schmerzlichen Rekonstruktion auch nichts entgangen ist, musste ich mich plötzlich laut fragen, wie ich überhaupt von all dem, ohne das ich jetzt vielleicht besser dran wäre, erfahren hatte: Wie konnte ich die ganze Zeit über an diese Toten denken, mit ihnen leben, sprechen, mir ihre Klagen anhören und meinerseits darüber klagen, dass ich nichts tun kann, um ihr Leid zu lindern. Und verwundert stellte ich fest, dass alles mit ein paar dahingesagten Worten begonnen hatte, mit denen mich Doktor Benavides beiläufig zu sich nach Hause einlud. Die Einladung hatte ich damals, wie ich glaubte, angenommen, weil er mir in einem schwierigen Moment seine Zeit gewidmet hatte und ich ihm die meine nicht vorenthalten wollte; eine bloße Verbindlichkeit, eine der vielen Belanglosigkeiten, mit denen wir das Leben verbringen. Ich konnte nicht wissen, wie sehr ich im Irrtum war, denn was an jenem Abend geschah, setzte ein Räderwerk des Schreckens in Gang, das erst mit diesem Buch zum Stillstand kommen sollte: ein Buch als Sühne für Verbrechen, die ich zwar nicht begangen, aber doch geerbt habe.
Francisco Benavides war einer der renommiertesten Chirurgen im Land, Liebhaber von Malzwhisky und ein gieriger Leser, auch wenn er immer wieder betonte, dass ihn Historisches mehr interessierte als Erfundenes, und einen meiner Romane hatte er, eher stoisch als begeistert, wohl nur aus sentimentaler Anhänglichkeit zu seinem Patienten gelesen. Streng genommen war ich gar nicht sein Patient, und doch hatte uns meine Gesundheit in Verbindung gebracht. 1996, ich wohnte seit wenigen Wochen in Paris, versuchte ich eines Abends einen Essay von Georges Perec zu entschlüsseln, als ich etwas Merkwürdiges rechts vom Oberkiefer spürte, eine Art Murmel unter der Haut. Die Murmel wuchs in den folgenden Tagen an, aber ich war so mit meinem neuen Leben beschäftigt, damit, die Regeln der neuen Stadt zu entwirren und meinen Platz in ihr zu finden, dass ich die Veränderung nicht bemerkte. Nach ein paar Tagen war das Ganglion bereits so angeschwollen, dass es mein Gesicht entstellte. Die Leute auf der Straße sahen mich mitleidig an, und eine Mitstudentin hielt sich von mir fern, aus Angst, sich mit einer unbekannten Krankheit anzustecken. Die Untersuchungen begannen. Einem ganzen Heer von Pariser Ärzten gelang es nicht, eine korrekte Diagnose zu treffen; einer von ihnen, ich will mich nicht an seinen Namen erinnern, wagte sogar die Prognose, es könne Lymphdrüsenkrebs sein. Da konsultierte meine Familie Benavides und fragte ihn, ob er das für möglich halte. Benavides war kein Onkologe, begleitete jedoch seit einigen Jahren Kranke im Endstadium: eine Privatbeschäftigung, der er aus freien Stücken und ohne Vergütung nachging. Obwohl es unverantwortlich gewesen wäre, über den Atlantik hinweg eine Diagnose zu wagen, als es noch keine Telefone gab, die Fotos schicken konnten, keine Computer mit integrierter Kamera, stellte Benavides großzügig seine Zeit, seine Kenntnisse und seine Intuition zur Verfügung, und seine transatlantische Hilfe war mir fast so nützlich wie eine endgültige Diagnose. »Wenn Sie das hätten, was die Ärzte da suchen«, sagte er mir am Telefon, »dann hätten sie es bereits gefunden.« Die verwickelte Logik des Satzes war wie ein Rettungsring, dem man dem Ertrinkenden zuwirft: Man packt ihn, ohne sich zu fragen, ob er dicht ist.
Nach einigen Wochen (eine zeitlose Zeit für mich, während der mich die konkrete Möglichkeit begleitete, dass mein Leben mit dreiundzwanzig Jahren zu Ende ging, aber so betäubt von dem Schlag, dass ich nicht einmal echte Furcht oder echte Traurigkeit empfinden konnte) benötigte ein Allgemeinarzt, den ich zufällig in Belgien kennengelernt hatte, der für Ärzte ohne Grenzen arbeitete und eben erst von den Schrecken Afghanistans zurückgekehrt war, nur einen einzigen Blick, um eine Art Ganglientuberkulose festzustellen, die aus Europa verschwunden und nur noch (was mir ohne die Anführungszeichen erklärt wurde, die ich jetzt benutze) in der »Dritten Welt« anzutreffen war. Sie wiesen mich in ein Krankenhaus in Lüttich ein, isolierten mich in einem dunklen Raum, machten eine Untersuchung, die mein Blut zum Brodeln brachte, betäubten mich, schnitten die rechte Gesichtshälfte unter dem Kiefer auf, holten etwas von dem Ganglion heraus und legten eine Kultur an; nach einer Woche bestätigte das Labor, was der Arzt aus dem Stegreif festgestellt hatte, ohne all die kostspieligen Untersuchungen. Ich unterzog mich neun Monate lang einer Behandlung mit dreierlei Antibiotika, die meinen Urin grellorange färbten, das entzündete Ganglion schrumpfte, eines Morgens spürte ich etwas Feuchtes auf dem Kopfkissen und merkte, dass es geplatzt war. Danach kehrte mein Gesicht in seinen früheren Zustand zurück (abgesehen von zwei Narben: die eine kaum sichtbar, die des chirurgischen Eingriffs auffälliger), und endlich konnte ich die Angelegenheit hinter mir lassen, auch wenn ich sie in all den Jahren nie ganz vergessen habe, zur Erinnerung sind da die Narben. Das Gefühl, bei Doktor Benavides in der Schuld zu stehen, hatte mich niemals verlassen. Und als wir uns neun Jahre später zum ersten Mal persönlich begegneten, fiel mir gleich ein, dass ich mich nie gebührend bei ihm bedankt hatte. Vielleicht hatte ich ihn deshalb so ohne Weiteres in mein Leben eingelassen.
Wir trafen uns zufällig in der Cafeteria der Clínica Santa Fe. Meine Frau und ich waren seit zwei Wochen dort und kämpften so gut wie möglich mit dem Notfall, wegen dem wir unseren Aufenthalt in Bogotá hatten verlängern müssen. Wir waren Anfang August gekommen, gleich nach dem Unabhängigkeitstag, wollten die europäischen Sommerferien bei unseren Familien verbringen und rechtzeitig vor der Entbindung wieder in Barcelona sein. Bis zur vierundzwanzigsten Woche war die Schwangerschaft normal verlaufen, wofür wir Tag für Tag dankbar waren: Wir wussten, dass eine Zwillingsschwangerschaft per se in die Kategorie Risiko fällt. Aber eines Sonntags war es vorbei mit der Normalität, als wir nach einer Nacht des Unwohlseins und seltsamer Schmerzen Doktor Ricardo Rueda aufsuchten, Spezialist in allen Gefahren der Fortpflanzung, der uns von Anfang an begleitet hatte. Nach einem ausführlichen Ultraschall teilte uns Doktor Rueda die Nachricht mit:
»Gehen Sie nach Hause und holen Sie Wäsche«, sagte er mir. »Ihre Frau bleibt bis auf Weiteres hier.«
Er erklärte uns die Situation mit einem Ton, einer Gestik, als meldete er im Kinosaal ein Feuer: Man muss den Ernst der Lage vermitteln, aber so, dass die Leute sich nicht in überstürzter Flucht zertrampeln. Er beschrieb detailliert, was eine Zervixinsuffizienz ist, fragte M., ob sie Wehen gehabt habe, und eröffnete uns, dass dringend operiert werden müsse, damit der unwiderrufliche Prozess verlangsamt werde, der sich da ohne unser Wissen in Gang gesetzt hatte. Gleich darauf fügte er hinzu – er hatte ein Feuer entdeckt und versuchte, eine überstürzte Flucht zu verhindern –, eine Frühgeburt sei unausweichlich, nun gehe es darum, in dieser ungünstigen Lage so viel Zeit wie möglich zu gewinnen, von dieser Zeit hänge die Überlebenschance meiner Töchter ab. Anders gesagt: Wir hatten einen Wettlauf gegen den Kalender begonnen und wussten, eine Niederlage konnte Leben zerstören. Von da an hatte jede Entscheidung das Ziel, die Geburt aufzuschieben. Anfang September lag M. bereits zwei Wochen eingeschlossen in einem Zimmer im Erdgeschoss der Klinik, unter strengem Verbot, sich zu bewegen, und wurde Tag für Tag Untersuchungen ausgesetzt, die unsere Widerstandskraft, unseren Mut und unsere Nerven auf die Probe stellten.
Die tägliche Routine drehte sich um Kortisonspritzen für die Lungenreifung meiner ungeborenen Töchter, um Blutentnahmen, so zahlreich, dass meine Frau bald keine unversehrte Stelle mehr an den Unterarmen hatte, um höllische Ultraschallsitzungen, die bis zu zwei Stunden dauern konnten und bei denen der Zustand der Gehirne untersucht wurde, der Wirbelsäulen, der beiden Herzen, deren beschleunigter Rhythmus niemals im Einklang schlug. Die nächtliche Routine war nicht weniger anstrengend. Jederzeit kamen Krankenschwestern herein, erfassten Daten, stellten Fragen, und der Mangel an durchgehendem Schlaf machte uns zusätzlich zu der Anspannung immer gereizter. M. hatte nun Wehen, die sie nicht spürte; um sie zu verringern (nie erfuhr ich, ob ihre Intensität oder ihre Häufigkeit), bekam sie ein Medikament mit Namen Adalat, das, wie man uns erklärte, für ihre heftigen Hitzewallungen verantwortlich war, derentwegen ich das Fenster sperrangelweit öffnen und in der unbarmherzigen Kälte der Bogotaer Morgendämmerungen schlafen musste. Wenn die Kälte oder die Besuche der Krankenschwestern den Schlaf endgültig verscheucht hatten, wanderte ich durch die verlassene Klinik, setzte mich auf die Ledersofas der Wartezimmer, wenn ich einen beleuchteten Raum fand, und las ein paar Seiten in Lolita, auf dessen Umschlag mich Jeremy Irons musterte; oder ich streifte durch halbdunkle Gänge, da die Klinik in diesen Stunden die Hälfte der Neonlampen ausschaltete, ging von unserem Zimmer bis zur Neonatologie und von da zum Wartesaal der ambulanten Chirurgie. Während dieser nächtlichen Wanderungen durch weiße Korridore rekapitulierte ich die letzten Erklärungen der Ärzte und versuchte zu bestimmen, wie hoch das Risiko für die Mädchen war, wenn sie in diesem Augenblick auf die Welt kommen würden; dann überschlug ich, wie viel die Mädchen in den letzten Tagen zugenommen hatten und wann sie das minimale Gewicht für ihr Überleben erreichen würden, und es brachte mich aus der Fassung, dass mein Wohl von diesem verbissenen Grammzählen abhing. Allerdings entfernte ich mich nicht allzu weit von unserem Zimmer und hatte auf jeden Fall das Handy griffbereit, nicht in der Hosentasche, damit ich das Klingeln auch sicher hörte. Häufig nahm ich es zur Hand: um zu überprüfen, ob ich Empfang hatte, ob das Signal gut war und meine Töchter nicht ohne mich auf die Welt kamen, nur weil vier schwarze Balken am kleinen grauen Firmament eines LCD-Bildschirms gefehlt hatten.
Während einer dieser nächtlichen Exkursionen erkannte ich Doktor Benavides, oder vielmehr übernahm er das Erkennen. Ich rührte gerade lustlos in meinem zweiten Milchkaffee an einem der hinteren Tische in der rund um die Uhr geöffneten Cafeteria, fern von einer Gruppe Studenten, die Nachtschichtpause hatten (meine Stadt mit ihren kleinen oder großen Gewalttaten sorgt nachts immer für Beschäftigung), und in meinem Buch traten Lolita und Humbert Humbert ihre Reise durch die Vereinigten Staaten an, von Motel zu Motel, füllten Parkplätze mit Tränen und verbotener Liebe, setzten die Geografie in Bewegung. Der Mann kam auf mich zu, stellte sich seelenruhig vor und fragte mich zweierlei: erstens, ob ich mich an ihn erinnere; dann, was aus der Sache mit den Ganglien geworden sei. Bevor ich antworten konnte, hatte er sich schon gesetzt, die Kaffeetasse mit beiden Händen umklammert, als könnte sie ihm jemand entreißen. Es war keiner dieser Plastikbecher im Stil von Flüchtlingscamps, wie wir anderen sie bekamen, sondern eine schwere Keramiktasse in Dunkelblau. Hinter den kleinen Handtellern, den gespreizten Fingern lugte verzweifelt ein Universitätswappen hervor.
»Und was tun Sie um diese Zeit hier?«, fragte er.
Ich gab ihm eine knappe Zusammenfassung: die drohende Frühgeburt, die Wochenzahl, die Prognosen. Aber ich merkte, dass er keine große Lust hatte, sich darüber zu äußern, und kam einem Kommentar zuvor. »Und Sie?«, fragte ich.
»Ich besuche einen Patienten«, sagte er.
»Und was hat Ihr Patient?«
»Große Schmerzen«, lautete sein brutales Resümee. »Ich will sehen, wie ich ihm helfen kann.« Dann wechselte er das Thema, aber nicht, wie mir schien, um einer Antwort auszuweichen. Benavides gehörte nicht zu denen, die sich scheuen, über den Schmerz zu reden. »Ich habe Ihren Roman gelesen, den über die Deutschen«, sagte er. »Wer hätte das gedacht: Mein Patient hat sich als Schriftsteller entpuppt.«
»Wer hätte das gedacht.«
»Und Sie schreiben auch noch etwas für die Alten.«
»Für die Alten?«
»Über die vierziger Jahre. Über den zweiten Weltkrieg. Den 9. April und all das.«
Er meinte das Buch, das ich ein Jahr zuvor veröffentlicht hatte. Es ging auf meine Begegnung mit Ruth de Frank zurück, die ich 1999 kennengelernt hatte, eine deutsche Jüdin, die dem europäischen Debakel entkommen, 1938 in Kolumbien eingetroffen war und dort erlebt hatte, wie die kolumbianische Regierung als Alliierte der Alliierten die diplomatischen Beziehungen zu den Achsenmächten abbrach und begann, die Bürger der feindlichen Länder – Propagandisten oder Sympathisanten der europäischen Faschisten – in Luxushotels auf dem Lande einzusperren, die man in Lager verwandelt hatte. Drei Tage lang hatte ich das Vergnügen und das Vorrecht, diese Frau mit ihrem guten Gedächtnis zu befragen, die mir fast ihr ganzes Leben erzählte, das ich auf die Quadrate eines zu kleinen Notizblocks zwängte: das Einzige, was ich in dem Hotel in Tierra Caliente, wo wir uns trafen, zur Hand gehabt hatte. In Ruth de Franks faszinierendem Leben, das zwei Kontinente und über sieben Jahrzehnte umspannte, stach eine Anekdote besonders hervor: der Augenblick, in dem ihre Familie, geflüchtete Juden, durch eine der grausamen Ironien der Geschichte am Ende auch in Kolumbien verfolgt wurde, weil sie eben deutsch war. Dieses Missverständnis (aber Missverständnis ist hier ein unglückliches, frivoles Wort) wurde zum Anstoß für den Roman, den ich Die Informanten nannte, und Ruth de Franks Leben und Erinnerungen verwandelten sich – verzerrt, da die Fiktion immer verzerrt – in die der Hauptfigur, eine Art moralischer Kompass der fiktiven Welt: Sara Guterman.
Aber der Roman handelte von vielerlei. Da er vor allem in den vierziger Jahren spielte, war es unvermeidlich, dass die Geschichte oder ihre Figuren die Ereignisse des 9. April 1948 streiften. Die Personen in Die Informanten sprachen über diesen unheilvollen Tag; der Vater des Erzählers, Rhetorikprofessor, erinnerte sich mit Bewunderung an Gaitáns übernatürliches Redetalent, und der Erzähler begab sich auf ein paar wenigen Seiten ins Zentrum Bogotás und besuchte den Schauplatz des Verbrechens, wie ich es viele Male getan habe, und Sara Guterman, die ihn dabei begleitete, bückte sich im Buch kurz, um die Straßenbahnschienen zu berühren, die in den Vierzigern noch auf der Carrera Séptima verkehrte. Im weißen Schweigen der nächtlichen Cafeteria, jeder vor seiner Kaffeetasse, gestand mir der Doktor, dass er wegen dieser Szene – eine ältere Frau, die sich zum Pflaster bückt, wo Gaitán niedergestreckt worden war, und die Schienen der dahingegangenen Straßenbahn berührt, als fühlte sie einem verletzten Tier den Puls – den Kontakt zu mir gesucht hatte. »Ich habe das nämlich auch gemacht«, sagte er.
»Was gemacht?«
»Ich gehe ins Zentrum. Stelle mich vor die Gedenktafeln. Bücke mich sogar und berühre die Schienen.« Er machte eine Pause. Dann: »Was packt Sie so daran?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Das war schon immer so. Eine meiner ersten Erzählungen handelt vom 9. April. Sie ist nie veröffentlicht worden, zum Glück. Ich weiß nur noch, dass am Ende Schnee fiel.«
»In Bogotá?«
»In Bogotá, ja. Auf Gaitáns Körper. Auf die Schienen.«
»Verstehe«, sagte er. »Mit gutem Grund lese ich ungern Erfundenes.«
So fingen wir vom 9. April an. Mir fiel auf, dass Benavides nicht den Ausdruck »Bogotazo« benutzte, wie wir Kolumbianer diesen legendären Tag großspurig nennen. Nein, Benavides gebrauchte immer das Datum, manchmal mit Jahresangabe, als wäre es der Vor- und Nachname von jemandem, der Respekt verdient, während ein Beiname unzulässige Vertrautheit bedeutet hätte: Mit den ehrwürdigen Ereignissen unserer Vergangenheit hatte man sich keine Vertraulichkeiten zu erlauben. Er erzählte mir Anekdoten, und ich versuchte mitzuhalten. Er sprach von den Scotland-Yard-Beamten, die 1948 im Auftrag der Regierung die Ermittlungen überwachen sollten, sprach von seinem kurzen Briefwechsel mit einem von ihnen viele Jahre später: einem äußerst höflichen Mann, der sich mit noch frischer Empörung an die fernen Tage seines Kolumbien-Aufenthalts erinnerte, als die Regierung tagtäglich Ergebnisse von den Ermittlern forderte und ihnen zugleich jedes nur mögliche Hindernis in den Weg legte. Ich erzählte ihm von meinem Gespräch mit Leticia González, der Tante meiner Frau, deren Mann Juan Roa Cervantes von einer kleinen Gruppe Liberaler mit Macheten verfolgt worden war, weil sie ihn für den gleichnamigen Mörder gehalten hatten. Als ich ihn später kennenlernte, erzählte er mir selbst von diesen Tagen der Angst, aber am tiefsten hatte sich ihm eingeprägt (er konnte kaum die Tränen zurückhalten), wie ihn die verirrten Gaitán-Anhänger gestraft hatten: Sie hatten seine Bibliothek angezündet.
»Der falsche Name an einem solchen Tag«, sagte Benavides.
Dann erzählte er, was er von Hernando de la Espriella erfahren hatte, einem Patienten von der Küste, der sich bei Ausbruch der Unruhen in Bogotá aufgehalten und die erste Nacht bäuchlings auf einem Leichenhaufen verbracht hatte, damit er nicht ebenfalls getötet wurde; und ich erzählte ihm von meinem Besuch in Gaitáns Haus, damals bereits ein Museum, in dem man den mitternachtsblauen Anzug in einer Vitrine an einer kopflosen Schaufensterpuppe besichtigen konnte, die Einschusslöcher im Stoff (zwei oder drei, ich erinnere mich nicht mehr) für alle Welt sichtbar … Fünfzehn, zwanzig Minuten verbrachten wir in der Cafeteria, die die Nachtschichtstudenten bereits verlassen hatten, und tauschten Anekdoten aus wie Jungen Fußballbildchen. Doch schließlich hatte Doktor Benavides das Gefühl, mich zu stören oder um meine stillen Momente zu bringen. So wirkte es auf mich: Benavides wusste wie alle Ärzte, die mit dem Schmerz und den Sorgen anderer leben, dass die Patienten oder ihre Angehörigen Zeit für sich brauchen, in der sie mit niemandem sprechen und niemand mit ihnen. Er verabschiedete sich.
»Ich wohne in der Nähe, Vásquez«, sagte er, als er mir die Hand drückte. »Wenn Sie über den 9. April reden wollen, kommen Sie bei mir vorbei, trinken Sie einen Whisky, und ich erzähle ein bisschen. Das Thema wird mir nie langweilig.«
Eine Weile dachte ich über diese Leute in Kolumbien nach: Leute, für die ein Gespräch über den 9. April das Gleiche ist wie Schach oder Karten zu spielen, Kreuzworträtsel zu lösen, zu stricken oder Briefmarken zu sammeln. Obwohl nur noch wenige von ihnen übrig sind. Sie sterben allmählich aus und wachsen nicht mehr nach, hinterlassen keine Erben, machen keine Schule, bezwungen von der unheilbaren Amnesie, die dieses arme Land seit jeher plagt. Aber es gibt sie noch, und das ist verständlich, denn die Ermordung Gaitáns – ein Rechtsanwalt aus bescheidenen Verhältnissen, der die Gipfel der Politik erklommen hatte und dazu bestimmt gewesen war, Kolumbien vor seinen unbarmherzigen Eliten zu retten, ein brillanter Redner, der in einem Satz die Gegenpole Marx und Mussolini vereinen konnte – ist Teil unserer nationalen Mythen, wie für einen Nordamerikaner die Ermordung Kennedys oder für einen Spanier der Putsch vom 23. Februar. Wie alle Kolumbianer bin ich mit den Meinungen groß geworden, Gaitán sei von den Konservativen umgebracht worden, von den Liberalen, den Kommunisten, von ausländischen Spionen, der Arbeiterklasse, die sich verraten oder von der Oligarchie, die sich bedroht gefühlt hatte; und bald schon akzeptierte ich, wie wir alle mit der Zeit, dass der Mörder Juan Roa Sierra bloß der bewaffnete Arm einer Verschwörung gewesen war, die man mit Erfolg vertuscht hatte. Vielleicht kommt daher meine Obsession für diesen Tag: Obwohl ich beileibe kein hingebungsvoller Gaitán-Anhänger bin – er kommt mir zwielichtiger vor, als viele wahrhaben möchten –, weiß ich doch, dass dieses Land ein besserer Ort wäre, wenn man ihn nicht umgebracht hätte, und das Land sich leichteren Herzens im Spiegel betrachten würde, wenn der Mord nicht immer noch ungesühnt wäre, nach so vielen Jahren.
Der 9. April ist ein schwarzes Loch in der kolumbianischen Geschichte, mag sein, aber er ist noch vieles mehr: eine einzelne Tat, die ein ganzes Land in einen blutigen Krieg gestürzt hat; eine kollektive Neurose, deretwegen wir einander über ein halbes Jahrhundert lang misstraut haben. All die Zeit, die seit dem Verbrechen vergangen ist, haben wir Kolumbianer erfolglos zu begreifen versucht, was an jenem Freitag 1948 geschehen war, und viele haben daraus einen mehr oder weniger ernsten Zeitvertreib gemacht und alle ihre Energien damit verbraucht. Ebenso gibt es Nordamerikaner – ich kenne einige davon –, die ihr ganzes Leben lang über die Ermordung Kennedys sprechen, über die kleinsten Einzelheiten und Nuancen, Leute, die die Marke von Jackies Schuhen am Tag des Attentats kennen, Leute, die ganze Sätze aus dem Warren-Report auswendig wissen. Und ja: ebenso gibt es Spanier – ich kenne nicht viele, aber einen schon, und der ist mir genug –, die unaufhörlich von dem gescheiterten Putsch am 23. Februar 1981 im Abgeordnetenhaus in Madrid reden müssen und mit geschlossenen Augen die Einschusslöcher in der Decke des Parlamentsaals finden könnten. Solche Leute gibt es gewiss überall, Leute, die auf diese Weise auf Verschwörungen in ihren Ländern reagieren: indem sie eine Geschichte daraus machen, die man wie ein Märchen wieder und wieder erzählt, oder einen Ort in der Erinnerung oder der Phantasie, einen virtuellen Ort, den wir als Tourist besichtigen und an dem wir nostalgische Gefühle ausleben oder etwas suchen, was wir verloren haben. Der Doktor gehörte, wie mir damals schien, zu dieser Art Leute. Ich etwa auch? Benavides hatte mich gefragt, was mich daran so packe, und ich hatte eine Erzählung erwähnt, die ich in meinen Studienjahren geschrieben hatte. Aber von dem Anlass dieser Erzählung, ihren Umständen, hatte ich ihm nichts gesagt. Lang schon hatte ich nicht mehr daran gedacht und war überrascht, dass sich gerade jetzt, in einer bedrängenden Gegenwart, diese Erinnerungen zurückmeldeten.
Es waren die schweren Tage im Jahr 1991. Seit der Drogenboss Pablo Escobar im April 1984 den Justizminister Rodrigo Lara Bonilla hatte ermorden lassen, war meine Stadt Geisel und Schauplatz des Krieges zwischen dem Medellín-Kartell und dem Staat. Die Bomben explodierten an sorgfältig von den Narcos ausgesuchten Plätzen, mit dem Ziel, namenlose Bürger zu töten, die nicht an diesem Krieg teilhatten (obwohl wir alle Teil dieses Krieges waren; das zu leugnen, war naiv oder einfältig). Am Vorabend eines Muttertages, um ein Beispiel zu nennen, hinterließen zwei Attentate in Bogotaer Einkaufszentren einundzwanzig Tote; eine Bombe in Medellíns Stierkampfarena – ein weiteres Beispiel – hinterließ zweiundzwanzig. Die Explosionen schrieben sich in den Kalender ein. Im Laufe der Monate begriffen wir, dass wir niemals außer Gefahr waren, keiner von uns, denn jeden konnte in jedem Augenblick und an jedem Ort eine Bombe treffen. Die Tatorte waren durch einen atavistischen Reflex, der uns erst allmählich bewusst wurde, für die Passanten tabu. Teile der Stadt gingen uns verloren oder verwandelten sich einer nach dem anderen zu einem Memento mori aus Zement und Ziegeln, und zaghaft gaben wir einer noch scheuen Erkenntnis nach: dass eine neue Art von Zufall (ein Zufall, der uns vom Tod trennt, neben dem Zufall der Liebe also der größte und dreisteste) in unser Leben getreten war, unsichtbar und unvorhersehbar wie eine Detonationswelle.
Unterdessen hatte ich mit meinem Jurastudium an einer Universität im Zentrum Bogotás begonnen, ein altes Kloster aus dem 17. Jahrhundert, das später als Gefängnis für die Unabhängigkeitskämpfer gedient hatte und über dessen Treppen so mancher zum Schafott hinabgestiegen war. Die Hörsäle mit den dicken Mauern hatten mehrere Präsidenten hervorgebracht und nicht wenige Dichter und – in unglücklichen Fällen – Dichterpräsidenten. Im Unterricht sprachen wir kaum von dem, was draußen geschah. Wir diskutierten darüber, ob eine Gruppe verschütteter Höhlenforscher das Recht hatte, einander aufzuessen; diskutierten, ob Shylock im Kaufmann von Venedig das Recht hatte, Antonio ein Pfund Fleisch aus dem Leib zu schneiden, und ob es rechtmäßig war, dass Portia ihn mit einem billigen Trick daran hinderte. In anderen Vorlesungen (den meisten) langweilte ich mich auf eine fast physische Weise, eine Art Unruhe in der Brust, vergleichbar mit einer leichten Panikattacke. Die unsägliche Ödheit von Verfahrens- oder Sachenrecht trieb mich immer öfter in die letzte Reihe im Saal, und hinter einem bunt gewürfelten Schutzwall von Studenten zog ich ein Buch hervor, Borges oder Vargas Llosa oder Flaubert, Vargas Llosas Empfehlung, oder Stevenson oder Kafka, Borges’ Empfehlungen. Sehr bald kam ich zu dem Schluss, dass es nicht der Mühe lohnte, zum Unterricht zu gehen`und dieses ausgefeilte Ritual akademischen Schwindels aufzuführen; ich fehlte immer öfter, vertrieb mir die Zeit mit Billardspielen und Gesprächen über Literatur, hörte mir auf den Ledersofas in der Casa Silva aufgezeichnete Dichterstimmen an, León de Greiff, Pablo Neruda, oder schlenderte in der Nähe der Universität umher, ohne Programm oder Plan, ohne Ziel, von den Schuhputzern auf dem Platz zum Café am Chorro de Quevedo, von den lauten Bänken im Parque Santander zu den versteckten, verschwiegenen im Palomar del Príncipe, oder vom Centro Cultural del Libro mit seinen quadratmetergroßen Ständen, den dicht an dicht gedrängten Buchhändlern, die jeden Roman des lateinamerikanischen Booms besorgen konnten, zum Templo de la Idea, einer dreistöckigen Villa, in der Bücher für Privatbibliotheken gebunden wurden und man sich auf die Stufen setzen und in einer Wolke von Leimgeruch und Maschinenlärm für andere bestimmte Bücher lesen konnte. Ich verfasste abstrakte Erzählungen voll poetischer Exzesse à la Hundert Jahre Einsamkeit und andere, in denen ich Cortázars Satzzeichen eines Saxophonspielers nachahmte wie in Bestiarium, sagen wir, oder in Circe. Gegen Ende des zweiten Studienjahres begriff ich etwas, was ich monatelang ausgebrütet hatte: Das Jurastudium interessierte mich nicht und nutzte mir nichts, denn meine einzige Leidenschaft war es, Fiktives zu lesen und es selbst schreiben zu lernen, mit der Zeit.
An einem dieser Tage geschah etwas.
In einem Seminar über die Geschichte der politischen Ideen sprachen wir gerade über Hobbes, Locke oder Montesquieu, als es auf der Straße zweimal laut knallte. Unser Raum befand sich im achten Stock, der auf die Carrera Séptima hinausging; vom Fenster aus konnte man die ganze Straße und den westlichen Gehweg überblicken. Ich lehnte an der Wand in der letzten Reihe und sprang als Erster zum Fenster. Auf dem Gehweg vor dem Schaufenster des Schreibwarenladens Panamericana lag der Körper, der gerade niedergeschossen worden war und vor aller Augen verblutete. Ich sah mich nach dem Schützen um, vergebens: Niemand schien eine Pistole in der Hand zu halten, niemand schien fortzulaufen und hinter einer opportunen Ecke zu verschwinden, keine Köpfe sahen einem Fliehenden nach, es gab keine neugierigen Blicke, keine deutenden Finger, denn in Bogotá hatte man gelernt, sich nicht in fremde Angelegenheiten zu mischen. Der Niedergeschossene trug einen Büroanzug, aber keine Krawatte; sein Sakko hatte sich beim Sturz geöffnet und gab den Blick frei auf das weiße, blutbefleckte Hemd. Er regte sich nicht. Ich dachte: er ist tot. Zwei Passanten hoben den Körper hoch; jemand hielt auf der Straße einen weißen Pick-up an. Sie legten den Körper auf die Ladefläche, und einer der beiden Passanten stieg mit hinauf. Ich fragte mich, ob er ihn kannte oder erkannt hatte, ob er im Moment der Schüsse bei ihm gewesen war (vielleicht ein Kompagnon bei trüben Geschäften) oder ob er es einfach aus Solidarität, aus ansteckendem Mitleid tat. Ohne das grüne Licht an der Avenida Jiménez abzuwarten, löste sich der weiße Pick-up aus dem Verkehr, bog abrupt nach links ab (ich begriff, dass sie den Verwundeten ins Hospital San José brachten) und verschwand aus meinem Blickfeld.
Nach dem Unterricht ging ich die acht Stockwerke hinunter bis zum Kreuzgang der Universität und trat auf die Plazoleta del Rosario, wo die Statue des Stadtgründers Don Gonzalo Jiménez de Quesada steht, Rüstung und Schwert in meiner Erinnerung mit ewigem Taubendreck überzogen. Ich ging durch die enge Calle 14, die immer kalt ist, weil sie nur morgens Sonne bekommt, niemals nach neun, und überquerte die Carrera Séptima auf Höhe des Schreibwarenladens. Der Blutfleck glänzte auf dem Gehweg wie ein verlorener Gegenstand, die Passanten machten einen Bogen um ihn, wichen ihm aus, als wäre das frische Blut des Angeschossenen ein Defekt im Pflaster, an dem man im Zentrum schon seit unvordenklichen Zeiten vorbeiging, an den man sich gewöhnt hatte und den man mied, ganz unbewusst. Der Fleck war von der Größe einer gespreizten Hand. Ich ging so nah heran, bis er sich zwischen meinen Füßen befand, als wollte ich ihn vor den Tritten der anderen schützen, doch dann tat ich genau das: ich trat darauf.
Ich tat es vorsichtig, eigentlich nur mit der Schuhspitze, wie ein Kind, das den Finger ins Wasser steckt, um die Temperatur zu prüfen. Die sauberen, klaren Umrisse des Flecks verwischten. Plötzlich musste mich Scham überkommen haben, denn ich sah mich um, ob es jemand beobachtet hatte und stillschweigend mein Betragen verurteilte (das etwas Respektloses, Ungebührliches hatte), und so unauffällig wie möglich trat ich von dem Fleck weg. Wenige Schritte entfernt befanden sich die Marmorgedenktafeln, die an die Ermordung Jorge Eliécer Gaitáns erinnerten. Ich blieb stehen und las sie oder tat zumindest so; dann überquerte ich die Séptima an der Jiménez-Ecke, ging einmal um den Block, trat ins Café Pasaje, bestellte einen Kaffee und putzte mir mit der Papierserviette die Schuhspitze ab. Ich hätte die Serviette auf dem Cafétisch zurücklassen können, unter dem Porzellantellerchen, aber ich nahm sie lieber mit, hütete mich jedoch davor, mit der bloßen Hand die getrockneten Blutreste des Mannes zu berühren. Ich warf die Serviette in den ersten Mülleimer, den ich fand. Mit niemandem sprach ich darüber, weder an dem Tag noch an den folgenden.
Doch am nächsten Morgen kehrte ich zu dem Stück Gehweg zurück. Der Fleck war nicht mehr da; kaum ein Schatten davon war auf dem grauen Beton zu sehen. Ich fragte mich, was mit dem verletzten Mann geschehen war: ob er überlebt hatte, ob er sich gerade in Begleitung seiner Frau, seiner Kinder erholte, ob er gestorben war und gerade die Totenwache gehalten wurde, irgendwo in dieser wütenden Stadt. Wie am Vortag ging ich ein paar Schritte in Richtung Avenida Jiménez und blieb vor den Marmortafeln stehen, aber diesmal las ich sie ganz, jede Zeile auf jeder der Tafeln, und mir wurde bewusst, dass ich das nie zuvor getan hatte. Gaitán, der Mann, der Teil unserer Familiengespräche gewesen war, seit ich denken konnte, war für mich praktisch immer noch ein Unbekannter, eine verschwommene Figur im vagen Bild, das ich von der kolumbianischen Geschichte hatte. An dem Nachmittag passte ich Professor Francisco Herrera nach seiner Rhetorikvorlesung ab und fragte, ob ich ihn auf ein Glas Bier einladen dürfe, damit er mir vom 9. April erzähle.
»Besser ein Milchkaffee«, sagte er. »Ich darf nicht mit Fahne nach Hause kommen.«
Francisco Herrera – Pacho für seine Freunde – war ein schlanker Mann mit großer schwarzer Hornbrille, dem Ruf eines Exzentrikers und prägnanter Baritonstimme, mit der er jeden unserer Politiker, egal welcher Tonlage, nachahmen konnte. Sein Gebiet war die Rechtsphilosophie, aber auf Grund seiner Rhetorikkenntnisse und seines Talents als Imitator gab er ein Abendseminar, in dem wir uns die großen Reden der politischen Rhetoriker anhörten und analysierten, von Marcus Antonius in Julius Caesar bis Martin Luther King. Nicht selten war das Seminar nur ein Vorspiel, denn nachher begleiteten ihn einige von uns ins Nachbarcafé, wo wir gegen einen Kaffee mit Schuss seine besten Imitationen vorgeführt bekamen, zur Verwunderung und Freude, manchmal auch zum Spott der Nachbartische. Gaitán konnte er besonders gut imitieren, denn die Adlernase und das nach hinten gegelte schwarze Haar erweckten die Illusion der Ähnlichkeit, doch vor allem verliehen seine erschöpfenden Kenntnisse über Gaitáns Leben und Werk – er hatte eine kurze Biografie in einem Universitätsverlag veröffentlicht – jedem einzelnen Satz eine Präzision, die eher an ein Medium bei einer spiritistischen Sitzung erinnerte. Durch seinen Mund erwachte Gaitán wieder zum Leben. Das sagte ich ihm einmal: Bei seinen Reden habe man das Gefühl, Gaitán habe Besitz von ihm ergriffen. Er lächelte, wie nur jemand lächeln kann, der sein Leben einer Verschrobenheit gewidmet hat und nun überrascht merkt, dass die Zeit nicht verschwendet war.
Vor der Tür des Café Pasaje – wir wollten gerade hinein, als ein Schuhputzer mit seinem Holzkasten unter dem Arm herauskam, und wir blieben stehen, um ihn vorbeizulassen – fragte mich Pacho, worüber ich reden wolle.
»Ich will wissen, wie das genau gewesen ist«, sagte ich. »Gaitáns Ermordung.«
»Ah, dann setzen wir uns besser nicht«, sagte er. »Kommen Sie, wir gehen um den Block.«
Das taten wir und zwar wortlos, beide gingen wir schweigend nebeneinander, nahmen auf dem kleinen Platz schweigend die Stufen zur Jiménez hinunter, gelangten schweigend an die Ecke und warteten schweigend, bis wir die Séptima mit ihrem dichten Verkehr überqueren konnten. Pacho schritt mit einer gewissen Eile aus, und ich bemühte mich, zu folgen. Er benahm sich wie ein älterer Bruder, der fortgezogen ist und dem jüngeren auf Besuch nun die neue Stadt zeigt. Wir gingen an den Marmortafeln vorbei, und es wunderte mich, dass Pacho nicht davor stehen blieb, nicht einmal mit einer Kopfbewegung, einer Geste andeutete, dass er sie kannte. Wir erreichten die Stelle, an der im Jahr 1948 das Agustín-Nieto-Gebäude gestanden hatte (nur wenige Schritte, wie mir auffiel, von dem Ort entfernt, wo sich am Vortag der Blutfleck befunden hatte und heute nur noch sein Gespenst, seine Erinnerung zurückgeblieben war). Pacho führte mich zur Glastür eines Geschäfts. »Anfassen«, sagte er.
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was er wollte. »Ich soll die Tür anfassen?«
»Ja, fassen Sie die Tür an«, sagte Pacho, und ich gehorchte. »Hier, durch diese Tür, ist Gaitán am 9. April herausgekommen«, fuhr er fort. »Natürlich nicht durch dieselbe Tür, es war nicht einmal dasselbe Haus. Das Agustín-Nieto-Gebäude haben sie schon vor langem eingerissen und diesen hässlichen Kasten gebaut. Aber für uns ist diese Tür jetzt eben die Tür, durch die Gaitán herausgekommen ist, und Sie berühren sie gerade. Es war zur Mittagszeit, gegen ein Uhr, und Gaitán wollte mit ein paar Freunden essen gehen. Er war guter Laune. Wissen Sie, warum er guter Laune war?«
»Nein, Pacho«, sagte ich. Ein Pärchen kam aus dem Haus und musterte uns kurz. »Erklären Sie mir, warum.«
»Weil er am Vorabend einen Prozess gewonnen hatte. Deshalb war er so zufrieden.« Seine Verteidigung von Leutnant Cortés, angeklagt wegen Mordes an dem Journalisten Eudoro Galarza Ossa, war nicht nur ein Sieg vor Gericht, sondern ein regelrechtes Wunder gewesen. Gaitán hatte eine mitreißende Rede gehalten, eine der besten seines Lebens, hatte eingeräumt, ja, der Leutnant habe den Journalisten getötet, aber in legitimer Verteidigung seiner Ehre. Das Verbrechen lag zehn Jahre zurück. Der Journalist, Direktor einer Zeitung in Manizalez, hatte die Veröffentlichung eines Artikels gebilligt, der die schlechte Behandlung anprangerte, die der Leutnant seiner Truppe zukommen ließ. Cortés begab sich eines Tages zur Redaktion und beschwerte sich über den Artikel. Als Direktor Galarza seinen Reporter verteidigte, er habe schließlich nur die Wahrheit geschrieben, zog der Leutnant die Pistole und feuerte zweimal auf ihn. So weit das Geschehen. Doch Gaitán griff zu seinen besten rhetorischen Waffen, sprach von menschlicher Leidenschaft, Soldatenehre, Pflichtbewusstsein, von der Verteidigung patriotischer Werte, der Verhältnismäßigkeit von Angriff und Verteidigung, davon, dass gewisse Umstände den Soldaten entehren, aber nicht den Zivilisten, dass ein Soldat, der seine Ehre verteidigt, zugleich die ganze Gesellschaft verteidigt. Ich war nicht überrascht, dass Pacho den Schluss des Plädoyers auswendig kannte. Langsam verwandelte er sich, wie ich es schon oft erlebt hatte, seine Stimme schlug um, aus Francisco Herreras tiefer, voller wurde Gaitáns höhere mit ihrem tiefen Atem eines Metronoms, den betonten Konsonanten, dem leidenschaftlichen Rhythmus.
»Leutnant Cortés, ich weiß nicht, wie die Entscheidung des Gerichts ausfallen wird, aber die Menge erahnt und spürt sie! Leutnant Cortés, Sie sind nicht mein Mandant. Ihr nobles, Ihr schmerzliches Leben reicht mir die Hand, und ich drücke sie im Wissen, dass es die Hand eines Ehrenmannes ist, voll Anstand und Güte!«
»Anstand und Güte«, sagte ich.
»Wunderbar, nicht wahr?«, sagte Pacho. »Was für eine schamlose Manipulation, aber wunderbar. Oder vielmehr: wunderbar, gerade weil es so eine schamlose Manipulation ist.«
»Schamlos, aber erfolgreich«, sagte ich.
»Genau.«
»Bei so etwas war Gaitán ein Zauberer.«
»Ein Zauberer, ja«, sagte Pacho. »Er war ein Verteidiger der Freiheit, hatte aber gerade den Mörder eines Journalisten aus dem Gefängnis geholt. Und niemandem kam der Gedanke, dass darin ein Widerspruch stecken könnte. Die Moral: Glaube niemals einem großen Redner.«
Die Menge brach in Beifall aus und trug Gaitán auf ihren Schultern aus dem Saal wie einen Torero. Es war spätnachts, zehn nach eins. Gaitán, müde, doch befriedigt, ließ sich zur obligatorischen Feier überreden, stieß mit den Seinen und mit Wildfremden an und kam um vier Uhr morgens nach Hause. Aber fünf Stunden später war er schon wieder im Büro, makellos gekämmt und im Dreiteiler: ein dunkelblauer Anzug, fast schwarz, mit feinen weißen Streifen. Er empfing einen Mandanten, nahm Anrufe von Journalisten entgegen. Kurz vor ein Uhr mittags versammelten sich ein paar Freunde in Gaitáns Büro, die ihn beglückwünschen wollten. Da waren Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla. Einer von ihnen, Plinio Mendoza Neira, lud alle zum Mittagessen ein, denn das Ereignis der letzten Nacht musste gefeiert werden.
»Einverstanden«, sagte Gaitán und lachte auf. »Aber ich warne dich, Plinio, ich bin teuer.«
»Sie sind im Fahrstuhl hinuntergefahren, der war ungefähr da«, sagte Pacho und deutete auf den Eingang des Gebäudes (des hässlichen Kastens). »Der Fahrstuhl hat nicht immer funktioniert, im Agustín-Nieto ist manchmal der Strom ausgefallen. An dem Tag aber ging er. Und da sind sie nach unten gefahren, sehen Sie.« Und ich sah hin. »Sie sind hinausgegangen. Plinio Mendoza hat Gaitán beim Arm genommen, so.« Pacho nahm mich beim Arm und schob mich voran, weg von der Eingangstür, Richtung Carrera Séptima. Da der Eingangsbereich seine Stimme nicht mehr abschirmte, musste Pacho lauter sprechen und näher heranrücken, damit er den Lärm von Verkehr und Passanten übertönte. »Drüben, auf der anderen Straßenseite hingen die Plakate des Teatro Faenza. Es wurde gerade Rom, offene Stadt gezeigt, der Film von Rossellini. Gaitán hatte in Rom studiert, und wer weiß, vielleicht ist ihm das Plakat aufgefallen, eine blitzschnelle Gedankenverbindung. Aber das werden wir nie erfahren. Wir können nicht wissen, was einem Menschen vor dem Tod durch den Kopf geht: was für unterirdische Erinnerungen, Assoziationen. Ob in Gedanken bei Rom, bei Rossellini oder nicht, jedenfalls ist Plinio Mendoza ein paar Schritte vorgegangen, hat sich von den Freunden entfernt. Als hätte er etwas Vertrauliches mit Gaitán zu besprechen. Und wissen Sie was? Vielleicht war das auch so. ›Was ich dir sagen will, geht ganz schnell‹, hat Mendoza gesagt. Dann hat er gesehen, wie Gaitán abrupt stehen blieb und wieder Richtung Tür zurückwich, die Hände vors Gesicht geschlagen, als wollte er sich schützen. Drei Schüsse knallten hintereinander, einen Sekundenbruchteil später ein vierter. Gaitán ist rücklings hingeschlagen. ›Was ist passiert, Jorge?‹, hat Mendoza gefragt. Was für eine dumme Frage«, sagte Pacho. »Aber wem fällt in einem solchen Moment schon Originelleres ein?«
»Niemandem«, sagte ich.
»Mendoza hat den Mörder gesehen«, sagte Pacho, »und ist ihm hinterhergestürzt. Doch der richtete die Pistole auf ihn, und Mendoza musste zurückweichen. Er hat gedacht, dass er ihn ebenfalls erschießen will, und versucht, ins Haus zurückzugelangen, zum Eingang, damit er sich dort verstecken und verschanzen kann.«
Pacho nahm mich wieder beim Arm. Wir kehrten zum verschwundenen Eingang des Agustín-Nieto zurück. Drehten uns um, blickten zum Verkehr auf der Séptima, und Pacho hob die rechte Hand, um mir die Stelle auf dem Gehweg zu zeigen, wo Gaitán zu Boden gegangen war: von seinem Kopf rann ein dünner Faden Blut auf den Gehweg. »Da drüben hat Juan Roa Sierra gestanden, der Mörder. Anscheinend hatte er vor der Tür des Agustín-Nieto auf Gaitán gewartet. Genau weiß man das natürlich nicht. Nach dem Attentat haben Zeugen ausgesagt, sie hätten ihn ins Gebäude treten und öfter als üblich mit dem Fahrstuhl hinauf- und hinabfahren sehen. Er war ihnen also aufgefallen. Aber mit Sicherheit konnten sie es nicht sagen: Nach einer so furchtbaren Tat redet man sich ein, Dinge gesehen, etwas verdächtig gefunden zu haben … Einige sagten, Roa habe einen grau gestreiften Anzug getragen, alt und verschlissen. Andere, der Anzug sei gestreift gewesen, aber braun. Wieder andere haben gar nichts von Streifen gesagt. Man muss sich das Durcheinander vorstellen, von allen Seiten Schreie, rennende Menschen. Wer soll da den Überblick bewahren? Kurzum: Mendoza hat den Mörder von hier aus gesehen, wo wir jetzt stehen. Er hat gesehen, wie er den Revolver sinken ließ und dann erneut auf Gaitán zielte, wie zum Gnadenschuss. Nach Mendozas Aussage hat Roa nicht geschossen. Ein anderer Zeuge hat ausgesagt, er habe sehr wohl geschossen, die Kugel sei auf dem Pflaster abgeprallt und habe beinahe Mendoza getötet. Roa hat sich dann nach allen Seiten umgesehen, einen Fluchtweg gesucht. Da, an der Ecke«, sagte Pacho und wedelte mit der Hand in Richtung Avenida Jiménez, »hat ein Polizist gestanden. Mendoza sah, wie der eine Sekunde zögerte, eine sehr kurze Sekunde, und dann seine Pistole zog, um auf Roa Sierra zu schießen. Roa ist Richtung Norden geflohen, da entlang, sehen Sie.«
»Ja, ich sehe.«
»Dann hat er sich umgedreht, als wollte er Gaitáns Begleiter bedrohen, verstehen Sie, als suchte er Deckung bei der Flucht. Und da haben ihn sich die Leute auf der Straße geschnappt. Ebenso der Polizist, der auf ihn schießen wollte, oder ein anderer, sagen einige. Manche behaupten aber auch, der Polizist sei von hinten gekommen, habe ihn mit der Pistole bedroht, und da hat Roa die Arme gehoben, und die anderen haben sich auf ihn gestürzt. Wieder andere sagen, er wollte weiter oben die Séptima überqueren, in östlicher Richtung. Aber sie haben ihn gepackt, hier auf dem Gehweg, bevor er hinüber konnte. Als die Freunde gesehen haben, dass der Mörder gefasst war, sind sie wieder zu Gaitán gegangen, um zu sehen, ob sie ihm helfen können. Der Hut war ihm heruntergefallen, einen Schritt vom Körper entfernt. Der Körper lag so da«, sagte Pacho und malte horizontale Linien in die Luft. »Parallel zur Straße. Aber alle waren so fassungslos, dass jeder der Freunde nachher etwas anderes erzählt hat. Die einen, Gaitáns Kopf habe nach Süden gezeigt, die Füße nach Norden; die anderen, das genaue Gegenteil. Doch in einem waren sie sich einig: Seine Augen waren offen und entsetzlich reglos. Jemand, vielleicht Vallejo, hat bemerkt, dass er aus dem Mund blutete. Ein anderer hat geschrien, man solle Wasser bringen. Im Erdgeschoss befand sich El Gato Negro, und eine Kellnerin kam mit einem Glas Wasser heraus. ›Sie haben Gaitancito umgebracht‹, hat sie angeblich gerufen. Die Leuten sind zu Gaitán getreten, haben sich gebückt und ihn angefasst, als berührten sie einen Heiligen: seine Kleidung, sein Haar. Dann ist Pedro Eliseo Cruz gekommen, ein Arzt, er hat sich neben den Körper gekniet und ihm den Puls gefühlt. ›Lebt er?‹, hat Alejandro Vallejo gefragt. ›Du ruf einfach ein Taxi‹, hat Cruz entgegnet.«
»Aber das Taxi, ein schwarzes Taxi, war schon da, ohne dass es jemand hatte rufen müssen«, sagte Pacho. »Die Leute haben sich um das Privileg gestritten, Gaitán aufheben und in den Wagen legen zu dürfen. Doch zuvor hatte Cruz eine Wunde am Hinterkopf bemerkt. Er wollte sie untersuchen und hat Gaitáns Kopf bewegt, aber er hat Blut gespuckt. Jemand hat gefragt, wie es stehe. ›Hoffnungslos‹, hat Cruz gesagt. Gaitán hat ein paar Klagelaute von sich gegeben«, sagte Pacho. »Geräusche, die wie Klagelaute klangen.«
»Dann war er am Leben«, sagte ich.
»In dem Moment ja«, sagte Pacho. »Eine Kellnerin aus einem anderen Café in der Nähe, das El Molino oder El Inca, hat später geschworen, sie habe ihn sagen hören: ›Lasst mich nicht sterben.‹ Aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher Cruz und seiner Einschätzung: Für Gaitán kam jede Hilfe zu spät. Da ist ein Kerl mit Kamera aufgetaucht und hat angefangen, Fotos von Gaitán zu machen.«
»Was denn, Pacho?«, sagte ich. »Es gibt Fotos von Gaitán? Nach den Schüssen?«
»So heißt es, ja. Ich habe sie nicht gesehen, aber es gibt sie wohl. Das heißt, jemand hat fotografiert, so viel ist sicher. Eine andere Frage ist, ob sie überlebt haben. Man kann sich zwar nicht vorstellen, dass etwas so Wichtiges verlegt worden, beim Räumen verloren gegangen sein soll. Aber so ist es aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen. Sonst wären sie uns doch überliefert worden, nicht wahr? Natürlich kann sie auch jemand vernichtet haben. So viele Geheimnisse verschleiern diesen Tag … Kurzum: es hat sich wohl so abgespielt. Der Fotograf hat sich einen Weg durch die Menge gebahnt und angefangen, Gaitán zu fotografieren. Einer der anwesenden Zeugen hat sich empört. ›Der Tote ist nicht wichtig‹, hat er zum Fotografen gesagt. ›Nehmen Sie lieber den Mörder auf.‹«
»Aber das hat der Fotograf nicht getan«, sagte Pacho. »Inzwischen hatten die Leute Gaitán ins Taxi gehoben. Cruz ist mit eingestiegen, die übrigen in ein anderes Taxi, das gleich danach aufgetaucht ist. Und alle sind Richtung Süden zur Clínica Central gefahren. Danach sollen sich einige zu der Stelle gebückt haben, wo der Körper gelegen hat, sie haben ihre Taschentücher hervorgezogen und in Gaitáns Blut getaucht. Dann hat einer das Gleiche mit einer kolumbianischen Flagge getan.«
»Und Roa Sierra?«, fragte ich.
»Roa Sierra hatte ein Polizist geschnappt, erinnern Sie sich?«
»Ja, neben dem Gebäude.«
»Fast an der Ecke. Roa Sierra ist Richtung Jiménez zurückgewichen, und da hat ihn der Polizist von hinten gepackt und die Pistole in die Rippen gedrückt. ›Töten Sie mich nicht, Hauptmann‹, hat Roa gesagt. Es war ein stellvertretender Wachmann, der gerade Dienst hatte. Er hat Roa entwaffnet (hat ihm die vernickelte Pistole weggenommen und sie sich in die Hosentasche gesteckt) und ihn beim Arm genommen.«
»Er hieß Jiménez«, sagte Pacho. »Wachmann Jiménez im Dienst auf der Avenida Jiménez: Etwas mehr Phantasie könnte die Geschichte schon haben, oder? Nun gut, der Wachmann führt Roa Sierra also gerade ab, da fällt jemand auf der Straße über Roa her und schlägt ihn, ich weiß nicht, ob mit der Faust oder mit einem Kasten, und Roa Sierra prallt gegen ein Schaufenster, genau dort.« Pacho deutete auf eine Tür neben dem Agustín-Nieto. »Das Gebäude hieß Faux, glaube ich, und da ist das Schaufenster zu Bruch gegangen: ein Kodak-Fotoladen, scheint mir, aber ich bin mir nicht sicher. Man weiß nicht, ob es der Schlag war oder der Prall gegen das Schaufenster, jedenfalls lief Roa Blut aus der Nase.«
Als er sah, dass die Leute sie umringten, suchte Wachmann Jiménez einen Unterschlupf. Er ging Richtung Süden, wieder an dem Gebäude vorbei. »Der war’s«, schrie die Menge, »der hat Doktor Gaitán umgebracht.« Der Wachmann führte Roa immer noch am Arm und steuerte auf die Granada-Apotheke zu, konnte auf der kurzen Strecke jedoch nicht verhindern, dass die Schuhputzer mit ihren schweren Holzkästen nach ihm schlugen.
»Roa hatte Todesangst«, sagte Pacho. »Nach Aussagen von Vallejo und Mendoza, die ihn hatten schießen sehen, war sein Gesicht von Hass verzerrt gewesen. Der Hass eines Fanatikers. Alle waren sich einig, dass Roa im Augenblick des Schusses absolute Selbstbeherrschung gezeigt hatte. Aber nachher, als ihn die wütenden Schuhputzer umringten, ihn schlugen und er gewiss dachte, dass diese Leute ihn lynchen wollten … da war es vorbei mit Fanatismus und Selbstbeherrschung. Nackte Angst. Die Veränderung war so drastisch, dass viele dachten, es seien zwei unterschiedliche Männer gewesen, der Fanatiker und der Verschreckte.«
Gaitáns Mörder war bleich. Er hatte olivfarbene Haut und ein kantiges Gesicht; das schlaffe Haar war zu lang, und eine nachlässige Rasur zeichnete ihm schmutzige Schatten ins Gesicht. Er machte den Eindruck eines Straßenköters. Einige Zeugen sagten aus, er habe wie ein Mechaniker oder Handwerker ausgesehen, und einer behauptete sogar, einen Ölfleck auf dem Ärmel gesehen zu haben. »Lyncht den Mörder!«, schrie jemand. Mit gebrochener Nase ließ Roa sich zur Granada-Apotheke stoßen. Pascal del Vecchio, ein Freund Gaitáns, bat den Apotheker, den Mörder einzulassen, damit er nicht gelyncht würde. Sie schoben Roa hinein, der sich anscheinend mit seinem Schicksal abgefunden hatte und keinerlei Widerstand mehr leistete; er hockte sich in eine Ecke der Apotheke, die von der Straße nicht einsehbar war. Jemand ließ die Metalljalousie herunter. Einer der Angestellten trat auf ihn zu:
»Warum haben Sie Doktor Gaitán getötet?«
»Ach, wissen Sie«, sagte Roa, »da ist Mächtiges im Spiel, von dem ich nicht reden kann.«
Draußen versuchte man, die Jalousie aufzubrechen. Der Inhaber erschrak oder wollte nicht, dass man ihm den Laden zerstörte, und so öffnete er am Ende selbst.
»Die Leute werden Sie lynchen«, drang der Angestellte weiter in ihn. »Sagen Sie, wer Sie geschickt hat.«
»Ich kann nicht«, sagte Roa.
»Roa wollte sich hinter der Theke verstecken, aber bevor er sie umrunden konnte, hatten sie ihn schon gepackt«, sagte Pacho. »Die Schuhputzer haben sich auf ihn geworfen und ihn hinausgeschleift. Aber er war noch nicht auf der Straße, da hat sich jemand eine Schubkarre gegriffen, so ein Metallwägelchen für Kisten. Nun, dieser Jemand packt die Karre und wirft sie auf Roa. Ich glaube, Roa war danach schon bewusstlos. Die Leute haben ihn auf die Straße gestoßen. Haben dort weiter auf ihn eingeprügelt: mit Fäusten, Füßen, Kästen. Einer soll ihm mehrmals einen Kugelschreiber ins Fleisch gebohrt haben. Sie haben ihn Richtung Süden geschleift, zum Präsidentenpalast. Es gibt ein Foto, ein berühmtes Foto, von einem der oberen Stockwerke aufgenommen, da ist die Meute schon weiter vorne, auf Höhe der Plaza de Bolívar. Man sieht, wie die Meute Roa hinter sich her schleift, und man sieht Roa oder vielmehr seinen toten Leib. Beim Schleifen hat er die Kleider verloren und ist fast nackt. Das ist eines der furchtbarsten Fotos, die von diesem furchtbaren Tag geblieben sind. Roa war da bereits tot, er muss also auf dem Weg von der Granada-Apotheke gestorben sein. Manchmal kommt mir der Gedanke, dass Roa gleichzeitig mit Gaitán gestorben ist. Wissen Sie, wann genau Gaitán starb? Um ein Uhr fünfundfünfzig. Fünf vor zwei. Gut möglich, dass er zur selben Zeit gestorben ist wie sein Mörder, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum das wichtig sein soll, das heißt, ich weiß, dass es nicht wichtig ist, aber manchmal kommt mir dieser Gedanke. Von dort drüben aus haben sie Roa Sierra mitgeschleift. Da war die Granada-Apotheke, und von da haben sie ihn mitgeschleift. Vielleicht war er hier, wo wir beide jetzt stehen, bereits tot. Vielleicht ist er später gestorben. Man weiß es nicht, wird es niemals wissen.«
Pacho verstummte. Er streckte die Hand aus und blickte zum Himmel.
»Mist, es nieselt«, sagte er. »Wollen Sie noch mehr wissen?«
Wir standen nur ein paar Schritte von der Stelle entfernt, an der vor wenigen Stunden ein unbekannter Mann zu Boden gegangen war. Fast hätte ich Pacho gefragt, ob er davon gehört habe, hielt es dann aber für eine überflüssige Information, ja sogar für respektlos gegenüber dem Mann, der mich an seinem Wissen hatte teilhaben lassen. Es waren zwei ganz unterschiedliche Tote, Gaitán und dieser Unbekannte, so viele Jahre lagen zwischen ihnen, und doch waren die beiden Blutlachen – die eine von 1948, in die die Leute ihre Taschentücher getaucht hatten, und die andere aus dem Jahr 1991, die meine Schuhspitze benetzt hatte – im Grunde gar nicht so verschieden. Nichts verband sie außer meiner Faszination, meiner krankhaften Neugier, aber das war ausreichend, denn diese krankhafte Neugier oder Faszination war so stark wie der abgrundtiefe Widerwillen, den ich allmählich für die Stadt empfand, für diese Mörderstadt, diese Friedhofsstadt, die Stadt, in der jede Ecke ihren Gefallenen hatte. Ebendas entdeckte ich, mit einer Art Entsetzen, damals in mir selbst, die dunkle Faszination für die Toten, von denen die Stadt wimmelte: die gegenwärtigen Toten und die vergangenen ebenso. Ich ging durch die wütende Stadt, suchte die Schauplätze bestimmter Verbrechen auf, eben weil sie mich entsetzten, verfolgte die Gespenster der Toten, die eines gewaltsamen Todes gestorben waren, eben weil ich Angst hatte, eines Tages zu ihnen zu gehören. Aber das war nicht einfach zu erklären, nicht einmal jemandem wie Pacho Herrera.
»Nein, mehr nicht«, sagte ich. »Danke für alles.«
Und ich sah ihm nach, wie er sich in der Menge verlor.
An dem Abend kam ich nach Hause und schrieb in einem Schwung sieben Seiten einer Erzählung, die wiedergab oder wiederzugeben versuchte, was mir Pacho Herrera auf der Séptima erzählt hatte, auf demselben Gehweg, auf dem die Geschichte meines Landes eine radikale Wende vollzogen hatte. Ich glaube, ich begriff nicht einmal, wie sehr Pachos Bericht meine Phantasie gefesselt hatte, und wohl ebenso wenig, dass es Abertausend Kolumbianern in den letzten dreiundvierzig Jahren nicht anders gegangen war. Die Erzählung taugte nicht viel, aber es war meine, ihr Stil war nicht García Márquez, Cortázar oder Borges entliehen, wie bei vielen meiner anderen Versuche damals, sondern ihr Ton, ihre Perspektive hatte etwas, was ich zum ersten Mal als Eigenes empfand. Ich zeigte sie Pacho – ein junger Mann, der die Billigung des Älteren sucht –, und von da an änderte sich unsere Beziehung, wurde vertrauter, aus der Respektsperson wurde eine Art Freund. Wenige Tage später fragte er mich, ob ich mit ihm Gaitáns Haus besuchen wolle.
»Gaitán hat ein Haus?«
»Das Haus, in dem er gewohnt hat, als sie ihn umgebracht haben«, sagte Pacho. »Jetzt ist es natürlich ein Museum.«
Dorthin gingen wir an einem sonnigen Nachmittag, zu einem großen zweistöckigen Haus, das ich seitdem nicht wieder besucht habe, von Grün umgeben (ich erinnere mich an eine kleine Wiese und einen Baum) und restlos besetzt von Gaitáns Gespenst. Im Erdgeschoss wiederholte sich in einem alten Fernseher ein Dokumentarfilm über sein Leben, Lautsprecher spuckten Aufnahmen seiner Reden aus, und oben, gleich hinter der weit geschwungenen Treppe, stieß man auf die viereckige Vitrine, in der man aufrecht den mitternachtsblauen Anzug sah. Ich ging um die Vitrine herum, suchte nach den Einschusslöchern im Stoff und fand sie mit einem Schaudern. Später suchte ich das Grab im Garten und blieb eine Weile davor stehen, dachte an das, was Pacho mir erzählt hatte, blickte auf, sah die Blätter des Baums im Wind schaukeln und spürte Bogotás Abendsonne auf dem Kopf. Da trat Pacho wieder auf die Straße, ließ mir keine Zeit zum Verabschieden, hielt ein Taxi an und stieg ein. Ich sah, wie er die Tür schloss, wie sich sein Mund bewegte und eine Adresse angab, sah ihn die Brille abnehmen, als wollte er sich ein Staubkorn aus dem Auge wischen, eine lästige Wimper, eine Träne, die uns den Blick trübt.
Der Besuch bei Doktor Benavides fand ein paar Tage nach unserem Gespräch statt. Am Samstag hatte ich, als Abwechslung zum eintönigen Speiseplan der Cafeteria, zwei Stunden im Restaurantgeschoss eines benachbarten Einkaufszentrums gesessen und anschließend etwas Zeit in der Librería Nacional verbummelt, wo ich auf ein Buch von José Avellanos gestoßen war, das mir für den Roman nützlich sein konnte, den ich in der herausgeschundenen freien Zeit zu schreiben versuchte. Es war eine pikareske, bizarre Geschichte über einen möglichen Aufenthalt Joseph Conrads in Panama, und mit jedem Satz merkte ich, dass das Schreiben nur einen einzigen Zweck erfüllte: mich von den medizinischen Schrecken abzulenken, sie zu verbannen. Als ich in das Krankenhauszimmer zurückkehrte, steckte M. gerade mitten in einer Untersuchung, die die Intensität ihrer heimlichen Wehen maß. Ihr Bauch war mit Elektroden bedeckt; aus einer Maschine neben dem Bett drang elektrisches Säuseln und im Hintergrund das sanfte, doch frenetische Fegen einer Feder, die Tintenlinien auf Millimeterpapier zeichnete. Bei jeder Wehe gerieten die Linien in Bewegung, schüttelten sich wie ein Tier, das im Schlaf gestört wird. »Da war eben eine«, sagte die Krankenschwester. »Die haben Sie doch gespürt?« Und sie musste zugeben, nein, auch diesmal habe sie nichts gespürt, missmutig, als ärgerte sie absurderweise die eigene Fühllosigkeit. Für mich dagegen war dieses durchfurchte Papier eine der ersten Spuren, die meine Töchter in der Welt hinterließen, und ich wollte die Krankenschwestern schon um eines der Diagramme bitten oder um eine Kopie. Aber dann sagte ich mir: Und wenn es schlecht ausgeht? Wenn es eine Fehlgeburt wird und die Mädchen nicht überleben oder nur unter widrigen Umständen, und wenn es in der Zukunft nichts zu gedenken, geschweige denn zu feiern gibt? Diese Möglichkeit war noch nicht vom Tisch; weder die Ärzte noch die Untersuchungen hatten sie ausgeschlossen. Ich ließ die Krankenschwestern also gehen, ohne sie darum zu bitten.
»Wie war die Untersuchung?«, fragte ich.
»Wie immer«, sagte M. mit einem angedeuteten Lächeln. »Die beiden wollen unbedingt hinaus, als hätten sie ein Rendezvous.« Und dann: »Jemand hat etwas für dich abgegeben. Da, auf dem Tisch.«