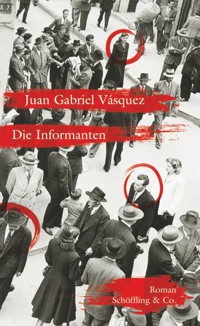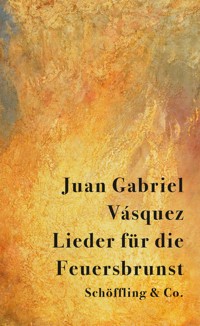
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie scheinbar belanglose Vorfälle ein Leben von Grund auf verändern können - davon handeln die neuen Erzählungen von Juan Gabriel Vásquez. Da ist der junge Mann, den das Los vor dem Militärdienst verschont, während es seinen besten Freund in den Tod schickt. Oder die Fotografin, die bei einem Treffen von Großgrundbesitzern mehr versteht, als ihr lieb ist. In einigen Geschichten ist es die Politik, die Menschen aus der Bahn wirft: Eine selbstbewusste Frau versucht sich gegen die erzkonservativen Kräfte durchzusetzen, doch gehen ihre Hoffnungen in Flammen auf. Manchmal betritt Juan Gabriel Vásquez selbst die Bühne und versucht etwa herauszufinden, was zwischen den Mitgliedern der mexikanischen Band vorgefallen ist, die er auf ihrer Tournee begleitet. Ein andermal wirkt er als Statist beim Dreh eines Films von Roman Polanski mit und sieht sich mit den schmerzlichen Brüchen im Leben des berühmten Regisseurs konfrontiert. In seinem Erzählungsband Lieder für die Feuersbrunst wirft der gefeierte kolumbianische Autor auf ganz neue Weise Fragen danach auf, was uns prägt und warum. Der eindringliche Sound seiner Sprache übt dabei einen unwiderstehlichen Sog aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
Frau am Ufer
Der Doppelgänger
Die Frösche
Schlechte Nachrichten
Wir
Flughafen
Die Jungen
Der letzte Corrido
Lieder für die Feuersbrunst
Anmerkung des Autors
Zitatnachweis
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Für Carlota und Martina, Reisegefährtinnen
Sie werden ihn belagern ohne Ende, Erinnerungen, ob geheiligt, ob profan, die unser Schicksal sind, die tödlichen Erinnerungen, weit wie nur ein Kontinent.
Jorge Luis Borges, »Das Ende«
Meine Vergangenheit, wem mag sie wohl gehören?
Jorge Luis Borges, »All our yesterdays«
Frau am Ufer
I
Schon immer wollte ich die Geschichte aufschreiben, die mir die Fotografin erzählt hat, konnte es aber nur mit ihrer Erlaubnis, ihrem Einverständnis. Die Geschichten der anderen sind unantastbares Terrain, zumindest für mich, denn oft steckt in ihnen etwas, was ein ganzes Leben erklärt und begründet, und sie zu stehlen und aufzuschreiben ist weitaus schlimmer, als ein Geheimnis zu verraten. Jetzt hat sie mir aus Gründen, die keine Rolle spielen, diese Aneignung gestattet und nur darum gebeten, dass ich die Geschichte so erzähle, wie ich sie an jenem Abend von ihr gehört habe: ohne Änderungen, Ausschmückungen, ohne Paukenschläge, aber auch ohne Schalldämpfer. »Fangen Sie an wie ich«, sagte sie. »Beginnen Sie mit meiner Ankunft auf der Farm, als ich die Frau gesehen habe.« Und das will ich tun, denn mir scheint, sie hat über mich einen Weg gefunden, sich die eigene Geschichte erzählen zu lassen und etwas zu verstehen (oder es zumindest zu versuchen), was ihr bisher immer wieder entglitten war.
Die Fotografin hatte einen langen Vornamen, und ebenso lang waren ihre Nachnamen, doch jeder nannte sie J. Mit den Jahren war sie fast zur Legende geworden, einer dieser Menschen, über die man Dinge weiß: dass sie immer in Schwarz ging, niemals Schnaps trank und hinge ihr Leben davon ab. Man wusste, dass sie sich Zeit nahm, mit den Leuten sprach, bevor sie die Kamera aus dem Rucksack zog, und oft waren ihre Erinnerungen, nicht die Recherchen der Stoff, aus dem die Journalisten ihre Artikel schrieben. Man wusste, dass andere Fotografen ihr folgten, hinterherspionierten und glaubten, sie merkte es nicht; sie stellten sich hinter sie und versuchten vergebens zu sehen, was sie sah. Sie hatte die Gewalt beharrlicher (und auch einfühlsamer) dokumentiert als jeder andere Fotojournalist, und von ihr stammten die erschütterndsten Bilder unseres Krieges: die von der Guerilla zerstörte Kirche, zwischen deren Trümmern eine alte Frau weint; der Arm eines jungen Mädchens, darin eingeritzt die bereits vernarbten Initialen der paramilitärischen Gruppe, die ihren Sohn vor ihren Augen ermordet hatte. In manchen privilegierten Gegenden hatten sich die Dinge inzwischen geändert. Die Gewalt war auf dem Rückzug, und die Leute lernten wieder so etwas wie Ruhe kennen. Diese Orte besuchte J. gern und wann immer sie konnte: um auszuruhen, dem Alltag zu entfliehen, oder einfach nur, um persönlich diese Veränderungen zu bezeugen, die man früher für unmöglich gehalten hätte.
So kam sie zur Hacienda Las Palmas. Die Farm war das, was von den neunzigtausend Hektar, die den Eigentümern früher einmal gehört hatten, übrig geblieben war. Die Galáns hatten die Llanos nie verlassen und wollten auch das alte Haus nicht renovieren, sie lebten dort zufrieden und gingen barfuß über den Lehmboden, ohne die Hühner aufzuschrecken. J. kannte sie, da sie vor zwanzig Jahren schon einmal bei ihnen gewesen war. Damals hatten die Galáns das Zimmer einer Tochter vermietet, die in Bogotá Landwirtschaft studierte, und J. sah vor ihrem Fenster, was man dort den Spiegel aus Wasser nannte: einen fast hundert Meter breiten Fluss, der so ruhig war, dass er einem See glich. Die Wasserschweine durchschwammen ihn, ohne dass die Strömung sie vom Weg abbrachte, und manchmal ragte, reglos treibend, ein gelangweilter Krokodilkaiman aus dem Wasser.
Bei ihrem zweiten Besuch schlief J. nicht in diesem Zimmer voll fremder Dinge, sondern in der bequemen Neutralität eines Gästezimmers mit zwei von einem Nachtschränkchen getrennten Betten. (Nur eines benutzte sie und hatte sogar Mühe, zu wählen.) Alles andere war genau wie damals: Da waren die Wasserschweine, die Kaimane und das ruhige Wasser, durch die Dürre noch träger. Vor allem waren da die Menschen. Denn die Galáns, die ihre Farm fast nur zum Kauf von Materialien verließen, luden die Welt zu sich ein. Ihr Tisch, eine gewaltige Holzplatte neben dem Kohleherd, war immer besetzt mit Leuten von überallher, Besucher von den Nachbarfarmen oder aus Yopal, Freunde der Töchter, mal in ihrer Begleitung, mal allein, Zoologen oder Tierärzte, Viehzüchter, die über ihre Probleme reden wollten. Auch diesmal war es so. Die Leute setzten sich zwei, drei Stunden ins Auto, um die Galáns zu besuchen. Bei J. waren es sieben gewesen, und die war sie gern gefahren, hatte beim Tanken Pause gemacht, die Fenster ihres alten Geländewagens heruntergekurbelt, um die wechselnden Gerüche der Landstraße einzusaugen. Manche Orte haben eine magnetische Anziehungskraft, vielleicht zu Unrecht (unser Hang zum Mythischen, unser Aberglaube helfen nach). Für J. war Las Palmas ein solcher Ort. Und das suchte sie: ein paar Tage Ruhe unter Löfflern und Leguanen, die von den Bäumen herabkletterten und die Mangos am Boden fraßen, an einem Ort, der früher Schauplatz der Gewalt gewesen war.
Da saß sie also am Abend ihrer Ankunft unter dem weißen Licht einer Neonröhre und aß Fleisch mit gefüllten Bananen, in Gesellschaft von einem Dutzend Unbekannter, die einander offensichtlich auch nicht kannten. Man sprach über alles Mögliche – wie friedlich es in der Gegend geworden war, dass kein Geld mehr erpresst, kaum mehr Vieh gestohlen wurde –, als sie den Gruß einer Frau hörte, die gerade dazugekommen war.
»Gesegneten Abend«, sagte sie.
J. blickte wie die anderen auf, hörte, wie die Frau um Entschuldigung bat, ohne jemanden anzublicken, sah, wie sie einen Plastikstuhl heranzog, und da spürte sie ein Wiedererkennen. Sie brauchte einige Sekunden, bis sie sich erinnerte oder sich bewusst wurde, dass sie die Frau genau hier kennengelernt hatte, auf der Hacienda Las Palmas, vor zwanzig Jahren. Die Frau dagegen erinnerte sich offenbar nicht an J.
Als man später die Unterhaltung in den Hängematten und Schaukelstühlen fortsetzte, dachte J.: Besser so.
Besser, sie hatte sie nicht erkannt.
II
Vor zwanzig Jahren war Yolanda (so hieß die Frau) mit einer Gruppe gekommen. J. war sie gleich aufgefallen: diese Haltung einer belauerten Beute, der angespannte Schritt, die Art, sich zu bewegen, als hätte sie es eilig oder erledigte einen Auftrag. Sie wollte ernster wirken, als sie war, vor allem ernster als die Männer in der Gruppe. Beim ersten gemeinsamen Frühstück, man hatte den Tisch in den Schatten eines Baumes gerückt, der mit dumpfem Klacken von Bocciakugeln Mangos fallen ließ (ja, da war auch der lauernde Leguan), musterte J. die Frau, hörte ihr zu, musterte die Männer, hörte ihnen zu und erfuhr, dass sie aus Bogotá kamen und der Mann mit dem Schnurrbart, mit dem die anderen ehrerbietig, ja unterwürfig sprachen, ein Politiker aus zweiter Reihe war, um dessen Wohlwollen sich die Großgrundbesitzer der Gegend bemühten. Man nannte ihn Don Gilberto, doch der Gebrauch des Vornamens zeugte für J. von größerer Achtung, als hätte man ihn beim Nachnamen oder Titel gerufen. Don Gilberto gehörte zu den Männern, die beim Sprechen niemanden ansehen, niemanden beim Namen nennen, und doch weiß jeder, wem die Worte, die Vorschläge, die Befehle gelten. Yolanda hatte sich neben ihn gesetzt, mit durchgedrücktem Rücken, als hielte sie einen Notizblock, bereit zum Mitschreiben, zum Entgegennehmen von Aufträgen oder Diktaten. Als sie auf der Bank Platz genommen hatte (draußen gab es keine Stühle, sondern nur eine lange Bank aus dicken Holzlatten, von der die Tischgäste sich wie in einer Komödie gleichzeitig erheben mussten, um sie an den Tisch zu rücken), hatte sie ihren Teller samt Besteck von dem des Mannes abgerückt: fünf Zentimeter, mehr nicht, aber J. hatte die Geste bemerkt und bezeichnend gefunden. In dem Licht, das durch diese Lücke fiel, in dem ausgesuchten Bemühen, sich nicht zu berühren, spielte sich etwas ab.
Sie sprachen über die nächsten Wahlen, sprachen darüber, das Land vor der Gefahr des Kommunismus zu retten. Sprachen über den Toten, der vor ein paar Tagen den Fluss heruntergetrieben war, und alle waren sich einig, dass er etwas verbrochen haben musste: Wer ohne Schuld ist, dem passiert so etwas nicht. J. sprach nicht von dem Haus, das sie früh am Morgen nach einer halben Stunde Fahrt besucht hatte und wo ein Lehrer auf den Vorwurf hin, die Kinder zu indoktrinieren, für schuldig befunden und enthauptet worden war, den jungen Schülern ein warnendes Beispiel; sie sprach auch nicht über ihre Fotos von dem Schüler, der den Kopf auf dem Lehrerpult gefunden hatte. Dagegen sprach man von der traditionellen Musik der Region. Einer der Gäste hatte selbst ein paar solcher Lieder verfasst. J. kannte eines davon und überraschte die anderen (und sich selbst), indem sie den Refrain vortrug, Verse, in denen Reiter galoppierten und die Abendsonne die Farbe von einem Paar Lippen besaß. Sie spürte, dass sie die anderen auf sich aufmerksam gemacht hatte, vielleicht auf unpassende Weise. Sie spürte auch, dass sie Yolanda etwas von ihrer Last abnahm, die Blicke der Männer auf sie leichter wurden. Sie spürte, dass sie ihr das wortlos dankte.
Vor dem letzten Kaffee sagte Señor Galán:
»Für jeden, der mag, gibt es heute Nachmittag Pferde. Mauricio reitet mit euch aus, dann lernt ihr die Farm kennen.«
»Und was gibt es zu sehen?«, fragte der Politiker.
»Ah«, sagte Galán, »alles Mögliche.«
J. ließ die Stunden in einer grünen Hängematte verrinnen, wechselte Bier mit Zuckerwasser ab, döste vor sich hin oder las in einem Buch von Germán Castro Caycedo. Zur vereinbarten Uhrzeit ging sie zum Stall hinüber. Da standen sie, ein paar gesattelte Tiere, die auf den gleichen Punkt am Horizont starrten. Ihr Führer trug hochgekrempelte Hosen und ein Messer im Gürtel. J. fiel die Haut der nackten Füße auf, rissig wie ausgetrocknete Erde, wie ein Flussbett, vom Wasser verlassen. Der Mann zog Gurte fest und verlängerte Steigbügel, als die Gäste im Sattel saßen, blickte jedoch niemanden an, oder sein Gesicht erweckte diesen Eindruck: harte Wangenknochen, Schlitze statt Augen. J. wies er ein Pferd zu, das ihr allzu mager vorkam, aber als sie aufgestiegen war, saß sie bequem im Sattel und vergaß die Einwände. Es ging los, und ihr fiel auf, dass der Politiker nicht erschienen war. Da waren Yolanda und drei aus ihrer Gruppe: der mit den manierierten Koteletten, der mit dem gegelten Haar, der, der lispelte und besonders laut sprach (fast aggressiv), um seine Komplexe zu verbergen oder zu überspielen.
Es hatte aufgeklart. Ein gelbes Licht schien ihnen ins Gesicht, während sie über verdorrte Erde ritten, vorbei an Schädeln von Kühen und Wasserschweinen, über ihnen aufmerksame Geier. Die Hitze hatte nachgelassen, doch kein Wind ging, und J. spürte Schweiß in der Lendengegend. Ab und an roch es nach Aas. J. hatte man eine Wolldecke auf den Sattel gelegt, als Dämpfer für das harte Leder, aber etwas musste sie falsch machen, denn zweimal hatte sie einen Galopp versucht und zweimal Schmerzen im Becken verspürt. So fiel sie zurück, als wäre sie die schützende Nachhut. Vorn deutete Mauricio stumm auf Dinge oder sprach so leise, dass J. ihn nicht hörte. Das war nicht schlimm. Man musste nur der Linie seines Arms folgen und fand den Vogel mit der seltsamen Farbe, das riesige Wespennest, das Gürteltier, das für Aufregung in der Gruppe sorgte.
Dann hielt Mauricio an. Er gebot Schweigen und zeigte auf eine Baumgruppe, für die J. das Wort Wald zu groß vorkam. Dort stand, den Kopf witternd erhoben, der Hirsch.
»Wie schön«, flüsterte Yolanda.
Das war das Letzte, was J. sie sagen hörte, vor dem Unfall. Die Karawane setzte sich wieder in Bewegung, und das Folgende geschah blitzschnell. J. begriff den Vorfall, seinen Ablauf in dem Moment nicht, aber nachher sollte es jede Menge Erklärungen geben: Yolanda habe die Zügel schießen lassen, das Pferd sei in Galopp gefallen, Yolanda habe die Beine zusammengepresst (ein Reflex, um sich im Sattel zu halten), und das Pferd sei durchgegangen. Gesehen hatte J. jedoch dies: Das Pferd hatte eine schnelle Wendung vollzogen und war in Richtung Hacienda davongesprengt, Yolanda konnte sich nur noch am Hals festklammern (versuchte nicht einmal, nach den Zügeln zu greifen, oder tastete vergeblich nach ihnen, nur bemüht, sich im Sattel zu halten), und da war Mauricio ebenfalls losgestürmt, ein Wunder von Manöver, noch nie hatte J. derlei gesehen, er schnitt dem rebellischen Pferd den Weg ab, rammte es mit dem eigenen Pferd, dem eigenen Leib und brachte es zu Fall. Eine Bewegung von unglaublichem Geschick, die Mauricio vorübergehend zum Helden gemacht hätte (der eine Gefahr bei der Wurzel packt und verhindert, dass sie größer wird), wenn Yolando nicht unglücklich nach vorn katapultiert worden und ihr Kopf auf dem Boden aufgeschlagen wäre, auf den dürren Erdschollen, zwischen denen staubbedeckte Steine staken.
J. saß ab, um zu helfen (der Sprung einer Tänzerin), obwohl sie nichts tun konnte. Mauricio hatte schon ein Funksprechgerät aus der Satteltasche gezogen und rief in der Hacienda an, damit sie einen Wagen schickten und den Arzt riefen. Das gestürzte Pferd war bereits wieder auf den Beinen. Dort stand es, ruhig, und blickte ins Leere. Die Dringlichkeit, nach Hause zu kommen, hatte es vergessen. Auch Yolanda war ruhig, lag auf dem Bauch, die Augen geschlossen, die Arme unter dem Körper, ein schlafendes Mädchen in einer kalten Nacht.
Später, Señor Galán hatte Yolanda in die städtische Klinik gebracht, wurde viel über die Reaktion des Llaneros diskutiert. Er hätte das Pferd nicht zu Fall bringen dürfen, sagten die einen; die anderen führten an, er habe das Richtige getan, denn ein durchgegangenes Pferd sei für den Reiter gefährlicher, je länger man es gewähren lasse (die Geschwindigkeit, die Schwierigkeit, das Gleichgewicht zu halten). Man erzählte sich Anekdoten von früher, sprach von gelähmten Kindern, sagte, in den Llanos lerne man das Fallen. Don Gilberto hörte schweigend zu, das Gesicht von etwas verzerrt, was weniger Sorge als Wut verriet, die Wut dessen, der ein Spielzeug besitzt, auf das die anderen nicht aufgepasst haben. Vielleicht interpretierte es J. auch falsch. Sein Schweigen war schwer zu entschlüsseln, aber nachts, als Galán aus der Klinik anrief und den neusten Stand durchgab, wirkte er bestürzt. Er trank nun Whisky aus demselben Glas, aus dem er Zuckerwasser getrunken hatte, lag in einer bunten Hängematte, schaukelte aber nicht, sondern hatte als Anker einen Fuß mit schmutzigen Zehennägeln auf die Fliesen gestellt. Alles an ihm war Frage. Die erhaltene Information hatte ihn nicht befriedigt.
Yolanda war in ein künstliches Koma versetzt worden. Ihr linker Arm war stark gequetscht, aber sie hatte sich nichts gebrochen. Der Schlag gegen den Kopf hätte jedoch tödlich sein können und hatte zu einem Bluterguss mit unvorhersehbaren Folgen geführt. Die Ärzte hatten den Schädel bereits aufgebohrt, um den Druck des Blutes zu lindern, aber sie war nicht außer Gefahr, oder man konnte vielmehr die vielen Gefahren noch nicht benennen, die weiterhin bestanden. »Wir sind noch nicht über den Berg«, sagte der Mann, der mit Galán gesprochen hatte, vielleicht mit denselben Worten, die der Arzt verwendet hatte. Er war einer aus der Gruppe, umgänglicher als die anderen und zugleich weniger auffällig, und es hörte sich seltsam an, wie er die aufgeschürfte Haut beschrieb, das geschwollene, blau angelaufene Gesicht. Don Gilberto nahm die Worte mit schroffem Zug um den Mund auf und goss sich noch ein Glas Whisky ein, und J. dachte an die seltsamen Erscheinungsformen der Macht: Ein Untergebener – ein Assistent, ein Angestellter – unterrichtet uns über das Schicksal einer Person, die uns wichtig ist. Vielleicht kam J. die Sorge des Mannes deswegen so kühl vor, so distanziert.
Mitternacht war vorüber, Don Gilberto zog sich zurück, bereits betrunken oder wie betrunken redend. J. blieb noch etwas länger, von tiefem Schweigen umgeben oder von vorsichtigem Flüstern, als befände sich die Verunglückte im Nebenzimmer. Der Lispler hatte auch einiges getrunken und bot J. ein allzu volles Whiskyglas an. J. tat so, als tränke sie, kam sich aber plötzlich unsichtbar vor, da die anderen nun redeten, als wäre sie nicht anwesend.
»Der Chef ist erschrocken«, sagte einer.
»Klar«, sagte ein anderer. »Ist ja auch nicht irgendeine.«
»Es ist Yolanda, und er …«
»Ja. Es ist Yolanda.«
»Er ist erledigt, wenn ihr was passiert.«
»Sicher. Wenn ihr was passiert, ist er erledigt.«
Die Stimmen verschmolzen, waren eine einzige. J. wurde müde (diese verräterische Müdigkeit, mit der uns fremde Emotionen erschöpfen). Sie versank in der Hängematte, und ihr war, als deckte sie jemand zu. Sie wusste nicht, wann sie eingeschlafen war.
Als sie aufwachte, waren die anderen in ihren Zimmern verschwunden. Im Gang mit den Hängematten war das Licht ausgeschaltet, sodass J. sich im Dunkeln befand, umgeben von kaum wahrnehmbaren Schemen. Es roch nach verbranntem Öl. In der weiten Nacht hörte man nur den Chor der Frösche und namenloser Insekten. Geleitet von einer fernen Glühbirne gelangte sie zur offenen Küche, bahnte sich einen Weg zwischen schlafenden Hunden und Geranientöpfen und fand den Kühlschrank. Sie wollte sich ein Glas Zuckerwasser mit Eis eingießen und in ihr Zimmer gehen, wie alle anderen. Am nächsten Tag würde sie sich nach der Frau erkundigen, den Morgen auf der Farm verbringen, ein paar Fotos machen und nach dem Mittagessen nach Bogotá zurückkehren. So war ihr Entschluss. Doch während sie sich auf der Holzplatte Zuckerwasser einschenkte, wanderte ihr Blick zum ruhigen Fluss, vielleicht um zu sehen, ob die Kaimane nachts hervorkamen. Kaimane sah sie nicht, dafür jedoch Umrisse in der Größe eines mächtigen Wasserschweins am Ufer. J. ging zum Holzzaun, und dort erkannten ihre Augen, die sich allmählich ans Dunkel gewöhnten, einen Hut, dann einen sitzenden Menschen, dann, dass dieser Mensch Don Gilberto war. Später sollte sie sich fragen, warum sie nicht zu Bett gegangen war, sondern beschlossen hatte, hinüberzugehen. Wegen ihrer Beobachtung beim Frühstück oder wegen dieser seltsamen Art, in der der Chef sich sorgte?
»Guten Abend«, sagte sie, als sie herangekommen war.
Don Gilberto drehte sich kaum um. »Wie geht es Ihnen, Señorita?«, fragte er gleichgültig.
J. merkte, dass er weitergetrunken hatte, und fragte sich flüchtig, ob es klug sei, zu bleiben. Aber eine unbestimmte Neugier war stärker als jede Vorsicht. Der Mann saß auf dem Rasen – auf dem schütteren Gras, das widerwillig dort am Ufer wuchs –, mit rundem Rücken hielt er die Knie umklammert. J. suchte sich einen Platz zwischen dem Kot der Wasserschweine und setzte sich, ohne um Erlaubnis zu bitten, nicht neben den Mann, aber nah genung, um ein Gespräch zu führen. In der Nacht spiegelte das Wasser den verschleierten Mond, und J. versuchte sich zu erinnern, wie man die Lichtspur nannte, die der Mond aufs Meer wirft. Es fiel ihr nicht ein, und das war auch nicht das Meer, sondern ein stilles Gewässer in den Llanos Orientales, hier gab es keine Spur, sondern nur einen leichten weißlichen Widerschein.
J. streckte ihm die Hand entgegen und nannte ihren Namen.
»Ja, ich weiß, wer Sie sind«, sagte Don Gilberto, betonte die Konsonanten, obwohl seine Zunge ohnehin schon schwer war. »Die Fotografin, nicht wahr? Sie kommen aus Bogotá.«
»Was für ein Gedächtnis«, sagte J. »So sind die Politiker, sie erinnern sich an alles und jeden.«
Don Gilberto erwiderte nichts. J. fügte hinzu:
»Das mit Ihrer Assistentin tut mir sehr leid.«
»Ja«, sagte Don Gilberto. »Was halten Sie von der dummen Sache?«
Dumme Sache? Yolanda würde womöglich mit schweren Gehirnschäden aus dem Koma erwachen oder mit eingeschränkter Motorik, vielleicht wachte sie auch nie mehr auf, blieb gefangen in diesem künstlichen Schlaf und kehrte nicht mehr ins Leben zurück. Das war weit mehr als eine dumme Sache, dachte J. und dachte auch, dass ihre Neugier sie nicht getäuscht hatte.
»Nun, so würde ich es nicht nennen«, sagte J. »Die Sache ist ernst. Machen Sie sich keine Sorgen …?«
»Ich weiß, dass die Sache ernst ist«, fiel ihr Don Gilberto ins Wort.
»Natürlich«, sagte J. »Ich wollte nicht …«
»Kommen Sie mir nicht mit Predigten, Sie kennen sie nicht«, sagte der Mann. »Ich schon. Ich weiß, wer sie ist, und weiß, was geschehen kann.«
Hier brach er ab. »Verzeihen Sie«, sagte J. »Ich habe mich falsch ausgedrückt.«
»Wenn sie stirbt, stirbt sie für mich, nicht für Sie.«
»Ja«, sagte J. »Verzeihung.«
Da griff der Mann zu einer Aluminiumflasche zwischen den Beinen, schraubte den Verschluss ab, der als Becher diente, und nahm einen Schluck. Das Aluminium sandte einen schüchternen Lichtstrahl aus, weiß wie auf dem ruhigen Wasser. Dann füllte Don Gilberto den Becher noch einmal und reichte ihn J.
»Nein, vielen Dank«, sagte sie. Alkohol von ihm anzunehmen, konnte ein falsches Signal aussenden.
Der Mann trank den Becher selbst aus und schraubte ihn wieder auf die Flasche. »Was, denken Sie, wird passieren?«, fragte er.
»Mit ihr?«, entgegnete J., eine dumme Frage. »Ich weiß nicht, ich bin keine Ärztin. Man sagt, so etwas hinterlässt oft Spuren.«
»Ja, aber was für Spuren? Bleibt man zum Beispiel gelähmt?«
»Ich weiß nicht«, sagte J. »Das mag möglich sein.«
»Oder hat sie dann etwas am Kopf? Ist sie verwirrt oder hat Amnesie? Das heißt, vergisst sie Dinge?«
»Ah, ich verstehe«, sagte J. »Sie sorgen sich um das, was sie weiß.«
Don Gilberto wandte sich zum ersten Mal zu ihr um (von seinem Platz aus war das nicht einfach) und sah sie an. Auch im Halbdunkel erkannte J. in den schweren Lidern die Schläfrigkeit des Betrunkenen. Nein, keine Schläfrigkeit: als wäre ihm etwas in die Augen gekommen und hätte sie gereizt.
»Wie bitte?«, fragte Don Gilberto. »Was soll das heißen?«
»Nichts, gar nichts«, sagte J. »Sie arbeitet mit Ihnen und weiß vielleicht über wichtige Dinge Bescheid, hat wichtige Informationen. Nichts weiter.«
Don Gilberto blickte wieder auf den Fluss.
»Wichtige Dinge«, wiederholte er.
»Ja«, sagte J. »Nehme ich an.«
»Ja, genau, Señorita, ich glaube, Sie haben recht«, sagte Don Gilberto. Er goss sich wieder Whisky in den Schraubverschluss, schenkte nach, als triebe ihn auf einmal eine Art Dringlichkeit, und fuhr fort. »Aber das weiß man eben nicht, oder? Man weiß nicht, was in so einem Kopf vorgeht. Von jemandem, der so einen Unfall gehabt hat. Wie Yolanda. Meine Assistentin. Yolanda, meine Assistentin. Sie liegt im Koma, es kann gut oder schlecht ausgehen, und jetzt liegt sie im Koma. Aber was spielt sich in diesem Kopf ab? An was wird sie sich erinnern, wenn sie aufwacht? Wird sie nichts vergessen haben? Wichtige Informationen, ja. Informationen aus all den Jahren, die sie bei mir arbeitet: schon einige, drei oder vier. Da erfährt man vieles, meine Liebe. Wichtige Dinge. Die verloren gehen können, nicht wahr? Das haben Sie gesagt. Natürlich, genau das macht mir Sorge: dass diese Dinge verloren gehen, die sie weiß. Halten Sie das für möglich? Dass sie aufwacht und alles vergessen hat, einfach so? Glauben Sie, so was kommt vor?«
»Ja«, sagte J. »Bedauerlicherweise.«
Don Gilberto gab ein kehliges Geräusch von sich. War es Zustimmung, Resignation? Die Frösche waren zu hören und etwas, was J. nach einer Zikade klang, vielleicht auch nicht. Sie blickte auf ihr Handgelenk und sah im spärlichen Licht, dass es bereits zwei Uhr war. Die Nacht war kalt geworden, und etwas Unbehagliches hatte sich in die Unterhaltung mit diesem Mann eingeschlichen, ein Missklang, eine Art Feindseligkeit. J.’s Neugier gelangte an die Grenze der Müdigkeit. Sie stand auf und sprach von oben auf den Hut hinab:
»Wollen wir sehen, was uns morgen erwartet.«
Der Hut nickte: »Genau. Wollen wir sehen.«
J. machte sich auf den Weg zum Haus, in ihr Zimmer. Am nächsten Tag würde sie nach Bogotá zurückkehren. Die Nacht war blau und schwarz, und eine lautlose Brise erfrischte sie. Sie musste aufpassen, wohin sie den Fuß setzte, und das war ärgerlich, denn J. wäre gern sorglos, mit erhobenem Kopf vorangegangen, hätte lieber tief durchgeatmet und die Gerüche der Farm aufgesogen. Sie machte einen Umweg, damit sie ihr Zimmer nicht allzu schnell erreichte und sich noch eine Weile das Dunkel der Welt bewahrte, und so kam sie zu einem Winkel, in dem eine einsame Hängematte hing. Es war kein Gemeinschaftsbereich, eher eine private Ecke, wo (wie J. sich vorstellte) Señor Galán Siesta hielt. Sie legte sich in die Hängematte und blieb dort, schaukelte in der Dunkelheit, und im Dunkeln ging sie die Ereignisse des Tages durch: das Frühstück, das Besteck, das Yolanda von dem ihres Chefs abgerückt hatte, der Ausritt, der so schön begonnen hatte, dann Yolandas Fehler (die Zügel schießen zu lassen) und das Manöver des Llaneros, dieses blitzschnelle, erfahrene Manöver, das sich in ihrer Erinnerung nun in die Länge zog und einen Blick auf Yolandas Gesicht gestattete, auf ihre Miene, diesen lebhaften Ernst, der unsere Gesichtszüge im Notfall verzerrt, in einem Schreckmoment, in der Sekunde, die das Vorzimmer von etwas Schwerwiegendem ist. In ihrer Erinnerung tauchte auch Don Gilbertos Gesicht auf, obwohl er nicht dabei gewesen war. J. war abgestiegen, um der gestürzten Frau zu helfen, und da war auch schon der Chef, hockte neben ihr, streckte die Hand aus, als wollte er ihren Kopf stützen, ohne es jedoch zu tun. Wenn das Gedächtnis unsere Aufmerksamkeit verlangt, greift es oft zur Verzerrung oder Täuschung.
»Mist«, sagte J.
Wenn J. lange Zeit später über jenen Tag sprach, ließ sie an diesem Punkt der Erzählung eine Lücke. Dort in der Hängematte sei ihr, wie sie später erklären sollte, etwas bewusst geworden, aber was genau, wisse sie nicht, würde es nie wissen. »Mist«, hatte sie geflüstert, wie wenn uns ein Glas aus der Hand gleitet und am Boden zerspringt oder uns einfällt, dass wir etwas Wichtiges zu Hause vergessen haben (dann schlagen wir uns an die Stirn oder lassen die Faust aufs Lenkrad sausen). Sie habe die Hängematte verlassen, wie sie später erzählen sollte, und sich zu ihrem Zimmer aufgemacht, aber unterwegs (auf der Höhe des offenen Gangs, wo sie vor ein paar Stunden eingeschlafen war) drehte sie um und trat auf den Lehmweg des Gartens, so nannten ihn zumindest die Galáns, stolperte über eine Mango und schlüpfte zwischen den Zaunlatten hindurch, um ans Ufer zu gelangen, an die Stelle, wo das Ufer begann, und sie sah, dass Don Gilberto noch immer dort saß, am ruhigen Fluss.
Wie ein Gespenst glitt J. zu Don Gilberto und versuchte sich dann durch Schlurfen bemerkbar zu machen. Sie setzte sich nicht neben ihn, sondern ihm fast gegenüber, damit sie sein Gesicht besser sehen konnte. Dann sagte sie:
»Don Gilberto, es tut mir so leid. Ich habe es eben erfahren.«
»Was ist passiert?«
J. hielt Schweigen für angebracht. Don Gilberto ergriff wieder das Wort.
»Was ist passiert? Ist Yolanda gestorben?«
»Es tut mir so leid«, sagte J.
Dann sah sie es. J. sah, was in Don Gilbertos Gesicht vor sich ging, ein Aufeinanderprallen von Emotionen, ein Zucken der Muskeln, und später sollte sie über das Wunder des menschlichen Gesichts nachdenken, das mit so wenigen Instrumenten mehr Emotionen vermitteln kann, als wir zu benennen gelernt haben. Was J. sah, was sich in den geschlitzten Augen, im Bogen der Augenbrauen bemerkbar machte, war Erleichterung. Mag sein, da war zuerst Trauer oder Bestürzung, ein flüchtiger Kummer, aber Kummer, Bestürzung oder Trauer gaben der Erleichterung nach, und der Eindruck war so überwältigend, dass J., die auf der Suche nach dieser Offenbarung ans Ufer zurückgekehrt war, den Blick abwenden musste, wie beschämt von dem Schauspiel.
Kurz vor Tagesanbruch wurde sie von etwas geweckt. Ein Hahn krähte in der Ferne, wie von einer anderen Farm. J. tastete auf dem Nachttisch nach der Armbanduhr: Sie hatte nicht mehr als drei Stunden geschlafen. Dann spürte sie einen Luftzug und merkte, die Augen noch halb geschlossen, dass die Zimmertür offen stand. Aber sie erinnerte sich genau (oder glaubte sich zu erinnern), sie geschlossen zu haben. Ein Hund hatte sie wohl aufgedrückt, dachte sie, oder der Wind. Sie machte sie zu, leise, um niemanden zu wecken, ging wieder zum Bett, und da sah sie den Mann.
Don Gilberto saß auf dem anderen Bett, die Hände auf die Knie gestützt. J. hörte zuerst seinen Atem, dann seine Worte: »Habe ich Sie erschreckt, Señorita?«
J. überprüfte rasch ihre Kleidung – ein Pyjama mit Hose und Hemd – und sah zum Fenster, dann zur Tür.
»Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe«, sagte Don Gilberto. In seiner Stimme dehnten sich die Konsonanten der Trunkenheit. »Ich wollte Ihnen was erzählen.«
»Geht es nicht später?«, fing J. an. »Ich bin müde und …«
»Nein, es muss jetzt sein«, unterbrach sie der Mann. »Ich habe nämlich eine Neuigkeit.«
J. stand noch immer einen Schritt von der Tür entfernt. Sie versuchte, entschieden zu klingen.
»Was denn?«
»Dass Yolanda nicht gestorben ist«, sagte Don Gilberto. »Nicht zu fassen, oder?«
»Ah. Tatsächlich. Ich hatte das gehört.«
»Das hatten Sie gehört? Wie seltsam, oder? Von wem?«
J. antwortete nicht. Der ferne Hahn krähte wieder. Don Gilbertos Gesicht war nicht deutlich auszumachen. J. kam, eine absurde Assoziation, ein Bild von Francis Bacon in den Sinn. Don Gilbertos hängende Schultern hoben sich von der weißen Wand ab und gaben ihm einen melancholischen Anstrich, als hätte ihn die Lüge traurig gemacht, aber in seiner Stimme (dem Alkohol in seiner Stimme) steckte der Wille, zu drohen, zu erschrecken.
»Wenn Sie wüssten, wie sehr mir das missfällt«, sagte er.
»Hören Sie, Don Gilberto, ich weiß nicht, was man Ihnen gesagt hat, aber ich …«
»Getäuscht zu werden. Wie sehr mir das missfällt, getäuscht zu werden. Das war sehr hässlich, Kleines.«
Kleines, dachte oder registrierte J.
»Ich hatte das gehört«, sagte sie.
»Nein, das glaube ich nicht. Nichts haben Sie gehört. So was Dummes, was? Eine dumme Sache. Eine beschissene, dumme Sache haben wir da.«
»Es war ein Irrtum«, sagte J.
»Ein Scheiß war das«, sagte der Mann. »So was macht man nicht, Süße. Muss ich Ihnen das beibringen? Beibringen, dass man so was nicht macht?«
J. war sich bewusst, dass sie zwischen dem Mann und der Tür stand. Sie ging zum Fenster hinüber, damit man sie sehen konnte, denn bald würden die ersten Arbeiter kommen, und so gab sie auch den Weg frei für den Mann: als öffnete man eine Tür und machte draußen Licht, um eine Motte aus dem Zimmer zu locken.
Der Mann sagte:
»Ihr wollt gar nichts lernen, was?« Und dann: »Sie fahren heute, nicht wahr, Kleines?« Und dann: »Ja, Sie fahren heute. Damit ich Sie nicht mehr sehe, nicht mehr sehen muss.«
Langsam stand er auf, als trüge er schwer an seinen Schultern, und trat hinaus in die Morgendämmerung.
III
»Waren Sie schon einmal in Las Palmas?«