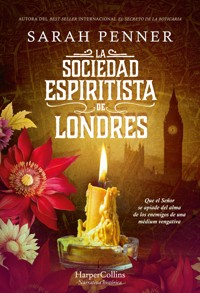10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman der Autorin von »Die versteckte Apotheke« – Zwei geheimnisvolle Frauen, die die Grenzen ihrer Zeit sprengen und den wohl außergewöhnlichsten Mordfall der Welt lösen 1873: In einem verlassenen Château außerhalb von Paris hält die Spiritualistin und Wahrsagerin Vaudeline D’Allaire düstere Séancen ab. Sie ist weithin bekannt für ihr Talent und ihre Dienste werden gleichermaßen von Verwitweten wie von Gesetzeshütern in Anspruch genommen – um Kontakt zu Mordopfern aufzunehmen und deren Mörder zu finden. Die junge Lenna Wickes ist nach Paris gekommen, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären, wobei sie erst ihre Vorurteile gegenüber dem Okkulten überwinden muss. Als dann Vaudeline für eine Mordermittlung nach England gerufen wird, begleitet Lenna sie als Gehilfin. Doch während die zwei Frauen versuchen, mit der exklusiven und ausschließlich aus Männern bestehenden Geheimgesellschaft »Séance Society« zusammenzuarbeiten, kommt ihnen langsam der Verdacht, dass sie nicht nur ein Verbrechen aufdecken sollen, sondern selbst in eines verwickelt wurden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelThe London Séance Society bei Park Row Books, an Imprint of Harlequin Books, S.A.
© 2023 by Sarah Penner
Deutsche Erstausgabe
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von zero Werbeagentur, München nach einem Entwurf von Elita Sidiropoulou
Coverabbildung von Shutterstock | iStock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749906017
www.harpercollins.de
Widmung
FÜR MEINE GROSSE SCHWESTER KELLIE
(UND FÜR DICH, MOM. SCHLIESSLICH WARST DU DIE ERSTE, DIE GESAGT HAT:»LASS UNS ZU EINER SÉANCE GEHEN …«)
Zitat
»GRÄBER, GÄHNET UND OFFENBART EURE TOTEN …«
SHAKESPEARE
Die sieben Phasen einer Séance
DIE SIEBEN PHASEN EINER SÉANCE
I
ALTE TEUFELSINKANTATION
Das Medium rezitiert eine Beschwörung, um die Teilnehmer der Séance vor üblen Geistern und Dämonen zu schützen.
II
INVOKATION
Das Medium fordert alle Geister der Umgebung auf, sich im Raum der Séance einzufinden.
III
ISOLATION
Das Medium reinigt den Raum von allen Geistern außer dem gewünschten, also dem der verstorbenen Person, mit der die Séance-Teilnehmer in Kontakt treten wollen.
IV
INVITATION
Das Medium öffnet sich dem Geist der verstorbenen Person.
V
TRANCE
Das Medium wird vom Geist der verstorbenen Person besetzt.
VI
DÉNOUEMENT
Das Medium bringt die gewünschte Information ans Licht.
VII
TERMINATION
Das Medium verbannt den Geist der verstorbenen Person aus dem Raum, beendet den Zustand der Trance und schließt die Séance ab.
1: Lenna
1
LENNA
Paris, Donnerstag,13. Februar1873
Das verlassene Château in den bewaldeten Außenbezirken von Paris würde heute zum Schauplatz einer düsteren Séance werden.
Die Uhr zeigte zweiunddreißig Minuten nach Mitternacht. Lenna Wickes, spiritistische Gehilfin, saß an einem ovalen Tisch, der von einem schwarzen Leinentuch bedeckt war. Ihr gegenüber waren die anderen Teilnehmer dieser Séance platziert, ein Gentleman und seine Frau. Den beiden war deutlich anzumerken, wie unwohl sie sich fühlten. Der Raum, in dem sie sich befanden, war einst der Salon des nun halb verfallenen Châteaus gewesen, welches seit hundert Jahren leer stand. Hinter Lenna löste sich die blutrote Tapete von den Wänden, unter der Schimmelflecken blühten.
Wenn heute Nacht alles wie gewünscht lief, würde ihnen der gesuchte Geist – der einer jungen Frau, die genau an diesem Ort ermordet worden war – bald erscheinen.
In der Zimmerdecke über ihnen trippelte etwas. Vermutlich Mäuse. Lenna hatte beim Hereinkommen ihre Köttel gesehen, kleine schwarze Krümel entlang der Fußbodenleisten. Doch dann verwandelte sich das Trippeln in ein Kratzgeräusch … Und war da nicht ein dumpfes Poltern? Lenna unterdrückte ein Frösteln und dachte bei sich, wenn es Geister tatsächlich geben sollte, dann wäre dieses halb verfallene Château sicher der Ort, an dem sie zu finden waren.
Sie warf einen raschen Blick durchs Fenster hinaus in die Dunkelheit. Dicke, nasse Schneeflocken fielen vom Himmel – eine Seltenheit in Paris. Im Licht der wenigen Laternen konnte sie das metallene Einfahrtstor erkennen, von toten Efeuranken umschlungen, in deren Umarmung es erzitterte. Dahinter erhob sich der dunkle, undurchdringliche Wald mit einer dünnen Schneeschicht auf den immergrünen Nadeln.
Die Teilnehmer der Séance hatten sich um Mitternacht hier versammelt. Die Eltern des Opfers waren zuerst eingetroffen. Ihnen folgten kurz darauf Lenna und ihre Lehrmeisterin, das bekannte Medium, das die heutige Sitzung leiten würde: Vaudeline D’Allaire.
Alle waren schwarz gekleidet, und die Energie im Raum war weder warm noch einladend. Die Eltern rutschten nervös auf ihren Stühlen hin und her. Aus Versehen stieß der Vater dabei einen Kerzenständer aus Messing um und entschuldigte sich. Lenna konnte es ihm nicht verübeln. Sie waren alle angespannt, und Lenna selbst hatte bereits ein Dutzend Mal ihre feuchten Handflächen am Kleid abgewischt.
Keiner von ihnen war erpicht darauf, diese quälende Stunde unter Vaudelines Anleitung zu verbringen. Der Preis für eine Séance-Teilnahme war erschreckend hoch, und da war die Vorauszahlung in Francs noch gar nicht mitgerechnet.
Bei dem Geist, den sie heute Nacht beschwören wollten, handelte es sich um keinen gewöhnlichen, doch das waren die Geister nie, die Vaudeline anrief. Bei ihr ging es nicht um alte Großmütter in weißen Nachtgewändern, die ein langes erfülltes Leben hinter sich hatten und durch die Flure streiften. Es handelte sich auch nicht um tapfere Soldaten, die gewusst hatten, worauf sie sich einließen und im Krieg gefallen waren. Nein, diese Geister waren Opfer von Gewalt geworden und zu früh gestorben. Sie waren ermordet worden, jeder Einzelne von ihnen. Und noch schlimmer: Ihre Mörder waren unerkannt davongekommen.
An dieser Stelle kam Vaudeline ins Spiel, denn genau aus diesem Grund kamen die Leute zu ihr. Menschen wie das Paar, das ihr nun zitternd am Tisch gegenübersaß. Menschen wie Lenna.
Die dreißigjährige Vaudeline war auf der ganzen Welt dafür bekannt, die Geister von Mordopfern heraufzubeschwören, um die Identität ihrer Mörder herauszufinden. Als angesehene Spiritualistin hatte sie einige der verzwicktesten Gewaltverbrechen in Europa aufgeklärt. Ihr Name war Dutzende Male in den Schlagzeilen aufgetaucht, vor allem nachdem sie London vergangenes Jahr von einem Tag auf den anderen verlassen hatte. Die genaueren Umstände waren nach wie vor unklar. Doch selbst das hatte ihre loyale Anhängerschaft nicht abgeschreckt. Vaudeline lebte nun in Paris, ihrer Geburtsstadt.
Das verlassene Château war ein ungewöhnlicher Ort für eine Séance. Andererseits war an Vaudelines Methoden vieles ungewöhnlich. Sie behauptete, Geister könnten nur an jenem Ort heraufbeschworen werden, wo sie gestorben waren.
Zwei Wochen zuvor, am 1. Februar, hatte Lenna den Ärmelkanal überquert, um ihr Studium bei Vaudeline aufzunehmen. Lenna wusste, dass sie nicht die ergebenste Schülerin war. Zu oft kamen ihr Zweifel, an der Notwendigkeit der Alten Teufelsinkantation, des palo santo oder der Schüssel mit Drosseleierschalen. Es war nicht so, dass sie nicht an diese Dinge glaubte, sie konnte sich einfach nur nicht sicher sein. Nichts von alledem ließ sich beweisen. Nichts davon konnte gewogen oder analysiert oder in den Händen hin und her gedreht werden wie die Steine und Präparate, die sie zu Hause hatte. Während andere Schülerinnen bereitwillig selbst die unglaublichsten Theorien des Okkulten akzeptieren mochten, ertappte Lenna sich dabei, wie sie ständig nach dem Wie fragte. Wie kannst du das mit Sicherheit wissen? Und obwohl sie ein paar Jahre zuvor bereits einer Séance beigewohnt hatte, war aus dieser Erfahrung keine Überzeugung erwachsen. Auf jeden Fall waren keine Geister aufgetaucht.
Es war zum Verrücktwerden, diese Sache mit der Wahrheit und der Illusion.
In den dreiundzwanzig Jahren ihres Lebens hatte Lenna noch nie eine Erscheinung gesehen. Einige Menschen behaupteten, einen kühlen Geisterhauch zu spüren, wenn sie alte Anwesen oder Friedhöfe überquerten, sie erzählten von flackernden Kerzen oder Schatten in menschlicher Gestalt an der Wand. Lenna nickte dann, denn sie wollte es so gerne glauben. Doch konnte dies alles nicht auch durch etwas … Vernünftigeres erklärt werden? Überall gab es Täuschungen des Lichts, Prismen und Spiegelungen, die sich ohne Schwierigkeiten wissenschaftlich herleiten ließen.
Hätte man Lenna ein paar Monate zuvor angeboten, nach Paris zu reisen, um an einer Séance teilzunehmen, hätte sie vermutlich gelacht. Ein Studium der Kunst der Séance? Nichts als Zeitverschwendung, wo es doch so viele Steinproben entlang der Themse zu sammeln gab. Doch dann kam der Abend vor Allerheiligen – die Nacht, in der Lenna ihre geliebte kleine Schwester Evie im Garten des bescheidenen Reisehotels ihrer Eltern, dem Hickway House in der Euston Road, fand. Erstochen. Es hatte eindeutig einen Kampf gegeben: Evies Haare waren zerzaust, und sie wies entsprechende Spuren – bleiche Stellen und blaue Flecken – an verschiedenen Körperteilen auf. Ihre Umhängetasche war ohne Inhalt neben ihren Leichnam geworfen worden.
In den Tagen danach hatte die Polizei Evies Tod so viel Beachtung geschenkt wie dem Tod jeder Frau aus der Mittelschicht, was hieß, so gut wie keine. Drei Monate vergingen, und es gab immer noch keine einzige Antwort. Lenna war verzweifelt – und Verzweiflung war stärker als Zweifel. Das wusste sie nun. Sie hatte Evie vergöttert, mehr als alles andere auf dieser Welt. Magie, Hexerei, Poltergeister – sie würde sich allem verschreiben, wenn es ihr nur die Möglichkeit gab, mit ihrer geliebten kleinen Schwester Kontakt aufzunehmen.
Obwohl Lenna sich also noch nicht sicher war, was die Existenz von Geistern anging, betrachtete sie ihre gesammelten Fossilien doch als Beweis, dass auch nach dem Tod etwas vom Leben bleiben konnte. Evie hatte diese These als Erste aufgestellt, und nun sehnte Lenna sich mehr denn je danach zu erfahren, wie viel Wahrheit darin steckte.
Wenn jemand eine Möglichkeit fand, die Grenze zwischen Leben und Tod zu durchbrechen, dann Vaudeline. Evie war selbst Anhängerin und Schülerin von Vaudeline gewesen, ein angehendes Medium mit einem eisernen Glauben ans Okkulte. Lenna musste einfach mit Evie kommunizieren, um die Wahrheit über das herauszufinden, was geschehen war. Die Polizei war vielleicht nicht gewillt, für Gerechtigkeit zu sorgen, aber Lenna war es umso mehr. Darum hatte sie beschlossen, ihre Zweifel beiseitezuschieben und diese seltsame Kunst der Séance zu erlernen.
Sie konnte nicht einmal richtig trauern, so sehr war sie gedanklich mit der Aufklärung des Verbrechens beschäftigt, das an ihrer Schwester begangen worden war. Lenna wollte nicht trauern, noch nicht. Zuerst wollte sie Rache.
Da sie wusste, dass Vaudeline nicht nach London reisen würde – seit ihrer plötzlichen Abreise vor einem Jahr war sie nicht mehr nach England zurückgekehrt –, hatte Lenna sich auf den Weg nach Paris gemacht. Sie war fest entschlossen, Evies Tod aufzuklären, auf die eine oder andere Art. Selbst wenn das bedeutete, sich einen Monat lang von einer Fremden unterweisen zu lassen – wobei sie bald feststellte, dass sie diese Fremde gern mochte –, und selbst wenn es bedeutete, die dunklen Feinheiten einer Kunst zu erlernen, an die sie nicht unbedingt glaubte.
Außerdem würde sich das heute Nacht womöglich ändern.
Vielleicht würde sie heute Nacht ja ihren ersten Geist sehen.
Lenna klemmte die Hände zwischen die Oberschenkel. Niemand sollte ihr Zittern bemerken. Sie wollte wie eine erfahrene Assistentin wirken, eine versierte Gehilfin. Den Eltern zuliebe musste sie nüchterne Klarheit demonstrieren, denn die beiden hatten sichtbar Angst davor, was heute Nacht offenbart werden könnte.
Sie war froh, das Ehepaar bereits einige Tage zuvor an einem weit weniger unheilvollen Ort kennengelernt zu haben. Zu viert hatten sie sich im Salon von Vaudelines weitläufiger Wohnung im Pariser Zentrum getroffen, um die Fragen zur bevorstehenden Séance durchzugehen.
Und die Risiken.
Lenna kannte die Risiken einer Séance bereits – Vaudeline und sie hatten bei Lennas Vorstellung als potenzielle Schülerin darüber gesprochen –, doch bei der Zusammenkunft im Salon schien die Tragweite der Gefahren weitaus größer.
»Sie werden bei mir keine Ouijabretter oder Planchetten finden«, hatte Vaudeline den Eltern erklärt. »Das sind Kinderspielzeuge auf Dachböden. Meine Séancen wählen einen anderen, gefährlicheren Weg.«
Sie wurde von einer Dienstmagd unterbrochen, die Tee für die vier Anwesenden brachte. Diese stellte das Tablett auf das Tischchen neben ein Diagramm, das Lenna und Vaudeline zuvor studiert hatten und in dem es um die richtige Aufstellung einer Séance-Tafel mit ihren vielen outils ging: die schwarzen Bienenwachskerzen, die Opale und Amethyste, die Schlangenhäute und Salzschalen.
»Ein Trancezustand«, wagte die Mutter zu sagen, sobald das Dienstmädchen verschwunden war.
»Genau.«
Da Lenna zu diesem Zeitpunkt schon einige Zeit von Vaudeline unterrichtet worden war, benötigte sie keine weitere Erklärung. Sie wusste, dass sich während einer Kontaktaufnahme mit dem Jenseits ein Trancezustand, eine Art Entrückung einstellte, wenn ein Geist buchstäblich den Leib des Mediums erfüllte und wieder in einem lebendigen, atmenden Körper weilte. Vaudeline beschrieb es als eine Art doppeltes Sein, das dem Medium erlaubte, die Erinnerungen und Gedanken der Verstorbenen zu erkennen und parallel dazu seine eigenen zu behalten.
Die Mutter trank einen Schluck Tee, dann zog sie etwas aus ihrer Tasche: einen Zeitungsausschnitt. Ihre Hände zitterten immer noch wie bei ihrer Ankunft, als sie Vaudeline lange angestarrt hatte, ehe sie ein Wort über die Lippen brachte.
Lennas Reaktion war bei ihrer ersten Begegnung mit Vaudeline ganz ähnlich gewesen, wobei es bei ihr nicht daran gelegen hatte, dass sie von der Berühmtheit des Mediums eingeschüchtert war. Vielmehr hatte es mit Vaudelines wolkengrauen Augen und der Art zu tun, wie sie Lennas Blick einige Sekunden länger festhielt, als es die Konvention gebot. Dieser kurze Moment hatte einiges offenbart: Vaudeline war selbstbewusst. Und genau wie Evie hielt sie nicht viel von Regeln.
Beides waren Wesenszüge, die Lenna ziemlich faszinierend fand.
Die Mutter reichte Vaudeline den Artikel. Lenna verstand die französische Überschrift nicht, doch das Datum legte nahe, dass der Text einige Jahre alt war. »Da steht, dass bei einer Ihrer Séancen ein Mann gestorben ist«, erklärte die Mutter. »Stimmt das?«
Vaudeline nickte. »Geister sind unberechenbar«, sagte sie. »Vor allem diejenigen, die wir suchen – die Opfer. Das Risiko ist zu Beginn einer Sitzung am größten, nachdem ich die Invokation rezitiert habe, die alle nahen Geister herbeiruft. Das ist, als würde man einen Wasserhahn öffnen. Um den Geist eines Mordopfers erscheinen zu lassen und ein Verbrechen aufzuklären, habe ich auch mit den Toten in der Peripherie zu tun. Ich versuche, diese Phase zügig zu durchschreiten, doch ich kann die Geister nicht vollkommen kontrollieren.« Sie deutete mit dem Kopf auf den Artikel.
»Hat die Polizei je herausgefunden, wie der Mann gestorben ist?«, wollte die Mutter wissen.
»Herzversagen, offiziell. Doch wir im Raum haben gesehen, wie es passiert ist, den Schatten einer Hand über seinem Mund.« Vaudeline reichte den Artikel zurück. »Während eines ganzen Jahrzehnts voller Séancen sind unter meinen Augen erst drei Menschen gestorben. Es kommt also sehr selten vor. Häufiger ist das plötzliche Auftauchen von Wunden, die mit den Traumata zu tun haben, welche das Opfer vor seinem Tod erlitten hat. Schnittwunden, verstauchte Gelenke, Prellungen.«
Der Vater senkte den Kopf, und Lenna verspürte das plötzliche Bedürfnis, den Raum zu verlassen, sich vielleicht sogar übergeben zu müssen. Die Tochter der beiden war erdrosselt worden. Was, wenn während der Séance plötzlich Schürfmale eines Seils am Hals einer der Teilnehmer auftauchten? Allein der Gedanke war unerträglich.
»Es gibt auch harmlosere Risiken«, fuhr Vaudeline fort. Vielleicht spürte sie, dass es ratsam war, zügig fortzufahren. »Dinge, auf die sich jemand … einlassen könnte, zum Beispiel. Bei einer Séance vor ein paar Monaten fingen zwei der Teilnehmer unter dem Einfluss von Geistern an, auf dem Tisch Unzucht zu treiben.«
Lenna gab einen erschrockenen Laut von sich. Vaudeline hatte in den vergangenen zwei Wochen so viele Geschichten mit ihr geteilt, aber diese hatte sie noch nicht gehört.
»Waren die beiden zuvor schon Liebende gewesen?«, fragte sie in der Annahme, die Eltern seien sicher ebenso neugierig wie sie.
Vaudeline schüttelte den Kopf. »Sie waren sich noch nie in ihrem Leben begegnet.« Sie sah Lenna an, deren Blick wiederum auf die winzige Sommersprosse auf Vaudelines Nasenspitze fiel. So klein, dass man sie für einen Schatten halten könnte.
»Trotz aller Risiken«, wandte sich Vaudeline nun wieder an die Eltern, »sind Trancezustände die schnellste und effektivste Art, an die Informationen zu gelangen, die nötig sind, um einen Fall zu lösen. Es geht hier nicht um Unterhaltungen oder Friedensstiftung. Wenn es das ist, was Sie suchen, dann kann ich Sie an eine große Anzahl angesehener Geisterjäger hier in der Stadt verweisen.«
Der Vater räusperte sich. »Ich mache mir Sorgen …«, begann er und nahm zärtlich die Hand seiner Gattin. »Nun, ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen meiner Frau, wenn wir die Séance in dem Château abhalten, wo unsere Tochter zu Tode gekommen ist.«
Wo unsere Tochter zu Tode gekommen ist, hatte er gesagt. Leichter auszusprechen als die Worte wo unsere Tochter umgebracht wurde. Das zuzugeben, es über die Lippen zu bringen, war schwer. Lenna wusste das besser als jeder andere.
Vaudeline sah die Frau an. »Sie müssen einen Weg finden, Ihre Fassung zu wahren, sonst schlage ich vor, dass Sie nicht teilnehmen.« Dann lehnte sie sich zurück, faltete die Hände und unterband damit sämtliche weiteren Diskussionen. Dies war schließlich eine von Vaudelines wichtigsten Überzeugungen: Ein Geist konnte nur in der Nähe der Stätte seines Todes herbeigerufen werden. Könnte sie eine Séance aus der Ferne abhalten, wäre Lenna nicht hier in Paris. Dann hätte sie Vaudeline geschrieben und sie um eine Séance für Evie in Frankreich gebeten. Die Ergebnisse hätte sie Lenna einfach mitteilen können.
Doch wie Vaudeline öffentlich verkündet hatte, würde sie in absehbarer Zeit nicht nach London zurückkehren. Lenna würde also selbst die Kunst der Séance lernen müssen, um dann an den Ort von Evies Tod zurückzukehren in der Hoffnung, den Geist ihrer Schwester allein heraufzubeschwören.
»Viele Medien halten Séancen bei sich zu Hause ab«, wandte die Mutter nun ein. »Fernab des Ortes, an dem die Liebsten der Teilnehmer gestorben sind.«
»Und viele Medien sind Scharlatane.« Vaudeline ließ den Tee in ihrer Tasse kreisen und fuhr unbeirrt fort: »Ich verstehe, dass es schwierig ist, die Todesstätte Ihrer Tochter aufzusuchen, aber wir werden nicht dort sein, um unseren Gefühlen nachzuhängen. Wir sind dort, um ein Verbrechen aufzuklären.«
Das mochte kaltherzig wirken, doch Vaudeline hatte es schon unzählige Male gesagt. Sie durfte sich nicht auf die Trauer der Angehörigen einlassen. Trauer war Schwäche, und bei einer Séance war nichts so gefährlich wie Schwäche jedweder Art. Geister – die gefährlichen, frei umherschweifenden, die gerne Teilnehmer verfolgten und ärgerten, ob sie nun gerufen worden waren oder nicht – mochten Schwäche.
»Es werden nur Sie beide anwesend sein, richtig?«, fragte Vaudeline.
Der Vater bejahte mit einem knappen Nicken.
»War Ihre Tochter verheiratet, oder hatte sie einen Beau? Falls ja, wäre es hilfreich, ihm oder ihr eine Einladung zukommen zu lassen. Je mehr wir von der verborgenen Energie Ihrer Tochter im Raum versammeln können, umso besser.«
»Nein«, antwortete der Vater. »Nicht verheiratet und kein Beau.«
»Soweit wir wissen, zumindest«, fügte seine Frau mit einem kleinen Lächeln hinzu. »Unsere Tochter war ziemlich … unabhängig.«
Lenna musste lächeln, während sie über die vorsichtige Wortwahl der Mutter nachdachte. Vielleicht war ihre Tochter ein bisschen wie Evie gewesen. Unangepasst. Eigenwillig.
Die Mutter hüstelte. »Darf ich fragen«, erkundigte sie sich mit Blick auf Lenna, »welche Rolle Sie in der Séance spielen werden?«
Lenna nickte. »Ich bin Vaudelines Gehilfin«, erklärte sie. »Ich lerne gerade die Beschwörungen, aber ich werde Notizen zu den sieben Phasen des Séance-Ablaufs machen.«
»Sie ist nicht Teil einer meiner üblichen Klassen«, fügte Vaudeline hinzu, »die für gewöhnlich aus drei bis fünf Schülerinnen bestehen. Aktuell habe ich jedoch keine Ausbildungsgruppe. Deshalb habe ich mich aufgrund der Umstände entschieden, Lenna in ein individuelles Programm aufzunehmen, als sie mich vor zwei Wochen aufsuchte.«
Diese Fakten waren alle richtig, wenn auch ausgesprochen arm an Details. Als Lenna in Paris ankam und Vaudeline erzählte, dass Evie – ihre frühere Schülerin – in London ermordet worden war, zeigte sich Vaudeline von dieser Neuigkeit tief betroffen. Eilig bat sie Lenna herein, quartierte sie im Gästezimmer mit den Stockbetten ein, das normalerweise für Schülerinnen reserviert war, und begann sofort ein beschleunigtes Ausbildungsprogramm. Üblicherweise studierten die Elevinnen acht Wochen lang bei Vaudeline, doch sie hatte das Ziel, Lennas Ausbildung in der Hälfte der Zeit abzuschließen.
»Mir war nicht bewusst, dass Sie auch Medien ausbilden«, sagte die Mutter zu Vaudeline, »und nicht nur selbst Séancen abhalten.«
»Ja, so ist es. Ich bin seit zehn Jahren Medium und seit fünf Jahren Lehrmeisterin.« Vaudeline beugte sich vor und fuhr in ernstem Ton fort: »Was die Séance betrifft, so gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um die Risiken zu minimieren, die ich Ihnen gerade dargelegt habe. Am allerwichtigsten ist, im Vorfeld keinen Wein oder sonstige alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Nicht einen Tropfen. Und versuchen Sie nach Kräften, Tränen zu unterdrücken. Halten Sie sich nicht an Erinnerungen fest. Erinnerungen sind Schwäche. Und in einem Séance-Raum bedeutet Schwäche Ihren Untergang.«
Die Gefahr, die von Schwäche ausging, war eine der ersten Lektionen, die Vaudeline Lenna zu Beginn ihres Unterrichts beigebracht hatte. Auf der Welt wimmelte es nur so von Geistern. In jedem Schlafzimmer, auf jeder Wiese, in jedem Hafen. Über Jahrtausende hinweg, seit es Menschen gab, waren sie auch gestorben und gingen dann nicht weit fort. Deshalb, so hatte Vaudeline erklärt, kam es bei vielen Séancen vor, dass ungeladene Geister auftauchten. Die meisten von ihnen waren harmlos und lediglich neugierig. Sie sehnten sich danach, wieder einmal das Gefühl von Körperlichkeit zu spüren, oder sie wollten die Teilnehmer nur ein wenig necken. Vaudeline hatte keine Schwierigkeiten, diese freundlichen Gespenster loszuwerden.
Es waren die bösartigen Geister und zerstörungswilligen Dämonen, die eine Gefahr darstellten und bewirkten, dass während einer Séance einiges schiefgehen konnte. Sie konnten Vaudeline in Trance versetzen, ehe der eigentlich angesprochene Geist Gelegenheit dazu hatte. Oder sie konnten die Teilnehmer in Trance versetzen, ein Phänomen, das als absorptus bekannt war. Diese Wesen waren intelligent und wussten genau, auf wen sie sich stürzen mussten: die Weinenden. Die Jungen. Die Alkoholisierten. Die Lüsternen. All das waren Formen der Schwäche, eine Art Durchlässigkeit, durch die das Diabolische ins Innere eindringen konnte.
Um zu verhindern, dass solche Unholde eine Séance störten, sah sich Vaudeline vor Beginn der Sitzung die Teilnehmer genau an. Sie ließ niemanden zu, der jünger als sechzehn Jahre alt war, ebenso wenig solche, deren Atem nach Alkohol roch. Weinende Familienmitglieder wurden mitunter des Zimmers verwiesen.
Diese Wachsamkeit, gepaart mit der uralten schützenden Beschwörungsformel, die Vaudeline zu Beginn jeder Sitzung rezitierte, und den beiden Austreibungsbefehlen, die als letzte Möglichkeit zur Verfügung standen, sorgten dafür, dass ihre Séancen sicher waren.
Meistens jedenfalls.
Garantien gab es keine. Es handelte sich hierbei um eine Kunst, betonte Vaudeline immer wieder. Und Geister waren schrecklich unberechenbar.
Im Château hob Lenna nun den Blick von ihrem Notizbuch, das vor ihr auf dem Tisch lag, und studierte wieder den Gesichtsausdruck der Eltern. Die Miene des Vaters war entschlossen, seine Hände lagen flach auf dem Tisch, als wäre er bereit für den Kampf. Die Mutter hingegen wirkte grau und abwesend. Ein Rinnsal aus inzwischen getrockneten Tränen hatte sich eine Spur durch das Rouge auf ihren Wangen gebahnt.
Lenna war stolz auf sie. Stolz auf beide. Doch ihre Stärke könnte wiederum Lenna in eine schwierigere Lage bringen. Sie schauderte. Was, wenn ein Geist sie als schwächste Person im Raum ausmachte oder wenn etwas anderes schiefging? Ihr fielen ein paar von Vaudelines Geschichten ein, von Teilnehmern, die einander in Trance mit Waffen angegriffen hatten, von Kerzenleuchtern, die wie von Geisterhand durch den Raum flogen. Lenna sah sich um und stellte erleichtert fest, dass keine Kerzenständer zu sehen waren.
Vaudeline schloss einen ledernen Koffer auf und holte einige Gegenstände heraus. Alle anderen hatten ihre Plätze eingenommen, und eine nervöse Stille senkte sich über den Raum. Was, fragte sich Lenna, würde in den nächsten Minuten wohl geschehen? Gedankenverloren kaute sie an ihren Fingernägeln herum, ein lebenslanges Laster, und beobachtete dabei aufmerksam Vaudeline, um irgendwelche Tricksereien ausschließen zu können. Doch sie entdeckte nichts dergleichen.
Vaudeline zog nun zwei Längen schwarzen Leinenstoff aus ihrem Koffer. Diesen hängte sie über den gemauerten Kamin und vor das vergitterte Fenster vorne im Raum, das zum Eingang des verfallenen Châteaus hinausging. Der untere Teil der Fensterscheibe war zerbrochen, sodass der Stoff die Zugluft abhalten würde. Doch Lenna kannte auch den anderen Grund, weshalb Vaudeline es verdeckte, denn sie hatten ihn während des Unterrichts durchgenommen. Fenster waren Portale des Lichts und ermunterten ungeladene Geister, die in der Nähe gestorben waren, hereinzukommen und sich frei zu bewegen. Offene Kamine ebenso. Ein bösartiger Geist konnte ebenso leicht durch einen Schornstein herunterfegen, wie er durch ein Fenster eindringen konnte. Daher war es am besten, das Zimmer so weit wie möglich abzuschotten. Abgeschlossen und dunkel.
Abgeschlossen fühlte es sich nun eindeutig an. Schließlich nahm Vaudeline Platz, rückte ihren Stuhl näher an Lenna heran und drehte sich ein wenig in ihre Richtung. Lenna fragte sich, ob die Bewegung wohl unabsichtlich war. Sie hoffte nicht.
Als Vaudeline das Buch mit den Beschwörungen aufschlug, warfen ihre langen Wimpern Schatten auf ihre Wangen. Eine lose Haarsträhne hing ihr ins Gesicht, doch sie schenkte ihr keine Beachtung, und während sie die Seiten umblätterte, glitt der Stoff ihres Seidenkleides über ihre blassen Arme.
Lenna ertappte den Vater dabei, wie er Vaudeline anstarrte. Seine Pupillen waren groß und schwarz, seine Lippen leicht geöffnet. Lenna erkannte, was in diesem Blick lag – Begierde –, und sie konnte es ihm nicht verübeln. Andere hätten den Mann abartig finden können, sogar würdelos, weil er die Fähigkeit besaß, Verlangen zu empfinden, obwohl er immer noch von Verlust und Trauer überwältigt war. Nicht jedoch Lenna. Sie kannte diese Verstrickung gut.
Ja, sie mochten ein hässliches Paar abgeben, Trauer und Verlangen. Doch Lenna konnte dem Mann auf der anderen Seite des Tisches keinen Vorwurf machen, denn auch sie litt in diesen Tagen unter beiden Qualen.
Es wurde ganz still im Raum. Weder flackerte die Kerze, noch raschelte die Fensterverhüllung. Die Séance hatte noch nicht begonnen, und trotzdem war eindeutig spürbar: Vaudeline hatte die absolute Herrschaft über den Raum übernommen. Alles, was sie verlangte, würden die Teilnehmer tun.
Lenna war froh darüber. Vaudelines erfahrene Gelassenheit beruhigte sie, bildete sie doch einen solchen Gegensatz zu der unheimlichen Stimmung ringsum. Ihr fiel wieder das Versprechen ihrer Lehrmeisterin auf dem Weg zum Château ein: Dir wird nichts Böses geschehen, hatte Vaudeline ihr leise versichert. Du wärst die Erste, die ich beschützen würde, wenn nötig. Ma promesse à toi.
Diese Worte, dieses Versprechen, wiederholte Lenna in Gedanken. Ihre ganz eigene Beschwörungsformel.
Nun zog Vaudeline eine kleine Uhr aus ihrem Mantel. Sie betrachtete das Ziffernblatt, ehe sie das Chronometer wieder in eine Innentasche schob. »Wir beginnen in vierzig Sekunden«, verkündete sie.
Auf der anderen Seite des Tisches schniefte die Mutter des Opfers, der Vater räusperte sich und setzte sich aufrechter hin. Lenna vermochte die Emotionen, welche die beiden empfanden, nicht genau zu ergründen, die Nuancen der Versuchung und des Schreckens dessen, was sie gleich erleben würden. Wie fühlte es sich wohl an, eine Begegnung mit der eigenen toten Tochter vor sich zu haben?
Vermutlich ähnlich wie eine Begegnung mit der toten Schwester.
Der Gedanke wühlte Lenna auf. Heute Nacht, und eigentlich bei ihren ganzen Studien, ging es nicht darum, die Kunst der Séance zu lernen. Dieses ganze Unterfangen hatte letztlich nur den Sinn, mit Evie zu kommunizieren und die Wahrheit über ihren Mörder herauszufinden.
Lenna lächelte die Mutter ermutigend an. Kerzenlicht funkelte in ihren Augen, offensichtlich versuchte sie, ihre Tränen zu unterdrücken. Lenna wünschte, sie könnte ihr einige tröstliche Worte zuflüstern, doch dazu war es längst zu spät.
Die Teilnehmer hielten den Blick gesenkt, während die restlichen Sekunden langsam vorbeitickten. Lenna konnte die Uhr in Vaudelines Mantel hören, die Bewegung des winzigen Mechanismus in seiner Metallhülle. Sie wusste, Vaudeline zählte die Sekunden und würde dann mit ihrer ersten Beschwörung beginnen, der Alten Teufelsinkantation, der Einleitung, die aus einem eintausend Jahre alten lateinischen Text über Dämonen stammte. Lenna kannte die ersten vier Strophen bereits auswendig, aber insgesamt waren es zwölf.
Sie wartete darauf, dass Vaudeline tief Luft holen würde. Die Beschwörung musste in einem einzigen ununterbrochenen Atemzug rezitiert werden. Die Beherrschung des Atems war etwas, das Lenna noch üben musste. Wenn sie in den vergangenen Tagen die Beschwörung in ihrem Notizbuch gelesen hatte, war sie immer nur bis zur Hälfte gekommen, ehe ihr schwindelig wurde und sie nach Luft schnappen musste.
Die Kerze, die dem Kamin am nächsten stand, flackerte, und irgendwo in der Nähe – außerhalb des Raumes oder darüber? – erklang ein dumpfes, metallisches Geräusch.
Lenna erstarrte und blickte von ihrem Notizbuch auf. Das waren keine Mäuse in den Dielen gewesen, so viel war klar. Der Bleistift fiel ihr aus den Fingern. Instinktiv neigte sie sich zu Vaudeline hinüber, bereit ihre Hand zu ergreifen, falls nötig. Zum Teufel mit dem Anstand.
»Da kommt etwas«, sagte Vaudeline plötzlich. Ihr Tonfall blieb gleichmäßig und ruhig. Sie hielt den Blick gesenkt, die Augen geschlossen.
Das Poltern ertönte erneut. Lenna drehte ruckartig den Kopf zu den Eltern. Die Mutter hatte die Augen weit aufgerissen, und der Vater beugte sich mit hoffnungsvollem Blick nach vorn. Offenbar glaubten sie, dieses Geräusch bedeute, dass ihre Tochter gleich vor ihnen auftauchen würde. Vaudeline hatte die Details des siebenstufigen Ablaufs nicht mit ihnen besprochen, daher konnten sie nicht wissen, dass es noch zu früh für ein Erscheinen war, weil die Séance noch gar nicht begonnen hatte.
Lenna aber wusste es: Irgendetwas stimmte hier nicht. Die Abfolge war falsch. Vaudeline würde niemals eine Séance ohne die Uralte Teufelsinkantation beginnen, die sie alle beschützen sollte. Einen Augenblick lang wurde sie von Panik ergriffen. War genau in diesem Moment irgendein Dämon auf dem Weg in diesen Raum? Etwas, das so böse war, dass es Vaudelines Ritual durchbrechen konnte? Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus, während sie darauf wartete, dass das Medium handeln würde.
Doch Vaudeline saß immer noch reglos da. Mutig, gewissermaßen in ihrer Funktion als Gehilfin, wandte sich Lenna an sie. »Da kommt … etwas? Ein Geist?«, flüsterte sie.
Vaudeline atmete aus. Ihre Miene war verärgert. Sie schüttelte den Kopf und hob den Zeigefinger, als wollte sie sagen: Wart’s ab.
Gleichzeitig flog die Tür des Raumes auf.
EINIGE TAGE ZUVOR
AUF DER ANDEREN SEITE DES ÄRMELKANALS IN LONDON
2: Mr. Morley
2
MR. MORLEY
London, Montag,10. Februar1873
Im zweiten Stock der London Séance Society, einem Etablissement im West End, das ausschließlich Gentlemen vorbehalten war, saß ich in meinem persönlichen Arbeitszimmer über den Mahagonischreibtisch gebeugt. Darauf flackerte eine Lampe, deren orangeblaues Licht die Gegenstände beleuchtete, die vor mir lagen: einige unbeschriebene Bögen des Briefpapiers unserer Gesellschaft, ein Monokel an einer Silberkette und ein Tintenfass in Form einer Glocke.
Ich hielt einen Augenblick inne, um die geschwollenen Tränensäcke unter meinen Augen zu massieren, die wohl von Überanstrengung und Sorge stammten. Seit Monaten hatte ich nicht mehr gut geschlafen, und meine Kiefermuskulatur war ständig verkrampft.
Wir sahen uns hier in der Society mit einigen Problemen konfrontiert.
Nicht in der Abteilung für Hellseherei – nein, die war blitzsauber. Die Probleme lagen vielmehr in der Abteilung für Spiritualität, der ich als Vizepräsident vorstand, seit ich der London Séance Society vor einem Jahrzehnt beigetreten war.
Wie jeder ehrenwerte Gentleman in einer Autoritätsposition wusste ich alles, was es über meine Abteilung zu wissen gab. Ich wusste, welche Séancen wir vergangene Woche abgehalten hatten – schließlich war ich derjenige, der die Mitglieder dafür einteilte –, und ich kannte den Standort jedes Referenzhandbuches in unserer Bibliothek, jeden Band über das Okkulte. Ich kannte die Finanzen der Abteilung, die Namen der Ehegattinnen unserer Mitglieder und wusste, was wir bei der Abteilungsversammlung in drei Tagen zum Frühstück servieren würden.
Sei die Information auch noch so persönlich oder trivial, ich verfügte darüber.
Was also diesen Schlamassel im Department of Spiritualism anging, so fiel es mir, und mir ganz allein, zu, für Ordnung zu sorgen.
Zu meiner Rechten stand ein leeres Cognacglas. Meine Lippen brannten noch vom letzten unbefriedigenden Schluck. Ich schenkte mir nach und betrachtete dabei den kleinen Bilderrahmen an der Wand vor mir. Darin prangte das Leitbild der Society. Gegründet im Jahr1860, ist es das Anliegen der London Séance Society, der Stadt London die Dienste des Hellsehens und spiritueller Medien zur Verfügung zu stellen, um damit Trauernden Trost zu spenden und die wachsende Neugier der Bevölkerung bezüglich eines Lebens nach dem Tod zu befriedigen.
Ich verschränkte die Arme und dachte darüber nach. Trost zu spenden und Neugier zu befriedigen war in der Tat, was wir am besten konnten.
Die Society hatte mehr als zweihundert Mitglieder. Ungefähr zwei Drittel davon waren Mitglied im Department of Clairvoyance, angeführt von ihrem Vizepräsidenten, meinem Pendant, Mr. T. Shaw. Shaws Abteilung hielt jeden Monat Hunderte von hellseherischen Sitzungen in ganz London ab. Sein Ruf war tadellos und die Einkünfte konstant.
Dafür war unter anderem Shaws Kontrollprozess verantwortlich. Vor der Aufnahme in die Society mussten zukünftige Mitglieder seiner Abteilung ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, in Hellseherei, Numerologie, Wahrsagung oder welchem Talent auch immer.
In meinem Bereich, dem Department of Spiritualism, wurden die Dinge etwas anders gehandhabt. Erstens hatten wir weniger laufendes Geschäft. Wir führten im Monat nur ungefähr ein Dutzend Séancen durch (und trotzdem waren die Einkünfte pro Buchung höher – viel höher – als alles, was Shaws Abteilung mit Handlesen am Straßenrand einbrachte). Des Weiteren wurden die Mitglieder unserer Abteilung nur auf Einladung hin aufgenommen, und mein Prüfungsverfahren war weniger … präzise. Im Gegensatz zu Shaws Hellsehern, die in der Lage waren, das Datum auf einer Münze in meiner Tasche zu identifizieren, konnte ich von meinen Mitgliedsanwärtern schlecht erwarten, auf Befehl einen Geist in einem Sitzungssaal heraufzubeschwören.
Dies bedeutete, dass die Mitgliedschaft in meiner Abteilung auf vertrauenswürdigen Referenzen basierte, dem guten alten Empfehlungssystem. Doch das sollte nicht täuschen: Mein Auswahlverfahren mochte weniger rigoros erscheinen, ich war jedoch kein bisschen weniger wählerisch. Meine Ansprüche waren hoch.
Sowohl Shaw als auch ich unterstanden dem Präsidenten, Mr. Volckman. Volckman hatte die London Séance Society vor gut zwölf Jahren gegründet, als das Thema Geisterwelt in der Stadt populär wurde. Séancen, Geister, Gespenster: Dies alles war en vogue, und London konnte nicht genug davon bekommen. Da er eine finanzielle Gelegenheit witterte, machte Volckman sich an die Arbeit und zog frühzeitig Shaw und mich hinzu.
Er war ein bewundernswerter Mensch gewesen.
Jedenfalls bis zu seinem Tod.
In der Ecke meines Tisches lag ein Artikel über jene Unglücksnacht, der in der heutigen Morgenzeitung erschienen war. Ich warf einen Blick auf die Überschrift: Immer noch keine Antworten bezüglich Mord an Londoner Gentleman während Abendveranstaltung. Dann las ich den kurzen Bericht noch einmal in Gänze durch.
Die Metropolitan Police untersucht weiterhin die Umstände, die zum Tod von Mr. M. Volckman, Einwohner von Mayfair, vor über drei Monaten geführt haben. Volckman war ein geschätzter Gentleman: Vater, Ehemann und Vorsitzender des angesehenen Herrenclubs im West End, der London Séance Society.
Volckmans übel zugerichtete Leiche wurde am31. Oktober in einem privaten Keller in der Nähe des Grosvenor Square aufgefunden, der von einem gewissen Mr. M. Morley aus London, Vizepräsident der Abteilung für Spiritualismus in der oben genannten Society, geführt wird.
An jenem Abend vor Allerheiligen hatte in diesem Keller eine Soiree stattgefunden. Volckmans Leiche wurde von Mr. Morley persönlich in der unteren Kelleretage entdeckt. Mindestens einhundert Gäste hatten an der Veranstaltung teilgenommen, eine Tatsache, welche die Metropolitan Police als erhebliche Komplikation für ihre Ermittlungen anführt.
Mr. Volckman war ein aufrechter Bürger dieser Stadt. Laut seinen Freunden hatte er keine Spielschulden angehäuft und sich auch sonst mit niemandem angelegt. Als ehrenwerten Gentleman bezeichnen ihn seine Angehörigen, was für uns alle weiterhin die Frage aufwirft: Wer könnte seinen Tod gewollt haben?
Ich legte den Artikel beiseite und erhob mich aufgewühlt von meinem abgewetzten Lederstuhl. Auf meinen Wanderungen durchs Zimmer blieb ich vor dem Spiegel stehen, der neben der Leitlinie der Society an der Wand hing. Ich sah lange hinein und runzelte wie immer die Stirn ob des Konterfeis, das meinen Augen entgegenblickte. Sechsunddreißig Jahre alt mit einem dichten Haarschopf – keine schütteren Stellen, kein zurückweichender Ansatz –, mit markantem Kinn und gerade geschnittener Nase.
Es war meine Haut, die ich verabscheute. Ein Muttermal, tiefrot und fleckig, zog sich von meinem linken Unterlid quer über mein Gesicht bis zum Ohr. Es handelte sich dabei nicht um einen kleinen Makel, der sich mit etwas Creme abdecken ließe. Nein, der Fleck hatte die Größe meines Handtellers und war einst glatt gewesen. Inzwischen jedoch hatte sich diese Hautpartie verdickt und wirkte erhaben und rau.
Während meiner Kindheit hatte mir dieses Mal die Zuneigung von Erwachsenen eingebracht. Eines Tages würde es verschwinden, versicherten mir alle. Doch das tat es nicht, und wie sehr ich mich nun dessen schämte. Keiner meiner Freunde wurde von einem solchen Makel geplagt. Zwischen den edelsten Gentlemen der Londoner Gesellschaft stach ich hervor, und zwar nicht auf positive Weise.
Wenn sich dieser Fleck doch nur wegschrubben oder bleichen ließe. Als Jugendlicher hatte ich ihn mit Sand und Kalk wund gescheuert. Als mir das jedoch nur fleckigen Schorf auf der gesamten linken Gesichtshälfte einbrachte, rührte ich eine selbst erdachte Salbe an: Essig, vermischt mit einer Bleichcreme, die ich bei den Sachen meiner Mutter fand, und trug sie über Nacht auf meine Haut auf. Woche für Woche probierte ich solche absurden Behandlungen aus. Keine einzige davon funktionierte. Wenn überhaupt, wurde das Muttermal dunkler, vielleicht sogar größer.
Und das Schlimmste daran? Die Art, wie Frauen mich einen Moment zu lange ansahen, als wäre ich ein seltenes fremdartiges Wesen. Einen solchen Makel zu haben trug auch nicht gerade zu meinen Heiratschancen bei. Abgesehen davon, dass es auf Frauen optisch nicht anziehend wirkte, konnte niemand erklären, was diesen Fleck verursacht hatte. Meine Eltern hatten keine riesigen Muttermale im Gesicht gehabt. Welche Frau würde riskieren, ihren Kindern so etwas anzutun?
Ich fuhr mir mit der Hand über die Wange. Meine Gesichtsbehaarung verdeckte einen kleinen Teil des Flecks, doch den Anblick meiner restlichen Visage fand ich abstoßend. Ich drehte mich weg. Schamgefühle wegen meiner Erscheinung waren etwas, womit ich schließlich meinen Frieden gemacht hatte, doch Spiegel hasste ich nach wie vor.
Mr. Volckman hatte stets hinter mein Äußeres geblickt. In all den Jahren, die ich ihn kannte, hatte er nicht eine einzige Bemerkung darüber gemacht.
Er fehlte mir sehr. Obwohl er zehn Jahre älter als ich und ein Mann außergewöhnlicher Ansprüche gewesen war, war er für mich Mentor und Vertrauter geworden. Ein Partner.
Großzügig war er ebenfalls gewesen – und er war der Grund, weshalb meine Mutter und ich vor zehn Jahren finanziell nicht in Schwierigkeiten gerieten, nachdem mein Vater, ein erfolgreicher Tuchhändler, an einer Lungenentzündung gestorben war. Wir versuchten beide nach Kräften, das Stoffgeschäft meines Vaters am Laufen zu halten, doch weder sie noch ich besaßen das Talent oder das Auftreten eines Verkäufers. Innerhalb weniger Monate hatte sich eine Staubschicht über unser Inventar gelegt: über die Seidenbahnen, die Wollstoffe für Wintermäntel, das leuchtend rosafarbene Baumwolltuch für Trachten. Alles kam aus der Mode, und wir besaßen nicht die Mittel, um die neusten Muster zu beschaffen oder unser Angebot zu aktualisieren. Unsere vornehme Kundschaft verlor keine Zeit, ihre Konten bei uns zu schließen und ihre Einkäufe anderswo zu tätigen.
Mr. Volckman, der seit Langem Stammkunde gewesen war, hatte Erbarmen mit uns. Ich fragte mich, ob ich ihm wohl leidtat, ein sechsundzwanzigjähriger Gentleman von Stand und mit guten Manieren, doch unverheiratet und belastet mit einem strauchelnden Unternehmen und einer älter werdenden Mutter. Mr. Volckman hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst die London Séance Society gegründet und suchte nach einer verlässlichen Person – einer loyalen Person –, die das Department of Spiritualism etablieren und führen konnte. Er nahm mich unter seine Fittiche und zahlte mir ein stattliches Gehalt, das ausreichte, um auch meine Mutter zu versorgen. Sie schloss das Textilwarengeschäft und verkaufte, was immer möglich war, während ich meine Nase in zahllose Bücher über Spiritualismus steckte. Texte über die Natur der Seele, die Art und Weise, wie Geister kommunizieren, die Werkzeuge, die diesen Austausch erleichtern. Volckman ließ mir jede Menge Freiraum, die Abteilung nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Als sich die Einkünfte mehrten, merkte ich, wie zufrieden er war. Zufrieden, und vielleicht sogar ein wenig überrascht.
Ich würde für immer in Mr. Volckmans Schuld stehen. Seine Großzügigkeit hatte nicht nur meine Familie vor finanziellem Ruin gerettet, sondern auch meine gesellschaftliche Position erneuert und mich mit einem Kreis vornehmer Freunde versorgt.
Ich wollte mich ihm gegenüber als würdig erweisen.
Volckman war ein Mann mit hohen Erwartungen und wenig Verständnis für Fehler gewesen, und ganz besonders wichtig war ihm der Ruf der Society, was Glaubwürdigkeit und Authentizität anging. Waren diese bedroht, kannte er keine Gnade. Er war alles andere als glücklich, als Anfang 1872 eine Welle von Gerüchten in Umlauf kam, vor allem Salongeflüster, die Society benutze während ihrer Séancen magische Tricksereien. Diese Information wurde ihm von einem seiner nahestehenden Bekannten zugetragen, jemandem, der sich in den okkulten Kreisen Londons recht gut auskannte.
Diese Gerüchte, die sich auf meine Abteilung bezogen, warfen ein schlechtes Bild auf die gesamte Organisation. Sie legten nahe, dass die ganze Arbeit der Society auf Schwindel und Täuschungen basierte und wir nichts anderes als Illusionisten waren. Männer der Theatermagie.
Ungeachtet unseres gegenseitigen Wohlwollens war Mr. Volckman erzürnt gewesen, vor allem mir gegenüber. Es war schließlich meine Abteilung, die Probleme machte. Dem konnte ich nichts entgegenhalten. Bei der Vorstellung, dass der tadellose Ruf unserer Gesellschaft durch Gerüchte über ein solches Fehlverhalten beschädigt werden konnte, wurde mir elend.
Unter dem Spiegel befand sich noch ein weiterer Bilderrahmen. Dieser enthielt Zeitungszitate von zufriedenen Kunden. »Ich bin außerordentlich erfreut über das Ergebnis der Séance, die vor vierzehn Tagen abgehalten wurde«, stand in einem der Artikel. »Die Gentlemen der London Séance Society brachten meinen toten Ehemann dazu, zu erscheinen, und als sie seinen Geist fragten, ob er mich freigeben würde, um wieder zu lieben, ertönte im Kamin ein lautes Hämmern …»
Ich erinnerte mich noch gut an diese Séance. An den Ausdruck von Freude auf dem Gesicht der Witwe, die Erleichterung in ihrer Miene. Das war noch besser als die Bezahlung.
Wobei die Bezahlung auch nicht zu verachten war.
Der gute Ruf der Society im Lauf des vergangenen Jahrzehnts brachte eine Menge an Aufträgen für die Organisation ein, und zum Ende jedes Quartals wurden die Erträge gesammelt und in Form einer Dividende an die Mitglieder der Society ausgezahlt. Für viele waren diese Dividenden der attraktivste Aspekt der Mitgliedschaft. Es ermunterte sie, ihre Fähigkeiten in Hellseherei oder Geisterbeschwörung zu verbessern, um die Geschäfte am Laufen zu halten.
Für andere ging es weniger ums Geld als vielmehr um die Kameradschaft unter den Herren. Der Geschäftssitz der Society war ein Ort, an dem sie der Monotonie ihres Alltags zu Hause entfliehen und anregende Unterhaltungen führen, exklusive Feste feiern und aufwendig zubereitete Mahlzeiten einnehmen konnten.
Und für einige wenige machte der größte Reiz einer Mitgliedschaft weder das Einkommen noch die Exklusivität aus, sondern vielmehr die weibliche Kundschaft, mit der wir für gewöhnlich zu tun hatten.
Es lag in der Natur unseres Dienstes, dass wir in der ganzen Stadt ungehinderten Zugang zu vielen Häusern hatten. Die Society war eine anspruchsvolle Organisation, und vor allem in meiner Abteilung war es kein Zufall, dass es sich bei fast allen unseren Klienten um wohlhabende Witwen und Erbinnen handelte. Ich behielt die Todesanzeigen stets im Blick und kannte die adeligen Stammbäume, die Namen, die zu Ländereien oder politischen Ämtern gehörten – in anderen Worten, es war die Sorte von Frauen, die bei teuren Séancen nicht mit der Wimper zucken würden.
Obwohl wir oft mit ihnen zusammenarbeiteten, hatten Frauen keinen Zutritt zum Gebäude der Gesellschaft. Das war schon immer so gewesen, seit der Gründung der Society. Während der letzten Führungsversammlung Ende Oktober, an der Volckman teilnahm, hatte ein Mitglied einen Antrag gestellt, diese Regel abzuschaffen. Sollten Frauen nicht wenigstens als geladene Dinnergäste zugelassen werden?
Obwohl Volckman selbst ein Familienmensch war, hatte er über den Vorschlag nur gelacht. »Gentlemen suchen die Society auf, um ihren Frauen zu entkommen«, hatte er gesagt, »nicht um weiter mit ihnen Umgang zu pflegen. Wir würden unsere eigenen Frauen auch nicht zu Morleys Kellerfeiern im Grosvenor Square einladen, oder?«
Darüber hatten wir alle gelacht. Seit mehreren Jahren veranstaltete ich große Feste in den unterirdischen Räumlichkeiten, die weitläufig genug waren, um hundert Gäste zu beherbergen. Diesen Keller verwaltete ich bereits seit Jahren, um ein wenig dazuzuverdienen. Es lagerten dort fast zweihundert Fässer – Gin, Wermut, Whisky – und jede Menge Wein. Meine Aufgabe war es, die Fässer zu drehen, sie ein- und auszuladen und die Ratten zu vertreiben. Die Fässer und Flaschen gehörten einem Händler im Norden Londons.
Keines unserer Mitglieder erzählte seiner Frau daheim von den Soireen in meinem Keller. Wir konnten alle gut Geheimnisse wahren, vor allem Volckman. Er war äußerst loyal allem gegenüber, was er schätzte.
Zehn Jahre lang war auf diese Weise alles bestens gelaufen.
Bis diese Gerüchte aufkamen.
Als Folge des Tratsches gingen unsere Geschäfte zurück. In meiner Abteilung sanken die Aufträge vierteljährlich um vierzehn Prozent. Die Aufträge von Shaw lagen dicht dahinter. Die rückläufigen Einnahmen waren an sich schon alarmierend genug, doch noch problematischer waren die gekürzten Dividenden. Einige der Mitglieder waren unzufrieden mit ihren Zuteilungen und drohten damit, aus der Organisation auszutreten. Das Gerede in der Stadt war gefährlich, aber Mitglieder, die das Schiff verließen? Diese Abtrünnigen würden uns keinen Gefallen tun. Die Leute würden anfangen, Fragen zu stellen, mehr noch, als sie es bisher schon taten.
Nein, das konnte ich nicht zulassen. Die Society durfte nicht zugrunde gehen. Die Feiern, das Geld, das alles war zu wichtig.
Volckman verlangte, ich solle mich der Sache annehmen: Wir mussten das Problem identifizieren und so schnell wie möglich lösen. Er versprach, seinerseits ebenfalls Erkundigungen einzuziehen.
Nur dass seine Bemühungen ihn schließlich das Leben gekostet hatten.
Irgendwo dort draußen, außerhalb der fensterlosen Mauern dieses Raumes, begann eine Mönchsgrasmücke ihre fröhliche Melodie zu zwitschern. Der Vogel hatte in den vergangenen Tagen immer wieder dieses Abendlied angestimmt. Ein seltsames Verhalten für ein Tier, das normalerweise am Morgen sang, doch so war es nun einmal mit ungezähmten Wesen.
Ich warf einen weiteren Blick auf den Artikel zu Volckmans Tod und tippte mit dem Finger auf den letzten Satz: Wer könnte seinen Tod gewollt haben?
Der Vogel zwitscherte lauter. Ich lauschte dem winzigen Sänger einige Augenblicke und beneidete ihn um seine Freude. Dann ließ ich den Kopf hängen und massierte meine Schläfen.
Sie würde gefährlich werden, diese Aufgabe, die vor mir lag.
3: Lenna
3
LENNA
Paris, Donnerstag,13. Februar1873
Im Château flog plötzlich die Tür zum alten Salon auf.
Die Mutter der ermordeten jungen Frau stieß einen entsetzten Schrei aus. Lenna fuhr herum und konnte im Türrahmen einen Schatten in menschlicher Form erkennen. Wenn das ein Geist ist, dachte sie, dann habe ich mich in allem schrecklich getäuscht.
Der Schatten machte einen Schritt in den Salon hinein. Da er nun besser zu sehen war, erkannte Lenna die dunkle Uniform und die Bartstoppeln an seinem Kinn. Es war die höchst körperliche Gestalt eines jungen Mannes, in dessen Hand eine Laterne schaukelte. Vier Messingknöpfe an seinem Mantel reflektierten das schummerige Kerzenlicht, und quer über die Brust geschlungen trug er eine lederne Umhängetasche. Keuchend stand er da, die Wangen vor Kälte gerötet. Einige Schneeflocken zierten seine Uniform, doch sie schmolzen, als er den Raum betrat.
»Wer ist das?«, zischte der Vater verwirrt. Er sah fragend seine Frau an, die höchst ungläubig dreinschaute und stumm blieb.
Das Ungestüme des Vaters, gepaart mit der Sanftmut der Mutter, erinnerte Lenna sehr an ihre eigenen Eltern. Nach Evies Tod vor einigen Monaten war ihre Mutter schließlich mit einer Cousine aufs Land gereist. Mehrere Wochen lang hatte sie versucht, die Stadt zu ertragen, mit einem Schleier über den glasigen Augen im Salon des Hickway House Besucher zu empfangen. Doch als der Mord an ihrer Tochter unaufgeklärt blieb, hinterfragte sie irgendwann alles und jeden. Egal ob Fremde oder alte Freunde, Lennas Mutter traute niemandem mehr.
So blieb es Lennas Vater überlassen, sich ums Hotel zu kümmern. Es war machbar, denn es gab nur vierundzwanzig Betten, die meist von Reisenden von King’s Cross und St. Pancras gebucht wurden. Dennoch war die Belastung für ihren Vater groß, und Lenna freute sich auf den Tag, an dem ihre Mutter sich gut genug für eine Rückkehr in die Stadt fühlen würde.
Der trauernde Vater ihr gegenüber rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Ist dieser Mann echt?«, polterte er.
Lenna fragte sich dasselbe. Denn bei allem, was Vaudeline und sie während der vergangenen zwei Wochen durchgenommen hatten, war ihr die grundlegendste aller Fragen nicht in den Sinn gekommen: Wie, genau, sah ein Geist eigentlich aus? Sollten Geister den schwebenden ätherischen Figuren aus Kinderbüchern gleichen, oder waren sie so greifbar und lebensecht wie der Mann, der dort in der Tür stand?
Rasch sah sie in ihr Notizbuch, in dem sie die letzten Tage über brav alles mitgeschrieben hatte. Ihr Blick huschte über die Seite auf der Suche nach einem Hinweis, den sie übersehen haben könnte.
So wie er schnauft, dachte Lenna, und mit dem geröteten Gesicht, wirkt er völlig echt, aber wie kann ich das sicher wissen?
Evie hätte sich mit solchen Fragen nicht aufgehalten. Ihre Überzeugung war stets vollkommen gewesen, nicht von Bedenken, von der Wissenschaft, der Vernunft geplagt.
Lenna hingegen betrachtete sich selbst als Frau der Logik und des Praktischen. Sie hatte sich schon immer für die Natur interessiert, erst recht seit ihrer Begegnung mit Stephen Heslop.
Stephen war der Zwillingsbruder von Eloise, die eine enge Freundin von Evie und Lenna gewesen war. Er war nur einige Monate älter als Lenna, und sie beide lernten sich kennen, als er vom Studium in Oxford zurückkehrte, um im Museum of Practical Geology in der Jermyn Street zu arbeiten, wo er Mineralien und Fossilien erforschte.
Stephen kam regelmäßig im Hickway House vorbei, um Lenna zu besuchen, und häufig brachte er Arbeit mit, wie Meißel und Pinsel, die repariert werden mussten. Lenna setzte sich dann zu ihm, während er sich im Garten um sein Werkzeug kümmerte. Ihr Interesse an Naturalismus wuchs, als Stephen ihr die Wissenschaft der Fossilien erklärte. Sie begleitete ihn sogar ein paarmal ins Museum, wo sie sich mit den vielen verschiedenen Steinsammlungen vertraut machte.
Eines Tages brachte Stephen ihr einen kleinen runden Stein mit, wie Lenna ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Er war durchscheinend, hatte die Farbe von Whisky und hieß Bernstein. Lenna war klar, dass Stephen mit diesem Geschenk um sie werben wollte, doch sein romantisches Interesse ließ sie kalt. Was sie begeisterte, war der Harzstein selbst und das, was darin eingeschlossen war: das Skelett eines winzigen Spinnentiers, nicht größer als ein Fingernagel, und die beinahe unsichtbaren Fäden des Netzes, das immer noch perfekt gesponnen war. Es handelte sich um einen jungen Stein, erklärte Stephen ihr, weniger als tausend Jahre alt.
»Er gehört dir«, sagte er, mit einem leichten Schweißfilm auf der Oberlippe. Dann streckte er die Hand aus, um Lennas Arm zu berühren, doch sie drehte sich sanft weg und studierte stattdessen die winzigen Haare auf den krummen Beinen der Spinne.
Das war der Beginn ihrer Sammlung von Bernsteinexemplaren und des Wunsches, mehr über solche Dinge zu erfahren. Relikte aus Mineralien oder versteinerte Spinnen, an fernen Orten von Forschern entdeckt, die es wagten, diese Stadt mit ihrem Nebel und der Feuchtigkeit zu verlassen.
Einige Wochen darauf kehrte Stephen mit Abfallmaterialien aus dem Museum zurück, darunter auch eine Tüte mit halb getrocknetem Ton und einigen zerbrochenen Werkzeugen. Er ließ Lenna damit experimentieren, damit sie selbst einige Abdrücke von Fossilien herstellen konnte. Dann ging Lenna zur Themse, um einen toten Barsch aufzusammeln. Mit seiner stacheligen Rückenflosse ergab auch er einen schönen Abdruck. Das war etwas, das sie mit dem Finger berühren konnte, und das gefiel ihr. Sie war fasziniert von allem Greifbaren, Sichtbaren, Nachweisbaren. Genau wie die kleine Spinne in ihrem von Bernstein eingeschlossenen Netz. Sie veränderte sich nicht, verschwand nicht.
Im Gegensatz zu den Dingen, mit denen sich Evie beschäftigte.
Evie hatte schon immer ätherische Themen bevorzugt: Erscheinungen, Vorahnungen, Träume. Sie erledigte jeden Tag pflichtbewusst ihre Arbeit im Hotel ihrer Eltern, und abends stürzte sie sich auf ihre vagen, seltsamen Studien. Sie glaubte, dass Geister überall existierten, unter irgendeiner Schicht von Leben, die für sie bisher noch unsichtbar war. Mit der richtigen Formel – dem richtigen Zauber oder dem richtigen Amulett – würde sich dieses Reich ihr vielleicht offenbaren.
Außerdem glaubte sie, damit auch ganz gut Profit machen zu können. In London waren Geister vor einigen Jahren förmlich in Mode gekommen. Evie erkannte die Gelegenheit: Ihre persönliche Besessenheit könnte ihr gutes Geld einbringen. Sie war überzeugt davon, damit reich werden zu können – sehr reich –, wenn sie nur die nötige Ausbildung erhielt. Daher war sie vor nicht allzu langer Zeit höchst erfreut gewesen, einen Platz in einer von Vaudeline D’Allaires Schülergruppen in London zu ergattern. Vaudelines Name hatte in den verrauchten, verschleierten Salons viel Gewicht, und Evie wusste, die Erfahrung würde ihr einen Vorsprung verschaffen.
Das war keine reine Geldgier, musste Lenna zugeben, sondern brillant.
Die Schwestern unterschieden sich nicht nur in ihren Interessen. Auch äußerlich waren sie sich kein bisschen ähnlich. Evie hatte kurzes schwarzes Haar und wasserblaue Augen, genau wie ihre Mutter, während Lenna die goldenen weichen Locken und haselnussbraunen Augen ihres Vaters geerbt hatte. Lenna war eher feminin, Evie schon immer etwas unkonventionell und burschikos, insgesamt eher unauffällig. Zumindest im Aussehen, doch gewiss nicht im Wesen. Sie war schlauer und mutiger als alle, denen Lenna je begegnet war. Zu schlau, wenn Lenna ehrlich war. Fast schon listig.
Wie alle Schwestern stritten sich die beiden oft. In der Woche vor Evies Tod hatten sie zusammen in dem Zimmer gesessen, das sie sich im Hotel teilten. Während Evie las, studierte Lenna ihre Fossilienabdrücke. Sie hielt den Barsch ins Licht der Öllampe und betrachtete die komplizierten Vertiefungen und Hohlräume, die das Fleisch des Fisches hinterlassen hatte.
»Damit hast du soeben bewiesen, dass ich recht habe«, sagte Evie. Sie blickte von ihren Papieren auf, und ihre rosafarbenen Wangen glühten.
»Wie bitte?«
»Dein kleiner Barschabdruck da, den du die ganze Zeit anstarrst. Der Fisch selbst ist tot und verschwunden. Doch seine Form liegt immer noch vor dir, und wird bis in alle Zeit in diesem Tonklumpen bleiben. Genauso ist es mit Geistern. Wir sterben zwar, aber wir verschwinden nie wirklich ganz.«
Lenna fuhr mit dem Daumennagel den runden Bauch des Abdrucks nach. So hatte sie das noch nie betrachtet, aber trotzdem würde sie ihrer jüngeren Schwester nicht so schnell recht geben. »Ist das nicht eine Wunschvorstellung?«
Evie schnaubte. »Etwas kann keine Illusion sein, wenn es immer noch da ist, obwohl wir glauben, es wäre verschwunden. Einschließlich dieser Fossilien und Steine, von denen du so besessen bist. Letzte Woche hast du die ganze Zeit von einem Blattfossil gesprochen, das dir dein Beau vom Museum mitgebracht hat. Wie alt war das, tausend Jahre?«
»Viertausend. Und er ist nicht mein Beau.«
»Von mir aus.« Evie faltete die Hände im Schoß. »Also, das Blatt selbst gibt es schon lange nicht mehr. Zerfallen. Aber es hat eine Spur hinterlassen, oder etwa nicht? Etwas von ihm ist immer noch da. Oder willst du behaupten, das Blatt selbst war eine Illusion, weil es nicht mehr existiert?«
Ganz unrecht hatte Evie nicht. Auch Lennas Bernstein mit der Spinne darin war ein Beweis für dieses Argument. Die Spinne war perfekt konserviert. Tot, aber nicht verschwunden. Trotzdem würde Lenna nicht klein beigeben. Lieber blieb sie stumm, als zuzugeben, dass sie im Unrecht war.
»Du hast zu viel Zeit mit Stephen verbracht und dir Gedanken über Dinge gemacht, die man anfassen kann«, fuhr Evie fort. »Du solltest mal mit mir auf eine Geisterjagd gehen. Vielleicht wärst du überrascht.«
»Du hast doch noch keinen einzigen Geist gesehen.«
»Es gibt sie, das versichere ich dir. Genau wie dein Barsch einst in diesem Ton lag.« Evie spielte gedankenverloren an einem Schnürsenkel ihres Schuhs herum, den Blick auf den Lesestoff gerichtet, der um sie herum ausgebreitet lag: ein Handbuch übers Tischklopfen – was auch immer das war – und ein anderes darüber, wie das Wesen von Geisterflecken in Fotografien bestimmt werden konnte. Werbeanzeigen für etwas, bei dem es sich um Phiolen mit Phosphoröl zu handeln schien, ein Diagramm zum Aufbau eines Séancen-Kabinetts und ein Büchlein mit dem Titel Katalog der Apportationen.
»Was sind Apportationen?«, wollte Lenna wissen. Sie hatte das Wort noch nie zuvor gehört.
Evies Augen leuchteten auf. »Oh, das ist so faszinierend. Apportationen sind kleine Zeichen, die während Séancen auftauchen. Oder an einem Ort, an dem sich Geister aufhalten. Münzen, Muscheln, Blumen und solche Dinge.«
»Und die erscheinen … einfach so? Aus dem Nichts?«
Evie zuckte mit den Schultern. »Manchmal. Oder man schaut kurz weg und dann wieder hin und findet das Zeichen direkt vor sich.« Sie griff nach dem Katalog und schlug eine markierte Seite nahe der Mitte auf. »Diese Apportationen gibt es in einem Geschäft für Wahrsagerei in der Jermyn Street zu kaufen. Ich schaue da oft vorbei. Diese hier möchte ich gern haben.« Sie hielt Lenna die Seite hin, auf der die Illustration einer Feder abgebildet war. »Sie stammt von einer Mönchsgrasmücke. Die machen schrecklich viel Lärm.«
»Du und deine Vögel«, erwiderte Lenna lächelnd. Evie liebte Vögel, seit sie klein war. Es passte zu ihr und ihrem wilden, unabhängigen Wesen.
»Es ist die einzige Feder-Apportation im ganzen Laden«, erklärte Evie. Sie blätterte weiter. »Muscheln hingegen gibt es Dutzende.«
Lenna wandte sich wieder ihrem Fossilienabdruck zu und dachte darüber nach, wie wahrscheinlich es war, dass ein Zeichen einfach so vom Himmel fiel. Die Vorstellung befremdete sie. Muscheln und Federn tauchten nicht aus dem Nichts auf. Das war genau die Art von fantastischen Themen, die den Spiritualismus für Lenna trübten, denn es gelang ihr nicht, irgendetwas davon zu glauben.
»Huch«, machte Evie plötzlich und schüttelte den Kopf. Sie hatte sich einer Zeitschrift namens The Spiritualist zugewandt.
»Was ist denn?«