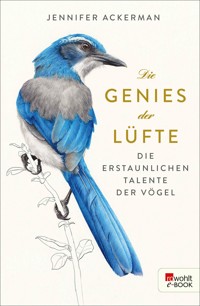
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eines der beeindruckendsten Naturbücher der letzten Jahre! Vögel sind erstaunlich intelligente Wesen: Sie überqueren Kontinente, ohne nach dem Weg zu fragen. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und planen für die Zukunft. Sie beherrschen die Grundprinzipien der Physik. Wie zahlreiche neue Studien zeigen, stehen die kognitiven Fähigkeiten vieler Vogelarten denen von Primaten in nichts nach. Und nicht nur ihre technische Kompetenz ist größer als lange angenommen, sie verfügen auch über eine beeindruckende soziale Intelligenz. Sie täuschen und manipulieren, sie machen Geschenke und trösten einander. Und das alles mit einem Gehirn kleiner als eine Walnuss. Jennifer Ackerman ist begeisterte Vogelbeobachterin und begibt sich auf Entdeckungsreise zu den Genies der Lüfte. Während sie von ihren Besuchen bei Ornithologen auf der ganzen Welt berichtet, versetzt sie den Leser immer wieder in Staunen: Etwa über die Neukaledoniekrähe auf einer Inselgruppe im Pazifik, die sich Werkzeug bastelt, um an ihr Futter zu gelangen. Oder den Kiefernhäher in den Rocky Mountains, der bis zu 30000 Samen über Dutzende Quadratkilometer verteilt und einige Monate später noch erinnert, wo. Ihr Fazit: Das einzigartige Talent der Vögel macht vor allem ihre Fähigkeit aus, sich an stetig verändernde Lebensumstände und Herausforderungen anzupassen und dafür innovative Lösungen zu finden. Jennifer Ackerman verbindet auf elegante Weise persönliche Anekdoten und Reisereportage mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – nach der Lektüre sieht man die Wunder der Vogelwelt mit neuen Augen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jennifer Ackerman
Die Genies der Lüfte
Die erstaunlichen Talente der Vögel
Über dieses Buch
Sie überqueren Kontinente, ohne nach dem Weg zu fragen. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und planen für die Zukunft. Sie beherrschen die Grundprinzipien der Physik. Vögel sind erstaunlich intelligente Wesen. Wie zahlreiche neue Studien zeigen, stehen die kognitiven Fähigkeiten vieler Arten denen von Primaten in nichts nach. Und nicht nur ihre technische Kompetenz ist größer als lange angenommen, sie verfügen auch über eine beeindruckende soziale Intelligenz. Sie täuschen und manipulieren, sie machen Geschenke und trösten einander. Und das alles mit einem Gehirn, kleiner als eine Walnuss.
Jennifer Ackerman ist begeisterte Vogelbeobachterin und begibt sich auf Entdeckungsreise zu den Genies der Lüfte. Während sie von ihren Besuchen bei Ornithologen auf der ganzen Welt berichtet, versetzt sie den Leser immer wieder in Staunen: Etwa über die Neukaledonienkrähe auf einer Inselgruppe im Pazifik, die sich Werkzeug bastelt, um an ihr Futter zu gelangen. Oder den Kiefernhäher in den Rocky Mountains, der bis zu 30.000 Samen über Dutzende Quadratkilometer verteilt und an ihren Ort einige Monate später noch sich erinnert. Ihr Fazit: Das einzigartige Talent der Vögel macht vor allem ihre Fähigkeit aus, sich an stetig verändernde Lebensumstände und Herausforderungen anzupassen und dafür innovative Lösungen zu finden. Jennifer Ackerman verbindet auf elegante Weise persönliche Anekdoten und Reisereportage mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – nach der Lektüre sieht man die Wunder der Vogelwelt mit neuen Augen.
Vita
Jennifer Ackerman ist preisgekrönte Autorin und schreibt seit über 25 Jahren über Wissenschafts- und Naturthemen, u.a. für «The New York Times Magazine», «Scientific American» und «National Geographic».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 2016 by Jennifer Ackerman
Ilustrationen Innenteil John Burgoyne
Mitarbeit Hubert Mania
Die Übersetzerin dankt Holger Mihm für die große Unterstützung bei allen Sach- und Fachfragen
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «The Genius of Birds» bei Penguin Press.
Redaktion: Ulrike Gallwitz
Umschlaggestaltung nach dem Original von Penguin Press (Gestaltung: Gabriele Wilson)
Umschlagabbildung: Eunike Nugroho
Foto der Autorin: Robert Llewellyn
ISBN 978-3-644-00068-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Karl, mit all meiner Liebe
Einleitung
Die Genies der Lüfte
Vögel, so hieß es lange abfällig, seien dumm. Knopfaugen und kein Grips. Reptilien mit Flügeln und Hühnerverstand. Kleine Trottel. Sie fliegen gegen Fenster, hacken auf ihr Spiegelbild ein, rauschen in Überlandleitungen, flattern in den Untergang.
Unsere Sprache verrät unsere Respektlosigkeit. Jemanden, dem das Schicksal hart zusetzt, nennen wir einen «Pechvogel» oder einen «Unglücksraben». «Der hat ’ne Meise», sagt man über jemanden, den man für nicht ganz bei Verstand hält. Ein zickiges, albernes Mädchen ist eine «dumme Pute», ein erfolgloser Politiker eine «lahme Ente», und wer viel Alkohol trinkt, eine «Schnapsdrossel» oder ein «Schluckspecht». «Weiß der Kuckuck», sagt man, weil man das Wort Teufel lieber nicht ausspricht. «Hahnrei» ist das etwas altmodische Wort für einen betrogenen Ehemann, und eine «Rabenmutter» kümmert sich nicht um ihre Kinder. Bei dem «piept es wohl», äußert man spöttisch über eine dumme, törichte oder schusselige Person mit einem «Spatzenhirn». Der entsprechende englische Ausdruck «bird brain» tauchte übrigens zum ersten Mal in den frühen 1920ern auf; Vögel wurden für bloße fliegende, pickende Automaten gehalten, in deren winziges Gehirn nicht der kleinste Gedanke hineinpasst.
Diese Ansicht ist Schnee von gestern. Seit etwa zwei Jahrzehnten berichten Feldforscher und Labore auf der ganzen Welt von Hirnleistungen bestimmter Vogelarten, die sich mit denen von Primaten vergleichen lassen. Da ist zum Beispiel ein Vogel, der aus Beeren, Glasscherben und Blüten bunte Muster kreiert, um Weibchen anzulocken, andere Vögel verstecken bis zu 33000 Samen auf einer Fläche von mehreren Dutzend Quadratmeilen und wissen noch Monate später, wo sie vergraben sind. Und da ist die Spezies, die ein klassisches Rätsel fast genauso schnell löst wie ein fünfjähriges Kind, und wieder eine andere ist Spezialist im Schlösserknacken. Dann gibt es Vögel, die können zählen und einfache Rechenaufgaben lösen, sich selbst ihr Werkzeug herstellen und sich im Takt von Musik bewegen, einfache Prinzipien der Physik begreifen, sich an die Vergangenheit erinnern und die Zukunft planen.
Bisher waren es andere Tiere, die allen Ruhm für ihre fast menschliche Klugheit einheimsten: Schimpansen machen Speere aus Stöcken, um kleinere Primaten zu jagen, und Delfine kommunizieren über ein komplexes System aus Pfiffen und Klicklauten. Menschenaffen trösten einander, und Elefanten trauern um den Verlust eines Verwandten.
Nun haben die Vögel sich dazugesellt. Eine Unzahl neuerer Forschungen hat die alten Ansichten revidiert, und wir begreifen allmählich, dass Vögel sehr viel intelligenter sind, als wir uns jemals vorgestellt haben – in mancher Hinsicht stehen sie unseren Primaten-Verwandten sogar näher als ihren Reptilien-Verwandten.
Es war in den 1980er Jahren, als der charmante und listige Graupapagei namens Alex zusammen mit der Wissenschaftlerin Irene Pepperberg der Welt vorführte, dass manche Vögel offenbar die kognitive Intelligenz von Primaten besitzen. Bevor Alex mit 31 Jahren (nach der Hälfte der erwartbaren Lebensspanne) plötzlich starb, beherrschte er ein Vokabular von Hunderten englischer Bezeichnungen für Gegenstände, Farben und Formen. Er erfasste den kategorialen Unterschied von gleich und verschieden für Zahl, Farbe und Form. Wenn ihm auf einem Tablett diverse Objekte verschiedener Farben und unterschiedlichen Materials präsentiert wurden, konnte er die Anzahl der Objekte gleichen Typs nennen. «Wie viele grüne Schlüssel?», fragte Pepperberg zum Beispiel und breitete mehrere grüne und orangefarbene Schlüssel und Korken vor Alex aus. In acht von zehn Fällen war seine Antwort richtig. Er konnte bei Fragen nach Additionsaufgaben mit Zahlen antworten. Zu seinen größten Triumphen, sagt Pepperberg, gehörten sein Erfassen abstrakter Ideen, darunter auch so etwas wie die Idee von Nichts; seine Fähigkeit, aus der Position einer Leerstelle innerhalb einer Zahlenreihe die entsprechende Ziffer zu erschließen; und schließlich seine Fähigkeit, Wörter so auszusprechen, wie Kinder es tun: «Nu-Hu-SS». Vor Alex dachten wir, wir seien die Einzigen oder fast die Einzigen, die Wörter benutzen können. Aber Alex konnte nicht nur Wörter verstehen, er konnte sie bei seinen Antworten im Gespräch auch benutzen, um mit Stringenz, Intelligenz und vielleicht sogar Gefühl zu reagieren. Seine letzten Worte zu Pepperberg, als sie ihn in der Nacht, bevor er starb, wieder in seinen Käfig setzte, waren sein täglicher Refrain: «Alles Gute, bis morgen. Ich liebe dich.»
In den 1990ern kamen dann aus Neukaledonien, einer kleinen Insel im Südpazifik, nach und nach erste Berichte über Krähen, die sich in der freien Natur ihr Werkzeug selbst herstellen und ihre spezielle Technik offenbar auch von Generation zu Generation weitergeben – eine Leistung, die an die menschliche Kultur erinnert und beweist, dass für raffinierten Werkzeuggebrauch kein Primatenhirn erforderlich ist.
Als die Wissenschaftler diesen Krähen Rätsel vorsetzten, um ihre Problemlösefähigkeit zu testen, verblüfften die Vögel sie mit ihren schlauen Lösungen. 2002 fragten Alex Kacelnik und seine Kollegen an der Universität Oxford die eingefangene neukaledonische Krähe namens Betty: «Kommst du an das Fressen, das sich außerhalb deiner Reichweite in einem kleinen Eimer am Ende dieser Röhre befindet?» Betty machte die Forscher fassungslos, indem sie spontan ein Stück Draht zu einem Haken bog und den kleinen Eimer zu sich heranzog.
Bei den Überschriften mancher Artikel, die derzeit die wissenschaftlichen Zeitschriften füllen, kann man einfach nur staunen: «Sind wir uns schon begegnet? Tauben erkennen vertraute menschliche Gesichter wieder»; «Tierische Syntax: Kohlmeisen zwitschern in ganzen Sätzen»; «Sprachdiskriminierung unter Reisfinken»; «Küken lieben harmonische Musik»; «Persönlichkeit begründet Führungsanspruch bei Weißwangengänsen» und «Tauben können ebenso gut zählen wie Primaten».
Spatzenhirn: Die Verunglimpfung rührte von dem Glauben her, die Gehirne von Vögeln seien so winzig, dass sie nur für instinktives Verhalten reichen. Ihr Gehirn besitze nicht wie unseres eine Hirnrinde, wo all die «schlauen» Sachen passieren. Wir dachten, Vögel hätten aus gutem Grund einen winzigen Kopfinhalt: für ihre luftige Fortbewegung; um der Schwerkraft zu trotzen; um zu schweben, zu tanzen, zu tauchen, tagelang durch die Luft zu segeln, Tausende von Meilen als Zugvögel zurückzulegen und sich in sehr engen Räumen zu bewegen. Ihre Beherrschung des Luftraums, so schien es, hatten die Vögel mit dem Verlust kognitiver Fähigkeiten bezahlt.
Bei näherem Hinsehen haben wir umlernen müssen. Vögel besitzen in der Tat ein sehr anderes Gehirn als wir – kein Wunder. Menschen und Vögel haben sich seit sehr, sehr langer Zeit unabhängig voneinander entwickelt: Den letzten gemeinsamen Vorfahren gab es vor mehr als 300 Millionen Jahren. Einige Vögel haben übrigens für ihre Körpergröße ein relativ großes Gehirn, genauso wie wir. Außerdem scheint die Größe, wenn es um Intelligenz geht, weniger wichtig zu sein als die Anzahl der Neuronen sowie ihre Positionierung und die Art und Weise, wie sie miteinander verbunden sind. In einigen Vogelhirnen drängen sich die Neuronen an wichtigen Stellen in sehr großen Mengen und einer Dichte, die der bei Primaten ähnelt, und sie sind kaum anders platziert und verknüpft als in unserem Gehirn. Das könnte zu großen Teilen erklären, wieso bestimmte Vögel über derart raffinierte kognitive Fähigkeiten verfügen.
Wie unser Gehirn ist auch das der Vögel «lateralisiert», d.h., bestimmte Bereiche sind auf bestimmte Funktionen spezialisiert, das Gehirn hat «Seiten», die verschiedene Arten von Informationen verarbeiten. Es besitzt außerdem die Fähigkeit, alte Gehirnzellen genau dann durch neue zu ersetzen, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Und obwohl ein Vogelhirn auf gänzlich andere Weise als unseres organisiert ist, hat es doch ähnliche Gene und neuronale Schaltkreise und ist zu äußerst erstaunlichen intellektuellen Höchstleistungen in der Lage. Apropos Verstand: Elstern können sich selbst im Spiegel erkennen, haben also eine Vorstellung vom «Ich», die wir einst Menschen, Menschenaffen, Elefanten und Delfinen und einem hoch entwickelten sozialen Bewusstsein vorbehalten glaubten. Der Westliche Buschhäher benutzt machiavellische Taktiken, um sein Futter vor anderen Hähern zu verstecken – allerdings nur, wenn er das Futter selbst gestohlen hat. Diese Vögel scheinen irgendwie zu wissen, was andere Vögel «denken», sie können sich womöglich in sie hineinversetzen. Sie behalten auch, was für Futter sie wo vergraben haben – und wann, sodass sie sich den Happen wieder holen können, bevor er schlecht wird. Diese Fähigkeit, sich an das Was, Wo und Wann eines Ereignisses zu erinnern, wird episodisches Gedächtnis genannt und legt für einige Wissenschaftler die Vermutung nahe, dass diese Häher vielleicht in der Lage sind, im Geiste in die Vergangenheit zurückzuwandern – was einst als Schlüsselkomponente für jene Art mentaler Zeitreisen galt, zu denen ausschließlich Menschen fähig seien.
Wir wissen inzwischen auch, dass Singvögel ihre Lieder auf dieselbe Weise lernen, wie wir Sprachen lernen, und ihre Melodien dann weiterreichen; diese Tradition der Überlieferung begann schon vor zig Millionen Jahren, als unsere Primatenvorfahren noch auf allen vieren herumkrochen.
Manche Vögel sind geborene Euklidianer und können sich mit Hilfe geometrischer Merkmale und Landmarken im dreidimensionalen Raum orientieren, durch unbekanntes Territorium navigieren und verborgene Schätze lokalisieren. Andere wiederum sind geborene Buchhalter. 2015 fanden Forscher heraus, dass neugeborene Küken Zahlen räumlich von links nach rechts «verorten», genau wie die meisten Menschen (links bedeutet weniger; rechts bedeutet mehr). Das würde heißen, dass Vögel dasselbe Von-links-nach-rechts-Orientierungsschema benutzen wie wir – eine kognitive Strategie, die unserer menschlichen Befähigung zu höherer Mathematik zugrunde liegt. Frisch geschlüpfte Vögel können auch Größenverhältnisse erfassen und lernen, aus einer Reihe von Objekten eines auszuwählen, und zwar aufgrund seiner Position in einer Reihe (dritter, achter, neunter Platz). Sie können außerdem einfache mathematische Operationen wie Addieren und Subtrahieren ausführen.
Ein Vogelhirn mag klein sein, aber lassen Sie sich von seinem Gewicht nicht täuschen.
Mir sind Vögel nie dumm vorgekommen. Im Gegenteil, wenige andere Geschöpfe sind so aufgeweckt, so durch und durch lebendig und geschickt, so voll unermüdlichem Schwung. Natürlich kenne ich die Geschichte von dem Raben, der einen Pingpongball aufzuknacken versucht, vermutlich weil er sich darin etwas Eiähnliches erhofft. Ein Freund, der in der Schweiz Urlaub machte, hat beobachtet, wie ein Pfau seinen breiten Schwanz bei heftigem Wind aufzufächern versuchte. Er kippte um, stand wieder auf, spreizte erneut die Federn und fiel wieder um, sechs- oder siebenmal hintereinander. Und in jedem Frühling attackieren die Rotkehlchen, die in unserem Kirschbaum nisten, den Außenspiegel unseres Autos, als wäre er ein Rivale, picken wie wild auf ihr eigenes Spiegelbild ein und kacken unterdessen die Wagentür voll.
Doch wer von uns ist nicht auch schon über die eigene Eitelkeit gestolpert oder hat sich sein Ebenbild zum Feind erkoren?
Ich beobachte Vögel schon fast mein ganzes Leben lang und bewundere seit jeher ihren Mut, ihre Konzentriertheit und diese energiegeladene, hoch bewegliche Vitalität, die eigentlich für ihren winzigen Körper zu viel ist. Wie Louis Halle einst schrieb: «Ein Mensch wäre in kürzester Zeit vollkommen erschöpft von einer solch intensiven Lebensweise.» Die Vögel in meiner alten Wohngegend schienen die Anforderungen der Welt mit lebhafter Neugier und Selbstsicherheit zu bewältigen. Die Amerikanerkrähen etwa, die mit fürstlicher Besitzerarroganz um unsere Mülltonnen herumstrichen, machten den Eindruck höchst erfindungsreicher Geschöpfe. Und einmal sah ich, wie eine Krähe eine Nuss mitten auf einer Straße platzierte, um sie von einem Auto zerkleinern zu lassen, und anschließend mit der eingesammelten Beute an einen sicheren Platz flog und sie verschlang.
In einem Jahr nistete eine Östliche Kreischeule nur wenige Meter von meinem Küchenfenster entfernt im Nistkasten eines Ahornbaums. Tagsüber schlief die Eule, nur ihr runder Kopf war zu sehen, perfekt eingerahmt von dem runden Loch, das in meine Richtung zeigte. Doch nachts verließ die Eule den Nistkasten, um auf die Jagd zu gehen. Und in der Morgendämmerung sah ich dann die Zeichen ihres großartigen Erfolgs – den Flügel einer Trauertaube oder einen Singvogel, der wild zuckend halb aus dem Kasten hing, bis er hineingezogen wurde.
Sogar die Knuttstrandläufer, denen ich an den Stränden der Delaware-Bucht begegnete und die nicht gerade die Hellsten sind, wussten offenbar, wo sie wann sein mussten, um an die vielen köstlichen Eier zu gelangen, die die Pfeilschwanzkrebse im Frühling bei Vollmond legen. Welcher Himmelskalender verriet diesen Vögeln, wohin sie ziehen mussten, und schickte sie gen Norden?
Vieles über Vögel lernte ich von zwei Männern, die beide Bill hießen. Der eine war mein Vater, Bill Gorham, der mich, seit ich sieben oder acht war, in der Umgebung unseres Wohnorts in Washington, D.C., zum Vögelbeobachten mitnahm. Es war die Washingtoner Version des schwedischen gökotta – früh aufstehen, um die Natur zu erkunden – und gehörte zu meinen eindrücklichsten Kindheitsfreuden. An Frühlingswochenenden verließen wir das Haus morgens, wenn es noch dunkel war, und machten uns auf in die Wälder am Potomac-Fluss, um den geheimnisvollen Begrüßungschor mitzuerleben, jenen Augenblick, wenn die Vögel mit tausend Stimmen «Musik, die wimmelt wie das All / Doch nah wie Mittag ist» erklingen lassen, wie Emily Dickinson schrieb.
Mein Vater lernte die Vögel als Pfadfinder durch einen fast blinden Mann kennen, der Apollo Taleporos hieß. Der alte Mann verließ sich allein auf seine Ohren, wenn er eine Vogelart bestimmte. Meisenwaldsänger. Kronwaldsänger. Rötelgrundammer. «Die Vögel sind da!», rief er den Jungen immer zu. «Los, findet sie!» Mein Vater wurde sehr gut darin, Vögel an ihrem Ruf zu identifizieren – er erkannte den melodiösen, flötenartigen Gesang der Walddrossel, das weiche Wi-tschi-ti, Wi-tschi-ti des Weidengelbkehlchens oder den hellen, pfeifenden Ruf einer Weißkehlammer.
Wenn ich mit meinem Vater im späten Licht der Sterne durch den Wald wanderte, lauschte ich etwa dem heiseren Gesang eines Carolina-Zaunkönigs und fragte mich, was so ein Vogel wohl sagte, falls er überhaupt etwas sagte, und wie die Vögel ihre Lieder lernten. Einmal stieß ich auf eine junge Dachsammer, die offenbar gerade ihr Lied übte. Sie hockte irgendwo unsichtbar auf einem niedrigen Zweig einer Zeder, begann mit ihren Pfiffen und Trillern, machte einen Fehler und begann ruhig und hartnäckig so lange von vorn, bis sie die richtige Abfolge endlich beherrschte. Später erfuhr ich, dass diese Ammer sich ihre Lieder nicht vom eigenen Vater abhört, sondern von den Vögeln der Gegend, in der sie geboren wird – ebenjenen Wäldern und Flüssen, die ich von den Wanderungen mit meinem Vater kannte –, dort wird der spezielle Dialekt seit Generationen weitergegeben.
Den zweiten Bill lernte ich im Sussex Bird Club kennen, als ich in Lewes, Delaware, wohnte. Bill Frech brach jeden Morgen um fünf Uhr auf und beobachtete Watvögel und all die verschiedenen Sperlingsvogelarten, die in den Wäldern und Feldern um Lewes zu Hause waren. Er war ein geduldiger, hingebungsvoller und unermüdlicher Beobachter und notierte sich akribisch, welche Vögel er wo und wann sah; seine Aufzeichnungen landeten schließlich bei der Delmara Ornithological Society als Teil der offiziellen staatlichen Vogelverzeichnisse. Dieser Bill war fast taub, aber er war ein Meister darin, Vögel visuell über den generellen Eindruck, die Größe und die Form zu identifizieren. Er zeigte mir, wie man einen Goldzeisig hoch in der Luft an seinem wellenförmigen Flug erkennt und dass man Watvögel anhand ihres Charakters, ihres Verhaltens und ihres Erscheinungsbildes unterscheiden kann, ähnlich wie man Freunde aus der Ferne an ihrem Gang und insgesamt an ihrer Körpersprache erkennt. Er erklärte mir den Unterschied zwischen der gelegentlichen und der intensiveren, konzentrierteren Vogelbeobachtung und hielt mich dazu an, die Vögel nicht nur zu erkennen, sondern auch ihr Handeln und Verhalten zu verfolgen.
Die Vögel, die ich bei diesen und anderen Ausflügen beobachtete, schienen durchaus zu wissen, was sie taten. Genau wie der Schwarzschnabelkuckuck, den ein Freund direkt über dem Nest von Ringelspinnerraupen hocken sah: Der Kuckuck wartete, bis die Raupen aus dem Nest krochen, um den Baum hinaufzuklettern, und pflückte dann eine nach der anderen ab, wie Sushi von einem Förderband.
Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Elstern und Häher, die Meisen und Reiher, die ich für ihre Federn und ihren Flug, ihre Lieder und ihre Rufe so sehr bewunderte, über mentale Fähigkeiten verfügten, die denen meiner Primatenverwandtschaft entsprechen – oder sie sogar übertreffen.
Wie können Geschöpfe mit einem nussgroßen Gehirn solche raffinierten mentalen Meisterstücke vollbringen? Was hat ihre Intelligenz geformt? Ist sie wie unsere Intelligenz beschaffen, oder unterscheidet sie sich von ihr? Was haben uns ihre kleinen Gehirne über unsere großen zu erzählen, falls sie überhaupt etwas dazu zu sagen haben?
Intelligenz ist ein schwammiger Begriff und selbst für unsere eigene Gattung weder einfach zu definieren noch einfach zu messen. Für den einen Psychologen ist es «die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen oder zu profitieren». Für den anderen «die Fähigkeit, Fähigkeiten zu erwerben» – eine Definition, die ebenso zirkulär ist wie die des Harvard-Psychologen Edwin Boring: «Intelligenz ist das, was mit Intelligenztests gemessen wird». Wie Robert Sternberg, ein ehemaliger Dekan an der Tufts University einmal spöttelte: «Es scheint ebenso viele Definitionen von Intelligenz zu geben wie […] Experten, die gebeten wurden, sie zu definieren.»
Wenn es generell um die Beurteilung der Intelligenz von Tieren geht, sollten Wissenschaftler vielleicht darauf schauen, wie erfolgreich sie in vielen unterschiedlichen Umgebungen überleben und sich reproduzieren. Und nach diesen Kriterien übertrumpfen Vögel nahezu sämtliche anderen Wirbeltiere, eingeschlossen Fische, Amphibien, Reptilien und Säugetiere. Sie sind die einzigen wild lebenden Tiere, die fast überall anzutreffen sind. Sie leben in sämtlichen Teilen des Globus, vom Äquator bis zu den Polen, in den am tiefsten gelegenen Wüsten ebenso wie auf den höchsten Gipfeln, praktisch in jedem Habitat – Land, Meer und Süßwasser. In biologischen Begriffen: Sie besetzen eine sehr große ökologische Nische.
Als Klasse gibt es Vögel schon seit mehr als 100 Millionen Jahren. Sie stellen eine der großen Erfolgsgeschichten der Natur dar, indem sie immer neue Strategien des Überlebens, ihre eigenen charakteristischen Formen von Einfallsreichtum erfinden, die, zumindest in mancher Hinsicht, die unsrigen zu übertreffen scheinen.
Irgendwo im Dunkel der Zeit lebte einst der Urvogel, der gemeinsame Vorfahr aller Vögel, vom Kolibri bis zum Reiher. Heute gibt es etwa 10400 verschiedene Vogelarten – mehr als doppelt so viele wie Säugetierarten: Triele und Kiebitze, Kakapos und Milane, Nashornvögel und Schuhschnäbel, Chukarsteinhühner und Chacalakas. Als Wissenschaftler in den späten 1990ern die Gesamtzahl der wilden Vögel auf dem Planeten schätzten, kamen sie auf 200 bis 400 Milliarden einzelne Vögel. Das sind etwa 30 bis 60 lebende Vögel pro Person. Die Behauptung, Menschen seien erfolgreicher oder höher entwickelt, hängt entschieden davon ab, wie man diese Begriffe definiert. Denn schließlich geht es in der Evolution nicht um Höherentwicklung, es geht ums Überleben. Es geht darum, dass man lernt, die Probleme, die einem die Umwelt stellt, zu lösen, etwas, worauf Vögel sich seit sehr, sehr langer Zeit ganz hervorragend verstehen. Weshalb ich es umso überraschender finde, dass viele von uns – selbst die, die sie lieben – sich so schwer damit tun, den Gedanken zu schlucken, dass Vögel vielleicht auf eine Weise schlau sind, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Vielleicht weil sie so anders als Menschen sind, finden wir es schwierig, ihre mentalen Fähigkeiten wirklich zu würdigen. Vögel sind Dinosaurier; sie stammen von den wenigen glücklichen Anpassungsfähigen ab, die die Katastrophen – welche auch immer – überlebt haben, an denen ihre Cousins und Cousinen zugrunde gingen. Wir sind Säugetiere und verwandt mit den furchtsamen, winzigen, spitzmausähnlichen Geschöpfen, die erst dann im Schatten der Dinosaurier auftauchten, als die meisten dieser Tiere schon ausgestorben waren. Und während unsere Säugetierverwandten immer größer wurden, wurden die Vögel im Verlauf desselben Prozesses natürlicher Auslese immer kleiner. Während wir lernten, uns aufzurichten und auf zwei Beinen zu gehen, perfektionierten sie Leichtigkeit und Flug. Während unsere Neuronen sich zu Rindenschichten gruppierten, um komplexes Verhalten zu erzeugen, entwickelten die Vögel eine vollkommen andere neuronale Architektur; sie unterscheidet sich zwar von der der Säugetiere, ist aber – zumindest in mancher Hinsicht – ebenso raffiniert. Genauso wie wir haben sie herauszufinden versucht, wie die Welt funktioniert; und gleichzeitig war die Evolution mit dem Ausbau und der Feinanpassung ihrer Gehirne beschäftigt und stattete ihren Verstand mit jener enormen Leistungsstärke aus, die sie heute besitzen.
Vögel lernen. Sie lösen neue Probleme und erfinden originelle Lösungen für alte. Sie stellen Werkzeug her und benutzen es. Sie zählen. Sie imitieren das Verhalten anderer. Sie erinnern sich, wo sie Dinge abgelegt haben.
Auch wenn ihre mentale Leistung nicht ganz unserem komplexen Denken entspricht, so enthält sie doch Ansätze dazu – zum Beispiel so etwas wie Einsicht, eine unserer kostbarsten kognitiven Fähigkeiten, die man als das plötzliche Auftauchen einer Lösung ohne langes vorheriges Herumprobieren definiert hat. Häufig bedeutet das ein mentales Simulieren des Problems mit einem plötzlichen «Aha»-Moment, wenn die Lösung sich als blitzartige Erkenntnis meldet. Ob Vögel tatsächlich über Einsicht verfügen, ist noch nicht entschieden, aber bestimmte Arten scheinen das Prinzip von Ursache und Wirkung zu verstehen – einen der Grundbausteine von Einsicht. Dasselbe gilt für die «native Theorie», d.h. das differenzierte Verständnis für etwas, das ein anderes Individuum weiß oder denkt. Ob Vögel diese Fähigkeit in vollem Umfang besitzen, ist umstritten, aber Mitglieder bestimmter Arten scheinen in der Lage zu sein, die Perspektive eines anderen Vogels einzunehmen oder zu spüren, was er braucht – beides notwendige Bestandteile der nativen Theorie. Einige Wissenschaftler halten diese Grundbausteine für das Kennzeichen von Wahrnehmung überhaupt und glauben, dass sie möglicherweise die Vorläufer solch hochkomplexer menschlicher Fähigkeiten wie Schlussfolgern und Planen, Empathie und Einsicht sowie Metakognition sind, wobei Letzteres das Wissen um die eigenen kognitiven Prozesse meint.
Natürlich sind all das menschliche Maßstäbe für Intelligenz. Wir können nicht umhin, den Verstand von anderen an unserem zu messen. Aber Vögel besitzen auch Möglichkeiten, Wissen zu erwerben, von denen wir nichts ahnen und die wir nicht einfach als instinkthaft oder vorprogrammiert abtun können.
Welche Art von Intelligenz erlaubt es einem Vogel, ein fernes Unwetter vorauszuahnen? Oder den Weg zu einem Ort zu finden, an dem er noch nie war und der vielleicht viele tausend Meilen entfernt ist? Oder die komplexen Gesänge Hunderter anderer Arten zu imitieren? Oder Zigtausende Körner auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmeilen zu verstecken und sechs Monate später noch zu wissen, wo? (Ich würde bei dieser Art von Aufgaben genauso sicher versagen, wie Vögel vermutlich an den meinen scheitern würden.)
Vielleicht ist Genie das bessere Wort. Der Begriff, der dieselbe Wurzel wie Gen hat, leitet sich her von dem lateinischen Wort genius und bedeutete ursprünglich «persönlicher Schutzgott, der von Geburt an da ist; angeborene Fähigkeit oder Neigung». Später meinte genius dann angeborene Fähigkeit, schließlich (dank Joseph Addisons Essay «Genie» von 1711) außergewöhnliches Talent, sei es angeboren oder erworben.
Erst neuerdings ist Genie auch als die Fähigkeit definiert worden, «etwas einfach gut tun zu können, was andere nur schlecht tun können», und beschreibt ein mentales Talent, das außergewöhnlich ist, verglichen mit dem, was andere der eigenen oder einer fremden Spezies können. Tauben sind geniale Navigatoren und uns darin bei weitem überlegen. Spottdrosseln können unendlich viel mehr Lieder lernen und behalten als die meisten anderen Singvogelarten. Buschhäher und Tannenhäher haben ein Gedächtnis für ihre Verstecke, neben dem unseres alt aussieht.
In diesem Buch verstehe ich unter Genie die Gabe, zu wissen, was man tut – seine Umgebung «zu kapieren», Dinge zu erfassen und herauszufinden, wie man seine Probleme löst. Mit anderen Worten, es ist das Vermögen, den Herausforderungen der Gesellschaft und der Umwelt scharfsinnig und geschmeidig zu begegnen; und darüber scheinen Vögel in reichlichem Maße zu verfügen. Häufig gehört dazu auch das Talent, etwas Neues, Innovatives zu tun – zum Beispiel den Vorteil neuer Nahrungsquellen zu nutzen oder zu lernen, sie auszuschöpfen. Das klassische Beispiel dafür lieferten vor Jahren Meisen in Großbritannien. Kohlmeisen ebenso wie Blaumeisen kriegten den Dreh raus, wie man die Pappverschlüsse von Milchflaschen öffnet, die morgens an die Haustüren geliefert wurden. Es ging darum, an die fette Sahne oben in der Flasche zu kommen. (Vögel können die Kohlenhydrate in Milch nicht verdauen, nur die Lipide.) Die Meisen lernten den Trick zuerst 1921 in der Stadt Swaythling; 1949 wurde dieses Verhalten dann schon an vielen hundert Orten in England, Wales und Irland beobachtet. Offensichtlich hatte die Technik sich dadurch verbreitet, dass ein Vogel sie beim anderen abguckte – eine beeindruckende Demonstration sozialen Lernens.
Das «Spatzenhirn» hatte sich endlich für seinen verunglimpfenden Gebrauch gerächt. Das heißt, die angeblich zentralen Unterscheidungsmerkmale zwischen Vögeln und unseren nächsten Primatenverwandten – Werkzeugbau, Kultur, die Fähigkeit, zu schlussfolgern, sich an die Vergangenheit zu erinnern und an die Zukunft zu denken, die Fähigkeit, den Blickwinkel eines anderen einzunehmen sowie voneinander zu lernen – scheinen sich, eines nach dem anderen, in Luft aufzulösen. Viele unserer hochgeschätzten Formen von Intelligenz scheinen sich – entweder teilweise oder im Ganzen – bei den Vögeln ziemlich unabhängig und sehr raffiniert direkt neben den unsrigen entwickelt zu haben.
Wie kann das sein? Wie können Geschöpfe, die evolutionär seit 300 Millionen Jahren voneinander getrennt sind, ähnliche kognitive Strategien, Talente und Fähigkeiten entwickeln?
Zuerst einmal verbindet uns biologisch mehr mit Vögeln, als man glauben möchte. Die Natur ist eine Meisterin der Improvisation, sie hält an biologischen Details fest, die sich als nützlich erwiesen haben, und passt sie neuen Zwecken an. Vieles, was uns heute von anderen Geschöpfen trennt, ist nicht durch die Bildung neuer Gene oder Zellen, sondern durch leiseste Verschiebungen im Gebrauch der schon existierenden entstanden. Diese gemeinsame biologische Grundlage macht es möglich, dass wir andere Organismen als Modelle benutzen können, um unser eigenes Gehirn und unser eigenes Verhalten zu verstehen – dass wir, zum Beispiel, den Vorgang des Lernens an der riesigen Meeresschnecke Aplysia studieren, das Phänomen der Angst an Zebrafischen und das der Zwangsstörung an Border Collies.
Auch den Herausforderungen der Natur begegnen wir auf ähnliche Weise wie Vögel, selbst wenn wir sie auf unterschiedlichen evolutionären Wegen erworben haben. So etwas nennt sich konvergente Evolution, und in der Natur ist sie überall zu finden. Die übereinstimmende Form der Flügel bei Vögeln, Fledermäusen und jenen Reptilien, die Flugsaurier genannt wurden, ist ein Resultat der Probleme, die sich beim Fliegen stellten. Tiere, die am Baum des Lebens so weit voneinander entfernt sind wie Bartenwale und Flamingos, entwickelten, vor die Aufgabe gestellt, ihre Nahrung aus dem Wasser herauszufiltern, erstaunliche Ähnlichkeiten in Verhalten, Körpergestalt (große Zungen und behaartes Gewebe, genannt Lamellen) und sogar in der Körperausrichtung. Wie der Evolutionsbiologe John Endler hervorhebt: «Immer wieder registrieren wir bei absolut nicht verwandten Gruppen vielerlei Übereinstimmungen in Form, Erscheinung, Anatomie, Verhalten und anderen Aspekten. Warum also nicht auch im Denkvermögen?»
Dass sowohl Menschen als auch bestimmte Vogelarten ein für ihr Körpergewicht großes Gehirn haben, weist mit ziemlicher Sicherheit auf konvergente Evolution hin. Ebenso die Entwicklung derselben Muster von Hirnaktivität im Schlaf. Wie auch die Entwicklung analoger Gehirnschaltkreise und -abläufe beim Erlernen von Singen und Sprechen. Darwin sah im Vogelgesang «die nächste Analogie mit der Sprache». Er hatte recht. Die Parallelen sind unheimlich. Besonders wenn man den evolutionären Abstand zwischen Menschen und Vögeln bedenkt. Eine Gruppe von 200 Wissenschaftlern aus 80 verschiedenen Laboren ermöglichte uns vor gar nicht langer Zeit einen Blick auf diese Parallelen. Die Forscher sequenzierten die Genome von 84 Vögeln, und die 2014 veröffentlichten Resultate verrieten eine verblüffend ähnliche Genaktivität in den Gehirnen von Menschen, die sprechen lernen, und denen von Vögeln, die singen lernen. Das gibt zu der Vermutung Anlass, dass es eine Art Genexpressions-Grundmuster fürs Lernen geben könnte, das bei Vögeln und Menschen gleich ist und sich in konvergenter Evolution entwickelt hat.
Aus alledem ergibt sich, dass sich am Modell von Vögeln ganz hervorragend studieren lässt, wie unser eigenes Gehirn lernt und sich erinnert, wie wir Menschen Sprache erschaffen, welche mentalen Prozesse unserem Problemlösungsverhalten zugrunde liegen und wie wir uns im Raum und in sozialen Gruppierungen positionieren. Die Schaltkreise im Vogelgehirn, die das soziale Verhalten kontrollieren, sind, wie sich herausstellt, den Schaltkreisen in unserem Gehirn sehr ähnlich, sie werden von ähnlichen Genen und biochemischen Stoffen betrieben. Indem wir die neurochemischen Grundlagen des sozialen Verhaltens von Vögeln untersuchen, können wir etwas über die unseres eigenen Sozialverhaltens lernen. Auf die gleiche Weise können wir, wenn wir begreifen, was in einem Vogelhirn beim Erlernen einer Melodie vor sich geht, auch den menschlichen Spracherwerb besser ergründen, können begreifen, wie unser Gehirn Sprache erlernt, warum es mit zunehmendem Alter schwerer ist, eine neue Sprache zu erwerben, und vielleicht sogar, wie Sprache sich überhaupt entwickelt hat. Wenn wir begreifen, wieso zwei Wesen, die nur entfernt miteinander verwandt sind, im Schlaf das gleiche Muster von Gehirnaktivität aufweisen, können wir vielleicht sogar eines der größten Geheimnisse der Natur lösen – wozu Schlaf gut ist.
In diesem Buch versuche ich, nicht nur die verschiedenen Formen von Genie zu verstehen, die Vögel so erfolgreich gemacht haben, sondern auch, wie diese entstanden sind. Es ist eine Art Reise, die ebenso in die Ferne führt, bis nach Barbados und Borneo, wie in die nächste Nähe, in meinen eigenen Garten. (Man muss nicht an exotische Orte fahren oder exotische Arten untersuchen, um auf die Intelligenz von Vögeln zu stoßen. Sie findet sich überall, direkt bei Ihnen, an Ihren Vogelfutterstellen, im Park in Ihrer Nähe, auf städtischen Straßen und am ländlichen Himmel.) Das Buch ist auch eine Reise in das Gehirn von Vögeln, bis tief in die Zellen und Moleküle, die ihr Denken antreiben und manchmal auch unseres.
In jedem Kapitel wird eine Geschichte von Vögeln mit außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Talenten erzählt – technischen, sozialen, musikalischen, künstlerischen, räumlichen, erfinderischen und solchen des Anpassungsgeschicks. Mitglieder der äußerst gewitzten Rabenvogel- und Papageienfamilien werden auf diesen Seiten immer wieder auftauchen, aber auch der Spatz und der Fink, die Taube und die Meise. Mich interessieren die Durchschnittsbewohner der Vogelwelt ebenso wie die Einsteins. Natürlich hätte ich mir auch andere Arten aussuchen können als meine Stars, aber ich habe mich aus einem einfachen Grund für sie entschieden: Sie können großartige Geschichten erzählen – Geschichten, die veranschaulichen, was möglicherweise im Verstand eines Vogels vor sich geht, wenn er die Probleme löst, die ihm seine Umwelt stellt; und vielleicht können diese Geschichten uns auch eine Perspektive auf das eröffnen, was in unserem eigenen Verstand vor sich geht. All diese Vögel erweitern unsere Vorstellung davon, was es heißt, intelligent zu sein.
Das abschließende Kapitel konzentriert sich auf die brillante Anpassungsfähigkeit bestimmter Vögel. Nur relativ wenige verfügen über dieses Genie. Veränderungen in der Umwelt – besonders solche, die von Menschen verursacht wurden – bringen das Leben vieler Vögel völlig aus dem Lot und stellen ihr erlerntes Wissen in Frage. In einem jüngst veröffentlichten Bericht der Audubon Society ist zu lesen, dass die Hälfte der nordamerikanischen Vogelarten – von der Schwarzkehl-Nachtschwalbe bis zum Weißschwanzaar, vom Eistaucher bis zur Löffelente, vom Flötenregenpfeifer bis zum Felsengebirgshuhn – vermutlich in etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben sein werden, und zwar aus einem einzigen Grund: Sie sind nicht in der Lage, sich an das schnelle Tempo menschengemachter Veränderungen auf unserem Planeten anzupassen. Welche Vögel werden überleben und warum? Auf welche Weise sind wir Menschen eine evolutionäre Macht, die nur bestimmte Arten von Vögeln und Vogelintelligenz überleben lässt?
Wissenschaftler nähern sich diesen Rätseln aus den verschiedensten Blickwinkeln. Einige heben den Deckel vom Vogelhirn und benutzen moderne Techniken, um zu sehen, was in den neuronalen Schaltkreisen passiert, wenn ein Vogel ein menschliches Gesicht wiedererkennt, oder um bestimmte Gehirnzellen zu beobachten, während ein Singvogel ein Lied lernt, oder aber um die Neurochemie von sehr geselligen Vögeln mit der von Einzelgängern zu vergleichen. Andere sequenzieren und vergleichen das Genom verschiedener Vögel, um die Gene herauszufiltern, die für komplexes Verhalten, wie etwa das Lernen, zuständig sind. Wieder andere befestigen winzige sogenannte Geolokatoren am Rücken von Zugvögeln, um ihre Reisen und ihre inneren Landkarten zu erforschen. Sie überwachen, markieren, messen und beobachten unermüdlich, bereiten sorgfältig und sehr ausführlich Experimente vor, von denen einige schließlich scheitern und neu geplant werden müssen, weil ihr Untersuchungsgegenstand entweder zu argwöhnisch oder zu widerspenstig ist. Kurzum, diese Wissenschaftler untersuchen das Gehirn und das Verhalten von Vögeln auf ungewöhnliche, komplizierte und manchmal sogar heroische Weise.
Doch in diesem Buch sind die Vögel selbst die eigentlichen Helden ihrer Geschichten. Und ich hoffe, dass Ihnen die Meise und die Krähe, die Spottdrossel und der Spatz nach der Lektüre dieser Seiten ein wenig anders erscheinen werden. Nämlich als die gewitzten Mitbewohner der Erde, die sie sind – unternehmungslustige, erfinderische, verspielte, durchtriebene Wesen, die einander mit «Akzent» vorsingen, komplexe navigatorische Entscheidungen treffen, ohne nach der Richtung zu fragen, sich mit Hilfe von Landmarken und Geometrie erinnern, wo sie etwas hingetan haben, Geld stehlen, Nahrung stehlen und die innere Befindlichkeit eines anderen Wesens verstehen können.
Es gibt offensichtlich mehr als nur einen Weg zu einem klugen Gehirn.
Eins
Vom Dodo zur Krähe
Ein Vogelhirn wird vermessen
Der Wald ist kühl, dunkel und, bis auf gelegentliche Vogelrufe aus dem dichten Laubdach hoch oben, ein Teppich aus Farbschattierungen von Smaragd- und Avocadogrün bis zum Grün von Flechten und einem dunklen, fast kupfern schillernden Grün. Das ist der typische Gebirgsregenwald von Neukaledonien, einem entlegenen Landfinger im südwestlichen Pazifik, auf halbem Weg zwischen Australien und den Fidschiinseln. Der Parc des Grandes Fougères ist nach dem gigantischen Baumfarn benannt, der bis zu sieben Stockwerke hoch wird und diesem Wald eine wahrhaft urzeitliche Aura verleiht. Der Pfad, dem ich folge, steigt eine Weile an und fällt dann wieder ab zu einem Fluss, wo die Rufe und Lieder der Vögel lauter werden.
Ich bin auf diese Insel gereist, um den wohl schlauesten Vogel der Welt zu sehen, die Geradschnabelkrähe (Corvus moneduloides), ein Mitglied der recht gewöhnlichen, aber ungewöhnlich intelligenten Familie der Rabenvögel. Diese Vogelgattung wurde zunächst durch Betty berühmt, jene Krähe, die vor einigen Jahren anscheinend spontan ein Stück Draht zu einem Haken bog, um an schwer zugängliches Fressen zu kommen. Und dann, vor kürzerem, durch einen Schlauberger von Vogel, der den Spitznamen «007» bekam und 2014 zum Star wurde, nachdem seine schnelle Lösung einer komplizierten Denkaufgabe von der BBC gefilmt worden war.
Die Aufgabe, die aus acht separaten Stufen bestand, wurde von Alex Taylor konstruiert, einem Hochschuldozenten an der Universität von Auckland in Neuseeland. Verschiedene kleine Kästen und «Werkzeugkisten» mit Stöcken und Steinen waren auf einem Tisch aufgebaut. Die einzelnen Teile des Rätsels kannte Vogel 007 schon, aber nicht in dieser speziellen Zusammenstellung. Um an das Stück Fleisch in der letzten Kammer, dem Futterkasten, zu kommen, musste er die Lösungsschritte nacheinander in der richtigen Reihenfolge vornehmen.
In dem Video fliegt ein dunkler, hübscher (mit «007» passend benannter) Vogel ins Bild, landet auf dem Tisch und mustert erst einmal die Situation. Dann flattert er hoch zu einem Zweig, an dem eine Schnur mit einem unten daran festgebundenen Stock hängt – der erste Schritt. Er zieht die lange Schnur mit mehreren Schnabelgriffen zu sich hoch, bis er den Stock aus der Schlinge ziehen kann. Wieder auf dem Tisch, hüpft er zum Futterkasten und versucht, das Fleisch mit dem Stock durch das unten angebrachte Loch zu angeln. Doch der Stock ist zu kurz, worauf er ihn stattdessen dazu benutzt, um aus drei verschiedenen Kästen jeweils den darin befindlichen Stein zu fischen. Die Steine lässt er nacheinander durch ein Loch im Deckel einer Kiste fallen, in der auf einer Wippe ein langer Stock liegt. Mit dem Gewicht des dritten Steins kippt die Wippe in der Kiste und gibt den Stock frei, den der Vogel dann zur Futterkammer trägt, um das Fleisch herauszufischen.
Es ist ein erstaunlicher Vorgang, und der Vogel braucht ganze zweieinhalb Minuten dafür. Der wirklich clevere Teil dabei ist folgender: Für die achtstufige Denkaufgabe muss der Vogel begreifen, dass er ein Werkzeug nicht nur dafür benutzen kann, um direkt an die Nahrung zu kommen, sondern auch, um an ein weiteres Werkzeug zu kommen, mit dessen Hilfe er schließlich ans Ziel gelangt. Dass eine Kreatur sich mit einem Werkzeug spontan einen Gegenstand besorgt, der nicht Nahrung ist, sondern dafür gedacht, an ein anderes Werkzeug zu kommen – ein sogenannter Metawerkzeuggebrauch –, kannte man bis dahin nur bei Menschen und Menschenaffen. «Das legt den Schluss nahe, dass Krähen ein abstraktes Verständnis davon haben, was ein Werkzeug tut», sagt Taylor. Außerdem erfordert die Aufgabe ein aktives Gedächtnis (Arbeitsgedächtnis), d.h. die Fähigkeit, Fakten oder Gedanken zu behalten und sie für kurze Zeit – vielleicht ein paar Sekunden lang – hin und her zu bewegen, während man ein Problem löst. Bei uns Menschen sorgt das Arbeitsgedächtnis dafür, dass wir behalten, was wir gerade suchen, wenn wir zum Beispiel ein Bücherregal nach einem bestimmten Titel durchforsten oder eine Telefonnummer so lange behalten, bis wir einen Zettel zum Notieren gefunden haben. Es ist also ein unerlässlicher Bestandteil von Intelligenz; und Krähe 007 scheint darüber in hohem Maße zu verfügen.
Irgendwo am Flusslauf höre ich schließlich das Wak Wak einer Geradschnabelkrähe oder von zweien, die einander rufen – es klingt nicht viel anders als das Krah Krah einer Amerikanerkrähe, nur eben verkehrt herum. Sehr häufig begegnet man Vögeln auf diese Weise als körperlosen Stimmen. Das leise, klagende Huh Huh in der Ferne könnte das kleine grüne Nebelhorn einer Spaltschwingentaube sein, eines exotischen Harlekins von Vogel mit weißen und dunkelgrünen Schmuckbändern über Rumpf und Flügeln. Aber das Baumkronendach ist so dicht, dass ich überhaupt keine Vögel entdecken kann.
Vor mir taucht eine Lichtung auf. Aber die Sonne verschwindet hinter einer Wolke, und der Wald wird dunkel. Plötzlich höre ich ein eigentümlich fauchendes Zischen. Ich blicke angestrengt zur Lichtung. Das Zischen kommt näher. Dann sehe ich, wie ein großer, bleicher Vogel aus der grünen Finsternis wie ein vom Erdboden losgelöster Geist auf mich zurennt, ein Mischwesen aus Vogel und Gespenst. Er ist reiherähnlich, kniehoch, mit einem Kakadukamm, aber rauchgrau: der flugunfähige Kagu (Rhynochetos jubatus), alleiniger Repräsentant seiner Familie und einer der hundert seltensten Vögel auf der Erde.
Eigentlich hatte ich nach einem auf dieser Insel weit verbreiteten, höchst cleveren Vogel Ausschau gehalten. Und nun stolperte ich über einen absolut seltenen Vogel, einen, der … im Grunde … gar nicht da sein dürfte. Der Kagu steht kurz vorm Aussterben; die Population umfasst nur noch ein paar hundert Exemplare. Kein Wunder, dachte ich. Ein Vogel, der seinem möglichen Jäger in die Arme läuft?
In gewisser Weise ist der Kagu so etwas wie das Gegenstück zur Krähe, ein Abgesandter vom dunklen Ende des Intelligenzspektrums. Wie kann dieses Geschöpf zur selben phylogenetischen Klasse gehören wie die gerissene Krähe? Beide Vögel bewohnen dieselbe abgelegene Insel. Sind die Geradschnabelkrähen eine evolutionäre Anomalie, superintelligente Abweichler, die sich extrem weit von ihren gefiederten Artgenossen entfernt haben? Oder befinden sie sich schlicht am oberen Ende des Genie-Kontinuums der Vögel? Aber ist denn der Kagu wirklich solch ein Dodo?
Natürlich sind nicht alle Vögel gleich klug und in jeder Hinsicht gleich geschickt – zumindest nicht aus heutiger Sicht. Tauben können zum Beispiel nicht abstrahieren, wenn es darum geht, auf eine Reihe ähnlich gelagerter Probleme dieselbe generelle Regel anzuwenden, was Krähen leicht erlernen. Aber die in diesen Belangen unbedarfte Taube ist in anderer Hinsicht durchaus ein Schlaumeier: Sie kann Hunderte verschiedener Objekte über einen langen Zeitraum hinweg im Gedächtnis behalten, zwischen verschiedenen Malstilen unterscheiden und den Weg nach Hause finden, auch wenn sie meilenweit vom heimischen Territorium entfernt ausgesetzt wurde. Watvögel wie Regenpfeifer, Sanderlinge und Wasserläufer scheinen nicht über «Einsichtsfähigkeit» zu verfügen, erkennen also keine Zusammenhänge, die es Vögeln wie der Geradschnabelkrähe erlauben, Werkzeug zu benutzen oder mit menschengemachten Vorrichtungen so umzugehen, dass ihr Einfallsreichtum durch Futter belohnt wird. Aber einer der Watvögel, der Flötenregenpfeifer (oder Gelbfuß-Regenpfeifer) ist ein meisterhafter Komödiant: Er kann Räuber von seinem sehr exponierten Nest mit der Aufführung eines vorgetäuschten «gebrochenen Flügels» weglocken.
Was macht einen Vogel schlauer als einen anderen? Wie messen wir überhaupt die Intelligenz von Vögeln?
Um diese Fragen zu ergründen, habe ich mich an einen Ort begeben, der eine halbe Weltreise entfernt von Neukaledonien liegt: die karibische Insel Barbados, wo Louis Lefebvre vor mehr als einem Jahrzehnt die erste Intelligenzskala für Vögel erfand.
Lefebvre, Biologe und Psychologe an der McGill University, erforscht seit Jahren die Beschaffenheit des Vogelverstands und wie man ihn messen kann. Eines Winters vor noch gar nicht langer Zeit suchte ich ihn und seine Vögel im Bellairs Research Institute auf, wo er seine Untersuchungen durchführt; es handelt sich dabei um eine Ansammlung von vier kleinen Gebäuden in der Nähe von Holetown an der Westküste von Barbados. Das kleine Institut wurde der McGill University 1954 von Commander Carlyon Bellairs vermacht, einem britischen Marineoffizier und Politiker; gedacht war es ursprünglich als Station für Meeresforschung. Inzwischen benutzen außer Lefebvre und seinem Team nur noch wenige Forscher das Institut. Ich kam im Februar, mitten in der Trockenzeit von Barbados; doch häufige monsunartige Regengüsse setzten den Hof des Instituts unter Wasser, und es bildeten sich Pfützen in den Kuhlen und Vertiefungen auf der Terrasse in Seabourne, dem Wohngebäude direkt an der karibischen See, wo Lefebvre untergebracht ist, wenn er seine Forschungen betreibt.
Lefebvre, etwas über sechzig, mit einem unbeschwerten Lächeln und einem lockigen, grau-schwarzen Haarschopf, hat unter dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins gelernt. Anfangs befasste er sich mit der Körperpflege bei Tieren, einem angeborenen, «programmierten» Verhalten; jetzt versucht er, das komplexere Verhalten von Vögeln zu verstehen – wie sie denken, lernen und Neues erfinden –, und als Forschungsgegenstände wählt er die unspektakulären Vogelarten seines Gartens auf Barbados.
Anders als Neukaledonien ist Barbados nicht gerade ein Ort, an dem man seine persönliche Artenliste auffüllen kann. Verglichen mit der üppigen Vielfalt in den meisten tropischen Gebieten ist die Insel enttäuschend. Sie ist gekennzeichnet durch eine entschieden «pauperisierte Avifauna», wie die Experten sagen, und beherbergt nur dreißig einheimische brütende Arten und sieben eingewanderte Arten. Das liegt zum Teil an ihrer physikalischen Beschaffenheit. Barbados, eine winzige, nicht sehr hohe Anhäufung aus jungem Korallenkalk östlich der Hauptkette der Kleinen Antillen, ist zu flach für Regenwald und zu porös für Bäche und Sumpfland. Dazu kommt, dass das Buschland und die natürlichen Felder und Wälder in den letzten ein, zwei Jahrhunderten mit Zuckerrohr bepflanzt wurden. Heute wuchern dort Städte und touristische Einrichtungen. Und aus den offenen Fenstern der bunt bemalten Busse, die zwischen Strand und Hotels hin und her fahren, dröhnt Calypsomusik. Hier überleben nur noch solche Vogelarten, die sich von der Überhandnahme menschlichen Lebens nicht verdrängen lassen, sondern sie eher zu nutzen wissen. Für Vogelbeobachter, die scharf auf seltene Arten wie den Kagu sind, ist Barbados Wüste. Aber wenn Sie Lust haben zuzusehen, wie Vögel schlaue, betörende Sachen machen, ist die Insel ein Paradies.
«Da die Vögel hier so zahm sind, ist es einfach, Experimente vorzunehmen», sagt Lefebvre. So ist zum Beispiel die große Steinterrasse direkt vor seiner Wohnung eine Art Gelegenheitslabor, auf der Liebestauben – die Tauben von Barbados – und Trauergrackeln herumlungern und darauf warten, dass etwas passiert. Die Grackeln (Quiscalus lugubris) sind glänzend schwarz mit leuchtend gelben Augen, dabei kleiner als die amerikanischen Bootschwanzgrackeln und kompakter. Sie wissen, dass Lefebvre der «Pellet- und Wasser-Typ» ist, wie er es nennt, und schreiten wie ungeduldige Kleriker auf der Terrasse auf und ab, in Erwartung, dass er liefert. Er gießt etwas Wasser in eine Vertiefung der Terrasse, sodass sich ein kleiner See bildet, und verstreut einige sehr kompakte Kügelchen Hundefutter auf dem trockenen Terrassenbereich. Die Grackeln schnappen sich mit dem Schnabel ein Futter-Pellet, spazieren damit zu der Pfütze, tauchen es feierlich ganz sachte ins Wasser, nehmen es wieder auf, flattern hoch und verspeisen das aufgeweichte Futter.
Mehr als fünfundzwanzig frei lebende Vogelarten tunken ihr Fressen aus dem einen oder anderen Grund in Wasser – um Schmutz oder giftige Teile abzuspülen, um Hartes oder Trockenes aufzuweichen oder um den Pelz oder die Federn von schwer zu schluckender Beute geschmeidig zu machen (so wie die Salvadorikrähe, die beobachtet wurde, wie sie einen Spatzen ins Wasser tauchte). «Das ist Proto-Werkzeuggebrauch, eine Art von Lebensmittelzubereitung», erklärt Lefebvre. Das Eintauchen macht den Brocken leichter essbar. «Einmal habe ich die Pellets vorher eingeweicht, prompt haben sie diese nicht mehr eingetunkt. Sie sind damit zwar zur Pfütze spaziert, aber ohne sie einzutauchen. Sie wissen also, was sie tun.»
Bei Trauergrackeln ist das Eintunken relativ selten, da es riskant ist. «Unsere Studien zeigen, dass 80 bis 90 Prozent dieser Grackeln die Fähigkeit beherrschen, diese aber nur anwenden, wenn die Umstände danach sind», sagt Lefebvre, «das heißt, wenn die Qualität des Futters und die sozialen Bedingungen stimmen und wenn niemand in der Nähe ist, der ihnen die Nahrung streitig macht oder stehlen will.» Je länger sie mit dem Futter herumhantieren, desto größer wird die Gefahr des Diebstahls durch schnorrende oder stibitzende andere Grackeln. «Diebstahl ist die große Gefahr beim Eintunken», erklärt er. Bis zu 15 Prozent der Futterbeute wird von Konkurrenten gestohlen. «Es existiert so etwas wie ein Kosten/Nutzen-Verhältnis, und die Vögel sind schlau genug, um entscheiden zu können, wann es sich lohnt.» Das sieht tatsächlich in jeder Hinsicht nach intelligentem Verhalten aus.
Wegen seiner menschlichen Konnotationen benutzen Tierforscher nur ungern den Begriff Intelligenz, erläutert Lefebvre mir weiter. In seiner Naturgeschichte der Tiere schreibt Aristoteles, dass Tiere Elemente unserer «menschlichen Eigenschaften und Einstellungen» besitzen, wie etwa «Grimmigkeit, Milde oder Ärger, Mut oder Zaghaftigkeit, Furcht oder Zuversicht, Munterkeit oder Durchtriebenheit und, was die Intelligenz angeht, etwas, das dem Scharfsinn nahekommt». Sobald Sie aber heutzutage zu behaupten wagen, ein Vogel besitze so etwas Menschliches wie Intelligenz und Bewusstsein oder die Fähigkeit zu fühlen, kann Ihnen schnell vorgeworfen werden, Sie würden anthropomorphisieren und das Verhalten von Vögeln so interpretieren, als seien sie Menschen im Federkleid. Es ist durchaus natürlich, dass wir Menschen unsere eigenen Erfahrungen auf andere Geschöpfe projizieren, doch es kann in die Irre führen – und tut es auch. Vögel werden ebenso wie Menschen dem Reich Animalia, Stamm Chordata, Unterstamm Vertebrata zugeordnet. Dort endet jedoch die Gemeinsamkeit der Abstammung. Vögel bilden die Klasse Aves, wir die Klasse Mammalia. Und mit dieser Verzweigung beginnt dann der gewaltige biologische Unterschied.
Aber wäre es nicht ein Fehler zu glauben, es gebe zwischen den mentalen Fähigkeiten von Vögeln und jenen von uns Menschen deshalb keine Gemeinsamkeiten, weil Vögel und ihr Gehirn fundamental anders beschaffen sind? Wir nennen unsere Spezies Homo sapiens, die wissende Spezies, um uns vom Rest alles Lebendigen zu unterscheiden. Darwin behauptete allerdings in Die Abstammung des Menschen, Tiere und Menschen unterschieden sich in ihren mentalen Möglichkeiten nur graduell, nicht substanziell. Für Darwin beweisen sogar Regenwürmer «einen gewissen Grad von Intelligenz», wenn sie zum Beispiel ihre Erdhöhlen mit Kiefernnadeln und sonstigen Pflanzenresten verbarrikadieren, um sie gegen den sprichwörtlichen «frühen Vogel» zu schützen. So verführerisch es sein mag, das Verhalten von anderen Lebewesen mit Begriffen zu interpretieren, die menschliche mentale Prozesse beschreiben, noch verführerischer ist es vielleicht, die Möglichkeit einer Verwandtschaft gänzlich zu verwerfen. Letztere Reaktion nennt der Primatenforscher Frans de Waal auf Englisch «anthropodenial» und meint damit eine Blindheit für die menschenähnlichen Eigenschaften anderer Spezies. Solche Leugner, sagt de Waal, «versuchen eine Mauer zu errichten, die die Menschen vom Rest des Reichs der Tiere trennt».
«In jedem Fall», erklärt Lefebvre, «müssen Sie bei Ihrer Wortwahl aufpassen.» Und er weist auf zwei jüngst erschienene Studien hin, eine über die Empathie bei Mäusen, die andere über mentale Zeitreisen bei Vögeln, die beide viele Zweifel und hochgezogene Augenbrauen ernteten. «Ich stelle nicht die Experimente in Frage – sie sind solide und anthropomorphisieren nicht», erläutert er. «Aber vielleicht gehen wir bei der Beschreibung dessen, was da unserer Meinung nach vor sich geht, mit den Begrifflichkeiten zu weit.»
Ebenso wie Lefebvre benutzen die meisten Wissenschaftler, die sich mit Vögeln beschäftigen, lieber den Begriff Kognition als den Begriff Intelligenz. Kognition bei Tieren wird gemeinhin definiert als diejenigen Mechanismen, mittels derer ein Tier Informationen erwirbt, verarbeitet, aufbewahrt und benutzt. Und gewöhnlich sind all jene Mechanismen gemeint, die mit dem Lernen, dem Gedächtnis, der Wahrnehmung und dem Fällen von Entscheidungen zu tun haben. Dabei gibt es sogenannte höhere und niedrigere Formen der Kognition. Einsicht, Abwägen und Planen gehören zum Beispiel zu den höheren kognitiven Fähigkeiten. Niedrigere kognitive Fertigkeiten umfassen etwa Aufmerksamkeit und Motivation.
Weniger Konsens herrscht darüber, wie Kognition in einem Vogelhirn aussieht. Einige Wissenschaftler behaupten, Vögel besäßen verschiedene Typen von Kognition – etwa für Räumliches, Soziales, Technisches und Stimmliches –, die nicht immer alle notwendig vorhanden sein müssen. Ein Vogel kann zum Beispiel räumlich schlau sein, aber nicht sehr gut im Lösen sozialer Probleme. Nach dieser Auffassung ist das Gehirn also ein Bündel spezialisierter Prozessoren oder «Module» bzw. einzelner Zonen, die für einen bestimmten Zweck geeignet und ausgestattet sind – so gebe es beispielsweise einen Schaltkreis fürs Erlernen des Vogelgesangs oder fürs Navigieren durch den Raum. Die Information in einem Modul sei grundsätzlich «nicht zugänglich» für ein anderes Modul. Lefebvre dagegen plädiert für so etwas wie allgemeine Kognition – einen Allzweckprozessor ohne systematische Unterteilung, der Probleme in den verschiedensten Bereichen löst – und betont, dass ein Vogel, der in einem bestimmten kognitiven Messbereich einen hohen Rang einnehme, diesen meist auch in anderen Bereichen innehabe. «Wenn ein Tier Probleme löst», erklärt er, «sind wahrscheinlich verschiedene Gehirnzonen netzwerkartig daran beteiligt.»
Lefebvre hat den Eindruck, dass einige Forscher im modularen Feld sich allmählich seiner Ansicht annähern, denn die Ergebnisse verschiedener Studien lassen inzwischen erkennen, dass manche Vögel allgemeine kognitive Mechanismen benutzen, wenn sie verschieden geartete Probleme lösen. So scheint zum Beispiel die soziale Intelligenz bei manchen Vögeln unmittelbar mit dem räumlichen Gedächtnis oder dem episodischen Gedächtnis verknüpft zu sein – der Fähigkeit also, sich zu erinnern, was wann und wo passiert ist.
Im Bereich der menschlichen Intelligenz gibt es übrigens eine parallele Diskussion. Die meisten Psychologen und Neurowissenschaftler stimmen darin überein, dass es verschiedene Arten menschlicher Intelligenz gibt – die emotionale, analytische, räumliche, schöpferische und die praktische, um nur einige zu nennen. Aber sie streiten immer noch darüber, ob diese verschiedenen Typen unabhängig sind oder miteinander korrelieren. In seiner Theorie der «multiplen Intelligenzen» unterscheidet der Harvard-Psychologe Howard Gardner acht Intelligenztypen, die er für unabhängig voneinander erklärt. Es sind dies die körperliche, die sprachliche, die musikalische, die mathematische oder logische Intelligenz, dann die «naturalistische» (Empfänglichkeit für die Welt der Natur), die räumliche (wissen, wo man sich in Bezug auf einen festgelegten Ort befindet), die interpersonelle (sich im Einklang mit anderen fühlen und sein) und die innerpersonelle Intelligenz (Fähigkeit, die eigenen Emotionen und Gedanken zu verstehen und zu beherrschen) – eine Liste mit tatsächlich faszinierenden Parallelen in der Vogelwelt: Denken Sie nur an den akrobatischen Gebrauch, den der Kolibri von seinem eigenen Körper macht, an das verblüffende Talent des Fraserzaunkönigs für musikalische Duette oder daran, dass Tauben wissen, wo sie hinfliegen sollen.
Andere Wissenschaftler plädieren für so etwas wie eine allgemeine Intelligenz bei Menschen, die rundum clever sind, und nennen es den g-Faktor. Eine Gruppe von 52 Forschern, die sich vor einigen Jahren diesem Problem widmete, war sich einig: «Intelligenz ist eine sehr allgemeine Eigenschaft, die unter anderem folgende Fähigkeiten umfasst – zu schlussfolgern, zu planen, Probleme zu lösen, abstrakt zu denken, komplexe Gedanken zu verstehen, etwas schnell aufzufassen und aus der Erfahrung zu lernen.»
Wenn schon die Definition von Intelligenz bei Vögeln problematisch ist, dann ist deren Messung womöglich sogar noch schwieriger. «In Wahrheit steckt die Entwicklung einer Testreihe zur Messung von Vogelkognition noch in den Kinderschuhen», sagt Lefebvre. Es gebe keinen IQ-Standardtest für Vögel. Deshalb versuchen Wissenschaftler, Rätsel für Vögel zu entwickeln, die etwas über ihre kognitiven Fähigkeiten aussagen, und vergleichen dazu nicht nur das Vorgehen von Tieren verschiedener Arten, sondern auch von einzelnen Individuen derselben Art.
Ein unauffälliger kleiner brauner Vogel auf Barbados spielt bei Lefebvres neuesten Untersuchungen eine Schlüsselrolle. Während ich auf der hinteren Terrasse von Lefebvres Wohnung sitze, mir Notizen mache und zwischendurch aufs azurblaue Meer schaue, flitzen die kleinen braunen Vögel in den Ästen der Kasuarinen und Mahagonibäume in der Nähe herum. Dann schießen sie direkt hinunter auf das Terrassengeländer. Ich starre einen an, der eine Armeslänge entfernt von mir hockt. Er zappelt herum, legt den Kopf schief und starrt zurück.
Warum so interessiert?, scheint er zu fragen.
Weil du hier in der Gegend geradezu berüchtigt bist für deine schlaue Art zu klauen – und dafür, neue Nahrungsquellen zu entdecken.
Loxigilla barbadensis: Barbados-Gimpelfink. Diese Gimpel seien die Hausspatzen von Barbados, erklärt Lefebvre. Bevor in dem Gebäude Abschirmvorrichtungen installiert worden sind, die vor dem Denguefieber schützen sollen, seien die Gimpel durch seine offenen seeseitigen Fenster und Türen geflogen und hätten eine Verwüstung bei den Bananen auf der Küchenarbeitsplatte angerichtet oder seien mit Kuchen- und Brotbrocken abgezogen. Berühmt wurden sie jedoch, als sie in den Restaurants unten am karibischen Meeresstrand eine neue Nahrungsquelle entdeckten. Später zeigt Lefebvre mir den speziellen Trick der Vögel. In einer schmalen Gasse zwischen zwei ufernahen Clubs in Holetown steht eine Steinmauer, die eine Villa im palladianischen Stil gegen das Meer abschirmt. Lefebvre legt ein Zuckertütchen auf die Mauer und dann noch vier weitere. Es dauert nur Sekunden, bis ein Gimpel den Schatz findet. Er landet auf der Mauer und untersucht das kleine weiße Papierrechteck, dreht es auf die andere Seite, sucht offenbar nach Löchern, dann trägt er das Tütchen hoch auf einen nahegelegenen Ast. In 30 Sekunden hat er das Papier aufgepickt und nascht den Inhalt, kleine weiße Zuckerkristalle kleben an seinem winzigen Schnabel wie Milch am Mund eines Kindes. Es ist ein einzigartiges Talent, das die Handvoll anderer Arten, deren Heimat diese Insel ist, nicht besitzt. Dieser Gimpel weiß, was er tut. Er ist kühn, dreist und sehr schnell, wenn es darum geht, neue Nahrungsquellen zu entdecken.
Und hier im Reich des Gimpels entwickelte Lefebvre dann auch eine Intelligenzskala, basierend auf der Annahme, dass schlaue Vögel innovativ sind. So wie dieser Gimpel und die Rahm abschöpfenden Meisen tun sie neue Dinge. Vögel mit weniger Verstand bewegen sich nach festen Mustern, selten erfinden oder erforschen sie Dinge oder wagen sich ins Unbekannte vor.
Wie der Zufall es will, hat der Barbados-Gimpelfink einen nicht ganz so hellen Doppelgänger auf der Insel, das nah verwandte Schwarzgesichtchen (Tiaris bicolor), das sich zu einem faszinierenden Vergleich anbietet. Beide Vögel ähneln sich in fast jeder Hinsicht, nur in einer nicht. Was die Intelligenz betrifft, ist der Barbados-Gimpelfink sehr schnell von Begriff, die Schwesterart dagegen langsam und schwerfällig. Der Kontrast zwischen diesen beiden Hinterhofarten hat es Lefebvre ermöglicht, den Vogelverstand besser zu verstehen.
«Diese beiden Vögel sind praktisch genetische Zwillinge, haben denselben Vorfahren und haben sich wahrscheinlich erst vor wenigen Millionen Jahren auseinanderentwickelt», erklärt Lefebvre. «Beide leben in derselben Umgebung. Beide sind territorial und leben in ähnlichen Sozialverbänden.» Der einzige Unterschied: Der Barbados-Gimpelfink ist schlau, furchtlos und opportunistisch, während das Schwarzgesichtchen scheu und zutiefst konservativ ist und vor fast allem Angst hat.
Die evolutionäre Geschichte des Gimpels mag aufschlussreich sein. Als diese Art auf Barbados ankam, nahm sie einen anderen Weg als der farbigere Bartgimpelfink. Bei dieser Art sind Männchen und Weibchen dimorph in der Färbung. Während die Weibchen schlicht braun sind, präsentieren die Männchen sich in einem durch sexuelle Auslese entstandenen Federkleid aus attraktivem Schwarz mit leuchtend roter Kehle. Hier auf Barbados sind die Gimpel monomorph, beide Geschlechter zeigen sich gleichermaßen in bescheidenem Braun.
«Eine Erklärung für diese evolutionäre Verschiebung war, dass es auf Barbados nicht die karotinhaltige Nahrung gibt, die es den Vögeln ermöglicht, rote und gelbe Federn zu produzieren», sagt Lefebvre. «Nun hat sich aber herausgestellt, dass das Rot der Federn gar nicht auf Karotin angewiesen ist. Es ist also möglich, dass die Weibchen die Männchen nicht aufgrund ihres Gefieders aussuchen. Vielleicht entscheiden sie sich ja für Männchen, die neue Futterquellen finden können – zum Beispiel Zuckertütchen.» Mit anderen Worten, vielleicht haben die weiblichen Gimpel auf Barbados gern kluge Köpfe als Partner.
«Ich kenne keine zwei anderen derart eng miteinander verwandten Arten, die so ähnlich und zugleich in ihrem Anpassungs- und ihrem Futtersuchverhalten so unterschiedlich sind», sagt Lefebvre. Auf einem kleinen Stück Land mit Wald und Feldern im Folkestone Marine Park führt er mir ein informelles Experiment vor, um seine These zu untermauern. Mehrere Schwarzgesichtchen sind etwa 30 Meter entfernt im Gras zu sehen, wo sie nach Samen suchen. Noch weiter weg sitzen ein paar andere Vögel in den Bäumen. Lefebvre streut eine Handvoll Körner aus und hockt sich dann ins Gras. Die Grackeln merken es als Erste. Innerhalb einer halben Minute hat sich ein lärmender Schwarm versammelt. Ihr Gekreische lockt Tauben und weitere Grackeln und ganze Schwadronen von Gimpeln an. Die Schwarzgesichtchen rühren sich nicht. Sie halten unbeirrt die Köpfe gesenkt und untersuchen akribisch ihre Stellen im Gras. Dann sagt Lefebvre im Flüsterton und mit betont britischem Akzent: «Ein perfektes Ergebnis, fast wie inszeniert und mit David Attenborough hinter den Kulissen.» Und schließlich, in einer geradezu unheimlichen Imitation der Stimme des berühmten Naturforschers: «Dieser Vogel macht erstaunliche Sachen …»
Abrupt erhebt er sich und zeigt auf die Schwarzgesichtchen. «Null opportunistische Anpassung dort», sagt er. «Weder die Körner noch die fressenden Vögel interessieren sie. Sie haben einfach kein Interesse an alternativen Nahrungsquellen.»
Fünfzehn Jahre lang ignorierte Lefebvre die Schwarzgesichtchen; sie schienen so … na ja … halt so langweilig zu sein. Doch jetzt bieten sie ihm wegen ihrer genetischen Nähe die ideale Vergleichsgruppe für die Barbados-Gimpelfinken.
«Warum ist das Schwarzgesichtchen so, wie es ist?», fragt Lefebvre sich. «Es besitzt denselben ererbten Genotyp wie der Barbados-Gimpelfink, lebt in derselben Umgebung. Wieso geht es die Futtersuche auf so komplett andere Weise an?» Warum ist der eine Vogel so viel mutiger, schlauer und opportunistischer als der andere?
«Studien haben gezeigt, dass Arten, die sich im Fressverhalten unterscheiden, sich auch in der Lernfähigkeit unterscheiden – und in der Gehirnstruktur, die dem Lernen zugrunde liegt», sagt Lefebvre. Also ist als Erstes ein Experiment dran, bei dem beiden Vögeln Aufgaben vorgesetzt werden, die ihre elementaren kognitiven Fähigkeiten messen. Es ermöglicht den Wissenschaftlern, natürliches Verhalten, das sie im Freien beobachtet haben, mit den Unterschieden ins Verhältnis zu setzen, die sie im Labor messen.
Das ist keine einfache Aufgabe. Allein die Schwarzgesichtchen einzufangen, stellt sich als schwierig heraus. Für die Barbados-Gimpelfinken benutzt Lefebvre begehbare Fallen, aber in seinen 25 Arbeitsjahren hier ist ihm noch nie ein Schwarzgesichtchen in so eine Falle gegangen; die Vögel sind viel zu argwöhnisch. Also benutzt sein Team Nylonnetze, um sie zu fangen.
«Dann geht es darum, sich eine Aufgabe für die Schwarzgesichtchen auszudenken», sagt Lefebvre. «Sie sind so scheu, und wenn ihnen bei dem Experiment ein Gegenstand ein bisschen zu sonderbar erscheint, machen sie einfach nicht mit.» Draußen im Feld hat Lima Kayello, eine von Lefebvres Doktoranden, die Geschwindigkeit gemessen, mit der die beiden Arten ein offenes Gefäß mit Körnern finden. Die Gimpel fänden die neue Futterquelle in etwa fünf Sekunden, sagt sie. Die Schwarzgesichtchen bräuchten dafür fünf Tage. «Ein Joghurtdeckel mit Körnern kommt ihnen einfach zu seltsam vor», sagt Kayello.
Für die kognitiven Experimente setzt Kayello den jeweiligen Versuchstieren der beiden Arten etwas vor, das sie noch nie gesehen haben: einen kleinen, durchsichtigen Zylinder mit einem abnehmbaren Deckel. Sie misst, wie lange die Vögel brauchen, um sich dem Gerät zu nähern, es zu berühren, den Deckel wegzustoßen und die Körner zu fressen. Selbst die schlauen Gimpel zeigen dabei verschiedene Vorgehensweisen. Ein Gimpel flitzt mehrere Minuten in der Voliere umher, bevor er sich endlich an das Gefäß wagt und es öffnet. Er braucht glatte acht Minuten, um die Aufgabe zu lösen. Ein zweiter Vogel geht direkt auf das neue Ding zu und öffnet es quasi umgehend. «Braver Junge!», sagt Kayello. Das Ganze hat nur sieben Sekunden gedauert.





























