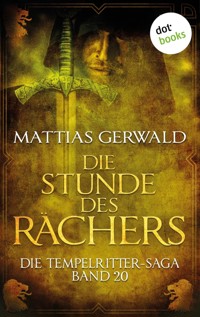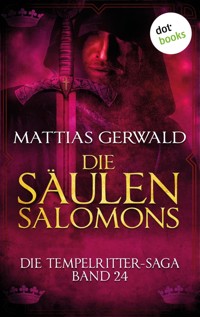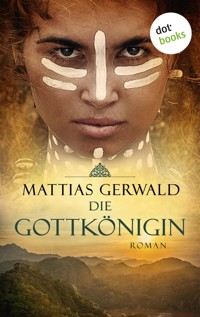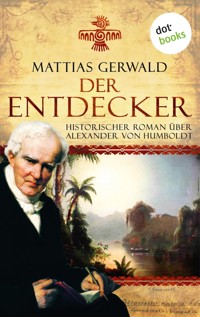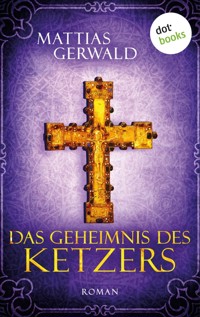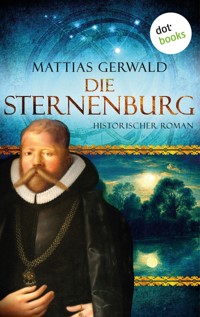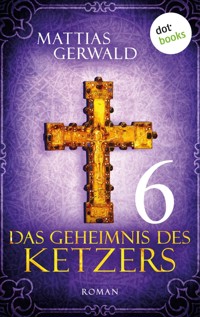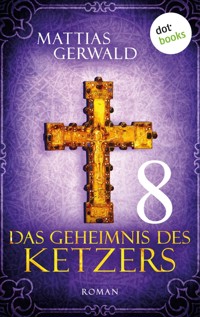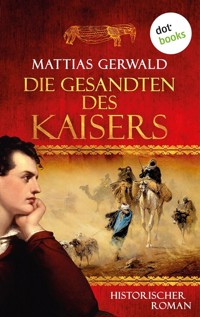
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren des sagenumwobenen Priesterkönigs Johannes: "Die Gesandten des Kaisers" von Mattias Gerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Europa im 12. Jahrhundert: Gerade erst wurde die heilige Stadt Jerusalem zurückerobert, da versetzt ein mysteriöser Brief die gesamte Christenheit in Aufruhr. Das Pergament berichtet von der unermesslichen Macht des geheimnisumwobenen Priesterkönigs Johannes, der von einer goldenen Stadt aus über ein schier endloses Reich herrscht. Kann er zu einer Bedrohung für Papst und Kirche werden oder ist er ein Verbündeter im Kampf gegen die Ungläubigen? Die mutige Fürstentochter Bixta und der päpstliche Medicus Phillip treten eine heikle Mission an: Sie reisen nach Afrika auf der Suche nach der goldenen Stadt und ihrem geheimnisvollen König … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Gesandten des Kaisers" von Mattias Gerwald. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Europa im 12. Jahrhundert: Gerade erst wurde die heilige Stadt Jerusalem zurückerobert, da versetzt ein mysteriöser Brief die gesamte Christenheit in Aufruhr. Das Pergament berichtet von der unermesslichen Macht des geheimnisumwobenen Priesterkönigs Johannes, der von einer goldenen Stadt aus über ein schier endloses Reich herrscht. Kann er zu einer Bedrohung für Papst und Kirche werden oder ist er ein Verbündeter im Kampf gegen die Ungläubigen? Die mutige Fürstentochter Bixta und der päpstliche Medicus Phillip treten eine heikle Mission an: Sie reisen nach Afrika auf der Suche nach der goldenen Stadt und ihrem geheimnisvollen König …
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: Novembermord, Engelmord, Regenmord und Frühjahrsmord. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach VinetaDie Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch ChristiDie Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der KinderDie Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des HeiligenDie Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des RächersDie Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons
***
Neuausgabe März 2016
Copyright © der Originalausgabe 2002 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von „Lord Byron von Richard Westall“ und „The Simoon von Ludwig Hans“
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-544-0
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Gesandten des Kaisers an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Mattias Gerwald
Die Gesandten des Kaisers
Historischer Roman
dotbooks.
»Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit.«
(Das Buch Daniel, Altes Testament, 12,9)
VORBEMERKUNG
Der vorliegende Roman beruht auf historischen Tatsachen. Der Brief des Priesterkönigs Johannes, um den es hier geht, erregte das gesamte 12. Jahrhundert. Wann genau der mysteriöse Verfasser ihn schrieb, wissen wir nicht, vermutlich zwischen 1165 und 1176, also auf jeden Fall zwischen dem 2. Kreuzzug (1147-1149) und dem 3. Kreuzzug (1189-1192). Offiziell wurde seine Existenz erst im Jahre 1190 bestätigt, weshalb unser Roman auch zu diesem Zeitpunkt einsetzt. Noch Ende des 15. Jahrhunderts suchten die Portugiesen unter ihrem Infanten Dom Henrique von der Algarve aus nach dem geheimnisvollen Absender. Die im Roman beschriebene Reise unter der Führung des päpstlichen Leibmedicus, Magister Philippus, fand ebenfalls statt – mit einem tragischen Ende. Niemals mehr hörte man irgendetwas von den Teilnehmern dieser Expedition, sie verschwanden in den Tiefen Afrikas.
Unser Roman bemüht sich um eine originalgetreue Sicht der Umstände dieser legendären Reise, stößt jedoch auf überraschende Einzelheiten und kommt deshalb zu neuen Schlüssen. Wir glauben zu wissen, was aus der Expedition und ihren Teilnehmern wurde. Die hier in Romanform beschriebenen Ereignisse vor dem Hintergrund eines rätselhaften' Geschehens waren möglich, ja sogar wahrscheinlich.
Manchmal sind die historischen Tatsachen faszinierender als jede Erfindung. Manchmal jedoch muss die Fantasie nachhelfen und historische Hürden außer Acht lassen, was in diesem Roman durch die Veränderung zeitlicher, örtlicher und persönlicher Fakten geschieht. Die politischen Gegebenheiten der damaligen Zeit wurden vereinfacht. Unser Ziel war jedenfalls nicht, den Leser mit Gelehrsamkeit zu langweilen.
BUCH EINS HINTERMÄNNER
»Sie war von mittlerer Größe, hatte goldglänzendes Haar und ein sehr schönes Gesicht. Ihre Zähne waren schneeweiß und schön gestellt, ihr Mund klein. Sie hatte die allerschönsten Hände und einen so anmutigen Körper ...«
KAISERPFALZ. DIE ZEIT DRÄNGT.
In den feinen Sprühregen, der mit einer Schlechtwetterfront von den Ausläufern der Rhön herüberzog, mischte sich der Blütenstaub der Obstbäume. Um die Mittagszeit war das Leben im Ort erstorben, ganz besonders sonntags, ganz besonders an einem Sonntag, an dem Regen bevorstand. Bei Regen sahen die Abfallhaufen am Straßenrand noch schmutziger aus, schlichen die haarlosen Hunde mit gesenkteren Köpfen als sonst schnüffelnd an den Rinnsalen aus Abwaschwasser und Fäkalien vorbei, die ins Kinzigtal abflossen. Bei Regen hörte sich das Geräusch der geschwollenen Flüsse im Tal dumpf und kalt, auf jeden Fall abweisend an, und der Schrei der Reiher und Graugänse klang klagender von den Sumpfwiesen her. An einem solchen Sonntag hatte niemand Lust, auf das helle Schlagen der Glocken zu hören, weil sich niemand vorstellen konnte, dass es so etwas wie Zeit, wie das Vergehen des Tages, den ein düsterer Himmel beherrschte, überhaupt gab. Die Bewohner des Ortes zogen sich in die tiefsten Winkel ihrer braunen und gelben Fachwerkhäuser mit den grünen Fensterläden zurück und warteten ab.
So duckte sich Gelnhausen gegen die Nässe, das Unbehagen und die dunklen Hänge des Spessart. Aber unten, wo die jetzt über die Ufer getretene Kinzig die kleine Fachwerkstadt gegen die Mainebene abschnitt, ragten drei stolze, herrische Türme der neuen Basilika in den Himmel, und die rote Kaiserpfalz dahinter verkündete mit ihrem prächtigen, zweistöckigen Palas die wachsende Bedeutung der seit zwanzig Jahren freien Reichsstadt für die Geschicke der deutschen Lande.
Seit vier Wochen war mit der Stadt auch die Pfalz zu pulsierendem Leben erwacht. Ein ständiges Kommen und Gehen herrschte, Fuhrwerke, Soldaten, Kutschen mit kirchlichen Würdenträgern, Bauern, Viehtreiber, Diebe, Weinhändler, Musikanten und käufliche Mädchen aus dem bettelarmen Fuldaer Land bahnten sich den Weg durch den Schlamm des Kinzigtales und polterten durch die wappengeschmückten Stadttore mit ihren verschlafenen Haubendächern über die gepflasterten, krummen und steilen Straßen der Stadt. Alle hatten das gleiche Ziel: die Kaiserpfalz. Dort tagten seit heute die mächtigsten Männer des Abendlandes.
Und während draußen das rotwangige, duftende und stinkende, das pulsierende und immer wieder aufbrechende Leben seinen Gang nahm, starb drinnen der Kaiser.
Friedrich I. Barbarossa fühlte, wie seine Kräfte versiegten. Er war am Ende seiner Lebensbahn angelangt. Er konnte es nicht aufhalten, seine dreißig Ärzte und Wunderheiler konnten es auch nicht und selbst seine zu früh verstorbene Gattin Beatrix mit ihren zärtlichen Händen wäre machtlos gewesen. Was hätte es ihr und ihm genutzt, dass sie einst fünftausend kampferprobte, auf den waffenstarrenden Alltagskampf dressierte Ritter in die Ehe eingebracht hatte und dazu noch ihre gesamten Erblande Hochburg und, Savoyen und die blühende Provence? All dieser Reichtum blieb jenseits des einzig wichtigen, persönlichen Schicksals als verblassender, weltlicher Tand liegen, und Beatrix, um die alle lange geweint hatten, wartete nun in einem anderen Reich auf ihren Mann.
Wer den römisch-deutschen Kaiser allerdings an diesem Morgen auf seinem Thron im Saal des Reiches sah, ahnte nichts von seiner Todesnähe. Hoch aufgerichtet, im glänzenden Ornat, die von Juwelen funkelnde Kaiserkrone auf den fahl werdenden Haaren, saß er mit herrischem Gesichtsausdruck unbeweglich da und strich sich nur von Zeit zu Zeit über den mächtigen Bart, der ihm im Volksmund einen Namen verlieh, als sei er jedermanns Familienangehöriger. Barbarossa sah, wie im Osten die Sonne aufging und ihr erstes Licht wie mit begehrlichen Fingern durch die mit Blattreliefs und lächelnden Frauenköpfen geschmückten Portalfenster kroch, sich in den Rosetten des Palastes brach und über die funkelnden Edelsteine auf den Gewändern der Gäste aus dem Lateran und Konstantinopel tastete. Friedrich I. Barbarossa wäre lieber mit Blicken und Gedanken dem Spiel dieses Lichtes gefolgt. Aber er musste die Sitzung eröffnen.
»Heute, genau zu dieser Stunde, beginnen sie mit der Vorbereitung ihrer großartigen, wagemutigen Reise«, sagte der Kaiser. Er wollte stark, optimistisch klingen, aber seine Stimme klang flach und dunkel. »Wie Ihr es wolltet, Heiliger Vater, unter der Führung Eures ehemaligen Leibmedicus, jenes Philippus, der sich, wie Ihr sagtet, so verdient gemacht hat. Begleitet von den grimmigen Kriegern des Santiago-Ordens, die unbeirrbar die Pilgerpfade beschützen. In zwei Wochen wird sich der Zug in Bewegung setzen, in fünf Wochen schon werden sie in der Sierra Morena vor Cádiz sein, und in vier weiteren Wochen, nach gefährlicher Fahrt mit den Barken am Mittelmeer, dem östlichen mare mediterraneum. Dann mögen sich die Ungläubigen an den Ufern Nordafrikas in Acht nehmen.«
Er schwieg erschöpft. Die Knoten im Hals schmerzten wieder. Doch er wollte sich nichts anmerken lassen. Er starb, das wusste er, aber nicht, bevor das Konzil sich über diesen Brief einig geworden war. Deshalb sah er seine Gegenüber fest an. Der Patriarch und der Papst, die Führer der Abordnungen der beiden geistlichen Oberhäupter des Abendlandes saßen erhöht wie er inmitten ihrer Ratgeber an den Stirnseiten des bändergeschmückten Konzilsaals. Er suchte nur ihren Blick; die hundertköpfige Gefolgschaft von Personen höchsten Ranges drang in sein Bewusstsein nur als rauschhaftes, buntes Bild von Farben, hochfahrenden Gesten, Knistern der Gewänder, Getuschel, ab und zu knurrten die gezähmten Leoparden des Patriarchen vom Bosporus. Barbarossa fuhr fort: »Die Zeit drängt. Schon erheben sich Gerüchte, mit dem Auftauchen des Priesterkönigs gerate das Weltgefüge aus den Angeln, würden die bisherigen Machtverhältnisse hinfällig, die Prophezeiungen nichtig. Wir müssen diesen Gerüchten entgegentreten. Ich schlage deshalb vor, wir eröffnen umgehend die Aussprache über diesen Brief. Zeremonienmeister, erklärt uns die Prozedur und die Reihenfolge der Redner.«
»Halt! Wartet damit!« Die Stimme des Papstes schnitt scharf durch den Saal. Klemens IH. trug das silberbestickte weiße Rochett, das in Falten bis zum Boden fiel, und die Mitra. Mit seiner rechten Hand rammte er den von irdischem Gold aus den Gebirgsflüssen der Alpen und den Juwelen aus den Tiefenregionen der Extremadura verzierten Hirtenstab, der ihn gleichzeitig als himmlischen Stellvertreter Jesu auf Erden auswies, in den Marmorboden. Sein Brustkreuz unter dem hoch stehenden Kragen der Capa magna glänzte im frühen Licht, seine langen, von weiteren Edelsteinen geschmückten Finger der anderen Hand umkrampften wie eine giftige Tarantel die karmesinroten Armlehnen seines Sessels. »Ich bin dagegen! Der deutsche Kaiser ist Gastgeber dieses Konzils, so wie er vor zehn Jahren dem hiesigen Reichstag unter unserer Führung vorsaß, auf dem er seinen Vetter Heinrich den Löwen seines Amtes enthob. Aber er sollte nicht vorgeben dürfen, wie die Prozedur vonstatten geht. Er sollte sich gerade als Herrscher über Staat und Kirche in weiser Beschränkung im Hintergrund halten. So war es vor zehn Jahren, und so ist es weiter ungeschriebener Brauch.«
Friedrich I., von beiden Seiten flankiert von seinen Ratgebern aus den deutschen Fürstentümern, spürte, wie eine Hitzewelle in ihm aufstieg. Gleichzeitig plagte ihn ein heftiges Jucken in der Leiste. Aber er blieb ungerührt sitzen. Als er seinen Kopf unmerklich nach links drehte, flüsterte ihm der früh ergraute Graf von Selbold, Konventuale aus dem Reichskloster Lorsch zu: »Ihr solltet nicht nachgeben, Kaiser. Er meint nicht wirklich, was er sagt. Der Spieler will nur Punkte machen.«
Wie verhielt sich der Würdenträger vom Bosporus? Barbarossa sah hinüber zum Pfauenthron, auf dem der rotgesichtige Kaiser Alexios III. Angelos von Byzanz saß. Er fing dessen Blick aus wässrigen braunen Augen auf, deren geweitete Pupillen von ungewöhnlich viel wie aus Leinwand gestochenem Weiß umgeben waren. Er traute den Byzantinern nicht, die das deutsche Heer des zweiten Kreuzzuges ins Verderben gestürzt hatten, weil sie einen heimlichen Waffenstillstand mit den Seldschuken abschlossen. Was sagst du, was sagst du, Verräter?, drängte Barbarossa stumm. Aber der glattgesichtige Byzantiner, bis zum Kinn gehüllt in seinen Hermelin, als ob er friere, schwieg.
»Gut!« Der Kaiser rang sich zu einer Antwort durch. »Euer Einwand, Heiliger Vater, mag berechtigt sein oder auch nicht. Aber er ist unbedeutend ...«
Die versammelten Gesandten an den gleich langen Seiten des Thronsaales ließen ein Murmeln hören. Es klang wie das unterdrückte Keifen von Hausbesorgerinnen, die sich aus Angst vor Strafe mit geschlossenen Lippen über ihre Herrinnen ausließen.
»Ja, er ist unbedeutend ...« Friedrich I. hob den Arm und schnürte jeden möglichen Einwand ab. »Als Gastgeber dieses Konzils bestimme ich den Ablauf. Worüber wir zu sprechen haben ist zu wichtig, als dass wir uns mit Verfahrensfragen aufhalten sollten. Nur dieses eine Mal, ich bitte Euch alle, lasst uns nicht darüber streiten, wie wir vorzugehen haben. Fangen wir einfach an. Jeder wird zu Wort und zu seinem Recht kommen. Die Zeit drängt.«
Der Papst blickte wütend, schwieg aber. Seine Ratgeber bewegten sich geduckt wie Schilfrohr im Wind. Er wollte wirklich nur einen Punkt fürs Protokoll sammeln, dachte Barbarossa. Laut sagte er: »Zeremonienmeister, Ihr habt das Wort, fangt an!«
Ein Mann mit bodenlangen Umhängen in Reichsfarben und einem mächtigen Federbuschhut, der einen Schatten über sein gesamtes Gesicht warf, trat in die Mitte des Saales, entrollte eine Pergamentrolle und gab die Reihenfolge der Redner bekannt. Als Erster, es war ein weises Zugeständnis, erhielt ein Konventuale des Laterans die Gelegenheit, zu sprechen. Der Geistliche, ein Hieronymit aus dem Heimatkloster San Lorenzo in den Abruzzen, erhob sich auch sofort und sagte mit näselnder, weicher Stimme:
»Heute, an diesem Tag, Eminenzen, Hochwürden und Signores, könnte unser alter Glaube zerbrechen. Es ist der Glaube daran, dass wir Menschen erkennen können, ob die Wege des Herrn weise sind oder nicht.«
Wieder entstand das Murmeln, es glich jetzt dem Wind, der einem Gewitter auf den Hochflächen vorauseilt.
Barbarossa hob erneut herrisch die Hand. Augenblicklich verstummten alle Stimmen. »Fahrt fort. Erläutert uns, was Ihr damit meint.«
»Ich weiß, ich weiß«, fuhr der Hieronymit fort und bewegte sich dabei ungebührlich in den Hüften. »Ihr mögt denken, dass ich von etwas rede, wovon ich kein Recht habe zu reden. Kein Mensch, so hochgestellt er auch sein möge, besitzt dieses Recht, an den Wegen des Herrn zu zweifeln. Doch was uns mit diesem Brief zugetragen wird, stellt diesen Tag und alle kommenden Tage in Frage. Er könnte das Ende der Welt bedeuten!«
Das Murmeln der Zuhörer ging in Wortblitze über. Sie zuckten von den kalten, steinernen Sitzbänken zu allen Seiten des Saales herüber zu den Thronen. Der Donner der Stimme Barbarossas kam dazu: »Ruhe! Der Sachverhalt ist uns doch bekannt! – Sprecht weiter!«
»Umsonst gelebt zu haben schmerzt jeden an der Neige dieses großen Jahrhunderts, deshalb ist es für die Christenheit ein so wichtiger Triumph, alle im Glauben wiedervereint zu sehen. Wir haben Jerusalem zurückerobert, das Abendland glaubt wieder an den gleichen Gott, die Feinde sind besiegt ...«
Diesmal zustimmendes Getuschel von den Anwesenden. Die Spinnenfinger des Papstes trommelten jedoch weiterhin ein ungeduldiges, knöchernes Stakkato auf die mit rotem Samt bezogene Sessellehne.
»Wir leben im Herrn. Die Kirche war nie mächtiger. Umso furchtbarer ist der Schatten, der nun über uns fällt. Ein Presbyter, der Priesterkönig Johannes, nennt sich Herr der Herren, er behauptet, er überrage an Tugend, Reichtum und Macht alle, die unter dem Himmel wandern. Welch ein Frevel! Ist er Papst? Ist er Patriarch? Ist er Kaiser? Nein, nichts davon. Aber er maßt sich all dieses an! Zweiundsiebzig Könige zahlen ihm Tribut – behauptet er. In den drei Teilen Indiens herrsche seine Erhabenheit – wie er sich ausdrückt. Und seine Länder erstreckten sich bis ins hinterste Afrika, wo der Leichnam des heiligen Apostels Thomas ruht ... Wenn dies alles zutrifft, dann hat er seinen Reichtum und seine Macht der legitimen Kirche geraubt. Sollen wir ihn loben? Nein, nein! Ein solcher hochfahrender Mann ist ein Ketzer, er muss ausgelöscht werden!«
Die Stimme des Hieronymiten ging bei den letzten Worten in ein Falsett über und überschlug sich schließlich. Der Mann verschluckte sich und schwieg. Die Stille, die nun einkehrte, war Besorgnis erregend. Sie zeugte von einem Erschrecken, dem mit Worten nicht beizukommen war.
Der Redner fing sich jedoch wieder. »Der Frevler greift in die Schöpfung ein, wie die Heilige Schrift sie uns darbietet. Er spricht gleichzeitig von roten Löwen, weißen Bären, weißen Drosseln, stummen Greifen, wilden Pferden, wilden Rindern und wilden Menschen, gehörnten Menschen, Einäugigen, Menschen mit Augen vorn und hinten, Zentauren, Faunen, Satyren, Pygmäen, Riesen von vierzig Ellen Höhe, Zyklopen, Männern wie Frauen, vom Vogel Phönix und fast allen Tierarten, die unter dem Himmel leben. Ist das nicht das Abbild des Paradieses, von dem die Heilige Schrift spricht? Wer ist dieser Mann, dass er so zu sprechen wagt? Die Antwort ist: Es muss der Antichrist sein, die Versuchung selbst, die Mensch gewordene Schlange des Bösen. Er will an den Anfang zurück, die Schöpfung auslöschen, uns alle in die Hölle ziehen, um sich selbst an den Schöpfungsanfang zu setzen!«
Die Redezeit des Hieronymiten war beendet. Er wischte sich die Lippen trocken und zog sich zurück. Wieder trat der Zeremonienmeister vor. »Als Nächster möge der Abgesandte des erhabenen Kaisers aus Konstantinopel sprechen.«
Ein Byzantiner mit der Figur eines Ringers sprang auf und eilte die Thronstufen hinab in die Mitte des Konzilssaales. Er schwenkte ein Papier. »Verteufelt ihn nicht nur!«, rief er mit Baritonstimme. »Dieser Priesterkönig eröffnet uns auch die Möglichkeit, unseren Einflussbereich erheblich zu erweitern. Wir müssen uns mit ihm verständigen! Denn spricht er nicht auch davon, wie unermesslich reich er ist? Ich habe hier eine Abschrift von unserem bestellten Schreiber – der übrigens nach seiner befohlenen Arbeit unerklärlicherweise verschwunden ist, aber das ist eine andere Sache. In dem Brief heißt es: ›Unser Tisch ist aus kostbarstem Smaragd und wird von vier Amethystsäulen getragen. An Unserm Hofe haben Wir viele Diener, die hohe geistliche Ämter und Würden innehaben. Unser Hofmeister ist Primas und König, Unser Mundschenk König und Erzbischof, Unser Kammerherr Bischof und König, Unser Marschall König und Archimandrit, Unser Küchenmeister König und Abt. In der einen Richtung dehnt sich Unser Reich vier Monate weit aus, wie weit unsere Macht in der anderen Richtung sich erstreckt, weiß niemand ... ‹
Ja, so steht es in diesem Brief. Wir, die Vertreter des orthodoxen Reiches, bestehen darauf, dass wir den Priesterkönig nicht als Ketzer betrachten, sondern als Waffenbruder. Hat er nicht in einer blutigen Schlacht die ihm entgegengezogenen islamischen Herrscher vernichtend geschlagen, entschlossen, die von den seldschukischen Heerscharen bedrängten Kreuzfahrer zu unterstützen? Wir haben Verbündete nötig, gegen den verbreiteten Unglauben außerhalb unseres Machtbereichs. Dies umso mehr in Zeiten, wo unsere Stadt Edessa, die Vorburg der Kreuzfahrerreiche, von Irrad-ad-din-Zenghi, dem seldschukischen Wesir, im Sturm erobert worden ist.«
Barbarossa bemühte sich, kein Urteil in sich aufsteigen zu lassen. Er sympathisierte aber mit den Worten des orthodoxen Byzantiners, der sich wieder zurückzog. Des. deutschen Kaisers nächster Ratgeber, der Fürst von Langenselbold, ergriff nun das Wort. Der Sonderbotschafter des Kaisers in Konstantinopel hatte dem Kaiser das Brieforiginal aus den Händen des byzantinischen Kaisers überreicht.
»Wir möchten die Aufmerksamkeit der Versammlung auf einen weiteren Punkt des Briefes lenken. Das Reich, von dem dieser spricht, mag unermesslich und unermesslich reich sein, aber es scheint auch gefährdet zu sein, nicht, wahr? Denn heißt es hier nicht: ›Aber von dort, vom Rand der Welt, versuchen nun entsetzliche Wesen, zu uns vorzudringen, und wir sehen einer ungewissen Zukunft entgegen‹. Heißt es an dieser Stelle etwa nicht so? Doch, es steht hier schwarz auf weiß. Deshalb ist unsere Position die folgende: Wir eilen dem christlichen Herrscher im schwarzen Kontinent zu Hilfe, wir müssen ihn unterstützen – gegen welche Feinde auch immer. Denn in unseren Augen ist der Priesterkönig Johannes ein ökumenischer Gralskönig und Friedensfürst einer zukünftigen Kirche des Heiligen Geistes. Deshalb werden wir uns an der Expedition beteiligen, die bald ihren beschwerlichen Weg ins schwarze Herz Afrikas und damit an den Rand der Weltscheibe beginnt. Nur aus diesem Grund!«
Barbarossa nickte seinem Sonderbotschafter zu. Auch Kaiser Alexios Angelos stimmte offensichtlich mit dessen Rede überein. Nur der Papst schien mit sich zu kämpfen – durfte er diesem Sendboten, der den Brief aus Byzanz nach Deutschland gebracht hatte, und den anderen nachgeben? Der Stauferfeind hatte erst vor kurzem zähneknirschend den über Barbarossa verhängten Bann lösen und ihm den Friedenskuss geben müssen. Das war in Venedig gewesen, er schmeckte noch jetzt die salzige Haut des Kaisers auf seinen Lippen. Er malte sich heimlich das Schreckgespenst einer Verbindung zwischen Friedrich Barbarossa und dem Priesterkönigtum in Afrika aus, sie könnte das Ende des reichsfeindlichen Papsttums sein. Ihm schwante nichts Gutes, denn der Presbyter mit der Autorität eines von den Heiligen Drei Königen sich ableitenden Johannesjüngers musste unvermeidlich zum Nebenbuhler, ja zum Liquidator des Petrusamtes werden, wenn er sich mit dem deutschen Kaiser verbündete.
Der Papst wusste, dass Barbarossa von Beratern umgeben war, die das Kaisertum leidenschaftlich verfochten und sogar mit der Drohung von Gegenpäpsten darauf drängten, dass in Rom reichsfreundliche Päpste gewählt wurden. Dazu gehörten vor allem Konrad, der Nachfolger des Bischofs Christian von Mainz, der gegen die gewaltige Übermacht des Papstes bei Tusculum einen glänzenden Sieg für den Kaiser errungen hatte. Konrad saß zur Linken Barbarossas und wartete ebenso gespannt wie die anderen auf die Antwort des Papstes.
Im versteinerten Gesicht des Papstes war nichts weiter zu lesen als anteilslose Leere. Offensichtlich versuchte er, seine wahren Gedanken zu verbergen. Dann hob er den Arm, bat um das Wort und sagte:
»Lasst uns weitere Standpunkte hören. Wir haben Zeit.«
***
»Nein«, flüsterte Friedrich Barbarossa, »ich habe keine Zeit mehr. Die Sanduhr ist abgelaufen. Es geht zu Ende.«
Die junge Bixta kümmerte es nicht, dass ihr die blonden Haarsträhnen über die Augen hingen, sie wollte ohnehin nichts mehr sehen. Es gab nichts mehr zu sehen, das den Besitz von Augen lohnte. Ihre Augen waren voller Tränen. Sie sah, wie ihr Vater starb. Und sie selbst fühlte sich zum ersten Mal in ihrem Leben so jung, stark und lebendig, dass sie die ganze Welt umarmen konnte. Sie empfing die Gnade sämtlicher Götter. Man lag ihr zu Füßen. Aber wenn der Vater starb, war alles andere sinnlos. Sie ertrug es nicht.
Bixta kauerte auf dem breiten Eichenbett des Vaters, er lag bleich in den Seidenkissen. Sie spürte ihren jungen, zwanzigjährigen, blühenden Körper und blickte auf den bleichen, dürren, kraftlosen Leib des hinfälligen Kaisers. Der Kaiser starb. Und sie wollte leben, leben! Dort lauerte schon der Tod, und sie stand noch auf dem Sprung, diesseits des Anfangs.
Bixta spürte, dass sie es nicht aushielt. Sie hatte das Gefühl, der Boden schwanke unter ihr. Und das lag gewiss nicht daran, dass die Kaiserpfalz von einem federnden Pfahlrost auf zwölftausend Stämmen getragen wurde, die man in den abgründigen Sumpf des Kinzigtales gerammt hatte. Davon wusste sie, und ihre sensible Seele nahm dieses Schwanken oft wahr. Aber ihr jetziges Gefühl kam aus anderen, aus schwankenden, seelischen Abgründen.
Der Lärm von draußen prallte an den geschlossenen Türen dieses Sterbezimmers ab. Kein Laut war zu hören, außer den scharfen, manchmal röchelnden Atemzügen des Kaisers. Konstanze von Sizilien, die viel umworbene Schwiegertochter des Kaisers und Gattin von dessen Sohn Heinrich, hatte im Sitzungssaal die beargwöhnte, ja angefeindete Stelle des Kaisers eingenommen. Und Bixta, des Kaisers uneheliche Tochter, nahm die Stelle der Trauernden, der Weinenden ein.
Sie blickte ihn aus blicklosen Augen an. »Vater, du darfst nicht sterben! Hörst du? Ich brauche dich noch für so viele Dinge, Ratschläge, für jeden Tag Lächeln. Ich bin noch nicht so weit, auf dich verzichten zu können – hörst du? Ich bin zwanzig, und ich kann nun fast alles, Reiten, Fechten, Turniersiege erringen, ich spreche sieben Sprachen und spiele alle Instrumente, ich habe keine der Vorlesungen über Rhetorik und Philosophie versäumt, und die Weltkarte ist mir nur ein Kärtlein, das ich im Schlaf überfliege. Aber ich bin noch nicht bereit, loszulassen, ich bin doch noch ein Kind! Ich brauche deine Hand, um die letzten Schritte zu gehen, bis ich es allein schaffe ...«
Ihre Worte gingen in ein Schluchzen über. Es mischte sich mit den erstickten Lauten, die der Kaiser von sich gab. Friedrich war wieder wach. Die Sitzung hatte ihn zu sehr angestrengt, doch jetzt, nach zwei Stunden Schlaf und des Alleinseins mit seiner Tochter, fühlte er wieder Kraft in sich aufsteigen. Er richtete sich auf und stützte seinen hinfälligen, aber immer noch schweren Körper auf die Ellenbogen.
»Beklage mich nicht wie einen Toten, Kind. Hör auf. Ich lebe ja noch. Und, verdammt noch mal, ich kratze auch noch lange nicht ab.«
Bixta lachte im Weinen. »Alter Kaiser!«, flüsterte sie. »Guter, alter Kaiser, Rotbärtchen, Brummelkopf ...«
Der Kaiser versuchte ein Lächeln. Es verzerrte seine Züge, aber dann gelang es ihm. Er blickte zärtlich auf seine Tochter. Wie liebte er ihr gold glänzendes Haar, das sie von ihrer leiblichen Mutter hatte, an die sie jedoch kaum eine Erinnerung besaß, das schöne, sanfte Gesicht, den oft spöttischen, frechen Mund mit den schneeweißen Zähnen. Ja, sie war ein blutjunges Ebenbild der Mutter mit ihren schönen Händen und dem anmutigen Körper. Innerlich stöhnte der Kaiser auf. Verfluchtes Leben! Verfluchter Mörder im Himmel, der du mich umbringst und mich herausreißt aus der Mitte der wenigen Menschen, die ich jemals geliebt habe ...
Erschreckt hielt er inne. Er war Kaiser, aber er war auch ein Mensch, er durfte so nicht denken. »Verzeih mir«, presste er hervor. »Verzeih mir, Bixta ...«
»Was? Was soll ich dir verzeihen? ...«
»Alles, was ich falsch gemacht habe. Dass ich dich aus deinem Heimatland und von deiner Mutter fortgeführt habe, dich deiner Freunde und Spielgefährten beraubt habe. Dass man über dich Verleumdungen und Halbwahrheiten verbreiten kann. Das Leben ist selbst für einen mächtigen Mann so entsetzlich kurz und die Einsichten begrenzt. Ich bin kein guter Vater gewesen ...«
»Du bist der beste! Der Vater aller Väter! Mensch, Kaiser, mehr Selbstbewusstsein!« Bixta lachte und rollte sich zur Seite, sie lag jetzt mit angezogenen Beinen wie ein Kleinkind neben ihm. »Ich liebe dich, Friedrich!«
Barbarossa dachte an die Sitzung. Aber es war so fern, so – unwichtig. Wichtig waren nur Bixta und er selbst, unter der Berührung ihrer warmen Hände. Diese innige, unwiederholbare Gemeinschaft von Vater und Tochter, von zwei Menschen, die eine Strecke lang gemeinsam ihre eigene, kleine Bahn zogen, unter diesem drohenden, schweren Himmel, der jeden Moment auf sie hinabstürzen konnte. Zumindest dachte der Kaiser so.
»Vater?«
»Ja.«
»Ich denke schon lange darüber nach ... Lass mich mit auf diese Reise gehen.«
»Was?«
»Ja. Lass mich diese Reise nach Afrika anführen. Ich fühle mich bereit dafür.«
»Unsinn, Bixta. Hör auf damit, mach bitte keine Scherze mit einem alten Mann.«
»Nein, keine Scherze. Du bist der Empfänger dieses Briefes aus Äthiopien. Aber du gibst ihn mir weiter. Ich trete an deine Stelle. Ich werde zu seiner Empfängerin. Ich kenne ihn schon, ich habe ihn empfangen und gründlich gelesen. Und ich bin bereit, darauf zu antworten. Lass mich die Reise mitmachen, ich weiß, es gibt niemanden, der dafür besser geeignet wäre.«
Die Worte der Tochter wanden ein Band im Kopf des Kaisers. Sie flatterten zuerst locker umher, beschwingt wie im Frühlingswind, schlangen sich um ihn, wurden deutlicher, fester, schnürten ihm schließlich das Herz zu.
»Nein«, stieß er hervor. »Ausgeschlossen. Es ist unmöglich, Bixta. Und du weißt es. Es ... ist viel zu gefährlich für eine Frau. Hat schon jemals ein Weib in der Weltgeschichte einen solchen Wunsch geäußert? Was denkst du dir? Nein. Das kann ich nicht erlauben. Das darf ich nicht erlauben!«
»Doch Vater, das kannst du. Du musst es. Es ist meine Feuertaufe. Der letzte Schritt, den ich gehen muss. Du nimmst mich an die Hand und schickst mich dann los. Ich werde gehen. Und du wirst mich dabei nicht aus den Augen lassen. So ist es gut.«
»Lassen wir das«, sagte der Kaiser. »Sprechen wir von der Liebe. Draußen auf Burg Brandenstein schubsen sich die Freier in einer endlosen Schlange herum, in der Kanzlei von Schloss Steinau melden sich täglich neue Kandidaten, es haben all diejenigen kaum noch Platz, die darauf warten, sich dir als legitime Liebhaber zu präsentieren. Im nächsten Turnier in Schlüchtern wird er, der um dich buhlen darf, ausgefochten. Du weißt das.«
»Mich interessieren diese Freier nicht. Mich interessiert überhaupt kein Mann – noch nicht. Ich mag nicht diese grimmigen Gestalten, die sich mir mit dem gönnerhaften Gehabe von Kriegern oder Pfaffen nähern. Alles, was sie können, das kann ich auch ... Ich brauche keinen von ihnen!«
»Sei nicht so hochfahrend, Bixta! Es geziemt sich nicht für eine Tochter, so zu reden. Und es geht beileibe nicht nur darum, was du magst, Querkopf! Deine Brüder müssen ihre vorgeschriebene Rolle ebenfalls spielen, die Einheit des Reiches steht auf dem Spiel, die Erbfolge und die Einflussbereiche müssen geregelt werden. Wenn ich nicht mehr bin, muss ich das Reich und auch dich in guten und richtigen Händen wissen. In Händen, die unser Land lenken können.«
»Das mag sein – ich will auch nicht ungehorsam sein. Aber ich bin noch nicht so weit ...«
»Nimm dir einen, der dir treu zur Seite steht, der dir den Weg ebnet und dich leitet, Kind!«
»Ich will allein gehen, ich brauche keinen Führer. Außer dich! – Bitte, Vater!«
Friedrich sagte müde: »Für dich gibt es andere Aufgaben in der Welt, auch wenn du besondere Begabungen hast. Du bist ein außergewöhnliches Weib, eine einzigartige Tochter, gesegnet mit so vielen Gaben – aber du musst auch deinen vorgezeichneten Platz einnehmen.«
»Nein. Eine muss den Anfang machen, Kaiser. Bei allem Respekt und meiner unendlichen Liebe zu dir – ich will die vorgefertigte Rolle meines Geschlechts und meines Standes nicht spielen.«
Barbarossa verdrehte die Augen. »Wenn überhaupt jemand aus unserer Mitte diese Reise antreten würde, dann wären es die beiden ältesten der fünf Brüder – das weißt du!«
»Ich weiß, ich weiß. Heinrich ist längst volljährig und ich noch nicht. Aber Heinrich bereitet sich in Trier auf deine Nachfolge vor, und Friedrich befehligt das große Heer in Regensburg, das du im letzten Jahr bestellt hast, um gegen Saladin, den Sultan von Syrien und Ägypten zu ziehen, den größten Feind der Christen, der die Kreuzfahrerstaaten bedroht. Sie können also gar nicht fort, sie sind hier unentbehrlich! Und meine drei jüngeren Brüder sind gänzlich ungeeignet für eine solche Reise. Sie taugen nur für das höfische Leben. Ihr größtes Abenteuer ist das Schäkern mit Jungfern am Kamin zur Musik der Zimpeln und Gitarren.«
Friedrich sagte: »Ich selbst würde dieses Unternehmen gern anführen. Es ist das wichtigste seit Menschengedenken. Aber ich muss noch einmal die Rüstung anziehen und mit meinen Streitern nach Kleinasien, wenn ich nicht vorher ...« Ein Verdacht war in ihm aufgestiegen. Er sah die Tochter stirnrunzelnd an und sagte unbarmherzig. »Du willst nicht dabeisein, wenn ich sterbe, nicht wahr?«
»Vater!« Bixta schrie es fast. Dann sagte sie leise: »Du sagst ja selbst, du musst nach Kleinasien zu deinen Kreuzfahrern. Lass mich nach Afrika ziehen. Dann sind wir uns näher, als wir uns sonst sein könnten. Wir wissen dann beide, dass wir unterwegs sind, nicht Seite an Seite, aber unterwegs. Allein dafür sind wir geschaffen. Abends am Feuer werden wir nur an uns denken. Wir werden den gleichen Mond ansehen. Wenn die Schlachten geschlagen sind, gehören wir nur uns, ist das nicht eine besonders kostbare Art von Nähe?«
Friedrich verstand endlich. Und gleichzeitig begriff er, er würde es ihr erlauben. Er sagte: »Es stimmt schon – hier in Gelnhausen quälen wir uns nur. Du mit deiner Ungeduld, ich mit meiner Todesangst. Es wäre zuletzt ein unwürdiger Abschied.«
»So lass uns jetzt trennen. In diesem innigen Moment. Wenn wir den bitteren Weg nicht ganz bis zu Ende gehen, wird dieser Moment uns immer bleiben. Wir werden immer gemeinsam unterwegs sein und uns nie aus den Gedanken verlieren – bis in alle Ewigkeit. So nah werden sich nie wieder zwei Menschen sein.«
»Da draußen ist eine feindselige Welt, Bixta! Man kann in ihr nur überleben, wenn man die sicheren Stützpunkte kennt – und wenn man Gott auf seiner Seite hat. Du wirst allein bis zum sicheren Jerusalem mehr als ein halbes Jahr unterwegs sein, und was danach kommt, das weiß niemand. Und du brauchst hunderte von kampferprobten Begleitern!«
»Die braucht ein solches Unternehmen sowieso, egal, ob ich mit dabei bin oder nicht. Ein solches Heer steht doch auch schon unter Waffen, alles wartet auf dein Zeichen. Ich bin also keine Belastung und stelle für niemanden eine Gefahr dar. Vielleicht stimmt meine Anwesenheit sogar die Feinde, auf die wir treffen werden, milder. – Lass mich mitreisen, Vater!«
Barbarossa sank in die Kissen zurück und schloss die Augen. Die Zeit verging. Bixta zügelte ihre Ungeduld. Von draußen war plötzlich ein Schlag zu hören. Bixta stand auf, trat an ein Fenster, stieß den Laden auf und sah nach draußen. Ein Vogel war nur gegen die Fensterhöhlung geflogen. Sie blickte hinunter in den Park, der sich zwischen den roten Sandsteinmauern der Pfalz und dem Castrum des Grafen Dietmar von Gelnhausen hinzog und sich bis zu den brüchigen Mauern des Klosters Selbold erstreckte. Ein Schwarm von Saatkrähen rauschte in diesem Moment unter dem hoch aufragenden Gewölbe der Korkeichen und Platanen mit ihrem jahrhundertealten Grün davon.
Bixta ging wieder zum Bett zurück. Sie sagte nichts, wartete nur.
Der Kaiser schien eingeschlafen zu sein. Bixta stöhnte leise auf, in ihr war eine Spannung, die sie kaum bändigen konnte. Gedanken quälten sie. War es richtig, den Vater gerade jetzt verlassen zu wollen? Kam das nicht einem Verrat gleich? Gleichzeitig wusste sie, er würde sein Sterben mit keinem teilen wollen. Nicht mit ihr, nicht mit einem seiner Söhne. Sie kannte ihn wie kaum jemand. Friedrich würde noch einmal aufbrechen und den Tod im Abenteuer, im Kampf suchen. Er würde an irgendeinem Fluss im Osten, angesichts feindlicher Heere, mit dem Schwert in der Hand sterben, den Blick auf das Licht am Horizont gerichtet. Sie verstand das. Sie selbst glaubte, von ähnlicher Natur zu sein.
Bixta wartete. Eine Biene hatte den Weg durch die geschlossenen hölzernen Fensterläden gefunden und dröhnte so laut im Zimmer, dass Bixta glaubte, sich die Ohren zuhalten zu müssen. Alles war so nahe und doch ungreifbar. Die Zeit stand still!
Die Tochter sah auf den Vater herab. Sein Gesicht war fahl, kleine rote Flecken lagen auf seinem Hals.
»Ja«, sagte er unvermittelt. »Ist gut. Reise. Führe mein Werk auf deine Weise fort. Ich habe keine Angst um dich. Es kann dir nichts geschehen. Was auch immer passiert, mit dieser Reise wirst du unsterblich werden.«
***
Es war Nachmittag, als Bixta den Weg zur Basilika ging. Die Schwalben trauten sich gerade wieder heraus aus den Dachspalten, und der Himmel wurde lichter. Das Klappern der Wassereimer nahm zu und auch der Geruch nach gedünsteten Rüben, nach Feuern und nach gebratenem Fisch. Frauen traten mit Bottichen aus den windschiefen Häusern und hingen Wäsche auf.
Als das große Aufatmen über den Ort hinwegstrich, verließ Bixta, die schlanke Gestalt verhüllt von einer langen weißen Kutte, den südöstlich der Stadt gelegenen Pfalzbezirk auf der Insel, die der Fluss Kinzig in einem Kreis zog. Sie beachtete die geschäftigen Höfe der Ministerialen zur Linken nicht weiter, überquerte an der Burgmühle eine der kleinen Holzzugbrücken, umging den mit herumpolternden Bewaffneten besetzten Ziegelturm und betrat im Trubel des Untermarktes unerkannt die Ausläufer der Stadt. Sie wollte allein zur Kirche gehen.
Bixta atmete tief die saubere, kühle Luft nach dem Regen ein, ging den immer noch staubigen Weg hinauf, vorbei an Hunden, die auf den Schnauzen lagen, durch den schmutzigen Ort hindurch, aus dem Einerlei der matten Farben, aus engen, stinkenden Gassen heraus ins lichtdurchflutete, schattige Grün dieser Straße, über die steilen Staffeln der Goldschmiede, die direkt zur Basilika führten.
Sie passierte jetzt üppige Stadtgärten, die an verwitterten Balustraden grenzten, an denen die Blüten der Vogelbeerbüsche loderten, musste an schlammigen Pfützen den Umhang raffen, ging weiter hinauf aus dem Tal, in dem die klaren Wasser rauschten, wo Salzluft und Mövenrufe wie von fernen Küsten lockten, in das gedrängte, obere Stadtleben hinein.
Sie hätte auch in der Kapelle der Pfalz beten können, oder in der feierlichen St. Peterskirche, aber sie zog die gerade fertig gestellte Marienkirche vor. Es war wie eine Wallfahrt.
Der Fluss unten war eine kühle Quelle, die sie erfrischte, der unruhige Fluss, der irgendwo im Süden weiterzog, weiter und weiter und in das Meer mündete, dieses riesige, rätselhafte Lebewesen, das Bixta seit ihrer Jugend lockte. Ich muss einfach ans Meer, ans mare mediterraneum, ich muss, ich muss, dachte Bixta, nicht zum ersten Mal an diesem Tag. An dieses stoische, überlegene Meer jenseits der eitlen, höfischen Feste, der Tändeleien, der blutlosen Minne, der nichts weniger als sportlichen Kämpfe, Turniere und Gefechte. Was soll mir das alles, das nur ihre Langeweile vertreibt? Ich will ans Meer, nach Afrika!
Oben unterbrach nur das Gezwitscher der Vögel die tiefe Stille. Bixta betrat die romanische Kirche von Westen her durch den vorgebauten, viergeschossigen Glockenturm. Im hoch auffahrenden Innenraum der einschiffigen Kirche, die noch Spuren der jüngsten Bauarbeiten zeigte, durch welche die geduckte romanische Vorgängerkirche prächtiger und offener geworden war, saßen nur Frauen. Die meisten dick und plump, alt, traurig, ergeben, vertieft in ein Zwiegespräch mit der Heiligen Jungfrau.
Bixta kniete sich in einiger Entfernung vom Allerheiligsten, dem mit Goldfiguren der Märtyrer geschmückten Altar in den Arkaden des Sandsteinlettners nieder. Sie betrachtete auf dem Fries über den Lettnersäulen den Zug der Sünder zur Rechten und der Geläuterten zur Linken. Es schien ihr plötzlich, als würden darauf die geheimen Gedanken der betenden Frauen sichtbar, als liefen sie wie eine ausgezogene Pergamentrolle über den Fries, von Bild zu Bild der Jünger und Apostel, als könnte sie diese geheimen Gedanken wie in einer aufgeschlagenen Schrift lesen. Die eine verfluchte ihren Ehemann und wollte einen neuen. Eine andere erging sich in Unterwürfigkeiten, eine dritte verlangte einen besseren freitäglichen Marktstand. Die vierte erflehte die Gesundung von einem heimtückischen Leiden.
Die Jungfrau mit dem Kind an der Seite blickte streng aus den frischen Nelken und Rosen hervor. Nur Nelken und Rosen, weiß und rot. Blut und Unschuld. Ein Meer von Blumen, das betörend duftete. Ja, es wurde behauptet, die Jungfrau sei gleich nach Fertigstellung des Bauwerks auf einem Felsen hinter der Basilika erschienen. Seitdem kamen die Menschen hierher, um Wunder zu erflehen. Haarzöpfe, Armprothesen und Krücken säumten den Altar mit dem Marienbild unter dem mächtigen goldenen Kruzifix. Hundert Kerzen brannten, hundert Blumensträuße dufteten, die Helligkeit hinter dem Altar nahm zu, das Gemurmel und die Schrift der Gedanken schienen Bixta noch hektischer zu laufen, es wurde noch drückender, die Seufzer erfüllten den Raum wie bunte, flatternde Schmetterlinge.
Einige Frauen knieten jetzt nieder, sie berührten das Leinentuch des Altars und küssten das Medaillon zu Füßen der Heiligen. Bixta wurde seltsam zumute. Die Kerzen flackerten plötzlich, die Kuppel des Chorraums hinter dem Altar trat, wie ihr schien, weiter zurück, die fünf Rosetten im Obergaden schienen sich zu öffnen, die Mauern brachen nach hinten auf oder wurden durchsichtig, wehte im Hintergrund nicht eine Tür auf? Bixta begann zu zittern und schloss für einen Moment die Augen. Ihr schien es, als läge danach tatsächlich der Durchblick zum Felsen hinter der Kirchenmauer frei. Ja, es war lichthell dort, die Wolkendecke brach endlich ganz auf, und Erleichterung machte sich bei allen hörbar breit.
Bixta richtete ihren Blick fest in die Augen der Jungfrau. Lass diese Reise gelingen, murmelte sie. Bitte mach, dass ich mich würdig erweise und den Anforderungen gerecht werde. Mach, dass ich zurückkehren kann und den Vater noch lebend vorfinde. Sie wiederholte ihren Wunsch mehrmals. Bitte mach mich bereit und fähig. Bitte. Bereit und fähig. Dem Vater zuliebe.
Bixta sah der Jungfrau in die schönen, verwundert geöffneten Augen, die nur sie anzublicken schienen. Die Blumen dufteten betörend. Ganz tief drinnen wurde ihr wohl. Sie sah Maria in die Augen und wusste nun, sie würde das schaffen, sie würde ihre geheimsten Wünsche erfüllen. Diese Reise würde gelingen.
Die Rosen dufteten. Schaffst du das?, fragte sie und bewegte stumm die heißen Lippen.
Die Jungfrau lächelte.
KASTILISCHE PROVINZ. KLOSTER SAN RAFFAEL.
Magister Philippus Fontea erhob sich endlich und trat mit leichten Schritten an die schmale, hohe Fensteröffnung mit dem verschlungenen Maßwerk. Leise summte er eine Melodie vor sich hin, brach ab und begann sie erneut. Sie klang finster, fremd. Dieses Lied! – Es ging ihm nicht aus dem Kopf. Es flatterte hinter seinen Augen wie ein gefangener Schmetterling umher.
Die hoch gewachsene Gestalt des jungen Arztes im Dienst der kastilischen Kirche straffte sich, als habe sie zu lange über den Büchern gesessen. Er starrte lange hinunter auf den Klostergarten, uni seinen Blick auszuruhen, aber es sah aus, als wolle er diesen Blick auf den Kräuterbeeten eingraben, um nichts anderes sehen zu müssen als die einfachsten Formen der Schöpfung. Er grub seinen Blick ein im Grün, so wie sich dort schon den ganzen Tag lang die Sonne mit Urgewalt eingegraben hatte. Es war heiß, die Luft brannte den scharfen Geruch von Rosmarin, Ysop, Bärlauch und Scharbockskraut aus dem Apothekergarten heraus, den Philipp angelegt hatte, nur der Kreuzgang duckte sich im kühlen Schatten, und der junge Magister sehnte sich danach, durch diese Kühle zu gehen.
Philipp kannte das Lied. Er musste es nur endlich entschlüsseln! Denn das Lied, das ihm nicht aus dem Sinn ging, wollte ihm etwas sagen. Wieder summte er die Melodie, bald lauter, bald leiser vor sich hin, mit seiner wohltönenden Baritonstimme, die im Kontrast zu seiner jungenhaften, schlaksigen Erscheinung stand. Er blieb kerzengerade wie ein Mann stehen, der Anklägern die Stirn bieten will, bis sich auf der leicht gebräunten Haut seiner Wange plötzlich ein Zucken zeigte. Als wolle er eine lästige Fliege loswerden, schlug er mit der Hand auf die Wange. Dabei brach die Melodie ab.
»Das ist es!«, sagte der Magister erstaunt. »Der Heilige Vater selbst hat das Lied gesungen, weißt du? Irgendwann bei Nacht, als ich ihn zur Ader lassen musste. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Etwas in meinem dummen Kopf war wohl dagegen. Seltsam, seltsam – es drückte wohl seine Art aus, mit der Angst vor den Schmerzen umzugehen.«
»Ja«, sagte jemand, der sich in der Zimmerecke hinter einer spanischen Wand befand. »Aber warum löst diese Melodie unsere Rätsel, Magisterchen?«
Philipp winkte übertrieben mit dem Zeigefinger in die Richtung der Stimme, und eine zwergenhafte Gestalt sprang daraufhin hinter dem Schirm hervor. »Schau einmal dort hinüber, Giacomo.«
»Ich schaue schon, lieber Herr.«
»Und was siehst du?«
»Was Er wohl auch sehen möcht, Herr«, antwortete der verwachsene Lakai vorsichtig.
»Nein, das tust du nicht, mein Freund. Du siehst einen Klostergarten – stimmts?«
»Das will ich meinen«, sagte Giacomo bedächtig und schielte nach oben. »Und was für einen! Vom Magisterchen selbst angelegt!«
»Ich hingegen sehe die Schöpfung. Das kommt daher, weil ich sie sehen will! Würdest du dich anstrengen, dann könnte es dir auch gelingen.«
»Dafür bin ich nicht angestellt, Herr! Das bleibt für die hohen Herren, die auf Samtsesseln sitzen«, erwiderte der Zwerg listig.
»Vorsicht, Giacomo! In unseren Mauern kann ein solcher Satz schon ausreichen, um geradewegs auf die Streckbank geworfen zu werden, wie du am besten weißt! Aber gut, wir haben ja keine Zuhörer – einer der Vorteile dieses abgelegenen kastilischen Klosters, zu dem niemand kommt. Dennoch Vorsicht, bis ich zurück bin. Ich werde bis zur Visite im Krankensaal hinüber in den Kreuzgang gehen. Zwanzig Runden dürften reichen. Dann weiß ich, warum diese Melodie mehr als ein einfaches Lied ist und an meine tiefste Seele rührt. Du passt inzwischen auf die Abschrift des Briefes auf, als gelte es dein Leben. Du weißt, niemand darf sie zu Gesicht bekommen.«
»Zu Diensten«, murmelte der Zwerg und krümmte sich wie unter Schmerzen.
Philipp hatte sanft und langsam gesprochen, aber jetzt durchquerte er den kargen, weiß getünchten Raum schnell wie ein geübter Läufer. Als er die Treppenstufen genommen hatte – auf jeder Stufe hinunter schien es etwas weniger heiß zu sein – die Pforte durchquerte und in den menschenleeren Kreuzgang trat, setzte er seine Füße auf, als wolle er die Festigkeit der roh behauenen aber glatt geschliffenen Sandsteine testen. Er raffte seinen leichten schwarzen Rock und spürte die Kühle an den nackten Beinen, die in Sandalen mündeten. Mit wiegendem, geschmeidigem Gang drehte er die erste Runde. Dann die nächsten. In der zwölften wusste er plötzlich, woher er das Lied noch kannte.
Seltsames Ding! Er hatte es in den Folterkellern gehört, als er in seiner Ausbildungszeit am römischen Tiber oft als Medicus zur Hand gehen musste. Dort hatte es jemand mit fester Stimme gesungen, bis diese brach. Darüber hatte das Stöhnen der anderen Häftlinge in Ketten gelegen und der Geruch nach hinfälligem Fleisch.
Aber die Schöpfung? Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. An diesem Ort, zu dieser Stunde war sie nicht zu spüren gewesen. Das Erschrecken vor ihrer völligen Abwesenheit ließ ihn später umso mehr danach suchen. Allein deshalb, das war klar, war er ein gläubiger Mensch geworden, obwohl seine Lehrer ihm sagten, dass er den sezierenden Verstand des Chirurgen besaß und dass es seine Aufgabe sei, die Menschen von den Schmerzen zu befreien.
Philipp brach seine Runden ab, stand einen Augenblick lang unbeweglich da, versunken in den Anblick von vier gelassenen afrikanischen Löwen aus trentinischem Marmor, die den leise sprudelnden Brunnen im Innenhof schmückten, und kehrte in das kleine Arbeitszimmer zurück. Auf dem Weg dorthin überlegte er, welche Anweisungen er dem Zwerg geben wollte, der ständig beschäftigt werden musste, damit er keinen Unsinn anstellte. Philipp spürte Mitleid mit dem Krüppel, der so viel Unrecht erlitten hatte.
Der Magister sperrte die Tür des spärlich möblierten Raumes auf und sofort überfiel ihn ein heftiges Unbehagen. Unwillig blickte er um sich. Irgendetwas hatte sich inzwischen verändert. Er bemerkte nicht auf den ersten Blick, was es war, aber auf den zweiten desto genauer. Und er erschrak.
***
Das Schreibpult in der Ecke war leer gefegt, sämtliche Papiere lagen auf dem kalten Steinfußboden. Und der Zwerg?
»Giacomo!« Keine Antwort. »Zum ... !« Wo war der Kerl! »Giacomo !«
Philipp ging schnell in die Knie und wühlte in den Pergamentblättern. Über einige hatte sich Tinte geleert, andere waren zerknüllt. Auf einem Pergament mit dem Siegel des Papstes lag eine rote, klebrige Masse. Der Brief war verschwunden, auch die halb fertige Abschrift aus dem Lateinischen für die kastilische Krone ließ sich nicht finden. Philipp gab die Suche schnell auf. Er hatte sich zu sicher gefühlt. Jemand hatte die Zeit seiner Abwesenheit gründlich genutzt.
»Giacomo !«
Er konnte nicht weit sein. Sicher war er beim Eindringen des Unbekannten sofort ängstlich davongelaufen, ohne an Gegenwehr zu denken und die Abschrift zu verteidigen. Jetzt hockte er womöglich wimmernd unter den Betten im Dormitorium.
Philipp rannte hinüber, die Treppen hinunter, hinter dem Klausursaal wieder hoch und betrat den von fünfundzwanzig Säulen getragenen, tagsüber verlassenen Schlafsaal der Mönche.
»Giacomo?«
Er ging den lang gestreckten Saal entlang, an den Wänden links und rechts je zwei Reihen sorgfältig gerichteter Betten. Er legte sich flach auf den Bauch und blickte unter jedes. Giacomo war nicht zu sehen. An der Stirnseite des kühlen Raumes mit der flachen Ebenholzdecke blieb er stehen, sah zurück und überlegte. Wer konnte der Eindringling gewesen sein? Müßig, darüber zu spekulieren, denn genau genommen kam jeder der Brüder infrage.
Von der Existenz des Briefes, der allerdings nur eine Kopie des Originals war, das der Kaiser von Byzanz und danach Friedrich Barbarossa erhalten hatten und das schließlich im Lateran lagerte, wusste allerdings nur der Abt. Philippus musste zu ihm gehen und die Sache aufdecken. Aber halt! Eine Hitzewelle überflutete Philipp bei dem Gedanken – konnte er Abt Zaragon angesichts der Sachlage überhaupt trauen? Und selbst wenn! Würde er sich mit dem Eingeständnis des Verlustes nicht große Nachteile verschaffen? Wenn der Abt sah, dass Philipp seine Sorgfaltspflicht verletzt hatte, und das in einer so wichtigen Angelegenheit! Nein, damit stand alles infrage, der ehrwürdige Vater würde ihm womöglich die gesamte Verantwortung für das Schriftdokument entziehen. Das konnte er nicht riskieren. Also, was war zu tun?
Er musste auf die Suche gehen, eigene Nachforschungen anstellen. Von der Existenz dieses Briefes und der angemessenen Geheimhaltung hing seine eigene Zukunft ab.
Im Kloster blieb es ruhig. Kein Laut störte den Hitzefrieden der Nachmittagszeit. Philipp überfiel ein Gefühl völliger Einsamkeit, wie er es seit seiner Kindheit im Lateran nicht mehr gehabt hatte. Er war allein. Alles zog sich von ihm zurück. Es war der Beginn eines Verhängnisses ... Aber nein, Unsinn!, schalt er sich, das macht nur diese bleierne Hitze auf den Mauern und diese lähmende Stille in der Ruhezeit des Nachmittags. Aber aus dem Eindruck der Leere heraus, in die er haltlos hinunterzufallen drohte, entschloss er sich, doch den Abt aufzusuchen. Er musste die schreckliche Nachricht einfach an eine Instanz weitergeben. Dann war er zwar die Verantwortung nicht los, aber er teilte sie mit jemandem.
Mit langsamen Schritten betrat er den vom Kloster getrennten Abtshof. Vorsichtig klopfte er an die Tür zum Arbeitszimmer des ehrwürdigen Vaters. Von drinnen ertönte sofort eine gedämpfte Stimme, die ihn aufforderte, einzutreten. Er betrat das dunkle Zimmer.
Der ehrwürdige Vater hatte die Angewohnheit, sämtliche Vorhänge zuzuziehen. Seine schwachen Augen vertrugen keine Helligkeit. Philipp versuchte, sich im Halbdunkel zu orientieren. Der Abt saß auf dem Stuhl am Fenster, mit dem Rücken zur kalten Wand, und sah ihm angestrengt entgegen. Sein lang gezogenes Gesicht mit den harten Konturen schimmerte bleich. Er trug wie immer das dunkle Habit des Klosters, seine Füße waren nackt.
»Nun, mein Sohn?«
»Abt, ehrwürdiger Vater – ich habe ein Anliegen.«
»Davon gehe ich aus, Magister.«
Lag Spott in seiner Stimme? Philipp riss, sich zusammen. »Abt, es gilt, etwas Entsetzliches zu melden, ... einen Raub. Der – Brief ist verschwunden. Ein Einbrecher. Ich war im Kreuzgang und überließ Giacomo ...«
Der Abt hob die Hand. »Ich habe nichts gehört! Ich will auch nichts hören! Das kann nicht sein! ...«
»Und doch ist es so, Abt.«
»Von diesem Brief – dem Original ohnehin und auch seiner Kopie – für die wir zuständig sind, hängt alles Geschehen im kirchlichen Bereich der nächsten Zeit ab, der Segen des Heiligen Vaters, das Seelenheil der Christenheit, das wisst Ihr. Wenn er in falsche Hände gerät! ... Er ist geraubt?! Das wagt Ihr, mir zu sagen? Wenn das wahr ist, dann beschafft ihn wieder, und wenn Ihr ihn habt, dürft Ihr wiederkommen!«
Hatte Philipp etwas anderes erwartet? Er machte Anstalten, noch etwas zu sagen, er wollte beruhigen, erklären. Aber der Abt sagte scharf: »Beschafft ihn wieder. Geht!«
Philipp antwortete nicht, er nickte nur stumm und verließ den Raum, allerdings nicht ohne die Tür lauter zuzuschlagen, als es statthaft gewesen wäre. Draußen stand er einen Moment lang ratlos. Was sollte er jetzt tun? Zunächst einmal musste er in sein Zimmer zurückgehen, nach Spuren suchen, vielleicht war der Zwerg inzwischen wieder aufgetaucht.
Und wenn nicht ...
Giacomo blieb verschwunden, das entsprach ganz und gar nicht seinen Marotten, die er hier in Kastilien angenommen hatte. Im Gegenteil ging er dem Magister oft durch seine ständige, listige Gegenwart auf die Nerven. Im Kloster gab es natürlich viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Aber warum versteckte er sich? Philipp versuchte, die Situation zu rekonstruieren. Es gab nur eine Tür zum Schreibzimmer, der Eindringling war über den Gang im ersten Stockwerk gekommen, an dem zu beiden Seiten die Klausen der anderen Brüder lagen. Da in den Konventbereich des Klosters keine Laien hineinkamen, musste sein ungebetener Besucher aus den Reihen der Konventualen sein. Ein Mitbruder! Oder hatte Giacomo seine ungewaschenen Finger im Spiel? Nein, entschied Philipp, der Gnom war ihm ergeben, und nach seinem peinlichen Verhör auch viel zu feige für irgendeine unbotmäßige Tat.
Was blieb ihm übrig, als die Zellen der Mönche aufzusuchen, eine nach der anderen, vierundzwanzig insgesamt. Irgendwo musste der Brief sein. Vielleicht wollte ihn jemand nur ausleihen? Unsinn! Niemand sonst wusste von dem Dokument, das jener sagenumwobene Herrscher ihnen geschickt hatte. Es war ein Geheimnis, so tief, wie es die Zusammensetzung des neuen Weihrauchs aus dem fernen Osten war, um das es schon Kriege gab.
Philipp seufzte, die Rolle eines Ermittlers gefiel ihm gar nicht, lieber hätte er sich wieder an die Übersetzung des Briefes aus dem geheimnisvollen Reich jenseits der Christenheit gemacht. Er gab sich einen Ruck und trat auf den Gang hinaus.
Die Brüder hielten noch nachmittägliche. Ruhe, aber die Stunde war gerade zu Ende, und er konnte stören, ohne Schimpf zu ernten. Er klopfte an die erste Tür zur Linken, die zum Raum neben dem seinen führte. Ein dumpfes Geräusch war drinnen zu hören, dann wieder Stille. Philipp klopfte erneut. Keine Antwort.
»Bruder Josué?«
Kaum hatte er den Namen des Mönches ausgesprochen, hörte er von jenseits der dunklen Eichentür ein unterdrücktes Geräusch. Es klang wie ein Schluchzen. Dann rannte jemand davon. Philipp spürte ein ekelhaftes Kribbeln im Nacken. Deutlich vernahm er sich entfernende Laufgeräusche. Durch welche Tür wollte der Bruder verschwinden, es gab keine zweite in den Zellen. Und wohin?
Philipp klopfte noch einmal, nichts geschah. Er beschloss, sich mit Gewalt Eingang in den Raum zu verschaffen. Aber das war gar nicht nötig, denn die Tür war nicht verriegelt, wozu aber jeder Bruder während der Ruhezeiten verpflichtet war. Die Tür ging leicht nach innen auf, als er die Klinke herunterdrückte.
»Bruder? Verzeiht, Bruder! ...«
Philip brach ab, die Zelle war verwaist. Im ersten Moment wollte er umkehren, aber dann machte er sich klar, dass bei seinem Klopfen jemand hier gewesen war. Und hing nicht Schweißgeruch in der Luft? Aber – ein unchristlicher Fluch formte sich auf seinen Lippen – wohin sollte der Bruder gegangen sein? In einem Augenblick des Erschreckens sah Philipp, dass am Fensterrahmen ein Leinentuch verknotet war. Schnell trat er an die Öffnung. Das Leinentuch endete gut und gern fünf Meter über dem Boden, unten, im weichen Sand des Weges, Spuren nackter Füße. Philipp sah selbst von hier oben deutlich die abgespreizten Zehen, die Füße waren beim Sprung tief eingesunken. Bruder Josué!, dachte er in einem Anflug von schmerzhafter Erinnerung an den jungen, liebenswerten Zimmernachbarn.
Philipp hielt sich nicht mit Gedanken auf. Er raste mit klappernden Sandalen hinunter in den Kreuzgang, vielleicht konnte er die frischen Spuren des Flüchtigen eine Weile verfolgen. Unten begegnete er einem anderen Bruder, den er nach Josué fragte. Er erhielt nur ein stummes, verwundertes Kopfschütteln als Antwort. Erst auf dem sauber geharkten Sandweg sah er wieder Fußspuren, sie führten geradewegs zum Durchgang nach dem Kapitelsaal.
Philipp lief mit gleichmäßigen Bewegungen den Weg entlang und über die wenigen Steinstufen, die in den Saal hinunterführten. Hinter dem Eingangsportal erwartete ihn jemand.
***
Eine Hand strich über den Brief und glättete ihn. Die Hand war braun, mit Spuren von Altersflecken, das Pergament schimmerte glatt, weiß, geheimnisvoll mit seiner Schrift aus roter Tinte. Jetzt kam die Hand, die einen Siegelring trug, auf dem Papier zur Ruhe, lag wie eine Spinne darauf, und ein befriedigtes Knurren war zu hören.
»Apostel. Deine Botschaft. Du Hund!«, murmelte eine brüchige Stimme.
Die Gestalt, die jetzt in den Lichtkreis des Kerzenhalters trat, war so alt wie die Stimme, greisenhaft. Aber das Lächeln im Gesicht war jung und boshaft. Es drückte Triumph aus. Das Lächeln triumphierte über etwas, das mehr bedeuten musste, als ein Brief es sein konnte. Es war etwas im Dunkeln, in der Vergangenheit, das den Mann im roten Ornat triumphieren ließ, und sein erstarrtes Wesen drückte aus, dass er ganz in dieser Vergangenheit zu leben schien. Zumindest verweilten seine Gedanken dort und holten sich reichlich Nahrung, während die Gegenwart des kleinen, schmucklosen Zimmers mit dem scharlachroten kastilischen Kreuz der Santiagoritter über dem Türsturz keinen Anlass zur Freude bot.
Er las laut: »An Unserem Tisch essen täglich außer denen, die zufällig kommen, 30 0000 Menschen, und alle erhalten Geschenke aus Unserem Vorrat. Unser Tisch ist aus kostbarstem Smaragd und wird von vier Amethystsäulen getragen. An Unserm Hofe haben Wir viele Diener, die hohe geistliche Ämter und Würden innehaben. Unser Hofmeister ist Primas und König, Unser Mundschenk König und Erzbischof, Unser Kammerherr Bischof und König, Unser Marschall König und Archimandrit, Unser Küchenmeister König und Abt ...«
Die Stimme brach ab. Nach einer Pause ging sie in ein hartes Lachen über. »Du Hund!«, murmelte der Mann noch einmal. »Du hast es also tatsächlich überlebt. Der Orden hat dir nichts anhaben können, du bist untergetaucht, und nun wieder hervorgekrochen unter den stinkenden Röcken der ungläubigen Teufel und hast dein eigenes Reich gegründet. Nun gut, endlich zeigst du dich in vollem Licht. Du sollst verdorren!«
Nein, es war nichts Friedfertiges an dem Mann, der so sprach, nichts Versöhnliches glättete seine Züge, seine ganze Erscheinung drückte in der Welt des Sichtbaren aus, was er dachte. Er schien der personifizierte Hass zu sein. Und Hass verbrannte noch einmal seine Stimme.
»Du erreichst uns nicht, Presbyter. Deine Botschaften werden nicht ankommen. Wir werden vor dir da sein, wenn du noch den Schlaf des Selbstgerechten schläfst. Du wirst sterben!«
Er blies die Lichter aus, der Kerzenrauch umwölkte einen Moment lang sein hageres Haupt wie Schwefeldampf. Er rückte seine Kleider zurecht. Dann verließ er lautlos den Raum.
***
Philipp erkannte ihn sofort. Es war der Großinquisitor. Er sah den Magister mit einem so finsteren Blick an, dass Philipp schauderte. Philipp konnte es nicht glauben. Was machte der hohe Herr hier in diesem Kloster? Wusste der Abt überhaupt von seiner Anwesenheit?
»Stell keine Fragen!«
»Nein, Eminenz, aber ...«
»Wir haben dich erwählt, mein Sohn! Du wirst nach Abessinien reisen, um das Reich des Priesterkönigs Johannes zu finden. Die Mönche vom Santiago-Orden werden dich begleiten. Es sind gute, aufrechte Christen. Sie werden dich und deine Begleiter beschützen. Du kannst dir drei Personen aussuchen, die dein Vertrauen haben. An der afrikanischen Küste, dort wo das Reich der Almorawiden die Festung Bougie errichtet hat, werdet ihr mit der Abordnung des fränkischen Kaisers zusammentreffen, die aus Sizilien übersetzen. Es werden weitere fünfzig Mann unter Waffen sein.«
»Aber ... warum ich?«, stammelte Philipp.
»Du bist ein Geheimnisträger. Du kennst den Brief. Und der Heilige Vater in Rom vertraut dir, weil du sein Leibarzt gewesen bist. Er hat dich gerufen. Du wirst dem hochheiligen Priesterkönig, erlauchten und ausgezeichneten König der drei Indien, den Antwortbrief des Heiligen Vaters überbringen. Diese Antwort ist noch wichtiger als des Priesterkönigs Brief, denn darin ermahnt unser Heiliger Vater den Presbyter, sich der allein selig machenden römischen Kirche zu unterwerfen und bietet ihm dafür ein Bündnis im Kampf gegen die Muslime an. Außerdem erklärt sich der Heilige Vater bereit, in Rom wie in Jerusalem den Christen des Johannes-Reiches Altäre zu stiften, um damit die Einheit ihrer Kirche zu bezeugen. Du siehst – diese Antwort muss den Priesterkönig unbedingt erreichen.«
»Der heilige Vater! ...«, entfuhr es Philipp entgeistert. »Aber ...«
»Keine Fragen!«, sagte der Großinquisitor scharf. »Du reist in einer Woche. Wen willst du mitnehmen?«
Philipp schüttelte den Kopf. »Es kommt alles so schnell ... Was wird mit dem Brief? Mit der Abschrift? Wer soll sie ...«
»Um den Brief kümmern sich andere. Du bist der Verantwortung dafür enthoben.«
»Aber Eminenz ...«
»Keine Einwände!«
»Natürlich ...«
»Wen also!«
Philipp überlegte. »Es gibt ein junges Ehepaar in Cádiz, die Santels. Sebastian hat den gleichen Beruf wie ich – wenn man abzieht, dass er nicht im Dienst der Kirche arbeitet ... Aber er kennt alle alten Sprachen und Schriften.«
Misstrauisch starrte der Großinquisitor ihn an. »Santel? Verfertigt er nicht ebenfalls eine Abschrift des Briefes für die Verbündeten?«
»Das stimmt. Darüber hinaus verfertigt er Abschriften in Deutsch, Englisch, Russisch, Serbisch, Okzitanisch, Italienisch, Portugiesisch und Hebräisch. Er spricht im Gegensatz zu mir, der ich nur des Lateinischen, Italienischen und Spanischen mächtig bin, alle diese Sprachen. Ich kenne ihn seit meiner Ausbildung in Rom. Wir lernten zusammen. Seine Frau Eva ist ein tatkräftiges Weib und sie wird ihn nicht allein ziehen lassen. Ich hätte sie beide gern an meiner Seite ...«
»Nun gut. Ich werde Order erlassen. – Willst du noch jemanden dabeihaben?«
»Meinen Diener, Giacomo. Er ist jedoch verschwunden, ich weiß nicht ...«
»Wir werden ihn suchen. Er wird wieder auftauchen, glaub mir. – Halte dich bereit, mein Sohn!«
Dem jungen Magister schwirrte der Kopf. Afrika, Äthiopien, der Priesterkönig Johannes – wo liegen diese Länder überhaupt, vor oder hinter dem Rand der Welt ... ? Sind sie vielleicht sogar das Paradies, aus dem Adam vertrieben wurde? Papst Klemenz hatte ihn ausgewählt. Obwohl er, Philipp, wegen der Vorfälle um seinen Diener Giacomo vor zwei Jahren auf Abschied aus dem Lateran gedrungen hatte. Manchmal ist die Freundschaft eines großen Mannes eine unerträgliche Last. Aber alles liegt in Gottes Hand .. .
Die schlaksige Gestalt des jungen Magisters straffte sich. »Wenn sie mich rufen, die Herren, dann werde ich mich nicht verweigern! Ich werde ihnen zeigen, wozu ein Magister fähig ist, auch wenn er nicht die Messe lesen darf. Ich stehe bereit und ginge es geradewegs in die Hölle ...
AL ANDALUS. CÁDIZ.
Der königliche Besucher aus Burgos war gewandet in die Tracht der kastilischen Würdenträger, schwarzer Umhang, rote Schärpe, Schwert, Stiefel, Federbusch. Auf seiner Brust prangte an einer Goldkette das Wappen Kastiliens mit den drei Burgtürmen, er war also offenbar Mitglied des königlichen Geheimrates. Ein schwerer weißer Mantel sollte ihn gegen die Kälte des Hochlandes schützen, erwärmte ihn jedoch nur ungebührlich unter den Strahlen der Sonne. Er beratschlagte sich mit seinem Gefolge aus weltlichen und geistlichen Herren. Etwa zehn Hidalgos, Männer von meist niederem, aber einflussreichem Adel aus der gesamten Region, standen ein paar Schritte abseits.