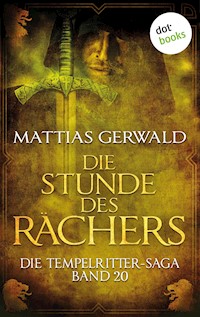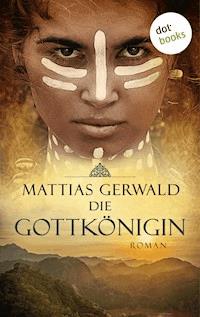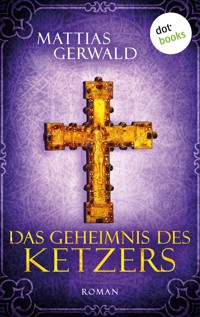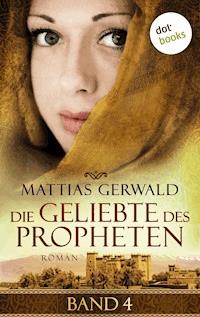6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist sie die wahre Autorin des Koran? „Die Geliebte des Propheten“ von Mattias Gerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Mekka und Medina im Jahr 622. Sie ist die Schönste im Land der aufgehenden Sonne: Aischa. Auch der verarmte Schafhirte Mohammed wird sofort in ihren Bann gezogen. Schnell wird Aischa zu seiner Lieblingsfrau – und engsten Vertrauten. Nur im Beisein der schriftkundigen Aischa erhält der Analphabet Mohammed die Offenbarungen Gottes und wird so zum Prophet des Islam. Als Mohammed stirbt, ist es an Aischa, das Werk ihres Geliebten und Ehemannes in die Welt zu tragen und die heilige Botschaft zu verbreiten. Doch für ihren leidenschaftlichen Glauben muss sich die junge Frau in ungeahnte Gefahren begeben … Ein fundierter, sorgfältig recherchierter, historischer Roman voller Sympathie für eine starke Frau und voller Respekt für eine der großen Weltreligionen – hochspannend und hochaktuell!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mekka und Medina im Jahr 622. Sie ist die Schönste im Land der aufgehenden Sonne: Aischa. Auch der verarmte Schafhirte Mohammed wird sofort in ihren Bann gezogen. Schnell wird Aischa zu seiner Lieblingsfrau – und engsten Vertrauten. Nur im Beisein der schriftkundigen Aischa erhält der Analphabet Mohammed die Offenbarungen Gottes und wird so zum Prophet des Islam. Als Mohammed stirbt, ist es an Aischa, das Werk ihres Geliebten und Ehemannes in die Welt zu tragen und die heilige Botschaft zu verbreiten. Doch für ihren leidenschaftlichen Glauben muss sich die junge Frau in ungeahnte Gefahren begeben …
Ein fundierter, sorgfältig recherchierter, historischer Roman voller Sympathie für eine starke Frau und voller Respekt für eine der großen Weltreligionen – hochspannend und hochaktuell!
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: Novembermord, Engelmord, Regenmord und Frühjahrsmord. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen..
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta
Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi
Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder
Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen
Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers
Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons
***
Neuausgabe April 2015
Copyright © der Originalausgabe 2006 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Zurijeta
ISBN 978-3-95824-191-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Geliebte des Propheten an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Mattias Gerwald
Die Geliebte des Propheten
Roman
HISTORISCHE NOTIZ
Aischa, Tochter der Alexandrinerin Zainab bint Ruman und des Attiq ibn Uthman, den man in seiner Heimatstadt Mekka Abu Bah nannte, lebte zwischen 613 und 678 n. Chr. Die »Geliebte des Propheten« und spätere Lieblingsfrau Mohammeds wurde vor dem Auszug der Muslime aus Mekka im Juli/August 622 als Neunjährige mit Mohammed verheiratet, die Ehe jedoch erst nach der Hedschra in al-Madinat vollzogen, dem Jithrab der Juden und heutigen Medina.
Aischa war »das lebende Gedächtnis« des letzten Propheten Mohammed. Als dieser im Jahr 632 starb, sorgte die Neunzehnjährige für die schriftliche Fassung der Offenbarungen, die er ihr diktiert hatte, und bereitete damit den Koran vor. Die junge Frau träumte nach Mohammeds Tod den Traum von der Schaffung des islamischen Weltreichs – auch mit militärischen Mitteln – weiter und wurde zur strahlenden Figur ihrer Zeit, zur »Mutter der Gläubigen«. Sie war die einzige Frau, die im Islam jemals eine führende Rolle spielte. Aischa ist neben Mohammed in Medina bestattet. Millionen Menschen pilgern Jahr für Jahr zu ihren Gräbern.
Dieser Roman hält sich an die historischen Tatsachen, auch was die Personen der Handlung angeht. Wo die Originalquellen einander widersprechen, werden die eingängigsten und spannendsten Versionen verwendet. Einige Ereignisse wurden nur dann in ihrer chronologischen Abfolge umgestaltet, wenn es der erzählerischen Notwendigkeit entsprach.
Wichtige Personen der Handlung
Mohammed ibn Abdallah – Kaufmann
Aischa bint Bakr – seine Geliebte und spätere Lieblingsfrau, die »Mutter der Gläubigen«
Abu Bakr – Vater Aischas aus der Sippe Taim, engster Vertrauter Mohammeds
Zainab bint Ruman – seine Frau, Mutter Aischas
Zayd ibn Harith – abessinischer Sklave, Vertrauter Aischas
Zainab, Rukaija, Umm Kulthum, Fatima – Mohammeds Töchter
Ali ibn abi Talib – Ehemann Fatimas und vierter Kalif, Aischas Hauptgegner
Chadidscha bint Chowailid – erste Frau Mohammeds
Sawdah – zweite Frau Mohammeds
Hafsah – Tochter Umars, vierte Frau Mohammeds
Umm Salama – fünfte Frau Mohammeds, Quraischitin
Zainab bint Chuwalid – achte Frau Mohammeds
Umm Habibah – Tochter Abu Sufyias, zehnte Frau Mohammeds
Safiya – Jüdin vom Stamm der Nadir, elfte Frau Mohammeds
Maryam – koptische Sklavin, zwölfte Frau Mohammeds
Abu Talib ibn Muttalib – Führer der Sippe Haschim
Umar ibn Chattab – aus der Sippe Adi, zweiter Kalif
Uthman ibn Affan – aus der führenden Sippe Abdschams, dritter Kalif
Hamzah ibn Abdalmuttalib – Onkel Mohammeds
Abbas ibn Abdalmuttalib – Onkel Mohammeds, Stammvater der späteren Abbasiden-Dynastie
Bilai – afrikanischer Sklave, erster Muezzin der Tazaqqa
Waraqa ibn Naufal – Christ
Abu Sufyian – Führer der reichen mekkanischen Sippe Abdschams, Quraischit
Umm Hind bint Rabia – seine Frau, Hauptgegnerin Aischas
Abu Dschahl – Führer der bedeutenden mekkanischen Sippe Machzum
Ikrima – Sohn des Abu Dschahl
Abu Lahab ibn Abdalmuttalib – Haschimit und Gegenspieler Mohammeds
Suhayl ibn Amr – Ratsherr der Quraisch, Führer der mekkanischen Sippe Amir
Chaud ibn al-Walid – bedeutender Vertreter der mekkanischen Sippe Machzum
Abu Walid – führender Vertreter der Sippe Abdschams
Nadr ibn Harith – aus der Sippe Abdaddar, »Teufel der Quraisch«
Bara ibn Manir – Führer der Chasradsch in Medinta
Salman – Diener Aischas
Safwan ibn Muattal – vom Stamm Sulaym, in die Verleumdungsaffäre gegen Aischa verwickelt
Jamal ibn Uthman – judaisierter Araber, enger Vertrauter Aischas
Tulba – Reitergeneral, militärischer Berater Aischas
Ferner:
Männer und Frauen der arabischen Sippen Aus und Chasradsch aus Jathrib (dem heutigen Medina); vom Stamm der Chuzaa aus dem Küstenstreifen zwischen Mekka und Medinta; vom mächtigsten mekkanischen Stamm der Quraisch; vom bedeutenden zentralarabischen Stamm der Hawazin; von den drei großen jüdischen Stämmen von Medinta Nadir, Qurayza, Quaynuqa; vom Stamm Sulaym im Südosten von Medinta, sowie Bewohner und Würdenträger der Städte Medinta, Mekka, Taif.
Im Hintergrund:
Ibrahim, der Abraham der Bibel und Erbauer der Kaaba; der vorletzte Prophet Gottes, Jesus von Nazareth; der Erzengel Gabriel; die drei Töchter Allahs.
Die Schreibweise der arabischen Namen wurde der deutschen Phonetik angeglichen.
ERSTES BUCH
1. DIE TANZENDEN
Sie waren alle gekommen. Und so war der Platz bis hinunter zum tosenden grünen Meer gefüllt, und die Menschen darauf waren selbst ein Meer aus bunt gekleideten Körpern und verhüllten Köpfen – ein lebendiges Meer, dessen Wellen im Sonnenlicht des frühen Abends wogten.
Zur anderen Seite, in Richtung Osten, türmten sich im frühen Abendlicht die Berge aus rotem Sand mit ihren weichen, weiblichen Formen und den faltigen Verwehungen des ständigen Windes. Den flachen Streifen der Ebene davor, von Steinen und rauem Gras übersät, durchzog die Karawane der Kamele. Mit ihren langen Beinen und vorgereckten Hälsen sahen sie in der Ferne wie Insekten aus, die beharrlich einem uralten, nur ihnen bekannten Weg folgten. Und sie näherten sich so zögernd, als wäre es ihnen zuwider, die unendliche Einsamkeit und feierliche Stille der Wüste zu verlassen, um den Staub und das Getöse dieser Stadt dagegen einzutauschen. Doch sie kamen näher. Und schließlich waren sie da. Sie hielten würdevoll schnaubend an den Tränken vor den Tanzplätzen. Und die Waren aus Hadramaut und Oman wurden abgeladen.
Die Tanzenden bemerkten nichts von der Karawane. Sie bewegten sich weiter in den berauschenden Wellen ihres eigenen Meeres, weich und dennoch ekstatisch, in sich versunken oder Schreie ausstoßend, die sie überwältigten, zu einer treibenden Musik von Rasseln, Trommeln und Hirtenflöten, der sie manchmal mit fassungslos erhobenen Köpfen lauschten, weil sie ihnen eine Botschaft mitteilte.
Unbeachtet von den Kamelen und den Tanzenden, ohne Interesse für die Wogen aus rotem Sand und die Wellen der weiß gekleideten Menschen mit Burnussen und Turbanen, saßen am Rand des Tanzplatzes in der Moschee die Priester-Derwische vom Stamm der Mustaliq auf schmutzigweißen, kunstvoll gewebten Baumwollteppichen. Helles Licht fiel von draußen durch die offenen Höhlen der Bogenfenster auf sie. Ihre langen Finger glitten immer wieder über ihre Kinnbärte hinweg oder ließen bunte Rosenkränze laufen, und ihre braun gegerbten, zerfurchten Gesichter verfinsterten sich.
Denn während zwischen den schlanken Elfenbeinsäulen der Moschee mit den blättrigen Kapitellen Stille herrschte und die roten Vorhänge in den grünen Türstürzen sich nur in mäßiger Bewegung in der frischen Brise vom Meer her blähten, entstand nun immer mehr Lärm.
Kindergeschrei näherte sich. Die Köpfe mit den weißen, zylindrischen Kappen aus geklöppelter Wolle und die Oberkörper in den kragenlosen Hemden und bunten Seidenwesten wandten sich in Richtung des Geräusches. Die Mustaliq wurden ungehalten. Nackte, auf den Steinfliesen platschende Füße näherten sich rasch.
Und dann stand ein Mädchen in ihrer Mitte.
Ihr Gefolge blieb stehen und warf sich dann ehrfurchtsvoll auf den kalten Steinboden aus fugenlosen roten Ziegeln. Das vielleicht siebenjährige Mädchen aber stand stocksteif und blickte neugierig und trotzig zugleich aus beinahe schwarzen, funkelnden Augen auf die Männer, die mit überkreuzten Beinen auf dem Boden hockten. Dann sagte das Mädchen etwas, das in dieser hochfliegenden Säulenhalle noch niemals zu hören gewesen war.
»Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden. So erschuf ich die Welt.«
»Was redest du, Kind?«, entfuhr es einem der alten Männer. »Du bist hier im Heiligtum. Schweig still.«
Die anderen schauten das hübsche Mädchen mit den lodernden, rotgoldenen Haaren, die ihr in einem merkwürdigen Lichtschimmer auf die elfenbeinfarbene Schulter fielen, verwundert an. Wer war sie? Und dann wurde es ihnen bewusst. War sie nicht die kindliche Verlobte dieses vor zwei Tagen angekommenen Kaufmanns aus Mekka, der sich verdächtig gemacht hatte, weil er immer häufiger in den versteckten Höhlen des Berges Hira als in den Häusern seiner Heimatstadt lebte? Der Mann, der sich anschickte, die Familien auseinander zu reißen und die alten Göttinnen zu stürzen?
»Allahu akbar, Gott ist größer! Es gibt nur einen Gott. Gelobt sei Allah!«
»Jetzt ist es genug! Wie kommst du dazu, uns im Gebet zu stören! Verschwinde! Geh zurück zu den Tanzenden und zum Mob auf der Straße.«
»Aber es sind nur die Worte, die der Prophet gehört hat und die er mir heute Morgen diktierte, damit ich sie aufschreibe. Und jetzt erzähle ich euch davon. Seid ihr Priester nicht froh darüber, aus erster Hand von Gott zu hören?«
»Kleine Bilqis, Prinzessin, du bist sehr hübsch. Nun sei ein liebes Mädchen und mach dich aus dem Staub. Wir sind an deinem Propheten und seinem Gott nicht interessiert. Er ist bloß ein verrückt gewordener Poet aus der Stadt der Kaaba, der schöne Worte macht. Wir beten unsere alten, wahren Frauengötter an, die Ibrahim uns schenkte.«
»Aber ihr betet nicht genug. Ihr murmelt doch nur zahnlos in euch hinein. Fünfmal müsst ihr beten: zuerst bei Anbruch der Morgendämmerung, dann zur Mittagszeit, wenn die Sonne sich zu neigen beginnt, dann am Nachmittag, wenn der Schatten, den ihr werft, so lang ist wie ihr selbst, dann bei Sonnenuntergang und schließlich, nachdem das Abendrot verglüht ist.«
»Hört euch diesen dürren Klugscheißer an. Wir brauchen keine anderen Offenbarungen, Klugscheißer!«
»Und schon überhaupt nicht von einem kleinen dummen Mädchen, mag es noch so hübsch sein und rote Haare haben.«
Die Derwisch-Priester nickten einander zu. Aischa fand ihre Worte nicht beleidigend. Die Mustaliq waren nun einmal selbstgefällig und eingebildet, das kannte sie schon.
»Ich habe die Worte aus erster Hand. Und ich verkaufe sie euch. Denn wir sind arm und brauchen Dirham, um uns Lederzeug kaufen zu können. Deshalb sind wir hier in eurer langweiligen Hafenstadt, wo man während des Tanzfestes Geschäfte machen kann. Weshalb sollten wir sonst hier sein? Auch müssen wir endlich unsere Moschee bauen und die Wohnungen für die Familie des Propheten.«
»Höre, Bilqis …«
»Ich heiße Aischa bint Abu Bakr.«
»Höre, Aischa«, sagte der Derwisch mit erzwungener Geduld. »Wir kennen deinen Allah, gelobt sei sein Name! Er ist unser eigener Hochgott, wie der Gott der Juden, und hier in Jiddah steht der Schrein zu seiner Verehrung, ebenso wie zur Verehrung unseres Gottes Hubal, der auch in eurer Kaaba in Mekka angebetet wird. Verstanden?«
Aischa sagte mit verächtlicher Miene: »Hubal! Eine Art Mensch aus Karneol mit einem goldenen Arm, auf den Lospfeile geschossen werden, um seine Meinung zu ergründen. Ich muss lachen.«
»Ob du lachst, kleines Ding, spielt keine Rolle. Wegen Hubal kommen ja die Pilger zum Tanzfest, um zu opfern und Allah im Haram anzubeten, jenem Heiligtum, in dem er wohnt. Doch Allah kann nicht zu deinem Propheten sprechen, er spricht zu niemandem. Wo kämen wir denn hin, wenn Gott zu einem Kaufmann spricht, der einst Schafe hütete, aber nicht zu uns, den Priestern, die ihn ständig befragen … oder es zumindest versuchen, wenn wir nicht von kleinen, vorlauten Mädchen daran gehindert werden?«
Das Mädchen schüttelte trotzig den Kopf. »Es gibt keinen Propheten, der nicht Schafe gehütet hat. Es ist die Voraussetzung.«
»Kindergewäsch!«, schnaubte der Priester. »Viel wichtiger als Allah, den wir kennen, sind uns die bösen und die guten Geister, die in Gestalt von Tieren die Welt durchstreifen. Hörst du zu? Und vor allem die banat Allah, die drei Töchter Allahs, die Göttinnen, die unseren Alltag bestimmen, weil sie die Geister kennen. Sie sind stets gegenwärtig. In Kriegszeiten sind sie sogar anwesend, und sie sprechen tatsächlich zu uns. Übrigens, sie mögen kleine, rotznäsige Mädchen nicht. Kennst du sie?«
»Warum sollte ich sie kennen?«
»Weil sie …«
Einer der Derwische blickte anheischend in die Runde und sagte rasch: »Es sind al-Lat, die Göttin der Sonne und der Fruchtbarkeit, al-Uzzah, die Mächtige des Morgensterns und der Raubzüge, und al-Manat, die Göttin des Schicksals und des Todes.«
Die Stimme des Mädchens zitterte leicht, doch tapfer sagte sie: »Ihr dürft keine anderen Götter anbeten als ihn, den Allmächtigen, den Allerbarmer.«
Die alten Männer schauten sich an, und ein Grinsen legte sich auf ihre wettergegerbten Gesichter. Einer spuckte aus. Sie nahmen das Mädchen nicht ernst. Aber einige rutschten unruhig auf ihren Matten herum.
»Geh jetzt!«, herrschte einer der jüngeren Derwische das Mädchen an. »Kinder haben hier nichts zu suchen. Und Mädchen schon gar nicht. Deine Anwesenheit beleidigt die Würdevollen. Fege euren Hof oder füttere eure Kamele.«
»Wir haben keine Kamele, Herr, wir sind zu arm. Wir hatten einmal welche, aber in Mekka verbietet man uns, mit ihnen Geschäfte zu machen. Und Chadidscha …«
Einer der Derwische warf dem Mädchen mit verächtlicher Miene einen Dirham hin. Die Münze klirrte in der Stille laut auf dem Steinboden. Das Mädchen hob sie auf, blieb aber stehen. Sie schwor sich insgeheim, diese Münze eines Tages zurückzugeben und hörte schon jetzt das Geräusch des Metalls auf den Steinfliesen.
»Nun, was ist jetzt noch?«
Das Mädchen wirkte plötzlich unsicher. »Sind eure drei Göttinnen in der Lage, eure Gedanken zu erkennen?«
»Natürlich nicht. Wir rufen sie auch nur, wenn wir sie brauchen.«
»Ha!« Triumphierend wedelte das Mädchen mit den dünnen Armen. »Dann taugen sie noch viel weniger. Allah nämlich ist immer anwesend. Er sucht sich den aus, den er aussuchen will. Es gibt keinen Winkel, in dem sich Derwische oder Priester vor ihm verstecken könnten!«
»Jetzt reicht’s!«
Einer der Männer sprang auf und wollte die Kleine verscheuchen.
Aber sie hatte schon auf den nackten Hacken kehrtgemacht und rannte mit wehenden Haaren und wehendem Kleid hinaus. Die anderen Kinder folgten ihr. Es waren einheimische Kinder; das Mädchen musste sie irgendwie beeindruckt haben, denn sie schienen ihr überall hin zu folgen. Womit fing das Mädchen sie? Vielleicht mit dem seltsamen Schimmer ihres goldroten Haares, den hier noch nie jemand gesehen hatte?
Der Lärm ebbte ab. Das Meer draußen, dieses große, sich ständig bewegende Tier, schien ihn nach und nach zu verdauen.
Gefolgt von den anderen Kindern, lief Aischa über den Vorplatz des Bethauses, der vom Grün des Khazumparks umsäumt war. Dann ging sie weiter zum Meer hinunter. Ihr Schritt verlangsamte sich allmählich. Nicht weil die Furcht vor den Derwisch-Priestern nachließ, sondern weil sie Zeit hatte.
Die Kinder riefen: »Du Aischa! Du Aischa! Ihr Haar hat die Sonne gestohlen!«
Aischa blickte sich nach allen Seiten um. Was sollte sie in diesem fremden, langweiligen Jiddah anfangen?
Die Stadt, die sich im Braun und Weiß ihrer Häuserwaben, an denen kunstvoll durchbrochene Balkone klebten, die Hügel emporschob, quoll über von Menschen. Es war Tanztag zu Ehren der drei Töchter Allahs, den man im Du’l-Hiddscha feierte, dem letzten Monat im Jahr. Es war ein Tag der Botschaften; dafür sorgten die Dichter, die auf Kisten standen und laut rezitierten. Und es war ein ausgelassener Tag, davon kündeten die offenen Garküchen, Brettspielplätze, an denen Masir gespielt wurde, Schänken und Weinstände. Und die meist abessinischen Schankmädchen versteckten sich durchaus nicht unter ihren Umhängen, die ärmellos und weit waren und an den Fesseln zugebunden. Aber die leiblichen Genüsse kamen erst nach Einbruch der Dunkelheit zu ihrem Recht.
Und es war Markttag. Die Souks hatten geöffnet und breiteten sich mit ihren Teppichen und Tischen auch im Freien aus, und jeder verkaufte seinen kleinen Teil.
Aischa griff sich im Vorbeigehen ein paar Datteln und spuckte die abgekauten Kerne empor. Bevor sie ihr auf den Kopf fallen konnten, war sie schon einen Schritt weiter.
Der Strom der Menschen teilte sich; er kam vom Hafen herauf und führte zu ihm hinunter. Pilger zu den Heiligtümern von Jiddah und zur Kaaba in Mekka waren auf kleinen Dhaus mit einem Lateinersegel eingetroffen. Mohammed versuchte, sie hier abzufangen, wie Aischa wusste. Denn in Mekka wurde es immer schwieriger für ihn, Handel zu treiben. Die herrschende Familie riss alles an sich.
Aischa hüpfte herum. Dann begann sie zu schwitzen und ging bedächtiger. Zur Mittagszeit war es unerträglich heiß, auch wenn die Brise ein klein wenig Frische mit sich brachte. Doch nichts dämpfte die Kraft der gnadenlosen Sonne, es sei denn, man tauchte in die schmalen Schluchten der alten Häuser ein, an denen auf Leinen, die sich beinahe berührten, Wäsche hing. Dort gab es kostbaren Schatten.
In Aischas Heimatstadt jedoch – dem flachen, im Kreis hingestreckten Mekka – versank man völlig in einer weißglühenden Gnadenlosigkeit, in der selbst die bunten Steine zu schmelzen schienen. Dort roch man auch nichts außer Hitze, nicht einmal den Kamelmist, der überall lag. Hier in Jiddah war alles voller Düfte; es roch nach Früchten, Salz, Weihrauch und Schweiß, nach Blut von Geschlachtetem und nach süßlichem Moschus, das wohlhabende Frauen sich an jene Stellen des Körpers schmierten, die behaart waren.
Aischa ließ sich von der wogenden Menge mitziehen. Sie fühlte sich wie in einer Welle und schloss die Augen. Überall spürte sie die Berührungen fremder Körper. Sie stellte sich vor, sie würde schweben und von den Bewegungen des Windes hin und her getragen wie einer jener Engel, von denen Mohammed erzählte. Als sie die Augen wieder öffnete, kam eine Herde Ziegen direkt auf sie zu. Sie sprang behänd zur Seite und atmete den Staub und den scharfen Geruch ein. Hirten schlugen fluchend auf die Tiere ein.
Ein Reiter auf einem schweißnassen Pferd kam vorbei. Pferde gab es hier selten, und Aischa bewunderte den seidigen, muskulösen Körper des Tieres, das sich jetzt aufbäumte und Schaumflocken spie. Ein Karren polterte auf zweigroßen Rädern heran. Aischa griff nach Nüssen; dann stellte sie sich am Rand des Marktplatzes unter ein Zeltdach. Müde ließ sie den Blick über die Stände und die Menschen, über Körbe, Karren, Säcke und Rohrgestelle schweifen.
Wo war Mohammed? Bei den Tanzenden unten am Meer? Aber die kauften nichts; sie waren verzückt wegen der Töchter Allahs und beteten ohne Besinnung. Ob Mohammed dennoch Erfolg gehabt hatte?
Das Mädchen verließ den Schatten und zog ihr blaues Kopftuch über.
Da stand Mohammed.
Er war so unerwartet aufgetaucht, dass Aischa erschrak. Er sah sie nicht. Sofort wollte sie zum ihm eilen, um ihn nach den Stunden der Abwesenheit zu begrüßen, doch etwas hielt sie zurück. Sie beobachtete Mohammed voller Stolz. Er war ein so ansehnlicher Mann und schön wie ein Märchenprinz. Und er bewegte sich so selbstsicher in seiner grünen Tunika. Sein dichtes, dunkles Haar wehte im Wind wie eine schwarze Fahne, denn er trug an diesem Tag keinen Turban.
Warum verbarg sie sich vor ihm?
Sie wusste keine Antwort, ja, eigentlich suchte sie auch keine. Sie empfand nur kindliche Freude, ihn zu beobachten, als wäre sie selbst unsichtbar und er ein Fremder aus einem abenteuerlichen, schönen Märchen, den sie in diesem Moment zum ersten Mal sah.
Und sie stellte sich vor, wie er jenen Tanz tanzte, den sie in der Nacht zuvor gesehen hatte, als sie in der Karawanserei schlief.
Im Dunkel einer Ecke, auf Decken eines Holzgestells, hatte ein nackter Mann auf dem Bauch gelegen. Er bewegte sich auf irgendetwas, das hin und her bebte. Oh, wie schön und anmutig waren diese Bewegungen gewesen. Aischa hatte diesen Tanz sofort nachmachen wollen, hatte dann aber gesehen, wie unter dem nackten Mann, der eine glatte, weiße Haut besaß, ebenso glatte, weiße Arme hervorkamen und den Mann umschlangen.
Aischa hatte gebannt zugeschaut und in ihrem Bauch ein süßes Ziehen gespürt, diese Empfindung aber nicht weiter beachtet. Als der Tanz der beiden, die wie zu einem einzigen Wesen verschmolzen waren, zu Ende ging, wollte sie Mohammed wecken und mit ihm über das Gesehene sprechen. Doch sie hatte gezögert und ihn dann doch nicht geweckt, denn sie hatte plötzlich Scheu verspürt. Zudem war er müde und brauchte seinen Schlaf. In Mekka gab es viele schlaflose Nächte.
Aischa folgte dem stattlichen Mann, der nur mittelgroß war, aber kräftig gebaut. Offenbar suchte er sie, denn von Zeit zu Zeit blieb er stehen, reckte den Kopf und drehte sich um die eigene Achse, wobei er den Blick in die Runde schweifen ließ.
Mohammed sah nie über die Schulter.
Am Meer, wo in den Lagunen rund ums Viertel Hay Al Qurayat jetzt rote Flamingos standen und ihr bizarres Spiegelbild ins grüne Wasser warfen, lösten nun andere Menschen die Marktbesucher und Händler ab. Die Wellen der ekstatisch Tanzenden schlugen wieder höher. Und Aischa hörte die Musik. Alles schien sich wie unter einem Zauber aufzulösen.
War es die Hitze, die alles verschmolz? War es das metallblaue Licht? Die Schlieren der sich bewegenden Menschenleiber? Die Wellen mit ihren Schaumkronen? Es war, als würden Himmel und Erde sich vereinigen, so wie die beiden Nackten in der Karawanserei sich vereinigt hatten.
Aischa war in eigentümlicher Stimmung. Es war etwas Kostbares.
Sie blickte in den wolkenlosen Himmel, hörte hinter sich die Schreie der Kinder, die ihr noch immer folgten und ihr jetzt winkten, mit ihnen in die Stadt zurückzugehen. Aischa überlegte einen Moment, ob sie der Aufforderung nachkommen sollte. Dann aber folgte sie dem Schatten des Mannes in der grünen Tunika. Es war ein gedrungener Schatten im gleißenden Mittagslicht. Dann reckte er die breiten Schultern, legte die Hände beschirmend über die Augen und sah den Tanzenden zu.
Bewegte auch er sich nicht ganz leicht, indem er die Hüften wiegte?
Aischa sah ihm eine Weile zu.
Dann kicherte sie belustigt und ging zu ihm.
2. DER WEISSE SCHIMMER
Das lange Tal wurde im Westen vom Bergriesen Abu Qubais abgeriegelt, im Osten durch den Jebel Hindi; nach Nord und Süd zog sich die Straße hin, die der heiße Wüstenwind immer wieder hoffnungslos verwehte.
Im Tal kochte jeden Tag die Hitze, sogar noch in der Nacht. Skorpione und giftige Schlangen, gefräßige Riesenameisen und ein tückischer Wurm, der sich in die Körperöffnungen bohrte, nisteten in diesem Tal. Es war nicht dazu geschaffen, vom Menschen bewohnt zu werden. Gerade deshalb hatten sie sich hier niedergelassen.
Die Bewohner der Stadt im Tal der Hitze, des Schweißes und der Gefahren glaubten, dass sich hier das Paradies befände. Zumindest war es nicht weit entfernt. Denn die Pforte zum Paradies befand sich mitten in der Stadt. Und es gab keinen, der nicht eines Tages durch die Pforte gehen wollte.
Die Pforte befand sich unmittelbar neben dem größten Brunnen der Stadt, der eine seit langem verschüttete Quelle umschloss. Das Heiligtum besaß die Form eines Würfels; in einer Wand eingemauert, befand sich ein Symbol mächtiger Götter. Das Heiligtum war Hubal geweiht, eine Gottheit, die aus dem Königreich der Nabatäer nach al-Arabia gekommen war. Ein geheimnisvoller schwarzer Stein von beachtlicher Größe, der von innen heraus strahlte und vor undenklichen Zeiten vom Himmel auf die Erde gebracht worden war. Von wem, wusste niemand. Vielleicht hatte Gott selbst ihn aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Ibrahim, der Urvater aller Menschen, den die Juden in Mekka Abraham nannten, hatte ihn jedenfalls neben der wieder freigeschaufelten Quelle eingemauert. Seitdem galt der Würfel als die Pforte zum Paradies. Jeder, der hierher kam, umkreiste ihn fünfmal und küsste ihn. Dann schritt er hindurch.
Die Kontrolle über die saubere Quelle des ummauerten Brunnens, der Zemzem hieß, stand seit jeher der mächtigsten Familie zu. Sie bestimmte, was in der Stadt geschah. Wurde dieser Großfamilie eine andere zu gefährlich, gab es Krieg. Brauchten sie Geld, Kamele, Salz, Stoffe, Weihrauch und Wein, unternahmen sie einen ghazu, einen unbarmherzigen Raubzug. Sie überfielen Karawanen, wobei sie jedoch versuchten, kein Blut zu vergießen, denn dies hätte unweigerlich zur Blutrache geführt. Da ihre Krieger jedoch grausam und unbelehrbar waren, war Blutrache im Tal und in der ganzen Umgebung an der Tagesordnung.
Manchmal strebten die Stammesscheiks aber auch eine friedliche Lösung an, um den Streit zu schlichten. Man verheiratete nach langen nächtlichen Sitzungen, in denen viel gesüßte Ziegenmilch getrunken und viel Lammfleischstücke in Hirsebrei gegessen wurde, die Mädchen der Familie mit den Söhnen der anderen Familie. So diente alles den Interessen der eigenen Großfamilie.
Die neuen Herren hießen die Banu Quraisch. Sie waren reich, doch sie hatten ihr Vermögen nicht im Schweiß ihres Angesichts mit der Bewirtschaftung des ausgetrockneten Bodens verdient. Sie verstanden nichts von Bewässerung, Bergbau oder Architektur und ließen bezahlte Helfer für sich arbeiten. Die Banu Quraisch waren Kaufleute, Makler und Wucherer und hatten ihren Reichtum mit Karawanen angehäuft und damit, dass die Pilger zur Pforte – dem Würfel, der in der Landessprache der weitläufigen Arabia Bait Allah hieß, Haus Gottes – alles bei ihnen kaufen mussten.
Die Stadt mit der Pforte zum Paradies lag am Schnittpunkt der beiden wichtigsten Handelsrouten Arabiens, der Hidjas-Straße, die an der Küste des Roten Meeres entlang von Jemen nach Syrien und Transjordanien führte, und der Najd-Straße, die den Jemen mit dem Irak verband. Es waren reiche Karawanen, die fast täglich über diese Straße zogen, und ihre Führer zahlten gern und gut, wenn man ihre Sicherheit garantierte. Sicherheit war ein einträgliches Geschäft, denn es gab keine Polizei in der Arabia, und die Stämme in der Gegend kannten kein Gesetz.
Mord war an der Tagesordnung; er wurde nicht gesühnt und galt bei seinen Nutznießern sogar als Heldentat. Fast jeder im bewohnten Arabien zwischen Khaybar im Norden und Taif im Süden hatte schon einmal aus niederen oder ehrenwerten Motiven heraus einen anderen, meist unschuldigen Menschen umgebracht.
Mörder, Pilger, Viehtreiber, Nomaden und Kaufleute trugen so dazu bei, dass die Familie der Quraisch zum mächtigsten Stamm nicht nur der Stadt Mekka, sondern ganz Zentralarabiens aufgestiegen war. Sie hatten sich zum Ende des 5. Jahrhunderts in dem heißen, menschenfeindlichen Tal niedergelassen. Hier war es nicht fruchtbar wie in Südarabien, das vom Monsunregen begünstigt wurde. Hier gab es nur die erschreckende Ödnis, besiedelt von Wilden, welche die alten Griechen Sarakenoi genannt hatten – Menschen, die in Zelten hausten. Weder die heidnischen Reiche Jemen und Oman, noch die weiter entfernten, christlichen Nachbarn Abessinien im Südwesten und Byzanz im Norden dachten im Traum daran, die unwirtlichen Steppen Arabiens zu erobern.
Äußere Feinde gab es für die Quraisch also nicht. Ihr Ahnherr Qusayy siedelte vor mehreren Generationen mit seinem Bruder Zuhrah und seinem Onkel Taym neben dem Heiligtum, dem schwarzen Würfel mit dem geheimnisvollen eingelassenen Stein von den Sternen, die ebenfalls als Götter galten. Mit einer Mischung aus List und brutaler Gewalt war es ihnen gelungen, die Feinde zu bekämpfen, die bisherigen Hüter des Heiligtums, die Chuzaah, zu vertreiben, und die Macht in der Stadt mit der Pforte zum Paradies an sich zu reißen.
Da die in Reichtum lebenden Quraisch, von denen es fünftausend an der Zahl gab, nicht mehr selbst kämpfen wollten, sorgten sie für die Sicherheit in der Stadt, indem sie Bündnisse mit den grausamen Beduinen der Umgebung schlossen. Auch ihre Frauen schlossen sich mit den Frauen der Beduinen zusammen, denn sie wollten ihre Kinder nicht mehr selbst stillen, und die Beduinenfrauen nahmen ihnen diese Aufgabe ab. Nach den Gemetzeln in ihrem Auftrag badeten die Männer der Quraisch ihre Hände am Heiligtum in Schalen mit Duftwassern, und ihre Frauen dachten einmal kurz und hingebungsvoll an ihre abgegebenen Säuglinge. Dann beteten die Männer ihre drei Göttinnen an: Allahs Töchter al-Lat, al-Uzzah und al-Manat. Die banat Allah standen ebenso auf ihrer Seite wie der Gott Hubal.
Die Frauen der Quraisch, die ihre eigenen Kinder nicht mehr säugten, hatten sich dadurch genug Zeit erkauft, ihren Männern bei allen Geschäften zur Hand zu gehen. So wurden die Quraisch immer reicher und mächtiger. Und sie duldeten niemanden neben sich. Nicht in ihrer Hitzestadt, nicht in ihrem heißen, trockenen Arabien zwischen Mekka und Jathrib, das sie für einen ganzen Kontinent, ja für die Welt, hielten.
Eines Tages aber war ihre unangreifbar scheinende Macht bedroht. In ihrer Mitte – in einer der ärmeren Sippen der Großfamilie, den Haschimiten, die wie die Naufal, Abdschams und Muttalibs von den Abdmanafs abstammten –, entstand ein ungebändigter Geist, der sie stürzen wollte. Und nach einigen weiteren Jahrzehnten der Blüte der Quraisch und ihrer Verbündeten entfachte der junge, wilde Mann einen gewaltigen Sturm.
Er war unnachgiebig und zerstörte alles.
Schon bei der Zeugung des Aufrührers gab es einen gewaltigen Sturm. Der Himmel war verdüstert. Selbst in fernen Gegenden der Welt bemerkte man, dass etwas Außergewöhnliches geschehen war. Am Palast des persischen Herrschers wütete ein Erdbeben, und die heiligen Feuer der Perser, die seit Anbeginn der Welt gebrannt hatten, erloschen. Und niemand vermochte sie wieder zu entzünden.
Es war der Tag, als Abdallah ibn Abdalmuttalib eine Frau besuchen wollte, die ebenfalls sein Weib war, so wie seine erste Hauptfrau Amina.
Er hatte gerade auf dem Acker gearbeitet; Erde und Staub hafteten noch an ihm. Abdallah versuchte, die Frau zu umarmen, doch sie wehrte ihn ab wegen der lehmigen Erde und dem Geruch nach Dung, der an ihm haftete. Sie vertröstete ihn auf die Nacht. Nachdem Abdallah sich gewaschen hatte, wollte er zu Amina gehen. Er kam wieder an jener Frau vorbei, die ihn nun ihrerseits zu sich rief. Doch jetzt war er es, der sie von sich schob. Abdallah ging zu Amina und nahm sie, und sie empfing Mohammed. Als Abdallah Amina verließ, kam er wieder am Zimmer jener Frau vorbei und sagte zu ihr: Willst du? Sie gab ihm zur Antwort: Nein! Als du an mir zuerst vorbeigekommen bist, lag ein weißer Schimmer zwischen deinen Augen. Du wolltest nichts von mir wissen und bist zu Amina gegangen. Jetzt aber trägst du diesen weißen Schimmer nicht mehr. Amina hat ihn dir genommen. Geh!
Wegen dieses weißen Schimmers in den Augen Abdallahs hatte der kleine Junge, den sie Mohammed nannten, also Amina zur Mutter. Auch sie gab ihren Sohn schon als kleines Kind zu den Beduinen, und so wurde Mohammed von Halima bint Abu Dhuayb aus einer armen Sippe des Wüstenstammes Hawazim gesäugt. Halima starb früh, wie auch Amina; der Junge war gerade erst sechs Jahre alt. So wuchs Mohammed ohne Mutter und Vater auf, denn der Vater war während einer Karawane aus Gaza in Jathrib gestorben.
Der Junge stand nun auf eigenen Füßen. Deshalb hinderte niemand ihn daran, wild und noch ungebärdiger zu werden. Er wagte es sogar, sich auf die Liegestatt seines Großvaters zu setzen. Der Heranwachsende besaß als Einziger das Privileg, ein Bettgestell in den kühlen Schatten zu stellen, den das Heiligtum warf, die Pforte zum Paradies.
Mohammed ging zu seinem Großvater und ließ sich Geschichten erzählen vom Jahr des Elefanten, in dem er geboren worden war, und von der Errettung Mekkas durch die Vögel, die vergiftete Steine auf ihre anrückenden Feinde geworfen hatten.
Mohammed lauschte den Geschichten und dachte mit jugendlichem Überschwang, dass er etwas Besonderes sein musste, wenn im Jahr seiner Geburt so viele wichtige Dinge geschehen waren. Er lauschte und ruhte sich aus von der Anstrengung, in täglicher Hitze und Staub die Schafe zu hüten.
Mohammed lernte von allem. Im heißen Gleichmaß der Tage und Nächte sog er alles in sich auf, was er sah und hörte.
Ehe die mächtigen Quraisch es sich versahen, hatte Mohammed ein Auge auf sie geworfen. Elternlose Burschen suchen sich frühzeitig Verbündete – und Feinde.
Die Familie Quraisch, die in Mekka bestimmte, was zu geschehen hatte, merkte eines Tages, dass es inmitten ihrer Reihen etwas Fremdes, Gefährliches gab – einen noch schwachen Geist, der aber mit nie versiegender Zähigkeit und unerklärlichem, unstillbarem Eigensinn und Hass an ihrer Macht zu nagen begann.
Die Zeit verrann. Der glühende Sonnenball kam und ging. Die Wirbel der Wüste waren ständig in Bewegung, veränderten jedoch kaum etwas. In der Wüste stand die Unendlichkeit – und die Ewigkeit.
Der Sohn des Abdallah war längst herangewachsen.
Er wurde ein gut aussehender Mann mit stämmigem Körper. Bart und Haarwaren dicht und kraus, sein Mund schien immer zu lächeln, und in seinen Augen stand ein Glanz, der allen auffiel. Er wirkte offen und treu, sodass er in der ganzen Stadt Al-Amin, der Treue, genannt wurde. Er war energisch und entschlossen und spielte gern mit Kindern, war jedoch oft ernst und zurückgezogen.
Eine Eigenschaft fiel den Menschen in seiner Umgebung besonders auf. Mohammed, der Sohn Abdallahs, blickte nie über die Schulter. Selbst wenn sein Umhang aus Baumwolle, der Dschalabija, sich in einer Dornenhecke verfing, drehte er nicht den Kopf. Er wollte nur nach vorn schauen; er fühlte, dass von dort etwas auf ihn zukam, das seine ganze Aufmerksamkeit forderte. Eines Tages musste der jetzt erwachsene Mann, der sich niemals umwandte, die, bittere Erkenntnis schmecken, dass die große Familie der Quraisch zu mächtig für ihn war. Der arme Haschimit und ehemalige Hütejunge bekam zu spüren, was es heißt, ein armer Verwandter zu sein, ein Nichts. Inzwischen war er zum stattlichen Mann gereift. Doch arm war er noch immer.
Mohammed, der Mann, ließ sich an diesem frühen Abend auf den Stufen des Heiligtums nieder. Er spürte seine Müdigkeit. Sein Hals war rau und ausgetrocknet, obwohl er nun nicht mehr auf den Feldern arbeitete, sondern Karawanen von Hadramaut und Hedschaz im Süden nach Syrien und Mesopotamien im Norden mit Wasser und Proviant versorgte. Er dachte daran, wie wichtig der heilige Würfel für die Erfolge seiner Feinde war, den reichen Quraisch. Und er dachte darüber nach, warum sie eigentlich seine Feinde waren.
Doch er spürte, er hatte keine Zeit, sich ausgiebig mit dieser Frage zu beschäftigen. Es war nie anders gewesen und schlicht eine Tatsache. Die Quraisch waren überheblich, gewalttätig und feindselig gegen ihre eigenen, ärmeren Verwandten, auf die sie herabsehen konnten. Und ihre Frauen schauten ihm nie in die Augen, musterten nur die Flecken auf seiner Tunika.
Mohammed spürte, wie seine innere Unruhe, die schon abgeklungen schien, wieder mächtiger wurde. Irgendetwas war heute Morgen geschehen. Etwas so Unerhörtes, dass er noch immer nicht wusste, ob er geträumt hatte.
Er hatte zusammen mit einem Hirten bei einer Karawane gestanden und auf die kostbaren Waren aufgepasst, als zwei Männer in weißen Gewändern erschienen waren, die ein goldenes, mit Schnee gefülltes Becken trugen. Sie packten ihn, öffneten ihm den Leib, rissen ihm das Herz heraus, schnitten es auf und entnahmen ihm einen schwarzen Blutklumpen, den sie wegwarfen. Dann wuschen sie sein Herz und seinen Leib und schlossen die Wunde.
Sein Gefährte, der Zeuge des Geschehens wurde, hatte befürchtet, den Verstand verloren zu haben. Mohammed selbst hatte anfangs geglaubt, es läge an der Hitze. Doch es gab Anzeichen, dass alles mit der Bait Allah zu tun hatte.
Nun grübelte Mohammed auf den Stufen des Brunnens neben der Pforte zum Paradies darüber nach, den Kopf in die Hände gestützt. Und plötzlich wurde ihm klar: Auch wenn er das abenteuerliche Geschehen vom Morgen nicht begriff – es war nicht zufällig passiert. Es hatte ihn wie selbstverständlich hierher geführt, zum geheimnisvollen Stein von den Sternenhimmeln. Es war der glänzende, schwarze Stein, der ihn mit Macht hierher zog.
Mohammed stand auf und betrat das Innere des großen Würfels. Er stieg die kleine Treppe hinunter, weil die niedrige Tür sich in zwei Meter Höhe befand. Der quaderförmige Schrein aus so hartem Granit, wie er in der ganzen Umgebung, ja vielleicht auf dem ganzen Kontinent nicht vorkam, war von den 360 Bildnissen der heidnischen Götter umgeben, die von den Stämmen hier angebetet wurden, wenn sie an den festgesetzten Tagen kamen.
Er war hier oft drinnen gewesen, als Kind, als Junge, als Mann, aber jetzt nahm er das Heiligtum wahr, als sähe er es zum ersten Mal.
Zwischen ihm und dieser Pforte zum Paradies bestand eine alte, seltsame Bindung. Manchmal spürte er, dass es ihm gehörte. Doch die Quraisch hatten es an sich gerissen. Er ließ den Blick durch den Raum schweifen, betrachtete die Vorderseite mit der jetzt offenen Tür, den geheimnisvoll schimmernden schwarzen Stein im Nordosten, die bunt bemalten Wände mit den Götzenbildern, ungefähr jeweils zwölf Meter lang. Da jetzt keine Pilgerzeit war, bedeckte ein mit Inschriften versehener schwarzer, sonst weißer Teppich das gesamte Gebäude. Nur ein Summen war zu hören, ansonsten war es totenstill.
Gemächlich, doch mit gierigen Augen durchmaß Mohammed das Gebäude. Wie verlockend die Vorstellung war, diese Kaaba einem anderen Gott, seinem Gott, dem einzigen Gott zu weihen! Ich werde sie nehmen, dachte er, und sie dir schenken. Aber dazu musste er sie den Quraisch entreißen. Dann würde er das Bait Allah wieder aufrichten, doch mit den richtigen Göttern, mit dem einen und einzigen Gott. Dann wäre er selbst der Verkünder des neuen Glaubens.
Was für unsinnige Pläne. Sie würden Krieg bedeuten.
Sollte er nicht zufrieden sein mit seiner Anstellung als Kaufmann? Ging es ihm nicht gut? Hatte er mit Chadidscha nicht eine wundervolle Gattin? Zugleich war sie seine Arbeitgeberin, denn ihr gehörten große Karawanen, und sie überwachte den Verkauf der Waren auf dem Markt von Mekka. Ja, seine Frau Chadidscha, die ihn angestellt hatte, war ein Glück für ihn.
Aber reichte ihm das? War es nicht Tollheit oder sogar Sünde, wenn er mit dem Gedanken spielte, sein auskömmliches Leben an der Seite von Chadidscha bint Chowailid, die schon zweimal Witwe geworden war, mit einem ungewissen Leben als Rebell des wahren Gottes zu tauschen?
Nein, Sünde war es nicht. Aber es war Tollheit.
Hier in Mekka konnte er im Dienst Chadidschas jegliche Bestallung erhalten, die er wünschte. Er musste sich nur offen zu den drei Göttinnen der Quraisch bekennen. Aber die drei weiß gekleideten Männer, die ihm das Herz herausgerissen und gewaschen hatten, ließen das nicht zu. Seitdem saßen sie ständig auf seiner Schulter. Unsichtbar, aber mit spürbarem Gewicht.
Und einer von ihnen – Gabriel, dessen Füße den Horizont des Himmels berührten – mahnte ihn ständig, bis ihm der Kopf dröhnte.
Mohammed fühlte die Last des Geschehens auf sich. Gedankenverloren ging er zwischen den drei Holzsäulen hindurch, die das Dach der Kaaba trugen, und die zahlreichen silbernen und goldenen Lampen klirrten leise bei seinem festen Schritt. Vor dem schwarzen Stein in der östlichen Ecke verharrte er. Er befand sich genau in seiner Augenhöhe. Heute sprach der Stein nicht zu ihm.
Mohammed drehte sich nicht um, bemerkte aber etwas aus den Augenwinkeln. Durch einen Spalt in der Tür lugte sein Onkel Abu Talib herein. Der alte Sippenführer und Dichter der Haschim beobachtete das Treiben des Mohammed im Innern und dachte: Was für ein eigentümlicher Kerl der Sohn des Abdallah doch ist. Was macht er da drinnen, als wäre er dort zu Hause? Was sieht er, was hört er? Will er nicht wieder gehen, bevor ein Quraisch kommt, um seine üblichen Riten zu verrichten?
Doch Mohammed machte keine Anstalten zu gehen. Zwar bemerkte er den Onkel, drehte sich jedoch wieder in der Kaaba herum, ließ die Blicke und Gedanken kreisen und dachte: Ich muss einen Entschluss fassen, hier und heute. Der Stein spricht nicht zu mir. Er nimmt mich nicht einmal wahr. Will er, dass ich selbst spreche?
Aber zu wem? Und was soll ich sagen? Ich wüsste keinen einzigen Satz, den ich sagen könnte. Gerade wenn ich sprechen will, ist mein Kopf besonders leer – wie ein schwarzes Loch, in das ich stürze. Es ist ein viereckiges, dunkles Loch, in das der schimmernde Stein von den Sternen genau hineinpassen würde.
Gegenüber der nordwestlichen Wand stand die halbkreisförmige, einen Meter hohe Wand aus weißem Marmor, die nicht mit dem Stein von den Sternen verbunden war. Der Zwischenraum zwischen dieser Hatim genannten Mauer und dem Stein galt als die Stelle, wo Ibrahim und sein Sohn Ismael, die Patriarchen und ihre Mutter Hagar begraben waren. Mohammed wendete sich dorthin; dann drehte er sich zurück zur schwarzen, mannshohen Kaaba. Dazwischen liegt meine Wahrheit, dachte er. Welchen Namen muss ich ihr geben? Muss ich die Menschen hierher ziehen, die gelernt haben, den richtigen Gott anzubeten? Die Quraisch hatten schon einmal versucht, den schwarzen Monolithen abzureißen. Mohammed erinnerte sich an diesen Tag, es war sein fünfunddreißigster Geburtstag gewesen. Als einer der Männer sein Brecheisen zwischen zwei der ihn umgebenden Steine stieß, erbebte ganz Mekka und wankte, als würde es umstürzen, worauf die Quraisch ihr Vorhaben erschreckt aufgaben.
Muss ich ein Heer aufstellen, um den Quraisch die Kaaba zu entreißen?, fragte er sich. Dafür brauche ich Zeit. Und die habe ich nicht.
Plötzlich spürte er wieder die Kraft des göttlichen Rufes. Er hatte ihn als Junge auf dem Feld mit den Schafen gehört, er hatte ihn später, in vielen Nächten, in der Höhle auf dem Berg gehört. Jetzt hörte er ihn wieder. Der Gedanke war ganz klar: Er benötigte Zeit, und dafür brauchte er Frieden mit den Quraisch. Er musste ihnen entgegengehen, damit er sie umso gründlicher vernichten konnte.
Ich werde sie nicht bekämpfen, dachte er, ich werde ihnen die Hand reichen. Sie werden verwundert sein. Dann entreiße ich ihnen das Bait Allah. Und dann werde ich selbst mit meinem eigenen Gott in der Kaaba einziehen.
Welch wunderbarer Einfall!
Es wird eine Heimkehr sein!
Dann erst wurde ihm bewusst, dass er soeben gesprochen hatte. Die Sätze waren ohne sein Zutun in seinem Innern entstanden.
Mohammed stieg über die schmale Treppe nach draußen. Sein Onkel Abu Talib stand da und blickte ihn misstrauisch an. Mohammed sah es, sagte aber nichts. Ein glückliches Lächeln umspielte seine Lippen. Seine Fantasie zeigte ihm die Bait Allah, wie sie sein wird. Schon ertönt ein Ruf – die seltsame, tiefe Stimme, die die Gläubigen zum Gebet ruft, und alle kommen und werfen sich nieder, aber nicht unterwürfig, nur ergeben und dankbar. Ergeben in den freiwilligen Dienst an Gott. Es sind seine Ergebenen, wahre Muslime. Er wird sie in das neu eingerichtete Haus führen.
Und im Bait Allah werden dicke Teppiche auf den kalten Steinen liegen, und Springbrunnen werden sprudeln. Um die Wände, die von den 360 Götzen befreit sind, werden sich Inschriften in hebräisch, arabisch und aramäisch hinziehen, Verse der großen Dichter aus dem Volk des Buches. Und überall wird kühles Wasser die Durstigen erquicken. Vor allem jene, die nach dem wahren Wort des Herrn dürsten.
Und er wird es sein, der sie vor der Willkür seiner eigenen Leute schützt, den falschen Quraisch. Er wird seinen bedrängten Muslimen eine Heimstatt schaffen. Denn er ist ihr Bruder.
Zu Hause im einzigen dreistöckigen Haus der Stadt empfing ihn Chadidscha.
Sie saß im Kreis ihrer vier Kinder Zainab, Umm Kulthum, Rukaija und Fatima. Und obwohl der Sohn Al Qasim mit zwei Jahren gestorben war, trug Mohammed den kunya, den Ehrennamen, den Araber nach der Geburt ihres ersten Sohnes annehmen: Abu al-Qasim. Sie trauerten noch immer um ihren Sohn. Doch Mohammed war auch hingebungsvoll gegenüber seinen Mädchen; besonders die Jüngste und Schwächste, Fatima, hatte es ihm angetan. Er wäre für sie gestorben.
Chadidscha blickte ihrem Mann lächelnd und wie stets freundlich entgegen. Chadidscha, die Umm al-Qasim, wenngleich schon im vierzigsten Jahr, aber immer noch schön und energisch, zog Mohammed, der sie mit fünfundzwanzig Jahren geheiratet hatte, in ihren Kreis. Er liebte seine Kinder und spielte gern mit ihnen, auch mit fremden Kindern. Er fragte, ob sie einen schönen Tag hatten, und sie plapperten los mit ihren schon halb erwachsenen Stimmen und erzählten einander alles, als würde der Tag ein Leben lang währen. Chadidscha musste schließlich einschreiten.
Mohammed sagte: »Ich war in der Kaaba. Auch Onkel Abu Talib war dort. Aber nur ich bin hineingegangen. Und obwohl der Stein heute nicht zu mir sprach, weiß ich jetzt, was ich gegenüber den Quraisch tun muss. Ich werde ihnen friedlich begegnen.«
Chadidscha strahlte. »Das ist richtig. Ich muss deine Weisheit rühmen. Schon immer habe ich deine Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und deinen guten Charakter geschätzt, mein Mohammed. Manchmal aber bist du jähzornig. Ich habe dir immer gesagt, mit Sanftmut erreichst du mehr gegen die Quraisch, die auch meine Verwandten sind, als mit allen kriegerischen Gesten und ausfälligen Worten zusammen.«
»Und noch etwas ist mir eingefallen. Ich werde mehr für dich tun, meine geliebte Frau. Für dich ganz persönlich, und für dein Unternehmen.«
»Auch das ist sehr weise«, sagte sie mit liebevoller Ironie in der Stimme.
»Ich werde die Karawanen allerdings nicht mehr selbst nach Syrien führen. Man braucht mich hier. Ich muss mich meinen Leuten öfter zeigen. Und da du selbst für die Waren aus Syrien auf dem Markt von Mekka stets den doppelten Preis erzielst, benötigst du mich nicht als Verkäufer, und um unser Unternehmen braucht uns nicht bange zu sein. Eine geschicktere Geschäftsfrau als dich kann es nicht geben.«
»Alles, was du für richtig hältst, ist mir recht. Du weißt, ich bin zweifache Witwe. Ich habe genug geerbt und brauche nicht mehr Geld. Denn Reichtum ist nur gut, wenn er das Leben bereichert, nicht die Schatullen. Wenn du mehr Zeit für mich und die Kinder und für deine Leute in Mekka aufbringen willst, soll es mir nur recht sein.«
»Allerdings musst du mir gestatten«, sagte Mohammed nachdenklich, »einen Teil deiner Einkünfte zu verwenden.«
»Wofür?«
»Ich muss Leute anwerben und bezahlen. Ich brauche eine ergebene Gefolgschaft, die ich ernähren und bezahlen kann. Denn wenn sie mir anfänglich nicht wegen meines Glaubens an den einzigen Gott folgen, den Allbarmherzigen, will ich sie wenigstens gut halten können. Die Vierzig, die mir jetzt schon folgen, sind mittellose junge Männer, die ihre Väter noch nicht aus der Führung ihrer Sippe verdrängt haben und nichts besitzen. Und es sind Handwerker und freigelassene Sklaven aus der Vorstadt, allesamt Rechtlose, die nur am Schluss der Prozessionen zu den Heiligtümern der Göttinnen gehen dürfen. Ich muss ihnen allen zeigen, dass sie mit diesem neuen Gott durchaus nicht darben müssen und dass sie sich an meiner Seite von der noch herrschenden Clique unterscheiden können. Sie verlieren ihre Schande und gewinnen sich selbst.«
»Was du sagst, widerspricht der überlieferten Ordnung. Willst du alles umkehren? Willst du gar einen Aufstand? Sagt dein Gott nicht: ›Sieh, wie wir schon in diesem Leben die einen bevorzugen?‹«
»Dennoch muss ich einen Ausgleich zwischen den Extremen von Arm und Reich bewirken, sonst folgen sie mir nicht. Ich sitze oft mit den Ärmsten meiner Anhänger im Schatten der Kaaba, wo der Platz für die Vornehmsten der Banu Quraisch reserviert ist. Dann vertreiben sie uns. Ich muss den Reichen diesen Platz wegnehmen und ihn meinen Leuten geben.«
»Egal. Ich brauche das Geld für die Karawanen. Die Geschäfte gehen schlechter, es ist kalt, und man spricht von einer Hungersnot. Oben im Norden sterben Menschen; sie kaufen nichts, weil sie nicht bezahlen können. Nein, ich kann dir keine Einkünfte abtreten, mein Gatte.«
»Ich kann meinen Auftrag nicht erfüllen«, erwiderte Mohammed enttäuscht, »wenn ich dich gegen mich habe. Sag mir, dass ich falschen Einflüsterungen folge. Dann höre ich zu kämpfen auf. Aber sag mir nicht, ich kann kein Geld für meine Aufwendungen von dir erhalten. Du hast damals, als ich vom Berg Hira zurückkehrte, wo Gabriel sich mir offenbarte, nicht über mich gespottet, sondern hast mir als Einzige geglaubt. Du hast mir die Kraft gegeben weiterzumachen, Chadidscha, als ich nach diesem gewaltigen Erlebnis an mir selbst zweifelte. Du hast mich gestärkt, als ich daran dachte, meinem Leben ein Ende zu setzen und nahe daran war, mich von einem der steilen Felsen zu stürzen. Du warst es, die mir glaubte, dass ich die Stimme der Engel gehört habe. Damals hättest du mich aus dem Wahn retten können, aber du sprachst mir im Gegenteil Mut zu. Verweigere mir also jetzt nicht den kleinen Gefallen, mich mit Geld zu unterstützen.«
»Du sprichst stets überzeugend. Aber mich kannst du nicht täuschen. Was du sagst, ist stolz und unvernünftig. Nein, ich kann dir kein Geld geben, und schon gar nicht kann ich dir einen Teil meiner Umsätze abtreten. Du musst selbst sehen, wie deine Muslime dir die Treue halten. Wenn nur Geld dafür sorgen kann, taugt diese Gemeinschaft ohnehin nicht den Dreck an den Hufen meiner Kamele.«
Verärgert blickte Mohammed sie an. Dann glättete seine Stirn sich wieder. »Ich kenne durchaus meinen Wert und den meiner Gemeinschaft. Missverstehe mich bitte nicht. Ich will dich nicht berauben, und ich will auch meine Macht, die ich als dein Ehemann besitze, nicht gegen dich verwenden. Doch als ich in der Kaaba weilte, wurde mir klar, dass ich keine Zeit mehr habe. Ich bin in einem fortgeschrittenen Alter. Bald muss etwas geschehen, dem neuen Glauben zum Sieg zu verhelfen. Und das schaffe ich nicht, wenn ich meine Mission bloß nebenher betreibe. Ich muss mich ihr ganz und gar widmen – mit allen Mitteln, die ich habe.«
»Dann verwende deine eigenen Mittel, aber nicht meine. Ich fände es angemessen, würdest du dich damit begnügen, deinen bisherigen Platz in unserem Unternehmen so gut auszufüllen wie bisher.«
»Du weißt, es ehrt mich, dass du mir diesen Platz angeboten hast, Chadidscha. Ich glaube auch, dass ich ihn die bisherigen fünfzehn Jahre zu deiner vollen Zufriedenheit ausgefüllt habe.«
Chadidscha entgegnete: »Wir haben Kinder. Wir führen ein teures Haus. Mein Unternehmen floriert. Doch wenn ich jetzt Mittel herausziehe, könnte alles in sich zusammenstürzen. Und du bist zwar mein Mann und hast alle Rechte über mich, aber du bist auch mein Angestellter, und als solcher bist du von mir abhängig. Ich kann das Pergament zerreißen, das Siegel zerstören und dich hinauswerfen, vergiss das nicht.«
»Drohst du mir, Chadidscha?«
»Ich nenne es nicht Drohung. Aber wenn ich dir als Eheweib dienen soll, wie es auch mein ehrlicher Wunsch ist, darf ich nicht deinen … Launen nachgeben.«
Mohammed wollte aufbrausen, beherrschte sich aber. »Chadidscha. Es sind nicht meine Launen. Du sprichst über Allah, den einzigen Gott. Ich kann den Dienst an ihm nicht halbherzig betreiben, wie man in der Tageshitze die staubigen Sandalen eines Kameltreibers putzt. Die Geschäfte, die wir tätigen, sind eine Sache – sie sind gut und richtig. Aber das Geschäft mit Gott ist ungleich bedeutender. Ich kann Allah nicht nur den fünften Teil meines Gewinns anbieten. Ich brauche alles, um mich für ihn einsetzen zu können. Es ist Gott. Wir verdanken ihm alles, was wir haben. Und er kann uns auch alles wieder entziehen, mit einem Federstrich.«
»Das heißt, du wirst uns in Armut und Unglück stürzen.«
»Aber nein. Aber man erwirbt Gottes Gunst nicht mit Kleinkrämerei, sondern muss sie mit ganzem Einsatz erobern. Denn geht es nicht um das Allergrößte?«
Mohammeds Augen strahlten voller Begeisterung. Chadidscha betrachtete ihn voller Liebe. Sein Lächeln machte ihn so jung und begehrenswert wie einen jungen Liebhaber. Doch Chadidscha wusste – ohne dass es sie schmerzte –, dass sie ihn mit einem anderen teilen musste.
Der ehemalige christliche Sklave Zayd ibn Harith betrat in diesem Moment das Zimmer. Er brachte kühlen Limonensaft und räumte die Scherben eines Kruges fort, den die Kinder umgekippt hatten. Zayd war ein junger, hübscher Abessinier aus dem Südwesten, den Chadidscha ihrem Mann zur Hochzeit geschenkt hatte. Mohammeds Morgengabe an seine Braut waren zwanzig Kamele gewesen, die jedoch seine Sippe aufgebracht hatte, weil er zu arm war. Mohammed hatte Zayd die Freiheit geschenkt, doch er war freiwillig als Sklave im Haus geblieben, und Mohammed hatte den jungen Mann zu seinem Pflegesohn gemacht.
Zayd sagte: »Friede sei mit dir, Abu al-Qasim. Und verzeih, Umm Chadidscha, wenn ich mich einmische, doch ich hörte euer Gespräch mit. Du hast mich zu deinem Zögling gemacht, Mohammed al-Qasim, und jetzt kann ich vielleicht ein wenig von dieser Gunst zurückzahlen. Ich erbiete mich, deine Stelle in der Karawanserei zu übernehmen, Mohammed, und verlange keinen Anteil dafür. Dann kannst du all dein Geld für deine Aufgaben verwenden.«
Verblüfft schauten die Zieheltern Zayd an. Mohammed sagte: »Aber wenn ich aus dem Unternehmen ausscheide, bekomme ich nichts mehr. Von welchem Geld redest du also?«
Zayd erwiderte: »Diese Frage kannst du besser beantworten, Umm Chadidscha.«
Mohammeds Frau zögerte einen Moment, dann sagte sie: »Ich würde dir deinen Anteil weiterzahlen, Mohammed. Denn mir würden durch Zayds Eintritt ins Geschäft keine neuen Unkosten entstehen. Im Gegenteil. Da er im Gegensatz zu dir lesen und schreiben kann und mehrere Dialekte spricht, würde ich sogar drei Angestellte sparen. Es wäre eine Lösung. Aber du darfst nicht verlangen, dass ich dir darüber hinaus weitere Anteile an meinen Gewinnen zugestehe.«
Mohammed, jetzt unwirsch, erwiderte: »Dann machen wir es so. Ich scheide aus dem Unternehmen aus. Lass es uns besiegeln.«
Wenig später überreichte ihm Chadidscha aus der quraischitischen Sippe der Asad, die mächtiger war als die Haschimiten, das Schreibrohr mit der Feder. Mohammed machte mit versperrtem Gesicht, aber innerlich voller Genugtuung seinen Schnörkel unter den Text. Auch Zayd musste unterschreiben; er tat es mit schwungvollen hebräischen Buchstaben.
»Willst du nicht wissen, was drin steht?«, fragte Chadidscha.
Mohammed war seiner Frau – und auch seinem Gott – unendlich dankbar, schüttelte aber nur kurz angebunden den Kopf. »Es wird schon alles richtig sein, da du es aufgesetzt hast. Ich bin dir dankbar für deine Großzügigkeit, Chadidscha, und dir, Zayd, danke ich für deine aufrichtige Liebe. Ob Allah diese Dankbarkeit mit uns teilt, wird sich zeigen.«
»Frag ihn, deinen Gott!«, meinte Chadidscha trocken, doch ohne Boshaftigkeit.
»Ich werde ihn befragen. Im Monat Ramadan werde ich mich vier Wochen lang auf den Berg Hira zurückziehen. Vielleicht bin ich würdig, dass er zu mir spricht. Dann weiß ich, ob ich richtig handle oder nicht.«
Fatima kam wieder herein und sagte mit ihrer hellen, atemlosen Stimme: »Nimm mich mit, Vater. Ich erzähle dir schöne Geschichten. Sonst ist es so furchtbar langweilig und einsam da draußen.«
Zärtlich nahm Mohammed seine jüngste Tochter auf den Arm. »Nein. Du bleibst bei deiner Mutter. Erzähl ihr deine schönen Geschichten. Sie bedarf ihrer noch viel mehr, sonst verhärtet ihr Inneres, wenn es sich immerzu um die Geschäfte kümmert.«
Chadidscha blickte ihren Mann mit großen, grünen Augen prüfend an. Dann legte sich ein freudiges Lächeln auf ihre Lippen, und Heiterkeit spiegelte sich auf ihrem Gesicht. »Deine Dienerin wünscht dir Glück auf deinem schweren Weg, Herr Prophet«, sagte sie.
Mohammed machte seine Ankündigung bald wahr. Der Berg Hira war hoch und einsam, und in der Höhle, die er schon oft aufgesucht hatte, lag der Mist von Adlern und Geiern. Doch Mohammed spürte hier die Nähe zu seinem Gott. Er brauchte nicht viel Wasser und nicht viel Nahrung, magerte zwar ab, fühlte sich aber stark und geistig rege. Hier blieb er sechzehn Tage. Und als wäre dies die richtige Zeit für Entscheidungen, kam in der Nacht, als Mohammed schlief, Gabriel zu ihm mit einem Tuch aus Brokat, auf dem etwas geschrieben stand. Er sagte zu Mohammed:
»Lies!«
»Ich kann nicht lesen«, antwortete Mohammed.
Da presste Gabriel das Tuch auf ihn, drückte es so fest auf sein Gesicht, seinen Mund, seine Augen, dass Mohammed glaubte, es wäre sein Tod. Dann ließ Gabriel den armen Mann los und sagte wieder:
»Lies!«
»Ich kann nicht lesen!«, sagte Mohammed leise und verzweifelt.
Und wieder legte Gabriel ihm das Brokattuch über das Gesicht. Mohammed glaubte zu ersticken, wehrte sich aber nicht. Und als Gabriel ihm das Tuch abnahm, verlangte er zum dritten Mal, Mohammed solle lesen.
»Ich kann nicht lesen!«, bekannte Mohammed erneut, nun mit erstickter Stimme und Tränen in den Augen.
Als Gabriel das Tuch erneut hob, packte Mohammed jene Todesangst, die er schon gespürt hatte, als die drei weißen Männer ihm das Herz herausrissen. Aber damals hatte er das Geschehen so empfunden, als wäre er gar nicht selbst dabei; jetzt aber war er es, und es war schmerzhaft.
Ein Gefühl der Schwere und Trauer überwältigte ihn, und er verbarg den Kopf zwischen den Knien. Nach einer Weile besann er sich und brachte heraus:
»Was ist es, das ich lesen soll?«
Da antwortete Gabriel:
»Lies im Namen deines Herrn, des Schöpfers, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut! Lies, und der Edelmütigste ist dein Herr. Er, der das Schreibrohr zu benutzen lehrte, der die Menschen lehrte, was sie nicht wussten.«
Mohammed begriff, er sollte diese Worte wiederholen, und so murmelte er sie. Und als er verstummte, ging Gabriel hinaus, ohne sich umzusehen. Mohammed schlug die Augen auf, und ihm war, als wären die Worte direkt in sein Herz eingraviert. Er stöhnte. Sein ganzer Leib schmerzte ihn. Dann rappelte er sich auf und schlug den Weg nach Mekka ein.
In Staub und Hitze taumelte er den Berg hinunter und über die Ebene heimwärts. Er wollte nur fort aus diesem Bereich, in dem er sich von der göttlichen Gewalt wie vergewaltigt fühlte. Nie zuvor bei seinen Versuchen, mit Gott zu sprechen, hatte er sich eine Vorstellung von den Schrecken solcher Visionen gemacht.
Und als er ging, hörte er Gabriels Stimme wieder. »Mohammed. so wie ich Gabriel bin, so bist du der Gesandte Gottes.«
Mohammed blickte auf. Er sah Gabriel in Gestalt eines Mannes, dessen Füße den Horizont des Himmels berührten. Wieder sprach Gabriel.
»Vergiss niemals, Mohammed, du bist der Gesandte Gottes und wirst es immer sein.«
Mohammed fiel auf die Knie; er zitterte am ganzen Körper und war in Gabriels Bann. Dann nahm er den Blick von ihm und ließ ihn über den Horizont schweifen. Doch in welche Richtung er auch schaute, überall war Gabriel, der Geist der Wahrheit. Er verließ ihn nicht mehr.
Mohammed war erschüttert von der Gegenwart dieser strahlenden Erscheinung und fühlte das erschreckende Anderssein Gottes. Den Blick auf diesen schrecklichen, wunderschönen Mann gerichtet, verharrte Mohammed, ohne sich von der Stelle rühren zu können.
Erst nach einer Weile gelang es ihm, die Beine zu bewegen. Schritt für Schritt ging er voran. Dann verschwand die Erscheinung, und Mohammed konnte freier ausschreiten. Am Ende rannte er. Stolperte. Rannte weiter.
Zu Hause angekommen, lief Chadidscha ihm entgegen. Mohammed warf sich in ihre Arme.
»Schütze mich, Chadidscha. Um Gottes willen, schütze mich!«, flehte er.
Sie stützte ihn beim Gehen und schmiegte sich an ihn.
»Abu al-Qasim«, sagte sie nach einer Weile, als schon die Oase in Sicht kam. »Bei Gott, ich habe bereits einen Boten ausgesandt, denn ich bekam plötzlich Angst um dich. Was ist geschehen? Haben Beduinen dich überfallen? Bis in die Berge nördlich von Mekka sind sie gezogen und kamen ohne dich zurück. Wie erleichtert bin ich, dass du wieder da bist.«
Mohammed blickte sie dankbar an. Aller Streit mit seiner Frau über die Karawanserei war vergessen. Er schluckte mit trockener Kehle und langsam wurde ihm leichter.
»Gabriel überwältigte mich mit einer Umarmung, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich habe das nicht geträumt. Jetzt hat er wirklich mit mir gesprochen. Chadidscha, ich habe einen Beweis, dass ich auserwählt bin.«
Chadidscha begriff, dies war kein Hirngespinst ihres Mannes, dies hier hatte er wirklich erlebt. Sie bekam Angst.
Mohammed erzählte weiter von seiner Begegnung mit Gabriel. Schließlich verlor Chadidscha ihre Fassungslosigkeit und rief aus vollem Herzen:
»Oh, mein Mann, Sohn meines Oheims. Freue dich und sei standhaft. Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt – wahrhaftig, ich hoffe, du wirst der Prophet dieses Volkes sein.«
Zu Hause angekommen, bettete Chadidscha Mohammed, wusch ihn, brachte ihm frische Kleider und Säfte. Langsam ließ Mohammeds Angst nach; er wurde ruhiger, und aus seinen Augen wich der irrlichternde Glanz. Dann legte Chadidscha selbst neue Kleider an und ging zu ihrem Vetter Waraqa ibn Naufal, der Christ geworden war, die Heiligen Schriften las und von den Anhängern der Thora und des Evangeliums gelernt hatte. Ihm erzählte sie von den Erlebnissen Mohammeds. Der Christ rief aus:
»Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Chadidscha, wenn du mir die Wahrheit gesagt hast, so ist tatsächlich der Engel Gabriel zu ihm gekommen, so wie er zu Moses kam, und dein Mann ist der Prophet dieses Volkes. Sag ihm, er soll standhaft bleiben.«
Chadidscha kehrte zu Mohammed zurück. Auf dem Heimweg wurde sie wieder mutlos.
»Ich habe Angst um dich, mein Gemahl. Kannst du diesen Auftrag nicht zurückgeben?«
Mohammed schüttelte stumm den Kopf.
»Man wird dich einen Lügner nennen, wird dich kränken, vertreiben und zu töten versuchen. Dein Leben ist schon jetzt in Gefahr. Was sollen wir tun?«
Mohammed antwortete schwach: »Ich werde Gott helfen, wie Er es weiß!«
Chadidscha verstand, was er meinte. Sie beugte sich zu ihm hinunter, küsste seine Stirn und seinen Mund.