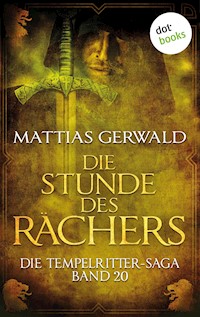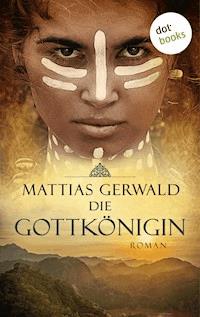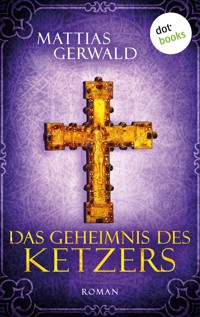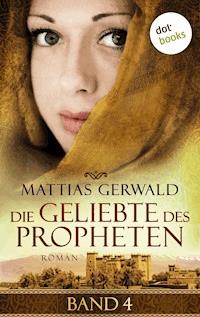4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
„‚Wie sollen wir die Slawen missionieren, wenn sie sich eine solch sündige Stadt bauen?‘ – ‚Und du willst gegen sie ziehen?‘ – ‚Der Erfolg des Deutschritterordens steht auf dem Spiel!‘“ Ein Mythos von Reichtum und Macht! Einst war das legendäre Vineta die größte und einflussreichste Stadt Europas. Hier blühte der Handel zwischen Heiden und Muslimen. Dann aber versank das Venedig des Nordens im Meer. Jetzt, Jahrhunderte später, wollen slawische Heiden die Metropole an einem geheimen Ort wiederaufbauen; eine Bedrohung für die Christenheit. Henri de Roslin, der schottische Templer, macht sich zusammen mit seinen Gefährten auf die Suche nach dem neuen Vineta – und ahnt nicht, in welch tödliche Gefahr sie sich begeben … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Mythos von Reichtum und Macht! Einst war das legendäre Vineta die größte und einflussreichste Stadt Europas. Hier blühte der Handel zwischen Heiden und Muslimen. Dann aber versank das Venedig des Nordens im Meer. Jetzt, Jahrhunderte später, wollen slawische Heiden die Metropole an einem geheimen Ort wiederaufbauen; eine Bedrohung für die Christenheit. Henri de Roslin, der schottische Templer, macht sich zusammen mit seinen Gefährten auf die Suche nach dem neuen Vineta – und ahnt nicht, in welch tödliche Gefahr sie sich begeben …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: Novembermord, Engelmord, Regenmord und Frühjahrsmord. Er lebt in Frankfurt am Main.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta
Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi
Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder
Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen
Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers
Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons
***
Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2005 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Andrey Kuzmin, antipathique und shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich
ISBN 978-3-95520-782-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Tempelritter an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Mattias Gerwald
Die Suche nach Vineta
Die Tempelritter-Saga
Band 5
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Ende September 1315, Tage der Erzengel
Aus Norden erhob sich ein Wind. Er kündigte sich schon an in den geduckten Gräsern der Ufer und Ebenen, setzte sich fort im Wispern und Flattern der Birkenblätter, verfing sich in den schweren Ästen der Flussweiden, die sich noch dagegen stemmten. Krähen und Raben torkelten auf den Schwingen dieses Windes von Baum zu Baum, aus der Höhe ließen sich Schwalben fallen, Raubvögel nutzten den aufwirbelnden Staub der Ebene, machten sich jetzt auf, das kleine Getier in seiner vergeblichen Suche nach Behausung zu schlagen. Die Sonne verdunkelte sich, und die stillen Flüsse rund um Paris beschleunigten ihre Strömung.
Das Land hatte wie die Natur seine letzten schönen Farben angelegt. Es schien wie ein herbstlicher Aufbruch zu sein.
Als wäre der aufkommende Wind ein Signal gewesen, zeigten sich jetzt im weißen Ufersand der noch jungen Seine Gestalten. Auf zottigen hohen Pferden, deren Mähnen sich ebenso rasch bewegten wie ihre tänzelnden Hufe, denn die Reittiere waren erschöpft und deshalb unruhig und warfen die Köpfe, näherten sich in einer finsteren Linie mehrere Reiter. Es waren zwanzig Männer in schwarzen Umhängen, die in diesem Moment, an diesem klaren, noch kühlen Morgen an Corbeil-Essones vorbei nach Norden ritten. Sie verschwendeten keinen Blick für das geduckte Landstädtchen zur Linken. Sie trieben nur ihre Pferde an und beugten sich über die dampfenden Kruppen.
An ihrer Spitze ritt ein blonder Hüne in einem auffälligen Gewand aus teurem grauen Tuch mit aufgenähten roten Schulterklappen. Die Hacken seiner Stiefel stießen immer wieder in die Flanke seines Reittieres. Das mächtige Schwert an seiner linken Seite schlug laut gegen den Steigbügel. Er achtete nicht darauf. Ferrand de Tours war versperrt in seine ganz persönlichen Rachegedanken. Seit seiner schmählichen Niederlage und Flucht aus der Judenstadt Toledo hatte er auf seinem Weg Söldner um sich gesammelt, von denen jeder Einzelne ein Fluch Gottes war.
Sie alle hatten ihr Ziel fest vor Augen. Es war der Königspalast von Paris. Und in ihren Köpfen stand der Anlass ihres überstürzten Aufbruchs vor zwei Tagen immer lebendig vor ihnen, es war ein Fanal, das sie ständig hörten. Sie mussten es nicht mehr aussprechen, sie mussten es nicht mehr zu Worten formen. Ihr Ziel war Rache. Auch ihre Gesichter schienen aus dem einzigen Grund geschaffen, dieses Ziel mit wilden Blicken auszudrücken.
Der Königsmörder musste endlich zur Rechenschaft gezogen werden! Die Tage der Erzengel waren gute Tage, uni zu richten und zu sterben!
Hinter Corbeil wurden sie aufgehalten. Sie zügelten ihre Pferde im aufwirbelnden Staub des Ufers. Eine Schafherde zog ihnen entgegen nach Süden. Fluchend ließ Ferrand seinen mächtigen Schimmel auf die Hinterflanken steigen. Dann drehte er sich im Kreis. Erst als Ferrand sein Schwert aus dem Halfter zog und auf die Schafe einhieb, floh die Herde blökend den Hang hinauf. Händeringend und jammernd liefen die beiden Hirten in ihren rechteckigen Fellmänteln hinterher.
»Weiter, Männer!«, schrie Ferrand und gab seinem Pferd erneut die Hacken.
König Ludwig der Zehnte, der neue Herrscher, den man den Zänker nannte, weil er an seinem Hof unaufhörlich Dispute führte, hatte Ferrand gerufen. Und so war der französische Ritter mit seinen gedungenen Gesellen aus allen Teilen des Landes gekommen, bis sie sich in der Kapelle St. Cyr sur Loire vor den Toren der befestigten Stadt Tours gesammelt und beraten hatten. Ferrand hatte sie in seine Heimatstadt gelenkt, weil er hier seine Macht ungebrochen spürte. Er verbrachte die Nacht im Bett seiner Geliebten, ließ von ihr seine Männlichkeit anbeten und betete am Morgen danach selbst demütig in der Kapelle.
Ab Tours ritten er und seine Spießgesellen vereint und unter einem Banner, dem roten, löwengeschmückten Banner de Tours und dem mit Blut gemalten Banner des Hasses. Wenn Ferrand rief, waren alle Fehden und Händel der Mörder, Brandstifter, Schänder vergessen, es winkte reiche Belohnung. Wenn der König rief, kam Ferrand und vergaß, was ihn sonst noch umtrieb. Die Aufmerksamkeit des Herrschers zu erlangen war ihm Belohnung genug.
Und jetzt durfte er in seinem Auftrag den Ketzer endlich bestrafen, der ihn in Toledo gedemütigt hatte.
Ludwig der Zänker saß währenddessen in seinem Palast inmitten seiner Ratgeber und trank. Hin und wieder sprang er von seinem Thronsessel auf und schritt mit auf den Rücken verschränkten Armen auf und ab. Er durchmaß ein ums andere Mal auf hirschledernen Schnürschuhen den Thronsaal mit seinen Teppichen, Gobelins und Möbelstücken, mit seinen Blankwaffen und Jagdgeräten an den Wänden zwischen den hohen Fenstern. Es hatte ihm die Sprache verschlagen. Er blieb vor seinen Ministern stehen und starrte sie aus einem weißen, verkrampften Gesicht heraus an.
Das machte auch seine Ministerialen sprachlos. Denn es kam nicht oft vor, dass der neue König nichts sagte. Jetzt sprachen allein seine Augen. Wo blieb die Abordnung der Söldner! Warum kamen sie nicht endlich, um den Auftrag auszuführen! Warum durfte er nicht, während er wartete, einige Hofschranzen, die größer waren als er, einen Kopf kürzer machen?
Der Zänker war schlau und ängstlich und deshalb in ewigem Aufruhr. Er wusste, dass Warten das eigene Leben verkürzte. Er zählte seine Schritte. Er zählte sie beim Hinundherlaufen wie den mechanischen Schlag der ganz neuen Räderuhr von Notre Dame, mit der die staunende Bevölkerung zum ersten Mal die vierundzwanzig gleich langen Stunden ablesen konnte. Zeiger und Zahnrad dieses befremdlichen Wunderwerks zeigten den Tod bei der Arbeit. Der König wusste, mit jedem Springen des Zeigers, mit jedem Klöppelschlag bei Tag und Glockenschlag bei Nacht und mit jedem seiner eigenen Schritte kam er dem Tod näher. Er hatte noch viel Zeit, denn er war noch nicht alt, erst fünfundzwanzig. Aber dennoch verging die Zeit zwischen dem Morgengebet und dem Nachtgebet, die Gebete flossen ab wie Wasser, und die Lebenszeit floss ab. Sie zerrann zwischen den Fingern der leeren Hand.
Er warf sich manchmal in diesen wahnsinnigen Gedanken hinein, tobte und schrie, und es half doch nichts. Es gab keine Erlösung aus dem Dahingleiten der Zeit. Sie hatte einen Anfang, aber kein Ende, sie war ein Attribut Gottes. Und weil Gott ewig war, war die Zeit auch ewig. Und er konnte nichts dagegen tun.
Das verbitterte ihn maßlos.
Er war der König, aber dennoch konnte er die Zeit nicht anhalten! Selbst dann nicht, wenn er es anderen befahl und sie dafür richtete, wenn sie versagten. Er konnte nur warten. Immer wartete er wie ein gewöhnlicher Bittsteller auf irgendetwas. Wie jetzt auf die Abordnung.
Das machte ihn wütend, dann mutlos. Und dann traurig.
Ludwig der Zänker setzte sich wieder, brütete vor sich hin und trank.
Und dann kamen sie. Man hörte sie schon von weitem. Wie sie herumpolterten, wie sie die Türen aufrissen und gegen die Wände schlagen ließen. Der König zuckte zusammen und dachte an seine kostbaren, neuen Seidentapeten aus Burgund: Er sah die Löcher vor sich, die diese verdammten Fremden in seine Tapeten rissen. Er sah vor sich, wie die Eindringlinge ihre Schwerter in die Hände nahmen und beim Gehen in den Parkettboden stießen. Er hörte, wie sie laut lachten.
Und dann traten sie in den Thronsaal.
Der König mochte diesen Ferrand de Tours nicht. Er mochte nicht sein selbstgefälliges Auftreten, nicht seine flackernden Blicke aus unsteten Augen, nicht seinen einfältigen Judenhass. Wenn er diesem Ritter gegenübertrat, fühlte er sich nicht, als sei er wirklich ein Herrscher, er fühlte sich wie ein ungehorsamer Sohn. Wie war das möglich? Er mochte das nicht. Aber er brauchte den eitlen Ritter, denn der brachte immer sein eigenes Gefolge mit, das er entlohnte – so kostete er selbst keinen Sous.
Und er brachte es ohne Skrupel fertig, zu töten.
König Ludwig der Zänker saß auf dem Thron seines ermordeten Vorgängers Philipp, den sie den Schönen genannt hatten, bis der hässliche Tod seine Züge auslöschte. Er rutschte unruhig hin und her und sah Ferrand entgegen. Dessen Männer knieten inzwischen in angemessener Entfernung, Ferrand trat polternd näher und senkte nur unmerklich das blonde Haupt. Aber sein Blick wagte es nicht, den König anzusehen.
»Ergebenster Diener, Herr König, Ferrand de Tours!«
Ludwig verschluckte seinen Ärger. Er hüstelte. Er winkte zwei seiner wichtigsten Ratgeber heran. Demurger und de Nazrier traten beflissen näher und streckten die Hälse vor. Der König flüsterte ihnen zu, auf Tuchfühlung in seiner Nähe zu bleiben. Dann sagte er:
»Du hast auf dich warten lassen, Ferrand de Tours. Beinahe hätte ich mir einen anderen gesucht, der meine Befehle schleunigst ausführt.«
Ferrands Grinsen verrutschte in einem Gesicht, das schön zu nennen war, kräftig geformt, mit ebenmäßigen Zügen. Seine Hässlichkeit kam von innen, wie eine Farbe, die nicht passte. Er erwiderte:
»Ich musste mich von Toledo her durchschlagen, wo gerechte Richter alle falschen Anklagen gegen mich fallen ließen, Majestät. Das Land der Iberer ist unruhig. Erst an der Grenze zu Frankreich erreichte mich Euer Ruf, aber Frankreich, verzeiht, Majestät, ist kaum weniger befriedet. Es gab Aufenthalte hier und da und die Judengemeinden ...«
Der König wollte nicht weiter auf seine Erklärung achten. Er fuhr fort:
»Du weißt, wir feiern jetzt die Michaelistage des Herbstes, das schöne Fest der Erzengel.«
Ferrand wusste es. Aber für fromme Andacht war das Herz des Christen zu hasserfüllt. Er nickte.
»Aber wir feiern auch noch einen anderen Tag. Gerade heute. Und deshalb bist du hier. Wir feiern den Tag des Johannes von Antiochien. Er wurde auf einen bloßen Verdacht hin vom kaiserlichen Hof angeklagt, wegen Ungehorsams aus Konstantinopel verbannt und starb in Kumana. Weißt du, dass er uns heute als der größte Prediger der östlichen Kirche gilt? Dieser Gabe verdankt er seinen Beinamen. Goldmund. Johannes Chrysostomus, der Goldmund. Warum ich dir das erzähle? Er vergaß trotz aller Ungerechtigkeiten gegen ihn und trotz seines Hasses auf die Verfolger niemals seinen Glauben. Und auch nicht die Pflichten seiner Andacht. Und vor allem seinen Gehorsam der Obrigkeit gegenüber nicht. Verstehst du?«
Ferrand schluckte und senkte den Blick. »Ja, Herr König.«
»Bei allem, was du für uns tun wirst, Ferrand de Tours, wirst du niemals den schuldigen Gehorsam und Respekt dem König und der Kirche gegenüber vergessen! Verstanden?«
»Ganz gewiss nicht, Herr König, Sire.«
»Du wirst am Abend beim Fest des Chrysostomus anwesend sein. Wir werden dir dort etwas sehr Wichtiges anvertrauen. Und morgen früh reitest du mit deinem Haufen weiter, bevor die Sonne aufgegangen ist. Und ihr findet mir diesen Henri de Roslin und seine Spießgesellen obendrein. Und ihr bringt sie mir. Und wenn sie sich wehren, tötet ihr sie auf der Stelle und bringt mir nur ihre Köpfe.«
»Damit Ihr sie anspucken könnt. Wie man es mit räudigen Hunden macht, Herr König.«
»So weit, so gut. Aber wohin werdet ihr reiten?«
Ferrand blickte überrascht auf. »Ich weiß es nicht, Sire. Ich rechnete damit, Ihr würdet es mir anweisen.«
»Jetzt gefällst du mir, Ferrand. Ich brauche gehorsame und demütige Untertanen. Ich brauche niemanden, dessen Hochmut die Fahnen flattern lässt wie ein ungestümer Wind, der vor ihm herbläst. Ihr nehmt Befehle entgegen und führt sie aus. Nichts weiter. Verstanden?«
»Ganz gewiss, mein König.«
»Also wohin reitet ihr? Das ist die Frage. Meine Ratgeber haben mir ihre Ansichten unterbreitet, und sie haben mich überzeugt. Sprecht, Demurger und Ihr, de Nazrier.«
Demurger war der Ältere. Er hatte schon unter Philipp dem Schönen gedient. Er hatte am Totenbett seines geliebten Königs in Fontainebleau gestanden. Sein Haar war seitdem grau, und es fiel halblang unter seiner schwarzen Samtmütze hervor.
»Wir vermuten«, sagte er, »dass der Ketzer nach Schottland zurückkehren will. Er wird sich in den Schoß seiner ketzerischen Kirche in Roslin begeben wollen, um dort die Vergebung seiner Sünden herbeizuwinseln. Deshalb denken wir, er wird sich von einem Hafen in der Bretagne aus in die Nordsee einschiffen. Aber von welchem Hafen? Von Le Havre, Cherbourg, Brest?«
Ferrand begriff erst nach einem Moment, dass die Frage ihm galt. Er wusste die Antwort nicht. Er sagte:
»Gewiss wird Henri flüchten. In Frankreich zu bleiben, das wagt er nicht. Aber nach Schottland? Verzeiht, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, er wird sein gegenwärtiges Schlupfloch verlassen, wo immer es sich befindet, und hierher kommen.«
»Nach Paris?« Der König schrie es fast. Er umkrampfte die Lehnen seines Thronsessels.
»Ja, Herr König. Er ist geldgierig. Er wird seinen Schatz holen wollen. Irgendwo in Paris hat er ihn versteckt, denn er war ja dafür verantwortlich. Den dreimal verfluchten Schatz des endlich verbotenen Tempels.«
»Unsinn!« Demurger hatte die Hand gehoben. »Das wagt er niemals. Henri de Roslin ist ein tollkühner Mann, aber nach Paris zu kommen gleicht einem Selbstmord. Das liegt ihm fern. Dazu ist er viel zu schlau.«
»Aber verzeiht«, sagte Ferrand de Tours. »Er braucht Geld. Ohne Mittel kann er nicht reisen. Und die Tempelritter haben ihren Schatz überall versteckt. Den größten Teil jedoch verbargen sie heimlich hier in Paris. Unermesslicher Reichtum, gestohlen und abgejudet! Und ich weiß auch, wo er ist.«
Der König warf überraschte Seitenblicke auf seine ratlosen Berater. Sie schüttelten stumm den Kopf. Ludwig der Zänker beugte sich gespannt vor.
»Nun?«
»In ihrem alten Tempelbezirk auf der Seine-Insel. Nicht im Heiligen Tempel selbst. Ganz tief unten in den Verliesen. Vielleicht sogar noch unter den Verliesen.«
»Das weißt du?«
»Ja, Herr König. Ich erfuhr es von einem der ihren. Einem Abtrünnigen ...«
Unwillig schaltete sich de Nazrier ein. »Reden wir nicht weiter darüber. Es ist geklärt, dass im Haus des Tempels kein Schatz versteckt ist. Er war dort, das steht fest, aber jetzt ist er nicht mehr dort. Wir haben alles durchsucht. Jeden Stein umgedreht, keinen geheimen Raum ausgelassen. Wir fanden keine einzige Kupfermünze. Nein, der Templerschatz liegt längst woanders. Ich denke, in Gisors. Ja, da bin ich sicher. Recht habt Ihr nur damit, dass kleinere Teile des Reichtums über das ganze Land verstreut sind. Vor allem in den Komtureien und Unterschlupfen der Küstenorte. Denn dort brauchen es die Ketzer am dringendsten, wenn sie vom Kontinent und damit vor der gerechten Bestrafung flüchten wollen.«
»Wohin also wird Henri de Roslin mit seinen Mordgesellen ziehen?« Der König blickte Ferrand unverwandt an.
Ferrand sah unglücklich aus. Er wagte es nicht, Paris noch einmal zu erwähnen. »Ich ... ähhh ...«
»Ich sage es Euch, Herr de Tours.« Demurger fuchtelte mit den Händen. »Er bricht nach Nantes auf. Nach Nantes! Und nirgendwo sonst hin! Denn dieser Hafen liegt in der Bretagne und ist deshalb unabhängig. Der Templer glaubt, dort muss er uns nicht fürchten. In der bedeutenden Komturei von Nantes holt er das Geld und schifft sich nach Schottland ein. Er weiß doch ganz genau, dass in Paris die Strafe auf ihn wartet – der Generalinquisitor, Monsieur Imbert. Seine Majestät, der Herr König. Wir selbst. Und die gesamte Anzahl der gehenden und reitenden Stadtboten und Guten Gerichtsbüttel mit Pieken, Schwertern, Äxten und Schlingen!«
»Sehr richtig, Demurger«, sagte der König zufrieden. »Er geht also nach Nantes. Und woher wissen wir das? Wir spekulieren natürlich nicht wild herum, nicht wahr? Wir haben unsere Zuträger und Spione. Kluge Leute, die ihr Handwerk verstehen. Sie haben Beweise dafür vorgelegt, dass Henri nach Nantes kommt. Wir konnten nämlich einen Sarazenen dingfest machen, der heimlich in Nantes weilt. Ein Freund Uthmans, der mit Henri de Roslin reitet. Ein durchaus vertrauenswürdiger Heide. Aber auch ein wenig geschwätzig. Vor allem, als man seine nackten Beine in offener Glut röstete! Dann konnte dieser tapfere Mann einfach den Mund nicht halten!«
De Nazrier blinzelte irritiert, dann sagte er: »Es wird also so sein, dass Henri innerhalb der nächsten drei Wochen in Nantes eintrifft, um die Finanzen der Komturei endgültig aufzulösen. Dort werdet Ihr auf ihn warten, Ferrand. Natürlich werden auch Stadtsoldaten zur Stelle sein, zumindest soweit wir auf Soldaten eines unabhängigen Territoriums Einfluss haben. Unsere Möglichkeiten sind da im Moment beschränkt.«
»Gewiss«, murmelte Ferrand.
De Nazrier fuhr fort: »Aber um keinen Verdacht zu erregen, müssen wir sie versteckt halten. Und im Kampf sind sie möglicherweise dem Ketzer nicht gewachsen. Vielleicht sympathisieren einige sogar mit seinen Ideen. Man hört ja, je weiter es nach Norden geht, desto anfälliger sind die Leute für die Irrlehren des Tempels. Henri de Roslin jedenfalls ist es gewohnt, wie ein scheues Reh zu wittern und wie ein Raubtier zu kämpfen und zu reißen. Ebenso seine Gefährten. Deshalb kommt Ihr ins Spiel. Ihr seid ihm ebenbürtig.«
»Das will ich meinen«, sagte Ferrand geschmeichelt. »Ich werde ihn zu fassen kriegen.«
»Ihr reitet, wie gesagt, morgen früh. Wir statten Euch mit allen Privilegien aus. Und richtet es nach Möglichkeit so ein, dass Ihr den Ketzer erst dann stellt, wenn er seinen Schatz schon gehoben hat. Verstanden?«
Ferrand nickte. »Ich werde auf ihn warten. Dann kehre ich mit dem Schatz und dem Verräter nach Paris zurück. Ich war noch nie in Nantes, gibt es dort eine jüdische Gemeinde? Dann könnte ich mich auch noch darum kümmern. Es ist ein Abwasch, werte Herren.«
»Ihr konzentriert Euch allein auf Henri!« Der König hatte sich vorgebeugt, er spießte den vor ihm Stehenden mit seinem Zeigefinger auf. »Es darf nichts schief gehen! Ihr lauert ihm auf und lasst Euch von nichts ablenken! Von keinem Juden, von keinem Weib, von keinem Spielebrett, von keiner Flasche Wein! Wenn er uns durch die Lappen geht, mache ich Euch wegen Hochverrats den Prozess!«
»Jawohl, Herr König, Sire.«
»Und noch eins. Ihr habt niemals vom König einen solchen Auftrag bekommen. Verstanden?«
»Gewiss.«
»Und nun bezieht euer Quartier«, sagte Demurger, »und kümmert euch um die Ausrüstung für die Weiterreise. Nehmt, was ihr braucht. Scheut euch nicht, nur das Beste zu beanspruchen. Es ist alles vorbereitet.«
Ferrand wurde durchflutet von Dankbarkeit gegen den König, der es gut mit ihm meinte. Wie liebte er den König – jeden König! Aber er wagte es nicht, aufzublicken. Mit gesenktem Kopf zog er sich zurück. Im Kreis seiner Gesellen verließ er rückwärts gehend und dienernd, dabei auffällig leise den Thronsaal. Als die Flügeltüren hinter ihnen geschlossen worden waren, winkte König Ludwig der Zänker die Anwesenden hinaus. Ferrands Auftritt hatte ihn aufgeregt.
Als er allein war, rieb sich der König die Hände und merkte, dass sie feucht waren.
Langsam konnte er sich wieder auf die angenehmen Dinge konzentrieren. Er freute sich auf einen Disput mit seinem Hofphilosophen Gaumier.
Sie würden über die Ewigkeit und das Zeitalter reden, über aeternitas und aevum. Über die irdische Zeit und die sakrale Zeit. Der König wollte endlich beweisen, dass nur seine eigene Zeit real war. War das verwerflich? Er spürte seinen inneren Zweifel. Das machte ihn noch unruhiger. Er war der König, er tat, was er wollte!
Ludwig der Zänker trank noch mehrere kräftige Schlucke aus dem Weinpokal. Dann stemmte er sich aus seinem Sessel hoch und verließ gemessenen Schrittes den Thronsaal.
*
Am Abend waren alle vor der Palastkirche versammelt, um das Fest für den Johannes Chrysostomus, den Bischof von Konstantinopel, zu feiern. Man kam mit Fackeln und brennenden Holzscheiten, in die der böige Wind fuhr und Funkenregen erzeugte, der Hände und bärtige Gesichter verbrannte.
Vom städtischen Platz jenseits der Mauern her kamen Gesänge und übermütige Musik. Frauen lachten und kreischten, betrunkene Männer brüllten. In der Stadt schien an diesem Freitag eine weniger ehrfürchtige Feier im Gang zu sein.
Die Herrschenden des Festzuges gingen unter golddurchwirkten Baldachinen. Vor den Frauen durften die Gäste des Palastes gehen, darunter Ferrand und seine Männer, gewaschen und herausgeputzt, mit sauberem Federbusch. Aber sie hatten noch immer keinen Sinn für Festlichkeiten und dachten nur an den kommenden Tag.
Als sie in den breiten Mittelgang der Kirche einmarschierten, fielen die letzten Sonnenstrahlen blutrot durch die Fensterrosetten des Altarbezirks und die hochfahrenden bunten Fenster der Seitenschiffe. Ferrand kam es vor wie eine Demonstration des Lichts, um sie zu erhöhen und zu feiern. Denn standen nicht sie selbst im Mittelpunkt solcher Feste? Die Lebenden? Was gingen ihn die Toten an, selbst wenn sie tote Heilige waren. Sein Christentum verband ihn ganz und gar mit der Gegenwart. Mit der Gegenwart von Rachegedanken. Von Kämpfen und Siegen.
Aber wenn der König es so wollte, dann feierte er eben mit. Schließlich war er als ergebener Christ auch empfänglich für Erhebung und Trost.
Der noch unverheiratete König trat bis vor den Altar. Dort setzte er sich. Die anderen nahmen in respektvollem Abstand ebenfalls ihre Plätze ein. Und jetzt verstand Ferrand, warum er bei der Feier anwesend sein musste.
Noch bevor der Priester mit den Regularien zum Fest für den heiligen Johannes begann, trat ein Mönch des Kirchenklosters durch die gedrungene Eichenholztür zum Dormitorium. Er schritt die dreizehn Steinstufen herab. Er trug ein Schwert. Seine Füße steckten in weichen Sandalen und machten auf dem Terrakottaboden kein Geräusch. Es schien, als schwebe er. Der Mönch ging auf Ferrand zu, der in sich versunken auf seiner Bank zur Rechten saß.
Als der Mönch mit dem Schwert Ferrand erreichte, flatterten drei weiße Tauben auf, die auf einem mit Tierköpfen geschmückten Kapitell gesessen hatten. Sie flogen mit wild schlagenden Flügeln quer durch das Kirchenschiff empor und machten für einen Moment die Abmessungen des aufragenden Raumes spürbar. Dann verschwanden sie durch die spitz zulaufenden Fensteröffnungen der Südfassade. Ferrand sah unsicher auf und verfolgte den Flug der Vögel. War das ein Zeichen? Musste er es deuten?
Der Mönch stand jetzt vor ihm. Und der König blickte auf sie.
Der Schwertträger murmelte, es war kaum verständlich: »Mit einem Text. Handschriftlich versehen. Die Worte lauten: Mein Sohn, behalte meine Rede und verberge meine Gebote bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst du deine Rache beenden, und behalte mein Gesetz wie deinen Augapfel. Vergiss sie niemals. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.«
»Proverbis, das siebte Kapitel«, murmelte jemand, und dann begriff Ferrand, dass er seine eigene Stimme hörte.
Das war es also, was der König ihm anvertrauen wollte. Ein Symbol der gerechten Rache. Ferrand griff unschlüssig nach dem Schwert.
»Nimm das Schwert und gehe«, sagte der Mönch mit tonloser Stimme. »Auf dich wartet der Tod, aber auch das Leben. Wähle! Die Ketzer verdorren die Welt, weil das Wort des Herrn in ihren Herzen fehlt. Unterweise deine Gefährten und richte mit dem Schwert. Der heilige Jacobus wird bei diesem Unterfangen bei dir sein. Die Muschel, das Zeichen unseres Heiligen, das wir aus Santiago erhalten haben, wird durch dieses Schwert immer gegenwärtig sein, wohin du mit deinen Brüdern auch ziehst.«
Ferrand hatte begriffen. Aus diesem Grund war er hier. Dafür brauchten sie ihn. Jetzt war seine Gegenwart nicht mehr erwünscht. Er spürte, wie seine Gefühle durcheinander gerieten. Man brauchte ihn nicht für die hohe Feier. Der Gottesdienst fand ohne ihn statt.
Aber der König vertraute ihm. Das war wichtig.
Er sah zum Licht empor. Feuer, murmelte er. Und Schwert. Es ist das Meinige. Mein ist die Rache.
Er erhob sich, jetzt wieder stolz, und nach ihm erhoben sich seine Männer. Sie beugten die Knie in Richtung des Altars und des Königs. Dann durchquerten sie die südöstliche Nebenapsis, die sich zum Chorumgang hin öffnete.
Ferrand faltete die Hände um den Griff des mächtigen Schwertes. Überall Feuer, dachte Ferrand, Feuer in hundertfacher Gestalt, reinigendes Feuer. Strafendes Feuer für die Ketzer und dazu das Schwert des Herrn. Wehrhafte Christen sind zu allen Zeiten willkommen gewesen.
Ich weiß, was zu tun ist. Ich danke dir, mein Herr König, Sire.
Als er den Ausgang erreichte und die schwere Eichentür mit einer Hand öffnete, flackerten im Windstoß Hunderte von Kerzen in den eisernen Kronleuchtern, die von der Decke herabhingen.
Draußen lagen die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf dem dicken Kirchengemäuer und verblassten langsam.
Sein Ziel war Nantes.
2
Ende September 1315, in Uzés
Als Henri de Roslin die Augen aufschlug, dachte er an die jetzt anbrechenden Tage des Herrn. Es waren tröstliche Tage in einer unseligen Zeit. Er wollte schon am frühen Morgen damit beginnen, sie zu feiern.
Die kleine Stadt schlief noch. In ihren dicken, reichen Mauern lagen noch die Kühle der Nacht und der schwere Traum, den die Einwohner träumten. Sie hatten den Papst in ihren Mauern begraben. War er wirklich ermordet worden? Allein der Gedanke war Furcht erregend. Aber sie waren immer gottesfürchtig gewesen und deshalb ohne Schuld. Und jetzt galt es, den Tod aus ihren Gedanken und Träumen zu schütteln und sich mit Gott zu versöhnen.
Henri bewegte sich leise. Er warf von seinem Strohlager aus einen Blick in den benachbarten Raum. Seine beiden Gefährten, die an seiner Seite geblieben waren, ließen noch Schlafgeräusche hören. Gottfried von Wettin, der Bruder von den Dominikanern, war inzwischen in den Klosterpalast nach Avignon zurückgekehrt, die beiden jungen sarazenischen Helfer nach Toledo. Nun waren sie wieder zu dritt, eine kleine, verschworene Gemeinschaft in Feindesland. Uthman ibn Umar lag ausgestreckt auf dem Rücken wie ein Büßer. Joshua ben Shimon hatte Arme und Beine angezogen und den Kopf hineingelegt wie ein schlafendes Haustier. Henri musste lächeln. Die Gefährten hatten wie er schwere Zeiten hinter sich. Aber aus all den Kämpfen, aus Verfolgung und Flucht waren sie gestärkt hervorgegangen.
Er hoffte es jedenfalls. Denn was vor ihnen lag, würde nicht einfacher werden. Es erforderte ihre ganze Kraft.
Und Liebe, dachte er.
Und Gottes Beistand, damit wir nicht das Falsche tun.
Sein sonnengebräuntes, noch junges und glatt rasiertes Gesicht wurde wieder ernst. Er legte für einen Moment versonnen die Hand auf die Tasche, in der seine Kriegskleidung mit dem Schwert, aber auch der Rock mit der roten Schärpe, der weiße Umhang mit dem roten Tatzenkreuz, die dunklen Pumphosen lagen. Er wollte aus der Erinnerung Kraft schöpfen, denn die Ordenskleidung durfte er nicht mehr tragen, und er versteckte sie meistens.
Seufzend zog er aus seiner zweiten Tasche, mit der er stets reiste, ein schlichtes Beinkleid und dann ein Hemd aus gebleichtem Leinen. Beides wog leicht in seinen Händen. Er zog es an, gürtete es um seine schmale Taille und zog einen leichten Rock darüber, um seinen zweischneidigen Dolch zu verbergen.
Henri verließ leise das gemietete Haus. Er spürte die Morgenkühle, der Herbst kündigte sich früh an, von den Bergen kam schon jetzt weißer Nebel herüber. Mit der Michaeliszeit begann die eigentliche Endzeit des Jahres und damit auch des Kirchenjahres, und die Natur richtete sich darauf ein.
Henri überquerte eine hölzerne Brücke, darunter schoss schäumend ein Bach dahin. Er blieb einen Moment stehen und berauschte sich an diesem Wasser, das alles mit sich riss. Nichts bleibt, wie es ist, dachte er. In Uzés gab es unzählige Quellen mit reinem, reinigendem Wasser, das vor nichts Halt machte.
Er ging an der Kathedrale St. Theodorit vorbei, deren fünfgeschossiger runder Tour Fenestrelle die Nebelschwaden berührte. Dort durfte er nicht beten, die Kirche war der Bischofssitz. Er ging hinüber in die schlichte Kapelle der Zisterzienser.
Auch hier war überall kühles Wasser. Es floss, strömte und schäumte in hundertfacher Gestalt durch Gärten und durch den ganzen Ort, als wollte es sich zu einer Hymne auf die Kraft der Natur vereinen. Henri bückte sich am Ufer eines anderen Baches und trank aus der hohlen Hand. Es stillte seinen Durst. Hunger verspürte er keinen.
Als er sich wieder aufrichtete, schnitten ihn die Schmerzen an den Handgelenken. Er rieb sie unwillkürlich. Die Narben von den Ketten im Donjon von Fontainebleau, wo er nach dem Mord an König Philipp dem Schönen von Generalinquisitor Guillaume Imbert gefoltert worden war, verheilten nicht. Sie würden nie heilen.
Aber während er das Laudes betete, während des Morgenlobes zur Feier der Erzengeltage, würde er die Schmerzen vergessen. Dann war er ganz in der zärtlichen Hand des Herrn.
Henri ging mit energischen Schritten weiter. Über dem gräflichen Erbschloss, das die Bewohner der Stadt einfach Duché nannten, wehten die Wimpel und Fahnen des herrschaftlichen Geschlechtes. Er konnte auf dem hohen Tour Bermonde gerüstete Wachsoldaten erkennen, und obwohl der mächtige Burgblock aus wucherndem Felsgestein entfernt war und unzugänglich schien, hielt sich Henri im Schatten der Bäume. Als er den Marktplatz überquerte, sah er, dass die Töpfereien des Ortes schon öffneten, die Drehscheiben standen bereit, die Brennöfen wurden trotz der frühen Morgenstunden schon von fleißigen Handwerkern geschürt. Die ruhige, selbstverständliche Arbeit der einfachen Leute war es, die ihn immer heiter stimmte.
Es sind die Herren, dachte er, durch die das Leben schwer wird.
Er betrat die Kapelle St. Genis. Im Hintergrund knieten einige Gestalten des Klosters in schwarzen Kutten und Kapuzen, die schon das Matutin zum Gedenken an die Vigilgottesdienste entrichtet hatten. Sie murmelten ohne Pause ihr Gebet. Die eifrigen Mönche würden in diesen Festtagen ohne Unterbrechung auch Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet beten. Henri genügte es, im Herzen bei Gott zu sein. Aber er hoffte, alles, was er tat, sei gottgefällig. Er befragte sich ständig selbst darüber. Und er lauschte so lange, bis er eine Antwort erhielt.
Henri de Roslin kniete nieder. Er senkte den Kopf. Und begann, in sich zu gehen. In seinem Inneren entstand die Epistel des Berichtes der Johannesoffenbarung über den Kampf Michaels und seiner Engel mit dem Drachen. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Der Satz löste ein Bild in seinem Inneren aus. Er sah Satan.
Dann verlöschte das Bild, und er dachte: Michael, Gabriel und Rafael erschienen und kämpften stark und vereint.
Henri konnte sich an diesem frühen Morgen nicht so konzentrieren, wie er wollte. Zu viel geschah in diesen Tagen. Seine Gedanken schweiften ab. Auch er und seine beiden Gefährten kämpften zu dritt vereint. Aber sie waren keine Engel. Sie waren jetzt nicht einmal mehr Rächer. Denn der Rache war Genüge getan. König Philipp und Papst Clement hatten das gerechte Schicksal von Verrätern erlitten. Was für ihn, Uthman und Joshua zu tun blieb, war die nackte Verteidigung ihres Lebens. Denn sie machten sich nichts vor. Das ganze Land war inzwischen aufgerufen, sie zu jagen und auszuliefern.
Der Kampf der Engel gegen die Macht des Bösen, dachte er weiter, das ist auch unser Kampf gewesen. Jetzt ist er zu Ende. Sie hatten wie die Erzengel gefochten, das war wohl wahr, und war es gottgefällig gewesen? War Gott noch auf ihrer Seite, obwohl sie zweimal schwer gesündigt hatten?
Aber hatten ihre Feinde nicht hundertfach mehr gesündigt? Wie Ferrand de Tours, der die Judengemeinde von Toledo mit Feuer und Schwert auslöschen wollte. Er, Henri, hatte das im letzten Moment verhindern können. Aber mit Sorge dachte Henri, dass er Ferrand nicht hatte bestrafen können. Er musste ihn den Gerichten der alten Judenstadt überlassen, einem zweifelhaften Gericht, wie er ahnte, das vielleicht mit Ferrands schändlichen Ideen von der Schuld der Juden sympathisierte.
Henri versenkte sich wieder. Er betete lange, der Schutzengel möge über seine beiden Gefährten wachen, denn sie brauchten ihn. Er betete, bis seine Knie schmerzten.
Er hob den Kopf und sah zum Altar auf, der mit Getreidegarben, Brot und Weintrauben geschmückt war. Der Schmerzensmann am Kruzifix schien heute milder zu blicken, er schien versöhnter zu sein mit den Menschen und dem irdischen Jammertal.
Henri seufzte. Dann beendete er sein Gebet, schlug das Kreuz und erhob sich.
Er blickte hinüber. Die Mönche jenseits des Lettners murmelten ungestört weiter ihre Gebete. Henri verstand Wortfetzen. Durch ihn haben wir, die wir dem Tod verfallen sind, die Hoffnung des ewigen Lebens ... Henri de Roslin verspürte plötzlich eine tiefe Sehnsucht danach, zu ihnen hinüberzugehen, mit ihnen gemeinsam den Gottesdienst zu verrichten, in Gemeinschaft zu sein wie früher ... Zu dem er am Tage des Gerichtes auferwecken wird alle jene, die an ihn glauben ...
Aber er ging nicht hinüber, es war zu gefährlich. Wenn jemand ihn erkannte, obwohl er nun nicht mehr das Gewand der Templer trug, keinen Bart und kein kurz geschorenes Haar, dann würde er ihn sofort ausliefern. Auch die Zisterzienser waren dazu verpflichtet, obwohl ihr Gründervater Bernhard zu den engsten Freunden des Tempelordens gehört hatte. Doch das war lange her. Heute war Henri de Roslin der größte Feind der gläubigen Christenheit, und dazu gehörten neben seinen größten Feinden, den Dominikanern, die er nur domini canes, Hunde des Herrn, nannte, nun auch die Franziskanerbrüder.
Damit musste er leben.
Er schlug noch einmal das Kreuz und verließ die Kapelle.
Draußen blieb er wie vom Schlag getroffen stehen. Mein Gott, er hatte es nicht anders erwartet – aber das Leben war weitergegangen! Es nahm einfach seinen gewohnten, kraftvollen Lauf – und wie schön alles war!
Am Himmel stand inzwischen die strahlende Sonne, sie hatte den Nebel besiegt. Es roch nach Salbei und Lavendel. Zwischen den Steinringen der aufgeschichteten bories blühte zum dritten Mal im Jahr der Rosmarin. Zikaden erhoben ihre Stimme. Henri sah, dass die Felder, die bis in die Stadt hineinreichten, längst abgeerntet waren, überall standen aber noch die gebundenen Garben. Er hatte bisher keinen Blick dafür gehabt.
Henri verspürte Lust, sich unter einer der mächtigen Kastanien der städtischen Promenade ins Gras zu legen. Konnte das Leben nicht leicht und schön sein? Wäre es nicht wunderbar, für eine kurze Weile auszusteigen aus seinem Schicksal und sich mit nichts als Schönheit zu umgeben? Mit einer jungen Frau, mit Musik, mit sorglosen Gedanken?
Henri schloss die Augen. Das würde er nie spüren, es war das Leben eines anderen. Und doch war es verführerisch, auch nur daran zu denken.
Henri de Roslin nahm sich zusammen. Er ging mit schnellen Schritten zu dem Haus am Stadtrand, das Joshua ibn Shimon für sie gemietet hatte. Für das vermietende Ehepaar, einfache Lavendelbauern von den Hochplateaus, waren sie nur drei Landvermesser auf dem Weg zu einer neuen Anstellung nach Orange, die in einigen Tagen begann. Auch im Garten vor dem kleinen Anwesen zirpten inzwischen die unsichtbaren Grillen und Zikaden mit ihren schrillen Geigen. Henri betrat das kleine, grob verputzte Steinhaus mit dem rostroten Dach.
»Wir dachten schon, du bist ohne uns weitergereist«, sagte Uthman vorwurfsvoll. »Sag uns bitte, wohin du gehst. Wir sind sonst in Sorge.«
Henri sah seine beiden Gefährten an und nickte. »Wohin werde ich gehen, das ist in der Tat die Frage. Ich denke, ich muss nach Paris. Dort ist noch so viel zu regeln. Ich kann nicht alles sich selbst überlassen.«
»Nach Paris darfst du auf gar keinen Fall«, erklärte Joshua und rückte sich die Brille zurecht. »Dort lauern so ziemlich alle auf dich, die dir Böses antun wollen.«
Henri sagte: »Ich will ihnen nicht unseren Reichtum überlassen. Sie wissen doch nichts anderes damit anzufangen, als Unheil zu erzeugen. Ein Rest unseres Templerschatzes blieb in Paris. Ich muss ihn in Sicherheit bringen.«
»Dann kannst du gleich dein Schwert holen und dich umbringen, Henri!« Uthman hatte eine laute Stimme bekommen. Er warf sein rabenschwarzes, halblanges Haar mit den Händen zurück. »Du läufst in eine Falle.«
»Er hat Recht«, pflichtete Joshua bei. In sein feines, verträumtes Gesicht trat Sorge. »Nach Paris darfst du in keinem Fall. Sagtest du nicht, der Schatz sei über das ganze Land verstreut? Gehe in die Bretagne, dort bist du außer Reichweite der Häscher.«
»Oder nach Bordeaux, es gehört immer noch dem englischen König«, ergänzte Uthman
»Ihr meint es gut mit mir, das weiß ich. Aber ich bin noch nie einer Gefahr ausgewichen. Die Templer kämpften immer an vorderster Front, alles andere hätte unserem Selbstwertgefühl nicht entsprochen. Gott wird auf meiner Seite sein, wie er es bis jetzt immer war.«
»Dann gehe hin und sterbe«, erregte sich der Sarazene. »Uthman, sprich nicht so! Hat dein Vater dich nicht Gefasstheit in jeder Lage gelehrt? Was ist los mit dir?«
»Ach!« Der Sarazene wendete sich ab. »Mir ist unsere ganze Situation zuwider. Ich habe das Gefühl, wir können uns kaum noch bewegen. Wir sollten auswandern. Alle drei! In ein Land jenseits dieser Herrschaft, die uns am Leben hindert.«
»Wo sollte das sein?«
»Im Orient! Im heiligen Land! Es ist für uns alle heilig! Die Menschen dort spüren die Allgegenwart Gottes genau und leben danach. Wir haben das doch schon zusammen erlebt! Hier redet man sie nur herbei.«
»Wir können nicht fort«, sagte Henri. »Es wäre ein Davonlaufen. Hier gibt es noch so viel zu tun. Noch immer sitzen einige unserer Brüder unschuldig in den Kerkern. Ich muss sie herausholen. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn auch nur einer in Gefangenschaft stirbt. Und ich muss die Hinterlassenschaft des Tempels regeln. Es wäre mir unerträglich, wenn auch nur die kleinste Kleinigkeit in ihre Hände fiele. Sie haben zu viel Blut vergossen. Es wäre eine Entweihung.«
»Gehe nach Nantes, Henri«, sagte Uthman beschwörend. »Dort kannst du ausruhen. Es ist so viel passiert. Du hast eine Zeit nötig, in der du nicht ständig auf der Hut sein musst. Bleib dort, bis sich hier alles beruhigt hat. Wir warten hier, bis der Junge angekommen ist. Wir weisen ihn bei seinem neuen Erzieher ein und folgen dir nach. In Nantes können wir gemeinsam überlegen, wohin wir reisen. Uns steht die Welt offen!«
»Ja«, sagte Henri, »wir können nach Schottland gehen. Das wäre herrlich. Ich könnte einen Abstecher nach Roslin machen. Oder wir bleiben in London.« Seine Stirn umwölkte sich. »Aber ich kann kein Leben in Bequemlichkeit führen, solange meine Brüder verfolgt und gequält werden. Es wäre gegen meine Natur, die Augen vor der Ungerechtigkeit zu verschließen.«
»Der Tempel ist zerschlagen, Henri. Kein Stein blieb auf dem andern. Sieh das ein!«
Henri blickte Uthman ungläubig an. »Das sagst du zu mir! Du weißt doch genau, wie sie noch immer Jagd auf jeden machen, der auch nur entfernt in Verdacht geraten ist. Es hält sie doch keiner auf, wenn wir es nicht tun. Sie wollen die grenzenlose Macht, sie wollen das Geld. Bevor sie beides nicht uneingeschränkt besitzen, geben sie doch keine Ruhe!«
»Du hast Recht. Aber was nützt es dir, wenn du in Frankreich bleibst, hier eingekreist wirst, und dich nicht mehr rühren kannst! Vielleicht stehen die Häscher schon draußen! Jeden Morgen denke ich das und schrecke aus dem Schlaf hoch. Nein, damit ist niemandem geholfen. Du musst dich für eine Weile unsichtbar machen. Wenn die Wogen sich geglättet haben, kehrst du zurück.«
Henri überlegte lange. »Nantes, hm?«
»Ja.«
»Ich – habe nur eine Bedingung. Ihr müsst sofort nachkommen, sobald der junge Sean of Ardchatten eingetroffen und versorgt ist.«
»Versprochen.«
»Warum nicht Brest, Quimper, Saint Malo?«
Uthman gestand: »Weil ich schon einen jungen Sarazenen nach Nantes geschickt habe. Er heißt Usama ibn Muquid. Er soll dort die Lage auskundschaften und für uns ein Haus kaufen. Es soll ein schönes Haus sein – nicht eine solche Hundehütte wie hier in Uzés. Eine Art Zentrum, von dem aus wir die nächste Zeit planen können. Nantes ist ideal. Es liegt abseits der Fronten. Und ist dennoch gut geeignet, falls wir uns schnell absetzen müssen. Denn natürlich können wir unsere Zeit nicht mit Ausruhen vergeuden. Der Kampf gegen Diktatur und Willkür von Kirche und Königshaus lässt uns nicht viel Spielraum – und keine Wahl.«
Henri schwieg. Dann sagte er: »Also gut. Ich reite nach Nantes. Wie kann ich mit deinem Boten Verbindung aufnehmen?«
»Warte, bis er dich findet.«
»Übermorgen früh bei Sonnenaufgang, nach dem dritten Gebet in St. Genies, breche ich auf. Dann habe ich alle Erzengel angerufen, die wir auf unseren Wegen benötigen. Und ich hoffe, sie hören mich.«
Uthman sagte: »Ich hoffe, du hast mir Gabriel zugeeignet. Er war der Bote, der zu Muhammad kam, der ihm in den Bergen von Mekka auch seinen Auftrag von Allah übermittelte, alle Muslime zu vereinen.«
»Gabriel ist auch der Schutzengel der Jungfrau Maria, die den Propheten Jesu gebar«, sagte Joshua. »Aber ich will ihn dir nicht streitig machen. Ich nehme Rafael, der immer mit dem jüdischen Volk einverstanden war.«
»Maria gebar nicht den Propheten Jesu. Sie gebar Gottes Sohn Jesus Christus«, erklärte Henri.
»Wie schön, dass wir drei in der Lage sind, Meinungen zu haben, ohne deshalb einen Krieg anzuzetteln«, sagte Uthman.
»Jedenfalls will ich nicht«, sagte Henri, »dass ihr mich verabschiedet. Ich werde, wenn ihr morgen früh erwacht, einfach nicht mehr da sein.«
Die beiden Gefährten blickten ihn an, als läge in seinen Worten ein besonderes Omen.
*
Als der junge Sean of Ardchatten endlich aus dem andalusischen Cordoba eintraf, wo er auf Empfehlung Uthmans die Bücher studiert hatte, waren die Michaelistage längst vergangen.
In Uzés besuchten nur noch ein paar alte Frauen das Grab des Papstes auf dem Friedhof hinter der Kathedrale. Mit dem Oktober hatte der Herbst endgültig Einzug gehalten, und die Menschen hatten alle Hände voll zu tun, sich auf den langen, stürmischen Winter vorzubereiten.
Der Vermieter ihres kleinen Hauses war nicht misstrauisch und freute sich über die weiteren Einnahmen. Aber sie erklärten ihm trotzdem, dass ihr Arbeitsantritt sich verzögert hatte und nur ihr Vorarbeiter seinen Vertrag sofort zu erfüllen habe, weshalb er vor Tagen nach Orange geritten sei.
Henris Knappe Sean schwelgte noch immer in der Seligkeit seines Liebeskummers und verfasste Reime. Hin und wieder ließ er auch das Lied seiner dreilöchrigen, klappenlosen Flöte hören, die seine jugendliche Sehnsucht nach der fernen Guinivevre ausdrückte, die ihn die körperliche Liebe gelehrt hatte. Joshua, der den Jungen ebenso liebte wie Henri und dieses Gefühl auch eher ausdrücken konnte, weil Sean ihn an seinen eigenen, verlorenen Sohn erinnerte, lächelte beim Anhören dieser Lieder. Uthman sah dabei aus, als dächte er verklärt an seine geliebte Heimatstadt. Aber Cordoba, die Metropole des Wissens, der Toleranz und der warmen Farben, lag für sie alle unerreichbar weit entfernt.
Sean bemerkte sofort die angespannte Stimmung der Männer. »Ihr lieben Herren«, sagte er mit seinem starken schottischen Akzent, »auch wenn mein Meister Henri nicht mehr hier ist, lasst uns nicht traurig sein. Wir reiten in die Natur hinaus, und ich werde euch etwas vorsingen. Ich habe neue Lieder gelernt. Es genügt, wenn wir erst am Abend den Ritter treffen, den ihr für meine Ausbildung auserkoren habt.«
»Er hat Recht«, sagte Joshua, »heute ist ein besonders warmer Tag, vielleicht einer der letzten, den wir genießen dürfen. Reiten wir an den Fluss Gard. Dort ist es besonders schön, wie man sagt. Wir können baden.«
»Du kannst baden«, sagte Joshua. »Denn du hast es nötig. Wir Juden baden nicht im Freien.«
Sean flachste: »Wir werden niemals baden gehen, nicht wahr? Dafür sind wir viel zu stark und einfallsreich. Aber waschen könntest du dich tatsächlich mal wieder, Sarazene! Du riechst nach Kampf!«
Uthman schnupperte an sich. »Tatsächlich. Ich rieche nach Kampf. Das hast du rücksichtsvoll ausgedrückt, mein Sean of Ardchatten. Für einen Knappen weißt du die Worte gut zu setzen.«
Ihre Pferde waren schnell gesattelt. Kurz darauf ritten die drei in einer Staubwolke aus dem Städtchen hinaus.
Sie bemerkten nicht den Reiter, der ihnen in respektvollem Abstand folgte.
*
Die Landschaft der Provence verfärbte sich. Der Mistral der Nacht hatte sich gelegt. Der kühle Wind hatte den Himmel leer gefegt und die Hitze fortgetrieben. Jetzt standen Pinien, Feigenbäume und Olivensträucher unbewegt, und die einsamen Tamarisken am Rand der Sümpfe beugten sich ohnehin nie. Die Zypressenwände, die man zum Schutz vor dem Mistral bei Feldern und Rebhängen errichtet hatte, schienen zu leben, sie tönten wider von tausendfachem Vogelgesang. Bei ihrem übermütigen Ritt kamen sie durch Nymphenwälder, in denen Efeu an den Baumstämmen wucherte, hier schien noch immer Sucellus, der geheimnisvolle, alte Keltengott, zu wohnen, oder irgendein Geist.
Sie erreichten den Fluss nach einer Stunde. Sean entledigte sich ungeniert seiner Kleider und sprang sofort splitternackt ins Wasser. Uthman behielt das Hemd an. Das Wasser war noch warm vom langen Sommer und klar, und als die Badenden wieder an Land kamen, trockneten sie sich in der Sonne.
»Wie schön es nach Lavendel riecht«, sagte Joshua. »Lavendel ist die heilige Blume der Provence, man sagt, sie könne Wunden heilen. Wenn ich hier draußen bin, spüre ich es genau. Ich fühle, wie die geistigen Wunden heilen, die uns die Zeit gerissen hat. So viel Schönheit und Harmonie gibt es nicht bei den Menschen, nur in der Natur.«
Sean begann wie aufs Stichwort mit seiner auffallend hellen Singstimme einen lustigen Gesang anzustimmen. Die beiden Männer versuchten in gespieltem Entsetzen, ihm an den Hals zu gehen. Dann lachten sie, sanken zurück und lauschten ihm, schlossen die Augen und fühlten sich eins mit allem. Mit dem Lied, dem Duft, der Sonne, der natürlichen Stille. Die Städte waren weit und mit ihnen die Gesetze und Mahnungen von Kirchen und Königshäusern. Und mit denen das Unheil.
Sie waren so versunken in ihre beglückende Stimmung, dass sie nicht wahrnahmen, wie der Verfolger sich inzwischen bis auf Rufweite genähert hatte. Er verharrte lautlos auf seinem Falben unter Trauerweiden, die ihre Äste bis zum Flussufer senkten.
Nach einer Weile, während er die drei Gefährten regungslos beobachtet hatte, gab er dem Pferd die Hacken und jagte auf sie zu.
Sie schreckten auf. Uthman sprang als Erster auf die Füße und stieß einen warnenden Schrei aus. Er machte drei Sätze auf sein Pferd zu und riss seinen Dolch aus dem Halfter. Er wirbelte herum und erwartete den Fremden mit ausgestreckten Armen in Kampfhaltung. Seine Augen blitzten.
Der Reiter parierte sein Pferd in einer Staubwolke. Er hob die Hand.
»Ich bin ein Freund, Ihr Herren! Ihr habt nichts zu befürchten!«
»So?«, sagte Uthman grimmig.
»Was wollt Ihr?«, rief Joshua.
»Er will mein Lied hören«, murmelte Sean.
»Ich komme aus Poitiers. Dort hat man jemanden, den Ihr kennt, gefangen genommen und hingerichtet.«
Der Falbe des Fremden drehte sich auf den Hinterläufen im Kreis, der Reiter hatte Mühe, ihn zu zügeln.
Die drei Gefährten standen wie erstarrt.
»Habt Ihr mich verstanden? Es handelt sich um Sir Henri. Er ist tot. Die Justiz in Poitiers hat ihn erhängt. Er wurde von einem Denunzianten verraten.«
»Das ist nicht wahr!« Sean schrie auf, in seiner Stimme lag ein Schluchzen.
Langsam richtete sich Uthman auf. Auch Joshua verlor seine Starre. Beide machten eine Geste. Der Reiter stieg ab.
»Sag, was du zu sagen hast«, knurrte Uthman dumpf.
Der Ankömmling wischte sich den Schweiß von der Stirn und setzte sich erschöpft zu ihnen in den warmen Sand.
»Ich bin wie der Teufel geritten, um es euch mitzuteilen. Sir Henri kam, wie gesagt, bis Poitiers. Am nächsten Morgen wollte er über Carthenay weiter, wohin, sagte er allerdings nicht. Er nahm Herberge bei uns an der Ausfallstraße nach Carthenay, deshalb weiß ich das alles. Ein freundlicher Mensch, dieser Schotte. In der Nacht kamen sie. Jemand, der Ferrand de Tours heißt, hatte ihn entdeckt und der Justiz gemeldet.«
»Ferrand!«, stieß Uthman hervor. »Hat der Hund sieben Leben?«
Joshua stöhnte auf. »Das Gericht in Toledo hat ihn laufen lassen. Ich ahnte es.«
Sean hatte die Hand vor den Mund geschlagen und war weiß im Gesicht. »Sprich nicht weiter«, sagte er dann gequält. »Ich glaube das nicht. Wozu etwas erfahren, das so schrecklich ist. Ich will es nicht hören.«
Joshua legte Sean den Arm um die Schultern. »Doch, wir müssen es genau wissen. Berichte alles, Fremder.«
»Ich heiße Verdon. Wie gesagt, betreibe ich mit meiner Frau eine Herberge in Poitiers, an der Straße nach Nantes. Sir Henri kam vor fünf Tagen, nahm ein Zimmer, versorgte sein Pferd und ging am Abend in die Stadt. In der Nacht trat plötzlich ein Trupp reitender Soldaten des Stadthauptmanns die Tür ein, stürmte in unser Haus und fiel über das Zimmer her. Sie sperrten uns ein und durchwühlten alles. Kaum eine halbe Stunde später verschwanden sie wieder.«
»Und Henri? Was war mit Henri?«
»Sie nahmen ihn mit. Oder er war nicht da. Ich weiß es nicht. Wir waren ja eingesperrt, konnten uns nicht um die Gäste kümmern, und es war mitten in der Nacht. Ich glaube allerdings, seine Stimme gehört zu haben, wie er protestierte, wie sie ihn zum Schweigen brachten. Später gegen Morgen kam ein Junge gelaufen, der sagte, sie hätten unseren Gast in der Stadt verhaftet. Was nun stimmt, kann ich nicht sagen. Jedenfalls brachten sie ihn in das Justizgebäude, dort hat man ihn ohne Prozess im Hof erhängt.«
Joshua schöpfte Hoffnung. »Du warst also nicht dabei, als sie ihn töteten! Du hast es nicht gesehen, nur gehört!«
»Ja. Aber unser Gast tauchte danach nicht mehr auf. Er holte sein Gepäck nicht ab, jedenfalls nicht die Überreste, die es noch gab. Also nehme, ich an, es ist alles so geschehen, wie man berichtet. Auch andere Einwohner haben mir hinterher bestätigt, dass die bewaffneten Stadtboten einen Mann auf offenem Pferdekarren in das Justizgebäude fuhren. Noch in der Nacht hörte man Trommelwirbel und das Fallen der Klappe.«
»Das Fallen der Klappe?«
»Das Geräusch, das die sich öffnende Bodenklappe verursacht, wenn der Delinquent in der Schlinge hinunterfällt. Anwohner hören es oft. Es ist laut.«
»Lass es nicht wahr sein, Herrgott!« Sean schlug erneut die Hände vors Gesicht.
»Noch mal«, sagte Uthman gefasst. »Die Stadtbüttel haben durch den Verräter erfahren, wo Henri zu finden war. Sie sind in der Nacht gekommen, um ihn zu holen. Und du weißt nicht genau, ob er da war oder nicht. Richtig?«
»So ist es.«
»Und wenn er nun nicht in der Herberge war und stattdessen in der Stadt verhaftet wurde, dann weißt du das nur durch die Erzählung dieses Jungen.«
»Ja.«
»Dann besteht Hoffnung«, sagte Uthman erleichtert.
»Nein«, erwiderte der Fremde aus Poitiers. »Leider nicht. Denn am nächsten Morgen verkündete der Herold auf dem Rathausplatz, dass man Henri, den schottischen Templer, seiner gerechten Strafe überantwortet habe. Sie sagten, er sei ein verstockter Ketzer.«
»Das kann reine Propaganda gewesen sein!«, murmelte Joshua.
»Zur selben Stunde fand ein Karrentreiber an der vorgeschriebenen Stelle, wo man Unrat, Mist und Trester in den Fluss kippt, die Leiche des Erhängten. Ihr wisst vielleicht nicht, dass die grausamen Behörden unserer Stadt ihre Hingerichteten einfach in den Stadtbach werfen, von wo sie in die umgebenden Flussläufe gespült werden. Unser Wasser ist auf diese Weise vergiftet, denn sie verurteilen oft und richten hin, wie es ihnen passt – Mörder, Diebe, Templer, Juden, Hexen, Unschuldige. Es ist ihnen egal. Sie müssen ihre Tötungsmaschinen bedienen.«