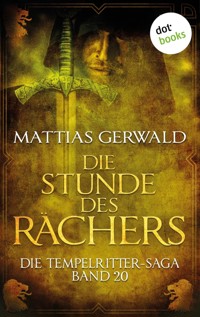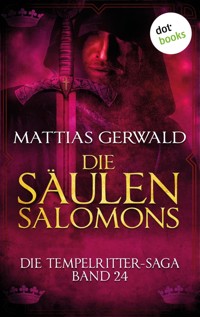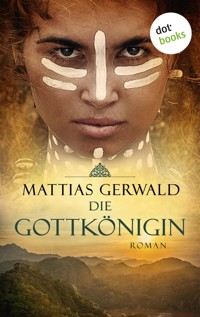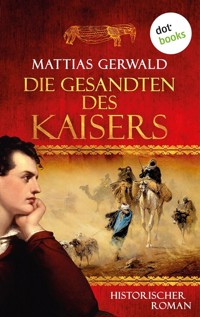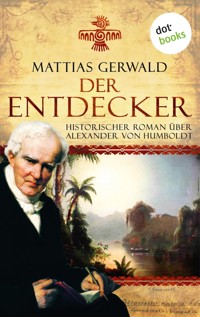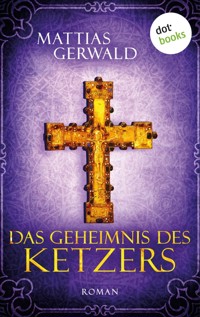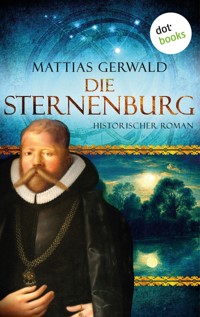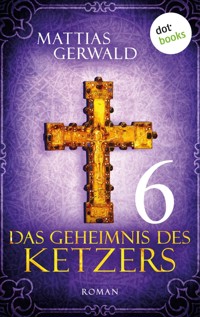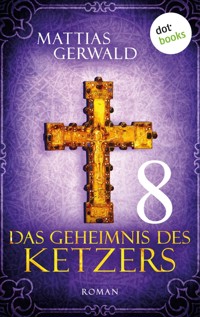Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine tödliche Spur: Der historische Kriminalroman "Die Hetzjagd" von Mattias Gerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Augsburg, 1518: Ein blutiger Anschlag auf den Reichstag, dem auch Kaiser Maximilian und Martin Luther beiwohnen, erschüttert die sonst so friedliche Stadt. Zwischen Machtgier, Gewalt und dem aufkommenden Chaos gerät der Buchmaler Narziss Renner unschuldig in ein Netz aus Intrigen und Verrat: Eines seiner Bilder zeigt angeblich einen Mord, den er selbst begangen haben soll. Kann seine Verlobte Agnes, in deren Herberge mächtige Fürsten geheime Treffen abhalten, an Informationen gelangen, die ihren Geliebten retten? Oder führt die blutige Fährte, auf die sie stößt, geradewegs in den Abgrund? Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Hetzjagd" von Erfolgsautor Mattias Gerwald. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Augsburg, 1518: Ein blutiger Anschlag auf den Reichstag, dem auch Kaiser Maximilian und Martin Luther beiwohnen, erschüttert die sonst so friedliche Stadt. Zwischen Machtgier, Gewalt und dem aufkommenden Chaos gerät der Buchmaler Narziss Renner unschuldig in ein Netz aus Intrigen und Verrat: Eines seiner Bilder zeigt angeblich einen Mord, den er selbst begangen haben soll. Kann seine Verlobte Agnes, in deren Herberge mächtige Fürsten geheime Treffen abhalten, an Informationen gelangen, die ihren Geliebten retten? Oder führt die blutige Fährte, auf die sie stößt, geradewegs in den Abgrund?
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: Novembermord, Engelmord, Regenmord,Frühjahrsmord und Klostermord. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta
Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi
Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder
Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen
Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers
Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons
***
Originalausgabe Juni 2017
Copyright © der Originalausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Susanne Zeyse
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung unter Verwendung eines Gemäldes von Edmund Blair Leighton (Frau mit Schleier) und Nicolas-Antoine Taunay „Henri IV and his suite hunting“ (Jagdszene)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ml)
ISBN 978-3-95824-984-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Hetzjagd an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktiven Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mattias Gerwald
Die Hetzjagd
Historischer Kriminalroman
dotbooks.
»Wir sollen unser Ende, gleich dem Schwan, vorher bedenken, sodass wir in Reinheit und Unschuld gefunden werden.«
(Markgraf Kasimir von Brandenburg-Ansbach)
Vorbemerkung
Dies ist ein Roman. Das darin vorkommende Andachtsbuch der Markgräfin Susanna von Brandenburg-Ansbach, das der genialische Augsburger Buchmaler Narziss Renner schuf, ist heute noch ein Anziehungspunkt der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe. Neben diesen schon genannten Personen haben weitere Handlungsträger des Romans tatsächlich gelebt. Ihr Verhalten, ihre Gedanken, Gefühle und Dialoge sind jedoch ebenso frei erfunden wie das kriminalistische Geschehen rund um den Augsburger Reichstag.
I. Augsburg August 1518
Kapitel Eins
Als Narziss Renner am strahlenden Morgen des 1. August in seine Heimatstadt zurückkehrte, war er blind für die düstere Gegenwart des Todes. Und doch war sie da.
Seine Augen waren noch geblendet von den leuchtenden Farben der Bilder, dem festlichen Feuerwerk in Farbe und Gold, den Akanthusranken mit Goldpollen, den glänzenden Miniaturen auf rotem und blauem Grund. Er war noch erfüllt von den Tagen in Ansbach. Die Erinnerung an die Herzogin stimmte ihn so heiter, dass er selbst dann noch schmunzelte, als er die aufdringliche Menschenmenge vor sich sah.
Die Welt ist doch ein Narrenkäfig, dachte er. Narziss Renner konnte sich nicht erinnern, jemals so lange vom Burgauer Schanzentor zum Dom gebraucht zu haben. Sein Pferd kam kaum voran, wurde unruhig, und er musste den Falben kräftig zügeln.
Ganz Augsburg schien ausgerechnet an diesem Morgen auf den Beinen zu sein, sodass er nicht so schnell zu seinem kranken Vater kam, wie er das wollte. Er bemühte sich, sein Pferd elegant, damit niemand zu Schaden kam, durch die holprigen und engen Straßen zu lenken, die trotz der gerade verlegten und festgestampften Flusskiesel vom heftigen Gewitterregen aufgeweicht waren.
Er fragte sich, was alle die Menschen heute miteinander zu schaffen hatten. Natürlich, sie versuchten, ihr Brot zu verdienen wie an jedem anderen Tag auch. Aber es kam ihm vor, als ob an diesem Morgen alle gleichzeitig auf den Straßen waren.
Vielleicht spürten sie etwas. Er wusste aus Ansbach, es gab solche Momente, wo so etwas wie Blutgeruch in der Luft lag – alle rochen es und wurden davon angestachelt, nicht nur der Pöbel war dafür anfällig. Vielleicht behinderten sie sich auch deshalb so eifrig, stießen sich gegenseitig und schimpften, besonders wenn sie an einem der unzähligen Laufbrunnen aus Holzröhren Halt machen wollten, um sich zu erfrischen, und die Nachdrängenden dabei aufhielten. So Mancher griff dabei drohend zum Degen, den jeder männliche Einwohner der schönsten Stadt an der Seite trug.
Während er langsam weiterritt, begriff der junge Buchmaler allmählich, was die Stadt aufwühlte.
Die einen kamen mit Banner und großem Gefolge, um den Reichstag des Kaisers vorzubereiten – man schien zu glauben, dass es Maximilians letzter sein würde. Die anderen begannen schon in langen Gebetszügen mit den Kirchenfeiern zu Maria Königin und führten auf dem Weg zum Dom Weihestatuen aus Kalkstein mit sich. Die Handelshäuser wollten eine neue, breitere Straße durch die Stadt treiben, ließen unförmige Baufahrzeuge auf hohen Speichenrädern auffahren und riegelten einen ganzen Bezirk ab. Und aufgeregte Reformatoren mit schwarzen Hüten zogen vom Karmeliterkloster her eine gestikulierende Menschenmenge mit sich, die den Platz vor dem Kloster St. Anna gänzlich verstopfte.
Narziss erfuhr von einem Einwohner, der trotz der Hitze eine teure Pelzkappe trug, dass die Fuggerkapelle von St. Anna heute geweiht werden sollte. Er sah, wie Prediger unter dem Gejohle einer Schülerschar in der blaugelben Kleidung der Höheren Schule beim Dom Papiere an die Kirchentür anschlugen.
Selbst auf den hölzernen Hofgalerien der Häuser und hinter den Zinnen der Anwesen mit Grabendächern standen noch Neugierige und schauten herunter. In Kirchennähe war es besonders voll, denn hier befanden sich in Reih und Glied die aufklappbaren Verkaufsläden. Narziss glaubte, den Weinhändler Ulrich Schwarz zu erkennen, der oft Gast im Haus seines Vaters war. Er erhob sich im Sattel. Bevor er sich jedoch bemerkbar machen konnte, musste er ein paar junge Händlerinnen abwehren, die ihm schöne Augen machten, weil sie ihm dampfende Marienküchlein und roten Hippocraswein verkaufen wollten. Narziss errötete und die Mädchen kicherten über den schüchtern wirkenden jungen Mann, dann aber verspürte er doch Hunger nach dem langen Ritt, kaufte schließlich einen der leckeren Hefekuchen und biss herzhaft hinein. Er spürte deutlich, wie lange er nicht hier gewesen war, aber er genoss den vertrauten Duft der Stadt, der ihm zusammen mit dem verdampfenden Regen im Straßenstaub in die Nase stieg.
Er versuchte, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wurde aber von der wogenden Menge abgedrängt. Der Weinmarkt am Tanzhaus war ebenso verstopft wie der Platz um Rathaus und Perlach. Widerstrebend schlug Narziss eine andere Richtung ein. Hoffentlich erreichte er den Vater rechtzeitig!
An der fürstbischöflichen Residenz bemerkte er mit Erstaunen, dass zerlumpte Tagelöhner unter Anleitung städtischer Zunftarbeiter noch immer mit dem Abriss der Zuschauertribünen von den Hochzeitsfeiern beschäftigt waren. Susanna von Bayern und der Markgraf Kasimir von Brandenburg-Ansbach waren von 3000 kaiserlichen und brandenburgischen Reitern zu St. Ulrich geleitet worden, wo Kardinal Albrecht von Mainz sie vermählt hatte. Narziss war noch ganz verzaubert von der Fülle der Einzelheiten aus dem Privatleben der Herzogin. Seine schöne Auftraggeberin hatte ihn in Vieles eingeweiht. Vielleicht in zu Vieles? Er gestand sich ein, dass sie sich in den Wochen in Ansbach näher gekommen waren. Aber war nicht schon ein solcher Gedanke unziemlich?
Zum Glück verblasste ihr Bild in seinem Gedächtnis, das er auf dem dreitägigen Ritt bewahrt hatte. Er war froh darüber. Es erschien ein anderes inneres Bild vor ihm, das ihn beflügelte – nicht auf so leuchtendem Goldgrund wie Susannas Bild im Andachtsbuch, aber dafür inniger und zärtlicher. Agnes … Sollte er sie nicht doch sogleich aufsuchen? Er stellte sie sich vor, wie sie bei der Arbeit wie eine junge Löwin umherging, obwohl sie sonst sehr sanft war. Er könnte ihr einen Kuss geben, sie umarmen, das Glück in ihren Augen mitnehmen und so gestärkt an das Krankenbett seines Vaters treten.
Aber er wies sich im gleichen Moment zurecht. Die Verlobte musste warten, so schwer ihm das auch fiel.
Narziss suchte Schleichwege und bog hinter der neuen Fuggerei für verarmte Einwohner in stillere Gassen ab. Er musste die Stadt ganz durchqueren, passierte das neue Viertel der Buchdrucker mit der jetzt leer stehenden, hochaufragenden Offizin des Vikar Felix und gab dem Pferd unwillkürlich die Hacken. Aber die dunkle Erinnerung an die Hetzjagd, bei der der Hofdrucker des Kaisers in einem See ertrunken war, wich nicht von ihm. Das war erst vor zwei Wochen geschehen! Welch ein Unglück! Und jetzt sollte er diesen begnadeten Buchdrucker beerben? Hatte er wirklich ein Recht, die Offizin seines einstigen Konkurrenten zu übernehmen? Was würden die Zunftmeister des Neuen Rates dazu sagen?
Es war viel, was im Moment auf ihn einstürmte.
Der Kaiser bestand darauf, dass er dieses Erbe annahm, aber der junge Buchmaler beschloss, es sich noch einmal gründlich zu überlegen. Vielleicht bekam er beim bevorstehenden Reichstag eine Audienz bei Maximilian, dem er schon bei der Hochzeit mit seltsamem Nachdruck vorgestellt worden war.
Er gestand sich ein, tausendmal lieber das Buch zu Ende ausmalen zu wollen, mit dem er gerade beschäftigt war, als Meister der Offizin zu werden – dafür fühlte er sich viel zu jung.
Narziss Renner sah das Buch im Stil der Augsburger Gotik vor sich. Er würde es nach den Vorlagen des Regensburger Holzschneiders Albrecht Altdorfer gestalten, wie viel hatte er dem Meister der Donauschule, der schon an seiner Wiege gestanden war, zu verdanken! Dann würde er es in schwarzes Veloursleder binden, mit silbernen Zierköpfen ausstatten und ein in Silber gefasstes Medaillon mit dem bayerischen Wappen voranstellen.
Das wird ihr gefallen, dachte er. Er war es Susanna von Bayern schuldig. Das Wappen des mürrischen Gatten Markgraf von Brandenburg-Ansbach hingegen, Kriegsobrist des Kaisers, sollte zurückstehen. Es würde oft genug inmitten der Bilder erscheinen.
Narziss kam plötzlich überhaupt nicht mehr weiter. Am Eingang zum Viertel, in dem sein Elternhaus stand, war eine Barrikade aus Balken und Karren errichtet worden. Narziss begann leise zu fluchen, obwohl das nicht seine Art war. Maurer waren mit Kellen und Spitzeisen beschäftigt, rührten in Mörtelbottichen, und über Seilwinden zog man Gerüsthölzer an Häuserfronten empor. Dahinter war die Straße aufgerissen, Erdarbeiter mit groben Kapuzen stapelten Kopfsteine und Quadersteine.
»Lasst mich durch bis zum Rennerhaus! Ich muss zu meinem kranken Vater! Er stirbt sonst, bevor ich ihm die Hand auf die Stirn legen kann!«
Ein Arbeiter, dem Schmutz und Schweiß tiefe Furchen in das magere Gesicht gezogen hatten, sagte: »Magisterchen, das ist traurig, aber nehmt einen Umweg. Hier geht es nicht weiter, das seht Ihr ja!«
»Sag mir, von wo aus ich in die Fürstenfeldergasse einreiten kann!«
»Überhaupt nicht, mein bester Herr! Ihr müsst absteigen und dem Viertel zu Fuß die Ehre geben! Und das geht auch nur, wenn Ihr von Süden kommt!«
»Aber bei dem Menschengewimmel dauert das zwei Stunden!«
Der Mann wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht. »Sicher. Das ganze Leben ist in Stunden geteilt. Wir feiern bald die Marientage. Und der neue Reformator will zum ersten Mal auf einem predigen – wenn ihn der römische Kardinal Cajetan lässt. Und bis es soweit ist, müssen wir uns eben durch die Stunden quälen, jeder von uns, einerlei womit.«
»Dank für deine kuriose Predigt! Wenn der Vater stirbt, bevor ich im Haus war, komme ich zurück und werde dich mit meiner Art der Predigt bekanntmachen!«
Der Arbeiter machte eine abfällige Geste und wandte sich wieder den Steinen zu. Narziss überlegte. Was sollte er tun? Wenn er die heimatliche Gasse wirklich nur von Süden her – und von außerhalb der Stadt – erreichen konnte, dann war auch ein Abstecher in die Via Claudia möglich. Der Gedanke beflügelte ihn. Er würde nicht übermäßig viel Zeit verlieren. Kurz entschlossen lenkte er sein Pferd aus dem Gewirr der holprigen Straßen hinaus, jetzt konnte es sogar in Trab verfallen. Wenig später hatte er schon das Westtor erreicht. Er konnte es passieren, weil gleichzeitig ein Wagen mit fahrenden Hübschlerinnen einzog, die vom städtischen Frauenmeister in Empfang genommen wurden. Sie trugen die Schleier mit dem zwei Finger breiten grünen Strich, der sie als Dirnen für die Frauenhäuser der Reichsstadt auswies. Einer der schwer bewaffneten Zollsoldaten des Bischofs kannte Narziss und grüßte vielsagend. Der junge Buchmaler, der nur so lange in sich gekehrt wirkte, wie man ihn ließ, schwenkte die Arme und grüßte munter zurück. Voller Vorfreude galoppierte Narziss ein Stück an den drei nebeneinander verlaufenden Bächen entlang, die sich in der Jakoberstadt, wo sich Walkmühlen und Papiermühlen drängten, zum Stadtbach vereinten, dann lenkte er sein Pferd in Richtung des Flusses Wertach. Hier stank es wie immer nach dem Geschäft der Gerber und die schräg gestellten Schabbäume standen in Reihen am Ufer. Pferdekarren leerten an einer vorgeschriebenen Stelle, wo das Wasser in Strudeln stärker strömte, menschlichen Unrat, Mist und Trester in den Fluss. Narziss hielt einen Moment inne und beobachtete, wie einer der Karrentreiber, der in den Fluss gefallen war, jämmerlich um Hilfe schrie und mit Stangen wieder herausgezogen wurde.
Wo die Via Claudia mit der von Kempten kommenden Straße zusammentraf, kam die Herberge in Sicht.
Dort band der Reiter sein Pferd an. Der Gasthof war trotz der frühen Tageszeit schon gut gefüllt. Es mussten Besucher des Reichstags sein, die auf das erste Essen warteten, darunter bemerkte er drei Ritter in einer schwarz-weißen Tracht mit schwerer Halskette, die er auch als Schutzherren der St. Gumbertuskirche in Ansbach gesehen hatte. Aber Narziss wusste, dass die Herberge seiner Verlobten immer gut ging – tagaus, tagein, zu jeder Jahreszeit. Sie lag an der verkehrsreichsten Fernstraße, besaß eine wunderbare Küche und ein paar Geheimnisse, die Agnes sorgfältig hütete. Einige kannte er. Vor einigen anderen verschloss er die Ohren, so fest er konnte.
Wo war sie überhaupt? Narziss ging quer durch den Schankraum, dessen getäfelte Decke halbmondförmig gewölbt war, in Richtung Küche. Die Bedienung begrüßte ihn laut. Er winkte zurück. Es roch nach Sauerkraut, Gewürzen, vergorenen Früchten, Fenchel und Schweinefleisch. Die drei Köche und ihre Gehilfen waren mit den Kesseln im Glutstock, hängenden Eisentöpfen an der qualmenden Feuerstelle und dem Bratenwender beschäftigt und beachteten ihn nicht. Narziss ging in den Hof. Agnes war nirgendwo zu sehen.
Dann hörte er ihre helle Stimme mit dem fröhlichen Unterton in seinem Rücken.
»Mein goldbrauner Herr! Schon zurück?«
Narziss wirbelte herum. »Ich konnte es nicht mehr erwarten, dich zu sehen!«
Agnes umarmte ihn. »Ich hatte felsenfest angenommen, dass die schöne Herzogin sich zwischen uns drängt. Einer solchen Frau kann kein Mann widerstehen.«
»Wenn du das wirklich glaubst, dann komme ich wohl im falschen Moment …«
»Aaach …«, sagte sie zärtlich schnurrend wie eine Katze. »Sei nicht dumm! Ich drücke nur meine Sorge um den Geliebten aus.«
»Aber du brauchst dich nicht zu sorgen.«
»Ich habe vor fünf Monaten gesehen, wie du an ihrer Seite losgeritten bist. Glaub mir, ich habe euch noch nachgesehen, als ihr schon verschwunden wart. Und seitdem hörte ich nichts mehr von dir, außer in einem Brief, in dem stand, dass du in die intimsten Dinge eingeweiht worden bist. Also, mein Freund! Was sollte ich damit anfangen?«
Narziss fasste seine Braut an den Armen und sah sie an. Sie schien schmaler geworden zu sein, vielleicht machte das auch nur ihre burschikose Kleidung, blasser war sie auf jeden Fall, sah ihn aus lichtbraunen Augen prüfend an. Aber ihr Mund mit den schönen Lippen war unverändert frech und ihr blondes Haar stand widerspenstig wie Sonnenstrahlen um ihren jugendlich wirkenden Kopf. Er küsste sie. Sie war warm wie die Sonne.
»Agnes! Sie ist eine Herzogin, die Gattin des Markgrafen!«
»Und eine von diesen Aufmachungen, die jedem Respekt einflößen, nur weil sie eine Adlige ist.«
»Sie ist eine wirkliche Herrscherin!«
»Und eine Frau wie jede andere.«
»Das darfst du nicht sagen! Außerdem weißt du, ich habe dich nicht allein gelassen, um mich zu amüsieren. Der Hof in Ansbach ließ mir auch gar keine Zeit dafür. Ich konnte viel lernen, ich habe gezeichnet und gezeichnet und Farben angerührt! Und die schönsten Figuren gemalt! Leider gab es auch ein Unglück …«
»Ich weiß!«
»Vikar Felix ertrank bei der Hetzjagd. Es war furchtbar. Der ganze Hof stand danach Kopf, das kannst du dir vorstellen. Und der Markgraf bestand anschließend auch noch darauf, dass ich den Unfall malte! Er schilderte mir den Hergang in so blumigen, lebendigen Worten, dass ich mich nicht weigern konnte. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es war mir mulmig zumute. Das Bild steht mir noch jetzt vor Augen.«
»Mein Herz! Das tut mir leid! – Willst du etwas essen? Rosa hat Schupfnudeln gekocht! Und du weißt, das sind nicht irgendwelche Schupfnudeln!«
»Wunderbar!«, sagte Narziss, doch dann hielt er erschrocken inne. »Nein, ich muss gleich wieder gehen, ich wollte ja nur Guten Tag sagen. Ich bin jedenfalls wieder hier, Agnes! Wenn auch nur für kurze Zeit, um meinen Vater zu pflegen, die Markgräfin hat es mir gestattet. Aber jetzt muss ich nach Hause. Es geht ihm so schlecht. Wenn ich ihm nur helfen könnte!«
»Ja, kümmere dich um deinen Vater, Narziss! Es ist schön, einen Vater zu haben, dem man zu Lebzeiten Liebe zurückzahlen kann. Ich habe mir immer gewünscht, einen zu haben.«
»Ja, man ist ein armes Kind, wenn man seinen Vater nicht gekannt hat. Komm doch mit! Es würde mir leichter sein, wenn ich dich um mich hätte! Und Vater mag dich!«
Sie schüttelte mit einem breiten Lächeln ihres süßen Mundes den Kopf. »Kann nicht. Will nicht. Hab eine Herberge. – Aber am Nachmittag, wenn gegessen ist, kann ich bis zum Abend freinehmen.«
»Gut. Kommst du zum vierten Glockenschlag zu mir? Kannst du das einrichten?«
»Klar! Ich wollte, es wäre schon soweit!«
»Meine kleine Agnes! Ich habe dich sehr vermisst!«
»Nun geh schon! Viel größer bist du auch nicht. Es ist schön, dass du wieder hier bist.«
Narziss machte sich von seiner Verlobten los und bestieg das Pferd. Er spürte die Hitze jetzt noch stärker und schwitzte unter seinem Malerkleid aus roter Scharlachwolle, das er trug, seit er in Ansbach war. Zuvor in Augsburg hatte er nur den braunen Leinenkittel der Adepten getragen, doch der Auftrag in Ansbach hatte ihn zum berühmten Mann gemacht, um den sich die Offizinen zu reißen begannen. Aber das bedeutete ihm nichts. Er war bescheiden geblieben.
Zu bescheiden, wie Agnes ihm immer wieder vorgehalten hatte. Er konnte nicht nur kommen, seine blendende Arbeit machen und wieder verschwinden. Es galt, seinen Namen zu nennen. Oder war er etwa zu schüchtern dafür?
Ganz in Gedanken ritt Narziss durch das Südtor wieder in die Stadt ein. Am Zolltor musste er diesmal warten, bis zwei Händler aus Hirblingen mit vollgepackten Fleischkarren abgefertigt waren. Wieder traten ihm die gemalten Bilder vor Augen, besonders jene eine Szene am See, mit dem erlegten Wild und dem toten Vikar im Wasser. Hatte er alles richtig und vor allem mit der angemessenen Anteilnahme an dem tragischen Vorfall ausgemalt? Der Markgraf schien zufrieden gewesen zu sein. Er war ein strenger, aber gerechter Herr, der auch mit Lob nicht sparte.
Als Narziss weiterreiten konnte, gab er dem Pferd die Zügel frei. Eine innere Unruhe sagte ihm, dass er sich beeilen musste. Mit Erleichterung erblickte er bald die Fürstenfeldergasse. Er musste einen weiteren, kleinen Umweg in Kauf nehmen, konnte aber von einer Nebengasse aus einreiten und pflockte sein Pferd an der Ecke an. Ein alter Mann, der vor seinem Schusterladen saß, versprach, auf seine Sachen aufzupassen. Narziss betrat das Haus auf der anderen Straßenseite.
Als er in die Stube eintrat, spürte er zum ersten Mal die Anwesenheit des Todes. Die drei Pflegerinnen erhoben sich im Halbdunkel.
Seine Schwester Katrin, die 19 war und noch immer keinen Freund hatte, aber viel Wert darauf legte, das eine Jahr älter zu sein als er, rannte auf ihn zu und umarmte ihn. Sie begann sofort zu weinen. Ihr Gesicht lag wie unter einem feuchten Schleier. Seit die Mutter vor zwei Jahren an einem Schlaganfall gestorben war, stand sie dem Handwerkerhaus vor. Katrin und Narziss waren früher unzertrennlich gewesen. Jetzt hielt eine unerklärliche Scheu die Geschwister voneinander fern. Sie nahm ihn an die Hand und führte ihn zum Krankenlager.
Der Vater war kaum wiederzuerkennen. Sein Gesicht, das immer kräftig, kantig und weiß gewesen war, sah gelb und spitz aus. Die Ärzte wussten nicht, woran er litt, deshalb ließen sie ihn so oft wie möglich zur Ader. Und die Pflegerinnen wischten ihm nur die heiße Stirn mit kalten, in Essigwasser getränkten Tüchern ab, beteten viel und kauerten sich jetzt im Hintergrund des Zimmers zusammen.
Narziss kniete am Bett nieder. »Vater. Ich bin zurück. Kannst du mich hören?«
Egidius Renner drehte langsam den Kopf. Über seine Züge quälte sich ein Lächeln, aber es vertrieb den Tod nicht, der hartnäckig lauerte. Der alte Handwerkermeister setzte ein paar Mal an, dann sagte er mit einer atemlosen Stimme, die seine trockenen Lippen kaum verließ:
»Ich habe es gehört. Es hat dir Unglück gebracht, nicht wahr? Bleib lieber hier, mein Sohn. Bleib lieber in Augsburg.«
»Vater! Ich bleibe an deinem Krankenbett, solange du mich brauchst. Die Arbeit kann warten.«
»Hat es dir Unglück gebracht?«
»Nein, nein! Es waren schöne Tage!«
Der Alte versuchte, sich aufzurichten, war aber zu schwach. Als Narziss ihm unter den Nacken greifen wollte, winkte er mit Spinnenfingern ab. Er ergriff die Hand seines Sohnes und hielt sie fest. Dann führte er sie an seine Lippen. Narziss spürte die heiße, fiebernde Berührung. So kommt der Tod, dachte er, gemein und unversöhnlich.
Der Vater schloss erschöpft die Augen. Narziss blickte ihn nur unverwandt an.
Ein Satz, den der Markgraf an seinem letzten Tag in Ansbach zu ihm gesagt hatte, fiel ihm ein. Wir sollen unser Ende, gleich dem Schwan, vorher bedenken, sodass wir in Reinheit und Unschuld gefunden werden. Narziss war sich sicher, dass dies auf seinen Vater zutraf. Er hatte sein Leben danach ausgerichtet.
Nach einer Weile, in der Vater Renner sich nicht gerührt hatte, trat Katrin an die andere Bettseite. Sie brachte eine Schnabeltasse und flößte dem Vater eine warme Fettbrühe ein. Der Kranke trank mit schmatzenden Geräuschen, leckte mit der Zunge gierig über die Lippen, saugte jeden Tropfen auf. Dann begann er zu husten und konnte nichts mehr zu sich nehmen.
Er wendete den Kopf und blickte seinen Sohn an. Narziss sah in seinen Augen den Schmerz darüber, dass er ihm nicht näher kommen konnte.
Kurze Zeit später war er mit rasselndem Atem eingeschlafen.
Narziss sagte zu Katrin: »Er ist alt. Er wird sich nicht mehr wehren können.«
»Aber welche Krankheit sitzt um Gottes Willen in ihm und zehrt ihn aus?«
»Vielleicht keine. Er hat einfach keinen Grund mehr, weiterzuleben. Und Gevatter Tod hat das erkannt, gewinnt den Kampf und saugt seine erschlafften Lebenskräfte aus ihm heraus. So ist das in unseren Kreisen. Irgendwann ist unser Leben nichts mehr wert und dann gehen wir einfach. Am Hof in Ansbach dagegen klammert sich jeder, sei er noch so hinfällig, an das letzte bisschen Atem und Glanz. Dort ist die Angst vor dem Sterben riesengroß. Bei Vater sehe ich keine Angst.«
»Du hast dich verändert, Narziss. Wie klug du redest.«
»Unsinn. Ich bin noch immer derselbe dumme Junge, eigensinnig, egoistisch. Manchmal liebe ich den Erfolg so sehr, dass mir schwindlig wird. Ich blicke dann ich mich hinein und sehe nichts als einen Abgrund aus Eitelkeit.«
»Verliere dich nicht, Narziss. Bleib mit Agnes zusammen. Sie ist so … irdisch. In ihrer Nähe habe ich das Gefühl, sie hat schon alles erlebt und sieht die Dinge ganz gelassen. Aber sie ist ja auch schon ziemlich alt.«
»Sie ist 27! Und erlebt hat sie schon viel, seit sie von ihrer Mutter die Herberge übernehmen musste, das ist wahr. Was sich dort für seltsame Gestalten treffen! Und sie muss mit ihnen zurechtkommen. Manchmal frage ich mich, woher sie diese Fähigkeit hat …«
»Ihre Mutter muss eine großartige Person gewesen sein …«
»Selbst Ritter vom Orden zum Schutze Mariens aus dem Brandenburgischen habe ich dort vorhin gesehen, und Kirchenfürsten steigen auch regelmäßig ab, ist das nicht seltsam? Ich konnte es kaum glauben, dass selbst der Markgraf schon einmal in Maria Premsen übernachtet hat. Wenn natürlich auch incognito.«
»Die Herberge soll viele geheime Zimmer haben.«
»Das glaube ich nicht, ich kenne alle Zimmer.«
»Man munkelt es, wenn wieder hohe Herrschaften dort gesehen werden und erst nach Tagen wieder auftauchen.«
»Ach, das ist Gerede.«
»Wie lange bleibst du, Narziss?«
»Bis Vater stirbt.«
»Und dein Buch? Ansbach? Wird deine Herzogin es dir erlauben?«
»Sie muss! Und sie wird. Sie ist großherzig genug.«
»Ich habe in deiner Mansarde alles hergerichtet. Du findest alles aufgeräumt und sauber.«
»Ich danke dir, Schwester! Jetzt mache ich mich auf den Weg. Wenn ich meine Sachen ausgepackt habe, warte ich auf Agnes. Sie kommt beim Glockenschlag um vier. Sie holt mich ab, dann kommen wir gemeinsam her – ist dir das recht?«
»Du weißt, ich bin froh, wenn wir alle zusammen sind.«
Narziss sah noch einmal nach dem Vater. Er lag auf dem Rücken und schnarchte, eine eingefallene Hülle, die einmal die Kraft besessen hatte, ihn zu zeugen. Auch das musste er in das Andachtsbüchlein der Markgräfin hineinmalen – nicht nur Gold, Glanz und bunte Lebensschminke. Narziss nahm es sich vor und wählte in Gedanken schon die Farben für solche Bilder aus, herbstliche Farben.
Als er hinaus auf die Gasse trat, zogen gerade dunkle Wolken auf. Ein neues Gewitter kündigte sich in der Sommerhitze an. Es würde manche gewundene, abfallende Gasse bald in einen Sturzbach verwandeln. Narziss hörte die Schmiedeglocken läuten, die den Kupferschmieden beim herannahenden Regen jetzt wieder erlaubten, ihr Feuer in der Esse zu entfachen. Die Menschen hasteten noch schneller durch die Straßen, um vor dem Gewitter irgendwo anzukommen. Narziss führte seinen Falben am Zügel weiter.
Kurze Zeit darauf erreichte er seine kleine Wohnung. Sie lag im überstehenden Obergeschoss eines dreistöckigen Ständerbaus mit roten Gerüsthölzern und hellgrünen Fachen. Über dem Eingang hatte sein Vater das Wappen der Buchmaler anbringen lassen.
Der Hausbesorger Andres schloss ihm die Eingangstür auf. Der ehrerbietige kleine Mann, dessen Frau ihn um Haupteslänge überragte, händigte ihm den Schlüssel für das Haus aus. Er weilte nur in den beiden Räumen zu ebener Erde, wenn Narziss ihn brauchte. Im ersten Stock lag die Werkstatt des Buchmalers. Da Narziss seine beiden Gehilfen mit nach Ansbach genommen hatte, war das Haus also lange verwaist gewesen, machte aber einen sauberen Eindruck.
Unterm Dach war es warm. Andres hatte die Fenster nicht geöffnet. Narziss stellte seine beiden Säcke ab, in denen sich Kleider und Bücher befanden, und hängte seine Mütze an einen hölzernen Wandzapfen. Katrin hatte die Wohnung wie versprochen in Schuss gehalten. Narziss atmete den vertrauten Geruch nach Holz und Honigwachs ein, aus der Werkstatt drang ein feiner Geruch nach Öl, Leim und Farbe, nach gestärktem Bütten und Schwarzpulver herauf.
Er öffnete die drei Fenster, die nur hölzerne Klappläden besaßen, aber kein Glas. Durch das fränkische Marienglas der drei anderen kleinen Fenster fiel warmes, gedämpftes Licht herein. Er blickte über die Dächer der Stadt bis zum Dom, ein Vogelzug nahm einen hohen Weg. Dann sah er sich in der Wohnung um.
Die Küche mit dem vertäfelten Einbauschrank und die Schlafkammer mit Strohsack, steifem Leinenzeug und Kissen wirkten aufgeräumt, irgendwie abwartend, so wie Katzen manchmal schauten. Die karge Inneneinrichtung der ganz aus Holz gezimmerten Wohnstube mit ihren aufgemalten Bildern gefiel ihm immer noch. Wenn er wie jetzt nach langer Abwesenheit zurückkehrte, war ihm alles vertraut. Katrin hatte sich um die Möblierung gekümmert. Sie stammte aus dem väterlichen Haus und bestand aus einem runden Eichentisch, über dem ein hübscher Leuchter hing, drei Faltstühlen mit Armlehnen und einem Sitz aus grünem Samt, einer abgetragenen Truhe mit Eisenbändern, einem Waschkästchen auf vier dünnen Beinen und einem schmucklosen, zweigeschossigen Kastenschrank. An einem der Fenster stand sein Lesepult.
Narziss ließ den Raum auf sich wirken. Seit ein Zimmermann ihn vor einem Jahr mit Tannenholz getäfelt hatte, war es ihm lieb zu denken: mein »Zimmer«. Eine Reihe Schlagholz lag aufgeschichtet am Ofen mit den grün lasierten Reliefkacheln, um den die Bank mit umlegbarer Lehne lief. Narziss setzte sich darauf. Hier also war sein Zuhause. War es nicht seltsam, wie Stuben die Identität ihrer Besitzer annahmen? Narziss hatte auf die Bohlenbalken zweier Wände Naturszenen gemalt – Vögel und fantasierte Blumen, eine Paradiesszene, wie Agnes sie liebte. Er ertappte sich bei dem Gedanken, dass die Bilder und auch die Wohnstuben länger hielten als ihre Bewohner.
Nach einer Weile stand er auf und ging hinaus in den dunklen stickigen Flur, um in die Werkstatt hinunterzusteigen.
Auch hier umfing ihn der Eindruck, alles warte auf ihn und schaue ihn an. Lag nicht noch ihr Parfüm in der Luft? Vor fünf Monaten hatte ihn die Markgräfin hier persönlich abgeholt. Er hörte noch immer ihren leichten Schritt die Stiege herauf und das Rauschen ihrer Gewänder. Sie hatte das Haus allein betreten, vor dem Haus warteten ihre Equipagen. Stolz hatte er ihr sein Handwerkszeug erklärt.
Narziss blieb unwillkürlich stehen. In der Erinnerung sah er das spöttische Lächeln auf ihrem Gesicht. War er zu aufdringlich gewesen? Hatte er ihr seine Arbeit nicht viel zu wichtigtuerisch erläutert? Wie hatte er annehmen können, es interessiere sie wirklich, was er tat? Und vor allem, mit welchen Geräten er es tat? All die Schnitzgeräte, Meißel und Stichel für die Rahmen, die Spachtel und Pinsel, die Tiegel für Firniss und Farbe, die Geheimrezeptur für den Überzug, der die Farben leuchten ließ und das Bild vor Fälschungen sicher machte. Wie er eine süddeutsche Ritterdichtung ausmalte, ein Epistelbuch, ein Arzneibuch, eine Jagdanleitung. Ob er seine Bildchen in den Buchstabenkörper stellte oder als Ligatur an den Buchrand setzte. Die Bedeutung des handgefertigten Stempels für seine Signatur, auf der er schon bestand …
Narziss begann, sich zu schämen.
Wie unwichtig für eine Herzogin!
Er war noch kein Werkmeister gewesen, nur ein Adept, vielleicht überhaupt nur Handwerker und kein Künstler, wenn auch im kleinen, lokalen Kreis so bekannt, dass Jakob Fugger zu seinen Auftraggebern gehörte.
Immerhin war sie gnädig geblieben. Sie hatte milde lächelnd mit ihrer eigentümlich kehligen Stimme gesagt: »Mein Lieber, ich verstehe Ihren Stolz. Der Schall eines Wortes allein kann vergehen, manche Gedanken können den Sinnen unzugänglich bleiben, nur ein Buch vermittelt ständige Erkenntnis und Ihre Bilder darin bewahren das wirklich Geschehene auf schönste Weise.«
Er hatte über den seltsamen Klang dieser Worte nachgedacht und war geschmeichelt gewesen. Nein, die Herzogin hatte ihn schon verstanden. War der beste Beweis dafür nicht, dass sie ihn mit sich nach Ansbach genommen hatte?
Plötzlich hörte Narziss auf dem Bretterboden über sich ein Geräusch. Es hörte sich an wie Schritte. Er schaute unwillkürlich auf, als könnte er die Decke mit Blicken durchdringen. War jemand in seiner Wohnung? Er trat auf den Flur und lauschte nach oben. Von unten hörte er die Stimme des Hausbesorgers Andres, der mit seiner Frau schimpfte und dann heraufrief, ob er jetzt gehen könne. Narziss bejahte, dankte ihm und verabredete, wann er ihn wieder brauchte. Er hörte, wie das Ehepaar die Eingangstür zuschlug und ihre Schritte auf der Straße leiser wurden.
Narziss ging in die Werkstatt zurück. Das Geräusch von oben hatte sicher der zunehmende Gewitterwind verursacht, der die Fensterläden klappern ließ.
Er nahm ein Buch aus dem Regal, das er vor seiner Abreise ausgemalt hatte. Es war ein Liebesbrevier, das Fugger für seine jüngste Tochter in Auftrag gegeben hatte. Jakob Fugger vergab solche Aufträge oft, um den Künsten und vor allem den Künstlern der Stadt zu helfen. Narziss hatte das Buch gerade noch zu Ende ausmalen können.
Er drückte es an seine Brust. Es hatte ihm Spaß gemacht. Er hatte dabei an Agnes denken können. Eines Tages würde er ihr ein Buch widmen, es würde schöner sein als alle anderen. Sogar schöner als das Andachtsbuch für die Herzogin Susanna. Dafür würde er ganz neue Farben erfinden.
Mitten in diesen verträumten Gedanken hinein, der ihn ganz packte, spürte Narziss Renner einen jäh entfachten Luftzug. Es war, als wäre eine Tür geöffnet worden. Es beunruhigte ihn noch nicht, aber dann roch er etwas Fremdes, etwas, das nicht hierhergehörte.
Als er sich umwandte, um nach der Eingangstür der Werkstatt zu sehen, sprang jemand auf ihn zu.
Narziss war unfähig, eine Abwehrbewegung zu machen. Er sah nur die Umrisse, so als würden die Konturen des Zimmers mit seinen Gegenständen und Möbeln zu einem einzigen Körper verwachsen, der etwas Gewalttätiges in sich vereinte.
Er hörte einen knurrenden Laut und einen weichen hinterher, so wie ein Ausatmen, ein Seufzen. Dann nahm er ein Blitzen wahr. Und mit dem Blitzen kam ein scharfer, weiß glühender Schmerz.
Narziss schnappte nach Luft. Der Schmerz fuhr von der linken Hand in seine Brust, er setzte sich als Feuerwerk aus Lichtpunkten in seinem Kopf fort. Dann bildete sich in seinem Verstand ein glasklarer Gedanke: Jetzt hat er mich gekriegt!
Aber wer war es?
Wer?
Er sah das Auf und Ab des Armes, der auf ihn einstach. Dann versagten seine Beine ihm den Dienst.
Als er auf dem gefliesten Boden der Werkstatt aufschlug, fiel ihm das Buch aus der Hand, das er noch immer an sich gepresst hatte. Und noch etwas anderes fiel zu Boden. Es war ein Blatt handgemaltes Papier. Darauf eine bunte Szene an einem Wasser, eine Jagdszene. Das Papier wurde verächtlich von einer Hand geworfen und segelte auf den am Boden Liegenden hinab.
»Du verfluchter Hund!«, keuchte jemand. Und dann traf ein Fußtritt den schon Bewusstlosen. Deshalb hörte er auch die Stimme nicht mehr, die sagte: »Endlich hast du deinen Teil, du Lump.«
Dann verließ eine Gestalt, deren Konturen längst wieder in einen menschlichen Umriss zurückgeflossen waren, den Raum. Eine gedrungene, geschmeidige Gestalt, die sich schnell bewegte. Im nächsten Moment war alles im Raum ruhig und friedlich.
Narziss lag verkrümmt in einer Blutlache, die sich langsam ausbreitete. Das herabgefallene Bild bedeckte das Liebesbrevier für Fuggers Tochter, das aus seinen Händen gefallen war. Es wurde von seinem austretenden Blut wie von einer herankriechenden Zunge geleckt.
Neben ihm lag noch etwas anderes. Es war dem Mörder aus der Jackentasche gerutscht, als er das Papier herausgezogen hatte.
Ein unscheinbares Ding, nicht einmal ein halbes Fingerglied lang. Ein länglicher Rechteckrahmen aus dünnen Metallstäben, die beiden Längsseiten nach innen sägeförmig gezahnt, an den Enden durch kleine Ringe und kurze Schraubenbolzen verbunden.
In der Rahmenmitte eingeklemmt befand sich ein kleines, rot gefärbtes Herz.
Kapitel Zwei
Agnes träumte. Das gestattete sie sich nicht oft. Seit sie die Herberge vor sechs Jahren von ihrer Mutter übernommen hatte, ließen ihre Aufgaben ihr keine Zeit dafür. Die Mutter Hilaria, nach ihrem Feuertod bestattet auf einer Insel im Lech, hatte immer gesagt: »Unsere Heimat Griechenland ist ein Land zum Träumen, in diesem kalten Land aber, mein Kind, kann man nur eines machen: Geld.« Agnes hatte sich dagegen gewehrt. Aber weil sie auf sich allein gestellt war, hatte ihre Mutter schließlich doch recht behalten.
Agnes hatte keine Zeit zum Träumen.
Die junge Frau seufzte und schüttete die Strohsäcke aus, die sie jeden Freitag austauschte. In einer Herberge mit 30 zugänglichen und sechs geheimen Räumen fraß die Arbeit jeden auf. Und da sie darauf achtete, dass ihre Bediensteten nicht mehr tun mussten, als sie selbst tat, hatte sie auch nie die Flausen der Jugend besessen. Und doch, wie gern würde sie einmal ausgehen! Im letzten Herbst hatte Narziss sie auf ein Weinfest geführt und sie hatten ausgelassen getanzt. Damals hatten sie sich Treue geschworen. Unverbrüchliche Treue.
Agnes wurde aus ihren Gedanken gerissen, als jemand schrie: »Wo ist, verdammt noch mal, die Patronin?«
Agnes trat ans Fenster. Unten stand ein Lieferant auf seinem Karren und stemmte die Arme in die Seite.
»Warum schreist du so, guter Mann? Hat deine Frau dir heute Morgen nicht ihre schöne Seite zugekehrt?«
»Agnes von Miller! Verdammt will ich sein! Warum hilft mir niemand, das Gemüse abzuladen! Ich habe keine Zeit, hier Wurzeln zu schlagen, in der Stadt tobt ab morgen früh der Reichstag, es ist das Geschäft des Jahres!«
»Mein Freund! Wenn du mit mir Geschäfte machst, hast du größere Vorzüge! Denn sagt man nicht, ich sei die adretteste und freundlichste Herberglerin in ganz Süddeutschland?«
»Das ist wahr, Schöne von Miller, und auch die Gescheiteste! Aber jetzt sei auch kollegial und schick mir jemand zum Abladen! Ich bitte dich!«
»Das klingt schon anders.« Sie wandte sich ins Haus und rief einen Knecht. »Anton! Geh und hilf dem Händler mit dem Gemüse.«
Agnes klopfte die Bettvorhänge ab, schüttelte noch ein paar Federkissen und Deckbetten aus und legte weißes Linnen über die Matratzen aus Heu und Häcksel, das an den Rändern mit hellblauem Posament verziert war. Sie reinigte die am Fußende der Betten mit Scharnieren befestigten Tische und klappte sie zusammen. Dann versprühte sie Tropfen von Obstessig, kehrte den Boden, bohnerte ihn dann mit gekochtem Sägemehl und schloss die Fenster. In ihrer Herberge gab es kein Ungeziefer, nicht einmal Spinnen. Auch deshalb kamen die hohen Herren zu ihr, die selbst in den teuren Stadthäusern von Flöhen und Wanzen zerstochen wurden. Agnes war stolz darauf, dass ihr Haus unterirdische Latrinenleitungen und einen gedeckten Kanal unter dem gepflasterten Vorplatz besaß. So wurden ihre Gäste nicht von dem Geruch belästigt, der sonst in den Gassen der Stadt lag, und sie hatten noch nie eine Ratte gesehen.
Agnes ging hinunter. Das Mittagessen war beendet, die Küchenhilfen säuberten die Herdstellen und die Tische mit Borstenbündeln des Wildschweins, der Küchenjunge wusch das Zinngeschirr, Holzteller und Krüge. Agnes hatte in aller Herrgottsfrühe nur frisches, mit Fenchel gewürztes Fladenbrot in Wein getaucht und hastig ein paar Brocken gegessen. Sie verspürte keinen Hunger. Ihr Hunger, der manchmal in ihr wuchs und heute besonders stark war, war von anderer Art.
Sie dachte an Narziss. Seine Küsse brannten noch auf ihren Lippen. Sie spürte seinen Leib an ihrem. Sie sollten Hochzeit halten! Sie passten vielleicht nicht zusammen, aber war das nicht eine wunderbare Voraussetzung, um lange beieinanderzubleiben?
Agnes ging durch die Räume im Erdgeschoss ihrer Herberge, öffnete alle hölzernen Fensterläden. Die Gäste waren ausgeflogen. Frische Luft nach dem Gewitterregen zog herein.
In der Vorstube standen Reisende, die sie verabschieden musste. Darunter waren zwei Gesandte aus dem Salzburgischen, ein Kaufmann aus München und ein Musiker aus Prag. Die Österreicher beschwerten sich, der Hornist habe die halbe Nacht lang geblasen.
»Ich habe nicht geblasen. Ich blase nie. Ich bin ein keuscher Mensch.« Der junge Musiker gefiel Agnes, er hatte ein verschmitztes Gesicht.
Der Gesandte erbleichte. »Nicht was Sie meinen! Wird einem denn hier das Wort herumgedreht! Ich meine, auf dem Horn geblasen! Auf dem Horn!«
»Auf Hörnern blase ich schon gar nicht. Meine Vorliebe geht eher zu den Damen! Aber auch auf ihnen blase ich nicht. Ich …«
»Ach, seien Sie doch still, unverschämter Mensch! Wirtin, ich zahle! Nur fort von hier!«
Agnes beruhigte die beiden aufgeregten Gesandten. »Bis jetzt hat es Ihnen doch bei uns gefallen, Exzellenzen! Kommen Sie wieder, ich bitte Sie! Beim nächsten Besuch, ich verspreche es Ihnen, wird nicht geblasen. Ich achte persönlich darauf, dass Ihnen kein Leid geschieht.«
»Vorerst setzen wir keinen Fuß mehr in diese Herberge. Auch nicht in diese Stadt. Hier regiert schon jetzt der Teufel! Das Werk des Reformators bringt Unglück über uns alle, denkt an meine Worte, Wirtsfrau! In diesem Augsburg gelten nicht mehr die Gesetze von Anstand und Ordnung. Hier wird Geld gemacht und Unzucht getrieben. Und das alles unter Kaiser Maximilians Augen. Sagt man nicht zu Recht, er sei nur Augsburgs Erster Bürgermeister? Wir brauchen einen neuen Kaiser, der das Ganze im Auge hat! Sonst geht es bergab!«
»Nun beruhigen Sie sich doch, wir bekommen ja einen neuen. Es wird der älteste Enkel Maximilians sein, der sich in Iberien schon große Verdienste erworben hat. Die Kurfürsten werden Karl auf dem Reichstag wählen und er wird streng und gerecht regieren.«
»Gebe Gott, dass es bald soweit sein wird.«
»Und geben Sie mir bitte jetzt acht Gulden und drei Batzen für vier Übernachtungen, mein werter Herr.«
Der Gesandte zahlte, nickte beleidigt und verschwand mit seinem Begleiter. Ihre grauen Gewänder rauschten. Auch der Kaufmann verschwand in seinem Gefolge. Der Musiker zahlte, packte seine Sachen und ging hinaus.
»Bis bald, Musikus!«, rief Agnes ihm nach. »Eine schön geblasene Melodie ist bei mir immer willkommen!«
Agnes hörte den Glockenschlag von der Domkirche. Drei Schläge, die über die Ebene rollten, als sei die Zeit ein großer Besen, der das Festgefügte davonkehrte. Sollte sie schon jetzt gehen? Dann wäre sie früher bei ihrem Narziss! Kurzentschlossen rief Agnes ihre Bediensteten zusammen und gab ihre Anweisungen. Sie ließ die Kutsche einspannen.
Als sie gerade losfahren wollte, hielt sie jemand auf. Einer der Gäste, er hatte funkelnde Augen in einem roten Gesicht mit Backenbart, vermisste einen kleinen, länglichen Kasten aus Ebenholz mit Elfenbeinverzierungen.
»Gestern Abend war er noch da! Ich bin in größter Bestürzung, Wirtin!«
Der Mann, er trug das schwarz-weiße Ornat des Ritterordens zum Schutze Mariens und darüber die schwere Kette, blickte Agnes misstrauisch an. Nahm dieser Herr von Staufach an, die Wirtin habe ihn bestohlen? Agnes spürte einen Moment lang Ärger. Dann entschied sie sich, belustigt zu sein.
»Suchen wir zusammen. Alles wird sich finden!«
»Er ist fort! Der Kasten ist fort!«
»Das sagten Sie ja schon. Was war drin?«
»Etwas Kostbares! Und etwas, das nicht für andere Augen bestimmt ist.«
Agnes suchte die Stube der Ordensritter ab. Es war die größte im Haus und befand sich am Ende des Ganges, zum Wald hinaus. Man konnte den Gang nur durch eine andere Tür betreten. Die Ordensleute wollten immer für sich sein.
Der Kasten blieb verschwunden.
»Wenn die Herren mir sagen wollen, wie er genau aussah, entdecke ich ihn sicher irgendwo.«
Der würdevolle, aber nun reizbare Ordensmann beschrieb den Kasten. Schmal, lang, braun, mit Intarsien aus Elfenbein, ein Geschenk aus einem der portugiesisch verwalteten Negerländer an der afrikanischen Südwestküste. Agnes versprach, weiterzusuchen.
Als sie gehen wollte, sagte der Ordensritter: »Wartet. Wer könnte Zugang zu unseren Räumen gehabt haben – außer Euch natürlich?«
Agnes blickte ihn ungerührt an. »Niemand. Wie Ihr wisst, richte ich Euren Raum persönlich her, so ist es abgemacht.«
»So, so …«
»Wenn Ihr glaubt, der Kasten sei Euch entwendet worden, dann müsst Ihr allein mich verdächtigen. Tut Ihr das, hoher Herr von Staufach?«
Der Ordensmann zögerte. »Nein. Ich kenne Euch ja als vertrauenswürdig. Andererseits kann der Kasten nicht davongeflogen sein. Und da er nicht mehr in meinem Besitz ist, wurde er gestohlen. – Welcher der anderen Gäste ist noch im Haus?«
Agnes wurde ungeduldig. Sie wollte zu Narziss. »Kommt mit zum Schlüsselkasten, dann kann ich es Euch sagen.«
Die Schlüssel zu allen Stuben, außer den geheimen, hingen am Brett. Agnes deutete darauf. »Seht selbst.«
»Wer wohnt in den Räumen, deren Schlüssel fehlen?«
»Das kann ich Euch ebenso wenig sagen, wie Ihr über den Inhalt des Kästchens sprechen wollen.«
»Nun – in dem Kasten befindet sich eine Nachbildung unserer Ordenskette. Im kleinen Format natürlich. Und aus purem Silber.«
»Ach?«
»Ein unermesslich wertvolles Stück. Es ist aus der Gründungszeit des Ordens und gehört deshalb nach Alt-Brandenburg, wohin wir es gerade soeben tragen wollten. Wenn wir es nicht wiederfinden, droht uns großes Ungemach!«
»Ihr Herren«, sagte Agnes betrübt, »ich sehe, was ich tun kann. Aber nun entschuldigt mich. Ich habe etwas zu erledigen. Am Abend haben wir den Kasten vielleicht schon irgendwo gefunden. Denn in meinem Haus ist noch überhaupt nichts gestohlen worden. Habt ein wenig Geduld.«
»Nun müsst Ihr uns sagen, wer in den geheimen Räumen wohnt!«
»Da irrt Ihr. Ich habe meine Gäste vor Belästigungen zu schützen, vor allem die, die darauf besonderen Wert legen. Dazu gehört Ihr selbst, meine Herren. Ich sage Euch aber zu, Euer Kästchen im Auge zu behalten.«
»Wie wollt Ihr unser Kästchen im Auge behalten, wenn es doch verschwunden ist!«
»Das ist so eine Redensart. Ich behalte es vor dem inneren Auge, versteht Ihr? Und nun erspart Eurem roten Ärger weiter die Mühe, in Euer Gesicht zu steigen. Ich muss gehen.«
Agnes nickte dem Ordensritter freundlich zu und verließ die Herberge. Ihre Hausbesorgerin Mathilde bekam ein paar Anweisungen und würde sich um alles kümmern.
Agnes bestieg den Einspänner und fuhr los. Das Pferd fiel in schnellen Trab.
Über die flachen Ufer ging ihr Blick in die weite Landschaft der Ebene bis zur weit entfernten Linie der Berge. Davor reckten sich stolz die Turmspitzen der Stadt, Agnes zählte 17. Sie lebte hier seit ihrer Kindheit, aber immer wieder entdeckte sie einen neuen Turm. Oder einer verschwand. Jedenfalls bildete sie sich das ein. Sie wollte einfach, dass es so war.
Am Stadttor kannte man sie und ließ sie ohne Kontrolle passieren. Die Soldaten des Bischofs unterließen es nie, ihre anmutige Gestalt mit bewundernden Blicken zu bedenken, aber sie wagten keine Anzüglichkeiten. Agnes von Miller brachte trotz ihrer jungen Jahre der Stadt Gewinn wie ein Kaufmann, der die Märkte beschickte. Sie zog hohes Publikum in die freie Stadt der Reichstage. Ihre Herberge an der Reichsstraße nach Italien war weithin berühmt und stand unter dem Schutz der Patrizier. Auch sie zogen aus ihrer Existenz so manchen Vorteil.
Agnes umrundete die mit Menschen übervolle Stadt auf den Wegen, die an der Befestigung entlangführten. Oben in den Wandelgängen polterten Wachsoldaten. Sie musste einem Schaufechten ausweichen, das mit beidseitig eisenbeschlagenen Stöcken ausgetragen wurde und viel wüstes Publikum anlockte. Bevor sie in das Straßengewirr hinter dem Palast der Fugger eintauchte, dessen Kupferdach in der Sonne leuchtete, stellte sie ihre Kutsche in einem öffentlichen Stall ab und ging zu Fuß weiter. Sie erreichte die vertraute Gasse mit dem Haus des Buchmalers Schlag halb vier.
Die Haustür war geschlossen. Agnes trat ein paar Schritte zurück und sah an der Fassade empor. Die obersten Fenster standen offen. Als sich auf ihr Klopfen und Rufen niemand zeigte, drückte sie gegen die Tür. Sie schwang nach innen auf. Agnes trat ins Dunkel.
»Andres? Niemand hier? Narziss?«
Sie lauschte. Kein Laut.
Sie rief noch einmal nach dem Hausbesorger. Er war nicht da.
»Narziss? Bist du oben?«
Agnes war seltsam berührt. Hatte Narziss die Verabredung vergessen? Es wäre das allererste Mal, seit sie sich kannten. Sicher stürzte gerade viel auf ihn ein, aber zerstreut war er keineswegs.
Sie ging die knarrende Treppe empor. Die Tür zur Werkstatt stand offen. Und dann sah sie ihn.
Im gleichen Moment schrie sie auf. Sie konnte nicht glauben, was sie sah. Ein kalter Schauder durchlief sie. Dann ging sie mutig in den Raum. Narziss lag in seinem Blut.
Agnes hob seinen Kopf an. Im bleichen Gesicht des Geliebten stand keine Regung. Was war hier geschehen? Lebte er überhaupt noch? Sie lauschte mit angehaltenem Atem an seinen Lippen. Ein ganz feiner Hauch, der unendlich viel Kraft kosten musste, kam aus seinem Mund. Unendlich erleichtert fasste Agnes hinter seinen Nacken. Sie strich ihm zärtlich über das Gesicht.
»Narziss!«
Der Verletzte reagierte nicht.
Agnes sah um sich. Sie erblickte das von Messerstichen zerfetzte Buch, sah die Zeichnung daneben, schob beides zur Seite.
Was sollte sie tun?
Sie bettete seinen Kopf in ihrem Schoß, wischte ihm den kalten Schweiß von der Stirn. Als sie vorsichtig sein Hemd zur Seite schob, sah sie den Einstich zwischen Schulter und Herz. Agnes traten Tränen in die Augen, doch das merkte sie gar nicht. Er schien unendliches Glück gehabt zu haben. Das Messer hatte sich in das Buch gebohrt. Jetzt sah sie auch die beiden Einstiche in der Hand. Das Blut floss nicht mehr.
»Narziss!«, flüsterte Agnes. »Mein lieber Narziss, hörst du mich!«
Er zeigte noch immer keine Reaktion.
Agnes wusste, sie konnte ihm nicht helfen. Ein Medicus musste kommen, sonst verstarb der Geliebte unter ihren Händen. Sie legte seinen Kopf sanft auf den Boden zurück. Schnell trat sie an ein Fenster und rief, so laut sie konnte, hinunter auf die Straße.
»Wohnt hier irgendwo ein Arzt? Kann jemand einen Arzt rufen? Ein schwerer Unfall!«
In einem schräg gegenüber liegenden Fenster zeigte sich eine korpulente Frau mit einer schief sitzenden, weißen Wickelhaube auf dem Kopf.
»Was ist denn passiert? Ist dem jungen Renner etwas geschehen? Es musste ja so kommen!«
»Er ist auf den Tod verletzt! Können Sie helfen?«
»In meiner Herrschaft ist ein Medicus. Ich hole den Magister, es ist Meister Amelung, er hält gerade seinen Nachmittagsschlaf.«
»Bitte beeilen Sie sich!«
Der Holzladen des Fensters wurde wieder zugeschlagen. Agnes eilte zu dem am Boden Liegenden. Hatte er nicht gerade gestöhnt?
»Narziss! Hörst du mich?«
Leicht begannen die Augenlider des Verletzten zu zittern. Agnes wusste, dies war immer ein Anzeichen des Erwachens aus der Ohnmacht. Sie hatte in der Herberge schon ein Dutzend Ohnmachten erlebt, einmal nach einer Schlägerei, bei der ein Gast einem anderen den Wanderstab über den Schädel gezogen hatte. Der Getroffene war später gestorben.
Agnes musste warten, bis der Arzt kam. Sie streichelte Narziss und flüsterte immer wieder seinen Namen. Dann fiel ihr Blick wieder auf das blutbefleckte Buch. Der Lederrücken war zerfetzt, darunter kam handgeschriebenes Papier zum Vorschein. Sie erkannte, was es war. Seine letzte Arbeit vor der Abreise nach Ansbach. Und das Bild daneben? Es war blutbefleckt. Sie hob es mit spitzen Fingern auf.
Eine Jagdszene an einem See. Eine Jagdgesellschaft. Schön ausgemalt in leuchtenden Farben. Sie hatte es noch nie gesehen. Hatte Narziss es gemalt? Sie glaubte es an der Wahl der Farben zu erkennen. Warum lag es hier?
Auf den zweiten Blick sah sie, dass es nicht nur eine Jagdszene darstellte. Es war auch der Moment eines Unfalls. Im See lag ein Toter. Ein Mann im Kleid eines Vikars.
Mein Gott, war das nicht jener Vikar Felix, von dem Narziss erzählt hatte? Der Buchdrucker des Kaisers am Ansbacher Hof, der einem Unfall zum Opfer gefallen war? Er war ertrunken, als sein Pferd in den See stürzte. Es war jener Mann, dessen Augsburger Offizin Narziss jetzt übernehmen sollte.
Agnes blickte zum Fenster, lauschte nach unten. Warum kam der Arzt nicht! Plötzlich kam ihr zum ersten Mal ins Bewusstsein, dass Narziss einem Attentat zum Opfer gefallen war. Jemand hatte ihn ermorden wollen. Ein Mörder war im Haus gewesen! Vielleicht war er immer noch hier!
Agnes lauschte. Es war nichts zu hören. Sie war nicht ängstlich. Sollte er nur kommen, sie würde mit ihm fertigwerden! Aber nein, sicher hatte er längst das Weite gesucht.
Wieder flüsterte sie den Namen des Geliebten, jetzt etwas lauter. Sie küsste ihn auf den Mund. Seine Lippen waren kalt. In diesem Augenblick sah sie am rechten Fuß des Verletzten etwas liegen. Es war ihr bisher nicht aufgefallen. Sie hob es auf.
Ein kleines Rechteck, an den Seiten mit Sägezähnen ausgestattet. Es schien aus Silber zu sein. Agnes erbleichte. Sie erkannte, was es war. Wie kam das hierher? Mit einer raschen Bewegung steckte sie den Fund in ihre Jackentasche.
Unten ging die Tür. Jemand rief. Der Medicus kam die Treppe herauf und erschien kurz darauf in der Tür. »Was ist hier los? Warum liegt Herr Renner am Boden?«
»Ein Überfall«, sagte Agnes schnell. »Kümmern Sie sich um Gottes willen um ihn. Er hat viel Blut verloren.«
Der Medicus stellte seine Ledertasche neben den Verletzten. Er zog ihm die Augenlider empor, dann sah er sich die Wunden an.
»Das gefällt mir ganz und gar nicht!«
»Helfen Sie ihm!«
»Bringen Sie mir heißes Wasser!«
Agnes lief in die kleine Wohnung des Hausbesorgers hinunter. Sie dachte jetzt mit keinem Gedanken mehr daran, der Mörder könnte irgendwo lauern. Sie schürte ein Feuer im offenen Herd an, setzte einen Wassertopf darauf. Es dauerte lange. Als sie mit dem heißen Wasser in die Werkstatt zurücklief, war der Arzt dabei, den blutigen nackten Oberkörper des Verletzten zu verbinden. Die Hand trug schon einen dicken Verband und lag in einer Schlinge.
»Man könnte denken, das Buch sei das eigentliche Ziel des Rasenden gewesen«, knurrte der Arzt. »Es weist acht Messerstiche auf.«
»Er hat Glück gehabt«, murmelte Agnes. Ihr wurde für einen Moment schwarz vor Augen, sie musste sich setzen. »Er könnte jetzt tot sein.«
»Das könnte er zweifellos«, knurrte der Arzt wieder. »Aber ich werde ihn durchkriegen. Geben Sie mir das Wasser.«
»Doktor, kann ich ihn pflegen?«
»Wie wollen Sie das anstellen? Sie bekommen kein einziges Medikament aus der Apotheke, in Augsburg wird alles streng kontrolliert. Nein, er kommt in mein Spital. Es ist unweit von hier. Ich lasse ihn hinbringen.«
»Es war ein Überfall. Müssen wir nicht den Stadtrat verständigen?«
»Ich muss das nicht. Nur die Wundärzte dieser Stadt müssen Verletzte unverzüglich dem Rat melden – und natürlich die Schneidärzte, wenn einer im Leichenschauhaus landet. Aber das werden wir nach Möglichkeit vermeiden. Außerdem würde die Polizei den armen Verletzten nur spornstreichs ins Hauptsiechenhaus einweisen, dort muss er sich ein Bett mit zwei anderen Verletzten teilen und die hygienischen Verhältnisse – na, reden wir nicht darüber.«
»Wer kann einen solchen Hass auf meinen lieben Narziss haben, dass er ihn töten will? Ich verstehe es nicht!«
»Ich noch viel weniger. Herr Renner ist ja ein liebenswerter, junger Bursche. War er die letzte Zeit nicht in Ansbach?«
»Er malte ein Andachtsbuch für die Herzogin Susanna.«
»Und seit wann ist er wieder hier?«
»Er kam heute Morgen.«
»Wer hat gewusst, dass Herr Renner heute zurückkommt?«
»Nun – lassen Sie mich nachdenken. Sein Hausbesorger, sein Vater, seine Schwester und ich.«
»Wo steckt der Hausbesorger?«
»Andres? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er bei sich zu Hause. Er wohnt in der Jakoberstadt.«
»Er ist natürlich verdächtig.«
»Aber Andres ist eine Seele von einem Menschen, auch wenn er im ärmsten Stadtviertel wohnt.«
»Vielleicht war es Zufall. Vielleicht war es ein Landstreicher, der im leeren Haus übernachtete. Oder ein Dieb, dem Herr Renner nur in die Quere kam.«
»Aber so viele Stiche! So viel Wut!«
»Ich bin kein Kriminalist. Später werde ich die Offizin des Stadthauptmanns informieren – für alle Fälle. Man muss diesen Andres verhören. Aber zuerst ist der Patient wichtig. Ich kenne den Herrn ja seit Jahren, er ist mir ans Herz gewachsen. Sein Vater gehört zu den unteren Räten der Stadt. Im Spital hat er jedenfalls die beste Pflege. Ich kann die Wunden mit allen Präparaten, Opiaten und Laxantien behandeln. Dort werden wir ihn auch bestens betreuen, falls er stirbt. Die Ermittler kommen später dran, ich werde mich darum kümmern.«
»Er darf nicht sterben!«
»Nun geben Sie mir schon das Wasser, damit ich die Wunde ausreiben und auswaschen kann. Reichen Sie mir auch die Alrauntropfen da. So, und nun rufen Sie die 14 Nothelfer oder den heiligen Achatius an, wenn Sie wollen.«