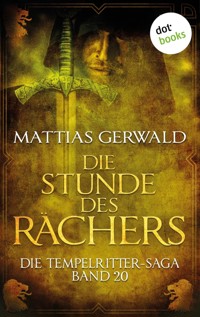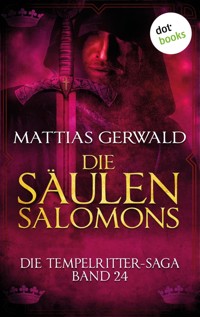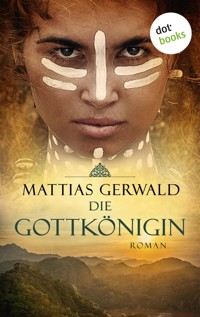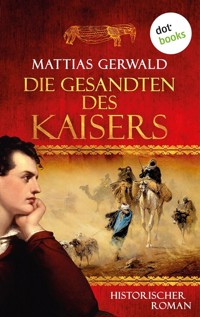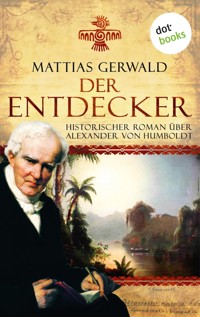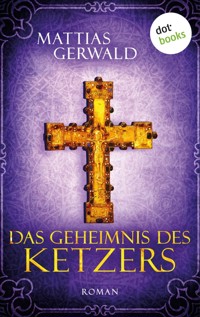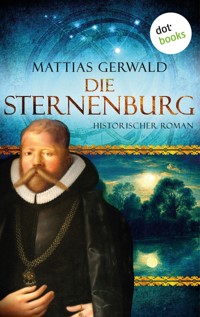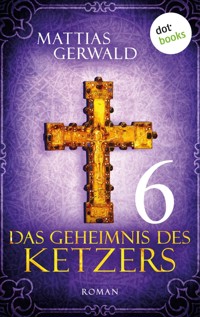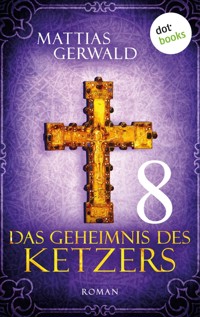Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"Ich weiß, dass die Kinder, die das Kreuz nach Palästina tragen wollen, dem Tode geweiht sind. Wer das bestreitet, macht sich schuldig!" Frankreich im Jahre 1316. Der Kardinal von Nîmes ruft zum Kreuzzug auf. Doch es sind nicht die Kampferprobten, die sich freiwillig melden: Hunderte von Kindern sehen ihre Chance, der Trostlosigkeit ihres Daseins zu entfliehen, und stürzen sich in das ruhmreiche Abenteuer. Doch was steckt wirklich hinter dem vermeintlich heiligen Auftrag? Der schottische Tempelritter Henri de Roslin misstraut dem undurchsichtigen Kirchenfürsten. Zusammen mit seinen Gefährten Uthman und Joshua beschließt er, dem Kindertross zu folgen. Er ahnt nicht, dass damit eine verhängnisvolle Irrfahrt quer durch das Heilige Land beginnt – mit ungewissem Ausgang … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich im Jahre 1316: Der Kardinal von Nîmes ruft zum Kreuzzug! Hunderte von Kindern sehen ihre Chance, der Trostlosigkeit ihres Daseins zu entfliehen, und stürzen sich in das ruhmreiche Abenteuer. Doch was steckt wirklich hinter dem vermeintlich heiligen Auftrag? Der schottische Tempelritter Henri de Roslin misstraut dem undurchsichtigen Kirchenfürsten. Zusammen mit seinen Gefährten Uthman und Joshua nimmt er sich des Schicksals der Kinder an und folgt ihnen. Er ahnt nicht, dass damit eine verhängnisvolle Irrfahrt quer durch das Heilige Land beginnt – mit ungewissem Ausgang …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheint: »Novembermord«, »Engelmord«, »Regenmord« und »Frühjahrsmord«. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.
Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.
Bei dotbooks erschienen »Die Geliebte des Propheten«, »Das Geheimnis des Ketzers«, »Der Entdecker«, »Die Sternenburg«, »Die Gottkönigin«, »Die Gesandten des Kaisers« und »Die Hetzjagd«.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald auch folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta«
»Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi«
»Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen«
»Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers«
»Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2006 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Olga Ruko und shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-786-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Kreuzzug der Kinder« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mattias Gerwald
Der Kreuzzug der Kinder
Die Tempelritter-Saga
Band 9
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Winter 1316, die Rückkehr der Kinder
Es waren die Tage des Sturms.
Henri de Roslin hatte eine lange Reise über Land hinter sich. Müde vom beschwerlichen Ritt und vom Kampf gegen den ständigen Wind, der kalte Regenschauer vom Meer her über den Reiter geworfen hatte, gelangte Henri nach Aigues-Mortes. Als er endlich in die Gesichter seiner beiden Gefährten blicken konnte, sah er Erleichterung und Freude. Sie umarmten ihn. Lange hatten sie auf ihn gewartet.
Und plötzlich, von den heftigen Südwinden des beginnenden Winters an die Küste zurückgepeitscht, waren auch die drei großen Nefs wieder da, die erst vor Tagen ins Heilige Land aufgebrochen waren. Uthman erblickte sie als Erster am Horizont, schwere Vögel mit dicken Segeln, die über den bleiernen Wassern heranschwebten. Und mit der letzten großen Sturmböe liefen sie in den Hafen am Kanal der Könige ein.
»Hier in Aigues-Mortes, an dieser unseligen Küste«, sagte Joshua ben Shimon, »geht alles drunter und drüber. Es hat viele Tote gegeben. Nachstellungen. Gewalt. Überall lauern Gefahren. Als ob die Welt aus den Fugen geriete. Wir wollten keinen Tag länger warten. Aber jetzt bist du endlich da, Henri, und wir müssen beraten, was zu tun ist.«
Uthman erkundigte sich nach Sean, und Henri erzählte ihm, dass er den liebeskranken Knappen zu seiner Angelique nach Quimper zurückgeschickt hatte. Er berichtete auch, dass Sean ein Tuch bei sich hatte, auf dem das Gesicht der jungen Frau abgebildet war.
»Und was war das für ein allerchristlichster Auftrag, den der Ritter Geoffroy de Charney in Lirey dir angetragen hat?«, wollte Joshua wissen.
»Es ging um das Grabtuch, in das Jesus Christus nach der Kreuzigung auf Golgatha gebettet worden war. Es ist im Besitz des Herrn de Charney, der es vom letzten Präzeptor des Tempels der Normandie geerbt hat«, erklärte Henri.
»Dieses sagenumwobene Tuch gibt es wirklich?«, fragte Joshua erstaunt. »Das Tuch mit der Abbildung des Gekreuzigten?«
»Ja.«
»Ich hielt das immer für eine der vielen Legenden, die sich Christen an langen Winterabenden erzählen.«
»Sie erzählen durchaus davon an langen Winterabenden«, sagte Henri. »Aber es existiert tatsächlich. Doch diese ganze Angelegenheit war ziemlich heikel.«
»Und dieses Grabtuch – es ist wirklich echt?«, wollte Uthman wissen.
»Zumindest verlangte der Ritter von mir, das Leinen für echt zu erklären. Ich hätte das tun können, auch wenn ich nicht überzeugt war, aber ich wollte es schließlich nicht. Es war zu viel geschehen in Lirey. Und es klebte buchstäblich zu viel Blut an dieser Reliquie – und nicht nur das meines Herrn Jesus. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich bin im Streit geschieden.«
»Wir haben ein Quartier im Franziskanerkloster«, erklärte Uthman. »Jetzt, wo du hier bist, haben wir kein schlechtes Gewissen mehr, in einem Kloster unterzukommen. Wir quartieren dich ebenfalls dort ein.«
»Und bei nächster Gelegenheit stechen wir in See, nicht wahr?«, fragte Joshua freudig erregt wie ein Kind, das auf ein Geschenk wartet.
Henri blickte zu den Nefs, die inzwischen am Ende des Kanals der Könige im Hafen angelegt hatten. Ein Strom von Kindern und Matrosen verließ die Schiffe über die Laufplanken. Es war ein seltsames Bild, an dem aus irgendeinem Grund nichts zu stimmen schien. Nichts passte zueinander. Nicht die gehetzten Kinder, nicht die speichergroßen Kästen der klobigen Handelsschiffe, nicht die vielen Bewaffneten.
»Ihr habt gewiss viel zu erzählen«, sagte Henri. »Setzen wir uns an einem ruhigen Ort zusammen.«
»Bringen wir zunächst deine Sachen unter!«, riet Joshua.
Henri bekam eine Zelle im Kloster der Franziskaner. Die Gastfreundschaft der Mönche ermöglichte es jedem Fremden, sich für unbegrenzte Zeit aufzuhalten, wenn er kleine Arbeiten auf dem Gelände übernahm, die sonst von den Laienbrüdern verrichtet wurden. Henri war dankbar für die einfache und saubere Unterkunft. Das mitten in der Stadt gelegene Kloster besaß unverputzte Mauern, an denen Kletterpflanzen rankten. Sie suchten sich im Garten einen windgeschützten Platz nahe dem Brunnen.
Die Gefährten erzählten Henri, von welchen Ereignissen die Stadt in den letzten Wochen überschattet gewesen war. Vor allem vom Kinderkreuzzug und dem Pogrom berichteten sie ausführlich. Henri war erschüttert. Jetzt erst wurde ihm bewusst, in welcher Gefahr die Freunde geschwebt hatten. Wie nebensächlich war dagegen sein Aufenthalt in Lirey gewesen, wo es nur um die Befriedigung der Eitelkeit eines jungen, stolzen Ritters gegangen war, der glaubte, eine heilige Reliquie zu besitzen. Henri schilderte, wie spät ihr Bote ihn erreicht hatte, weil der Ritter ihn aufgehalten hatte, und er berichtete auch von dem Überfall der Wegelagerer auf seinem Weg nach Troyes.
Joshua schlug entsetzt die Hände vor den Mund. »Es traf den Jungen?«, fragte er.
»Sean hat den Anschlag gut überstanden«, beruhigte Henri ihn. »Und überhaupt bin ich mit ihm sehr zufrieden, er entwickelt sich bestens. Er hat viel gelernt und verrät kluge Gedanken. Ganz gewiss wird er seinen Weg machen.«
»Das ist gut zu wissen. Und ich bin froh, dass er nicht mit dir gekommen ist, Henri. Denn in dieser Stadt der verwirrten Kinder, die von falschen Propheten aufgewiegelt werden, würde es ihm in der einen oder anderen Weise schlecht ergehen.«
Uthman sagte: »Ein achtzehnjähriger Nichtsnutz namens Marcel führt die Kinder auf einen Kreuzzug. Er glaubt, Christus habe ihm einen Himmelsbrief überbracht.«
»Wir haben das Heilige Land mit der militärischen Macht all unserer Armeen nie wirklich erobert«, sagte Henri. »Und jetzt wollen es Kinder versuchen? Man sollte die Anführer bestrafen!«
»Allein die Absicht der Eroberung ist schon der Strafe wert«, sagte Uthman ibn Umar.
»Unser Sarazene jedoch hat hier in der Stadt eine Eroberung gemacht«, meinte Joshua schelmisch. »Eine junge Frau namens Reneé ist ganz wild auf ihn. Aber sie ist jung und einfältig. Und ihr eifersüchtiger Verlobter hetzte die Leute gegen uns auf. Auch in Aigues-Mortes finden sich wie überall schnell Menschen, die Sündenböcke brauchen. Einige meiner Glaubensbrüder im jüdischen Viertel mussten es büßen. Jean-Luc heißt der aufgebrachte Verlobte, und er ist gefährlich. Wir müssen ihn im Auge behalten, solange wir uns in dieser Stadt aufhalten.«
»Gehen wir zum Hafen hinunter«, schlug Henri vor. »Ich möchte mir mit eigenen Augen ein Bild von der Lage machen. Vor allem will ich mir die Schiffe ansehen. Vielleicht können wir schon bald auf einem davon ins Heilige Land segeln – wenn die Stürme nachlassen.«
Joshua berichtete ausführlich von den Kindern, die an Deck der Nefs gewesen waren, aber auch von denen, die sich nicht aufhalten ließen, auf Fischerbarken mit einem kleinen Segel und sechs Ruderplätzen ins offene Meer hinauszusegeln. Er sagte zweifelnd:
»Hatten sie überhaupt eine Chance, die Stürme zu überleben? Wenn schon die Nefs zurückkehrten!«
»Wann sind sie losgefahren?«, wollte Henri wissen.
»Vor sieben Tagen.«
»Und sie glauben, mit einfachen Barken, auf denen sich die Fischer wohlweislich nicht aufs offene Meer begeben, bis nach Jerusalem zu kommen?«
»Sie waren fest davon überzeugt!«
»Sind denn wenigstens erfahrene Seeleute unter ihnen?«
»Kaum einer.«
»Sie können es nicht schaffen! Wir müssen sofort einen Konvoi organisieren, der den Kindern hinterhersegelt!«, rief Henri aus. »Sonst trifft auch uns Schuld an ihrem Unglück.«
Am Hafen stürzten ihnen Kinder entgegen, die nach den Abenteuern auf See genug vom Kreuzzug hatten. Sie wollten nur noch nach Hause. Die Gefährten sahen, wie geschwächt und verwirrt sie waren. Sie sprangen von den Schiffen, rannten an ihnen vorbei in Richtung Stadt und verschwanden durch die Tore. Eine Gruppe schlug den Weg in die umliegenden Sümpfe ein.
Henri nahm jetzt auch den mächtigen gelben Turm wahr, der jenseits der Stadt hervorragte. Er erinnerte sich daran, dass im obersten Stockwerk dieses Turms Tempelbrüder von Soldaten König Philipps gefangen gehalten und gefoltert worden waren. Wie viele hatten diese Gefangenschaft nicht überlebt.
Die schweren, kastenförmigen Nefs hoben und senkten sich im kabbeligen Wasser. Hin und wieder schlug ihr unförmiger Leib gegen die Kaimauer. Aus der Nähe sahen die Gefährten, dass die Stürme auf dem offenen Meer beträchtlichen Schaden angerichtet hatten. Eine zinnenbewehrte Bordwand war eingedrückt, die Masten mit der Lateinertakelung zeigten Risse, am zweistöckigen Heckaufbau, dort, wo die Gesellschaftsräume für die begüterten Reisenden waren, fehlte Butzenglas in leeren Fensterhöhlen. Auf den Decks und in der Takelage arbeiteten Matrosen, Hafenarbeiter schleppten Fässer, Säcke und Körbe von Bord. Dann entlud man auch die Pferde. Ein Auslaufen in nächster Zeit schien fraglich.
Henri ließ sich vom Kapitän eines der drei Schiffe, einem Katalanen namens Alfonso, die Lage erklären. Der Mann besaß das Gesicht eines Igels, seine Haare wirkten auf dem Kopf wie ein borstiger Deckel.
»Wir sahen unterwegs treibende Planken von zerschollenen Barken. Aber keine Schiffbrüchigen. Einige Kinder werden gewiss ertrunken sein. Der Rest wird durchkommen, oder man wird in den nächsten Tagen Barken sehen, die zurücktreiben. Dann müssen sie hier anlanden, denn die Strömung aus Süden und Osten des Mittelländischen Meeres wird sie zusammen mit den Winden, die jetzt blasen, an die Küste von Aigues-Mortes oder vor die Inseln der Stadt Marseille spülen. An der Insel Tauris, auf der eine gewaltige Festung thront, sind schon viele zerschellt.«
»Was geschieht mit den großen Schiffen?«
»Die Eigner in Triest und Istrien wollen Geschäfte machen und verlangen, dass wir ins Heilige Land fahren. Wir werden also wieder auslaufen. Aber erst, wenn diese verteufelten Stürme vorbei sind.«
»Wir müssen sofort aufbrechen«, mahnte Henri. »Wir müssen nach den Kindern suchen. Es müssen Hunderte sein! Sie sind den Elementen hilflos ausgeliefert. Suchen wir sie! Und dazu brauchen wir Euer Schiff, Kapitän.«
»Ich sagte doch, bei den Stürmen hat es keinen Sinn auszulaufen. Die Drift ist viel zu stark. Wir treiben an Land zurück. Und wenn wir zu weit gegen den Wind segeln und nach Süden abtreiben, werden wir gegen die Riffe vor dem italienischen Festland geschleudert!«
»Es geht um Menschenleben, Kapitän Alonso! Habt Ihr kein Herz?«
»Ich habe ein Herz, aber das schlägt auch für meine Mannschaft und für mein Schiff! Im Moment ist es zwecklos, auszulaufen! Und wie wollen wir eine Hand voll Barken auf dem Meer finden! Eure edle Absicht in allen Ehren, Herr, aber der Plan ist undurchführbar.«
Henri wollte es nicht wahrhaben. Aber Joshua stieß ihn an. »Er hat wohl Recht. Wir können vorläufig nichts machen.«
»Es bleibt uns einfach nichts anderes übrig, wir müssen abwarten«, meinte auch Uthman. »Sobald sich die Stürme legen, laufen wir aus.«
Henri ließ sich nur schweren Herzens überzeugen. »Wenn es so weit ist, fahren wir mit Euch, Kapitän. Wir dürfen nicht viel Zeit verlieren, hört Ihr? Wir suchen die Kinder, die jetzt hilflos auf dem Meer treiben, und segeln dann weiter ins Heilige Land.«
»Ihr wollt nach Palästina? Dann seid Ihr mir willkommen, denn Ihr scheint tüchtige Männer zu sein!«
»Und wir bezahlen die Überfahrt natürlich aus«, sagte Uthman.
»Auch das ist mir sehr willkommen«, lachte der Kapitän.
»Gebe Gott, dass die Stürme bald aufhören.«
»Ich lasse Euch meinen Preis noch wissen«, sagte der Kapitän und wandte sich ab.
Als der Kapitän wieder auf sein Schiff ging, raunte Henri seinen Gefährten zu: »Ich habe keinen Sous mehr in der Tasche. Und meine kleine Goldreserve ist bei dem Überfall den Räubern in die Hände gefallen. Ich kann also nichts bezahlen.«
»Keine Sorge«, beschwichtigte ihn Joshua. »Ich habe noch genug. Den Anteil, den du uns beim letzten Mal austeiltest, nachdem du das Versteck deines Tempelschatzes in der Bretagne aufgesucht hattest, trage ich noch vollständig in meinem Brustbeutel.«
»Es ist nicht mein Tempelschatz, Joshua. Er gehört meinen Brüdern. Und ich darf ihn nur zum Wiederaufbau des Tempels verwenden.«
»Ich weiß, Henri. Aber – du bist der Tempel! Was ich habe, das reicht für ein ganzes Jahr.«
»Ich habe in Troyes zum ersten Mal gemerkt, was es heißt, arm zu sein!«, sagte Henri. »Es war keine angenehme Erfahrung. Aber lehrreich. Ich weiß jetzt, wie es armen Leuten geht, die nicht wissen, wie sie ihre nächste Mahlzeit bekommen sollen.«
»Eine tüchtige Lektion, edler Tempelherr!«, sagte Uthman, »ich hoffe, sie vermenschlicht Euch ein wenig.«
»Aber Sarazene!«, empörte sich Joshua ben Shimon. »Ich kenne keinen Mann mit einem größeren Herzen als Henri!«
»Es war ein Scherz«, klärte Uthman ihn auf.
»Es war wohl eher der Versuch eines Scherzes«, verbesserte ihn Joshua.
»Du sagst es, mein Joshua«, erwiderte Uthman.
*
Die Gefährten hatten Henri darauf hingewiesen, dass der Kardinal von Nimes während des Kinderkreuzzugs eine zweischneidige Rolle gespielt hatte. Erst hatte er die Kinder gesegnet, dann verflucht. Und schließlich hatte er einen eigenen Kreuzzug angekündigt. Jetzt riefen junge Priester an seiner Seite mit Brandreden zur erneuten Eroberung des Heiligen Landes auf.
Henri wollte den Kirchenfürsten aufsuchen, doch der Kardinal war gerade in Aix. Er wartete also, bis er zu einem Besuch ins Kloster kam. Drei Tage später war es so weit. Der Kardinal hatte schon an der Morgenmesse in der Klosterkapelle teilgenommen. Jetzt wandelte er im Kreuzgang, einen jungen Priester an seiner Seite.
Henri trat ihnen in den Weg.
»Verzeiht mir, Eminenz! Darf ich Euch ein paar Fragen stellen?«
Der Kardinal blickte ihn befremdet an. »Warum stört Ihr uns im Gespräch? Wer seid Ihr?«
»Jemand, der Antworten sucht.«
»Der Name, wenn's beliebt?«
»Das tut nichts zur Sache.«
»Ihr seid Gast im Kloster der Franziskaner?«
»So ist es.«
»Also gut.« Der Kardinal seufzte. »Setzen wir uns einen Augenblick.«
»Ich hörte«, begann Henri, »dass von Aigues-Mortes ein unseliger Kinderkreuzzug seinen Ausgang nahm, von dem einige Kinder gerade wieder zurückgekommen sind. Andere werden auf dem Meer vermisst. Wie kann es angehen, dass die Kirche nichts gegen einen solchen Irrsinn unternimmt?«
»Das ist wohl kaum der angemessene Ton, um mit unserem Kardinal zu sprechen!«, brauste der junge Priester auf, Zornesröte im Gesicht.
»Lasst nur, Bruder Irenäus! Die Frage ist interessant genug. Nun, die Antwort ist im Grunde einfach. Es ist beileibe kein Irrsinn, wenn Christen gegen Jerusalem ziehen. Jeder Christ im Heiligen Land wiegt hundert Ungläubige auf. Aber man mag tatsächlich fragen, ob Kinder geeignet sind für diese große Sache, den Ruhm des Herrn dorthin zu tragen.«
»Ihr habt alles mit angesehen. Warum habt Ihr das Ganze nicht verhindert?«
»Ich habe meine eigenen Pläne, mein Sohn.«
»Welche sind das?«, wollte Henri wissen.
»Sollte Euch wohl zustehen, solche Auskünfte zu verlangen?«
»Ich bin tief gläubig, Eminenz. Und ich sorge mich um das Überleben der Kinder.«
Der Kardinal holte tief Luft. »Ich will Kreuzprediger losschicken, ich will ein Konzil einberufen, ich will ein Legat herausgeben, mit dem das Kreuz unterschiedslos an alle vergeben werden kann, auch an Kinder, an Greise, an Frauen, selbst an Kranke. Ich werde meine Kreuzprediger mit den nötigen Briefen versorgen, die meinen Namen tragen. Bußwesen und Kreuzzug werden künftig – zumindest in Frankreich – in meinen Händen liegen.«
»Ihr wollt zu einem eigenen Kreuzzug aufrufen?«
»Ja, das will ich.«
»Mit Feuer und Schwert?«
»Natürlich!«
»Und junge Priester wie dieser hier sollen dafür das Volk mit Brandreden aufstacheln?«
»Wir brauchen alle, die reden können. Wollt Ihr Euch nicht auch beteiligen? Ihr scheint mir rhetorisch dazu in der Lage zu sein. Denn eine gute Rhetorik ist ein wichtiges Vermögen – und kein Teufelszeug, wie man früher dachte.«
Henri lachte kurz auf. »Die Könige werden zweifellos gegen einen solchen Plan sein. Sie finanzierten bisher die Kreuzzüge, und sie werden sich das nicht aus der Hand nehmen lassen.«
»Das übernimmt ab nun die Kirche«, sagte der Kardinal nachdrücklich. »Ich bespreche gerade mit Bruder Irenäus, der die Kirchensprengel in der gesamten Provence bestens kennt, die Einzelheiten.«
»Die Menschen haben genug von Kreuzzügen«, sagte Henri. »Sie haben nur Unglück gebracht, Armut, Krankheit, Ruin – und den Tod in vielfacher Gestalt.«
»Diesmal machen wir es ganz anders«, sagte der Kardinal überzeugt. »Wir werden die Priester, die den Zug begleiten, von ihrer Residenzpflicht entbinden, auch während der Kreuzfahrt erhalten sie das heimatliche Einkommen. Wer nicht selbst auszieht, soll auf drei Jahre hin andere ausrüsten. Die Schiffsbauer werden mit besonderer Gunst bedacht, denn wir ziehen nicht mehr über Land. Der Kirchenbann droht jedem, der mit den Sarazenen verhandelt oder ihnen etwas verkauft, Sklaverei jenen, die als Freibeuter in Diensten der Ungläubigen stehen. Der Levantehandel in der bisherigen Form wird verboten, wir übernehmen ihn ab sofort. Alle Kreuzfahrer werden von Steuern und Zöllen befreit und bis zu ihrer Rückkehr oder dem Eintreffen sicherer Kunde von ihrem Tod dem Schutz des Apostolischen Stuhls unterstellt. Für ihre Schulden halten wir ein Moratorium ab.«
»Und die Kirche? Sie schickt die Gutgläubigen in die Schlacht und verdient daran?«
»Weit gefehlt! Alle Geistlichkeit zahlt an uns den Zwanzigsten, alle Kardinäle den Zehnten. Ihr seht, ich bitte mich selbst zur Kasse, damit das Werk gelingt. Ich nehme mich nicht davon aus, die Lasten zu tragen. Und jeder eingenommene Sous wird wirklich für den Kreuzzug verwendet!«
»Ein großes Vorhaben, Kardinal! Aber ich glaube dennoch, die Idee des Kreuzzuges ist überholt. Wir haben sie nicht in den Herzen verankern können.«
»Aber nein! Wieso denn! Diese große Idee beflügelte die Menschen zweihundert Jahre lang!«
»Wie viel Blut ist in dieser Zeit geflossen! Und gewonnen wurde nichts!«
»Ihr zweifelt am Auftrag unserer heiligen Kirche, die christlichen Stätten aus der Hand der Heiden zu befreien? Seid Ihr – ein Ketzer?«
»Nicht jeder, der eine abweichende Meinung über den Gang der Dinge hat, Eminenz, ist ein Ketzer! Kann die Kirche das nach all den Leiden, die der Inquisition angelastet werden müssen, noch immer nicht eingestehen?«
»Ihr seid ein Ketzer!« Der junge Priester war aufgesprungen. »So spricht nur ein unverschämter Ketzer!«
»Lasst!«, winkte der Kardinal ab. »Nur keine voreiligen Urteile. Wir sollten lieber versuchen, jeden einzelnen Zweifler für uns zu gewinnen. Wir können jeden gebrauchen.«
»Nun, wie stellt Ihr Euch einen neuen Kreuzzug vor?«, fragte Henri abwägend. »Wollt Ihr aus den Fehlern der Vergangenheit lernen?«
»Zieht mit uns, wenn Ihr so viel Erfahrung habt! Lenkt uns auf die richtigen Pfade!«
»Ich werde nach Palästina gehen, aber nicht aus diesem Grund. Ich kämpfe nicht gegen Sarazenen.«
Priester Irenäus stöhnte auf und schlug das Kreuz.
»Wir werden«, antwortete der Kardinal und blickte dabei zum Himmel, »mit unserer Heeresmacht nach Byblos segeln. Von dort aus ziehen wir bis vor die Tore Jerusalems. Und wir beten so lange, bis die Stadtmauern einfallen und der Herr vom Himmel heruntersteigt, um mit uns zusammen die Sarazenen zu vertreiben.«
»Eminenz, dem wird auf diese Weise kein Erfolg beschieden sein. Glaubt mir. Ich kenne das Heilige Land. Ich war auf dem letzten Kreuzzug dabei, bis unsere Hauptstadt Akkon fiel. Ihr könnt beten, so lange ihr wollt. Weder stürzen dabei Mauern ein, noch steigt unser Herr auf der Himmelsleiter herab. Rechnet nicht mit solch direkter Hilfe.«
»Ihr frevelt!«, rief jetzt Priester Irenäus. »Wollt Ihr behaupten, Ihr wisst, was Gott der Herr tut oder vorhat zu tun?«
»Nein. Natürlich nicht. Wie kommt Ihr darauf, junger Mann?«
Das Gesicht des jungen Priesters wurde noch roter. Dann fasste er sich:
»Ich kenne Leute wie Euch! Ihr seid Häretiker! Ihr verfälscht die reine Lehre! Immer zweifelt Ihr und biegt die einfache Wahrheit zu Euren Gunsten um!«
»Seid Ihr einmal in Palästina gewesen?«
»Nein. Wieso?«
»Wie gesagt, ich kenne das Heilige Land. Ich war jünger als Ihr, als ich den Fall von Akkon erlebte. Und deshalb weiß ich, dass die Kinder, die das Kreuz nach Palästina tragen wollen, dem Tode geweiht sind. Wer das bestreitet, macht sich schuldig! Und jeder andere Kreuzzug ist ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Die Zeit der Kreuzzüge ist vorbei! Wer heute noch dazu aufruft, ist ein Träumer!«
»Mäßigt Euch!«, rief der Kardinal. »Ob die Zeit für Kreuzzüge vorbei ist oder nicht, müsst Ihr uns überlassen. Denn der Gedanke der Befreiung kommt aus der Mitte unserer heiligen Kirche, er gehört nicht den Laien.«
»Das Heilige Land ist in der Hand der Ungläubigen, in Jerusalem wütet der heidnische Mob!«, rief der Priester. »Und wir sollen Träumer sein, wenn wir das beenden wollen?«
»Kriege führen zu nichts – das ist die Lehre meines bisherigen Lebens!«
»Ihr seid der Träumer, der Idealist!«, rief der Priester. »Wahrscheinlich seid Ihr einer von denen, die glauben, mit Überredungskunst die Heiden davon zu überzeugen, Jerusalem preiszugeben. Doch so geht es nicht. Wir müssen die Heiden hinausprügeln!«
»Ich werde in den nächsten Tagen, wenn die Stürme vorüber sind und die Strömung günstig ist, ins Heilige Land aufbrechen«, sagte Henri ruhig. »Unterwegs suchen wir nach Kindern, die schiffbrüchig wurden, und nehmen sie auf. Wollt Ihr uns dabei helfen?«
»Nein«, sagte der Kardinal.
»Wir haben andere Dinge zu tun«, erwiderte der junge Priester. »Unsere Herolde sind bereits in der Camargue und in der Provence unterwegs, und sie rekrutieren weitere Kinder. Wir warten hier auf ihre Ankunft. Und dann segeln wir auf den großen Schiffen, die gerade im Hafen angelegt haben, hinaus!«
»Halleluja!«, sagte der Kardinal.
»Ihr überlasst die Kinder ihrem Schicksal?«, fragte Henri.
»Der Herr beschütze sie«, erwiderte der junge Priester. »Wir werden ihm nicht ins Handwerk pfuschen wollen, nicht wahr? Alles liegt in Gottes Hand! Oder seid Ihr anderer Meinung?«
»Rhetorik ist gut, wenn sie zu etwas Rechtem dient. Aber Ihr redet Euch heraus«, sagte Henri. »Was seid Ihr nur für Menschen, die kein Mitleid mit armen, fehlgeleiteten Kindern aufbringen können, die in den sicheren Tod rennen! Das zu verhindern wäre eure Christenpflicht!«
»Ihr seid nur ein einfacher Gläubiger. Belehrt uns nicht!«, mahnte der Kardinal.
Priester Irenäus fügte hinzu: »Ihr solltet Euch mit dem Gedanken vertraut machen, dass Ihr Euch zu wichtig nehmt, mein Bruder.«
»Und Ihr solltet mehr auf Eure Gefühle achten statt auf Eure Glaubenssätze«, erwiderte Henri. »Wir brauchen keine geistlichen Führer, die nicht bei den Menschen sind.«
»Wenn das die Fragen gewesen sind, die Ihr stellen wolltet«, unterbrach der Kardinal und erhob sich, »dann habt Ihr sie gestellt. Und nun gehabt Euch wohl, und Gott mit Euch!«
*
Henri hatte das Gespräch äußerst deprimiert. Gedankenverloren ging er zur Hafenmole hinunter, setzte sich auf einen Stein und blickte über das Meer. Er überlegte, was er jetzt noch tun könnte.
Die Kinder nahm er zunächst kaum richtig wahr. Sie lungerten herum, scharrten im Sand, hämmerten mit Steinen auf die Kaimauer oder versuchten, mit einfachen Angelstöcken Fische zu fangen. Einige blickten hin und wieder verstohlen zu ihm herüber. Henri sah in ihren Gesichtern Hilflosigkeit und Verzweiflung, nagenden Hunger und Durst, aber von der Art, die nicht durch Essen und Trinken zu stillen gewesen wäre. Er begriff, dass die Kinder ihr Urvertrauen verloren hatten.
Henri ging zu ihnen hinüber.
»Wer kümmert sich jetzt um euch?«
Henri hatte die Frage ganz allgemein gestellt. Niemand antwortete. Jemand schniefte verächtlich. Ein verwahrlostes Mädchen blickte ihn von unten herauf an.
»Habt ihr meine Frage nicht verstanden?«
»Pah! Ist doch egal!«, sagte das Mädchen.
»Nein«, erwiderte Henri. »Das ist es nicht. Wer kümmert sich um euch?«
»Niemand.«
»Warum geht ihr nicht nach Hause?«
Das Mädchen lachte verächtlich. »Wer ein Zuhause hat, ist schon weg, wertester Herr. Wir hier haben keines.«
»Und was wollt ihr jetzt tun?«
»Was schon, wir warten, bis der Herr im Himmel uns ein Zeichen herabsendet.«
»Folgt mir«, sagte Henri, »ich sorge dafür, dass ihr wenigstens zu essen und zu trinken bekommt.«
»Das wäre ein Anfang«, mischte sich ein Halbwüchsiger ein, dem zwei Vorderzähne fehlten. »Mir zerreißt es sowieso schon den Magen.«
»Aber danach?«, fragte ein kleiner, dünner Junge. »Was geschieht dann?«
»Man hat euch hierher gelockt«, stellte Henri fest. »Nun muss auch jemand die Verantwortung für euch übernehmen. Ich brauche jemanden aus eurer Mitte, der es sich zutraut, zusammen mit mir ein paar Hilfsdienste aufzubauen.«
»Sie haben uns alle im Stich gelassen«, sagte das Mädchen. »Marcel, der Großkotz, die jungen Priester, die so genannten Propheten – alle. Wenn ich sie in die Finger kriege, gnade ihnen Gott!«
»Ihr tragt selbst Schuld an eurer Lage«, sagte Henri bewusst streng. »Ihr seid alt genug, um zu wissen, was ihr tut. Warum seid ihr auf die falschen Propheten hereingefallen?«
»Ihr redet, wie Ihr es versteht, Meister«, rief der Halbwüchsige. »Jeder hat uns zugeraten, den Kreuzzug anzutreten. Zu Hause, unterwegs, die Popen, die Büttel, alle! Und dann? Schon auf dem Weg hierher fing alles an. Wir sind Tausende von Meilen zu Fuß gelaufen! Könnt Ihr Euch das überhaupt vorstellen? Nur die Söhne der Adligen besaßen ja Pferde, aber einige haben wir unterwegs geschlachtet und gegessen, weil es nichts anderes gab.«
»Erzählt mir, wie das alles zugegangen ist«, bat Henri.
Das Mädchen sagte: »Das glaubt uns sowieso keiner.«
»Versuche es trotzdem.«
Das Mädchen blies die Wangen auf, dann erzählte es. »Die Wohlhabenden spielten Aufpasser. Als uns allmählich dämmerte, dass dieses Unternehmen schief gehen musste, passten sie umso schärfer auf uns auf. Die Adelssöhne waren die Schlimmsten, vor allem die, die aus Raubritterfamilien stammten. Die kannten keine Gnade, waren ja auch als Einzige bewaffnet. Auch die Diebe und Wegelagerer kannten nichts außer herumpöbeln und zuschlagen. Vor ihnen, die bald schon den Ton angaben, obwohl es zusammen genommen nicht mal hundert waren, hatten wir einfach Angst. Nur wenige türmten, die meisten trauten sich nicht. Und ständig hatten wir Hunger. Wir stahlen, was wir brauchten, und so kam es zu Streitereien mit den Bauern. Einige von uns wurden erschlagen, andere einfach aufgeknüpft, und unsere großartigen Propheten ließen all dies geschehen.«
»Anfangs war alles großartig«, setzte der Junge den Bericht des Mädchens fort. »Man empfing uns mit offenen Armen, gab uns zu essen, Kleidung, die Mädchen bekamen sogar Blumen. Immer mehr Kinder schlossen sich uns an. Priester segneten uns. Bauern schenkten uns sogar Ochsenkarren samt Zugtieren. Aber das änderte sich bald.«
»Wurdet ihr gewalttätig?«, fragte Henri.
»Wir mussten uns wehren«, fuhr der Junge fort, »sonst wären wir schon nach kurzer Zeit fertig gewesen. Wir waren Tausende! Wenn die Stadttore nicht rechtzeitig geschlossen wurden, fielen wir ein und prügelten uns mit Speicherbesitzern und Händlern herum ...«
»In den Dörfern empfing man uns mit Mistgabeln«, setzte das Mädchen hinzu.
»Schließlich lauerten uns in den Wäldern königliche Soldaten auf. Ich sehe noch immer wie in einem Albtraum das Wappen der blutroten Lilie auf ihrer Brust – und dann ihre Schwerter! Als immer mehr von uns elend verreckten, wussten wir, dass dieser Kreuzzug nicht im Sinne unseres Herrn sein konnte.«
»Wir beschlossen also«, fuhr das Mädchen fort, »uns an den Juden schadlos zu halten. Auf unserem Zug stießen wir auf Judengemeinden. Zuerst feilschten wir mit ihnen, aber wir hatten ja eh nichts anzubieten, also pressten wir aus ihnen raus, was zu kriegen war.«
Henri fühlte den Zorn in sich aufsteigen, aber er zwang sich, ruhig zu bleiben. »Die Schwachen richten sich meistens gegen die noch Schwächeren. Ihr wisst, wie verwerflich das ist.«
»Die falschen Propheten waren an allem schuld!«, rief der Junge. »Sie peitschten uns immer weiter, bis wir hier ankamen. Uns erschien ja Aigues-Mortes schon wie die Rettung, wie eine heilige Stadt, weil wir hier endlich ausruhen konnten! Viele von uns waren schon so durchgedreht, dass sie sich ins Wasser stürzten, weil sie glaubten, das Meer würde sich augenblicklich teilen!«
»Und dann lagen wir hier herum, wochenlang, und warteten auf die verdammten Schiffe aus Triest. Kein Wunder, dass die meisten irgendwann die Nerven verloren, den Fischern die Barken klauten und einfach losfuhren. Sie wollten endlich etwas tun!«
»Damit sind sie so gut wie tot«, sagte Henri nüchtern. »Sie können auf See nicht überleben. Von einem solchen Irrsinn habe ich noch nicht gehört. Warum hat sie niemand zurückgehalten?«
Das Mädchen weinte. Unter Tränen erzählte es: »Ich habe drei Schwestern verloren. Sie blieben bei Clermont einfach im Straßengraben liegen. Jetzt haben die Vögel sie längst gefressen. Verdammter Kreuzzug!«
»Ihr hättet euch wehren müssen!«, sagte Henri. »Wenn ihr euch geweigert hättet, weiterzuziehen, hätten sie den ganzen Zug aufgehalten!«
»Das ist leicht gesagt, Meister!«, grollte der Halbwüchsige. »Die Bewacher schlugen auf uns ein, sobald wir das Maul aufmachten. So hatten wir Feinde überall auf den Wegen und noch größere Feinde in unseren eigenen Reihen. Es war wie auf einer Sträflingsgaleere! So gingen wir einfach nur weiter und weiter. Wir ernährten uns von Wurzeln und Kastanien, manche fingen ein paar Fische, aber das reichte nur für wenige Auserwählte. Als wir hier ankamen, konnten wir uns tagelang nicht mehr rühren.«
»Wir müssen jetzt überlegen«, sagte Henri, »wie es mit euch weitergeht.«
»Da bin ich aber gespannt«, erwiderte das Mädchen.
»Zuallererst müsst ihr allerdings bereit sein, euch selbst zu helfen. Dazu gehört, dass ihr aufhört, euch nur als Opfer zu sehen. Ihr seid Opfer und Täter zugleich, habt anderen Leid zugefügt, habt nicht gegen die aufbegehrt, die euch verführten. Ihr habt euch verführen lassen und euch anschließend an schwächere Opfer gehalten, um euch zu rächen. Es liegt zu einem guten Teil an euch selber, die Misere zu beenden.«
»Aber wie?«, rief ein anderer Junge.
Henri taxierte mit einem Blick die Menge, die sich inzwischen um ihn gesammelt hatte. »Ihr seid ungefähr hundert. Wir gehen jetzt zum Kloster der Franziskaner, dort gibt es jeden Tag eine Armenspeisung. Habt ihr das nicht gewusst? Es gibt vielleicht nur Haferbrei, aber das ist besser als nichts. Wenn ihr gegessen habt, könnt ihr euch dort nützlich machen. Dann sehen wir weiter.«
»Wären wir doch mit den anderen Kindern auf den Barken davongesegelt!«, rief ein Mädchen. »Dann ginge es uns jetzt besser.«
Henri wurde bei diesen Worten geradezu schmerzlich bewusst, dass sie noch immer nichts begriffen hatten.
*
In der Stadt schlossen sich ihnen weitere zerlumpte, verlauste und bettelnde Kinder an. Wer noch bei Kräften gewesen war, als er von Bord ging, hatte Aigues-Mortes in Richtung Norden verlassen – dorthin, wo die Sümpfe der Camargue warteten. Die anderen vegetierten innerhalb der Stadtmauern vor sich hin. Einige schienen so schwach, dass sie nur auf ihr Ende warten konnten. Sie hockten apathisch auf dem Erdboden und starrten aus tief liegenden Augen vor sich hin. Die Einwohner Aigus-Mortes' waren nicht bereit, ihnen zu helfen. Die einzige Kirche des Ortes war verrammelt, weil zwei Opferstöcke geplündert worden waren. Nur eine barmherzige Schwester ging umher und teilte aus einem Bottich sauberes Wasser aus.
Ein Junge mit Pusteln im Gesicht trat plötzlich hinter Henri, fuhr mit beiden Händen in seine Umhangtaschen und wühlte blitzschnell darin herum. Henri musste den kleinen Dieb abklauben wie einen Blutegel. Manche Halbwüchsige stießen üble Drohungen aus, wenn ihnen die Erwachsenen nichts gaben und Flüche hinterherriefen. Aus Rache verrichteten die streunenden Kinder dann ihre Notdurft vor den Türen der Häuser und warfen Kothaufen in offene Fenster.
Henri fragte sich, wie lange es noch dauern würde, bis sich eine Wehr bildete, die die Kinder mit Waffengewalt aus Aigues-Mortes hinaustreiben würde. Wenn es so weit kommen sollte, konnte man nur hoffen, die Kinder würden ins Landesinnere getrieben und nicht in Richtung offenes Meer.
Im Kloster war von all diesen Widrigkeiten nichts zu spüren, und bis hierhin drang auch nicht der üble Geruch, den die Kinder verströmten. Inzwischen lagen hier und dort Kinderleichen am Straßenrand, und niemand wagte es, sie anzufassen. Der zuständige Stadtschultheiß von Aigues-Mortes weigerte sich, seine Büttel auszuschicken. Diese toten Körper waren unheimlich. Die Kirche sorgte sich nicht um sie. Und niemand wusste mit Gewissheit zu sagen, ob sie als vom Teufel besessen oder heilig anzusehen waren. Bei dem mildem Winterwetter wurde der Verwesungsgestank mit jedem Tag unerträglicher.
Henri war seltsam zumute, als er die Kinderschar in den Klostergarten hineingeleitete. Die Franziskaner standen in ihren weißen Kutten da, die Hände im weiten Ärmel ihres Rocks verschränkt, und sahen dem sonderbaren Treiben zu. Sie hatten die Klostertore geöffnet, aber was war, wenn die Kinder nicht freiwillig wieder gehen würden?
Henri blickte umher, immer wieder sah er in große Kinderaugen. In einigen stand die nackte Angst. Andere drückten Hilflosigkeit aus. Sie schienen darum zu betteln, dass jemand kam, sie an die Hand nahm und ihnen sagte, dass jetzt alles gut würde. Aber das konnte Henri nicht. Das Mädchen und der Halbwüchsige, mit denen er vorhin gesprochen hatte, drängten sich dicht an ihn. Sie war sechzehn und hieß Bettie, eine Vollwaise aus Caen, er hieß Jean und war ein Jahr älter, ein Dieb aus Belfort. Für beide war es einerlei, ob sie hier oder dort waren. Sie hofften nichts mehr für ihr trostloses Leben. Sie wollten nur den nächsten Tag überleben.
»Wozu sich erinnern, wie's früher war?«, meinte Jean verächtlich. »Kann man sowieso nicht ändern.«
»Das stimmt schon«, entgegnete Henri, »aber manches wird mitunter etwas verständlicher, wenn man es sich noch einmal vor Augen führt. Man kann daraus lernen.«
»Ach was, Priestergewäsch!«
Henri wollte etwas Strenges erwidern, ließ es aber sein. Du wirst dich nicht auch noch mit diesen Elendsgestalten streiten!, wies er sich selbst zurecht. Hier war eine Generation Kinder versammelt, die keinerlei Erziehung genossen hatte, die nur noch voller Verachtung und Enttäuschung war.
Die Klosterbrüder gesellten sich zu ihnen und sprachen vom Dienst am Nächsten. Von Liebe und Mitmenschlichkeit. Als jemand auflachte, war das für Henri wie ein Messerstich. Was war in diesen jungen Herzen alles zerstört worden, unwiderruflich. Es war zum Verzweifeln.
Er schwor sich, gegen die Kreuzprediger vorzugehen. Wenn es nach ihm ginge, würde es nie wieder einen Kreuzzug geben, erst recht keinen, an dem Kinder beteiligt waren.
*
Der Kardinal kam zu früh. Als er im Kloster eintraf, hielt er sich die Nase zu. Die Kinder, die im Dormitorium der Laien schlafen durften, wurden erst am darauf folgenden Tag gewaschen. Der Prior des Klosters führte den Kardinal, der sich keine Mühe gab zu verbergen, wie sehr ihn Dreck und Gestank anwiderten, zu ihnen.
Sein Kreuz hielt er nicht so, als wollte er damit den Segen erteilen, sondern wie ein Schild, um das Böse abzuwehren. Ohne die Kinder anzuschauen, begann der Kirchenmann eine Rede zu halten.
»Ihr werdet noch einmal hinausfahren!«, rief er mit tiefer, einnehmender Stimme, die einen Kontrast bildete zu dem unangenehmen Eindruck, den er sonst machte. »Nehmt das Kreuz und brecht mit den Schiffen auf! Es wird euer Schade nicht sein! Wir brauchen viele Kreuzfahrer! So viele wie möglich! Es wird das gewaltigste Heer werden, das je ins Heilige Land aufbrach! Seid Paladine der Kirche und macht das Heilige Land wieder zum Zentrum wahrer Christenheit!«
»Wir stürmen Jerusalem!«, schrie ein Junge mit rotblonden Haaren und Sommersprossen. Er war höchstens elf, seine Eltern waren von einem lothringischen Raubritter erschlagen worden.
»Wir brechen noch einmal auf!«, kreischte ein Mädchen. »Juchheissa nach Jerusalem! Wir kämpfen gegen echte Sarazenen!«
»Hört zu! Haltet ein!« Henri de Roslin war aufgestanden und hob die Arme. »Ihr versündigt euch. So zu denken und zu sprechen ziemt uns Christen nicht. Wir wollen die Menschen achten! Outremer, das Heilige Land, ist für uns für immer verloren! Versuchen wir lieber, in unserem eigenen Land zurechtzukommen! Es gibt so viel zu tun!«
Ein Junge lächelte versonnen. »Wie viel kostet ein Sarazenenmädchen? Ich will mir eins kaufen. Sie soll mir beibringen, wie man Liebe macht!«
Henri gab nicht auf. Die jungen Burschen blickten ihn aufsässig an. Aber er wusste, dahinter verbarg sich Enttäuschung.
Der Kardinal rief: »Ihr entscheidet über das Wohl und Wehe des himmlischen Jerusalems! Gottes Willen auf Erden geschehen zu lassen, liegt allein bei euch! Mit euren Händen, Armen und Füßen, mit eurem Leib und eurem Verstand wird die heilige Erde Palästinas gerettet werden!«
Ich sollte ihn aus dem Kloster werfen, dachte Henri grimmig. Ein alter Mann, der Kinder in den Tod hetzt – sollte das in einem Kloster geduldet werden? Henri blickte in die Gesichter der umstehenden Mönche. Er sah Zurückhaltung und Skepsis, aber von den Franziskanern war nicht zu erwarten, dass sie den Kardinal von Nimes in seine Schranken wiesen. Henri rief:
»Kardinal! Bevor eines dieser Kinder auch nur einen Fuß auf ein Kreuzfahrerschiff setzt, müssen wir dafür sorgen, dass keines mehr hier schon jämmerlich krepiert. Habt Ihr die Leichen auf den Straßen gesehen? Welch eine traurige, verkommene Stadt ist Aigues-Mortes! Wir versündigen uns alle, wenn wir diese schwachen Kinder auf die Reise schicken! Gebt ihnen zu essen und zu trinken, heilt ihre Geschwüre und Leiden – wenn sie gesund und stark sind, können sie entscheiden, was sie tun wollen. Aber mit solchen erbarmungswürdigen Gestalten kann man keinen Kreuzzug führen!«
»Schweigt!«, donnerte der Kreuzprediger des Kardinals. »Wie könnt Ihr es wagen, Kaufmann? Wir lassen Euch in den Turm der Stadt werfen!«
»Ihr werft mich nirgendwohin, Priester! Hole Euch der Teufel! Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ich dulde, dass die Kirche auch nur ein einziges Kind ins Verderben schickt! Ihr seid es, Ihr, die sich rechtfertigen müssen für die Irrwege, die Ihr beschreitet! Ihr allein werdet zur Verantwortung gezogen, und nicht erst am Tag des Jüngsten Gerichtes, wenn auch nur ein einziges Kind stirbt!«
Der Kreuzpriester, der dazu neigte, zu erröten, wenn er sich aufregte, war kreidebleich geworden, seine Lippen zitterten. Er fand keine Worte mehr. Sein Kardinal legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte ruhig zu Henri gewandt:
»Mein Sohn, ich begreife, Ihr seid in Sorge wegen der Kinder. Und das ist auch gut so, heißt es doch: Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich! Aber versteht doch, mein Sohn, bevor sie in das Himmelreich eintreten dürfen, müssen sie sich um die Christenheit verdient machen. Versteht Ihr? Sie müssen uns den Weg ebnen, damit wir triumphierend über den roten Teppich in das Heilige Land einziehen können. Die Kinder sind unsere Paladine, wir sind die himmlischen Fürsten!«
»Kardinal«, sagte Henri, »Kardinal! ...« Er wusste nicht weiter. Dieser Kirchenmann begriff nichts.. Blind und taub für das Leid anderer, klammerte er sich an seine Glaubenssätze. Dass er drauf und dran war, Unschuldige zu opfern für eine wahnsinnige Idee, die zum Scheitern verurteilt war, wie sollte man das verstehen?
Der Prior des Klosters hob die Hand. »Meine Brüder!«, sagte er, »lasst uns nicht streiten! Lasst uns lieber für die Speisung dieser verirrten Kinder sorgen. Und danach lesen wir eine Messe. Im Wort Gottes allein sind wir vereint. Nicht in den Worten der Menschen.«
»Das ist gewiss wahr«, sagte der Kardinal aus Nimes. »Und die Kinder sollen sich waschen.«
Die Mönche leiten die Kinder an. Sie durften sich am Klosterbrunnen, den eine tiefe Quelle speiste, Gesicht, Hals und Hände waschen. Dann wurde die Klappe zur Armenspeisung geöffnet, und jeder bekam einen Holzteller mit einer dampfenden, köstlich riechenden Suppe.
Der Kardinal stand dabei, verfolgte das Schauspiel und lächelte freundlich. Zu seinem Kreuzprediger sagte er leise: »Mich gelüstet eher nach einem Fleischtopf, mit einem Duft nach Poleiminze und Fenchel, große Stücke umgeben von Rainfarnblättern, Spikenarde und in Wein getränkten Nelken. Ich kenne eine Gaststube, die solches vorzüglich zubereitet. Am Abend will ich unbedingt dorthin gehen und speisen.«
»Auch die Franziskaner dieses Klosters verstehen sich durchaus auf eine gute Küche«, sagte der Kreuzprediger. »Mir selbst wurde einmal ein Mahl zuteil, das mir der Prior auf einer silbernen Platte servierte. Ich hätte mich allein am Duft sättigen können, so wunderbar war dieser.«
»Woraus bestand die Speise?«
»Aus zarten Fleischstücken von erlesenem Geflügel, in einer Glasschale mit außergewöhnlichem Wein gedämpft, dazu wurden verschiedene Arten Gemüse gereicht, die mit Schossenhonig aus Tannenspitzen übergossen waren.«
»Mein Lieber, mein Lieber«, sagte der Kardinal voll Anerkennung. »Gewiss, Ihr seid kein Kostverächter!«
Die beiden Kirchenmänner standen weiterhin nebeneinander und sahen dem Treiben der Kinder zu. Die Speisung ging zügig voran, fast alle Kinder versuchten, sich einen zweiten Teller Suppe zu ergattern. Henri de Roslin half dem Küchennovizen, die Suppe auf die Teller zu schöpfen. Der Kardinal segnete die Suppe.
»Allerdings waren die Tischmanieren der Mönche sehr gewöhnungsbedürftig«, sagte der Kreuzprediger gedankenverloren.
»Das ist immer so, wenn man sie nicht zur Mäßigung mahnt.«
Der Priester stöhnte in der Erinnerung auf. »Sie wiegten an der Tafel ihre Köpfe hin und her, streckten die Arme aus, rollten mit den Augen, vollführten widerwärtige Bewegungen und schlangen das Essen geräuschvoll hinunter. Sie hechelten und ächzten und versuchten mit fürchterlichen Anstrengungen, ihren Schlund noch weiter aufzureißen, als ob er zu eng sei, um die Gier rasch genug stillen zu können ...«
Der Kardinal gab ein glucksendes Lachen von sich.
»Einige schienen an außergewöhnlichen Krankheiten zu leiden, die nur durch eine Menge und köstlicher Leckerbissen geheilt werden mochten. Sie redeten bei der Tafel über Verdauungsbeschwerden, Brustbeklemmungen und Schwindelanfälle, alles Vorwände, um an Delikatessen zu kommen, die möglichst fett waren. Ihr zügelloser Appetit verlangte unentwegt nach Abwechslung und Raffinesse bei der Zubereitung der Speisen. Sie übertönten sogar den Vorleser, dessen Stimme völlig unterging. Sie kamen mir damals vor wie eine Horde schwangerer Weiber, die ihren seltsamen Gelüsten nachgaben.«
»Ach«, seufzte der Kardinal, »dürfte ich mich doch augenblicklich zu ihnen setzen und ihre Genüsse teilen.«
Der Kreuzprediger blickte ihn einen Moment lang befremdet von der Seite an. Dann sagte er: »Erbarmen mit den Hungernden! Erbarmen mit denen, die nicht von einem guten Koch geliebt werden. Aber schauen wir den Kindern zu, seht Ihr, wie gierig sie löffeln? Sie sind ebenso unmäßig wie die Konventualen. Allein aus diesem Grund wird ihnen die Buße der Kreuzfahrt nicht schaden.«
Henri de Roslin hatte die letzte Kelle Suppe aus dem Kessel geschöpft. Er selbst verspürte keinen Hunger. Ein anderes, fast väterliches Gefühl machte sich in ihm breit. Er war glücklich, den hungernden Kindern für einen Moment helfen zu können. Manchmal genügen kleine Gesten, dachte er. Und die großen Phrasen schweigen dann.
In seine Gedanken hinein drang ein Geschrei, das von außerhalb der Klostermauern kam. Stimmen wurden laut und lauter, immer mehr Stimmen. Alle Anwesenden, außer den essenden Kindern, drehten unwillkürlich die Köpfe herum. Dann stürmte ein Novize in das Refektorium und rief:
»Die Barken sind wieder da! Die Barken sind zurück! Die Kinder kommen aus Jerusalem!«
2
Winter 1316, das Fest der unschuldigen Kinder
Henri war allein in der Stadtkirche. Er hatte sich auf die kalten Steine des Mittelschiffs der Basilika gelegt, die Arme ausgebreitet, das Gesicht zur Seite gedreht und betete. Er sah den Heiland am Kreuz über sich nicht, aber er spürte seine Gegenwart.
Sie vermuten in jedem neugeborenen Kind einen Gegner, dachte er. So ist es heute, wenn ein Kardinal die Kinder in eine aussichtslose Schlacht schickt, so war es damals. Als die Weisen aus dem Osten Herodes von dem Neugeborenen in Bethlehem berichteten, sah er seinen Thron gefährdet, seine Herrschaft wanken. Der alte Mann schmiedete sofort einen tödlichen Plan. Er kannte keine Skrupel und befahl, alle Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem töten zu lassen. Er wollte sichergehen. Es war ihm einerlei, ob Tausende Unschuldiger starben, von denen nicht die geringste Gefahr für ihn ausging.
Es war ein trauriges Fest der wahllos Getöteten, heute können wir nur um Vergebung bitten, wenn erneut unschuldige Kinder in den Tod geschickt werden.
Sie sind wie Herodes, dachte Henri entsetzt, unsere Kirchenführer, die doch in Sorge und Liebe um uns sein müssten, in Wahrheit jedoch liefern sie uns den Feinden aus.
Ich schweife ab, dachte Henri und bewegte sich leicht auf den kalten Steinen, deren unebene Kanten hart gegen seinen Körper drückten. Dachte ich nicht eben eher an Papst Clemens, der uns Templer von einem Tag auf den anderen fallen ließ und uns den Folterbänken überantwortete?
Auch wir brauchten damals einen Vater, zu dem wir aufsahen. Welch schändliche Tat! Wir haben ihm wie einem Vater vertraut, und er hetzte gedungene Mörder auf uns!
Und geht es den Kindern in Aigues-Mortes nicht ebenso? Haben sie nicht den Propheten vertraut, die ihnen sagten, sie müssten durch das sich vor ihnen teilende Meer nach Jerusalem aufbrechen, um das Abendland zu befreien und das Heilige Land zu erobern? Und was haben sie jetzt davon? Schmach, Krankheit, Hunger und Tod.
Wir haben die Kinder verraten wie einst Herodes, dachte Henri. Und der Kardinal aus Nimes trägt das Gewand des Heiligen, wäscht seine Hände in Unschuld und befiehlt, die Kinder zu töten. Nein, nicht mit Dolch und Schwert. Dazu würde er nie aufrufen. Aber durch Strapazen und Gefahr. Er liefert sie einem absolut vorhersehbaren Schicksal aus.
Das Jahr neigt sich dem Ende, dachte Henri. Gebe Gott, dass es kein Ende mit Schrecken ist. Dafür muss ich sorgen. Herr, stehe mir bei!
Er erhob sich nach einer Weile. Im Angesicht der brennenden Kerzen schlug er seine Kreuze. Der Glaube allein ist das Bindeglied zwischen den Menschen und Gott, dachte er. Wenn der Glaube nicht trägt, wenn er missbraucht und verraten wird, gerät die Welt aus den Fugen.
Und wenn Kirchenmänner es sind, die den Glauben aushöhlen, indem sie Vertrauen zerstören, dann ist es besonders schlimm. Und dann muss unsere Fürsorge desto strenger sein. Und die Bestrafung der Verantwortlichen, der Schuldigen, darf keine Gnade kennen.
Gott stehe uns allen bei!
*