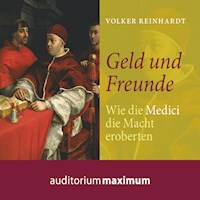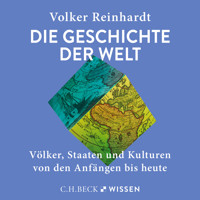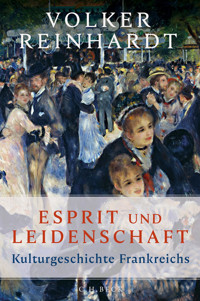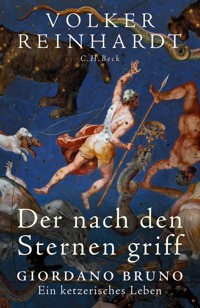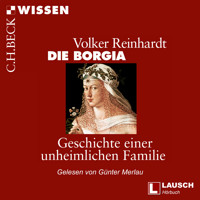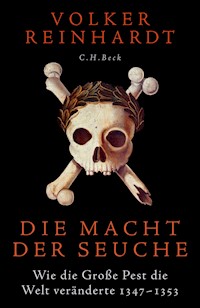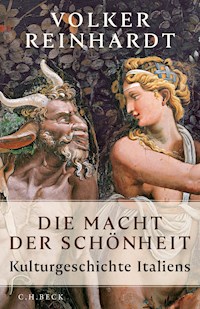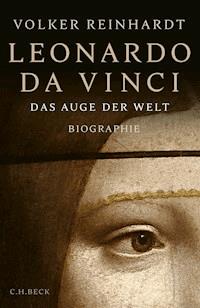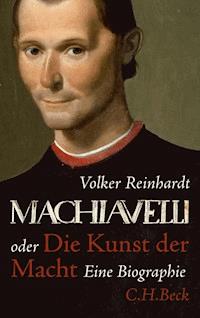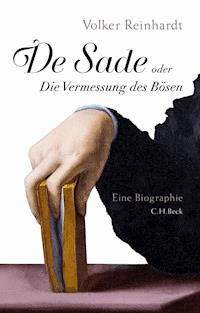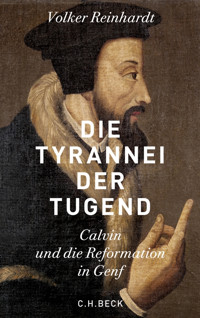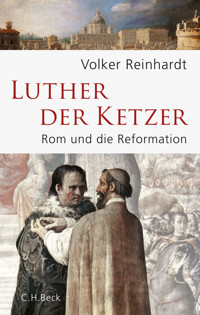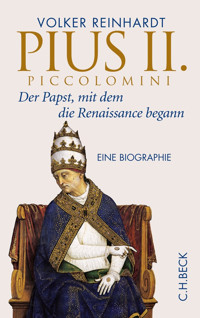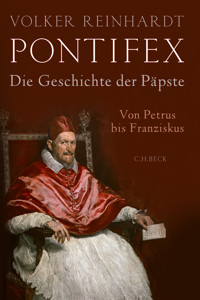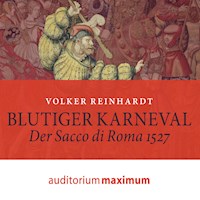9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Menschen ist seit ihrer Sesshaftwerdung ein Mosaik aus Völkern und Reichen, die entstehen und vergehen, aus Religionen und Kulturen, die den politischen Niedergang überdauern – oder auch nicht. Trotzdem lassen sich, wie Volker Reinhardt zeigt, große Linien und Wendepunkte erkennen. Er erklärt, wie vor rund 5000 Jahren die ersten Reiche entstanden, welche Errungenschaften Bestand hatten, wo sich Wege friedlich oder kriegerisch kreuzten und wo es, etwa in Afrika und Südamerika, zu eigenständigen Entwicklungen kam. Als sich vor gut 500 Jahren Kaufleute, Könige und Konquistadoren von Europa aus aufmachten, die Welt zu erobern, begann eine Globalisierung von Wirtschaft, Kultur und Politik im Namen des Fortschritts und im Zeichen der Gewalt, die auch noch die vernetzte und polarisierte Welt der Gegenwart prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Volker Reinhardt
DIE GESCHICHTE DER WELT
Völker, Staaten und Kulturenvon den Anfängen bis heute
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Wie schreibt man die Geschichte der Welt?
1. Von der Steinzeit zu den frühen Hochkulturen – Bis 500 v. Chr.
Der weite Weg zur Zivilisation
Frühe Reiche von Mesopotamien bis Austronesien
Sechs Formen des Neuen
2. Neue Götter, Reiche und Ideen – 500 v. Chr. – 700 n. Chr.
Demokratie und Philosophie
Erlösung und Pflichterfüllung
Neue Imperien: Rom, China, Mittelamerika, Afrika
Neue Religionen, neue Völker
3. Kreuzungspunkte und Konflikte – 700–1450
Ein langer ruhiger Fluss
Neue Mächte und neue Zentren bis 1100
Beschleunigung, Krisen und Konflikte ab 1100
4. Europäische Expansion und Globalisierung – 1450–1914
Grundlagen der Expansion
Neue Seewege nach Afrika, Asien und Amerika
Spanische Kolonisation
Konfessionen, Kriege, Kolonien
Naturwissenschaft und Hexenverfolgung
Aufklärung und Revolutionen
Nationalstaat, Nationalismus und industrielle Revolution
Imperialismus und Sozialismus
5. Das tödliche Jahrhundert – 1914–2025
Weltkriege und totalitäre Staaten
Die vernetzte und die polarisierte Welt
Zum Buch
Vita
Impressum
Wie schreibt man die Geschichte der Welt?
Wer die vor 37.000 Jahren gemalten Tierbilder in der Chauvet-Höhle gesehen hat, möchte Fragen stellen: Warum habt ihr das gemalt, zu kultischen Zwecken, um Wild zu verzaubern, aus Spaß oder zur Selbstvergewisserung und Selbstfindung? Es ist ein elementarer Wunsch des Menschen, in die Geschichte einzutauchen und auf Zeitreise zu gehen. Doch er ist fast so kühn wie der Wunsch nach Unsterblichkeit. Dass die Vergangenheit nicht wie die Mücke im Bernstein erhalten geblieben ist und nicht wiedererlebt werden kann, ist eine der vielen existenziellen Enttäuschungen des Menschen. Geschichtsschreibung war und ist daher ein Ersatz für etwas für immer Verlorenes: die Vergangenheit.
Die drängendste Frage, die Menschen seit je an die Geschichte stellen, ist die nach dem Sinn: Wozu das verwirrende Spektakel aufsteigender und niedergehender Reiche, blühender und welkender Kulturen? Das macht Geschichte zu einer gefährdeten und gefährlichen Wissenschaft. Gefährdet ist sie, weil sie permanent Fragen beantworten soll, die sie nicht beantworten darf, wenn sie Wissenschaft sein will, etwa: Wie geht es weiter, in welche Richtung bewegt sich die Geschichte, was ist ihr Ziel? Und, untrennbar damit verbunden: Was müssen wir tun, damit die Geschichte dieses Ziel erreicht? Geschichte als Wissenschaft ist dazu verurteilt, zurückzublicken und zu erklären, wie und warum die Gegenwart das geworden ist, was sie ist.
Seit den frühesten Mythen über den Ursprung der Welt haben sich verschiedene Modelle herausgebildet, um den Lauf der Geschichte zu deuten. Für Juden, Christen und Muslime steuert die Zeit auf ihr Ende und ein damit verbundenes Weltgericht zu, in dem nur die Gerechten auf Rettung hoffen dürfen. Mit dieser Endzeiterwartung war und ist häufig die Vorstellung von einem Niedergang und Verfall, vor allem in moralischer Hinsicht, verknüpft. Auch eine kreisförmige, von ewiger Wiederholung der Substanz bei wechselnden Erscheinungsformen im Einzelnen geprägte Bahn der Zeit war und ist vorstellbar, vor allem in den großen asiatischen Erlösungsreligionen. In der europäischen Aufklärung glaubten die einflussreichsten Historiker an einen zwar durch viele Rückfälle unterbrochenen und verzögerten, aber dennoch unaufhaltsamen Fortschritt. Dieser bestand für sie in der wissenschaftlichen Erfassung der Welt und im Aufstieg zu höheren Graden der Humanität. Um dieselbe Zeit brandmarkte der Genfer Gegen-Denker Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) die Zivilisation als Entfremdung des Menschen von sich und der Natur, konstruierte also einen zutiefst negativen Verlauf der Geschichte. Im 19. und 20. Jahrhundert verbreitete sich eine marxistische Spielart des Fortschrittsglaubens, nach der am Ende einer gesetzmäßigen Folge von Klassenkämpfen und Revolutionen eine egalitäre und befreite Gesellschaft steht.
Im Gegensatz zu solchen endzeitlichen Modellen hat der italienische Historiker Francesco Guicciardini (1483–1540) Geschichte als Aufbruch ins Unbekannte verstanden, was sowohl die Übernahme von Rezepten und Lösungen der Vergangenheit wie Aussagen über die Zukunft kategorisch ausschließt. Das Zerstörerische, so Guicciardini, wird wie das Gute und mit diesem unauflöslich vermischt wiederkommen, aber nicht in Neuauflage, sondern in anderer, auch entgegengesetzter Gestalt. Obwohl sich diese Auffassung von Geschichte als Aufbruch ins Unbekannte als die einzig richtige erwiesen hat, wird sie bis heute auf breiter Front missachtet. Der Drang vieler Historiker, Ereignisse wie den Ukrainekrieg durch Vergleich mit früheren Krisen zu erklären und daraus politische Ratschläge abzuleiten, scheint übermächtig zu sein.
Geschichtsschreibung ist gefährdet und gefährlich zugleich, weil in ihr Menschen über Menschen schreiben, was immer mit Parteinahme verbunden ist, die umso stärker (und offensichtlicher) wird, je näher die beschriebene Zeit der Gegenwart der Schreibenden steht. Historiker müssen sich dieser Gefahr bewusst sein und ihr entgegenwirken, aber gänzlich unterdrücken lässt sie sich nicht, denn auch und gerade die Geschichtswissenschaft ist immer vom Zeitgeist infiziert. Wissenschaftliche Geschichte gibt es daher immer nur in Annäherungen. Das hat viel damit zu tun, dass Geschichte mehr ist als die Rekonstruktion einer chaotischen Folge von Ereignissen. Wer Geschichte schreibt, muss Zusammenhänge erklären, Wendepunkte und treibende Kräfte definieren und Entwicklungsphasen voneinander abgrenzen, auch wenn sich die Geschichte als ein großes Fließen letztlich jeder Einteilung in präzise datierbare und definierbare «Epochen» entzieht. Mit einem Wort: Er muss Deutungen wagen.
Es gibt verschiedene Ansätze, die globale Geschichte durch gemeinsame Merkmale ihres Verlaufs zu erfassen und zu klassifizieren, ohne daran Vorhersagen und Werte zu knüpfen. Ein großer Entwurf dieser Art ist das aus der europäischen Vergangenheit abgeleitete, aber bewusst auch auf außereuropäische Länder und Kulturen anwendbare Modell des neapolitanischen Kulturhistorikers Giovanni Battista Vico (1668–1744). Vico ging davon aus, dass die Menschen aller Erdteile gleich beschaffen sind und daher die historische Zeit mit denselben Etappen, allerdings in einem unterschiedlichen Rhythmus durchmessen: Zuerst kommt eine lange Phase der mystischen Zuschreibung aller großen Wirkungen an göttliche Mächte, dann eine Zeitspanne, in der sich aristokratische Individuen als Herren der Geschichte verstehen, und schließlich der Durchbruch zur Dominanz der Masse, die sich nach langer Bevormundung und Unterdrückung als die geschichtsgestaltende Kraft herausbildet und versteht. Globale Geschichtsdeutungen der Moderne wie Max Webers Entzauberung der Welt und Norbert Elias’ Prozess der Zivilisation stehen in Vicos Nachfolge.
Will man Elias’ Begriff vom Prozess der Zivilisation auf die Geschichte der Welt beziehen, muss man ihn im Plural verwenden. Denn Zivilisationsprozesse verlaufen nicht nur in verschiedenen Räumen der Erde unterschiedlich, sondern auch innerhalb desselben Raumes und derselben Zeit in verschiedenen sozialen Gruppen. Zu dieser Erkenntnis gelangte schon der französische Philosoph und Historiker Voltaire (1694–1778) mit der scharfsichtigen Diagnose, dass einige Dutzend Kilometer von Paris entfernt die ländliche Bevölkerung in vormodernen, ja vorchristlichen Vorstellungswelten verhaftet lebt, während in der Hauptstadt die Aufklärung und mit ihr wissenschaftliches Denken Triumphe feiert. Eine solche Feststellung könnte im Jahr 2025 für viele Weltgegenden getroffen werden. Kontrovers diskutiert wird ohnehin, was als Maßstab für Fortschritt gelten soll. Der französische Soziologe Emmanuel Todd bemisst ihn an der Komplexität der Verwandtschaftsverhältnisse und Heiratsregeln. Moderne Gesellschaften mit ihren Kleinfamilien sind demnach viel «archaischer» als vermeintlich «traditionelle». Weltgeschichte und die kaum überschaubare Fülle ihrer Erscheinungsformen nach unterschiedlichen Verlaufsprozessen zu ordnen, zu sortieren und zu deuten, wie es im Folgenden geschieht, heißt ausdrücklich, auf Wertungen zu verzichten, nicht «Rückständigkeiten» oder Defizite auszumessen, sondern Diversität in all ihrer Vielfalt zu konstatieren.
Zur Dynamik des historischen Wandels haben Austausch und Konkurrenz entscheidend beigetragen. Weltgeschichte ist immer auch eine Erzählung von Kommunikation, Handel und Migrationen und den damit verbundenen Anregungen und Bereicherungen, Austauschprozessen, Konflikten und Horizonterweiterungen, aber ebenso handelt sie von Eroberungen, Verdrängungen, Überlagerungen, Unterdrückungen und Vernichtungen. Die Weltgeschichte der Zivilisation und ihrer Prozesse ist daher immer auch eine Geschichte der Zerstörung gewachsener Lebensformen nach dem Gesetz des Stärkeren, so sehr das nach den ethischen Standpunkten des 21. Jahrhunderts auch zu bedauern ist. Versucht man schematisch, die Faktoren zu sortieren, die historischen Wandel bewirken, so entsteht der Staat ganz überwiegend im Interesse von schmalen Führungsschichten, die gegen den Widerstand der Masse ihre Macht steigern. Revolutionen gehen am häufigsten aus den Bestrebungen bislang blockierter Sekundäreliten hervor, die Anteil an dieser Macht oder diese Macht für sich allein wollen und sich zu diesem Zweck als Sachwalter der unteren Klassen ausgeben, die selbst nie an die Macht gelangen. Auch Religionen mit ihren Vorstellungen von einer universalen, im Übernatürlichen verankerten sinngebenden Ordnung sind Faktoren der Stabilisierung oder der Neuverteilung von Macht.
Umso herzerfrischender, was der niederländische Historiker und Journalist Rutger Bergman, Autor von Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit, im Menschen aufgefunden zu haben glaubt, nämlich überwiegend Lobenswertes wie Empathie und Altruismus. Ambivalenter klingt es bei Yuval Noah Harari in Eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen: Hier hat sich der Mensch zum irdischen Vizegott erhoben, ja er wird dieses «Vize» in Zukunft sogar streichen können, aber dann von seinen selbst erzeugten Schöpfungen der KI entmachtet werden, mit schlimmen und guten Folgen. So lesenswert, da phantasieanregend diese Texte sind, als wissenschaftliche Geschichte können sie nicht verstanden werden.
Von höchster Aktualität ist im 21. Jahrhundert vor allem eine Frage: Sind die herausragenden Resultate der europäischen Geschichtsentwicklung wie demokratische Politiksysteme, allgemeine Menschenrechte und Gleichstellung der Geschlechter auch für andere Weltgegenden verbindlich? Die Frage, ob es sich dabei um globale Errungenschaften handelt oder um Instrumente neokolonialistischer Unterdrückung anderer, gleichermaßen historisch gewachsener und damit legitimierter Kulturen, wird heute zwischen europäischen und außereuropäischen Historikern, Philosophen und Politikern kontrovers diskutiert. Der hier vorgelegte Versuch einer Weltgeschichte kann nicht mehr leisten, als das Basismaterial zu liefern, das es den Lesenden erlaubt, ihren eigenen fundierten Blick auf die Geschichte zu werfen.
1. Von der Steinzeit zu den frühen Hochkulturen
Bis 500 v. Chr.
Der weite Weg zur Zivilisation
Die schwersten narzisstischen Kränkungen trafen den Menschen spät. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts zeichnete sich für einen kleinen Kreis europäischer Gelehrter ab, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, sondern ein Himmelskörper unter ziemlich vielen anderen ist. Dieses «ziemlich viel» heißt heute: eher 200 Billionen als 200 Milliarden Galaxien, jede von diesen mit jeweils mehr als 200 Milliarden Sternen. Eine 70 mit 21, 22, 23 oder 24 Nullen ist das – vorläufige – Überschlagsresultat. Das sind – wie glaubwürdige Schätzungen ergeben – in jedem Fall mehr Himmelskörper, als es auf der Erde Sandkörner gibt. Der zweite Schock kam etwas später und betraf die Zeit. Alle frühen Kulturen hatten das Alter der Erde nach menschlichem Maß berechnet. Dabei kamen Maya, Chinesen und Europäer zu ähnlichen Ergebnissen und datierten die Entstehung des Planeten etwa 5000 bis 6000 Jahre zurück. Dass das nicht stimmen kann, zeigte sich am Studium der Fossilien. Heute wird das Alter der Erde auf viereinhalb Milliarden Jahre geschätzt. Der schwerste Schlag für das Selbstwertgefühl des Menschen als Krone der Schöpfung aber war 1859 Charles Darwins Entdeckung der Evolution. Darwin zeigte, dass der Mensch in einem langen Entwicklungsprozess der Primaten entstanden war, machte diesen und sich selbst also, wie empörte Reaktionen damals lauteten, zum Affen.
Selbst wenn man die Geschichte des Menschen mit dem Entwicklungsstadium des Homo erectus, des «aufrecht gehenden Menschen», der vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren in Afrika auftrat, beginnen lässt, ist er, erdgeschichtlich betrachtet, ein sehr spät Gekommener, ein Parvenü, und so benimmt er sich auch. Von Afrika dürfte der Homo erectus vor knapp zwei Millionen Jahren nach Asien ausgewandert sein, etwa 600.000 Jahre später auch nach Europa. Auch die letzte biologische Entwicklungsstufe zum Homo sapiens wurde vor etwa 200.000 Jahren zuerst in Afrika erreicht. Von dort breitete sich dieser etwa 80.000 Jahre später nach Asien und Europa aus, wo er auf die Entwicklungsform des (nach einem Tal bei Düsseldorf benannten) Homo neanderthalensis traf und nach neueren Forschungen mit diesem bis zu dessen Aussterben vor etwa 40.000 Jahren mehr oder weniger schiedlich-friedlich zusammenlebte, teilweise sogar genetisch verschmolz.
Als 1994 die Wandmalereien und Ritzzeichnungen von Tieren und Händen in der Grotte Chauvet im französischen Département Ardèche entdeckt und die ältesten davon auf 35.000 v. Chr. datiert wurden, erwies sich der künstlerisch tätige Mensch, also der (biologisch nicht bestimmbare) Homo creativus, schlagartig als um fast 20.000 Jahre älter als bis dahin angenommen. Inzwischen sind durch die Entdeckung von Höhlenmalereien mit ähnlichen Motiven auf der indonesischen Insel Sulawesi weitere fünfzehntausend schöpferische Jahre dazugekommen.
Das wichtigste der älteren Entwicklungsstadien ist der langsame Übergang des Menschen vom Dasein als Jäger und Sammler zu Sesshaftigkeit, Tierhaltung und Getreideanbau. Diese Entwicklung, die durch günstige klimatische und geographische Bedingungen gefördert wurde, war im «Zweistromland» Mesopotamien im westlichen Asien um 12.000 v. Chr., im vom Nil bewässerten Ägypten um 7000 v. Chr. und in Teilen Europas ab 5000 v. Chr. erreicht. In anderen Weltgegenden wie Australien blieb sie aufgrund unterschiedlicher Umweltfaktoren aus.
Weitere Periodisierungen der frühen Menschheitsgeschichte legen die Stufen der Metallverarbeitung zugrunde, wonach die Bronzezeit in Westasien und Mitteleuropa von 2200 bis 800 v. Chr. und die Eisenzeit danach weitere 800 Jahre dauerte. Die Verarbeitung von Metall, zum Beispiel von Kupfer und Zinn zu Bronze für die Herstellung von Waffen, hatte die Entwicklung weitgespannter Handelsbeziehungen zur Folge. Der stets mit dem Risiko schlechter Ernten verbundene Anbau von Feldfrüchten brachte Fruchtbarkeitskulte und mit ihnen frühe Formen von Religionen hervor.
Die hier zugrunde gelegte Gliederung lässt die nächste Etappe der Menschheitsgeschichte mit den frühesten Zeugnissen eines komplexer organisierten menschlichen Zusammenlebens in Städten einsetzen. Hier bildeten sich eine arbeitsteilige Ökonomie und soziale Hierarchien heraus, und hier entwickelten sich Herrschaftsformen und konkretere Vorstellungen von übernatürlichen Mächten, die als Belohnung für das Wohlverhalten der Menschen die Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung versprechen. Auf archäologisches Fundmaterial gestützte Theorien von einer «Donauzivilisation», die ein eigenes Schriftsystem und im Unterschied zu den vorderorientalischen Kulturen eine in mancher Hinsicht egalitäre Gesellschaft ausgebildet habe, ließen sich nicht erhärten.
So ist davon auszugehen, dass der nächste bedeutsame Entwicklungsschritt im Prozess der Zivilisation in Asien und Ägypten zwischen dem 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. vollzogen wurde, und zwar bei vielen Unterschieden im Einzelnen mit einer Reihe gemeinsamer Merkmale. Am Anfang steht, ähnlich wie von Vico angenommen, die imaginierte Präsenz des Göttlichen in der Welt. Deren Verehrung hat höchste Bedeutung, da nur so eine Harmonie zwischen Erde und Himmel erreicht werden kann; diese Vermittlung ist die wichtigste Aufgabe der Herrschenden. Tempel sind Behausungen der Götter und Göttinnen, die in Abspiegelung irdischer Rangverhältnisse eine hierarchisch geordnete Hofgesellschaft mit zahlreichen, genau definierten Zuständigkeiten bilden und mittels dieser «Ressortzuteilungen» helfend, aber bei Bedarf auch strafend in den Alltag der Sterblichen eingreifen. Solche Vorstellungen waren in Mesopotamien, dem fruchtbaren Gebiet zwischen Euphrat und Tigris, ab etwa 3500 v. Chr., in China ab 1600 v. Chr. verbreitet und bilden offenbar eine historische Konstante. Auch fromme Christen malten sich später die Gesellschaft des Himmels abgestuft, mit mehr oder weniger einflussreichen Heiligen und spezialisierten Nothelfern, aus.
Macht und Rang sind in den frühesten menschlichen Gemeinschaftsbildungen auf religiöse Rechtfertigung angewiesen. Herrscher schreiben sich entweder selbst göttliche Abstammung, unmittelbare Kommunikation mit den Unsterblichen oder, absolutes Minimum, Einsetzung durch göttliche Gnade zu. Das ist bis heute so geblieben. Charles III., seit 2023 Monarch des Vereinigten Königreichs, führt die Formel «by the Grace of God», von Gottes Gnaden, in seinem offiziellen Titel. Demokratien verzichten heute meist völlig auf göttliche Weihen der Regierenden. Gleichsam als Ersatz dafür werden demokratische Werte oft religiös überhöht, obwohl sie das aufgrund ihrer rationalen Ableitung gar nicht nötig haben.
Die frühen Einzelherrscher der Geschichte im Zweistromland und in Ägypten bedurften aufgrund ihrer religiösen Ableitung der sichtbaren Zeichen, die sie und ihre Macht ins Übermenschliche überhöhten. Diesem Zweck dienten erste Formen der Hofbildung und des Palastbaus sowie politisch-religiöse Zeremonien der Erhabenheit, die gegen Angriffe von außen und innen schützen sollen. Im Extremfall ging diese Verherrlichung so weit, dass wie im mesopotamischen Stadtstaat Ur um 2500 v. Chr. beim Tod einer Herrscherin die Gefolgschaft Gift schluckte, um zusammen mit der Verstorbenen in die von vielen frühen Religionen verheißene selige Ewigkeit einzutreten.
Die wirtschaftliche Grundlage für die Ausbildung von Herrschaft bestand in den von den Beherrschten zu entrichtenden Abgaben, was eine tragfähige Finanzverwaltung und eine Schicht von Amtsträgern voraussetzte, die sich im Zentrum konzentrierte und in der Peripherie kaum präsent war. Zu diesen Amtsträgern gehörte auch die Priesterschaft, die die göttlichen Vorzeichen erkennen und mit Opfern und Ritualen die himmlische und irdische Ordnung aufrechterhalten musste. Zu den kulturellen Höchstleistungen früher Reichsbildungen in Asien, Europa und dem heutigen Mittelamerika gehört die Astronomie, die sich von der Astrologie und magisch-religiösen Zweckbindungen erst im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts abzulösen begann und für die Legitimation des Herrschers, der sich als Herr des Kalenders und damit der Zeit präsentiert, sowie für landwirtschaftliche Zwecke von großer Bedeutung ist.
Herrschaftsbildung hieß vor allem Machtdurchsetzung nach innen. Diese Hegemonie wurde durch Gefolgschaftsverbände gewährleistet, deren Loyalität sich die Herrschenden durch Gewährung von sozialer Exklusivität und weiterer Privilegien sicherten. Herrschaftserweiterung vollzog sich durch Eroberung neuer Territorien, die Ausschaltung der besiegten Machthaber und ihrer Führungsschichten sowie durch wirtschaftliche Ausbeutung der geschlagenen und unterdrückten Völkerschaften. Herrschaftsbildung bedeutete jedoch nicht Staatsbildung. «Staatsgewalt», verstanden als Ausformung und Institutionalisierung von Ämtern und Ämterhierarchien, administrativen Zuständigkeiten, Dienstwegen und bürokratischen Strukturen, war in den alten Reichen des Orients, in Ägypten und im «vordynastischen» China nur in sehr frühen, gewissermaßen tastenden Entwicklungsstufen vorhanden.
Aus diesem Grund weisen alle frühen Reichsbildungen der Geschichte seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. ein gravierendes inneres Defizit auf: Sie sind regelmäßig durch innerdynastische Konflikte, durch Unruhen im Machtzentrum, durch Aufstände als Folge von Hungersnöten und Abgaben, durch Prestige- und Legitimierungsverluste des Herrschers sowie durch Angriffe von außen geschwächt und dann leicht zu stürzen, so dass sich ein neues Imperium über das alte schichtet.