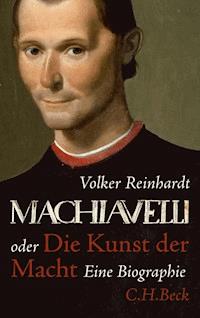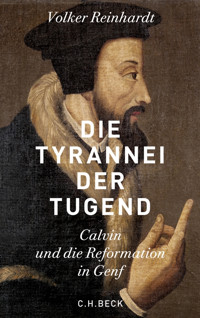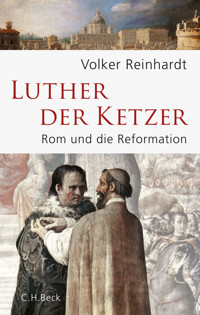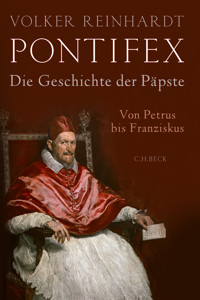21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leonardo da Vinci – Maler der Mona Lisa, visionärer Konstrukteur von Flugapparaten und Zeichner des ideal proportionierten Menschen – ist als prototypisches Universalgenie der Renaissance weltberühmt. Volker Reinhardt entdeckt demgegenüber einen Künstler, der vor allem gegen seine Zeit lebte: gegen die wortverliebten Humanisten, gegen das weltabgewandte Christentum, gegen den Glauben der Alchemisten an verborgene Kräfte der Natur. Für Leonardo galt nur, was das Auge sieht, und seine Mission war es, sehend, zeichnend und malend zum Auge der Welt zu werden. Leonardo wuchs in Florenz auf, arbeitete in der Werkstatt Verrocchios, als Hofkünstler in Mailand, als Kriegsingenieur Cesar e Borgias und verbrachte einen luxuriösen Lebensabend am Hof des französischen Königs. Die Stationen seines Lebens sind gut erforscht und doch voller Rätsel: Warum stellte er kaum ein Werk fertig und schrieb in Spiegelschrift? Wen stellt die Mona Lisa dar? Sind seine gebirgigen Hintergründe geheime Seelenlandschaften? Volker Reinhardt hat die von Kunsthistorikern vernachlässigten Notizbücher Leonardos neu gelesen und kann so quellenbasiert gängige Mutmaßungen über sein Leben und Werk korrigieren. Vor allem aber gibt er dem von allen vereinnahmten Außenseiter seine subversive Sperrigkeit zurück – und sein Geheimnis, denn die Aura des Mysteriums, mit der sich Leonardo selbst umgab, war, wie das profunde, glänzend geschriebene Buch zeigt, eines seiner erfolgreichsten Werke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
VOLKER REINHARDT
LEONARDO DA VINCI
Das Auge der Welt
Eine Biographie
C.H.BECK
ZUM BUCH
Leonardo da Vinci – Maler der Mona Lisa, visionärer Konstrukteur von Flugapparaten und Zeichner des ideal proportionierten Menschen – ist als prototypisches Universalgenie der Renaissance weltberühmt. Volker Reinhardt entdeckt demgegenüber einen Künstler, der vor allem gegen seine Zeit lebte: gegen die wortverliebten Humanisten, gegen das naturfeindliche Christentum, gegen den Glauben der Alchemisten an verborgene Kräfte der Natur. Für Leonardo galt nur, was das Auge sieht, und seine Mission war es, sehend, zeichnend und malend zum Auge der Welt zu werden.
Leonardo da Vinci (1452–1519) wuchs im Florenz der Medici auf, arbeitete in der Werkstatt des florentinischen Malers und Bildhauers Verrocchio, diente als Hofkünstler in Mailand, als Kriegsingenieur Cesare Borgias und verbrachte einen luxuriösen Lebensabend am Hof des kunstliebenden französischen Königs. Die Stationen seines Lebens sind gut erforscht und doch voller Rätsel: Warum stellte Leonardo kaum ein Werk fertig und schrieb in Spiegelschrift? Wen stellt die Mona Lisa dar? Sind seine gebirgigen Hintergründe geheime Seelenlandschaften? Volker Reinhardt hat die von Kunsthistorikern vernachlässigten Notizbücher Leonardos neu gelesen und kann so quellenbasiert gängige Mutmaßungen über sein Leben und Werk korrigieren. Vor allem aber gibt er dem von allen vereinnahmten Außenseiter seine subversive Sperrigkeit zurück – und sein Geheimnis, denn die Aura des Mysteriums, mit der sich Leonardo selbst umgab, war, wie das profunde, glänzend geschriebene Buch zeigt, eines seiner erfolgreichsten Werke.
ÜBER DEN AUTOR
Volker Reinhardt, Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg, gehört international zu den führenden Renaissance-Experten. Für seine Biographie «Machiavelli oder die Kunst der Macht» (C.H.Beck Paperback 2014) wurde er mit dem Golo-Mann-Preis für Geschichtsschreibung ausgezeichnet. Bei C.H.Beck erschienen von ihm zuletzt «Pontifex. Die Geschichte der Päpste» (2. Aufl. 2018) sowie «Luther, der Ketzer. Rom und die Reformation» (3. Aufl. 2016).
INHALT
VOR- UND NACHSATZ
DER UNBEKANNTE LEONARDO
ERSTES KAPITEL: VINCI UND FLORENZ – 1452–1481
Herkunft, Familie, frühe Prägungen
In der bottega Verrocchios
Maler in Florenz
Der fehlende Joseph und ein brüllender Löwe
ZWEITES KAPITEL: IM MAILAND DER SFORZA – 1482–1499
Von Florenz nach Mailand
Mailand und sein Herr
Verwirrspiel mit Madonna
Architektur und Herrschaft
Mailänder Zeitvertreib: Natur und Methode
Mailänder Zeitvertreib: Maschinen und andere Rätsel
Fatale Hochzeiten
Hermelin mit Dame
Herr der Feste
Das Teufelchen in der bottega
Der Herzog, das Pferd und die Politik
Das «Abendmahl»: Die Geschichte
Das «Abendmahl»: Das Drama
Wuchernde Wände und ein angeschlagener Kopf
DRITTES KAPITEL: AUF DER SUCHE NACH DEN KRÄFTEN DER NATUR
Noch eine Mätresse
Göttliche Proportionen
Die Unerschrockenheit des Anatomen
Von der Sterblichkeit der Seele
Die Sprache des Wissens
Der Traum vom Fliegen
Ein Fahrrad und diverse Kriegsgeräte
Lebende Pflanzen, versteinerte Muscheln
Theorie der Malerei
VIERTES KAPITEL: SPÄTE WANDERJAHRE – 1499–1513
Der vorübergehende Untergang des Hauses Sforza
Rückkehr nach Florenz
In Diensten Cesare Borgias
Ein Kanal für Florenz, eine Brücke für den Sultan
Der Kampf um die Standarte
Das Lächeln über die Entstehung der Welt
Zwischen Mailand und Florenz
Der Page
Die Ermordung des Lammes
Umsturz in Mailand und in Florenz
Schwanenbrut
Neue Anatomie
FÜNFTES KAPITEL: ROM UND AMBOISE – 1513–1519
Verloren im Vatikan
Spiegel und neue Perspektiven
Der lächelnde Täufer
Der Edelmann in seinem Schloss
Feste und Schlossbauten
Tödliche Fluten
Das Ende in Cloux
SECHSTES KAPITEL: DER WIEDERGEFUNDENE UND DER ERFUNDENE LEONARDO
ANHANG
VERZEICHNIS DER WICHTIGSTEN GEMÄLDE
ZEITTAFEL
KARTE
ANMERKUNGEN
DER UNBEKANNTE LEONARDO
Erstes Kapitel: VINCI UND FLORENZ
Zweites Kapitel: IM MAILAND DER SFORZA
Drittes Kapitel: AUF DER SUCHE NACH DEN KRÄFTEN DER NATUR
Viertes Kapitel: SPÄTE WANDERJAHRE
Fünftes Kapitel: ROM UND AMBOISE
Sechstes Kapitel: DER WIEDERGEFUNDENE UND DER ERFUNDENE LEONARDO
LITERATUR
Leonardos Manuskripte
Editionen
Wichtige Literatur zu Leonardo (Auswahl)
NACHWEIS DER BILDZITATE
Verwendete Bildquellen
PERSONENREGISTER
VOR- UND NACHSATZ
DER UNBEKANNTE LEONARDO
Schon zu Lebzeiten und mehr noch nach seinem Tod galt Leonardo den Wohlgesinnten und frommen Gemütern als verdächtig. «Seine Verrücktheiten gingen so weit, dass er beim Nachdenken über die Natur versuchte, die Eigenschaften der Kräuter zu verstehen sowie die Bewegung des Himmels und den Lauf des Mondes und der Sonne zu beobachten. Und dabei entwickelte er so ketzerische Vorstellungen, dass er jegliche Religiosität verlor und es in seiner Verwegenheit höher schätzte, Philosoph als Christ zu sein.»[1] In dieser Anklage gipfelt die Lebensbeschreibung Leonardo da Vincis, die Giorgio Vasari, Hofkünstler und künftiger «Kulturminister» des Großherzogs der Toskana, 1550 verfasste. Leonardo, der Ketzer, der in frevlerischer Selbstüberschätzung erkennen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, und sich durch diesen verderblichen Hochmut von Gott ab- und dem Bösen zuwendet: Das war acht Jahre nach Gründung der römischen Zentralinquisition eine massive und folgenschwere Anklage. Leonardo war zwar seit drei Jahrzehnten tot, doch einige seiner Schüler, Begleiter und Auftraggeber lebten noch. Sie alle mussten sich jetzt fragen, ob sie auf einen Gehilfen Satans hereingefallen waren. Wenn Vasari mit seiner Anklage Recht hatte, mussten die Werke des Glaubensfeindes unschädlich gemacht, also vernichtet werden.
In der zweiten Auflage von Vasaris Vitensammlung, die achtzehn Jahre später erschien, ist der inkriminierende Satz gestrichen. Sein Verfasser war offensichtlich zu weit gegangen: Leonardo hatte seinen Lebensabend schließlich ehrenvoll am Hofe des französischen Königs Franz I. verbracht, der sich als unerbittlicher Verfolger seiner protestantischen Untertanen beim Papst den Ruf eines standhaften Glaubenskämpfers erworben hatte. Doch von seiner Meinung in Sachen Leonardo rückte Vasari nicht ab, er formulierte sie nur geschickter. Auch in der zweiten, bereinigten Version seiner Biographie hat Leonardo auf dem Totenbett viel wiedergutzumachen: «Er machte deutlich, wie sehr er Gott und die Menschen dieser Welt dadurch beleidigt hatte, dass er in seiner Kunst nicht so gearbeitet hatte, wie es sich gehörte.»[2] Das klingt nach einem verbummelten Genie, das seine Begabung mit Nichtigkeiten vergeudet. Doch beleidigte man durch solche Tändeleien Gott? Auch in der entschärften Fassung bleibt unklar, ob es der «allergöttlichste Geist» (so Vasari 1568 über Leonardo) so mit Gott und der Religion hielt, wie es für einen guten Christen heiligste Pflicht war.
Das Bild von Leonardo als dem geheimnisvollen, rätselhaften, nicht ganz geheuren Verächter aller Werte, Normen und Regeln, der die Mächtigen mit seiner Faulheit und Nonchalance vor den Kopf stößt und nach verbotenem Wissen trachtet, entstand also schon zu Leonardos Lebzeiten, und es hat bis heute Konjunktur. Leonardo gilt als der Meister-Ingenieur, der mit seinen kühnen Erfindungen wie Helikopter und Unterseeboot Jahrhunderte überspringt, und als der Anatom, der unerschrocken die verborgensten Winkel des menschlichen Körpers mit dem sezierenden Skalpell erforscht. Und er fasziniert als Eingeweihter, der die uralten Weisheiten verbotener Sekten erforscht hat und weitergibt.
Doch das ebenso profitträchtige wie gefährliche Handeln mit Geheimwissen war gerade nicht Leonardos Sache. Für Alchemisten und Wundermänner aller Art hatte er nur Hohn und Spott übrig. Die selbsternannten Silber- und Goldmacher erzielten durch die Zufallserfindung nützlicher Nebendinge bestenfalls Glückstreffer; Schöpfungen hervorbringen konnte für Leonardo allein die Natur, und sie folgte festen, unveränderlichen Regeln, die es zu entdecken galt. Die Möchtegern-Zauberer behaupteten, mit Formeln, die ihnen allein zugänglich waren, die Natur zu überlisten und zu übertreffen, und ließen sich dieses angeblich exklusive Wissen teuer bezahlen. Leonardo hingegen machte seine Beobachtungen sichtbar und nachvollziehbar: durch Zehntausende von Zeichnungen, die mit ihrer Anschaulichkeit und Dramatik unerreicht geblieben sind und die Menschen bis heute bewegen. In seiner lebenslangen Suche nach den gestaltenden und zerstörenden Kräften der Natur hatte selbst das Wunder keinen Platz mehr, das im Christentum zum Beweis von Heiligkeit und Gottesnähe unverzichtbar ist. Wer sich wie die Mönche darauf berief, stellte sich an die Seite der Betrüger, die dem dummen Volk weismachen wollten, die Mysterien der Welt entdeckt zu haben und dadurch die Natur zu beherrschen.
Durch seine Frontstellung gegen Frömmigkeit und Kirche, aber auch gegen florierende Geheimlehren wie Magie, Alchemie und Astrologie gab Leonardo seinen Zeitgenossen Rätsel auf. Seine Malerei brach ebenso radikal mit Traditionen und Konventionen. In seiner unvollendeten «Anbetung der heiligen drei Könige» suchten die frommen Betrachter vergeblich nach Joseph, dem Ziehvater Jesu. Noch viel größere Verwirrung musste sein Gemälde der «Heiligen Anna selbdritt» stiften. Hier erscheint der künftige Erlöser in der liebevollen Gesellschaft seiner Großmutter und Mutter als trotziger und ungebärdiger Knabe, der einem unschuldigen Lämmchen so lustvoll das Genick bricht, dass man es geradezu knacken zu hören meint. Auch in Leonardos viel bewundertem Hauptwerk, dem «Abendmahl» im mailändischen Kloster Santa Maria delle Grazie, fehlte es nicht an Irritationen. Auf diesem monumentalen Wandbild hat Christus seinen Jüngern soeben die verstörende Mitteilung gemacht, dass einer von ihnen ein Verräter sei und seinen Herrn ans Messer liefern werde. Daraufhin herrscht unter den Aposteln heller Aufruhr: Ich bin es nicht, wer ist es dann? Diese alles entscheidende Frage aber bleibt unbeantwortet. In konventionellen Darstellungen des Themas saß Judas am Tisch der Jünger isoliert und war damit als Abtrünniger erkennbar. Bei Leonardo aber hat sich das Böse unter das Heilige gemischt und ist nicht von diesem zu unterscheiden. Was wollte der Künstler damit sagen? Dass es keine Unterschiede zwischen Gut und Böse gibt? Dass Christus nur ein Mensch ist, dessen naives Vertrauen auf die Treue seiner Anhänger grausam bestraft wird? War es diese radikale Vermenschlichung des Übernatürlichen, die Vasari mit seinem Vorwurf der Ketzerei meinte?
Rätsel formulierte Leonardo auch in Worten. Solche Ratespiele gehörten an sich zur Unterhaltung der Mailänder Hofgesellschaft. Leonardo aber machte aus harmloser Quiz-Unterhaltung ein Spiel der Verfremdung, bei dem Hofdamen und Höflingen die Haare zu Berge standen: Wer wird zu Ostern gemartert, gevierteilt und gehäutet und lässt seine markerschütternden Schreie zum Himmel emporsteigen? Allgemeine Verwirrung, dann die Auflösung: Gemeint sind die Lämmer, die ihren Müttern entrissen, geschlachtet und verzehrt werden. Fressen und gefressen, verdaut und ausgeschieden werden – diesen ekelerregenden Kreislauf unterbrach Leonardo für seine Person bewusst: Er tötete keine Lebewesen und aß kein Fleisch. Stattdessen erschreckte er vornehmes Publikum durch makabre Vorführungen: Er ließ Tiergedärm aufblasen, bis es platzte und als abstoßender Regen über die Anwesenden niederging. Seine karnivoren Mitmenschen betrachteten das überwiegend als den harmlosen Spleen eines Sonderlings – oder war es doch mehr, vielleicht eine Kritik am Abendmahl, bei dem Christen nach der Lehre der Kirche das Fleisch Christi zu sich nehmen? Bei dieser feierlichen Kommunion wurde Leonardo nie gesehen.
Eine Marotte, und zwar eine ärgerliche, war für seine Zeitgenossen auch Leonardos Passion für die Erforschung der Natur. Eigentlich war sie sogar ein Verbrechen: Wer von Gott mit einer solchen Begabung für die Malerei gesegnet worden war wie er, der musste sie zum Lob des Herrn und zum Entzücken der Mächtigen mit höchstem Fleiß ausüben und perfektionieren. Leonardo aber schien sein Ausnahmetalent gering zu schätzen, ja regelrecht zu vergeuden. Monatelang rührte er den Pinsel nicht an, um stattdessen versteinertes Meeresgetier im Apennin zu studieren. Darüber hinaus lehnte er die ehrenvollsten Aufträge von Fürstinnen und Fürsten mit den fadenscheinigsten Begründungen ab. Waren ihm Blumen und Tiere wichtiger als die Mächtigen dieser Welt?
Noch unbegreiflicher, ja empörender aus der Sicht der Wohlgesinnten war Leonardos Unzuverlässigkeit, wenn er ausnahmsweise einmal einen Auftrag angenommen hatte. Denn dann begann für die hoffnungsvollen Besteller eine Warte- und Leidenszeit, die fast immer in der totalen Enttäuschung endete: Sie bekamen kein Bild, zumindest kein vollendetes, stattdessen jede Menge juristische Scherereien. Vollends unfassbar war schließlich sein riskantes Experimentieren mit Maltechniken und Farben. So begann das «Abendmahl», das Leonardo mit Tempera auf die Nordwand des Refektoriums eines Mailänder Klosters gemalt hatte, schon bald zu verblassen, ja regelrecht abzublättern. Auch ein Jahrzehnt später konnte sich Leonardo bei einem Großauftrag für den Ratssaal in Florenz nicht zur bewährten Freskotechnik durchringen. Nachdem er die zentrale Szene mit einer neuen Farbmischung aufgetragen hatte, verlor er die Lust, ging nach Mailand – und ließ verbrannte Erde zurück. Sollten seine Werke so vergehen wie die Hervorbringungen der Natur im ewigen Kreislauf von Zeugung und Vernichtung? Die Selbstzerstörung des Kunstwerks als dessen finaler Triumph – das klingt nach Happenings des zwanzigsten oder einundzwanzigsten Jahrhunderts. Doch bei Leonardo, dem Außenseiter und Provokateur, ist nichts auszuschließen.
Nicht weniger rätselhaft sind Leonardos technische und anatomische Zeichnungen, denen er heute seinen Weltruhm ganz überwiegend verdankt. Seine Fahrzeuge, Fluggeräte oder Katapulte lassen einen genialen Techniker vermuten, der seiner Zeit weit voraus war, doch zeigen nicht wenige von ihnen bei genauerem Hinsehen ein anderes, finsteres Gesicht: Eine gigantische Kanone drückt Menschen zu Ameisen herab, eine riesenhafte Armbrust versklavt sie zu reinen Kraftlieferanten, und in der Flugmaschine muss der «Pilot» wie ein lebendes Antriebsrad für eine Energie sorgen, die trotz aller Anstrengungen seinerseits bald verpuffen wird. Ähnliche Gegensätze zeigen Leonardos Gesichter. Den wunderschönen Porträts der Jünglinge im seidigen Lockenhaar stehen grausige Grotesken von dementen, verunstalteten, verwirrten Physiognomien gegenüber. Nicht weniger widersprüchlich stellt sich die Natur selbst dar. Die Schönheit von Menschen, Tieren und Pflanzen kontrastiert mit Zeichnungen von ungeheuren Katastrophen, die mitleidlos den Untergang des Menschengeschlechts zeigen. Hielt Leonardo eine Natur ohne Menschen für die einzig mögliche Rettung der Welt? Musste man dieses verderblichste aller Wesen vernichten, um die übrigen Lebensformen zu erhalten?
Am Ende seines Lebens hatte Leonardo nach eigener Erinnerung dreißig Leichen seziert und die Ergebnisse dieser Untersuchungen gezeichnet. Der Körper des Menschen stand für ihn offensichtlich in lebendiger Analogie zum Bau und Aufbau der Welt im Großen. Doch warum schütteln dann moderne Anatomen den Kopf über eklatante Abweichungen zwischen seiner Wiedergabe und der tatsächlichen Lage und Funktion der menschlichen Organe?
Leonardo wollte der Welt ein Rätsel sein und hatte mit dieser lebenslangen Imagebildung vollen Erfolg. Generationen von Forschern, zumeist Kunsthistoriker, haben sich von den Tagen Vasaris bis heute an ihm abgearbeitet und Leonardo-Bilder produziert, die seiner Rolle in seiner Zeit nicht gerecht werden. Das gilt etwa für die gängigen Titulierungen als «Universalgelehrter» oder «Universalgenie der Renaissance», die mit ihrem konventionellen Pathos Leonardos wahre Größe eher verdecken als aufscheinen lassen. Gemessen an den Wert- und Rangmaßstäben der Zeit, ließe sich im Falle Leonardos treffender von einer sorgfältig gepflegten und zelebrierten Kunst des Scheiterns als Triumph über eine unverständige Zeit sprechen. Diese Größe liegt nicht zuletzt in der Gegenläufigkeit zur Zeit, zu ihrer Bildung, zu ihren kulturellen Strömungen und Moden. So ist viel zu wenig beachtet worden, dass Leonardo– nach heutigen Ausbildungskriterien – allenfalls mittlere Reife hatte; höhere Schulen oder gar Universitäten hat er nie besucht. Damit hatte er ein Handicap: Er konnte kein höheres Latein und war damit für die Humanisten, die kulturellen Trendsetter der Zeit, ungebildet, unqualifiziert und unfähig, über anspruchsvolle Themen überhaupt mitzureden, geschweige denn ernsthaftes Gehör zu finden. Der Spott, das Misstrauen und die Geringschätzung, die einem ungelehrten «Mechaniker» wie Leonardo vonseiten der gefeierten Edelfedern seiner Zeit wie etwa Baldassare Castiglione, dem hochgeschätzten Schiedsrichter und Lehrmeister des stilvollen Hoflebens, entgegenschlugen, sind daher ein Schlüssel, um seine Haltung zu seiner Zeit neu zu verstehen.
Leonardo hat auf die Verweigerung von Anerkennung in zweierlei Form reagiert: Einerseits hat er versucht, sich durch späte Bemühungen den Jargon der arroganten Kulturschickeria doch noch anzueignen; vom mäßigen Erfolg dieser Strategie legen die Grammatiken in seinem Bücherregal und die selbst angelegten Vokabellisten rührendes Zeugnis ab. Zudem hat er – ein gleichfalls von der Forschung bislang vernachlässigter Gesichtspunkt – konsequent an seinem Image gearbeitet, an seiner eigenen Legende gewoben und sich selbst kunstvoll als ersten Wahrheitssucher inszeniert, der die bequemen Scheingewissheiten hinter sich gelassen hat und zu einer Naturerkenntnis gelangt ist, deren Besitz seine «Mona Lisa» und sein «Johannes der Täufer» mit ihrem Lächeln anzeigen. Diese Selbstdarstellung und Selbststilisierung war eine Gratwanderung: Wieviel von diesem Wissen durfte man der irregehenden Welt zumuten, wo drohte der Absturz, zum Beispiel durch Anklagen, wie sie Vasari später formulierte? Auch diese Position Leonardos gegen seine Zeit ist bisher nicht genauer bestimmt worden.
Doch Leonardos eigentliche Antwort auf die permanenten Demütigungen sind seine Schriften zu Natur und Malerei. Sie sind wütende Gegenentwürfe, radikale Umwertungen, die die ihm entgegengebrachte Verachtung mit Zins und Zinseszins heimzahlen. Mehr Hohn ist über die Virtuosen des Wortes, die elegant über alles schreiben und dabei doch nichts von der Welt und ihren Gesetzen verstehen, kaum je ausgegossen worden. In Leonardos Rangordnung kommt die Malerei an erster Stelle. Er versteht sie als Philosophie, das heißt als Erforschung der Natur; das wichtigste Instrument dieser nobelsten aller Tätigkeiten des menschlichen Geistes ist das Auge, dessen Wahrnehmung in der Sortierungskammer des Gehirns zu Wissen verarbeitet wird. Nach der Malerei kommt lange nichts und dann die Musik, die Leonardo gleichfalls glänzend beherrschte. Darauf folgt die Skulptur, bei der man sich in peinlicher Weise schmutzig machte, und auf dem letzten Platz die von den Humanisten so hoch geschätzte Dichtung. Dabei war Leonardo kein Verächter der Sprache. In seiner Muttersprache Italienisch drückte er sich präzise und anschaulich aus und kreierte neue Ausdrücke mit neuen Bedeutungen für neu entdeckte Sachverhalte, etwa den Begriff «impressiva» für das Koordinierungszentrum der Sinneseindrücke im menschlichen Gehirn.
So ergab sich eine lebenslang anhaltende dreifache Frontstellung Leonardos: gegen die Humanisten, die glaubten, dass sich die Welt durch eine Erneuerung der antiken Bildung verstehen und verbessern ließ, gegen die Kurpfuscher, Quacksalber, Schwarzkünstler und Magier, die dem unwissenden Volk ein Geheimwissen vorgaukelten, und gegen die Theologen, die die Natur mit ihrer Lehre deformierten und herabwürdigten. Gegen Humanisten und Geheimwissenschaftler ließ sich mehr oder weniger offen gefahrlos polemisieren; bei den Gottesgelehrten war Vorsicht geboten, hier konnte er selbst in seinen Notizbüchern nur summarisch und oft verschlüsselt Kritik üben. Leonardo, der Nicht-Christ: auch diese Positionierung, die in seinen Texten vielfach belegt ist, hat bisher nicht einmal ansatzweise die gebührende Beachtung gefunden.
Es fehlt nicht an grundgelehrten Studien zu Leonardo als Maler und Kunsttheoretiker, als Naturforscher, Ingenieur, Techniker, Konstrukteur und Literat. Die neuere Leonardo-Forschung, die erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit einer kritischen Sichtung seiner weit verstreuten Hinterlassenschaft einsetzte, hat hier einen in vielen Einzelheiten reichen und oft bis heute gültigen Ertrag erbracht. Was die Zusammenfügung dieser Einzelaufnahmen zu einem geschlossenen Gesamtbild und die Verortung seiner diversen Tätigkeiten in seiner Lebensgeschichte mit ihren verschiedenen Stationen betrifft, so stechen jedoch gravierende Defizite ins Auge. Sehr summarisch gesprochen, hat die Leonardo-Forschung überwiegend werkimmanent und stilgeschichtlich gearbeitet, ohne eine allgemein anerkannte Chronologie seiner Produktion zu erreichen, und dabei die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Werk auf der einen Seite und Gesellschaft, Politik, Ökonomie und Mentalitäten auf der anderen Seite vernachlässigt. Leben und Werk, Umwelt und Vorstellungen sind aber untrennbar ineinander verschränkt. Intellektuelle Anregungen kommen nicht aus dem luftleeren Raum – das ist eine Binsenweisheit, die aber im Falle Leonardos viel zu wenig berücksichtigt worden ist.
Keine der bisherigen Leonardo-Biographien kommt zudem ohne eine Fülle von Vermutungen und Hypothesen aus, die ganz überwiegend durch Mythen- und Klischeebildungen geprägt sind: Ein Genie wie Leonardo muss bestimmte Erfahrungen gemacht haben, große Geister derselben Zeit müssen sich gekannt und beeinflusst haben, wichtige Ideen der Zeit müssen sich in seinem Werk niedergeschlagen haben. Solche Annahmen mutieren irritierend schnell zu gesicherten Aussagen. So kursiert in vielen Werken die Behauptung, Leonardo und Machiavelli – ein anderer Provokateur, der ebenfalls gegen eine irregehende Zeit wettert – hätten sich gekannt und beeinflusst. Schade nur, dass keiner den anderen in seinen Texten je erwähnt.
1 Angebliches Selbstporträt Leonardo da Vincis um 1515; erst seit den 1840er-Jahren bekannt, wahrscheinlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden. Turin, Biblioteca Reale
Die vermeintlichen Sicherheiten betreffen auch Leonardos Werk. Die berühmte Turiner Zeichnung des pessimistisch, ja verächtlich blickenden Greises mit langem Haupthaar und wallendem Bart ziert als vermeintliches Selbstporträt viele Bücher über Leonardo, doch kann sie genauso gut das idealisierte Bild eines anonymen Philosophen der Antike sein. Höchstwahrscheinlich handelt es sich sogar um eine «Fälschung» des neunzehnten Jahrhunderts, die aus der damals einsetzenden Verehrung des Meisters geboren wurde: So und nicht anders muss der große Weltweise ausgesehen und die Welt gesehen haben. Je weniger man sich eines Ausnahmekünstlers sicher ist, desto fassbarer muss er gemacht werden. Auf diese Weise entstand im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert auch ein durch nichts begründeter Kult um das angebliche Geburtshaus Leonardos in Sichtweite der Mauern von Vinci.
Beliebt sind auch Versuche, das Ausnahmegenie, dem das meiste Menschliche fremd zu sein scheint, in die sicher eingehegten Bezirke der Normalität heimzuholen. Auf diese Weise kommt es regelmäßig zur Wiederzusammenführung von Sohn und Mutter und ähnlich anheimelnden Versöhnungsriten, für die es keine Belege gibt. Doch Leonardo war nicht versöhnt, nicht mit seinen Mitmenschen, nicht mit seiner Familie und erst recht nicht mit der Natur.
In dieser Biographie soll deshalb ganz anders verfahren werden. Auf Vermutungen, Hypothesen, unbelegte Anekdoten und Stereotypen wird ebenso verzichtet wie auf die Mutmaßungen einer rein stilimmanenten kunsthistorischen Leonardo-Forschung, die sich nicht einmal über die ungefähre Datierung seiner Hauptwerke verständigen kann. Neue, sichere und weiterführende Zugänge lassen sich durch die literarische Produktion Leonardos erschließen, die bisher allenfalls am Rande Beachtung gefunden hat. Dabei hat Leonardo nicht nur die ungeheure Menge seiner Zeichnungen reichhaltig kommentiert, sondern auch Texte verfasst, in denen er seiner Sicht der Welt einen drastischen, oft satirischen und vor allem eindeutigen Ausdruck verleiht. Dazu kommen belastbare Quellen mit harten Fakten zu allen Lebensbereichen wie etwa Zahlungsanweisungen und Notariatsverträge, die zwar für eine Persönlichkeit vom Rang eines Leonardo eher spärlich fließen, doch neue Perspektiven öffnen, wenn sie in die Zeitverhältnisse eingebettet werden. Auf dieser Basis muss dann die Aussage seiner Bilder ermittelt werden, und nicht – wie bisher fast immer – umgekehrt von den Bildern auf die nur nebenbei und selektiv berücksichtigten Texte geschlossen werden.
Menschliche Größe und Genie sind pathetische Schlagworte, wenn man sie nicht genau definiert. Bestimmt man sie als ausmessbaren Abstand zu den verbreiteten Überzeugungen, den nicht hinterfragten Scheingewissheiten und selbstverständlichen Bewusstseinshorizonten der Zeit, also in Graden geistiger und kreativer Eigenständigkeit und darüber hinaus im Ausmaß des selbständig erschlossenen intellektuellen und künstlerischen Neulands, dann steht Leonardo da Vinci einzigartig und unvergleichbar dar. Diesen Platz so nüchtern und quellennah zu bestimmen, also Leonardo in seiner Zeit und damit als Denker und Schöpfer gegen seine Zeit hervortreten zu lassen, ist das Ziel dieses Buches.
ERSTES KAPITEL
VINCI UND FLORENZ
1452–1481
Herkunft, Familie, frühe Prägungen
Leonardos Geburt am 15. April 1452, nach damaliger Zählung um drei Uhr nachts, das heißt etwa um 22 Uhr 30, wurde von seinem Großvater Antonio notiert, der mit seinen achtzig Lebensjahren immer noch die Familienchronik führte. Der Vater des Kindes, Piero, war zu diesem Zeitpunkt nach Antonios Angaben sechsundzwanzig (nach anderen Quellen fünfundzwanzig) Jahre alt. Die Mutter findet in der Notiz des Großvaters keine Erwähnung. Sie hieß Caterina und heiratete kurz darauf, wohl schon 1453, einen gewissen Antonio di Buti, der einer Familie kleiner Landbesitzer aus einem Nachbardorf entstammte und den wenig vertrauenerweckenden Beinamen Accattabriga, «Ärgermacher», trug. Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor. Accattabriga starb um 1490, vor seiner Frau. Einige Jahre später nahm Leonardo seinen Aufzeichnungen zufolge eine gewisse Caterina in seinen Mailänder Haushalt auf; als sie wenig später starb, richtete er ihr ein Begräbnis aus, dessen Kosten durch seine Aufzeichnungen bekannt sind. Leonardo war im Gegensatz zu seinem jüngeren Rivalen Michelangelo großzügig im Umgang mit Geld, ja er galt sogar als ausgesprochen freigebig; für die Bestattung Caterinas hat er jedoch wenig ausgegeben. Das spricht dagegen, dass es sich um die späte Heimkehr der Mutter zu ihrem großen Sohn handelte, die sentimentale Biographen so gerne annehmen, und schlicht für die Einstellung einer Dienstmagd. Leonardo hielt seine Alltagsnotizen lakonisch knapp, doch einen kurzen Eintrag wie «Caterina, meine Mutter» hätte auch er sich fraglos abgerungen.
Leonardo war also wie so viele prominente Gestalten der italienischen Renaissance unehelicher Geburt. In fürstlichen Familien wie den Este oder Montefeltro war das kein Makel. In diesem Milieu erwiesen sich die «Bastarde» sogar oft als durchsetzungsfähiger als ihre legitimen Halbbrüder, obwohl oder gerade weil sie von Rechts wegen für die Nachfolge eigentlich nicht vorgesehen waren; offenbar setzte dieser B-Status besondere Energien frei. Nachteile bei der Erziehung hatten uneheliche Kinder an der Spitze der Gesellschaft nicht, doch das konnte im ländlichen Ambiente anders aussehen. Leonardos Vater ser Piero entstammte einer florentinischen Notarsdynastie, die sich nach dem Maßstab ihrer beruflichen Aktivitäten und Besitzstände dem gutsituierten Mittelstand der toskanischen Metropole zuordnen lässt. Notare waren mit der zunehmenden Verschriftlichung und Verrechtlichung des politischen Lebens und dem schrittweisen Ausbau der Verwaltung seit dem zwölften Jahrhundert zu wichtigen Funktionsträgern geworden. In den Kommunen Nord- und Mittelitaliens, die sich schrittweise von der Oberhoheit des Kaisers befreiten und immer ausgedehntere ländliche Herrschaftsgebiete erwarben, waren ihre Dienste an der Seite der herrschenden Eliten unverzichtbar, doch zu den Mächtigen zählten sie eher selten. Hier dominierten die Familien der Bankiers, Großhändler und Textilproduzenten mit ihren weitgespannten Netzwerken, die große Teile der Mittelschicht nach dem Prinzip «Ich gebe, damit du gibst» für ihre Interessen einspannten.
Seit 1427 mussten alle florentinischen Haushaltsvorstände dem Fiskus ihre sämtlichen Besitzungen und Einkünfte offenlegen. Steuergerechtigkeit für alle, so lautete die Parole, mit der der Mittelstand den regierenden Reichen dieses Gesetz abgetrotzt hatte. Vollständige Transparenz stellte sich dennoch nicht ein, dafür gab es zu viele Schlupflöcher; zudem verfügte die Republik nicht über die notwendigen Kontrollorgane. Da die Veranschlagung allerdings über die sogenannten Nachbarschaften lief, von denen jedes Stadtsechzehntel (gonfalone) mehrere zählte, darf davon ausgegangen werden, dass größere Lücken, speziell an Liegenschaften, den Argusaugen der Mitbürger – oder besser: Mitsteuerzahler – kaum entgangen sein dürften. Nach Auskunft dieser regelmäßigen Auflistungen war Leonardos Großvater Antonio da Vinci 1457 im florentinischen Stadtteil von Santo Spirito und im gonfalone des Drachen gemeldet und besaß in der Gegend von Vinci mehrere Immobilien, und zwar innerhalb und außerhalb dieser ländlich geprägten Kleinstadt, darunter ein Haus mit Garten, das er als seinen Wohnsitz bezeichnete; das angebliche Geburtshaus Leonardos im Weiler Anchiano vor den Mauern Vincis hingegen wurde erst 1482 von seinem Vater erworben. Von den zu versteuernden Erträgen durfte ein ansehnlicher Pauschalbetrag für jeden «Mund» (bocca) abgezogen werden, das heißt für jedes Mitglied der Familie, das von den aufgeführten Einkünften «ernährt» wurde. An solchen bocche führte Antonio im Jahre 1457 auf: sich selbst, mittlerweile fünfundachtzig Jahre alt, seine vierundsechzigjährige Frau, seinen dreißigjährigen Sohn ser Piero, der durch diese Anrede bereits als aktiver Notar ausgewiesen ist, dessen neun Jahre jüngere Gattin Albiera sowie «Lionardo, den nicht legitimen Sohn des genannten ser Piero und der Caterina, gegenwärtig Gattin des Accatabriga di Piero del Vacca aus Vinci, fünf Jahre alt». Hinzu kam ein weiterer Sohn Antonios namens Francesco, über den es kurz und etwas lieblos heißt: «Er lebt im Landhaus und macht gar nichts.»[1]
Leonardos Kindheit wird ausnahmslos auf dem Land, in und bei Vinci, lokalisiert. Bei seiner Mutter und seinem Stiefvater, dem «Unruhestifter», kann er seine ersten Jahre jedoch nicht verbracht haben; obwohl Steuerbetrug verbreitet und sehr populär war, wäre Antonio mit der erfundenen bocca des kleinen Leonardo nicht durchgekommen. Dieser wurde also von der väterlichen Sippe aufgezogen und lebte wie sein Onkel, der Tagedieb, höchstwahrscheinlich in der Villa des Großvaters. Völlig gesichert ist selbst das nicht, schließlich hielt sich sein Vater, sicherlich zusammen mit seiner Frau, aus beruflichen Gründen in Florenz auf; dass ser Piero seinen «natürlichen» Sohn schon in dieser frühen Phase mit in die Metropole nahm, ist nicht unbedingt wahrscheinlich, doch auch nicht ganz auszuschließen. Belege dafür, dass Leonardo in der bukolischen Idylle der Toskana aufwuchs, werden gerne in seinem beispiellosen Interesse für die Hervorbringungen und Erscheinungsformen der Natur gesucht und gefunden; Generationen von Biographen haben sich liebevoll ausgemalt, wie der Knabe Smaragdeidechsen nachstellte und blaue Apennin-Anemonen pflückte. Doch das alles gab es auch in Florenz, das abhängige Landgebiet (contado) und die Stadt waren politisch getrennte Welten, doch naturräumlich und wirtschaftlich gingen sie trotz aller Mauern und Befestigungsanlagen ineinander über.
Zwischen der Steuerklärung von 1457 und der von 1469 wird Leonardo in keiner einzigen Quelle erwähnt. Wie prägend sich die Anfänge auf die spätere Entwicklung eines Menschen auswirkten, war ihm im reifen Alter wohl bewusst: «Viele Ereignisse haben sich vor vielen Jahren zugetragen und sind trotzdem für die Gegenwart wichtig, und viele gegenwärtige Dinge leiten sich von der fernen Zeit unserer Jugend ab.»[2] Trotzdem – oder gerade deshalb – hat er sich zu seinen eigenen Anfängen in seinen umfangreichen Aufzeichnungen nur sehr spärlich geäußert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Für das selbstgeschaffene Image des adligen Natur-Weisen war die Herkunft aus einer biederen Juristenfamilie und einem ländlichen Marktzentrum unergiebig, da viel zu prosaisch. Deshalb fällt die einzige «Kindheitsreminiszenz», die Leonardo für überlieferungswürdig befand, auch völlig aus dem Rahmen. «Dass ich so viel vom Milan schreibe, scheint mein Schicksal zu sein. Denn nach meiner ersten Kindheitserinnerung – so scheint es mir – lag ich in der Wiege, und ein Milan kam zu mir und öffnete mir mit seinem Schwanz den Mund und stieß mir mit einem solchen Schwanz viele Male zwischen die Lippen.»[3] An diese kurze Notiz knüpfen sich viele Vermutungen. Dass sich ein Kind in der Wiege nicht an einen solchen «Besuch» erinnern kann, die angebliche Erinnerung also in Wirklichkeit eine kindliche Phantasie oder die Erfindung des Erwachsenen sein muss, steht außer Frage. Auch die ornithologische Unmöglichkeit der beschriebenen Operation sticht hervor – der Raubvogel hätte sich dem Kleinkind ja gewissermaßen im Rückwärtsgang nähern müssen.
Am berühmtesten sind die Schlussfolgerungen von Sigmund Freud, der darauf eine regelrechte Psychoanalyse Leonardos aufbaut. Freud deutet die Erinnerung (ricordatione) mittels einer faszinierenden Kombination von Methoden der von ihm entwickelten Psychoanalyse und diverser kulturwissenschaftlicher Disziplinen wie Ägyptologie und Religionswissenschaft. Leonardo – so seine Theorie – wuchs zuerst bei seiner Mutter auf dem Lande auf, die er in Ermangelung einer Vatergestalt wie eine jungfräuliche Verwandte empfunden habe. Die Mutter wiederum habe ihn mit innigen Zärtlichkeiten wie Küssen auf den Mund gehätschelt und damit eine dauerhafte sexuelle Prägung vorgenommen: Der Knabe wurde auf die Mutter und schöne junge Männer als Objekte von deren Liebkosungen fixiert. Der Raubvogel an der Wiege wurde dafür laut Freud zur zentralen Symbolgestalt: Er verkörperte die Mutter, im Zustoßen seiner Schwanzfedern spiegelten sich ihre Liebkosungen.
Zweierlei spricht jedoch gegen dieses brillante Charakterdeutungskonstrukt. Freud ging davon aus, dass der mythische Raubvogel ein Geier war. Dieser war in der ägyptischen Religion ein Muttersymbol, da man glaubte, dass es ihn nur als Weibchen gäbe. Ja, er stand später sogar für eine besondere Variante der unbefleckten Empfängnis, da man ihm eine Befruchtung durch den Wind zuschrieb. All das trifft auf den Milan jedoch nicht zu. Zum anderen steht fest, dass Leonardo nicht bei Caterina, sondern im (groß)väterlichen Haushalt aufwuchs. Philologisch und historisch ist die Interpretation damit entkräftet. Was Leonardo mit der kurzen Erzählung sagen wollte, muss also anderweitig erschlossen werden. Milane gelten in der antiken Mythologie als Unglücksboten. Dieser Raubvogelart hat Leonardo an anderer Stelle denn auch eine sarkastisch eingefärbte Bemerkung gewidmet: Milane finden ihre Jungen im Nest zu dick, piesacken sie mit dem Schnabel und lassen sie aus Neid ohne Nahrung, damit sie abnehmen. Falls diese Notiz auf das eigene Leben bezogen ist – und dafür spricht vieles –, spielt sie auf eine eher freudlose Kindheit im Zeichen von Zurücksetzung und Entbehrung an.
Zudem steht der «Bericht» Leonardos alles andere als vereinzelt dar. Antike Helden werden im zartesten Alter regelmäßig von Geflügel aller Art heimgesucht, das ihnen damit eine große Zukunft prophezeit. Leonardos Notiz hingegen klingt düster und resignativ: Das Schicksal, das ihm der Milan weissagt, ist eine Bürde, die er klaglos auf sich nehmen muss. Die ricordatione könnte auch auf die Erzählung eines Erwachsenen zurückgehen, nach dem im fünfzehnten Jahrhundert so verbreiteten Muster, dass die Mütter bedeutender Söhne bei deren Geburt oder kurz danach untrügliche Fingerzeige der Vorsehung bemerkt zu haben glauben. Doch handelte es sich bei diesen «Zeichen» meistens um Erscheinungen prominenter Heiliger oder um wundersame Rettung aus Todesgefahr. Dass sich der nüchterne Notar ser Piero oder Caterina, seine Einsommerliebe vom Lande, zu solch poetischen Aufschwüngen hinreißen ließen, ist unwahrscheinlich. Bleibt die Möglichkeit eines Traumes, dem die Geschichte von ihrer Anlage ohnehin am meisten ähnelt. Träume waren für Leonardo, wie die «Prophezeiungen» aus seinen Notizbüchern belegen, Orakel, die künftige Ereignisse, vorzugsweise große Katastrophen, vorausahnen ließen; dazu würde auch die Schicksalsträchtigkeit der Episode passen. Ob späterer Traum oder, mit Abstand am plausibelsten, bloßer Baustein der eigenen Image-Konstruktion, Leonardo will mit der Geschichte zeigen, dass er vom Schicksal zu einer besonderen Mission auserkoren ist. Die Botschaft, die der Raubvogel zu überbringen hat, ist also höchstwahrscheinlich eine heidnische Verkündigung und vielleicht sogar eine gewagte Persiflage. Der Milan wäre dann ein Erzengel Gabriel, der ja auch Flügel hat, in Vogelgestalt. Gabriel offenbarte der Jungfrau Maria, dass sie den Gottessohn gebären werde. Leonardo aber wird in seinem Leben mit der Erkenntnis der Natur, die alles hervorbringt und wieder zerstört, schwanger gehen. Die Öffnung bzw. Schließung des Mundes ist ein symbolischer Ritus in vielen Religionen, auch in der katholischen Messe und wenn der Papst neue Kardinäle kreiert. Im Falle Leonardos bezeichnet er eine lebensprägende Initiation, die Last und Ehre in einem ist, weil sie ihn mit seinem Streben nach Erkenntnis von den anderen Menschen isoliert und ihn zugleich weit über diese hinaushebt.
Mit Leonardos selbst erfundenen Fabeln hat die kurze Erzählung nichts zu tun. Die Fabel, die der Milan-Episode am nächsten zu kommen scheint, handelt davon, dass Affenliebe erdrückt, und zwar im doppelten Wortsinn: Eine Meerkatze entführt einen jungen Vogel aus dem Nest und liebkost ihn so heftig, dass er daran zugrunde geht. Solche Binsenwahrheiten illustrierten das Schicksal der anderen, für sich erfand Leonardo geheimnisvollere Konstellationen.
In der bottega Verrocchios
Das nächste Dokument, in dem Leonardo unzweifelhaft auftaucht, ist die Steuererklärung der Erbengemeinschaft Antonio da Vincis. Der Patriarch hatte 1465 im Alter von dreiundneunzig Jahren das Zeitliche gesegnet. Neues Familienoberhaupt war jetzt ser Piero; der Vermerk «beim Palast des Podestà»[4] bezeichnet den Ort seines Notariatsbüros gegenüber dem zentralen Justizgebäude. An den Besitzverhältnissen in Vinci hatte sich nichts geändert; auch Leonardo, dessen Alter mit siebzehn Jahren korrekt angegeben wird, gehörte weiter als «bocca» zum Haushalt. Ser Pietro aber hatte eine neue Frau namens Francesca, denn Albiera war 1464 bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben; im Laufe seines langen Lebens sollte er noch zwei weitere Ehen schließen, so dass es Leonardo am Ende auf vier Stiefmütter brachte. 1469 hielt sich dieser mit Sicherheit in Florenz auf, doch dass er zusammen mit dem Notar und dessen Gattin im angemieteten Haus beim florentinischen Stadtpalast wohnte, ist unwahrscheinlich – Lehrlinge lebten im Haushalt des Meisters, dafür zahlten die Väter Logis-, Kost- und Ausbildungsgeld.
Über die entscheidende Weichenstellung in Leonardos Leben berichtet Vasari Folgendes: «Obwohl er sich mit den verschiedensten Dingen beschäftigte, hörte er nie auf zu zeichnen und Reliefs zu verfertigen, was ihm mehr als alles andere entsprach und gelang. Als ser Pietro das sah und die Höhe dieses Geistes ermaß, nahm er eines Tages einige von Leonardos Zeichnungen und zeigte sie Andrea del Verrocchio, einem guten Freund, und bat ihn dringend, ihm zu sagen, ob Leonardo es in der Kunst des Zeichnens zu etwas bringen könne. Andrea war über Leonardos großartige Anfänge verblüfft und bestärkte ser Pietro in seinem Vorhaben. Dieser beschloss daraufhin, dass Leonardo in die Werkstatt (bottega) Andreas gehen solle, was Leonardo nur zu gut gefiel. Dort übte er nicht nur eine einzige Tätigkeit aus, sondern alle, die mit Zeichnen zu tun hatten.»[5] Andere Quellen dazu gibt es nicht. Die beiden mehr oder weniger zeitgenössischen Kurzbiographien aus der Feder des Humanisten und späteren Bischofs von Como Paolo Giovio und des sogenannten Anonimo Gaddiano wissen davon nichts. Der üblicherweise beim Eintritt in die bottega eines Meisters abgeschlossene Kontrakt ist nicht erhalten, der Zeitpunkt – wahrscheinlich 1466 – gleichfalls nicht präzise zu bestimmen. Trotzdem steht die Ausbildung Leonardos bei Verrocchio außer Frage. Ein solches Lehrer-Schüler-Verhältnis gehörte zur kulturellen Tradition von Florenz und prägte sich dem kollektiven Gedächtnis ein, weitere Belege liefern schließlich die Werke.
Warum gerade Verrocchio? Leonardos Vater war dessen Notar, wie verschiedene Beurkundungen zwischen 1465 und 1471 belegen. Es gab also berufliche Beziehungen zwischen beiden Häusern, was Vasaris Bericht über die Freundschaft zwischen dem Allround-Künstler und dem rührigen Juristen stützt. Trotzdem strotzt dessen Erzählung vor beliebig reproduzierbaren Klischees. Leonardo, das Wunderkind, gehört zu diesen Versatzstücken. Schon bald, so Vasari weiter, habe Leonardo besser gemalt als sein Meister, der daraufhin den Pinsel nicht mehr anrührte, sondern sich als ausgebildeter Goldschmied ausschließlich handfesteren Künsten wie der Skulptur zuwandte. Das ist nachweislich falsch, und auch für ein frühes Übertrumpfen spricht bei nüchterner Betrachtung nichts. Stereotyp überblendet ist auch die Vorgeschichte der Episode, die wie die Vita als ganze dem Gemeinplatz des vergeudeten Genies verpflichtet ist. Schon in der Grundschule – so Vasari – habe Leonardo durch seine Zweifel und Einwände den Lehrer heillos überfordert. Nebenher habe er sich ernsthaft dem Studium der Musik gewidmet, um danach ganz im Leierspiel aufzugehen. Das waren Belege für hohe Begabung, doch auch für eine tadelnswerte Leichtfertigkeit (leggiadria): «In seiner Bildung und in den Wissenschaften hätte er Großes geleistet, wäre er nicht so ablenkbar und unbeständig gewesen. Deshalb fing er an, vieles zu lernen, und gab es bald darauf wieder auf.»[6] Vasari überträgt das, was er vom späteren Leonardo zu wissen glaubt, auf dessen Anfänge. So färbt sich Leonardos selbst erzeugter Mythos bei Vasari negativ ein: Der allseitig interessierte Naturforscher erscheint in dieser unfreundlichsten aller Wahrnehmungen als Hallodri von Anfang an. Mit anderen Worten: Leonardo, der Flatterhafte, selbst schuld daran, dass ihm keine höhere Schulbildung zuteilwurde, denn dafür fehlte es ihm an den Voraussetzungen, nämlich an Disziplin und Durchhaltevermögen. Ser Piero war somit vollkommen im Recht, wenn er seinen Sprössling in Verrocchios bottega schickte, denn dort lernte man, zu gehorchen, mit anderen zusammenzuarbeiten, Werke fertigzustellen, mit einem Wort: sich zurückzunehmen.
Damit erklärt Vasari zugleich einen Akt der sozialen Zurücksetzung und Zurückstufung. Maler und Bildhauer galten als Handwerker und wurden auch als solche bezahlt. Wer bei ihnen Bilder oder Skulpturen bestellte, setzte einen Notariatsvertrag auf, in dem Gegenstand, Preis, Material und Ablieferungsdatum verbindlich vereinbart und darüber hinaus oft viele Einzelheiten, bis zur Anzahl und Größe der Figuren, festgelegt wurden. Die Auftraggeber durften die Erfüllung dieser Bestimmungen, nicht aber Eigenhändigkeit erwarten. Gemälde und Statuen wurden im Werkstattbetrieb zum großen Teil von den Gehilfen des Meisters gefertigt, der sich die Endkontrolle und letzte Korrekturen oder Glanzlichter vorbehielt, bei wichtigen Werken auch die Kernszene. Jede bessere bottega hatte überdies ihre Musterbücher, die die Grundprinzipien der Komposition bestimmten und die Lehrlinge bei ihren eigenen Versuchen anleiteten. Die Einrichtung von Verrocchios bottega ist aus dem Inventar bekannt, das nach seinem Tod im Jahr 1488 erstellt wurde. Neben reinen Haushaltsgegenständen befanden sich dort zahlreiche Büsten, Statuen, Reliefs und Gemälde, ein weitgehend fertiges Kardinalsgrabmal, eine Laute, eine Bibel, Novellensammlungen, ein Amboss, zwei Blasebälge und eine Glaskugel. Diese Werkzeuge und Requisiten spiegelten die erfolgreiche Tätigkeit eines Allroundkünstlers und seines Unternehmens, das sich bei den Mächtigen reger Nachfrage erfreute. So schuf Verrocchio mit seiner Werkstatt die Grabmäler für die älteren Generationen der Medici in San Lorenzo; auch an der heiteren Seite von deren Selbstdarstellung, an Bau und Ausstattung von Karnevalswagen, war er mit seinen Angestellten beteiligt. Der im wahrsten Sinne krönende Auftrag während Leonardos Ausbildungszeit aber bestand darin, Brunelleschis grandioser Florentiner Domkuppel die Weltkugel mit dem Kreuz aufzusetzen; ob Leonardo an dieser Montage in schwindelerregender Höhe beteiligt war, ist nicht bekannt.
So hochgestellt Verrocchios Kunden und so prestigeträchtig deren Bestellungen auch waren, für den Sohn eines Notars konnte die Ausbildung in einer solchen bottega kaum als standesgemäß gelten. Ser Piero war immerhin Bevollmächtigter angesehener Klöster und ging in Patrizierpalästen ein und aus. Dass er Leonardo einen ebenbürtigen Bildungsgang verweigerte, ihn vom akademischen Studium der «freien Künste» Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie sowie von weiterer beruflicher Qualifizierung als Jurist oder Mediziner ausschloss und ihm den direkten Zugang zu den Zirkeln und Debatten der humanistischen Kulturelite verbaute, hat Leonardo sein Leben lang tief getroffen. Seine bescheiden klingende, aber ironisch und aggressiv gemeinte Selbstbezeichnung als Mann ohne höhere Bildung (omo sanza lettere) atmet Groll und Stolz zugleich: Das vertiefte Studium des Lateinischen und der antiken Texte wurden ihm zwar versagt, aber dadurch habe er das Abgleiten in die Oberflächlichkeiten eitler Wortverliebtheit und ihrer Scheingewissheiten vermeiden können. In schroffer Frontstellung gegen die humanistische Kultur wird Leonardo lebenslang eine andere, von den Maßstäben seiner Zeitgenossen radikal abweichende Rangordnung der intellektuellen Tätigkeiten und der dazu gehörigen Metiers einfordern: mit dem Maler-Philosophen, also sich selbst, an der Spitze. Ebenso oft und polemisch wird er die «Schule der Erfahrung» als höchste und vornehmste Ausbildungsstätte auf Erden für sich in Anspruch nehmen, weit über allen Akademien und Universitäten für hochgeborene junge Schnösel. Diese Überzeugung ist tief verwurzelt und wird durch eine Fülle von Argumenten belegt, doch ist sie gerade durch die obsessive Wiederholung als Kompensation einer tiefen Kränkung erwiesen.
Die gesellschaftliche Zuordnung, die ser Piero für seinen «natürlichen» Sohn bewusst vornahm, hatte lange Bestand: Er wurde als «Meister Leonardo» angeredet, und dieser maestro-Titel bedeutete Handwerksmeister, nicht wie heute bei der respektvollen Anrede von Dirigenten Kreativität und künstlerische Größe. Unehelich geborene Prinzessinnen und Prinzen waren für regierende Dynastien Heiratsware zweiter Klasse und wurden deutlich rangniedriger verehelicht; für Leonardo, den illegitimen Spross, war die bottega Verrocchios gut genug. Prägend war sie nicht nur durch die Allround-Ausbildung, die er erhielt, sondern wohl auch durch den dort praktizierten Lebensstil. In seinen theoretischen Schriften zur philosophischen Malerei als höchster Tätigkeit des menschlichen Geistes preist Leonardo leitmotivisch die Zurückgezogenheit, ja, geradezu die Einsamkeit als angemessenen Wirkungsort. Dazu passen viele seiner Zeichnungen, am stimmungsvollsten die sinnende Greisengestalt mit Stock und aufgestütztem Kopf vor einem Baum, die deshalb sogar gelegentlich als Selbstbild deklariert wird. Doch das ist erhabene Fiktion; in der bottega Verrocchios und als Chef einer eigenen Werkstatt lebte Leonardo nicht allein, sondern stets in munterer Gesellschaft – männlicher Gesellschaft. Verrocchio war nicht verheiratet. Laut Vasari, dem Denunzianten aus Leidenschaft, war er seinem Schüler Lorenzo di Credi besonders zugetan, doch für die damit suggerierte homosexuelle Beziehung gibt es keine Belege. Wahrscheinlich spielt diese Unterstellung auch auf Leonardo an, dessen sexuelle Präferenzen zu Gerüchten und Diskussionen Anlass gaben, nicht nur hinter vorgehaltener Hand.
2 Sitzender Greis vor strömendem Wasser, um 1513. Windsor Castle, Royal Library
Am 9. April 1476 ging bei den Ufficiali della Notte, der Sittenpolizei von Florenz, eine anonyme Anzeige ein: «Ich teile Ihnen hiermit folgende wahre Nachricht mit: Jacopo Saltarelli, der zusammen mit seinem Bruder Giovanni Saltarelli beim Goldschmied in der Via Vacchereccia gegenüber dem Briefkasten für Denunziationen wohnt, siebzehn Jahre alt und schwarz gekleidet ist, geht zahlreichen unsittlichen Tätigkeiten nach; er stillt die Gelüste der Personen, die ihn um solch verabscheuungswürdige Scheußlichkeiten ersuchen. Auf diesem Gebiet hat er eine reiche Tätigkeit entfaltet und viele Dutzend Personen bedient, über die ich gut unterrichtet bin; jetzt will ich nur einige von ihnen nennen.»[7] Darauf folgen vier Namen: «Bartholomeo di Pasquino, Goldschmied; Lionardo di ser Piero da Vinci, wohnhaft bei Andrea de Verrochio; Baccino, Wamsmacher bei Or San Michele …; Lionardo Tornabuoni, genannt der Teri, schwarz gekleidet.» Und am Schluss der Eid: «Diese haben mit besagtem Jacopo widernatürlichen Umgang gepflegt.» Neben der Viererliste hat der Gerichtsschreiber den vorläufigen Beschluss der Behörde festgehalten: «Freigesprochen, unter der Bedingung, dass sie nochmals überprüft werden.»[8] Diese zweite Untersuchung fand knapp zwei Monate später, am 7. Juni, statt; die lakonische Notiz «freigesprochen, wie bereits vermerkt» zeigt an, dass die Anzeige keine Folgen hatte.[9]
Warum nicht, lässt sich ziemlich einfach schlussfolgern: Der Letztgenannte aus Saltarellis Klientel gehörte zu den primi, den einflussreichsten Familien von Florenz. Die Tornabuoni waren mit den Medici eng verbündet und zudem verschwägert. Die Mutter Lorenzos, des «ersten Bürgers der Republik», der mit seinen Gefolgsleuten die Politik von Florenz fast wie ein Stadtherr bestimmte, entstammte diesem Geschlecht, das sich ein Jahrzehnt darauf von Ghirlandaio in seiner Chorkapelle von Santa Maria Novella in großformatigen und farbenprächtigen Fresken feiern ließ; unter den Zuschauern des frommen Geschehens ist auch der angebliche Päderast verewigt, dessen Prominenz Leonardo die Einstellung der Untersuchung zu verdanken gehabt haben dürfte. Dass Leonardo – nach einhelligem Zeugnis aller Zeitgenossen und Biographen selbst ein Adonis – eine Vorliebe für Seinesgleichen hegte, war ein offenes Geheimnis. So merkt Vasari mit seiner üblichen Süffisanz an, dass Leonardo später in die hübschen Locken seines jungen Gehilfen Giacomo Caprotti, genannt Salaï, vernarrt gewesen sei. Viereinhalb Jahrzehnte nach Leonardos Tod hielt der Mailänder Maler, Kunstschriftsteller und Skandaljournalist Giovanni Paolo Lomazzo die dortige Überlieferung in einem fiktiven Dialog zwischen Leonardo und Phidias, dem griechischen Meisterbildhauer der Perikles-Zeit, in drastischen Worten fest: «Habt ihr jemals mit ihm (= Salaï) das Hintern-Spiel gespielt? Ja, sehr oft. Man muss sagen, dass er ein sehr schöner junger Mann war, vor allem mit fünfzehn Jahren. Und Ihr schämt euch nicht, das zuzugeben? Nein, warum auch? Unter Männern von herausragendem Verdienst gibt es kaum etwas, dessen man sich mehr rühmen darf.»[10]
Bezichtigungen, wie sie der angeblich so gut informierte Denunziant vorbrachte, gehörten in Florenz zum Justizalltag, wie die Akten der Ufficiali della Notte belegen. Zwischen 1432 und 1502 leiteten die «Beamten der Nacht» über zehntausend Verfahren ein und sprachen mehr als zweitausend Verurteilungen aus; zur Zeit Leonardos lag der Durchschnitt der Anzeigen bei etwa fünfzig pro Jahr. Die Strafen, die den «Schuldigen» auferlegt wurden, fielen milde aus. Während im vierzehnten Jahrhundert noch Verstümmelungen und Hinrichtungen die Regel waren, begnügte sich die Behörde nach 1432 mit gestaffelten Geldstrafen; erst bei der vierten Rückfälligkeit war theoretisch die Todesstrafe möglich, doch wurde auch sie in der Praxis durch erhöhte Zahlungen abgelöst. Die Haltung der Öffentlichkeit zu solchen «Vergehen» war zutiefst gespalten. Von Eiferern abgesehen, wurden sie meist eher mit einer gewissen Häme geduldet; wer überdies Protektion geltend machen konnte, durfte seine Neigungen relativ gefahrlos ausleben. In strenger denkenden Kreisen, wie sie sich ab 1494 um den wortgewaltigen Bußprediger Girolamo Savonarola scharten, galt Homosexualität allerdings als Kapitalverbrechen, das wie in Dantes Göttlicher Komödie in der Hölle mit ewigen Flammenqualen gebüßt werden musste. So war eine Anzeige eine erfolgversprechende Maßnahme, um einen geschäftlichen Rivalen anzuschwärzen; bezeichnenderweise werden am 9. April 1476 gleich drei Goldschmiede-Werkstätten als Brutstätten der Unmoral angeklagt. Glaubt man der Denunziation, dann offerierte Jacopo Saltarelli seine Dienste gewerbsmäßig. Dass Leonardo, der stadtbekannte Schönling, es nötig hatte, für solche «Gefälligkeiten» zu bezahlen, ist jedoch wenig glaubhaft. So kann es über den Einfluss von «il Teri» hinaus gute Gründe für die «Beamten der Nacht» gegeben haben, das Verfahren gegen ihn einzustellen.
Was hat Leonardo in seiner zehnjährigen Zeit in der bottega Verrocchios außer einem etwas zweifelhaften Ruf hinterlassen? Die Rechnungsbücher der Compagnia di San Luca, der florentinischen Malergilde, bezeugen, dass Leonardo 1472 Mitglied wurde, und quittieren die Zahlungen der dafür fälligen Beiträge. Gesichert ist aus dieser Zeit allerdings nur eine kurze eigenhändige Datumsangabe Leonardos: «Am Tag der Heiligen Maria vom Schnee am 5. August 1473».[11] Mit dem Tag ist die Feier des sogenannten Schneewunders von Santa Maria Maggiore in Rom gemeint: Als Papst Liberius den Plan der neu zu errichtenden Basilika an einem heißen Sommertag aufzeichnen wollte, fiel plötzlich Schnee, in den sich der Grundriss optimal eintragen ließ. Der Schriftzug Leonardos mit dem Datum befindet sich auf der Zeichnung einer Landschaft, die Anlass zu mancherlei kontroversen Deutungen gegeben hat: Zeigt sie eine Gegend in der Nähe von Vinci, wo eine Kapelle diesem populären Mirakel gewidmet war? Drückte der junge Maler damit seine affektive Verbundenheit mit seiner Heimatregion aus? Für die exaltiertesten Leonardo-Bewunderer ist die Zeichnung mit ihrer Vielfalt von Hügeln und Gewässern nicht weniger als der Beginn der modernen Geomorphologie, der sich Leonardo, der malende Naturforscher, in späteren Jahren so hingebungsvoll widmete. Skeptiker hingegen betrachten das Blatt eher als eine Fingerübung, die aus der typischen Gemeinschaftsproduktion der Verrocchio-bottega hervorgegangen ist und sich zudem an flämischen Vorbildern, nicht aber an der toskanischen Topographie orientiert. Wahrscheinlich ist die reizvolle Landschaft sogar beides zugleich, flämisch beeinflusst und toskanisch geprägt.
3 Toskanische Landschaft, 1473, Feder und Tinte. Florenz, Uffizien
Von den Gemälden, die in den 1460er- und 70er-Jahren aus Verrocchios Werkstatt hervorgingen, gilt die zwischen 1473 und 1475 datierte «Verkündigung an Maria» überwiegend als Jugendwerk Leonardos. Bemerkenswert daran sind (neben späteren Übermalungen auf den Flügeln des Engels) vor allem die perspektivischen Unregelmäßigkeiten, die im Ausschnitt mit dem Buch, dem rechten Arm, dem reich verzierten Marmortisch und der Schulter der Jungfrau ins Auge stechen. Sind diese Abweichungen gewollt und damit bedeutungshaltig oder bloße Anfängerfehler? Manches spricht für die letztere Vermutung, denn ein tieferer Sinn dieser Verzerrungen ist schwer zu erkennen. Andererseits fertigte Leonardo wenige Jahre später Zeichnungen für die «Anbetung der Könige» an, die einen überaus komplexen Raum konstruieren und von höchster Virtuosität bei der Beherrschung der Perspektive zeugen. Auch die Margeriten-Monokultur am vorderen Rand der «Verkündigung» ist noch Welten von den Pflanzenzeichnungen der Mailänder Jahre mit ihrer vibrierenden Lebendigkeit entfernt. Wenn das Bild also tatsächlich von Leonardo stammt, wofür vieles spricht, widerlegt es alle Wunderkind-Erzählungen von selbst.
4 Verkündigung an Maria, um 1473–1475. Florenz, Uffizien
Ähnliches gilt für die «Taufe Christi», die Vasari mit einer bedeutungsschweren Geschichte ausschmückt: Leonardo habe in Verrocchios Bild auf dessen Anweisung den Engel am linken Bildrand eingefügt und seinen Meister damit so eklatant übertroffen, dass dieser daraufhin die Malerei aufgegeben habe. Diese Übertrumpfung ist für den unbefangenen Betrachter nicht unmittelbar nachzuvollziehen. Gewiss, Leonardos kniender Himmelsbote ist mit seinen goldenen Locken, die wie eine Kaskade über den Nacken auf den Rücken fallen, mit dem reichen Faltenwurf seines blauen Gewandes und der koketten Wendung des Hauptes eine überaus reizvolle Erscheinung, doch verstecken musste sich dessen Gefährte von der Hand Verrocchios vor ihm nicht, ebenso wenig wie die zentrale Gruppe mit dem asketisch abgehärmten Johannes dem Täufer und dem andächtigen Täufling Christus.
5 Taufe Christi, um 1473–1475. Florenz, Uffizien
Kurz darauf – so Vasari – trug sich eine Vater-Sohn-Geschichte mit bitterem Nachgeschmack zu. Ser Piero habe von einem Bauern aus seiner Heimatgegend, der ihm als Vogelfänger und Fischer gute Dienste leistete, einen Rundschild aus Feigenholz mit der Bitte erhalten, diesen bemalen zu lassen. Leonardo habe diese Aufgabe im Glauben, damit seinem Vater ein Geschenk zu machen, übernommen, zu diesem Zweck das rohe Machwerk von einem Drechsler veredeln lassen und dann mit einem monströsen Fabelwesen geschmückt, für das ihm seine reiche Sammlung toter Tiere als Vorbild diente. Herausgekommen sei ein Ungeheuer, das aus der Kehle Gift, aus den Augen Feuer und aus der Nase Rauch ausgestoßen und damit alle Betrachter in Angst und Schrecken versetzt habe. Ser Piero, der die ganze Angelegenheit längst vergessen hatte, erkannte verständlicherweise den veredelten und verwandelten Schild kaum wieder, erging sich in Tönen höchster Bewunderung – und entwickelte einen von schnöder Habgier diktierten Plan. Er erwarb einen anderen, billigen Schild, gab diesen dem Bauern und trat Leonardos unheimliches Meisterwerk für hundert Dukaten an einen florentinischen Händler ab, der es flugs für das Dreifache an den Herzog von Mailand weiterverkaufte. Die Anekdote wirkt wie aus späteren Versatzstücken – Leonardos Naturstudien, seinen Erfindungen höfischer Bühnenapparate und seinen makabren Späßen mit organischen Überresten – zusammengesetzt und wirft zugleich ein eigenartiges Licht auf das Verhältnis von Vater und Sohn. War das Präsent, so es denn überhaupt existierte, ein Wink mit dem Zaunpfahl? Betrachtete Leonardo seinen Vater als abschreckendes Monstrum? Und war diesem sein begabter Sohn so gleichgültig, dass er maximalen Profit aus dessen Talent zu ziehen versuchte? Auch der Preis, den der habgierige Notar in Florenz für den Schild erzielt haben soll, stimmt nachdenklich – von dieser Summe konnte ein Handwerkerhaushalt zwei Jahre lang leben –, vom dreimal höheren Erlös in Mailand ganz zu schweigen. Von solchen Honoraren konnte ein junger Künstler nur träumen.
Warum erzählt Vasari diese Geschichte, die im modernen Druckbild immerhin eine von insgesamt fünfzehn Seiten zu Leonardos Lebensgeschichte einnimmt? Vasari hatte nicht allzu viel an gesicherten Fakten zu seinem Antihelden zu berichten; gerade deshalb ist die unfreundliche Anekdote mehr als ein Zeilenfüller. Leonardo wird dadurch als Mann ohne Familiensinn und ohne Loyalitäten präsentiert, der seinen ätzenden Witz und sein maßlos übersteigertes Profilierungsbedürfnis über alle menschlichen Bindungen stellt. Sein Markenzeichen sind überdies von Anfang an die Geheimnisse der Natur, die in grotesker Kombination an den Vater weitergegeben werden. Auch dieser offenbart sein wahres Wesen. Anstatt sich von seinem kapriziösen Sohn durch dessen «Wappenzeichen» vereinnahmen zu lassen, haut er ihn als waschechter Jurist übers Ohr und verscherbelt das anstößige Objekt meistbietend. Damit schlägt Vasari zugleich das Leitmotiv von Leonardos mehrfacher Rücksichtslosigkeit und Gewissenlosigkeit an: gegenüber sich selbst, seinen göttlichen Anlagen, gegenüber der Außenwelt im Allgemeinen und den Auftraggebern im Besonderen. Sie dürfen für ihr gutes Geld gute Ware erwarten und werden stattdessen von Anfang an vor den Kopf gestoßen. Im Falle des Monsterschilds lieferte Leonardo zwar, doch bereits mit charakteristischer Verzögerung, und das Produkt entsprach in keiner Weise den Vorstellungen des Bestellers.
Den Wünschen der Auftraggeber dürfte ein Madonnenbild nähergekommen sein, das wohl noch aus Leonardos letzter Zeit in der Werkstatt Verrocchios stammt. In seiner «Madonna mit der Nelke» zeugt vor allem die Landschaft mit den gezackten Bergen und dem kurvig herabfließenden Wasser von Leonardos Hand; solche Hintergrundszenarien werden später zu seinem Markenzeichen. Demgegenüber wirken die Jungfrau Maria und das Jesuskind statisch, ja steif; eine intensivere Interaktion oder auch nur Kommunikation zwischen beiden findet nicht statt. Der Griff des Erlöserknabens nach der Blume ist weder psychologisch noch theologisch motiviert, er ist der bloße «Will haben»-Reflex eines Kleinkinds, mehr nicht.
6 Madonna mit der Nelke, um 1475–1477. München, Alte Pinakothek
Maler in Florenz
Die nächste Quelle zu Leonardos Leben datiert vom 1. Januar 1478. Die zuständigen kommunalen Gremien erteilen «Leonardo, Sohn von ser Piero da Vinci, dem Maler» den Auftrag, ein Altarbild für die Kapelle des heiligen Bernardo im florentinischen Stadtpalast zu malen, und zwar «mit dem Schmuck, der Qualität, Art und Form, zum Preis und zu allen übrigen Bedingungen, wie sie durch die für den besagten Palast zuständigen Verantwortlichen festgelegt werden».[12] Das hieß, dass über Thema, Maße und weitere Einzelheiten des Werks ein Notariatsvertrag aufgesetzt werden sollte, der jedoch nicht erhalten ist. Da Leonardos Gemälde ein Altarbild des vierzehnten Jahrhunderts ersetzen sollte, darf man davon ausgehen, dass es denselben Gegenstand, eine Verkündigung an Maria, darstellen sollte. Obwohl Leonardo Mitte März eine Anzahlung von 25 fiorini dafür erhielt, hat er dieses Werk nicht nur nicht fertiggestellt, sondern offensichtlich nicht einmal in Angriff genommen. Nicht eine einzige Vorzeichnung dafür ist bekannt. Für einen jungen Maler, der sich gerade selbständig gemacht hatte, war ein solches Verhalten äußerst geschäftsschädigend, ja geradezu selbstmörderisch. Das Bild sollte schließlich den Stadtpalast, das politische Heiligtum der Kommune, zieren, war also aller Mühen wert, zumal sich jedes neue Werk der Konkurrenz der dort bereits vorhandenen Ausmalung von prominenter Hand stellen musste. Zudem dürfte Leonardo mit der Nichterfüllung des Kontrakts seinen Vater brüskiert haben, der ihm höchstwahrscheinlich diesen ehrenvollen Auftrag verschafft hatte.
Auch die Medici mussten angesichts dieses Tatbestands die Stirn runzeln. Alle offiziellen Auftragskunstwerke der Zeit, auch solche mit scheinbar rein religiöser Thematik, dienten in hohem Maße dazu, ihre von der Vorsehung übertragene Mission, Florenz einem Goldenen Zeitalter entgegenzuführen, zu verherrlichen. Wer wie Leonardo solche Propaganda verweigerte, zeigte zumindest indirekt seine Missbilligung und wurde künftig aus den Listen förderungswürdiger Künstler gestrichen – mit dem Ergebnis, dass Leonardo für die herrschende Familie von Florenz kein einziges Werk schuf. Seiner künftigen Tätigkeit am Arno waren damit enge Grenzen gezogen.
Chef des Hauses und Fädenzieher hinter allen Räten und Kommissionen der Republik war Lorenzo de’ Medici, offiziell «der erste Bürger», in Wirklichkeit als Chef eines weitgespannten Interessennetzwerks der Pate von Florenz. Wie schon sein Großvater Cosimo und sein Vater Piero versuchte er, die Politik im Sinne seiner patrizischen Verbündeten zu lenken, bei der Mittelschicht durch prächtige Feste und lukrative Aufträge zu punkten, die große Masse der weitgehend Besitzlosen durch billiges Brot ruhig zu stellen und die Konkurrenten aus führenden Familien, die sich in die Klientel der Medici nicht einbinden ließen, mit allen Mitteln, auch ungesetzlichen, kaltzustellen. Zugleich musste er als Chef der Medici-Bank weiterhin die hohen Profite erwirtschaften, die es seiner Familie überhaupt erst ermöglicht hatten, in der Ober- und Mittelschicht so viele Gefolgsleute und mit ihnen die Macht am Arno zu gewinnen. Die Interessen der Republik und des Geldhauses auf einen Nenner zu bringen, erwies sich zunehmend als schwierig und mit der Wahl Papst Sixtus’ IV. sogar als ausgeschlossen. Dieser betrieb ab 1471 einen so aggressiven Nepotismus, dass er die 1455 mühsam austarierte Machtbalance der italienischen Staatenlandschaft irreparabel zerstörte. Im Zuge dieser Bemühungen hatte der Papst ein Auge auf die Stadt Imola in der Romagna geworfen, die zu Mailand gehörte, aber aufgrund ihrer Randlage zum Verkauf stand. Für Florenz war die Abtretung an einen Papstverwandten, der daraus ein unabhängiges Fürstentum machen wollte, unannehmbar, so dass Lorenzo als Bankier des Papstes diesem den nötigen Kredit verweigerte; für ihn sprang das Bankhaus Pazzi ein, das die Medici seit einigen Jahren geschäftlich überflügelt hatte und deshalb von Lorenzo mit allen juristischen und politischen Mitteln diskriminiert wurde.
Damit ist die Ausgangssituation eines Konflikts umrissen, in dem Leonardo die Nebenrolle eines späten Chronisten mit der Zeichenfeder spielen sollte. Sixtus IV., seine Nepoten aus den Familien Della Rovere und Riario, Francesco Salviati, der vom Papst ernannte Erzbischof von Pisa, dem Lorenzo den Zugang zu seiner Diözese verweigerte, Federico da Montefeltro, Herr von Urbino und berühmtester Söldnerführer (condottiere) Italiens, dessen Ruf bei der Plünderung der florentinischen Untertanenstadt Volterra sechs Jahre zuvor Schaden genommen hatte, sowie weitere mit dem Regime der Medici unzufriedene Kreise inner- und außerhalb von Florenz taten sich zu einer Verschwörung gegen die regierende Familie und ihr Netzwerk zusammen. Der Angriff wurde von Rom aus koordiniert und sollte am 26. April 1478 im Mord an Giuliano und Lorenzo de’ Medici im Dom von Florenz kulminieren. Da die zuvor gedungenen Profi-Mörder jedoch ein Attentat in einem Gotteshaus verweigerten, wurde auf die Schnelle ein Ersatz gefunden, der das Metier des Tötens allerdings nur unvollkommen beherrschte: Giuliano wurde zwar erstochen, doch sein Bruder Lorenzo überlebte nur leicht verletzt. Damit war das Komplott gescheitert, und die Zeit der Vendetta brach an. Die meisten Verschwörer wurden noch in derselben Nacht der langen Messer gelyncht. Einem der Mörder namens Bernardo di Bandino Baroncelli gelang es zwar, sich im Auge des Orkans, nämlich im Glockenturm der Kathedrale, verborgen zu halten und danach über die Adria nach Istanbul zu fliehen, doch dem Arm Lorenzos, des Rächers, entkam er selbst dort nicht. Auf dessen Ersuchen ließ ihn der Sultan festnehmen und nach Florenz ausliefern, wo er am 29. Dezember 1479 vor dem Fenster des Justizpalastes gehängt und vom Augenzeugen Leonardo gezeichnet wurde. Lorenzo, der sich vollmundig als Wiederhersteller der florentinischen Freiheit feiern ließ und mehr denn je die Aushöhlung der Republik in Angriff nahm, feierte seinen Sieg auch symbolisch. Vom Allzweck-Meister Verrocchio ließ er sich dreimal lebensgroß in Wachs darstellen und diese «magischen» Statuen in Kirchen platzieren; außerdem erhielt Botticelli den Auftrag, den gescheiterten Putschversuch in öffentlichen Schandbildern zu verewigen.
7 Hinrichtung und Porträt des Bernardo di Bandino Baroncelli, 29. Dezember 1479, Feder und Tinte. Bayonne, Musée Bonnat
Von all dem hat sich nichts erhalten – im Gegensatz zu Leonardos Zeichnung. Sie zeigt den toten Mörder Giulianos, den die Pazzi und der Papst zusammen mit seinem Bruder als Tyrannen gebrandmarkt hatten, als stillen Dulder; vor allem die kleine Kopfskizze links unten unterstreicht diese fast schon märtyrerhaften Züge. Eine Rechtfertigung Lorenzos, des Rächers, war das nicht, doch auch Parteinahme für die Aufständischen spiegelt sich darin nicht unbedingt wider. Für Machiavelli war der Erfolg der Medici der Triumph der Korruption und der geschickt eingesetzten Propaganda. Michelangelo war lebenslang glühender und bekennender Republikaner und damit Gegner der Medici, für die er trotzdem bedeutende Kunstwerke schuf – allerdings auf seine Weise: mit Aussagen, die den Botschaften der Auftraggeber häufig zuwiderliefen. Leonardo aber bezog politisch niemals Position; die Umtriebe der Mächtigen scheinen ihn von Anfang an kalt gelassen zu haben. Aus späteren Jahren sind Überzeugungen bekannt, die dieses eisige Desinteresse untermauern: die Ablehnung des Krieges als bestialischen Furor, mit dem der Mensch unter die Stufe der Tiere zurückfällt, sowie die pessimistische Einschätzung des Menschen insgesamt. Vielfach belegt ist seine Weigerung, Tiere zu töten oder auch nur zu verletzen, und seine auf diese ethischen Prinzipien gegründete vegetarische Ernährung. In diesem Licht erscheint der tote Verschwörer als Täter und zugleich Opfer der Bestie Mensch.