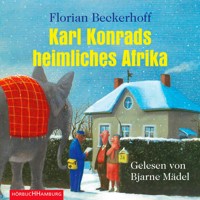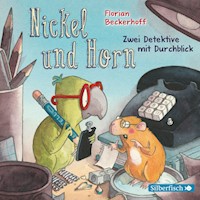4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Romane über die Höhen und Tiefen des Lebens – und die Kraft von Liebe und Freundschaft. DIE GESCHICHTENERZÄHLERIN: Widerwillig muss der zwölfjährige Jona den Sommer bei seinem alten Kindermädchen Gesomina verbringen. Doch schon bald fühlt er sich in der kleinen Berliner Straße, zwischen dem Tante-Emma-Laden von Herrn Dong und Tom Spencers Geschäft für tasmanische Stiefel mehr zu Hause als je zuvor. Als Gesomina ihm bei Brettspielrunden und Süßgebäck von ihrem bewegten Leben erzählt, beginnt für Jona das Abenteuer eines Sommers … DIE GLÜCKSSUCHENDEN: In Herrn Haiduks kleinem Berliner Kiosk geht die Welt ein und aus: Da ist die schüchterne Alma auf der Suche nach den neuesten Klatschmagazinen, der ewig jammernde »Pudelmann« und der stets mit Block und Stift bewaffnete Schriftsteller. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als Alma vor der Tür einen Lottoschein findet … der den Jackpot geknackt hat! Gemeinsam machen die beiden sich auf die Suche nach dem Besitzer des Gewinnscheins – und finden dabei etwas ganz anderes … DER WELTENTRÄUMER: Nie würde Eigenbrödler Karl Konrad sich von seinem kleinen Haus am Wald weg trauen. Doch als eine Postkarte von seinem Bruder aus Afrika im Briefkasten liegt, hat er plötzlich eine Idee: Er baut sich sein ganz eigenes, heimliches Afrika – direkt hinter dem Waldrand! Bald finden Zebras, Giraffen, Strauße und ein gutmütiges Flusspferd namens Esmeralda bei Karl ein neues Zuhause … aber wie lange kann er dieses Paradies für sich behalten? Ein berührender Sammelband für alle Fans von Carsten Henn und Fredrik Backman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 892
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
DIE GESCHICHTENERZÄHLERIN: Widerwillig muss der zwölfjährige Jona den Sommer bei seinem alten Kindermädchen Gesomina verbringen. Doch schon bald fühlt er sich in der kleinen Berliner Straße, zwischen dem Tante-Emma-Laden von Herrn Dong und Tom Spencers Geschäft für tasmanische Stiefel mehr zu Hause als je zuvor. Als Gesomina ihm bei Brettspielrunden und Süßgebäck von ihrem bewegten Leben erzählt, beginnt für Jona das Abenteuer eines Sommers …
DIE GLÜCKSSUCHENDEN: In Herrn Haiduks kleinem Berliner Kiosk geht die Welt ein und aus: Da ist die schüchterne Alma auf der Suche nach den neuesten Klatschmagazinen, der ewig jammernde »Pudelmann« und der stets mit Block und Stift bewaffnete Schriftsteller. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als Alma vor der Tür einen Lottoschein findet … der den Jackpot geknackt hat! Gemeinsam machen die beiden sich auf die Suche nach dem Besitzer des Gewinnscheins – und finden dabei etwas ganz anderes …
DER WELTENTRÄUMER: Nie würde Eigenbrödler Karl Konrad sich von seinem kleinen Haus am Wald weg trauen. Doch als eine Postkarte von seinem Bruder aus Afrika im Briefkasten liegt, hat er plötzlich eine Idee: Er baut sich sein ganz eigenes, heimliches Afrika – direkt hinter dem Waldrand! Bald finden Zebras, Giraffen, Strauße und ein gutmütiges Flusspferd namens Esmeralda bei Karl ein neues Zuhause … aber wie lange kann er dieses Paradies für sich behalten?
Über den Autor:
Florian Beckerhoff, geboren 1976 in Zürich, wuchs in Bonn auf. Nach seinem Studium der Literaturwissenschaften in Berlin und Paris promovierte er an der Universität Hamburg über literarische Schwerversprecher und arbeitete danach unter anderem als Sprachlehrer, Museumswärter und Werbetexter. Seinem Bestseller »Frau Ella«, der mit Matthias Schweighöfer verfilmt wurde, folgten zahlreiche Romane und Kinderbücher. Florian Beckerhoff lebt heute mit seiner Familie in Berlin.
Bei dotbooks veröffentlichte Florian Beckerhoff seine Romane »Frau Ella«, »Das Landei«, »Ein Sofa voller Frauen«, »Die Geschichtenerzählerin: Ein Sommer bei Gesomina« und »Die Glückssuchenden: Herrn Haiduks Laden der Wünsche«.
***
Sammelband-Originalausgabe November 2024
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Die Geschichtenerzählerin« erschien erstmals 2019 unter dem Originaltitel »Ein Sommer bei Gesomina« bei Harper Collins, Hamburg.; Copyright © der Originalausgabe 2019 by Harper Collins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg; Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München.
Die Originalausgabe von »Die Glückssuchenden« erschien erstmals 2019 unter dem Originaltitel »Herrn Haiduks Laden der Wünsche« bei HarperCollins, Hamburg.; Copyright © der Originalausgabe 2019 by HarperCollins, in der Harper Collins Germany GmbH, Hamburg; Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München.
Die Originalausgabe von »Der Weltenträumer« erschien erstmals 2014 unter dem Titel »Karl Konrads heimliches Afrika« bei Ullstein; Copyright © der Originalausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012/List Verlag; Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-385-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Florian Beckerhoff
Die Geschichtenerzählerin & Die Glückssuchenden & Der Weltenträumer
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Die Geschichtenerzählerin
Ein Sommer, der zwei Leben für immer verändern wird … Weil seine Eltern keine Zeit für Ihn haben, soll der zwölfjährige Jona den Sommer bei seinem alten Kindermädchen Gesomina verbringen. So hat er sich seine Ferien sicher nicht vorgestellt – doch schon bald fühlt er sich in der beschaulichen Berliner Straße, zwischen dem kleinen Tante-Emma-Laden von Herrn Dong und Tom Spencers höchst wichtigem Geschäft für tasmanische Stiefel mehr zu Hause als jemals zuvor. Als Gesomina ihm bei langen Brettspielrunden und klebrigem Süßgebäck von ihrem bewegten und oft so traurigen Leben erzählt, beginnt für Jona, das Abenteuer eines Sommers: Gemeinsam mit seinen neuen Freunden begibt er sich auf eine Spurensuche in Gesominas Vergangenheit – und beginnt so zu begreifen, dass eine Familie viele Gesichter haben kann …
Motto
Für N. und ihre Quatschlappen,
ohne die alle folgenden Figuren und
Ereignisse so frei niemals hätten erfunden
werden können. Grazie mille!
Kapitel 1
ARTUSIS QUATSCHLAPPEN
Die Granitplatten des Gehwegs glänzten noch feucht vom letzten Regen, als Gesomina Massati gegen Mittag dieses recht kühlen Berliner Julitages aus dem Tor des Mietshauses eilte, in dem sie damals schon seit fast vier Jahrzehnten wohnte. Der Sommer war bisher völlig verregnet, immer wieder gingen sintflutartige Sturzfluten nieder, was Gesomina aber weder freute noch ärgerte – das Wetter interessierte sie nicht. Die eher klein gewachsene Frau mit kurz geschorenem grauem Haar wandte sich gleich nach links, wo sie nach wenigen Metern den Laden von Tom Spencer passierte, der hier tasmanische Stiefel verkaufte. Wie immer, wenn es nicht allzu stark regnete, saß der stämmige Australier auf seinem Campingstuhl vor dem Geschäft. Früher hatte hier eine Podologin ihre Dienste und Produkte angeboten, die ihm zufolge aber niemand vermissen würde, der seine tasmanischen Stiefel trug. Mit denen könne man problemlos durch die Hölle gehen, hatte er Gesomina erklärt. Tatsächlich gebe es den Beruf des Podologen in Australien gar nicht, was umso bemerkenswerter sei, wenn man die Größe des Landes und die Beschaffenheit seiner Wege bedenke, das könne sie im Internet leicht überprüfen. Gesomina wollte weder vom Internet noch von seinen Stiefeln etwas wissen, da sie keinen Computer hatte und bei jedem Wetter nur Sandalen trug, bei starkem Frost mit Wollsocken. Sie hatte ihm gleich bei ihrer ersten Begegnung gesagt, dass sie als Kind in Mogadischu ausschließlich barfuß herumgelaufen sei, bis die Nonnen, deren Erziehung sie habe ertragen müssen, ihre Füße immer und immer wieder in Schuhe gezwängt hätten. Da solle er ihr nicht mit Stiefeln kommen, und seien sie sonst wo her! Tom Spencer hatte das Verkaufsgespräch daraufhin sofort beendet. Seitdem redeten sie über andere Themen, so auch darüber, dass er eigentlich Literatur studiert hatte. Zuletzt hatte sie ihn auf Dante angesprochen, nachdem sie durch eine Radiosendung auf die Göttliche Komödie gestoßen war.
»Dolce Beatrice!«, grüßte er sie heute und legte die sonnengegerbte Haut um seine Augen lachend in tausend Falten, doch darauf ging sie nicht ein.
»Ich habe keine Zeit«, rief sie ihm zu, ohne ihren Schritt zu verlangsamen. »Für Dante habe ich jetzt wirklich keine Zeit.«
Tom Spencer sah seiner Nachbarin verwundert hinterher. Sie war eigenwillig, aber so hatte er sie noch nicht erlebt. Ganz im Gegenteil hatten sie sich schon öfter gemeinsam über die Hektik der Deutschen lustig gemacht und überlegt, inwiefern ihr afrikanisches und sein australisches Gemüt einander entsprachen. Ehe er etwas dazu hätte sagen können, war sie aber schon einige Meter weiter.
Energisch warf sie ein Bein vor das andere. Ihre weit genähten Stoffhosen flatterten, und man hätte sich täuschen und annehmen können, sie trage einen Rock, was ihr aber niemals eingefallen wäre – sie hasste Röcke nicht weniger als Stiefel. So lief sie die Straße hinunter bis zum einstöckig gebauten Supermarkt der Familie Dong und verschwand in der Tür.
Erst kurz vor Tom Spencers Einzug in die einstige Podologie hatte eine der großen Supermarktketten diese Filiale aufgegeben. Die Farben waren geblieben, das der aufgeklebten Buchstaben beraubte Leuchtschild und die Griffe der wenigen Einkaufswagen: Blau und Gelb. Das Sortiment aber war jetzt ein anderes. In einer kleinen Küche gleich neben den Kühlregalen saß den ganzen Tag über die alte Frau Dong, schälte und schnitt Ananas, Mango und Melone, die in Plastikdosen verkauft wurden. Es gab frischen Koriander, Minze, Thai-Basilikum, Sojasprossen und Zitronengras, ein Dutzend Sorten Duftreis und Kokosmilch in Büchse und Karton. Gesomina grüßte in die Küche und eilte schon weiter. Sie brauchte nur Mehl, Butter, Ei und Puderzucker. Außerdem Aquavit. Das Rezept kannte sie auswendig: Farina, Burro, Zucchero in polvere, Uova, Aquavite – ein cucchiaiate. Das Wort für einen kleinen Löffel voll von was auch immer hatte sie auf Anhieb gemocht, auch wenn sie sonst von Schnaps nichts hielt. Ihr Mann hatte getrunken. Zu viel getrunken. Jetzt aber brauchte sie ein wenig Aquavit.
Herr Dong erwartete sie an der Kasse. Hätte sie den kleinen Mann, der sie mit einem verbindlichen Lächeln begrüßte, nach dem Aquavit gefragt, hätte er ihr den Schnaps sofort bestellt und einen Boten losgeschickt und sich tausendfach dafür entschuldigt, dass er ihn nicht führte. Oder er hätte sich auf die Suche begeben, in den Schubladen unter den Regalen oder auch im Lager, wo er die absonderlichsten Dinge fand, wenn man ihn nach etwas fragte. Er hatte von seinem recht chaotischen Vorbesitzer sämtliche Lagerbestände übernommen, bis jetzt aber nicht die Zeit gefunden, diese komplett zu sichten. Immer wieder fanden sich neue Kisten mit nicht ganz alltäglichen Waren, mit denen das Sortiment offenbar ergänzt worden war. Saisonware wie Indianerschmuck, Silvester-Raketen, Osterküken oder Lametta, aber auch einige Flaschen italienischer Schokoladenlikör, schwedische Fischkonserven und namibisches Trockenfleisch. Es wäre also durchaus möglich gewesen, dass er auch eine Flasche Aquavit hätte finden können, nur war Gesomina in Eile.
»Sie backen, ja?«, fragte Herr Dong, als sie bezahlte.
»Ja, ja«, sagte sie nur und packte die Zutaten eilig in ihren Beutel. »Ich muss mich beeilen. Ich bin sehr spät dran.«
Zurück auf der Straße, wollte Gesomina ihr Glück in der Bar Centrale versuchen. Das vor wenigen Monaten eröffnete Kneipencafe an der gegenüberliegenden Straßenecke hatte aber wie so oft geschlossen. Sie legte die Stirn ans Fenster und schirmte ihre Augen mit den Händen ab, um bis in das Hinterzimmer zu sehen. Dort hatten die beiden bärtigen Kneipiers, Milan und Robert, ihr Büro, in dem sie zusätzlich als Graphiker arbeiteten.
Die beiden jungen Männer hatten sich von der günstigen Miete herlocken lassen, was sie längst bereuten, so selten kam jemand in ihren Laden, der zuvor von einem Trödler als Lager genutzt worden war. Von außerhalb kam ohnehin so gut wie niemand in die Straße. In den großen und lange nicht gestrichenen Mietshäusern, ihren Seitenflügeln und Hinterhäusern wohnten zwar mehrere hundert Menschen, aber nur wer Arbeit oder einen Hund hatte, lief regelmäßig den breiten Gehweg entlang – und an der Bar vorbei. Vergnügen und Unterhaltung suchte man woanders. Kaffee und Bier gab es zu Hause vor dem Fernseher. Jetzt in den Sommerferien war die Straße wie ausgestorben, tot, bis auf die wenigen Läden, die sich noch halten konnten – das nächste Shopping-Center war nicht fern.
Da sich auch nach mehrfachem Klopfen niemand rührte, gab Gesomina es seufzend auf und lief die ganze Straße zurück, an Tom Spencers Laden und am Salon von Frisör Ergün vorbei, die zu ihrem Glück beide gerade beschäftigt waren. So schaffte sie es zum Weinladen am anderen Ende der Straße, ohne noch einmal aufgehalten zu werden.
Gesomina fragte die Weinhändlerin Julika gleich nach dem Aquavit.
»Für die Quatschlappen, für meinen Jungen«, sagte sie.
»Quatschlappen? Für Ihren Jungen?«
Gesomina erklärte ihr, dass sie früher schon für den Jungen gebacken habe, obwohl seine Mutter das nicht gerne sah, so viel Zucker und Fett und weißes Mehl, vom Schnaps ganz zu schweigen. Als er zu sprechen anfing, hatte er wissen wollen, wie das Gebäck hieß, das man in Italien mal cenci mal chiacchiere nannte, kleine Lappen aus frittiertem Teig oder ein gepuderzuckerter Quatsch für zwischendurch, klassisches Karnevalsgebäck, das schon die alten Römer kannten. Nachdem sie ihm das erklärt hatte, habe der Junge nur noch von seinen Quatschlappen geredet.
»Wirklich?«, fragte Julika, überrascht von Gesominas Redseligkeit. »Ich wusste gar nicht, dass Sie Enkel haben.«
»Wer sagt das denn?«, fragte Gesomina.
»Ich weiß nicht«, sagte Julika. »Sie sagten doch, dass Sie für Ihren Jungen backen.«
Gesomina schüttelte den Kopf und zahlte. Sie redete nur selten von sich und wollte erst recht nicht, dass über sie geredet wurde. Auch jetzt hatte sie weder Lust noch Zeit, Julika von Jona zu erzählen, und eilte aus dem Laden, in Gedanken schon in ihrer Küche. Da sie alle Zutaten hatte, musste sie schnell nach Hause.
Sie vergaß, die Straßenseite rechtzeitig zu wechseln.
»Signora!«, rief Herr Ergün, der keinen Kunden mehr hatte und neben ihr herlief. »Jetzt weiß ich es!«
»Was wissen Sie?«, fragte sie, ohne stehen zu bleiben.
»Warum Sie nicht schön sein wollen!«
»Wie bitte?«
»Ja! Ihre Haare, warum sie die rasieren! Sie sind eine Nonne!«
»Geht es Ihnen noch gut?«, fragte sie und blieb widerwillig am Bordstein stehen. »Haben Sie Haarwasser getrunken? Was fällt Ihnen denn ein?«
»Entschuldigen Sie, das war nicht persönlich gemeint. Aber ich habe einen Bericht gesehen. Über ein Kloster in Tibet und diesen Dalai Lama. Geben Sie es zu, Sie sind eine buddhistische Nonne! Ich sage es auch keinem weiter.«
Gesomina lachte laut auf, so absurd war die Idee.
»Eine Nonna vielleicht«, sagte sie dann. »Eine Ersatz-Nonna, da haben Sie allerdings recht.«
»Na, sehen Sie!«, rief Herr Ergün begeistert.
Gesomina ließ ihn einfach stehen und eilte nach Hause. Sie war verwirrt und wütend, was diese Leute sich einbildeten, so mit ihr zu reden. In ihrem Leben herumzuschnüffeln. Aber sie hatte die Weinhändlerin selbst auf den Gedanken gebracht, und es war ja auch nicht verwerflich, sie für eine Mutter zu halten. Sie konnte schließlich nicht wissen, was mit ihrem Kind geschehen war. Das ging niemanden etwas an. Darüber sprach sie fast nie. Das war so lange her.
Zurück in ihrer Küche verarbeitete Gesomina die Zutaten zu der gewünschten pasta piuttosto soda. Diesen eher festen Teig rollte sie aus und schnitt ihn mit dem Schneiderädchen in kleine Stücke, die, im Öl frittiert, jene forme bizzarre annahmen, die ihr so gut gefielen. Den Herd um die Pfanne herum schützte sie mit Küchenpapier vor dem spritzenden Fett. Artusis Kochbuch lag in sicherer Entfernung auf dem Küchentisch. Schon zischte und sprudelte und brutzelte es in der Pfanne, und sie hatte ganz vergessen, wie viel Spaß ihr das machte. Der Teig wurde schnell dunkler, und sie musste aufpassen, nicht zu spät zur Siebkelle zu greifen und die goldbraunen Stücke aus dem Öl herauszuholen. Jedes hatte seine eigene lustige Form, so passend war der Name, den der Junge ihnen gegeben hatte.
Während die Quatschlappen abkühlten, drehte Gesomina sich eine Zigarette. Sie rauchte am offenen Fenster und lauschte dem Regen. Sie dachte an ihr Kind und sah Jona vor sich. Die Bilder der Kinder verschwammen ineinander. Sie hätte das Foto holen können, aber sie wollte nach vorne blicken. Jona war längst so viel älter.
Als sie zwei Stunden später wieder auf die Straße trat, hielt sie in den Händen eine offene Papiertüte. Tom Spencer saß mit seinem breitkrempigen Hut und einem olivgrünen Regencape vor seinem Laden. Da sie vorhin schon kaum mit ihm gesprochen hatte, blieb sie jetzt stehen, und er begann sofort zu schnuppern, den Blick auf die Tüte fixiert, und sie musste lächeln.
»Ein Rezept von Artusi. Pellegrino Artusi«, erklärte sie. »Er nennt sie cenci, für andere sind es chiacchiere. Wir nennen sie Quatschlappen.«
»Klingt italienisch«, sagte Tom Spencer und kam der Tüte immer näher.
»Das Kochbuch hat mir mein Freund damals in Rom gekauft. Gleich nachdem wir uns in einer Bar kennen gelernt haben. Sonst wäre ich nie nach Berlin gezogen. Er hatte es von einem Antiquar.«
»Seltsam«, sagte Tom Spencer. »Das Gebäck riecht wie meine Kindheit, obwohl ich nur irisches Blut habe. Vielleicht ist es etwas Katholisches?«
»Ja, es ist Karnevalsgebäck«, sagte sie nur und blickte auf die Uhr, während er ihr erzählte, dass er ganz sicher noch nie Karneval gefeiert habe. Seine Mutter habe aber immer für ihn gebacken, mache ihm jetzt allerdings nur noch Vorwürfe, weil er vor ihr in die Ferne geflohen sei, sie im Stich gelassen habe wegen einer Frau, mit der er doch gar nicht mehr zusammen lebe.
»Ihr Gebäck war wirklich gut, aber muss ich ihr deswegen mein Leben opfern?«, fragte er. »Ein Kind kann seine Mutter doch gar nicht verlassen! Das ist einfach der Lauf der Dinge, oder nicht?«
Der sonst so gelassene Mann schien plötzlich völlig aufgelöst. Gesomina wollte ihn so nicht einfach stehen lassen.
»Nimm«, sagte sie deshalb und hielt ihm die offene Tüte hin.
Er zögerte, schüchtern wie ein Kind, und griff dann endlich zu. Er nahm einen einzigen Quatschlappen, und der Anblick des großgewachsenen Mannes, der mit feucht glänzenden Augen genoss, wie der Speichel seinen Mund füllte, ließ Gesomina völlig vergessen, dass sie auf keinen Fall den Bus verpassen durfte. Stattdessen erzählte sie ihm, wie man diese Dinger zubereitete.
»Man muss höllisch aufpassen, dass der Teig im Fett nicht zu dunkel wird«, erklärte sie ihm. »Und eigentlich müssen sie abkühlen, bevor man sie einpackt. Aber was soll’s? Eile ist Eile, oder? Und jetzt muss ich los!«
»Wer ist denn der Glückliche?«, fragte Tom Spencer.
Da hielt sie doch noch einmal inne und erzählte ihm die Geschichte von Jona, die sie Julika gegenüber nicht weiter hatte ausführen wollen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren sollte sie heute wieder auf den Jungen aufpassen. Von seiner Geburt an hatte sie ihn betreut, in der Wohnung seiner Eltern natürlich, wo die Mutter – kaum aus dem Krankenhaus entlassen – schon wieder am Schreibtisch gesessen hatte, auch dann, wenn sie den Jungen stillte. Später hatte Gesomina gelegentlich noch abends zu ihm kommen dürfen, bis die Eltern sich plötzlich nicht mehr meldeten. Sie waren umgezogen und hatten ein Au-pair gefunden.
Jetzt hatte sich die Mutter wieder gemeldet. Als wären nicht fünf Jahre, sondern wenige Wochen vergangen, hatte sie gleich gefragt, ob sie am Abend Zeit habe. Das heißt, sie hatte gar nicht gefragt, sondern so wie damals einfach festgestellt, dass sie doch sicher Zeit für Jona habe. Sie selbst müsse weg, ihr Mann sei dauerhaft im Ausland. Die Mutter hatte ihr eine neue Adresse genannt.
Tom Spencer nahm einen zweiten Quatschlappen aus der Tüte, die Gesomina ihm noch einmal hinhielt, und meinte dann augenzwinkernd, dass sie ja fast so gekränkt wie seine Mutter klinge.
»Unsinn«, sagte sie und sah ihn böse an. »Der Junge kann doch nichts dafür.«
Tom Spencer entschuldigte sich schnell für seine dumme Bemerkung, aber Gesomina hatte es jetzt wirklich eilig und lief schon wieder los, ohne weitere Worte zu verlieren.
Alleine mit seinem schlechten Gewissen und einem Rest Puderzucker auf den Lippen sah Tom Spencer seine Nachbarin am Ende der Straße um die Ecke verschwinden. Er holte sich ein Coopers Dark Ale aus dem Kühlschrank und spielte mit dem Gedanken, Weihnachten mal wieder nach Hause zu fliegen, musste dann aber an diesen Jona denken, der gleich die ganze Tüte Quatschlappen aufessen würde. Niemand anderem als einem Kind hätte er das neidlos gönnen können.
Als Milan kurz darauf die Bar Centrale öffnete, schloss Tom Spencer seinen Laden, um einen Kaffee trinken zu gehen. Natürlich hätte er sich wie die anderen Bewohner der Straße auch selbst einen kochen können, aber die beiden Wirte musste man unterstützen, fand er. Außerdem hatte er eine Idee, von der er Milan gleich erzählte, kaum hatte er die Bar gegenüber betreten. Der Wirt ohne Kundschaft massierte nachdenklich seinen schwarzen Vollbart, nachdem Tom Spencer ihm von Gesominas Quatschlappen berichtet hatte.
»Du meinst, damit kriegen wir Kunden? Mit Karnevalsgebäck?«, fragte Milan, der ungeduldig darauf wartete, dass die Kaffeemaschine sich erhitzte.
»Wenn du deine Maschine nur für einen Kaffee aufheizt, holst du noch nicht mal die Stromkosten rein«, sagte Tom Spencer. »Dann müsst ihr Kosten senken und es gibt gar keinen Kaffee mehr. Vielleicht spricht es sich rum, dass du etwas Neues im Angebot hast. Man weiß doch nie. Ich könnte meine Kunden sicher überzeugen.«
»Von Karnevalsgebäck?«
»Milan, ich habe wegen diesen Dingern zum ersten Mal seit Jahren wieder ein schlechtes Gewissen und bin kurz davor, nur deshalb nach Australien zu fliegen! Und ich kannte nur die irische Variante! Warum sollen sie da nicht auch ein paar Kunden in unsere Straße locken?«
Am Ende willigte Milan ein. Tom Spencer sollte Gesomina fragen, ob sie für ihn backen könne. Darauf tranken sie ein eiskaltes Peroni, und nach und nach ließ Milan sich davon überzeugen, dass die Bar eines Tages laufen würde. Wenn es Bedarf nach tasmanischen Stiefeln gab, würden die Menschen sich auch davon überzeugen lassen, ein Bier oder einen Kaffee trinken zu gehen, zumal wenn es dieses Gebäck dazu gab. Das würde auch die Mutter seiner Tochter überzeugen, die ihn verlassen hatte, weil es ihm nur noch um seinen Laden gegangen war.
Nach zwei weiteren Peroni auf Milans Tochter, die Liebe und die Zukunft ihrer Straße ging Tom Spencer zurück zu seinem Laden. Er machte es sich in seinem Campingstuhl bequem und beobachtete die wenigen Menschen, die nicht verreist waren. Er wusste, dass die touristischen Gegenden der Stadt jetzt überfüllt waren mit Reisenden aus aller Welt. Hier aber herrschte eine Ruhe, als sei man nicht in einer Metropole, sondern fern jeder Zivilisation, weit draußen im Outback, wo von Menschen und Maschinen nichts zu hören war.
Als Gesomina gegen Mitternacht nach Hause kam, sah sie Tom Spencer in seinem Stuhl schlafen. Kurz überlegte sie, ob sie ihn nicht wecken sollte, nur konnte dieser Mann sicher gut auf sich selbst aufpassen, so jungenhaft er vorhin auch gewirkt hatte. Da fühlte sie sich selbst schon eher unwohl, da sie noch lange nicht in ihrer Wohnung war, sondern noch durch ihre Hölle musste. Das Tor zur Straße wirkte noch ganz harmlos, bis man es öffnete und in die nach Urin stinkende Durchfahrt trat, um sich dann, wenn man ihr entkommen war, im Schutz der überquellenden Mülltonnen am riesigen Schäferhund des im Erdgeschoss wohnenden Muskelprotzes vorbeizuschleichen. Hinter den Fenstern der Wohnung zuckten wilde Blitze, eine Explosion folgte der anderen. Gesomina wusste, dass sie in ihrem Leben nicht alles richtig gemacht hatte, aber sie hatte nicht so sehr gesündigt, als dass sie dazu verdammt worden wäre, auf Dauer in der feucht-modrigen Dunkelheit des Hofes zu bleiben. Sie eilte weiter ins Hinterhaus, dessen oberstes Stockwerk sie ganz allein bewohnte. Der Aufstieg dahin war allerdings ein wahrer Leidensweg.
Im Erdgeschoss roch es meist süßlich, als verwese etwas hinter der schon mehrfach aufgebrochenen Wohnungstür des Säufers – wenn ein Paketbote oder ein Aushilfsbriefträger die Polizei alarmierte, hatte die keine andere Wahl, als die Situation zu klären, wobei sie ihn bis jetzt immer lebendig vorgefunden hatten. Im ersten Stock saß sogar jetzt noch der Stasi-Nazi auf einem Stuhl in seiner immer offen stehenden Tür. Starr blickte er aus seinen stahlblauen Augen, als wisse er von den Verfehlungen derer, die ihn passierten. Er konnte unmöglich etwas über sie und ihre Vergangenheit erfahren haben, aber Gesomina war sicher, dass er sie wegen ihrer Herkunft hasste und nur darauf wartete, sie in einem Moment der Schwäche zu erwischen. Schnell eilte sie deshalb an ihm vorbei zu den im zweiten Stock hausenden Asiaten, ein Ehepaar um die fünfzig oder sechzig, die dem Gestank zufolge tagein tagaus kochten. Zuletzt musste sie noch möglichst unauffällig an der Wohnung von Hans vorbei, dessen Musik sie abends oft wach liegen ließ und der, wenn er sie doch einmal abpasste, gar nicht aufhörte, von sich und seinen Problemen zu erzählen, die sich immer aus irgendwelchen Liebschaften ergaben. Aber der Aufstieg lohnte sich, da sie so nah am Himmel wohnte und das ganze Jahr über mittags Sonne in der Wohnung hatte.
Sie schloss die beiden Türschlösser auf und hinter sich gleich wieder zu. Dann streifte sie ihre Sandalen ab und ging in die Küche, um wieder Mehl, Butter und Ei zu verkneten, auszurollen und in möglichst unterschiedliche Formen zu schneiden, die sich im heißen Ol immer wieder anders krümmten und bogen, zusammenzogen oder Blasen warfen. Sicher war nur, dass der Gelbton immer satter wurde, bis er unmerklich in ein helles Braun überging. Dann war es höchste Zeit, die Quatschlappen herauszuholen.
Während das Gebäck auf dem Küchenpapier abkühlte, setzte Gesomina sich an den Tisch, um eine letzte Zigarette zu drehen. Diese Fuhre würde sie bis zum Morgen abkühlen lassen und erst dann mit Puderzucker bestäuben, der sonst so hässlich klumpte. Gerade hatte sie ihren Stuhl ans offene Fenster gerückt, als es an der Wohnungstür klopfte. Sie rauchte weiter, weil sie zu dieser Zeit ganz sicher keinem ihrer irren Nachbarn öffnen würde, bis sie Tom Spencers Stimme hörte. Der hatte sie noch nie besucht.
»Was ist?«, fragte sie.
»Darf ich bitte kurz reinkommen? Ich habe den ganzen Abend auf dich gewartet. Es ist wegen der Quatschlappen. Es duftet hier auch jetzt noch so unglaublich gut.«
Überrascht vom Erfolg ihrer Backkünste, öffnete Gesomina die Schlösser und ließ Tom Spencer ein, dem die Situation unangenehm war, da sie sich nur von der Straße kannten. Ein Besuch zu dieser Uhrzeit setzte eine Intimität voraus, die es zwischen ihnen nicht gab. So wirkte es wie ein Notfall, der ihm keine andere Wahl ließ. Gesomina schloss die Tür hinter ihm und bat ihn in die Küche. Da sie mit dünnen Blättchen drehte, war die Zigarette im Aschenbecher schon erloschen.
»Du hast schon wieder gebacken? Das trifft sich sehr gut!«
»Bitte?«, fragte sie ihn verwundert, und er berichtete ihr, was er sich ausgedacht hatte, um den Jungs mit ihrem Cafe ein wenig zu helfen.
»Außerdem kannst du so etwas verdienen«, sagte er. »Man wird dir das Gebäck aus der Hand reißen!«
Gesomina ließ ihn weiter davon schwärmen, wie ihre Quatschlappen alles verändern würden.
»Sie haben mir auch so schon ganz schönen Ärger eingebrockt, oder auch Freude, was weiß ich«, sagte sie. »Jedenfalls sind die hier ganz sicher nicht für irgendein Cafe.«
Tom Spencer sah sie ungläubig an.
»Du hast Ärger? Wegen der Quatschlappen? Haben sie dem Jungen denn nicht geschmeckt?«
Sie wiegte den Kopf in Gedanken und schmunzelte. Dann erzählte sie ihm, was passiert war, nachdem Jona die Tüte in wenigen Minuten leer gegessen und worum er sie dann gebeten hatte.
»Wer so einen Köder ins Meer wirft, muss damit rechnen, dass etwas anbeißt«, sagte Tom Spencer, als sie geendet hatte. »Aber ich verstehe, warum du damit erst einmal genug zu tun hast.«
Er scherzte, weil er sah, dass Gesomina nicht wirklich unglücklich war mit der Entwicklung der letzten Stunden. Ganz im Gegenteil: Ihre Augen strahlten.
Kapitel 2
DER JUNGE AUS DEM WAL
An den folgenden Tagen sahen Tom Spencer und Milan ihre Nachbarin immer wieder zum Supermarkt eilen, und hätten sie es nicht besser gewusst, wären sie davon ausgegangen, dass Gesomina ihre Backwaren nun doch für die Bar produzierte, so viel Mehl schleppte sie nach Hause. Tom Spencer hatte Milan gleich von der Lage der Dinge in Kenntnis gesetzt: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ihm die Ehre erwiesen werde, seinen Kunden dieses Gebäck anbieten zu dürfen. So lange mussten sie sich nur gedulden.
Einmal verweilte Gesomina trotz aller Eile für einen Moment vor Tom Spencers Laden, um zu berichten, wie viel sie noch zu tun habe, da sie auch noch aufräumen und putzen müsse.
»Ich habe sonst ja nie Besuch«, sagte sie.
»Du musst dich nicht entschuldigen«, sagte Tom Spencer. »Der Junge ist natürlich wichtiger.«
Beim nächsten Gang zum Supermarkt brachte sie ihm einen Teller mit Quatschlappen, die er zunächst nicht annehmen wollte, aber Gesomina bestand darauf.
»Sonst hätte ich dir erst gar keinen geben dürfen«, sagte sie lachend und drohte ihm mit dem Finger. »Du darfst nur keine weitergeben!«
Sie nickte in Richtung der Bar Centrale, die einmal mehr geschlossen war. Tom Spencer versprach ihr, das Gebäck ganz alleine zu genießen.
Gesominas Aufregung wuchs mit jedem Tag, bis endlich Montagmorgen war. Heute sollte Jona bei ihr einziehen. Herr Dong hatte kaum geöffnet, da stand sie schon in seinem Laden, um Kartoffeln, Tomaten und Basilikum zu kaufen, weil niemand nur von Quatschlappen leben konnte und es zu Mittag Gnocchi geben sollte. Sie hatte lange nachgedacht, bis Artusi sie an seine Gnocchi di patate erinnerte. Die hatte sie früher auch schon für Jona gemacht und ihm von der Frau erzählt, die eines Tages zu Artusi gekommen war und verzweifelt berichtet hatte, wie sich ihre Gnocchi in Nichts auflösten, kaum dass sie ins heiße Wasser glitten. Nur die besten Kartoffeln hatte sie gerieben und zu festen kleinen Klumpen geformt, die dann einfach verschwunden waren. O dov’erano andati! gab Artusi die Köchin wieder, die sich völlig verzweifelt fragte, wo die Gnocchi nur geblieben waren, als hätten sich nicht geriebene Kartoffeln in heißem Wasser, sondern Goldmünzen in Luft aufgelöst, als seien ihre eigenen Kinder verschwunden. Bei Artusi hielt die Oper Einzug in die Küche, die Frau war mit den Nerven am Ende und glaubte sich tatsächlich einer höheren Gewalt ausgeliefert, ein böser Küchengeist suche sie heim, obwohl sie immer eine gute Ehefrau und Mutter gewesen sei. Artusi beruhigte sie aber sogleich: lo strano è naturale – das Rätselhafte ist natürlich. Wer am Mehl als Bindemittel spare, stehe am Ende mit leeren Händen da.
Jona war von der Geschichte so begeistert gewesen, dass er anschließend nur noch von den Gespenstergnocchi gesprochen hatte, so lustig fand er die Vorstellung von der verzweifelten Köchin, und einmal hatte er sie auch dazu gebracht, echte Gespenstergnocchi ganz ohne Mehl zu kochen.
Ja, sie hatten wirklich viel Spaß gehabt, damals und auch jetzt wieder, an diesem ersten Abend nach fünf Jahren. Gesomina war dennoch überrascht gewesen, als Jona verkündet hatte, dass er seine Mutter in den Ferien nicht nach Kalifornien begleiten, sondern zu Gesomina ziehen werde. Die Mutter war leicht angetrunken nach Hause gekommen und hatte erst einmal ungläubig spitz gelacht wie ein exotischer Vogel. Dann hatte sie Gesomina vorwurfsvoll angesehen, und kurz blitzte die verletzte Boshaftigkeit der Eifersucht in ihren Augen auf. Gesomina war völlig ahnungslos, da er sie nur gefragt hatte, ob er sie nicht einmal besuchen dürfe, um mehr von den Quatschlappen zu bekommen. Aber natürlich durfte er so lange bei ihr wohnen, wie er wollte. Auch wenn sie sich so lange nicht gesehen hatten, war er doch immer noch ihr Junge. Die Mutter aber konnte es nicht fassen, dass er lieber vier Wochen bei ihr in einem Berliner Hinterhof bleiben wollte, als mit ihr nach Hollywood zu fliegen. Sie hatte sich noch ein Glas Wein eingeschenkt und erst dann erkannt, dass es keinen Grund gab, verletzt zu sein. Ganz unverhofft bot sich ihnen eine Gelegenheit. Jona hatte recht damit, dass er sich doch nur langweilen und sie bei der Arbeit stören würde. Genau so würde es kommen, wenn sie wirklich arbeiten wollte. Sie verstand zwar trotzdem nicht, wie man sich eine solche Reise entgehen lassen konnte, aber er wollte es ja so. Am Ende hatte sie nur genickt, noch ein Glas Wein getrunken und gesagt, dass er mit seinen zwölf Jahren alt genug sei, selbst zu entscheiden, wie er seine Ferien verbringen wolle. Sie hatte Gesomina für den Abend bezahlt und erklärt, dass sie für die Wochen einen Pauschalpreis vereinbaren könnten. Sie werde sich über den üblichen Preis informieren und Jona am kommenden Montag vorbeibringen. Dann war sie ins Bett gegangen, und Jona und Gesomina hatten sich angesehen und gleichzeitig die Schultern gehoben. Darüber hatten sie gelacht.
Als es an der Tür klingelte, zog Gesomina das frische Laken auf ihrem Bett ein letztes Mal zurecht. Schnell sah sie in die Küche, wo die fertigen Gnocchi nur noch ins heiße Wasser mussten, und griff endlich zum Hörer der Gegensprechanlage, überrascht, Tom Spencers Stimme zu hören.
»Du solltest runterkommen«, sagte er. »Sonst muss sie durch die Hölle.«
»Wer muss durch die Hölle?«
»Die Mutter. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie begeistert von unserer Straße.«
»Ach ja?«, sagte Gesomina, die endlich begriff, was auf dem Spiel stand. »Ich komme runter.«
Unten vor der Tür betrachtete Tom Spencer den monströsen schwarzen Wagen, der schon seit einigen Minuten mit laufendem Motor auf der Straße stand. Solche Autos tauchten hier nur auf, wenn ein Haus oder eine Wohnung verkauft wurde. Menschen mit solchen Autos ließen ihre Kinder jedenfalls nicht in solchen Gegenden Ferien machen. Wie ein noch feuchter gestrandeter Wal lag es glänzend am Bordstein. Anstatt eine stolze Fontäne in die Luft zu blasen, ließ das Monstrum aber nur ein Rinnsal an Kondenswasser auf den ausnahmsweise trockenen Asphalt tröpfeln.
In dem Monster saß Jona, der merkte, wie skeptisch seine Mutter die Umgebung musterte, in der er seine Ferien verbringen wollte.
»Mein Gott«, sagte sie. »Hier kannst du doch nicht bleiben.«
Jona hatte gerade noch ganz ähnlich gefühlt, aber so weckte sie seinen Trotz. Außerdem faszinierte ihn der Anblick des Manns mit dem breitkrempigen Hut, der im Campingstuhl auf dem Gehweg saß.
»Klar«, sagte er. »Klar kann ich das.«
Ihr Blick suchte seinen im Rückspiegel. Er hielt ihm stand, bis sie wieder aus dem Fenster schaute. Er hätte das nicht gesagt, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, sie umzustimmen, wenn er daran geglaubt hätte, dass sie ihre Pläne ändern und doch mit ihm in den Ferienclub fahren würde. Aber das war ausgeschlossen. Sie würde in Hollywood arbeiten und er könnte nur als ihr lästiges Anhängsel mit, egal, was der Flug jetzt kosten würde, den sie doch nicht selbst zahlen müsste. Sie begriff nicht, dass er nicht irgendetwas Tolles erleben wollte, um das ihn alle anderen beneideten. Er wollte einfach nur mit ihr in diesen Club, so wie sie es ihm versprochen hatte: zwei Wochen nur sie beide, ohne Arbeit und ohne Schule. Es reichte doch, dass sein Vater nie Zeit für ihn hatte. Innerlich schwankte er, aber davon sollte sie nichts wissen. Er wollte nicht, dass sie sich Sorgen machte.
Ein Klopfen an die Scheibe unterbrach seine Gedanken. Direkt am Auto stand der Mann aus dem Campingstuhl, der sich als Tom Spencer vorstellte, nachdem seine Mutter das Fenster heruntergelassen hatte.
»Sie kommt sofort«, sagte er. »Sie sollten so einen Wagen hier nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Man könnte Sie für eine Investorin halten.«
Jonas Mutter fragte, was ihn das angehe, woraufhin er sich als Nachbar von Gesomina vorstellte.
»Ich kümmere mich ums Gepäck«, sagte er und öffnete schon die Heckklappe. »Was sollen Sie sich abschleppen?«
Jona drehte sich um und sah den Mann zwischen den Kopfstützen hindurch lächeln.
»Hallo! Ich bin ein Freund deiner Freundin.«
»Welche Freundin?«
»Na, von Gesomina. Signora Massati, bei der du deine Ferien verbringst!«
Tom Spencer lachte laut, und dieses fröhliche Lachen nahm Jona seine Unsicherheit. Plötzlich fühlte er sich wohl. Das hier war ein Abenteuer! Jetzt freute er sich auf Gesomina. Schnell öffnete er die Tür, stieg aus.
Tom Spencer reichte Jona die Hand. Er überragte den großgewachsenen Jungen um knapp einen Kopf und wirkte gut doppelt so breit. Gesomina, die in diesem Augenblick aus dem Haustor trat, wirkte neben den beiden wie eine Zwergin. Die Mutter hatte unschlüssig hinter dem Steuer gesessen und stieg erst jetzt aus und machte die Schritte um die Motorhaube herum auf den Gehweg. Das kurze Winken, mit dem sie Gesomina grüßte, wirkte schon wie eine Verabschiedung.
»Hast du alles?«, fragte sie Jona, der auf Tom Spencer wies, der seine beiden großen Reisetaschen in den Händen hielt.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Gesomina. »Wir kommen hier schon zurecht.«
»Sonst ruft ihr mich an, und hier ist noch das Geld.«
Sie reichte Gesomina einen Umschlag und machte dann einen Schritt in Richtung ihres Sohnes, der aber auch nur die Hand hob. Gesomina verfolgte das alles genau. Die Mutter hielt inne und winkte unbeholfen, ehe sie hastig einstieg und losfuhr.
Sie tat Gesomina leid. Sie wollte ihr Zurufen, dass sie sich keine Sorgen machen müsste, nicht um den Jungen und nicht um sich selbst, aber da bog das große schwarze Auto schon um die Ecke und verschwand.
»Dann also auf ins Paradies!«, sagte Tom Spencer und ging mit Jona und seinen Taschen voraus. »Der Aufstieg ist nicht so bedrohlich, wie er scheint.«
Beim Anblick der verschmierten Toreinfahrt und der überquellenden Mülltonnen, bei all dem Lärm und Gestank im Hof und im Treppenhaus musste Jona an seine Mutter denken. Der Gedanke daran, wie schrecklich sie das alles fände, gefiel ihm. Bedrohlich fand er das alles nicht, auch nicht schön, aber es war anders als alles, was er kannte.
»Mein kleiner Himmel«, sagte Gesomina, als sie schließlich die Tür zu ihrer Wohnung aufschloss und den Männern den Vortritt ließ.
Tom Spencer stellte die Taschen gleich in das große Zimmer, während Jona sich neugierig umsah. Er hatte sich bis dahin keine Gedanken darüber gemacht, wie Gesomina wohl leben mochte. Die Wände des Flurs waren mit bunten Tüchern behängt. Gleich rechts ging es in eine kleine Küche. Auf der Fensterbank standen Pflanzen. An den Wänden hingen verschiedene Regale – aus Holz, aus Metall, aus Holz und Metall –, alle vollgestellt mit Dosen und Kisten, Gläsern, Bechern, Tellern und Schalen. Er wusste nicht, wohin er gucken sollte, so viele Dinge standen herum, ganz anders als bei ihm zu Hause, wo alles in bester Ordnung und meist hinter Türen versteckt war.
»Du schläfst im großen Zimmer«, sagte Gesomina und führte ihn durch den Flur an Tom Spencer vorbei, der sich bis später verabschiedete. »Gefällt es dir so?«
Ganz anders als die Küche war das Zimmer fast leer bis auf ein breites Bett auf dem Boden, ein Telefon mit Anrufbeantworter, einen Eimer aus Metall in der Ecke.
»Klar«, sagte Jona. »Echt okay.«
»Na ja«, sagte sie. »Ich mag die Küche auch lieber.«
Dann zeigte sie ihm noch die mit Kisten vollgestellte Kammer, in der sie selbst schlafen würde, und das Bad, ehe sie ihn zurück nach vorne führte, um ihm die Gnocchi zu servieren.
»Gespensterklößchen, weißt du noch?«, fragte sie ihn.
Er wusste nicht, was sie meinte, und sah sie fragend an.
»Die haben wir früher gemacht.«
Während sie schweigend aßen, sah sie immer wieder zu ihm hin, unsicher, wie er sich fühlte, da es natürlich eine Sache war, so einen Urlaub zu planen, und etwas anderes, wirklich zu jemandem zu ziehen, den man eigentlich gar nicht kannte. Aber sie konnte unmöglich erkennen, was in dem Jungen vor sich ging, der den Blick auf das Essen gesenkt hatte und sein Gesicht ohnehin zum großen Teil hinter seinen langen blonden Haaren verbarg.
Jona machte sich tatsächlich gar keine Gedanken. Er hätte auch nicht sagen können, wie er sich fühlte. Er dachte an seine Mutter und den seltsamen Abschied vorhin, froh, dass er nicht eingeknickt war, und doch auch immer noch gekränkt.
»Du darfst nicht denken, dass sie dich nicht liebt«, sagte Gesomina. Der Junge sah nur kurz auf und schob sich dann den nächsten Löffelvoll in den Mund. Gesomina seufzte, da sie sich an ihre Mutter erinnerte, von der sie ihm plötzlich erzählen wollte. Sie zögerte, aber der Junge überragte sie sogar sitzend um zwei Köpfe. Er war ja fast erwachsen.
»Ich war jünger als du«, setzte sie an. »Als meine Mutter mich zu den Nonnen gebracht hat, und sie hat es sicher gut gemeint.«
Er hielt inne und sah noch einmal von seinem Teller auf, gar nicht abweisend, und strich eine Haarsträhne hinters Ohr. Seinen Augen war anzusehen, dass er mehr hören wollte, und das freute sie so sehr, dass sie nicht zögerte, ihm von damals zu erzählen. Sie hatten in der Altstadt von Mogadischu gelebt, gleich hinter der alten Moschee. Ihren Vater hatte sie nie kennen gelernt, das heißt vielleicht hatte sie doch mit ihm gesprochen, ohne dass er sich aber als ihr Vater zu erkennen gegeben hätte, so er denn selbst davon wusste. So hatte sie sich das ausgemalt und immer wieder einen anderen der netten Männer zu ihrem Vater erkoren, wobei auch sie dieses Geheimnis ganz für sich behielt. Jedenfalls waren es gute Jahre gewesen, in denen immer eine ihrer Tanten dafür sorgte, dass sie zu essen hatte und abends ins Bett ging. In ihrer Erinnerung gab es immer Anjero, eine Art Hirsebrei, der wie alles andere auch mit den Fingern gegessen wurde.
»Immer dasselbe?«, fragte Jona. »Keine Quatschlappen?«
»Nein«, sagte Gesomina. »Die gab es nicht. Die habe ich viel später erst durch Artusi kennengelernt. Pellegrino Artusi, aber das ist eine andere Geschichte.«
Sie fuhr fort, ihm zu erzählen, dass sie nicht reich gewesen waren, aber auch nicht hatten hungern müssen. Ihre Mutter verdiente das Geld mit dem Handel oder Schmuggel von Lebensmitteln zwischen verschiedenen Verwaltungszonen, was sie damals natürlich nicht begriff. Sie hätte heute nicht mehr sagen können, ob sie sich als Kind über die Abwesenheit ihrer Mutter überhaupt Gedanken gemacht hatte, so selbstverständlich war das gewesen. Natürlich wusste sie jetzt, dass Kinder ihre Eltern brauchten, das alles hatte sie in ihren Jahren als Erzieherin immer wieder gelernt und vorgelebt bekommen, aber in sich selbst fand sie keine Antwort auf die Frage.
»Ich vermisse meinen Vater auch nicht«, sagte Jona. »Er war ja auch schon immer weg. Da vermisst man dann auch nichts.«
»Ja«, sagte sie. »Vielleicht war es bei mir auch so. Da waren immer nur meine Tanten.« Nur einmal, das wusste sie noch genau, da hatte sie die starke Frau vermisst, an diesem Tag, an dem sie gelernt hatte, dass sie auf sich selbst aufpassen musste, dass Freiheit eine Frage des Willens war. Sie wusste nicht mehr, was vorher passiert war, spürte aber noch immer den festen Griff der Tanten, die sie festhielten, roch den Schweiß der einen, die auf ihr lehnte, damit sie stillhielt und nicht sah, was man mit ihr machte. Aber sie war stärker. Sie hörte sich den Namen ihrer Mutter schreien, fühlte dann aber schon, wie sich die Finger von ihr lösten und sie vom Tisch sprang, um davonzurennen.
»Aber was wollten deine Tanten?«, fragte Jona.
»Sie meinten es sicher gut«, sagte Gesomina. »Aber es gibt schreckliche Dinge. Auch vor Menschen, die es gut meinen, muss man sich in Acht nehmen.«
Jona wollte mehr wissen, aber darüber wollte sie mit ihm nicht reden. Das hätte sie nicht erwähnen dürfen. Deshalb fuhr sie fort zu erzählen, wie ihre Mutter sie dann zu italienischen Nonnen geschickt hatte.
»Immerhin haben die mir das Schreiben beigebracht, und das mit ordentlich Prügel«, sagte Gesomina. »Und immer musste man Schuhe tragen. Immer! Weißt du, wie das ist, wenn man die ersten Jahre seines Lebens nur barfuß gelaufen ist?«
»Und was ist aus deiner Mutter geworden?«, fragte Jona, der ganz vergessen hatte, weiterzuessen.
»Iss«, sagte sie, weil sie nicht antworten wollte.
»Sag erst«, sagte er und sah sie direkt an.
»Ich habe sie noch ein paarmal gesehen. Bin ja immer wieder weggerannt von den Nonnen zu meinen Tanten, und jedes Mal hat meine Mutter mich zurückgebracht, wenn sie nach Hause kam, weil ich Schreiben und Lesen lernen sollte, damit aus mir etwas Ordentliches würde.«
Sie hatte es zur unangefochtenen Fluchtkönigin gebracht, so sinnlos es auch war, da es keinen anderen Ort gab, an dem sie hätte leben können. Trotzdem musste sie es immer wieder versuchen. Wenn sie ihr wieder den Teufel hatten austreiben wollen, da sie keine Schuhe tragen wollte und fragte und hinterfragte, wer Gott und Jesus und die Mutter Gottes waren und wie sie hatten Kinder haben können; dann gab es Schläge mit dem Stock, kein Essen oder eine Nacht im Keller. Sonst schliefen die Mädchen alle zusammen in einem großen Saal, an dessen Tür immer eine der Nonnen wachte, weil jemand für die Kinder denken musste, die angeblich noch nicht wussten, was sie taten. Aber auch diese Überwachung war nicht vollkommen und nur erfolgreich, wenn die Kinder sich gegenseitig kontrollierten und denunzierten. Gesomina aber verstand es, die anderen Mädchen einzuschüchtern, die wussten, dass sie nach jeder Flucht früher oder später wieder im Kloster landen und sich dann rächen würde. Die langfristige Erfolglosigkeit ihrer Ausbrüche garantierte also das Gelingen weiterer Unternehmungen, so unsinnig sie auch waren, da ihre Mutter nicht davon abzubringen war, dass sie bei den Nonnen lernen sollte.
»Ich wollte immer nur zu Hause bleiben, in den kleinen Gassen, wo ich jeden kannte. Der Staub duftete so herrlich, besonders, wenn er mittags in der heißen Sonne lag.«
Sie schnupperte, als könnte sie den Duft von damals riechen, schloss die Augen und sah einzelne Bilder: satt violette Blüten über einer strahlend weißen Mauer, ein nur spärlich beleuchteter Laden voller Blechwaren, ein Esel, der nicht weiterwollte. Sie hörte die Stimme des Muezzins.
»Und dann?«, fragte Jona.
»Und dann, und dann!«, sagte sie fast ein bisschen verärgert, dass er sie drängte und sie nicht allein mit ihren Erinnerungen ließ, nur hatte sie selbst damit angefangen, ihm davon zu erzählen. »Bei meiner letzten Flucht war sie nicht mehr zu Hause. Die Tanten haben mich selbst zu den Nonnen geschickt. Das war damals ja alles so ein Chaos. Das war nicht heute und nicht Berlin, verstehst du?«
Jona verstand nur, dass sie ihm die Geschichte nicht zu Ende erzählen wollte, und wusste plötzlich auch, warum.
»Das war deine Mutter«, sagte er. »Das hat mit meiner doch nichts zu tun.«
Da musste sie schmunzeln, und er war stolz darauf, sie durchschaut zu haben, auch wenn sie viel mehr gar nicht hinzuzufügen hatte.
»Das war ein Durcheinander«, sagte sie. »Ich weiß nur, dass es verschiedene Zonen oder Länder oder was weiß ich gab, die man nicht verlassen durfte. Zwischen denen hat meine Mutter geschmuggelt, Lebensmittel, vielleicht auch mehr, bis sie von den Italienern in ein Lager gesteckt wurde und dann offiziell nicht mehr existierte.«
»Was heißt das?«, fragte Jona. »Wieso existierte sie nicht?«
»Junge, was weiß denn ich? Das war ja alles Politik. Für die Menschen hat sich doch keiner interessiert. Mal hat man ihnen Pässe gegeben, mal nicht, mal solche und mal solche. Wie soll ich das denn heute noch verstehen?«
»Trotzdem war sie doch da«, sagte er. »Deine Mutter war in diesem Lager.«
»Ja, aber nicht lange, dann ist sie gestorben. Sie haben uns dann einen Brief geschickt, in dem stand, dass sie tot war, das haben mir meine Tanten bei meiner Flucht aus dem Kloster erzählt, bevor sie mich wieder zurückgebracht haben. So war das, aber das sind ja keine Feriengeschichten, oder?«
Jona zuckte mit den Schultern. Durch das offen stehende Küchenfenster hörte er den nächsten Regenguss prasseln, vor ihm standen noch immer die Gnocchi, auf der Arbeitsfläche reihten sich die Papiertüten mit Quatschlappen. Es gab sicher schlechtere Ferienbeschäftigungen, als hier zu sitzen und Geschichten zu lauschen.
»Jetzt müssen wir los«, sagte Gesomina. »Ich muss einer alten Frau helfen, aber du kannst sicher auch bei Tom Spencer bleiben und Stiefel polieren.« Darauf hatte Jona gar keine Lust. Er fühlte sich so wohl bei Gesomina, dass er sogar bereit war, sein Telefon zu Hause zu lassen, als sie meinte, dass er das zum Putzen sicher nicht brauchen werde.
Sie verbrachten den ganzen Nachmittag bei Frau Rescher. Die alte Frau lag im Bett und wurde lediglich morgens und abends kurz von einem Pfleger ins Bad geführt. Alleine konnte sie nicht gehen, und Gesomina bat Jona um Hilfe, weil er groß und stark genug war, um sie zu halten. Natürlich konnte er sich nicht weigern, obwohl es ihm unangenehm war. Die Frau wog kaum etwas, aber sie stank, und deshalb sollte er ihr ja auch aus dem Bett helfen und sie ins Bad führen, wobei er sie letztlich tragen musste. Sie hatte ins Bett gemacht, und er ekelte sich.
»Na komm, Junge, ich hab dir auch die Windeln gewechselt!«, rief Gesomina, und er versuchte mitzulachen, während die Frau irgendetwas vor sich hin redete.
Gesomina hatte ihm erklärt, sie sei dement, früher aber eine hochgebildete Frau gewesen. Ehrfurchtsvoll hatte sie Jona die Bibliothek gezeigt, Regale bis zur Decke voller Bücher, aber damit musste sie ihm nicht kommen. Bücher hatte seine Mutter selbst genug. Während Gesomina Frau Rescher wusch, saß Jona am Esstisch. Ein runder Tisch aus dunklem Holz, auf dem eine fleckige Spitzendecke lag. Der Tisch stand am Fenster des großen Zimmers, das Gesomina gleich nach ihrer Ankunft geöffnet hatte. Draußen regnete es leicht, gerade so stark, dass man es trotz der im Bad rauschenden Dusche hörte, dazu ruhiger Gesang, der ihm bekannt vorkam.
Nach einer Weile rief Gesomina ihn, damit er Frau Rescher an den Tisch führte. Er sollte sich zu ihr setzen, während Gesomina die Wohnung putzte. Jona sah ihr direkt in ihr von Falten durchzogenes Gesicht und suchte in ihren Augen die ganzen Bücher.
»Haben Sie die alle gelesen?«, fragte er sie, weil sie ihm vielleicht hätte sagen können, warum jemand so viele Bücher las. Lesen sei wie Reisen, sagte seine Mutter, und dass man lesend so viele Leben führen konnte. Aber man war immer allein, fand Jona, und am Ende vergaß man offenbar doch alles wieder und es brachte einem nichts. Frau Rescher wäre Gesomina sicher nicht in einem ihrer Bücher begegnet, und ihm auch nicht.
Sie saßen lange da, und Jona blickte immer wieder von den Buchrücken zum Gesicht der alten Frau und wieder zurück und überlegte, wie das eine zum anderen passte. Die Regale standen zu weit entfernt, als dass er die Titel hätte entziffern können, die ihm so nicht mehr sagten als die Linien und Striche ihrer Haut, die er dennoch zu lesen versuchte. Natürlich war das unsinnig, aber das Spiel gefiel ihm und vertrieb ihm die Zeit, bis Gesomina ihn bat, Frau Rescher zurück in ihr Schlafzimmer zu bringen.
Gesomina setzte sich ans Kopfende des Bettes und sang wieder mit ihrer ruhigen Stimme, und plötzlich lag ein Lächeln auf den Lippen der alten Frau.
»So bist du damals auch immer eingeschlafen«, sagte Gesomina leise. »Immer das gleiche Lied, immer wieder.«
»Und dann bin ich einfach eingeschlafen?«, fragte Jona.
»Oft hast du noch nach deiner Mutter gerufen und sie gesucht. Ich musste dir die ganze Wohnung zeigen, bis du mir geglaubt hast, dass wir alleine waren. Dann hast du dich beruhigt.«
»Habe ich sie so vermisst?«, fragte er.
»Das geht allen Kindern so«, sagte sie. »Das ist völlig normal.«
Sie zwinkerte ihm zu und stand auf und sagte, dass sie sich jetzt um ihr Abendessen kümmern mussten. Von der Schlafzimmertür aus sah Jona wieder die Regale voller Bücher. Er blickte sich noch einmal um. Frau Rescher lächelte noch immer, aber Jona fand es nicht richtig, dass sie alleine in der Wohnung bleiben sollte. Es kam ihm vor, als ließe man ein kleines Kind zurück.
»Was willst du machen?«, fragte ihn Gesomina. »So ist das Leben.«
Schweigend liefen sie durch die Straßen zurück nach Hause. Es hatte wieder einmal aufgehört zu regnen, und Tom Spencer saß vor seinem Laden.
»Lässt sie dich für sie arbeiten?«, fragte er Jona.
»Nein«, sagte der Junge. »Das war schon okay.«
Tom Spencer musterte ihn skeptisch, weil er nicht erwartet hätte, dass Jungen in dem Alter Spaß am Putzen haben könnten, aber das sollte seine Sorge auch nicht sein. Er wollte ihm Stiefel schenken, das hatte er sich gleich nach seiner Ankunft vorgenommen. Da Gesomina unbekehrbar war, sollte zumindest ihr Gast sich überzeugen lassen. Jona sah Gesomina fragend an, die meinte, dass er mit seinen Füßen machen könne, was er wolle.
»Ich war ja nicht bei den Nonnen«, sagte er.
»Ganz genau«, sagte sie.
Tom Spencer war überrascht, wie gut die beiden sich offenbar verstanden, und stand gleich auf, um Jona die passenden Stiefel zu holen.
»Und was ist daran so toll?«, fragte Jona, als er im Campingstuhl saß und den ersten Stiefel anprobierte.
»Sitzt er nicht gut?«
»Doch, schon«, sagte Jona unsicher. »Aber warum muss man Stiefel aus Australien tragen?«
»Aus Tasmanien«, korrigierte ihn Tom Spencer. »Die sind original aus Tasmanien, aus einem Familienbetrieb. Es sind einfach die besten Stiefel der Welt, darum muss man sie tragen, wenn man die besten Stiefel der Welt tragen will.«
Jona schlüpfte auch in den zweiten Stiefel, stand auf und lief einige Schritte auf dem Gehweg hin und her.
»Die besten Stiefel der Welt«, sagte er.
»Ganz genau«, sagte Tom Spencer. »So ist das. Du bist ja noch nicht am Ziel deines Weges, nur weil der Wal dich ausgespuckt hat. Du musst auf jeden Fall noch durch die Fiölle, und das nicht nur einmal.«
Jona blieb stehen und sah Tom Spencer an. Natürlich war er nicht der erste Erwachsene, der ihm mit dieser Geschichte kam, die er genauso wenig verstand wie die Entscheidung seiner Eltern, ihm diesen Namen zu geben. Allerdings hatte noch niemand behauptet, dass der Wal ihn ausgespuckt hatte. Bis jetzt hatte er, wenn überhaupt, immer gedacht, dass dieser Teil der Geschichte ihm noch bevorstand.
»Kannst du mir diese Geschichte erklären?«, fragte er.
»Gerne«, sagte Tom Spencer. »Aber ich glaube, deine Gastgeberin würde jetzt lieber nach Hause gehen. Wir kommen ein anderes Mal darauf zurück, wenn du versprichst, die erste Nacht in den Stiefeln zu schlafen. Dann bringen sie dir Glück, ein Leben lang.«
»Ist okay«, sagte Jona.
»Ist okay«, wiederholte Tom Spencer und zwinkerte Gesomina zu, die die Turnschuhe des Jungen schon in den Händen hielt und ungeduldig wartete.
In der Hölle donnerte und krachte es. Die feuchtwarme Luft stank noch viel schlimmer als sonst.
»Lasciate ogni speranza, voi che entrate«, sagte Gesomina und erklärte Jona, was Tom Spencer ihr über Dantes Hölle berichtet hatte, deren Tor diese Aufforderung zierte, beim Eintreten alle Hoffnung fahren zu lassen. Auch wenn sie nicht an Gott glaube, wiesen ihr Leben und ihr Zuhause erstaunliche Parallelen zur Göttlichen Komödie auf, nur dass sie das alles tagtäglich durchmachen müsse. Jona hörte nicht richtig zu, da er versuchte, durch die Fenster in die Erdgeschosswohnung zu schauen. Er sah einen riesigen Bildschirm, als ihm plötzlich der Hund die Sicht verstellte und ihn wie irre anbellte. Fast wäre er nach hinten gefallen, so sehr hatte er sich erschrocken, aber Gesomina fing ihn auf und führte ihn rasch zur Tür und hoch in die Wohnung.
»Du hast lustige Nachbarn«, sagte er, als er wieder am Küchentisch saß und eine selbst gemachte Limonade trank.
»Meinst du den Stiefelmann oder den wahnsinnigen Höllenwärter?«, fragte sie, während sie das Abendessen kochte.
»Beide«, sagte Jona. »Also irgendwie mal anders.«
»Auf die Irren im Haus würde ich gern verzichten«, sagte sie. »Aber Tom Spencer ist ein guter Mensch, trotz seiner Stiefel.«
»Bei uns draußen sieht man niemanden. Ist auch scheiße.«
»Deine Eltern wollten damals unbedingt diese Villa. Es wurde von nichts anderem geredet.«
Sie fragte ihn, wie das Leben da draußen sei, aber er hatte keine Lust, darüber zu reden. Sie sollte lieber weitererzählen, wie es bei ihr damals gewesen war.
»Du denkst, ich hatte es besser?«, fragte sie lachend.
»Weiß nicht«, sagte er unsicher. »Spannender schon, oder?«
»Junge, du weißt nicht, was du da sagst«, sagte sie und servierte ihm einen Teller mit Spaghetti. »Bei den Nonnen gab’s so was nicht. Die haben italienisch nur geredet.«
Gesomina selbst aß Gurke und Frischkäse, während sie ihm vom schlimmen Essen damals bei den Nonnen erzählte. Wässrige Suppen und hartes Brot und oft sogar Verdorbenes. Sie brach bald ab, weil sie merkte, dass es ihr selbst nicht guttat, sich zu erinnern, abgesehen davon, dass sie den Jungen nicht mit ihrer Vergangenheit belästigen sollte. Wie von selbst hatte sie am Nachmittag angefangen sich zu erinnern und über Dinge zu reden, von denen sie sonst nur selten sprach. Jona wollte trotzdem mehr hören und bat sie, nicht aufzuhören. Sie wollte nicht, aber er fragte immer weiter, bis sie ihn plötzlich anfuhr.
»Nein, es reicht, das habe ich doch gesagt.«
Erschrocken fuhr er zusammen, griff nach seinem Telefon und eilte aus der Küche zu seinem Bett. Gesomina drehte sich eine Zigarette, die sie am offenen Fenster rauchte. Sie kam wieder zu sich und legte schnell eine Handvoll Quatschlappen auf einen Teller, den sie dem Jungen brachte.
»Willst du deine Mutter anrufen?«, fragte sie, aber er reagierte nicht.
Sie seufzte und stellte den Teller vor ihn auf den Dielenboden. Er starrte weiter auf das Telefon, voll konzentriert auf das Spiel, damit er sich nicht mit etwas anderem beschäftigen musste. Das ging sonst immer sehr gut. Die Bilder löschten die Gedanken. Gesomina stand immer noch vor ihm.
»Gut«, sagte sie dann, da er sie weiter nicht beachtete. »Dann melde dich, wenn du noch etwas brauchst. Wenn deine Mutter anruft, sag ihr, dass alles gut geht. Sie soll sich keine Sorgen machen.«
Sie selbst ging zurück in die Küche und rauchte am Küchenfenster sehr viel mehr Zigaretten als gewöhnlich. Natürlich hätte sie ihm das alles nicht erzählen müssen und er hätte doch ruhig bei Tom Spencer bleiben können, aber das war doch noch lange kein Grund, sie einfach nicht zu beachten. Von solchen Kerlen hatte sie in ihrem Leben mehr als genug kennengelernt, Typen, die Frauen einfach ignorierten, sich für was Besseres hielten, aber sie zweifelte noch daran, dass Jona wirklich schon so einer geworden sein könnte. Sie hatte ja keine Ahnung, wie sich Kinder entwickelten, wenn sie erst einmal größer wurden, aber ihr Gefühl konnte sie doch nicht täuschen. Er war ganz sicher noch ihr Junge, auch wenn sie sich natürlich nicht mehr zu ihm legen würde wie früher, als sie niemals von seiner Seite gewichen war. Sie mussten sich jetzt erst einmal aneinander gewöhnen. Auch sie hatte sich womöglich verändert.
Kapitel 3
MILCHKALB UND SINTFLUT
Die Wand zwischen der Kammer und dem Schlafzimmer war so dünn, dass Gesomina sofort auf gewacht war, als Jonas Mutter mitten in der Nacht anrief. Er hatte gesagt, dass alles in Ordnung sei, dann herumgedruckst und schließlich genervt erwähnt, dass sie eine kranke alte Frau besucht hatten. Wenig später hatte Gesominas Telefon geklingelt, das bei ihm im Zimmer stand. Sie hatte ihn nicht stören wollen und ab gewartet, bis sich nach kurzem Klingeln der Anrufbeantworter einschaltete. Es war wieder seine Mutter gewesen, die wild schimpfte, was Gesomina einfalle, ihren Sohn putzen zu lassen, ob sie dafür bezahlt werde. Wenn sich das wiederhole, werde sie Jona sofort von einer Freundin abholen lassen.
Als Jona am Morgen unsicher in der Küchentür stand, war Gesomina sofort klar, dass sie nicht so zu tun brauchte, als hätte sie nichts gehört. In der Nacht hatte sie sich kurz darüber geärgert, warum er seiner Mutter von Frau Rescher hatte erzählen müssen, nur hatte sie ihn auch nicht darum gebeten, ihren Besuch zu verschweigen. Jona war das Ganze unangenehm. Er hatte Gesomina nicht verraten wollen.
»Ich fands gut«, sagte er. »Bei der Frau mit den Büchern.«
»Du hast ihr sehr geholfen«, sagte sie und fragte ihn, ob er Kaffee schwarz oder mit Milch trinke.
»Kaffee?«, fragte er, und sie brauchte einen langen Moment, ehe sie verstand, warum er so seltsam grinste.
»Keinen Kaffee«, sagte sie dann. »Na klar, ganz wie du willst. Vielleicht Kakao?«
»Klar«, sagte er und setzte sich an den Tisch, auf dem ein Teller mit Ravioli dolci stand, die sie gleich nach dem Aufstehen gemacht hatte. Jetzt, da er sie daran erinnert hatte, dass er trotz seiner Größe eigentlich noch ein Kind war, fürchtete sie, dass er das Zitronat nicht mögen könne, das sie in die Ricotta-Füllung gegeben hatte. Sie rührte ihm einen besonders süßen Kakao an, der den Geschmack vielleicht überdecken würde, sah aber sofort, wie er sich Mühe gab, sich nichts anmerken zu lassen, als er in eins der Teilchen biss.
»Kinder mögen kein Zitronat«, sagte sie. »Das hätte ich wissen können.«
Er schüttelte den Kopf, aber sie nahm ihm das Gebäck schon aus der Hand und stellte den Teller weg.
»Quatschlappen?«, fragte sie.
»Klar«, sagte er und schob seine Haare hinters Ohr. »Immer.«
Sie gab mehrere Hände voll auf einen anderen Teller, und Jona griff gleich zu, so groß war sein Hunger.
»Gehen wir heute wieder hin?«, fragte er kauend.
»Nein, heute nicht. Nur montags.«
»Und wer hilft ihr? Bleibt sie den ganzen Tag im Bett?«