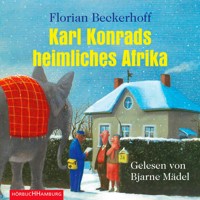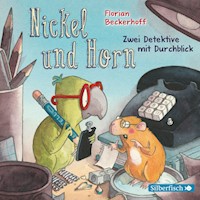9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Glück ist wartet manchmal an den ungewöhnlichsten Orten … Der warmherzige Sammelband von Florian Beckerhoff. FRAU ELLA: Gerade erst von der Freundin verlassen landet Sascha nun auch noch im Krankenhaus … und muss sich dort das Zimmer mit einer schnarchenden Oma teilen! Die wunderliche, aber liebenswerte Frau Ella entpuppt sich jedoch schon bald als charmante Zeitgenossin. Als ihr eine Operation droht, die sie gar nicht über sich ergehen lassen will, schmuggelt Sascha die 87-Jährige kurzerhand in seiner WG ein. Da ist das Chaos vorprogrammiert … DAS LANDEI: Rob hat es geschafft: super Job, klasse Auto, tolle Wohnung … und das alles ganz weit weg von dem Dorf, aus dem er nach dem Abi so schnell wie möglich geflohen ist. Eigentlich fehlt ihm jetzt nur noch die richtige Frau an seiner Seite – doch das ist sicher nicht Gabi, die Tochter seines alten Lehrers, die damals seine Haschplantage im Schulgarten enttarnt hat. Aber plötzlich steht ausgerechnet dieses Landei vor ihm. Und dann wird’s kompliziert … EIN SOFA VOLLER FRAUEN: Glück im Job, Pech in der Liebe ist das Lebensmotto von Sounddesigner Dickie. Seine Freunde melden ihn deswegen heimlich als Gastgeber fürs Couchsurfing an: eine der Touristinnen, die sich fortan die Klinke zu Dickies Wohnung in die Hand geben, sollte doch nun wirklich ein Herz für ihn haben! Aber ganz so einfach ist es nicht … Dieser humorvolle Sammelband wird Fans von Fredrick Backmann und Carsten Henn begeistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 919
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
FRAU ELLA: Gerade erst von der Freundin verlassen landet Sascha nun auch noch im Krankenhaus … und muss sich dort das Zimmer mit einer schnarchenden Oma teilen! Die wunderliche, aber liebenswerte Frau Ella entpuppt sich jedoch schon bald als charmante Zeitgenossin. Als ihr eine Operation droht, die sie gar nicht über sich ergehen lassen will, schmuggelt Sascha die 87-Jährige kurzerhand in seiner WG ein. Da ist das Chaos vorprogrammiert …
DAS LANDEI: Rob hat es geschafft: super Job, klasse Auto, tolle Wohnung … und das alles ganz weit weg von dem Dorf, aus dem er nach dem Abi so schnell wie möglich geflohen ist. Eigentlich fehlt ihm jetzt nur noch die richtige Frau an seiner Seite – doch das ist sicher nicht Gabi, die Tochter seines alten Lehrers, die damals seine Haschplantage im Schulgarten enttarnt hat. Aber plötzlich steht ausgerechnet dieses Landei vor ihm. Und dann wird’s kompliziert …
EIN SOFA VOLLER FRAUEN: Glück im Job, Pech in der Liebe ist das Lebensmotto von Sounddesigner Dickie. Seine Freunde melden ihn deswegen heimlich als Gastgeber fürs Couchsurfing an: eine der Touristinnen, die sich fortan die Klinke zu Dickies Wohnung in die Hand geben, sollte doch nun wirklich ein Herz für ihn haben! Aber ganz so einfach ist es nicht …
Über den Autor:
Florian Beckerhoff, geboren 1976 in Zürich, wuchs in Bonn auf. Nach seinem Studium der Literaturwissenschaften in Berlin und Paris promovierte er an der Universität Hamburg über literarische Schwerversprecher und arbeitete danach unter anderem als Sprachlehrer, Museumswärter und Werbetexter. Seinem Bestseller »Frau Ella«, der mit Matthias Schweighöfer verfilmt wurde, folgten zahlreiche Romane und Kinderbücher. Florian Beckerhoff lebt heute mit seiner Familie in Berlin.
Bei dotbooks veröffentlichte Florian Beckerhoff seine Romane »Frau Ella«
»Das Landei«
»Ein Sofa voller Frauen«
»Der Weltenträumer – Karl Konrads heimliches Afrika«
»Die Geschichtenerzählerin: Ein Sommer bei Gesomina«
»Die Glückssuchenden: Herrn Haiduks Laden der Wünsche« – erscheint im Hörbuch bei Saga
***
Sammelband-Originalausgabe Juni 2024
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Frau Ella« 2009 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin/List Verlag. Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Das Landei« 2011 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München. Das Zitat auf Seite 244 ist entnommen aus: Homer, DIE ODYSSEE. Deutsch von Wolfgang Schadewaldt. Copyright © 1958 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Originalausgabe von »Ein Sofa voller Frauen« 2014 Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin. Copyright © der Neuausgabe dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-390-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Frau Ella & Das Landei & Ein Sofa voller Frauen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Florian Beckerhoff
Frau Ella, Das Landei & Ein Sofa voller Frauen
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Frau Ella
Muss das Leben denn wirklich so kompliziert sein? Gerade erst ist er von seiner Freundin verlassen worden, nun landet Sascha auch noch im Krankenhaus … und muss sich dort das Zimmer mit einer schnarchenden Oma teilen! Was sich wie ein Albtraum anhört, entpuppt sich bald als charmante Zufallsbekanntschaft, denn Frau Ella ist zwar etwas aus der Zeit gefallen, aber auch ungemein liebenswert. Als ihr eine Operation droht, die sie so gar nicht über sich ergehen lassen will, schmuggelt Sascha sie kurzerhand aus der Klinik – und quartiert die 87-Jährige in seiner WG ein. Ist ja nur für eine Nacht, denkt Sascha. Doch da hat er die Rechnung ohne Frau Ella gemacht … und ohne das Leben, das immer genau dann Kapriolen schlägt, wenn man es am wenigsten erwartet!
»Der wahre Maßstab der Reife eines Menschen ist nicht, wie alt er ist, sondern wie er darauf reagiert, wenn er mitten in der Stadt in seinen Unterhosen aufwacht.«
Woody Allen
Kapitel 1
Sie wäre die letzten paar Jahre ihres Lebens auch mit einem Auge zurechtgekommen. Wenn man sie gelassen hätte. Was brauchte sie in ihrem Alter noch zwei Augen? Mit fast neunzig Jahren. Da lag sie jetzt in diesem kargen Krankenhauszimmer und beobachtete, wie seit vielleicht einer halben Stunde Wasser aus dem Bad strömte, mittlerweile den ganzen grauen Boden des Raumes bedeckte und silbern zum Glänzen brachte. Noch stand das Wasser nicht höher als bis zur Sohle ihrer Schuhe unter der Garderobe. Die hatte sie vorhin nicht in den Schrank geräumt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch das Leder nass würde, und dann wären die guten Schuhe dahin. Da hatte der Herr Doktor ihr was eingebrockt. Und sie hatte eingewilligt, in diese Klinik zu gehen. Wegen eines Auges! Sie musste etwas tun. Zumindest ihre Schuhe in Sicherheit bringen.
Ganze zwei Tage lag sie schon in diesem Zimmer. Freitagmittag war sie pünktlich in der Aufnahme erschienen, um sich das Auge machen zu lassen, dieses lästige eiternde Ding. Keine große Sache sei das, hatte der Herr Doktor gesagt. Ein kleiner Schnitt, ein Wochenende Ruhe, spätestens Dienstag wäre sie wieder zu Hause. Das müsse es ihr wert sein, um die Welt anschließend wieder mit beiden Augen in ihrer ganzen Schönheit sehen zu können. Dabei war sie vollkommen zufrieden gewesen mit der Welt, die sie sah, auch wenn das Auge immer wieder juckte. Wann, wenn nicht in ihrem Alter sollte der Körper anfangen, neue Wege zu gehen? Davon hatte der Herr Doktor nichts hören wollen. Hatte nur weiter auf sie eingeredet, dass es keine kleinen Krankheiten gebe, dass man immer eine Blutvergiftung riskiere. Daran, dass sie im Krankenhaus ertrinken könnte, hatte er wohl nicht gedacht.
Kerngesund lag sie jetzt hier am helllichten Tag im Bett, als hätte man sie vergessen. Bloß, dass die unfreundlichen Schwestern regelmäßig diese Mahlzeiten servierten, gegen die nicht nur ihr Gaumen, sondern auch ihr Darm rebellierte. Zum Glück war sie allein auf dem Zimmer. Wie Urlaub im Hotel sei so ein Klinikaufenthalt, hatte der Herr Doktor gesagt. Darauf konnte sie gut verzichten, auf Urlaub an sich und auf so einen erst recht. Die letzten vierzig Jahre war sie sehr gut ohne Urlaub ausgekommen. Und jetzt wurde auch noch ihr Zimmer überschwemmt. So konnte das nicht weitergehen. Ihre Hand zitterte. Sie wollte ja niemandem zur Last fallen, aber irgendetwas musste passieren. Sie drückte die Klingel. Hier konnte sie unmöglich bleiben.
Kapitel 2
Zurück von einem kleinen Ausflug in die Cafeteria des Krankenhauses, wollte er nicht glauben, dass das sein Zimmer war. Strahlend weiß stand da sein Bett, seine Bücher stapelten sich auf dem Nachttisch, seine Lederjacke hing an der Garderobe. Und da lag sie, auf dem Rücken, den Mund halb offen, und röchelte vor sich hin. Blässlich graues Haar zu Locken gedreht, ein zerfurchtes Gesicht, Falten, die in sämtliche Himmelsrichtungen liefen, ein schwabbeliges Doppelkinn, das rechte Auge unter einem schlaffen Lid, das linke unter einem Pflaster. Das letzte Mal, dass er näheren Kontakt zur Generation seiner Großeltern gehabt hatte, lag Jahre zurück, und er hatte nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Und jetzt diese schnarchende alte Schachtel in seinem Zimmer, die ihm das Leben zur Hölle machen würde. Daran bestand kein Zweifel.
Noch in der offenen Tür stehend, verfluchte er sein Fahrrad, seine Brille, den Alkohol, den unbeleuchteten Weg durch den Park und sich selbst. All diejenigen, die ihm das eingebrockt hatten. Der allererste halbwegs laue Abend des Jahres! Als er nach seinem Aufprall auf den Asphalt begriffen hatte, dass ein Bügel seiner Brille in einem seiner Augen steckte, war ihm sofort klar gewesen, dass der Start in den Sommer ganz und gar nicht seinen Erwartungen entsprechen würde. Schon beim Vorspiel war alles in die Hose gegangen. Sein verzweifeltes Stöhnen hatte weniger dem körperlichen Schmerz gegolten als der seelischen Belastung durch all die lästigen Dinge, die folgen würden. Das war noch keine Woche her.
Was hatte er hier verloren? Als könnte er sich selbst aus einem Alptraum befreien, ließ er die Tür knallend ins Schloss fallen. Er wachte genauso wenig aus seinem Alptraum auf wie seine neue Zimmergenossin aus ihrem lärmenden Mittagsschlaf. Auf dem Weg zu seinem Bett stieß er gegen einen der beiden Holzstühle, hustete laut, sah kurz in den Schrank, um dessen Tür gleich wieder zuzuschlagen. Unbeeindruckt schnarchte sie weiter vor sich hin. Etwas vorsichtiger schlich er an sie heran und sah ihr neugierig in den Mund. Hinter schmalen, blutleeren Lippen glänzten zwei Reihen weißer Zähne. Wenn die mal echt waren. Als er seine rechte Hand ausstreckte, um ihr die Nase zuzuhalten, änderte sich plötzlich der Rhythmus ihrer Schnarcherei. Er fühlte sich beobachtet und trat den Rückzug an. Wenn sie auch nachts so lärmen sollte, würde er weniger schüchtern sein und zugreifen. Dann schlurfte er die drei Schritte rüber zu seinem Bett, schlüpfte aus den Hausschuhen und ließ sich fallen, um mit dem Gedanken daran, dass er sich jetzt auch einen runterholen könnte, Trübsal zu blasen. Jeder Tag war wie ein Langstreckenflug, einmal um den Globus, in der Touristenklasse, mit schlechten Filmen, übergewichtigen, schwitzenden Sitznachbarn, warmen Getränken, Käsescheiben, die den Geschmack der sich an sie schmiegenden Wurst angenommen hatten. Ihm war schlecht, aber nicht schlecht genug, als dass er hätte kotzen können.
Wie war er nur in diese Scheiße geraten? Plötzlich war die ganze Energie weg, die er im Winter gesammelt hatte, um endlich loszulegen. Selbst der strahlend blaue Himmel draußen erinnerte ihn an sein Scheitern, daran, dass er hatte aufbrechen wollen und im Leben dieser oder einer anderen Stadt dieses oder jenes zu bewirken. Immer dieselben Gedanken, so originell wie ein schmerzender Pickel, der nicht so weit reifen wollte, dass er ihn hätte ausdrücken können. So wie sein Auge, das juckte, aber nicht weh tat, das verletzt, aber nicht zerstört war, das sich irgendwie im Vagen hielt und Zeit brauchte. Er müsse Geduld haben, sich möglichst viel Ruhe gönnen und abwarten, hatten sie ihm immer wieder gesagt, mit diesem wohlwollenden Blick. Er war verloren im Zwischenbereich.
Er tastete nach der Fernbedienung und suchte eine Tiersendung, als er zunächst ungläubig, dann beim zweiten Mal mit voller Gewissheit hörte, wie seine neue Zimmernachbarin in der kurzen Pause zwischen einem Ein- und Ausatmen, mit einer Kraft, die er keiner Frau, und schon gar nicht einer dieses Alters, zugetraut hätte, furzte. Er drehte sich um und blickte in ein von faltiger Haut fast verdecktes, verschlafenes blaues Auge, das ihn musterte. Eine Oase in trockener Steppe. Ein glänzendes Wasserloch. Wie verdorrte Sträucher krümmten sich einige Haare auf ihrem Kinn. Eine fremde Welt.
»Da bin ich doch tatsächlich mitten am Tag eingeschlafen«, sagte sie verträumt und lächelte. »Freitag. Ella Freitag.«
»Sascha«, stammelte er. »Sascha Hanke.«
»Aha«, sagte sie.
Unsicher, ob sie sich mit ihm unterhalten wollte und ob er sich darauf einlassen sollte, zögerte er, die Kopfhörer aufzusetzen, wusste aber auch nicht, was er noch sagen könnte.
»Und, waren Sie schon unterm Messer?«, fragte sie.
»Ja, vor Tagen.«
»Schlimm?«
»Nicht wirklich. Heilt aber irgendwie nicht.«
Sie beäugte ihn weiter, noch etwas verschlafen, aber anscheinend nicht unfreundlich.
»Entschuldigen Sie, wenn ich so unverschämt bin. Aber könnten Sie mir vielleicht meinen Morgenmantel aus dem Schrank reichen?«
Er brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass sie ihn, kaum hatten sie die ersten Worte gewechselt, schon zum Diener degradierte. Sollte sie sich ihren Morgenmantel doch selber holen! Wortlos stand er auf und reichte ihr das Stück Stoff, das mit seinem verblassten Blumenmuster vor Jahrzehnten vielleicht einmal modern gewesen war, und legte sich wieder hin.
»Vielen Dank«, sagte sie. »Wissen Sie, Sie sind seit dem Tod meines Mannes der erste Mann, mit dem ich in einem Zimmer schlafe. Das ist immerhin schon zwanzig Jahre her. Da wird man wohl etwas schüchtern. Seltsam, so einen Morgenmantel am Nachmittag zu tragen. Wäre ich nur mal zu Hause geblieben.«
Wieder war ihm nicht gleich klar, was sie ihm sagen wollte. Die Jahre zwischen ihnen waren ein Gebirgszug zwischen zwei Völkern. Sie hatten sich zufällig auf der Passstraße getroffen, nicht feindselig, nur verständnislos. Sie würden sich grüßen, um anschließend wieder jeder seines Wegs zu ziehen. Erst als er sah, wie sie unter ihrer Decke in den Bademantel schlüpfte und dann, mit einem entschuldigenden Lächeln in seine Richtung, langsam aufstand und ins Badezimmer ging, verstand er.
»Keine Ursache«, murmelte er. »Ist doch ganz normal.«
Dann sah er einer verschwommenen Gruppe Nilpferde beim Baden in einem Schlammloch zu. Er brauchte dringend seine Ersatzbrille, dachte er, als die Alte zurückkam und sich vorsichtig, aber durchaus nicht unbeholfen wieder auf ihr Bett legte.
»Das war sehr freundlich von Ihnen,« sagte sie.
»Schon gut.«
»Bitte?«
»Was?«
»Entschuldigen Sie, gelegentlich höre ich ein wenig schlechter als früher. Was sagten Sie?«
»Schon gut«, sagte er lauter. »Sie würden das ja auch für mich tun, wenn, na ja, wenn ich eher der Ältere wäre.«
Sie kicherte wie ein Mädchen, hüstelte gleichzeitig wie eine Dame.
»Na, Sie haben ja lustige Ideen. Was spielen sie denn eigentlich da im Fernsehen?«
»Irgendein Tierfilm.«
»Aha. Interessiert Sie das beruflich?«
Er schwieg, betrachtete die Nilpferde aus der Unterwasserperspektive, wie sie tonnenschwerelos herumpaddelten. Das konnte so nicht weitergehen. So unbefriedigend es war, ohne Brille fernzusehen, er war nicht bereit, dieses Gespräch und ihre dauernden Ahas weiter zu ertragen. Er wollte ein anderes Zimmer. Was fiel denen überhaupt ein, ihm eine Frau, und noch dazu eine solche, zuzumuten? Er war Patient und nicht Sozialarbeiter. Er zahlte seine Krankenkassenbeiträge. Er wollte seine Ruhe. Er würde nicht antworten. Nie wieder.
Da wurde ihm plötzlich klar, dass das nicht die Stimme des Tierforschers war, die er jetzt hörte, sondern die seiner neuen Nachbarin.
»Ja, davon hat er immer geträumt, mit Tieren zu arbeiten, aber so eine Anstellung gibt man so schnell ja nicht auf, und dann war er plötzlich tot. Und ich hab ihm noch immer gesagt, Stanislaw, hab ich gesagt, wegen mir kannst du machen, was du willst. Heute wäre das ja etwas anderes. Das ist ja alles längst voll automatisifiziert.«
Er stöhnte.
»Ist Ihnen nicht gut? Schmerzt Ihr Auge sehr?«
»Alles in Ordnung.«
»Bitte?«
»Alles in Ordnung«, schrie er.
»Aha.«
Eine Herde Zebras trabte gemächlich an den Rand des Wasserlochs. Er schielte vorsichtig zu seiner Nachbarin hinüber, sah, dass sie wieder aufgestanden war und sich daranmachte, den Inhalt ihres Koffers in den Schrank zu räumen. Ein dunkelblauer Stoffkoffer mit gelblichen Streifen, als käme sie aus einer anderen Zeit. Vielleicht war es ja genau das. Er bemerkte zu spät, dass sie sich umwandte und ihn mit ihrem einen Auge dabei ertappte, wie er sie beobachtete. Sie musste seinen Blick gespürt haben, selbst diesen vorsichtig diskreten, einäugigen Augenwinkelblick.
»Ist Ihre Tiersendung schon aus?«, fragte sie.
Er schloss sein Auge, so schnell er konnte.
»Stanislaw hat auch immer gern ferngesehen, nicht tagsüber natürlich, aber abends, wenn er noch wach bleiben musste wegen der Schichten. Tagsüber, hat er immer gesagt, tagsüber ist draußen genug zu sehen. Ich habe mir auch hin und wieder ein Programm angesehen, abends die Spielfilme mit all den wunderschönen Frauen, denen so unglaubliche Dinge zustoßen, aber seit ein paar Jahren funktioniert der Kasten nicht mehr. Die vom Fernsehen haben da irgendeine neue Technik, die mein Gerät zerstört hat, aber ich muss ja nachts auch nicht aufbleiben.«
»Das ist jetzt digitalisiert«, sagte er, ohne nachzudenken.
»Bitte?«
»Digitales Fernsehen. Das ist ein neues Sendeformat. Sie brauchen dafür einen neuen Empfänger.«
Er machte sein Auge auf und sah, wie sie ihn skeptisch musterte.
»Sie meinen, mein Fernseher ist gar nicht kaputt?«
»Er ist zu alt. Er versteht die Signale nicht mehr.«
»Und diese Signale heißen digitalisifiziert?«
»Digitalisiert.«
»Und deswegen muss man dann den alten Fernseher wegwerfen?«
»Nicht ganz. Sie brauchen einen anderen Empfänger für die neuen Signale. Vorausgesetzt, Ihr Fernseher hat den richtigen Anschluss.«
»Aha. Das sind ja Dinge.«
Er hörte erleichtert, wie es an der Tür klopfte. Ohne eine Antwort abzuwarten, rauschte eine Schwester samt Rollstuhl ins Zimmer.
»Ist nur provisorisch wegen Wasserschaden«, nuschelte sie und widmete sich dann ganz seiner neuen Zimmergenossin, die sie zur Voruntersuchung abholte und hierzu mit geübtem Griff in den Rollstuhl beförderte. Die Alte lächelte in seine Richtung, amüsiert und zugleich überrascht.
»Wenn ich nicht wiederkomme, verständigen Sie die Polizei«, rief sie, schon unterwegs zur Tür. Von wegen, dachte er und musste trotzdem grinsen. Wenn man keinen Fernseher hatte, musste man vielleicht ein bisschen mehr reden, überlegte er. Aber warum ausgerechnet in seinem Zimmer?
»Hals- und Beinbruch«, murmelte er.
Die Tür war kaum zugefallen, da griff er sich unter dem ausgeleierten Gummizug seiner Trainingshose hindurch zwischen die Beine und seufzte erleichtert, während sich auf dem Bildschirm eines der Zebras etwas zu weit von seiner Herde entfernt hatte und demnächst in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde. Er kannte den Film, erinnerte sich jedoch nicht daran, ob die Gefahr vom Wasser oder vom Land her drohte. Krokodil oder Löwin? Vielleicht täuschte er sich aber, und das Zebra käme ganz munter davon. Ob ihn das beruflich interessiere? So eine Schreckschraube.
Seine Bettnachbarin hatte es tatsächlich noch geschafft, vor ihrem Abtransport Decke und Kissen glattzustreichen und ihren Koffer im Schrank unterzubringen. Ihre Schuhe standen gerade so nah aneinander unter der Garderobe, dass sie sich nicht berührten und auch mit der Spitze nicht an die Wand stießen. Darüber hing ihr Mantel, gerade wie ein Kamin. Plötzlich kamen ihm sein Bett und der grässlich gräuliche Turm auf Rollen, der als Nachttisch diente, unaufgeräumt vor, von seinem Schrank ganz zu schweigen. Das fehlte noch, dass irgendwelche Kindheitstraumata hochkamen, nur weil man ihm diese alte Spießerin ins Zimmer legte! So viel Mühe er sich auch gab, das Zebra zu fixieren und irgendwie zumindest eine Erektion zu bekommen, das Gefühl, dass sein Verhalten zu wünschen übrigließ, blieb.
Schließlich hieb er mit aller Kraft auf die unter ihm liegende Bettdecke ein und stand auf, um aufzuräumen. Als er sich nach seinen Hausschuhen bückte, die unter das Bett gerutscht waren, schoss ihm das Blut ins Auge, ein stechender Schmerz zuckte durch seinen Schädel. Es war überhaupt der erste richtige Schmerz seit seiner Operation. Fluchend griff er nach seinen Hausschuhen und schleuderte sie einen nach dem anderen gegen das Bett seiner Nachbarin, der Frau, die seiner über die letzten Tage mühsam gepflegten Krankenhaus-Zufriedenheit ein Ende bereitet hatte. Er stand ruckartig auf, ignorierte den Schmerz, zerwühlte ihr komplettes Bett, diesen sich strahlend weiß windenden Vorwurf, stürzte zur Garderobe, um ihre vorbildlich gepflegten alten Lederschuhe mit einem Tritt durchs Zimmer zu schießen, griff nach ihrem Mantel, um ihn irgendwie aus seiner aufdringlichen Geradlinigkeit zu bringen, wobei der plötzlich nachgab und er rückwärts gegen die Wand stolperte, sich den Hinterkopf stieß und zu Boden ging. Jetzt ließ sich der Schmerz nicht mehr ignorieren. Er zerfraß die Wut, an deren Stelle pure Verzweiflung blieb.
Derart geschlagen vor der Zimmertür sitzend, stellte er, kaum hatte der Schmerz etwas nachgelassen, fest, dass der Aufhänger des Mantels gerissen war. Das kleine, stumpf goldene Kettchen baumelte, nur noch an einem Ende befestigt, an der Innenseite des Kragens. Er hätte heulen können, doch so eine Voruntersuchung würde nicht ewig dauern. Das musste er irgendwie wieder hinkriegen, nur würde er hier auf Anhieb kaum Nadel und Faden auftreiben können. Stöhnend raffte er sich auf und hängte den Mantelkragen über den Haken. Nichts mehr hatte der von seiner ursprünglichen Geradlinigkeit. Ein unförmiges Stück Stoff, unterhalb des Kragens zeichnete sich der Knauf des Garderobenhakens ab wie eine krankhafte Beule, ein Geschwür. Natürlich harmonisierte das jetzt wesentlich besser mit seiner Lederjacke, aber darum ging es nicht mehr. Im Kleiderschrank fand er zwei unbehangene Kleiderbügel, denen er schnell seine Jacke und ihren Mantel überzog, um sie dann zurück in den Schrank zu hängen. Ein rotes A und ein blaues B markierten, welches Schrankfach hier wem gehörte. Wie im Kindergarten. Noch einmal musste er vor Schmerz stöhnend auf die Knie, um ihre Schuhe und seine Pantoffeln unter den Betten zusammenzuklauben und ordentlich hinzustellen. Schnell strich er noch Kopfkissen und Decke des Nachbarbetts glatt, brachte den Zahnputzbecher, der ungenutzt auf seinem Nachttisch stand, ins Badezimmer, schob seine Bücher so zusammen, dass sie bündig an der Nachttischkante anschlossen, und ließ sich endlich auf sein Bett fallen. Im Fernsehen spielten Löwenkinder mit den Resten des Zebras.
»Wegen dieses lächerlichen Auges unter die Erde, das kann ja wohl nicht wahr sein«, hörte er und versuchte, sich in einem Traum zurechtzufinden, der keinen Sinn ergab. Da stellte er fest, dass er wach war. An dem kleinen quadratischen Holztisch, der zu Füßen der beiden Betten an der Wand stand, saß eine alte Frau, in der er nach kurzem Stutzen seine provisorische Zimmergenossin erkannte. Sie las irgendeinen Zettel, sicher diese Verzichtserklärung, die auch er vor der Operation unterschrieben hatte.
»Sie hätten wirklich nicht aufräumen müssen, junger Mann«, sagte sie und lächelte ihn mit ihrem strahlend blauen Auge an. »Ich bin hier ja schließlich der Eindringling.«
Es war zu spät, um sich schlafend zu stellen. Sie hatte längst gemerkt, dass er wach war.
»War nur so ’ne Laune.«
»Fernsehen am helllichten Tag ist ja auch eine seltsame Sache, Wasser zum Brunnen tragen, hat mein Stanislaw das genannt. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihnen gar nicht zur Last fallen, aber haben Sie auch diesen Todesbrief unterschrieben?«
»Ist nur eine Formsache. Die müssen sich absichern.«
»Ja, aber wogegen denn, wenn nichts passieren kann?«, fragte sie und sah ihn verwundert an.
»Theoretisch kann etwas passieren, irgendwas, keine Ahnung.«
»Also doch.«
»Nein, nur theoretisch.«
»Und warum dann der Zettel, wenn nichts passiert?«, lachte sie, als machte sie sich über ihn lustig. »Gibt mir meine Nachbarin denn ihren Schlüssel, wenn sie weiß, dass sie ihren nie verlieren wird?«
Wo sie recht hatte, hatte sie recht, nur brachte diese Einstellung sie im Moment nicht wirklich weiter.
»Bei mir ist schließlich auch alles gutgegangen. Also im Prinzip zumindest, bis auf die Heilung. Außerdem kann Ihre Nachbarin nicht wissen, dass sie ihren Schlüssel nie verlieren wird. So eine Sicherheit gibt es gar nicht. Wie gesagt, das ist theoretisch, das klappt schon.«
»Ja, bei Ihnen vielleicht. Aber nur weil einer über Schranke und Gleise klettert und rüberkommt, muss man das ja nicht gleich nachmachen, oder?«
»Zeigen Sie mal her«, stöhnte er schließlich, raffte sich auf und setzte sich zu ihr an den Tisch.
Nach kurzem Zögern war er sich sicher, dass sie eine ganz andere Erklärung unterschreiben sollte als er. Die meisten Punkte bezüglich möglicher Nebenwirkungen, Unfällen und höherer Gewalt waren die gleichen, aber warum wollte man ihr eine Vollnarkose verpassen, um an ihrem Auge herumzuschnippeln?
»Wollen Sie unbedingt eine Vollnarkose?«
»Ach was!«, rief sie und lachte aufgeregt. »Der Herr Doktor meint aber, dass das sein müsse. Aus medizinischen Gründen. Da sind schon ganz andere nicht wieder aufgewacht! Wegen diesem blöden Auge unter die Erde, das ist ja lächerlich! Das kann ich doch nicht unterschreiben.«
»Wollen Sie nicht Ihren Hausarzt anrufen oder irgendjemanden?«, fragte Sascha. Mit einem Mal wirkte sie fast verzweifelt.
»Der Herr Doktor ist ja gerade im Urlaub«, sagte sie leise, als suchte sie nach einer Lösung.
»Und Verwandte oder Freunde?«
»Ach, hören Sie doch auf. Ich komme sehr gut allein zurecht.«
»Nichts für ungut.«
Wenn sie keine Hilfe wollte, warum fragte sie ihn dann? Er stand auf, ging zurück zu seinem Bett, legte sich hin und tat, als würde er lesen. Eine alte Spießerin, die auch noch einen Knall hatte und einem blöd kam, wenn man helfen wollte. Großartig. Wofür genau wollte man ihn eigentlich bestrafen? Er sehnte sich danach, sein Zimmer wieder für sich zu haben.
Nach einer Weile schaffte er es trotz ihres unverständlichen Gemurmels, trotz ihrer ganzen aufdringlichen Anwesenheit, ein paar Seiten zu lesen. Kaum hatte er aber wieder in die Geschichte hineingefunden, klopfte es, und eine Schwester, klein, ziemlich dick und mit kurzen rotgefärbten Haaren, stürmte ins Zimmer, stellte die beiden Plastiktabletts mit dem Abendessen auf den Tisch und nahm den Zettel, den seine Zimmernachbarin die ganze letzte Stunde angestarrt haben musste.
»Sie haben ja noch gar nicht unterschrieben?«, rief die Schwester, als habe sich ihre vierjährige Tochter in die Hose gemacht. »Frau Freitag, hören Sie mich? Sie halten mich auf!«
»Wir haben beschlossen, dass eine Vollnarkose unnötig ist«, sagte die Alte.
»Na, die Entscheidung überlassen wir mal schön dem Herrn Doktor«, lachte die Schwester und zwinkerte ihm zu. »Wenn ich die Tabletts holen komme, haben Sie das schön unterschrieben, ja? Und jetzt einen Guten!«
Als die Schwester das Zimmer verlassen hatte, raffte er sich auf, setzte sich widerwillig auf den Stuhl, den er vorhin so fluchtartig verlassen hatte. Das blassblaue Tablett bot das gleiche Trauerspiel wie in den vergangenen Tagen. Sie behandelten einen nicht nur, als sei man minderwertig, sie fütterten einen auch dementsprechend. Kein Wunder, dass sein Auge so langsam heilte. Er blickte vorsichtig auf und sah, wie seine Nachbarin fein säuberlich Butter auf dem Graubrot verteilte, anschließend mit Messer und Gabel nach der schwitzenden Scheibe Käse griff und diese akkurat platzierte. Musste er sein Brot jetzt auch mit Messer und Gabel essen? Er starrte wieder auf sein Tablett und griff mit den Fingern nach dem wenigen, das er dort finden konnte. Während er vor sich hin kaute, spürte er, dass sie ihn anstarrte. Er sah auf. War das eine Träne, die sich von ihrem Auge einen Weg über die faltige Wange suchte? Sie schwieg. Er senkte seinen Blick wieder und griff nach einem der beiden altersschwachen Radieschen, das nicht einmal mehr zwischen seinen Zähnen knackte.
»Schweine sind das.«
»Entschuldigung?«
»Schweine, Dreckskerle, Quacksalber, Kurpfuscher! Seit einer Woche dieser Ekelfraß, als könnte ich nicht auch zu Hause auf dem Sofa liegen und mir eine Pizza bestellen!«
»Was soll ich denn tun?«, flüsterte sie verzweifelt.
»Unterschreiben und beten.«
»Meinen Sie wirklich?«
Was sollte er dazu sagen? Was ging es ihn an, was mit irgendeiner Halbtoten passierte? Er wollte hier einfach raus.
»Quatsch!«, sagte er.
»Aber was soll ich denn dann tun?«
Sie sahen sich gegenseitig ins Auge, sie verzweifelt, er langsam eher frustriert als wütend.
Er zögerte nur kurz, griff dann nach dem Zettel, legte ihn in die Tischmitte, stieß seine Tasse um. Zum Glück war der Kakao nicht so wässrig, dass er überhaupt keine Spuren hinterließ.
»Das tut mir aber leid«, sagte er und fragte sich, was er da gerade getan hatte. »Ich werde Zusehen, dass die Schwester Ihnen morgen früh einen neuen Zettel bringt.«
An der Bewegung ihrer Stirnfalten konnte er ablesen, dass sie beide Augenbrauen hob, auch wenn aufgrund des großen weißen Pflasters nur die eine zu sehen war.
»Vielleicht kommt uns ja heute Nacht eine Idee«, flüsterte sie fast, und er hatte das unangenehme Gefühl, dass er aus dieser Geschichte so leicht nicht wieder herauskommen würde.
Der Schwester war anzumerken, dass sie eine Verschwörung witterte, als er sich später für sein Missgeschick entschuldigte. Er gab sich jedoch alle Mühe, ihren Verdacht zu zerstreuen, forderte sogar, für die Nacht in ein Einzelzimmer verlegt zu werden. Er erinnerte sich noch gut genug an seinen nachmittäglichen Ärger, um die Rolle des erbosten Patienten glaubhaft spielen zu können. Am Ende war er so überzeugend, dass die Schwester sich noch einmal entschuldigte und nur ihm eine gute Nacht wünschte.
»Nehmen Sie auch ein Gläschen Klosterfrau?«, hörte er die Alte fragen, kaum dass die Tür ins Schloss gefallen war. Da saß sie und lächelte, während er sich erst einmal wieder zurechtfinden musste. Er hatte sich so in seinen Ärger hineingesteigert, dass er ganz vergessen hatte, dass sich die Situation ganz grundlegend verändert hatte. Er war einen Pakt eingegangen, und jetzt forderte man seinen Beitrag. Nur, was hatte er davon? Resigniert zuckte er mit den Schultern und nickte.
Sie ging ins Badezimmer, kehrte mit den beiden Zahnputzbechern zurück an den Tisch und schenkte ihnen zwei Fingerbreit Melissengeist ein, den sie aus ihrem Koffer geholt hatte.
»Prost, und vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte sie ernsthaft.
»Prost! Würde es Ihnen übrigens etwas ausmachen, mich zu duzen? Ich bin der Sascha.«
»Prost, Sascha.«
»Prost, Frau Ella«, sagte er, unfähig, sich an ihren Nachnamen zu erinnern.
»Frau Ella. So hat mich in den letzten siebenundachtzig Jahren noch niemand genannt.«
Vielleicht lag es an dem Melissengeist, vielleicht hatte er auch einfach nicht mehr die Kraft, sich über sein Schicksal zu ärgern, vielleicht war er auch bloß froh, seit einer Woche endlich wieder einen Abend in Gesellschaft zu verbringen. Jedenfalls merkte er plötzlich, dass er grinsen musste.
»Irgendwann ist immer das erste Mal«, sagte er, griff nach der Flasche und gönnte sich noch zwei Fingerbreit von der Klosterfrau, die viel besser schmeckte, als er zu hoffen gewagt hätte.
Der Klosterfrau war es wohl auch zu verdanken, dass er in der Nacht nichts gegen Frau Ellas Schnarchen unternehmen musste. Als Sascha langsam aufwachte und versuchte, sich in dieser Krankenhauswelt zurechtzufinden, an die er sich nicht gewöhnen konnte, musste er fast lachen über das, was wenige Meter neben ihm vor sich ging. Er war fasziniert, wie ein derart kleiner und magerer Körper solche Geräusche hervorbringen konnte. Wie ein Säugling, nur dass sie schlief, während sie lärmte. Seltsamerweise störte ihn das Schnarchen jetzt nicht mehr. Vielleicht ging es ihm wie jungen Eltern, wenn das Schreien des eigenen Kindes in den Ohren klingt wie sanfte Musik.
Er war verwirrt und glücklich. Selbst der Himmel über den noch dunklen Bäumen im Park des Krankenhauses strahlte sanft und friedlich in versöhnlichem Rosa. Was er empfand, war das Gegenteil von einem Kater, ein Klosterfrau-Kätzchen, das sanft um seine Schläfen strich. Seit einer Woche wachte er Morgen für Morgen in diesem Zimmer auf, aber erst heute empfand er eine Art Gleichmut gegenüber seinem Schicksal, wenn nicht gar ein bisschen Freude. War er vielleicht noch besoffen? Er wusste ja nicht, wie dieses Gebräu wirkte, welche geheimen Kräfte die heiligen Damen dem Trank einhauchten, wenn sie im Kellergewölbe ihres Klosters um einen großen Bottich tanzten, in dem die heiligen Kräuter vor sich hin köchelten. Jedenfalls ging es ihm gut. So gut wie seit langem nicht mehr. So gut; dass er sich nicht vorstellen konnte, diesen Tag ohne einen Kaffee zu beginnen. Vorsichtig, um Frau Ella nicht zu wecken, die den Raum unbeeindruckt weiter mit ihrer genauso eigenwilligen wie gleichmäßigen Musik beschallte, stand er auf. Dann schlüpfte er in seine Hausschuhe, die er schön parallel und mit der Spitze an der imaginären Verlängerung der Bettkante platziert hatte, nahm seine Sportjacke aus dem Schrank und machte sich auf in Richtung Tür, hinaus in den noch stillen Flur und in die Cafeteria.
Auch von seinem Tisch an der Fensterfront aus war der Blick auf den morgendlichen Himmel beeindruckend, auf eine sehr natürliche Art und Weise kitschig. Ein schmaler Streifen strahlend hellen Blaus schloss an die noch dunklen Kronen der Bäume an. Gleich darüber lagen, wie der Saum eines Prinzessinnenkleides, fein gemustert rosarote Wölkchen. Immer dunkler werdend, zog sich das zarte Kleidchen über den Himmel. Was für ein Anblick! In Gesellschaft eines Aluminiumkännchens Filterkaffee genoss er die Aussicht, spürte aber jetzt schon, wie ihn der Melissengeist langsam, aber sicher verließ. So langsam, dass er den Anblick des Himmels genoss und sich zugleich für seine Begeisterung schämte. Erst jetzt sah er auch die schwarzen Vögel auf der Scheibe, die ihm mit jedem Schluck Kaffee bedrohlicher erschienen. Er musste hier dringend raus. Er hielt den Himmel für ein Prinzessinnenkleid und fürchtete sich vor aufgeklebten Vögeln. Und das war bei weitem nicht das Schlimmste. Er war sich nicht einmal mehr zu schade dafür, mit einer Oma Klosterfrau zu saufen! Immerhin hatte er ihr nichts von sich erzählt, nicht angefangen, ihr sein Leid zu klagen, sich an ihrem welken Busen auszuheulen.
»Alles in Ordnung?«, fragte ihn nach einer Weile, in der er immer tiefer Trübsal blies, eine Angestellte, die seinen Kaffee abräumen wollte.
»Dann wäre ich wohl kaum hier.«
»Na, so schlimm wird’s schon nicht sein, oder?«, fragte sie.
»Nur Augenkrebs«, sagte er und freute sich über ihr erschrocken dummes Gesicht.
»Entschuldigen Sie bitte. Das tut mir leid«, stammelte sie.
»Nichts für ungut. Ist gar nicht so schlimm mit einem Auge.«
Dann stand er auf und ging. Er fühlte sich schon wieder etwas besser.
Zurück vor seiner Zimmertür, freute Sascha sich zwar nicht direkt auf die Gesellschaft seiner Bettnachbarin, doch immerhin sah er dem Wiedersehen recht gelassen entgegen. Der Flur war vollkommen ruhig, das ganze Krankenhaus schien noch zu schlafen. Er lauschte, konnte ihr Schnarchen aber nicht hören. Vielleicht war sie ja schon wach. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter und betrat das Zimmer.
»Guten Morgen«, säuselte sie wie blöde grinsend. Bei ihr wirkte der Geist der Melisse anscheinend noch länger als bei ihm.
»Guten Morgen, Frau Ella«, sagte er, hängte seine Sportjacke in den Schrank, schlüpfte aus seinen Hausschuhen, die er diesmal so in Position brachte, dass er beim nächsten Aufstehen direkt in sie hineinschlüpfen könnte, und ließ sich auf sein Bett fallen.
»Schauen Sie ruhig Ihre Tiersendung. Mich stören Sie nicht.«
»Ich lese jetzt erst mal.«
»Ja, ja.«
Er versuchte, sich auf sein Buch zu konzentrieren, wunderte sich jedoch zu sehr über die seltsame Verwandlung seiner Bettnachbarin. Das konnte unmöglich an diesen paar Schlücken Alkohol liegen. Er beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Dümmlich grinsend lag sie da auf dem Rücken und starrte die Decke an.
»Sagen Sie, Frau Ella«, setzte er schließlich an. »Und was haben Sie jetzt vor? Ich meine, wegen der Operation.«
»Danke der Nachfrage«, kicherte sie. »Aber das war wohl ein Missverständnis. Der Herr Doktor weiß schon, was richtig ist. Deswegen hat er ja studiert.«
»Wie bitte?«
»Da hätten Sie mich gestern nicht so verunsichern brauchen, junger Mann, auch wenn Sie das bestimmt gut gemeint haben. Aber schauen Sie ruhig Ihre Sendung, bitte.«
»Ich Sie verunsichert? Sind Sie noch ganz klar im Kopf? Sie wollen sich jetzt doch bei Vollnarkose operieren lassen? Trotz des Risikos?«
»Das ist nur ein theotaretisches Risiko.«
»Sagen Sie nicht, dass Sie diese Erklärung unterschrieben haben.«
Sie grinste weiter die Decke an. Normal war das nicht.
»Das heißt, die Schwester war schon da?«
»Und der Arzt. Der Chef persönlich!«
»Und Sie haben unterschrieben?«
»Aber natürlich! Warum denn nicht. Sonst hätte ich ja nicht herkommen brauchen, wenn ich mich nicht behandeln lassen will«, sagte sie amüsiert, als wäre er der Blöde. Sascha setzte sich auf, und ein weiterer Blick in ihr verschleiertes Auge reichte, um ihn davon zu überzeugen, dass er sich nicht täuschte.
»Die haben Ihnen doch was gegeben!«
Sie kicherte und kicherte. Er stand auf, stellte sich barfüßig ans Fußende ihres Bettes, die Hände auf der Eisenstange, und starrte sie ungläubig an.
»Frau Ella, was haben die Ihnen gegeben?«
»Einen kleinen Traubenzucker. Süß wie Rheinwein!«
»Und dann haben Sie unterschrieben?«
»Mit dem Arzt persönlich«, sagte sie zugleich stolz und amüsiert.
Das konnte doch nicht wahr sein, dass man eine wehrlose Alte hier einfach auf Drogen setzte, um dann ungestört an ihr herumzuschnippeln. Da konnte sie noch so dumm grinsen, das würde er nicht akzeptieren.
»Sie verlassen auf keinen Fall das Zimmer«, sagte er und stürmte auf den Flur, ohne an seine Hausschuhe zu denken.
In den wenigen Minuten seit seiner Rückkehr aus der Cafeteria war die Station zum Leben erwacht. Er sah die dicke rothaarige Schwester komplizenhaft in seine Richtung grinsen, doch ehe er sie ansprechen konnte, war sie an ihm vorbeigeeilt. Mit nur einem Auge und ohne seine Brille war es kaum möglich, Entfernungen richtig einzuschätzen. Der Raum verlor an Tiefe, war wirklich und unwirklich zugleich. Was war das nur für ein Morgen? Vor ihm versperrten plötzlich vier Putzmänner in hellblauen Kitteln den Flur.
»Ihr könnt jetzt nicht die Zimmer machen!«, hörte er eine kreischende Frauenstimme und erblickte hinter den Männern die Oberschwester.
Sascha drängte an den Männern vorbei.
»Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wo ich den Oberarzt finde?«, fragte er außer Atem die Schwester.
»Jetzt aber mal langsam, junger Mann. Visite ist bei Ihnen gegen neun.«
»Bitte. Wo ist der Arzt?«
»Halt!«, rief die Schwester und packte einen der Putzmänner am Kittel. »Ihr könnt da wirklich nicht rein!«
»Verdammt, wo ist der Arzt?!«, schrie er.
»Mein Gott, irgendwo auf Visite«, stöhnte die Schwester und zeigte den Flur hinunter.
»Wir wollen doch nur unsere Arbeit machen«, hörte er einen der Männer sagen. Dann stürmte Sascha weiter, riss eine nach der anderen die Türen der Krankenzimmer auf, ohne auch nur einen einzigen Assistenzarzt zu entdecken. Zimmer für Zimmer blickten ihn Patienten aus ihren mehr oder weniger lädierten Augen an, Blicke ohne jede Hoffnung darauf, dass vielleicht doch alles gut würde, jemand käme, um sie wie einen Menschen zu behandeln. Meist aber lagen die Blicke hinter Mull und Pflaster verborgen, und er konnte sie nur erahnen. Es war so deprimierend, dass er immer langsamer wurde, seine Wut sich zusehends verflüchtigte. Das hier war kein Ort, an dem Menschen gesund wurden. Menschen, die zum Nichtstun verdammt waren, die nur noch warten konnten. Ein Wartezimmer, aus dem es keinen Ausweg gab. Und das war nur die Augenstation. Wie ging es wohl auf den anderen Stationen zu, da, wo Frau Ella landen würde, wenn er nicht den Arzt fand? Da, wo man die Alten lagerte und an jede zur Verfügung stehende Maschine anschloss, um möglichst viel in Rechnung stellen zu können. Sollten sie machen, was sie wollten, aber nicht mit Frau Ella, nicht mit einer Frau, die ihm einen Drink spendiert hatte. Mit neuer Energie stürmte er weiter.
Er war fast am Ende des Flurs angelangt, als ihm aus einem Zimmer ein Pfleger entgegentrat.
»Was ist denn mit Ihnen los, Herr Hanke?«
»Ich muss mit dem Oberarzt sprechen. Es geht um Frau Ella.«
»Jetzt setzen Sie sich erst einmal.«
Der Pfleger legte ihm die Hand auf den Rücken und führte ihn zu einem der braunen Plastikstühle.
»Kommen Sie, setzen Sie sich. Sie sind ja vollkommen außer sich.«
»Hören Sie«, setzte er an, »Frau Ella, die Dame auf meinem Zimmer, soll gegen ihren Willen unter Vollnarkose operiert werden. Das ist vollkommen absurd. Die wacht doch nie wieder auf! Sie kann doch nicht wegen eines Auges sterben! Man kann doch auch mit einem Auge leben! Das ist doch lächerlich!«
»Herr Hanke, hallo, beruhigen Sie sich. Niemand wird gegen seinen Willen operiert, ob mit oder ohne Vollnarkose. Außerdem können wir Ihre Nachbarin heute wieder auf ihr eigenes Zimmer verlegen. Der Schaden ist behoben.«
»Von wegen verlegen! Das hört man doch andauernd, dass alte Menschen erst im Krankenhaus wirklich krank werden und sterben, obwohl sie zu Hause noch jahrelang glücklich leben könnten. An denen verdienen Sie doch Ihr Geld!«
»Herr Hanke, bitte, auf dieser Station stirbt überhaupt niemand. Kommen Sie, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Sie müssen sich beruhigen. Es gibt keinen Grund zur Sorge.«
Langsam, aber sicher ließ Sascha sich einlullen, wollte glauben, dass wahr war, was wahr sein sollte. Er stand auf und ließ sich den Flur entlang zurück zu seinem Zimmer führen. Was blieb ihm auch anderes übrig? Was war überhaupt mit ihm los? Er verlor den Kontakt zur Wirklichkeit. Er musste hier dringend raus.
»Sehen Sie, jetzt haben Sie wieder Ihre Ruhe«, sagte der Pfleger, als sie das Zimmer betraten, und tatsächlich war da nur noch sein Bett. Frau Ella war verschwunden. Kein Mantel mehr im Schrank, keine Wäsche, kein kleiner blauer Koffer. Als wäre sie nie da gewesen. Er setzte sich.
»Wollen Sie etwas zur Beruhigung?«, fragte der Pfleger.
»Danke, es geht schon wieder«, sagte er und streckte sich auf seinem Bett aus. »Ich bin vollkommen ruhig.«
Der Pfleger ging. Endlich war er wieder alleine. Er versuchte zu verstehen, was mit ihm los war. Was interessierte er sich plötzlich für diese alte Trulla, die ihm sein Zimmer vollpupste und ihn daran hinderte, sich einen runterzuholen? Wie kam er dazu, sich als Robin Hood des Gesundheitswesens aufzuspielen? Als Rächer der Rentner? Als bräuchten die seine Hilfe in dieser Gesellschaft, die einzig darauf ausgerichtet war, es ihnen recht zu machen. Sie waren doch schuld daran, dass er nicht weiterkam, dass dieses ganze Land wie gelähmt dalag, dass nichts passierte, um auch den Jungen eine Zukunft zu bieten. Wie sollte man denn da Energie entwickeln, wenn man wusste, die wenigen Früchte, die man irgendwann ernten würde, landeten in der Marmelade der Alten? Ihm war ja ganz offenbar einfach langweilig, dass er plötzlich auf braver Enkel machte. Sollte sie doch einschlafen und nicht mehr aufwachen! Sollten diese Verbrecher sie an ihre scheißteuren Apparate anschließen! Sollten die ihre Drecksmedikamente an ihr ausprobieren! Sie hatte ihre acht Jahrzehnte gehabt, noch dazu mit ihrem Mann als Versorger. Mit ihrer Rente könnte er wahrscheinlich eine ganze Familie ernähren. Ein ganzes afrikanisches Dorf! Und kleine Jungs, die spielen wollten, stopfte man mit Psychopharmaka voll, damit sie nicht störten und die Pensionsfonds schön Rendite abwarfen. Und die Alten durften selbst ihr Zahngold mit unter die Erde nehmen! Verdammt, das war ein Krieg, und er schlug sich bei der ersten besten Gelegenheit auf die Seite des Feindes! Er war ja vollkommen bescheuert. Er musste hier endlich raus!
Kapitel 3
Frau Ella versuchte, sich zurechtzufinden. Mit nichts als ihrem Nachthemd bekleidet, saß sie auf einem speckig abgeriebenen Sofa. Sie wollte sich gar nicht erst vorstellen, was man in den Ritzen zwischen den glanzlosen Dielen alles finden würde. Entlang der Fußleisten tummelten sich ganze Herden von Staubschäfchen auf eingetrockneten Farbklecksen. Wie konnte ein Maler nur so wenig achtgeben? Wie konnte man einem Boden gegenüber so lieblos sein? Sie fröstelte, zögerte aber, sich die neben ihr liegende Strickdecke über die Schulten zu legen, aus Angst davor, einen ganzen Schwarm Motten auf sich zu ziehen. Sie ekelte sich nicht, nein, dazu hätte es mehr bedurft, doch sie hätte alles gerne etwas sauberer gehabt. So, wie sie es gewohnt war. Durch das Kastenfenster sah sie einen schattigen Hinterhof. Vereinzelt reflektierten die gegenüberliegenden Fenster Sonnenstrahlen. Es war also Tag. Sogar die Luft war voller Staub. Das war ihr noch nie passiert, dass sie nicht wusste, wo und in welcher Zeit sie war.
Die Stube, in der das Sofa stand, auf dem sie saß, stammte anscheinend aus der Zeit, da sie und Stanislaw sich zum ersten Mal richtig eingerichtet hatten. Mitte der Fünfziger war das gewesen, als er seine Stelle gefunden hatte und sie Wochenende für Wochenende im Möbelhaus verbracht und auch unter der Woche die Kataloge gewälzt hatten. Viel Geld hatten sie damals nicht gehabt, aber gerade deshalb musste man sich bei der Auswahl ja Zeit lassen. Sie kannte diese Stehlampe aus Messing mit den biegsamen Stangen, an deren Ende pastellfarben die Lampenschirme in Richtung Decke zeigten, den Nierentisch, dessen schwarz glänzende Platte mit ihrer goldenen Fassung lange nicht poliert worden war, die Kommode aus dunklem Holz, auf der ein verstaubtes Radio mit seinem grünen Auge stand. Das alles kannte sie. Sie kniff ihr Auge zusammen, um die Namen der Radiostationen zu lesen. Genau wie bei ihnen waren einige Sender mit Pflaster markiert, damit man nicht zu viel Zeit mit der Suche nach den Lieblingssendern verbringen musste. Das war nicht schön, aber praktisch. Beim Fernseher gab es das nicht mehr.
Frau Ella kannte die Gegenstände und wusste doch nicht, wohin sie gehörten. Ganz sicher war sie noch nie zuvor in dieser altmodischen Wohnung gewesen. Sie erinnerte sich nur daran, wegen ihres eiternden Auges ins Krankenhaus gegangen zu sein. War sie dort mit einem Schlag alt und verrückt geworden? Oder träumte sie? Sie schüttelte den Kopf und stand auf, um sich in dieser seitsamen Wohnung umzusehen. Die Tür an der dem Sofa gegenüberliegenden Wand führte in ein Schlafzimmer. Auf dem Boden lag eine Matratze, darauf ungeordnet fleckig weißes Bettzeug, das bis zu ihr hin so roch, als sei es seit Wochen nicht gelüftet und schon gar nicht gewechselt worden. In einem Regal lag Wäsche, durcheinander und offen für Staub und Motten. Auch hier diese Lieblosigkeit gegenüber der Wohnung, als lebte jemand nur auf der Durchreise, habe kein Interesse daran, es sich schön zu machen. Die andere Tür ging auf eine kleine dunkle Diele, die rechts in die Küche führte, die tatsächlich richtig schmutzig war. Ungläubig betrachtete sie die sich stapelnden Teller, da hörte sie hinter sich das Rauschen einer Toilettenspülung, und zwar nicht das fröhlich plätschernde Rauschen eines sich entleerenden Spülkastens, sondern das zischende Rauschen einer dieser Direktspülungen. Sie drehte sich um, sah im Halbdunkel der kurzen Diele, wie sich eine Tür öffnete und jemand aus dem Bad heraustrat. Und sie stand im Nachthemd in einer wildfremden Wohnung!
»Hallo Frau Ella«, hörte sie die Stimme eines Mannes sagen, eine ihr bekannte Stimme. An die erinnerte sie sich.
»Hallo junger Mann. Sagen Sie, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist doch sicher nicht die Klinik.«
»Nein, nicht wirklich«, stammelte er und trat in die Küche. Auch dem Jungen war die Situation anscheinend nicht angenehm. Als hätte er etwas angestellt. »Das ist meine Wohnung. Sie sind in Sicherheit.«
»Aha. Hier müsste dringend mal wieder geputzt werden.«
»Ich bin bis heute auch ohne Ratschläge ganz gut über die Runden gekommen«, sagte er schroff.
»Ich auch«, sagte sie, überrascht von seiner Unfreundlichkeit. »Und deshalb wüsste ich nun gerne, was ich in dieser Wohnung verloren habe.«
Wieder druckste er herum, als hätte er etwas zu verbergen.
»Jetzt sagen Sie schon.«
»Na ja, erinnern Sie sich denn an gar nichts? An diesen Zettel zum Beispiel, den Sie unterschreiben sollten, im Krankenhaus, wegen der Vollnarkose?«
»Ja«, sagte sie und tastete nach dem Verband.
»Und auch daran, dass Sie am nächsten Morgen diese Tablette geschluckt und dann unterschrieben haben?«
»Die Tablette, ja, an die erinnere ich mich, die war gegen dieses Jucken am Auge.«
»Von wegen! Das haben die Ihnen erzählt. In Wirklichkeit war das irgendein Stoff, mit dem Sie gefügig gemacht werden sollten.«
»Ja und? War ich dann also gefügig?«
»Sie schon, aber mit mir hat keiner gerechnet. Ich habe sofort einen Pfleger alarmiert, der mir dann erst nicht glauben wollte.«
»Was sollte der Ihnen denn glauben?«
»Na, dass Sie gegen Ihren Willen operiert werden, also unter Vollnarkose.«
»Aha.«
»Genau. Ich hatte Sie schon fast aufgegeben, als er plötzlich in mein Zimmer kommt und sagt, dass ich recht hatte, dass da irgendwelche krummen Dinge liefen und dass er Sie in Sicherheit gebracht habe. Ich sollte meine Sachen packen und mitkommen. Na ja, und da hab ich eben meine Sachen gepackt und bin zusammen mit ihm runter und zum Hinterausgang, wo Sie in einem Taxi saßen. Vollkommen neben sich übrigens. Und da hat er mir dann gesagt, dass wir Sie so auf keinen Fall alleine lassen könnten, dass ich Sie also mit zu mir nach Hause nehmen müsse. Na ja, und deswegen sind Sie hier. Der Pfleger kommt später und bringt Ihre Sachen vorbei. Hoffentlich. Offiziell habe ich Sie jetzt wahrscheinlich entführt.«
Frau Ella sah ihn an und wusste, auch wenn sie sich nicht erinnern konnte, dass dieser junge Mann nicht log. Er tat ihr leid, so unbeholfen, wie er da vor ihr stand. Er wirkte noch hagerer als im Krankenhaus, trug jetzt unter seinen zotteligen blonden Haaren eine große Brille mit dickem schwarzem Rahmen, wie Stanislaw sie gehabt hatte.
»Unsinn«, sagte sie und spürte, wie ihr Herz schlug und ihr das Blut in die Wangen schoss. »Wenn Sie mir nichts vorflunkern, haben Sie mir das Leben gerettet! Und wer käme schon auf die Idee, eine Alte wie mich zu entführen?«
Er schaute überrascht, strich sich durchs Haar und wirkte noch immer unsicher.
»Na dann«, sagte er, und plötzlich strahlte Erleichterung aus seinem Auge. »Dann duzen Sie mich bitte auch wieder. Dann mach ich uns jetzt einen Kaffee, einen richtigen.«
»Danke, junger Mann«, sagte sie, die sich mit einem Mal überhaupt nicht mehr unwohl fühlte. »Danke, aber ich denke, es ist nur angemessen, wenn ich mich ein wenig im Haushalt nützlich mache. Auch wenn Sie bisher ohne mich zurechtgekommen sind.«
»Was soll’s?«, lächelte er. »Kommen Sie, ich zeig Ihnen die Maschine.«
Die verdorrten Kräuter auf der Fensterbank erinnerten sie an ihre eigenen Pflanzen, die schon seit Freitag ganz ohne sie auskommen mussten. Auf dem Boden stapelten sich in einem alten Karton die Zeitungen eines ganzen Jahres, umzingelt von leeren Bier- und Weinflaschen, die teils umgekippt in eingetrockneten Pfützen lagen. Am schlimmsten aber waren die Teller, die sich in der Spüle türmten, überwuchert von den schimmelnden Resten lange zurückliegender Mahlzeiten, und auf denen sich ganze Schwärme von Fruchtfliegen niedergelassen hatten. Sie durfte nicht vergessen, dass der junge Mann sie gerettet hatte, dass sie sich zurückhalten musste mit ihrer Kritik, dass nicht für jeden ein Haushalt so leicht erledigt war wie für sie mit ihrer ganzen Erfahrung. Sie ließ ihren Blick weiterschweifen auf der Suche nach der Kaffeemaschine. Erfolglos.
»Hier, die Kaffeemaschine«, sagte er und reichte ihr eine kleine Aluminiumkanne mit schwarzem Plastikgriff, auf der ein kleiner Mann in schwarzem Anzug mit dem Finger nach oben zeigte.
»Nehmen Sie, ich suche noch das Pulver.«
Täuschte sie sich, oder versuchte er, sie auf den Arm zu nehmen?
»Was ist denn das?«
»Meine Kaffeemaschine«, sagte er grinsend.
»Aha.«
»Das ist eine italienische Kaffeemaschine, für Espresso. Kommen Sie, ich zeig Ihnen, wie die funktioniert.«
»Haben Sie denn keine normale Kaffeemaschine? Oder einen Filteraufsatz?«
»Ach, Filterkaffee, davon wird einem nur schlecht. Espresso ist viel gesünder. Und bitte, hören Sie auf, mich zu siezen.«
Sie zögerte. Seit mehr als siebzig Jahren trank sie Filterkaffee und hatte nie etwas daran auszusetzen gehabt. Sicher, nach dem Krieg war das Pulver nicht immer das beste gewesen, aber sie hatte sich immer über jede Tasse frisch aufgebrühten Bohnenkaffee gefreut.
»Das heißt, Sie trinken gar keinen Filterkaffee?«
»Nur, wenn es nicht anders geht, wie im Krankenhaus«, sagte er, während er die kleine Kanne, die offenbar aus zwei Teilen bestand, aufdrehte, Wasser in den unteren Teil und Kaffeepulver in ein zwischen den beiden Teilen eingeschlossenes Mittelstück füllte. Er lächelte ihr wohlwollend zu, als zeigte er einem Kind, wie man sich die Schuhe zubindet.
»Und Sie meinen, wir haben alle über Jahrzehnte hinweg den falschen Kaffee getrunken? Dann hätte uns ja ziemlich häufig schlecht werden müssen.«
»Das ist wegen der Gerbstoffe. Wenn Sie Filterkaffee kochen, spült das heiße Wasser viel mehr Stoffe aus dem Pulver, als wenn Sie nur heißen Dampf durchjagen. Noch besser sind natürlich die großen Maschinen in den Cafés, die so richtig Druck aufbauen können. Außerdem ist das Problem beim Filterkaffee, dass das Wasser ja nicht mehr richtig kocht, wenn es auf den Kaffee trifft. Na ja, und diese ganzen Zusatzstoffe, die dann aus dem Pulver rauskommen, erzeugen Reaktionen, die man so gar nicht haben will, zum Beispiel Niesen oder Magenschmerzen oder Schweißausbrüche.«
Also doch, er wollte sie auf den Arm nehmen. Sie musste besser darauf achten, wann er etwas ernst meinte und wann nicht. Sie hatte wohl einfach zu viel Zeit alleine verbracht.
»Ich mache Ihnen bald mal einen Filterkaffee, von dem Sie niesen!«, lachte sie. »Aber jetzt werde ich erst einmal abspülen. Man fühlt sich ja wie zu Besuch bei den Fruchtfliegen.«
Plötzlich schaute er wieder so ernst, als hätte sie ihn beleidigt.
»Es bleibt nun einmal viel liegen, wenn man ins Krankenhaus muss«, fügte sie schnell hinzu.
Sascha schraubte die beiden Teile zusammen, machte den Gasherd an und stellte die Kanne auf die Flamme.
Dann verließ er schweigend und ohne sie eines Blickes zu würdigen die Küche. So würden sie es zusammen aushalten. Endlich konnte sie in Ruhe für Ordnung sorgen.
Während sie Wasser in das große emaillierte Waschbecken laufen ließ und die Essensreste mit einer Gabel von den Tellern kratzte, versuchte sie, die Dinge um sie herum auch in ihrem Kopf zu ordnen. Den Gedanken daran, dass sie in ihrem Nachthemd in der Küche eines fremden jungen Mannes stand, verdrängte sie schnell, um sich dem viel größeren Rätsel zuzuwenden. Wo war sie hier wirklich gelandet? Alles um sie herum wirkte wie aus der Vergangenheit. Das letzte Mal, dass sie an einem emaillierten Waschbecken gestanden hatte, lag Jahrzehnte zurück. Und erst der Dielenboden in der Küche! Bislang hatte sie alles, was in ihrem Leben passiert war, irgendwie verstanden, alles hatte im Wesentlichen der gleichen Logik gehorcht, auch wenn nicht nur im Krieg Dinge geschehen waren, die schwer zu begreifen schienen. Jetzt aber begann der Boden zu wackeln, die alltäglichen Dinge, die aufeinandergefolgt waren, der Kohlenofen, der Gasherd, der Elektroherd. Sie fuhr mit den Händen in das heiße Wasser und genoss den Schauder, der ihr den Rücken hinunterlief. Nein, zu viel funktionierte noch so, wie sie es kannte. Es musste für all das eine Erklärung geben. Da begann die seltsame Kaffeekanne zu blubbern, und ein wirklich feiner Kaffeeduft erfüllte die Küche. Auf manche Dinge konnte man sich verlassen.
»Könnten Sie den Kaffee vom Herd nehmen?«, rief ihr Gastgeber aus dem Nebenzimmer.
»Schon geschehen«, log sie und griff schnell nach der Kanne. Sie musste nur noch über den Tisch wischen und irgendwo zwei Tassen finden. Die Teller konnte sie solange einweichen lassen. Im Einbauschränkchen unter der Fensterbank wurde sie, auf Kosten eines leichten Stechens im Kreuz, fündig, richtete sich vorsichtig wieder auf und stellte die ebenfalls nicht gerade modernen Tassen samt Untertassen auf den feucht glänzenden Küchentisch.
»Haben Sie auch so einen Hunger?«, fragte der junge Mann, der lächelnd in der Küchentür stand.
»Ach was. In meinem Alter braucht man nicht mehr viel.«
»Na kommen Sie«, grinste er, griff hinter sich und präsentierte Brötchen, Milch und eine kleine Packung Eier, und sie spürte mit einem Mal, wie groß ihr Hunger war. »Das haben wir uns verdient, und bitte bleiben Sie sitzen! Ich bin auch ohne Sie nicht verhungert.«
»Ganz wie Sie befehlen. Aber wo haben Sie das denn so schnell herbekommen?«
»Vom Asiaten unten.«
»Asiatische Brötchen?«, lachte sie, und er sah sie an, als habe er Mitleid mit ihr. Wirklich übelnehmen konnte sie ihm das nicht, sie, die im Nachthemd in dieser Küche saß und nicht begriff, wie ihr geschah. Aber konnte er denn nicht auch ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen?
»Im Erdgeschoss ist ein vietnamesisches Geschäft, in dem es auch Brötchen gibt. Ganz normale deutsche Brötchen.«
»Aha. Ein Vietnamese also.«
Sie blieb sitzen und versuchte zu verstehen, was er jetzt schon wieder machte. Er legte zwei Eier in einen kleinen Topf, in den er anschließend heißes Wasser laufen ließ. Kein Eierstecher, keine Eieruhr, kein kochendes Wasser. Sie würde nichts sagen, wenn die Eier platzten. Schließlich war sie zu Gast. Einen zweiten Topf füllte er mit Milch, als wollte er Pudding machen oder Kakao.
»Ganz schön dreckig, die Teller. Gute Idee, die erst mal einzuweichen«, sagte er.
»Ach was«, sagte sie und wartete gespannt darauf, dass die Eier platzen und das Wasser durch das austretende Eiweiß aufschäumen und die Gasflamme löschen würde. Er verließ die Küche. Kurz darauf hörte sie Musik aus der Stube, und er stand wieder in der Küchentür.
»Sobald das Wasser kocht, noch genau ein Lied.«
»Aha«, sagte sie.
»Probleme gibt es nur, wenn gerade Werbung oder Nachrichten laufen, mit Musik klappt es aber immer. Das sind musikalische Eier.«
Jetzt griff er nach einem Schneebesen und fing an, die Milch aufzuschlagen. Sie hatte wirklich keine Lust auf Pudding. Gleich würden die Eier platzen.
»Ist Ihnen übrigens kalt? Wollen Sie eine Decke?«
»Besten Dank«, entfuhr es ihr, da sie sich an die mottenzerfressene Decke auf dem Sofa erinnerte. »Nein, es geht schon. Vielleicht nach dem Frühstück.«
»Der Pfleger bringt ja nachher Ihre Sachen. Vergessen Sie solange einfach, dass ich da bin.«
»Machen Sie sich keine Gedanken.«
Mittlerweile kochte das Wasser. Sie versuchte, an ihm vorbei zu gucken.
»Das Lied läuft schon zu lange«, sagte er. »Wir nehmen einfach noch den Anfang vom nächsten mit, bis zum ersten Refrain, das sollte reichen.«
Auch als er zur Seite trat, konnte sie von ihrem Stuhl aus nicht in den Topf blicken. Sie musste abwarten, bis das Wasser überschäumte. Noch war aber nichts zu sehen. Stattdessen kam er zum Tisch, nahm die Tassen mit zur Anrichte und füllte sie mit dem Kaffee aus der Kanne und der Puddingmilch. Er servierte ihr eine der beiden Tassen nach Manier eines regelrechten Kellners.
»So, hier ist Ihr Latte macchiato.«
»Wie bitte?«
»Ein Kaffee mit Milch, also eigentlich mit Milchauge oder so. Ein einäugiger Kaffee sozusagen. Das ist Italienisch.«
»Und der Kaffee?«
»Keine Ahnung. Wie gesagt, war nur ein Spaß. Das bestellt man so im Café. Ist so eine Mode.«
Das wurde ja immer besser, dachte sie.
»Verdammt, die Eier. Ist der erste Refrain schon vorbei?«, rief er plötzlich und stürzte zurück an den Herd, auf dem immer noch nichts übergekocht war. Der Dotter war bestimmt längst hart. So kochte man wirklich keine Eier!
Sie konnte es kaum glauben, als sie ihr Frühstücksei schließlich köpfte, und der Dotter genau die Schlieren auf dem Messer hinterließ, die er hinterlassen musste. Ein perfektes Ei, fast so, als hätte sie es gekocht. Dafür schmeckte der Kaffee, wie sie es erwartet hatte, nicht nach Kaffee, sondern nach Milch, aber sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Schließlich gab der Junge sich alle Mühe, lächelte immer wieder zu ihr herüber, und sie lächelte zurück, um ihm zu zeigen, dass es ihr bei ihm schmeckte. Sie sagte auch nichts, als er den Teig aus dem Brötchen zu kleinen Kügelchen formte und in sein Ei fallen ließ. Was hätte sie auch sagen sollen? Dass er bei Tisch nicht besonders gut erzogen war, hatte sie ja schon am Abend im Krankenhaus feststellen können. Seinen Kaffee schlürfte er jedenfalls, doch es gab Schlimmeres.
»Ist das auch so eine Mode mit den Kügelchen?«, hörte sie sich sagen.
»Was?«, fragte er.
»Diese Kügelchen, die Sie aus dem Teig machen und ins Ei werfen, ist das auch eine Mode, so wie dieser milchige Kaffee und die musikalischen Eier?«
»Schmeckt es Ihnen nicht?«, fragte er, und sie begriff gar nicht so recht, was sie da schon wieder angestellt hatte.
»Doch, doch, entschuldigen Sie, so war das nicht gemeint. Ich versuche nur, mich zurechtzufinden. Die Eier sind exzellent. Exzellent!«, sagte sie schnell, und er lächelte wieder. So ein empfindlicher junger Mann!
»Da bin ich aber beruhigt. Schließlich sind Sie seit Monaten die erste Frau, die mal wieder bei mir frühstückt, auch wenn Sie noch nicht hier übernachtet haben.«
»Exzellent!«, sagte sie noch einmal. »Wie im Hotel.«
»Das war aber auch nötig nach diesem Morgen. Ich habe übrigens überlegt, dass Sie sich ja gleich in mein Bett legen könnten. Ich beziehe es Ihnen schnell frisch. Vielleicht wollen Sie ja noch ein bisschen schlafen.«
»Jetzt schlafen?«
»Na ja, nach dem Morgen und dieser Tablette. Die Wirkung hält bestimmt noch an. Heute Abend bringe ich Sie dann nach Hause, wenn Sie wieder ganz fit sind.«
»Aha. Nach Hause also.«
Sie versuchte, sich zu erinnern. Lag es wirklich an diesem Traubenzucker, dass sie sich so fremd fühlte, so wenig von dem verstand, was um sie herum geschah? Sie versuchte, sich zu erinnern, ob sie vorhin auf diesem Sofa wirklich aufgewacht war oder nicht doch nur kurz da gesessen hatte. Wie spät war es überhaupt? Sie fühlte sich verloren, sehnte sich weg von all diesen Dingen, die sie nicht verstand.
»Frau Ella?«, hörte sie ihn fragen und blickte auf. »Machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen das schon hin.«