
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Waisenjunge Farisio schlägt sich mehr schlecht als recht auf den Straßen des windumtosten Landes Wirilat durch. Als die zwielichtige Gilde der Schatten Farisio anwerben will, lehnt er entschieden ab – bis sie seinen Schützling, das kleine Mädchen Ileija, entführt. Widerstrebend wird Farisio Schattenanwärter im Dienst der Gilde, während er insgeheim nach einem Fluchtweg für Ileija und sich selbst sucht. Doch als Farisio bei einem Einstufungstest von den mysteriösen Machenschaften der Gilde erfährt, muss er seine Pläne überdenken und sein wahres Schicksal annehmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.Piper.de
© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Finepic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
Brise
2
Brise
3
Brise
4
Schattenbasis
5
Testraum der Schatten
6
Testraum der Schatten
7
Windschiffhafen von Aussicht
8
Kantine der Schattenanwärter
9
Unterirdische Bombenwerkstatt
10
Schattenbasis
11
Königlicher Palast von Wirilat
12
Königlicher Palast von Wirilat
13
Udios Arbeitszimmer
14
Kommandozentrale der Schatten
15
Kommandozentrale der Schatten
16
Kantine der Schattenanwärter
17
Kommandozentrale der Schatten
18
Schattenbasis
19
Testraum der Schatten
20
Kantine der Schattenanwärter
21
Farisios Zimmer
22
Königlicher Palast von Wirilat
23
Königlicher Palast von Wirilat
24
Königlicher Palast von Wirilat
25
Farisios Zimmer
26
Kommandozentrale der Schatten
27
Zeremoniensaal der Schatten
28
See beim Palast
29
Königlicher Palast von Wirilat
Glossar
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Brise
Unerwartet fuhr ihm der Wind ins Gesicht. Farisios Augen brannten. Es fühlte sich für ihn wie ein Schlag an. Der Wind forderte seine Aufmerksamkeit und entlockte ihm ein Seufzen.
Natürlich hätte es auch ein Nachkomme von Wirilat sein können, der voller Übermut seine Windmagie an ihm erprobte, doch Farisio glaubte das nicht. Dann hätte er nicht dieses leise Wispern vernommen: Hör zu!
Farisio schloss für einen Moment müde die Augen. Sein Magen knurrte und schmerzte vor Hunger. An diesem Tag hatte er noch nichts gefunden, mit dem er das Monster, das in seinen Eingeweiden zu hausen schien, hätte besänftigen können. Und auch nicht am Tag zuvor.
Er war Hunger gewohnt, genau wie Durst, Kälte, Müdigkeit, Furcht und Wachsamkeit. Man überlebte nicht auf den Straßen, wenn man nicht hart im Nehmen war. Und Farisio war ein echtes Stehaufmännchen. So jedenfalls hatte ihn Ybbydus immer genannt.
Trauer kam in ihm auf, als er an seinen verlorenen Freund dachte, der ihm mehr Vater und Mutter gewesen war, als sein ahnungsloser Erzeuger oder seine wahnsinnige Mutter es je gewesen waren. Sechs Jahre war Ybbydus nun bereits vermisst und er hatte einen Teil von Farisios Seele mitgenommen, als er verschwand.
Der Wind nahm an Stärke zu, bis er laut brüllte und ihn aus seinen Gedanken riss. Farisio zuckte zusammen, als er wieder an seine Umgebung erinnert wurde. Es war höchste Zeit für ein warmes Plätzchen, eine Mahlzeit und ein Nickerchen.
Inzwischen hatte der launische Wind seine Aufmerksamkeit anderen zugewandt. Er fuhr durch die schweren Stoffbahnen der Marktstände um Farisio herum, brachte die Flaggen und Fähnchen zwischen den Häusern zum Tanzen und die Windspiele an den Gebäuden zum Klingen, erfand mit spielerischer Leichtigkeit eine neue Melodie und gab den Luftschiffen der Wachen über der Stadt Brise einen kleinen Stups. Er erzählte ihnen allen etwas, doch Farisio merkte, dass niemand dem Wind zuhörte. Niemand außer ihm.
Vielleicht musste man einsam sein, um mit dem Wind zu sprechen. Er wusste es nicht. Manchmal vergingen Tage, ohne dass er mit einem anderen Kuftari sprach. Tage, in denen er das Wort nur an Tiere oder an den Wind richtete, die ihm wenigstens zuzuhören schienen und die nicht aufgrund seiner alten, abgetragenen und geflickten Kleidung misstrauisch vor ihm zurückwichen.
Ja, er hatte kein Geld. Aber er war kein Taschendieb, Mörder oder sonstiger Gauner. Dennoch gab ihm niemand eine Chance oder eine ehrliche Arbeit. Er hätte sich prostituieren können – Angebote von lüsternen Männern, denen sein junges Gesicht gefiel, bekam er genug –, doch lieber wäre er verhungert oder erfroren, als sich zu verkaufen.
Er hatte gehofft, dass sein Leben besser werden würde, wenn er erst einmal die verfluchte Domäne Ectorui hinter sich gelassen hatte, in der nichts je so blieb wie am Tag zuvor und jede Straße überall hinführen konnte, nur nicht wieder hinaus in eine der Nachbar-Domänen. Wie oft hatte er geglaubt, es endlich bis zum Übergang nach Gorgubi geschafft zu haben? Nur um zum Beispiel am nächsten Morgen in der Gestalt eines beinlosen Kriechtieres aufzuwachen, und sich mühsam Elle um Elle auf den Ausgang aus dem Irrgarten des Wahnsinns zuzubewegen? Und wie oft hatte er dann bei Sonnenuntergang erlebt, wie sich die wandernden Hügel wieder auf den Weg ans andere Ende von Ectorui machten und ihn mit sich nahmen? Häufig hatte er kurz davorgestanden, einfach aufzugeben, wenn er wieder einmal in der falschen Gestalt gefangen gewesen war oder sich hoffnungslos verirrt hatte. Es hatte viele Jahre gedauert, bis er dem Chaos, das Ectorui war, entkommen war. Doch selbst jetzt, einen Monat nach seiner Flucht, selbst nachdem er die Domäne Gorgubi durchquert hatte, war er noch nicht ruhiger und hatte immer noch Angst, dass die vergangenen Wochen nur ein Traum gewesen waren.
Verstohlen musterte er die Kuftari in seiner unmittelbaren Umgebung. Viele von ihnen lachten oder unterhielten sich fröhlich mit ihren Bekannten oder Nachbarn, ohne zu ahnen, welch ein Glück sie hatten. Wirilat erschien ihm wie eine Oase der Zufriedenheit und des Wohlstands nach den langen Jahren des Chaos in Ectorui. Er wollte es ihnen gleichtun, doch er hatte das Lachen verlernt.
Sein Blick fiel auf eine Frau um die sechzig, die gerade mit ihrem schwer beladenen Einkaufskorb zwischen den Marktständen auf ihn zukam. Ihr junges Gesicht erschien ihm freundlich, sodass er einen Schritt vortrat und sie ansprach: »Bitte, Herrin, haben Sie etwas zu essen für mich?«
Sie zuckte überrascht zusammen. Farisio bemerkte, wie ihr Blick blitzschnell über seine hagere Gestalt und sein kantiges Gesicht fuhr, das durch seinen großen Hut zum Teil im Dunkeln lag. Zurückhaltung lag nun in ihrer Miene und sie zog den Einkaufskorb dichter an ihren Körper, bevor sie stumm den Kopf schüttelte.
»Verschwinde, Bettler«, rief einer der Marktstandbesitzer wütend und schwang drohend die Faust in Farisios Richtung. »Sonst hole ich die Wachen!«
Der rundliche Händler griff zur Trillerpfeife, die um seinen Hals hing. Ein einfacher Weg für die ehrenwerten Bürger der Stadt Brise, um die Wachen zu rufen, die mit ihren Luftschiffen in einigen Metern Entfernung über ihren Köpfen oder zu Fuß in den Straßen patrouillierten. Ein gellender Pfiff und Farisio würde eine unangenehme Nacht im Gefängnis bevorstehen.
»Ich gehe ja schon«, sagte er leise. Sein Magen knurrte laut und übertönte seine Stimme, doch noch nicht einmal das rief etwas Mitgefühl bei den Marktbesuchern hervor, geschweige denn bei den Verkäufern.
Farisio verlor den Mut. Er wandte sich um und ging. Das Verrückte war, dass er noch nicht einmal arm war. Er besaß lediglich kein Geld. Doch niemand, dem er die geerbten Schmuckstücke seiner Mutter zeigte, glaubte ihm, dass er sie nicht gestohlen hatte. Pfandleiher und Juweliere bekamen ein gieriges Funkeln in den Augen beim Anblick der wertvollen Ketten, Armbänder, Ohrringe und Ringe, die seine schöne und berühmte Mutter von ihren Verehrern geschenkt bekommen hatte. Zwei hatten ihn bestohlen und drei weitere hatten es versucht. Jedes Mal war es ihm nur dank seiner flinken Füße gelungen, ihnen und ihren Schergen zu entkommen. Das eine Mal, als er den Diebstahl angezeigt hatte, hatten die Wachen ihm nicht geglaubt und er hatte eine Nacht im Gefängnis verbringen müssen wegen Verleumdung unbescholtener Bürger.
Unbescholtene Bürger, pah!
Farisio verzog das Gesicht. Er hatte ehrlichere Diebe und Huren kennengelernt als manch angesehene Bürger, die unter dem Deckmantel von Reichtum und Ehre die verabscheuungswürdigsten Verbrechen begingen und diejenigen bestahlen oder ermordeten, mit denen sie kurz zuvor noch diniert oder höflich Konversation gemacht hatten.
Er merkte, dass er erneut gefährlich unaufmerksam gewesen war, als er plötzlich vor einer Wand aus Ziegeln stand und nicht wusste, wie er dorthin gekommen war. Erschrocken sah er sich um. Überall um sich herum entdeckte er hohe Mauern, die von abblätterndem Putz, Dreck und Wasserflecken überzogen waren. Farisio befand sich in einer dunklen Gasse. Einer Sackgasse ohne Fluchtweg, so wie es den Anschein hatte, und ihm wurde der Magen flau, als er sich ausmalte, was hätte geschehen können. Nur durch Glück war es helllichter Tag und die Gasse war leer.
Seine Augen brannten und er zwang sich, tief durchzuatmen. Er würde jetzt nicht weinen.
Doch langsam war er am Ende seiner Kräfte. Er musste etwas tun, etwas ändern. Viel länger hielt er das nicht mehr durch.
Der Junge schlang die Arme um sich und schluckte gegen den Kloß in seiner Kehle an, während seine Gedanken panisch rasten. War es ein Fehler gewesen, sich älter zu machen? Hätte die junge Marktbesucherin ihm vielleicht etwas zu essen oder ein paar Geldstücke gegeben, wenn man ihm sein Alter angesehen hätte?
In Gorgubi hatte er es nicht gewagt, sein wahres Alter, seine Haare oder sein ungeschminktes Gesicht zu zeigen. Jung, allein unterwegs und hübsch waren dort nur Synonyme für leichtes Opfer und kostbare Ware. Diese Lektion hatte er schnell gelernt. Je dreckiger er war, je mehr er stank, je älter er erschien, desto besser für seine Gesundheit.
Das Schluchzen war überraschend. Es dauerte einen Moment, bis er erkannte, dass es nicht von ihm selbst kam, sondern von irgendwo aus der dunklen Gasse. Doch woher genau? Und von wem?
Mülltonnen, alte Kartons, zerbrochene Gegenstände und Gerümpel drängten sich um ihn herum. Es roch nach Urin und Fäkalien: In seiner Müdigkeit hatte Farisio instinktiv einen sicheren Platz aufgesucht, an dem nur wenige Kuftari sein würden. Auch wenn es ihn überraschte, dass es in der sauberen, wohlhabenden Stadt Brise solch einen heruntergekommenen Ort überhaupt gab.
Doch woher kam das Schluchzen?
Der Junge lauschte aufmerksam und schloss die Augen, während er sich vorwärtsbewegte. Er spürte noch jemanden in der Gasse, auch wenn das Geräusch inzwischen wieder verstummt war. Jemanden, der genauso verängstigt und verzweifelt war wie er selbst.
Seine Füße hatten ihn zu einer großen Mülltonne mit Metalldeckel geführt. Anders als die übrigen Mülltonnen, die umgestoßen auf dem Boden lagen oder vor Unrat überquollen, schien diese nicht recht an den Ort zu passen. Nicht nur, weil sie nur relativ wenige Dreckspuren aufwies und immer noch glänzte. Der Abfallbehälter war zu fein für diese Gasse und Farisio bekam ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.
Schnell war er jetzt an der Mülltonne und stemmte die schwere Abdeckung hoch. Doch selbst bei dieser kleinen Anstrengung zitterten ihm bereits die Arme und er musste nach Luft schnappen. Er war wirklich in keiner guten Verfassung. Und das besserte sich auch nicht, als er das Kleinkind sah, das jemand in den Müll geworfen hatte. Er verstand es nicht. Er hatte gedacht, dass Wirilat besser sein würde als Ectorui, dass man hier das Leben wertschätzen würde. Aber ein Kleinkind, das man einfach in eine Mülltonne steckte, aus der es sich nicht befreien konnte und in der es leiden würde, bis es verdurstete oder verhungerte: Das sprach eine ihm leider nur zu vertraute Sprache. Gleichgültigkeit und Grausamkeit kannte er dank seiner Mutter zur Genüge.
»Hab keine Angst. Schhh«, machte er sanft, als er das dreckige Kind aus der Tonne hob. Er musste dafür auf eklige Abfallberge steigen, aus denen das Ungeziefer krabbelte, aber das nahm er gar nicht wahr. Er sah nur das Kind mit den großen, traurigen Augen, das vor Hunger und Durst wimmerte. Seine Entscheidung stand fest, ohne dass er groß darüber nachdenken musste. Wenn dieses Kind niemand haben wollte, dann würde er sich darum kümmern. Auch wenn das bedeutete, einige unangenehme Entscheidungen zu fällen und Dinge zu tun, vor denen er bislang zurückgeschreckt war.
Es war ein Mädchen, vielleicht vier Jahre alt, nicht mehr als ein Baby. Kuftari lernten mit vier oder fünf Jahren sprechen, also konnte er sie nicht nach ihren Eltern fragen. Nicht dass er sie ihnen nach ihrer grausamen Tat zurückgebracht hätte, aber so würde er nichts über die Kleine wissen.
»Ich nenne dich Ileija«, sagte er und erschrak, als sein Gesicht plötzlich schmerzte. Im Glanz der sauberen Metalltonne sah er, dass sich seine Lippen zu einem ungewohnten, glücklichen Lächeln verzogen hatten.
Sechs Stunden später krabbelte er aus seinem Versteck in der Erde an die Oberfläche zurück. Dorthin hatte er sich nach seinem vergeblichen Ausflug in die Stadt mit Ileija zurückgezogen. Da die Bewohner von Wirilat den Wind liebten und ihre Städte am liebsten an windumtosten Orten errichteten, war es ungewöhnlich, dass Brise nicht auf einer Klippe, einem Hügel oder einem Berg, sondern zu ebener Erde errichtet worden war.
Das bedeutete, dass er sich einen Unterschlupf in der Erde graben konnte, was er bei seiner Ankunft in der Stadt vor einer Woche auch getan hatte. Nun bot das Erdloch, das er mit Ästen abgestützt hatte, nicht nur ihm einen geschützten Schlafplatz in der Nacht und ein Versteck vor den aufmerksamen Blicken der Wachen aus der Luft, sondern auch Ileija. Er wusste allerdings, dass er schnellstens etwas anderes finden musste. Das kleine Mädchen brauchte die Wärme eines Feuers, ein sicheres Dach über dem Kopf und regelmäßige warme Mahlzeiten, und Farisio würde sein Möglichstes tun, um ihr all das zu geben.
Voller Sorge sah er zurück zum Unterschlupf. Er wollte die schlafende Kleine nicht allein zurücklassen, aber er hatte keine Wahl. Er musste Geld und Essen beschaffen und das konnte er nicht, wenn Ileija dabei war.
Ihm graute vor dem, was er in Kürze tun würde. All seine Versuche, sich einzureden, dass es nicht so schlimm sei, dass auch andere Jungen seines Alters auf diese Weise überlebten, halfen nichts. Die Übelkeit ließ sich nicht abschütteln, genauso wenig wie Ybbydus’ Stimme in seinem Kopf. Sein väterlicher Freund wäre entsetzt, wenn er ihn nun sehen könnte. Er hatte sich stets ein besseres Leben für Farisio gewünscht, ihm sogar angeboten, ihn bei sich aufzunehmen und zu adoptieren. Doch er Dummkopf hatte Nein gesagt, ohne zu ahnen, dass er nie die Chance bekommen würde, seine falsche Entscheidung zu korrigieren.
»Ich tue das für Ileija«, flüsterte er. Und jetzt, beim sechsten Versuch, klang es sogar einen Hauch entschlossen und nicht nur verängstigt.
Die Nacht war gerade erst angebrochen, doch er hatte sich nicht getraut, noch länger zu warten. Je später er aufbrach, desto schwächer würden er und das Mädchen werden. Er hatte zwar etwas Wasser auftreiben können, aber der Hunger plagte ihn bereits seit Wochen, und er wusste nicht, ob er weglaufen oder kämpfen musste, wenn er erst getan hatte, wovor es ihm so graute. Doch sie brauchten das Geld. Es war egal, wie er sich dabei fühlte. Solange Ileija satt und gesund war, war alles gut.
Es war alles gut.
Als Farisio einige Minuten später dem ersten Perversen begegnete, der seine Gestalt lüstern mit Blicken verschlang, wurde ihm übel. Er überlegte nicht lang, sondern rannte. Selbst für Ileija war er hierfür nicht bereit.
Immerhin gab es noch andere Wege, um Geld zu verdienen, wenn man auf der Straße lebte und vor einem Verbrechen nicht zurückschreckte. Farisio musterte das große, dunkle Gebäude, das er zuletzt vor einer Woche aufgesucht hatte und das jetzt verlassen vor ihm lag. Sein Puls raste. Er beobachtete das Haus bereits seit einer halben Stunde, daher wusste er, dass es keine Wachen hatte. Doch Wachen waren nicht das einzige Problem, das seinem Vorhaben im Weg stand. Die vermögenderen Bürger hatten genug Geld, um sich alle möglichen Arten des Schutzes zu kaufen. Er wusste nur nicht, für welche sich dieser Bürger entschieden hatte.
Klar, er hätte sich auch ein anderes, leichteres Haus für seinen allerersten Einbruch aussuchen können, aber das ließ sein Gewissen nicht zu. Von diesem Mann wusste er wenigstens, dass er ein Verbrecher und ein Dieb war. Einen ehrlichen, unbescholtenen Stadtbewohner auszurauben, das brachte Farisio nicht fertig.
»Dieser Mann hat es verdient«, murmelte er vor sich hin, wie um sich selbst zu überzeugen.
Aber hatte er das wirklich? Zweifel an sich und seinem Vorhaben kamen wieder in ihm auf. Nur weil der Pfandleiher ihm den Ring und die Kette seiner Mutter weggenommen hatte, hieß das nicht, dass es sich bei ihm um einen schlechten Kuftari handelte. Er wusste nicht länger mit Sicherheit, ob der Mann aus Gier gehandelt hatte oder in der Überzeugung, dass Farisio ein Dieb war. Seine Gewissheit, im Recht zu sein, geriet ins Wanken.
»Der Schmuck gehört mir und der Mann hat ihn genommen, ohne ihn zu bezahlen. Das macht ihn zu einem Dieb«, sagte er laut, um seine Zweifel zu übertönen.
Er begriff, dass er keine Wahl hatte. Wenn er nicht beim Pfandleiher einbrach, dann hatte er kein Geld für Essen oder Kleidung. Und beides brauchten Ileija und er dringend.
Mit der Entschlossenheit der Verzweifelten musterte er das Gebäude erneut. Das Erdgeschoss war vermutlich durch Zauber geschützt. Die seltsame Form der Lampen neben den Türen und Fenstern ließ ihn vermuten, dass in ihnen Ordnungssteine versteckt waren, die jede Störung durch Eindringlinge mittels eines lauten Alarms melden würden. Er musste einen anderen Weg finden.
Als Nächstes musterte Farisio das alte Nachbargebäude, das einige Meter neben dem Geschäft des Pfandleihers stand. Es war gut beleuchtet. Aus dem Dunkel seines Verstecks hatte er Wachen im und um das Haus patrouillieren sehen. Der Besitzer war definitiv nicht so reich wie der Pfandleiher.
Seine Zweifel, ob er das Richtige tat, schwanden. Was war das für ein Kuftari, der die Verzweiflung der Ärmsten ausnutzte, um auf ihre Kosten ein Vermögen anzuhäufen? Ordnungssteine kosteten sehr viel Geld und der Pfandleiher hatte sein Gebäude mit schätzungsweise drei Dutzend von ihnen gesichert.
Farisio lief los. Geräuschlos packte er die metallene Stange der Straßenlaterne und schwang sich hoch. Innerhalb von Sekunden war er von der Lampe auf das Fensterbrett im zweiten Stock geklettert. Ein schmaler Sims führte am Gebäude entlang, gerade breit genug für seine Zehen.
Farisio verspürte eine unnatürliche Ruhe, während er lauschte, seine Finger in das poröse Mauerwerk krallte, bis sie bluteten, und sich dabei Zentimeter um Zentimeter an der Wand entlang zum Regenrohr hangelte.
Der Wind umschmeichelte ihn und streichelte seine Wange. Er gab ihm die Gewissheit, dass niemand ihn bislang gesehen hatte und dass sein Freund ihn warnen würde, falls ihn jemand entdeckte.
Es dauerte keine Minute, bis er das Regenrohr erreicht hatte. Doch er hatte ein Gefühl, als würde alles um ihn herum verlangsamt ablaufen. Nur sein Herz rannte wie im Galopp und machte ihn schneller und aufmerksamer als sonst. Die Müdigkeit, der Hunger und die Gewissensbisse waren vergessen. Es zählte nur noch die Durchführung seines Plans.
Kurz darauf stand er auf dem Dach des Nachbargebäudes und starrte zu seinem Ziel hinüber, von dem ihn immer noch ein paar Meter trennten. Er wünschte sich, fliegen zu können wie die Nachkommen von Wirilat, zu ihnen zu gehören und einen ihrer geflügelten Freunde zu reiten. Doch wie er wusste, war das ein kindischer Traum.
Er unterließ es, die Entfernung zwischen den beiden Dächern zu schätzen. Vermutlich war der Abstand zu weit, aber er musste es einfach schaffen. Ileija zählte auf ihn.
Farisio atmete einmal tief durch, dann fixierte er das flache Dach gegenüber und lief los. Schon war er in der Luft und genoss den kurzen Moment, in dem er sich einreden konnte zu fliegen, bevor er auf dem Nachbardach aufkam, umknickte und mit dem Gesicht voran aufschlug.
Ängstlich lauschte er. Dabei blieb er liegen, atmete tief ein und blendete den Schmerz aus. Wenn er schrie, würden sie ihn schnappen. Also würde er nicht schreien. Es benötigte Willenskraft, um sich einzureden, dass er keine Schmerzen, keinen Hunger und keine Angst hatte. Aber darin hatte er Übung.
Als es ein paar Minuten lang still geblieben war, rappelte er sich leise auf. Er war nicht entdeckt worden, doch je länger er wartete, desto größer wurde die Gefahr, dass ein Luftschiff der Wache über ihn hinwegflog und er entdeckt wurde.
Das nächste Problem ließ nicht lange auf sich warten. Als er vor dem Eingang zum Treppenhaus stand, summte es ihm schon fröhlich entgegen.
Ein Ordnungsstein. Verdammt!
Er wusste nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gab, den Schutz vor Einbrechern zu überlisten, aber er musste es versuchen. Ein paar Meter von der Tür und dem Ordnungsstein entfernt hielt er inne. Mit geschlossenen Augen lauschte er, bis das Summen des Schutzsteins das Einzige war, was er hörte. Es dauerte nicht lange und seine geübten Ohren, die sonst immer dem Wind lauschten, hatten eine Melodie erkannt.
Farisio begann zu summen. Sein Duett mit dem Ordnungsstein beflügelte ihn. Er würde es schaffen.
Mit wenigen Schritten war er bei der Tür. Immer noch summend packte er die Klinke und drückte sie herunter. Die Tür schwang mit einem leisen Knarzen nach außen. Er huschte ins Innere und schloss sie hinter sich. Als er sich ein paar Meter vom Eingang entfernt hatte, verstummte er und lauschte.
Stille.
Erleichterung durchströmte ihn, dass er es geschafft hatte. Er war drin.
Leise ging er die Treppe hinab. Es war dunkel und er musste sich die Wände entlangtasten, doch das störte ihn nicht. Die nächtliche Dunkelheit war nicht sein Feind, im Gegenteil, sie versprach ihm Schutz.
Im Erdgeschoss angekommen, orientierte er sich an seinen Erinnerungen. Die Geschäftsräume des Pfandleihers standen ihm immer noch bildhaft vor Augen. Rasch hatte er das Büro gefunden und begann, die Schubladen zu durchsuchen. Kopfschüttelnd wunderte er sich über den Leichtsinn des Mannes, der seinen Besitz nur der Magie der Schutzsteine anvertraute und sich noch nicht einmal die Mühe machte, die Schubladen abzuschließen. Rasch hatte er das Geld gefunden.
Es war mehr, als die gestohlene Kette und der Ring wert waren. Seine Hand zuckte über den Geldstücken. Er konnte es einfach nicht. Er konnte nicht nehmen, was ihm nicht gehörte. Er war kein Dieb.
Rasch schätzte er den Wert der beiden Schmuckstücke und zählte dann die entsprechenden Münzen im schwachen Licht der Straßenlaternen ab. Er musste sich beeilen. Wenn das Licht ausreichte, dass er die Münzen erkennen konnte, dann war er auch von draußen zu sehen.
Farisio steckte seine Bezahlung in die Hosentasche und huschte zur Eingangstür. Von innen gab es keine Ordnungssteine, doch er würde den Alarm auslösen, sobald er einen Schritt über die Schwelle machte.
Vorsichtig öffnete er die Tür einen Spalt und lauschte auf die Melodie der Ordnungssteine. Dann summte er, bis er die Schritte und Stimmen der Wachen nebenan nicht mehr hörte.
Als er die Pfandleihe verließ, glaubte er, Blicke auf sich zu spüren. Doch er ließ sich nicht beirren und summte weiter, bis er die Reichweite der Schutzsteine verlassen hatte. Dann sparte er sich den Atem, um zu rennen.
Jemand fluchte leise. Farisios Panik wuchs. Er hatte recht gehabt. Irgendjemand hatte ihn entdeckt!
Er hörte Schritte hinter sich, aber keine Schreie, was ihm noch mehr Angst einjagte. Wer auch immer hinter ihm her war, wollte nicht entdeckt werden, was die Stadtwache und die Wachen des Nebengebäudes ausschloss.
Furcht ließ ihn noch schneller laufen. Er hörte seinen Verfolger keuchen. Farisio war schon immer flink gewesen, und das Leben auf der Straße hatte ihm viel Übung im Davonrennen beschert. Dass er den Mann hinter sich – und dass es ein Mann war, das wusste er – abschütteln konnte, daran zweifelte er nicht.
Doch er hatte nicht mit dessen Verbündetem gerechnet. Als er in die nächste Querstraße bog, rammte er ein großes, wenn auch weiches Hindernis.
»Uff!«, machte er, fiel rückwärts zu Boden und landete schmerzhaft auf seinem Gesäß.
Der Mann, der vor ihm stand, war weit über zwei Meter groß und sehr dick. Farisio war an seiner gepolsterten Mitte abgeprallt. Doch statt wütend zu sein, lächelte der Dicke ihn nur vergnügt an.
»Hallo, kleiner Mann«, sagte er und packte Farisio, um ihn hochzuziehen und ihn sich kurzerhand unter den kräftigen Arm zu klemmen. Es störte ihn nicht im Geringsten, dass Farisio sich wehrte und wild um sich trat.
Schnaufend traf Farisios Verfolger ein. »Verdammter kleiner Dieb«, schimpfte er zornig.
»Keine Sorge, ich hab’ ihn«, verkündete der Dicke und sein Kumpan musterte Farisio erfreut.
Dann lachten die beiden und Farisio schloss entsetzt die Augen.
2
Brise
»Ganz schön flinkes Bürschchen«, meinte der erste Verfolger, als er wieder normal atmete. Er musterte Farisio genau, doch was er im schwachen Licht der Straßenlaternen zu erkennen hoffte, war unklar.
»Wie heißt du?«, erkundigte er sich schließlich.
»Warum sollte ich euch das verraten?«, fragte Farisio und hob den Kopf, um ihn wütend anzufunkeln. Kampflos würde er sich jedenfalls nicht in ihre Gewalt begeben.
»Oho«, lachte der Dicke vergnügt. »Unser kleiner Freund hat Feuer.«
»Jeder ist kleiner und hat mehr Feuer als du, Scharfauge«, sagte der andere geduldig und ließ Farisio dabei nicht aus den Augen. »Lass ihn runter! Er muss ja denken, dass wir seine Feinde sind, wenn du ihn so festhältst.«
Der Dicke, den sein Kumpan Scharfauge – Was sollte das denn bitte für ein Name sein? – genannt hatte, gehorchte, blieb aber direkt neben Farisio stehen. Der Junge hegte keinerlei Illusionen. Er war noch immer in der Gewalt der beiden Männer.
»Was wollt ihr von mir?« Sein Misstrauen war deutlich zu hören.
»Keine Sorge, nicht das«, erklärte der dünne Mann rasch. »Und auch nicht dein Geld oder das, was du gerade erbeutet hast. Wir wollen nur mit dir reden, versprochen.«
»Warum?«
Nur reden, darüber konnte Farisio bloß lachen. Die Sache hatte eindeutig einen Haken. Er hätte weglaufen können, aber er wiegte die beiden lieber erst einmal in Sicherheit und hörte sich an, was sie zu sagen hatten. Sobald sie in ihrer Wachsamkeit nachließen, würde er verschwinden.
»Ich bin Flinkfinger«, stellte sich der Dünne vor. »Scharfauge und ich gehören zu den Schatten, einer geheimen Gesellschaft von Dieben, Einbrechern, Erpressern und Assassinen. Vielleicht hast du schon mal von uns gehört?«
»Nein.«
»Das macht nichts. Wir waren zufällig in der Gegend, um ein Nachbarhaus auszukundschaften, und haben gesehen, wie du die Ordnungssteine ausgetrickst hast. Sehr geschickt, ein echter Profi! Jemanden wie dich könnten wir bei den Schatten noch gebrauchen«, schmeichelte Flinkfinger ihm.
Ach nein! Und das sollte er glauben?
»Danke, kein Interesse. Warum sollte ich bei euch mitmachen? Was springt für mich dabei raus? Ich arbeite lieber allein.« Und nicht als Dieb, dachte er bei sich.
Die beiden Männer wechselten einen Blick. »Wir Schatten halten zusammen«, erklärte Scharfauge ihm nun. »Allein zu arbeiten ist schön und gut. Doch sobald die Wachen hinter dir her sind, wirst du froh sein über jeden Verbündeten, der sie von deiner Spur ablenkt, dir ein Versteck oder ein Alibi verschafft.«
»Genau. Bei uns findest du Freunde, einen sicheren Unterschlupf, Hilfe in allen Lebenslagen, warme Mahlzeiten und Heiler, die keine Fragen stellen, egal, mit welcher Verletzung du zu ihnen kommst«, ergänzte Flinkfinger.
»Und der Haken bei der Sache?«, wollte Farisio wissen, während er insgeheim mit den Augen den besten Fluchtweg auskundschaftete. Es wurde Zeit zu verschwinden.
»Es gibt keinen«, behauptete Flinkfinger. »Du musst nur den Eid der Schatten leisten, damit du uns und die anderen Schatten nicht verrätst. He!«
Nur den Eid der Schatten leisten. Nein, danke! Er würde überhaupt nichts schwören oder versprechen. Und schon gar nicht diesen beiden seltsamen Kerlen. Er glaubte nicht an Ehre unter Dieben.
Farisio nahm seine Beine in die Hand und rannte los. Er war schon an Flinkfinger vorbei und in die nächste Nebenstraße eingebogen, bevor der begriff, wie ihm geschah. Zunächst ertönten noch Schritte auf dem Pflaster hinter ihm, die jedoch rasch verstummten. Hatten die beiden die Verfolgung etwa abgebrochen?
Es schien so, denn Farisio erreichte unbehelligt seinen Unterschlupf, aus dem ihm schon ein leises Wimmern entgegenschlug. Ileija hatte Hunger, Durst oder irgendetwas anderes quälte sie. Kurz überkam Farisio Panik. Wie hatte er nur denken können, dass er für ein Kleinkind sorgen konnte? Er konnte ja noch nicht einmal richtig für sich selbst sorgen.
»Schhh! Alles gut, ich bin ja da«, sagte er leise und nahm das kleine Mädchen hoch. Er hatte noch etwas Wasser übrig, das er ihr nun langsam einflößte, damit sie sich nicht verschluckte. Ileija trank gierig und begann dann wieder zu wimmern. Anscheinend hatte sie auch Hunger, doch da musste sie bis zum Morgen warten, genau wie er. Zumindest hatte er jetzt Geld, um ihnen etwas zu essen zu kaufen.
Er begann zu summen, während er ihr mit sanftem Druck den Bauch massierte. Ihm hatte das bei Hungerkrämpfen immer geholfen, um sich abzulenken und das Unwohlsein zu bekämpfen. Auch bei Ileija schien es zu wirken. Er wiegte die Kleine sanft in den Armen, bis sie eingeschlafen war. Dann legte er sich neben sie und überließ sich wie jede Nacht seinen Albträumen und dunkelsten Erinnerungen.
Es war noch vor Sonnenaufgang, als Farisio die Augen aufschlug. Er hatte schon seit Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen. Jedes Geräusch, jeder Albtraum, die Stimmen der anderen Kuftari, die für ihn nachts überdeutlich zu hören waren, weckten ihn aus seinem leichten Schlummer.
Farisio lauschte dem Wind, doch dieser sprach so früh noch nicht mit ihm. Stille herrschte um ihn herum, auch Ileija schlief noch. Er krabbelte daher leise mit einer Schale aus dem Unterschlupf, um neues Wasser aus einem nahen Bach zu besorgen. Das Erdloch hatte er etwas außerhalb der Stadt in einem verwilderten Feld mit vereinzelten Bäumen und Büschen gegraben, das die Bewohner von Brise anscheinend nie aufsuchten, denn das Gras stand hier hoch.
Der Junge benutzte seinen bereits breit getretenen Trampelpfad zum Bach, dabei wies ihm das erste Zwielicht des Tages den Weg. Er füllte die Wasserschale auf und wusch sich dann gründlich, während er nachdachte.
Die Chancen, dass er eine legale Arbeit fand, bei der er genug verdiente, um sich und Ileija zu ernähren, standen schlecht. Er war fremd in der Stadt und hatte niemanden, der für ihn bürgen konnte. Zudem waren die Bewohner von Brise Fremden gegenüber misstrauischer, als er gedacht hatte, und er musste seinen potenziellen Arbeitgeber außerdem noch davon überzeugen, dass er alt genug war.
Farisio musterte kritisch sein frisch gewaschenes Gesicht in der spiegelnden Wasserfläche. Er hatte scharf geschnittene Gesichtszüge, die man als schön bezeichnen konnte, helle, ausdrucksstarke Augen, eine schmale Nase und volle Lippen. Man sah ihm an, dass er noch keine sechsundzwanzig Jahre alt war. Doch wenn er eine richtige Arbeit haben wollte und nicht nur eine unterbezahlte Lehrstelle, dann würde alles davon abhängen, dass ihn die Leute für volljährig hielten.
Seufzend schloss er für einen Moment die Augen. Die Wahrheit war, dass er mit gerade mal zwanzig Jahren sogar für eine Lehre noch zu jung war. Lehrlinge begannen in der Regel mit zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahren ein Handwerk zu erlernen.
Nein, ich habe gar keine Wahl, dachte er grimmig und machte sich dann konzentriert an die Arbeit. Als er ein paar Minuten später zum Unterschlupf zurückkehrte, hätte man ihn für Mitte dreißig halten können. Zwar immer noch sehr jung, aber definitiv kein Kind mehr.
Als er Ileija hochhob, blinzelte das Mädchen und fing dann an zu weinen. Anscheinend erkannte sie ihn nicht. Farisio benötigte ein paar Minuten, um sie zu beruhigen. Danach gab er ihr etwas zu trinken und wusch ihr mit dem restlichen Wasser den Schmutz aus dem Gesicht. Gegen den Schmutz an ihrer Kleidung konnte er wenig tun.
Überrascht stellte er fest, dass Ileijas Kleidung, die er sich vor lauter Müdigkeit am Vortag nicht genau angesehen hatte, zwar schmutzig war, aber keinesfalls zerrissen oder geflickt. Im Gegenteil, einst musste das Kleidchen schick und von guter Qualität gewesen sein, etwas, das man einem Kind aus guter Familie anziehen würde. Was war nur geschehen, dass das Mädchen in einer Mülltonne gelandet war? Für Farisio wurde das Ganze immer rätselhafter.
Als er die Kleine so gut wie möglich hergerichtet hatte, klemmte er sich seine Haare und die oberen und hinteren Ohrenspitzen wieder sorgfältig unter die eng anliegende Mütze, setzte seinen abgetragenen Hut auf und marschierte dann mit Ileija in die Stadt. Trotz der frühen Stunde waren schon einige Leute auf den Straßen unterwegs. Er begegnete Bauern, die auf dem Weg zum Markt waren, und einzelnen Kaufleuten. Hin und wieder preschte auch ein Kurier an ihnen vorbei. Niemand beachtete ihn und seine kleine Schwester, für die er Ileija ab sofort ausgeben wollte. Geschwister hatte er sich immer gewünscht. Jemanden, mit dem er spielen und reden konnte. Jemanden, der die Einsamkeit vertrieb, wenn er sich stundenlang in der Garderobe seiner Mutter verstecken musste, weil sie nicht wollte, dass die Theaterangestellten oder ihre reichen Verehrer von seiner Existenz erfuhren.
Er hoffte, dass niemand die fehlende Ähnlichkeit zwischen ihnen bemerken würde. Statt hellen Augen hatte Ileija dunkle. Ihre Haare waren von einem gewöhnlichen Weiß-blau, ganz anders als die von Farisio, der mit seiner seltenen Haarfarbe aufgefallen wäre, hätte er sie nicht sorgfältig unter einer eng anliegenden Mütze und einem großen Hut versteckt. Selbst die Hautfarbe des Mädchens war dunkler als seine eigene. Er konnte nur hoffen, dass das Verstecken seiner Haare ausreichte und die Leute nicht zu genau hinsahen. Die meisten Kuftari sahen ihm sowieso nicht ins Gesicht, sondern wandten die Blicke von ihm ab, sobald sie seine heruntergekommene Kleidung bemerkten. Nur die Wachen schauten genauer hin oder Männer, die Schwächere ausnutzten.
Inzwischen schlief die Kleine in seinen Armen, und er lächelte, als er ihr vorsichtig die Haare aus dem Gesicht und hinter die Ohren strich, die gerade erst die typische Dreiecksform der Kuftari annahmen: oben, unten und hinten spitz zulaufend.
Als er die Bäckerei erreichte, war Ileija jedoch rasch wieder wach und tat ihren Hunger mit Gebrüll kund. Farisio erstand ein kleines, weiches Brot. Dabei wurde er von dem Bäcker sofort bedient, was er wohl Ileijas Gebrüll verdankte und der Tatsache, dass er das Geld bereits passend in der Hand hatte.
Draußen zerpflückte er das Brot in kleine Stücke und reichte dem Mädchen das erste. Ileija begann zu essen und hatte ihre Portion schnell verputzt, auch die nächsten Stücke waren rasch verschlungen. Farisio aß langsamer. Er genoss jeden Bissen, da er nie wusste, wann es das nächste Mal etwas zu essen geben würde. Am liebsten hätte er die Hälfte des Brotes aufgespart, aber er brachte es nicht übers Herz, die Kleine hungern zu lassen.
»Dann lass uns mal einkaufen gehen, was, Ileija?«, meinte er und lächelte, als die Kleine an seiner Hand fröhlich mit ihm durch die Straßen lief. Dafür, dass sie erst vor Kurzem laufen gelernt haben musste, klappte das schon ganz gut.
Brise fühlte sich mit ihr an seiner Seite anders an. Fröhlicher, unbeschwerter – besser. Die Leute lächelten mehr und verfolgten wohlwollend, wie er versuchte, der Kleinen ihr erstes Wort beizubringen, während er ihr die Namen der Dinge nannte, auf die sie aufgeregt zeigte.
Ileija liebte die Windspiele: die Glockenspiele vor den Haustüren, die Windpfeifen an den Hauswänden oder die großen Metallmobiles auf den öffentlichen Plätzen. Es war selten still in Brise. Aber das Klingen, Klirren, Summen, Murmeln und dumpfe Rauschen waren angenehm und harmonisch. Farisio erkannte rasch unterschiedliche Melodien und Lieder. Einige hatte er schon in den letzten Tagen gehört, da der Wind von Wirilat ein paar Lieblingslieder zu haben schien, andere waren neu.
Am großen Platz vor dem Rathaus blieben sie einige Minuten stehen und beobachteten die Wachablösung. Das große Segelschiff aus Holz, auf dem die neue Schicht bei den letzten Vorbereitungen zum Ablegen war, summte bereits. Ein Mann stürzte aus der benachbarten Wachstation und knöpfte sich rasch noch die Jacke zu, während er über die Holztreppe hinauf zur Landeplattform eilte, an der das schwebende Schiff festgemacht war.
Farisio fand es immer wieder beeindruckend, dass die Leute die erstaunliche Magie, die notwendig war, um ein Schiff durch die Luft segeln zu lassen, als völlig normal und alltäglich ansehen konnten. Es benötigte gut ein halbes Dutzend Windkristalle – jeder einzelne wurde aus Sicherheitsgründen wöchentlich von einem Nachkommen von Wirilat aufgeladen –, um einen Windsegler fliegen zu können. Zwei davon waren schon im Ruhebetrieb nötig, um das Schiff schweben zu lassen. Hätte man diese deaktiviert, wäre das schwere Holzschiff mit dem Kiel voraus zu Boden gekracht und umgestürzt.
Eines Tages würde er auf einem von ihnen fliegen.
Der Junge seufzte sehnsüchtig, als er die Männer und Frauen der Wache um die Aussicht über ganz Wirilat beneidete, die sie bald genießen würden. Er war für diese Aussicht, für die Freiheit der Weite und die Musik des Windes nach Wirilat gekommen – und weil die Domäne des Windes die Heimat seiner Mutter gewesen war, die sie zu ihren Lebzeiten jedoch nie gemeinsam besucht hatten.
Farisio fragte sich, ob diese Domäne wohl irgendwann seine Heimat werden würde, und biss sich auf die Unterlippe. Wirilat war genauso, wie er sich das Land vorgestellt hatte, und zugleich völlig anders. Jede der neun Domänen unterschied sich von den anderen. Einst waren es zehn Domänen gewesen, denn zehn Gründer hatten die Splitterwelt gemeinsam aus dem Nichts erschaffen und ihr eine Schutzhülle gegen die verzehrenden Kräfte des Nichts gegeben, um dann ihre idealen Länder zu gestalten.
Da die Gründer Magier mit unterschiedlichen Fähigkeiten waren, hatten sie ihre Domänen ihrem jeweiligen Spezialgebiet und ihrem Element gewidmet. Wirilat war ein Windmagier, seine Schwester Diniri eine Wassermagierin, ihr Bruder Aklaj ein Feuermagier und ihre jüngste Schwester Gorgubi eine Erdmagierin. Die Zwillinge Ectorui, eine Chaosmagierin, und Osirriso, ein Ordnungsmagier, waren so unterschiedlich, wie man nur sein konnte. Die Brüder Tehmar und Moronis, die Herrscher über Zeit und Raum, hätte man auch nie für Geschwister gehalten, da es zwischen den beiden ungleichen Gründern weder Liebe noch Hass zu geben schien. Die letzte Gründerin war die Wahrheitsverfechterin Pultaris. Einst hatte sie noch einen jüngeren Bruder gehabt, doch Injati, der Verbindungsmagier, hatte vor etwa tausend Jahren Selbstmord begangen. Dabei hatte er die von ihm erschaffene Domäne und all ihre Bewohner mit sich in den Tod gerissen. Nun herrschte dort, wo einst eine Domäne der Splitterwelt gestanden hatte, wieder das Nichts und erinnerte durch abgeschnittene Pfade ins Nirgendwo an die Tragödie, die sich hier vor langer Zeit ereignet hatte.
Ileijas Glucksen lenkte Farisios Aufmerksamkeit wieder auf das Luftschiff, auf dem nun ein Mann die Leinen losmachte und der Mannschaft auf der Landeplattform ein Signal gab. Während die Mannschaft auf der Station zurücktrat und salutierte, nahmen die Wachen an Bord ihre Positionen ein. Am Ruder stand ein großer, breit gebauter Mann, der Farisio für einen kurzen Moment an Scharfauge erinnerte und ihm einen Schreck einjagte. Unwillkürlich zuckte er zusammen und duckte sich. So verpasste er den Moment, in dem die Wachen die Windkristalle berührten und aktivierten. Rasant erhob sich das Schiff in die Luft und segelte über den Platz. Doch obwohl es so schnell stieg, erschien es Farisio, als fliege es nur haarscharf über die angrenzenden Häuserdächer hinweg.
Sobald das eine Windschiff fort war, näherte sich auch schon das nächste, um zu landen. Die Nachtwache freute sich sichtlich über ihr Schichtende, denn kaum waren die Windkristalle bis auf die beiden Schwebekristalle deaktiviert und das Schiff fest vertäut, so strömten die Wachsoldaten auch schon vom Schiff und überließen der Mannschaft auf der Landeplattform die Aufräumarbeiten.
»Na? Hat dir das gefallen?«, fragte Farisio Ileija, die unverständliche Laute vor sich hin plapperte. Bald würde sie das erste Wort sagen können, und der Gedanke erfüllte ihn erneut mit einem Gefühl der Verantwortung.
Entschlossen trug er das Mädchen durch die Stadt. Sie brauchten neue Kleidung und er hatte auch schon eine Idee, wo sie die bekommen würden. Nicht weit vom Stadtrand und eine Viertelstunde Fußmarsch entfernt gab es eine kleine Schneiderei, die keine wohlhabenden Kunden zu haben schien, denn sie bot fertige Kleider für jedermann an. Man musste nur etwas finden, das ungefähr passte und dem eigenen Geschmack entsprach, und musste nicht erst tagelang warten, bis der Schneider Maß genommen und die neue Kleidung angefertigt hatte.
»Das ist genau das, was ich brauche«, flüsterte Farisio, als er durch das Schaufenster in den Laden sah. Je eher er neue Kleidung hatte, desto eher konnte er sich eine Arbeit suchen und für Ileija sorgen.
Er betrat den Laden mit Ileija auf dem Arm und sah sich um. Als Erstes brauchte er saubere und warme Kleidung für die Kleine.
»Ja, bitte?«, fragte jemand hinter ihm und Farisio wirbelte herum. Ein Verkäufer von etwa fünfzig Jahren stand vor ihnen und musterte sie kritisch. Farisio sah kurz Misstrauen und Abscheu über seine Züge huschen, dann war der junge Mann wieder ein Muster an Höflichkeit. »Wir geben leider keine Almosen.«
»Danke, wir brauchen auch keine«, erklärte Farisio mit aller Würde, die er aufbringen konnte. Es wunderte ihn, dass der Mann überhaupt höflich war. »Bitte zeigen Sie mir doch, was Sie in der Größe meiner Schwester dahaben. Wir benötigen drei neue Garnituren. Und danach werde ich für mich selbst noch etwas auswählen.«
Farisio merkte, dass sein Verhalten den Verkäufer irritierte. Er wusste nicht, was er von ihnen halten sollte. Sie waren verdreckt und wirkten arm, wollten aber mehrere Kleidungsstücke für jeden erwerben? Das Rätsel schien seine Neugier zu entfachen und ein paarmal wollte er etwas sagen oder fragen, wie sie in diese missliche Lage gekommen waren, blieb am Ende aber stumm.
Als Farisio neue, einfache Kleider für Ileija, warme Wäsche und eine Jacke gefunden hatte, setzte er sie in ihren guten Sachen in einen Sessel in der Ecke und bat den Verkäufer um ein Spielzeug, damit sich das Mädchen eine Weile beschäftigen konnte, während er Hosen und Oberteile anprobierte. Schließlich hatte er je drei Teile gefunden, die ihm einigermaßen passten und die nach einfachem, aber nicht armem Bürger aussahen. Widerwillig wählte er auch noch eine Jacke für sich aus. Die Ausgaben würden trotz aller Sparsamkeit ein kleines Vermögen verschlingen, und sie waren noch nicht beim Schuster gewesen, mussten später erneut Essen kaufen und eventuell noch eine billige Wohnung finden. Da er niemanden in der Stadt kannte, der sich für ihn einsetzen konnte, würde er mit Geld beim Vermieter bürgen müssen.
Als er bezahlte, ließ er sich nicht anmerken, wie unwohl ihm angesichts ihrer unsicheren Zukunft war. Der Verkäufer hingegen strahlte. Er war sichtlich erleichtert, dass Farisio ohne zu feilschen den Kaufpreis auf die Theke legte, und wickelte die Kleidung in Packpapier ein.
»Besuchen Sie uns doch gerne wieder«, meinte er höflich zum Abschied, während Farisio nickend das Bündel entgegennahm.
Als er sich umdrehte, sah er gerade noch, wie Scharfauge Ileija hochhob und sich mit ihr in Luft auflöste.
3
Brise
Farisio konnte im ersten Moment nicht glauben, was er gesehen hatte, hielt geschockt inne und ließ seine Einkäufe fallen. Hatte er tatsächlich gerade eben beobachtet, wie der dicke Gauner seine kleine Schwester aus dem Sessel gehoben und sich mit ihr einfach so davonteleportiert hatte, als wäre er ein Kind von Moronis?
Er keuchte leise, als er es vergeblich zu begreifen versuchte. Wie konnte ein Verbrecher in der Lage sein, sich einfach so in Luft aufzulösen, ohne ein Raumportal zu benutzen? Das war unmöglich, es sei denn Scharfauge war ein Nachkomme des Gründers der Raumdomäne Moronis.
»Keine Angst, der Kleinen geht es gut«, sagte plötzlich jemand direkt neben ihm und Farisio zuckte zusammen. Als er herumwirbelte, überraschte es ihn nur für einen kurzen Moment, Flinkfinger zu sehen.
Dann jedoch senkte sich ein roter Schleier der Wut über ihn und jeder klare Gedanke war vergessen. Er stürzte sich auf den noch anwesenden Entführer seiner Schwester, packte ihn am Kragen und zerstörte mit einem gezielten Schlag gegen den Berun-Nerv gleichzeitig Flinkfingers Gleichgewicht und löste einen scharfen Schmerz inklusive Lähmung in seinem gesamten rechten Bein aus. Flinkfinger schrie auf, fiel mit einem lauten Krachen zu Boden und stöhnte, während Farisio ihm mit einer schnellen Bewegung das Messer aus dem Gürtel zog und es ihm an die Kehle hielt. Nur undeutlich bekam Farisio mit, dass der Verkäufer vor Schreck und Angst quietschte und sich hinter den Tresen duckte.
»Wo ist sie?«, zischte er, während die Wut so heiß wie Lava durch seine Adern strömte. Es kostete ihn jede Unze der Selbstbeherrschung, die er sich in den letzten Jahren antrainiert hatte, um sich nicht der Dunkelheit in seinem Inneren zu überlassen. Er war gefährlich und nun erkannte das auch Flinkfinger.
»Bitte warte«, flehte er und die Dunkelheit in Farisio hätte die Todesangst in seinen Augen genossen, hätte er dieses Gefühl nicht gnadenlos unterdrückt.
»Du verrätst mir jetzt sofort, wo meine Schwester ist, oder du wirst es bereuen!«
»Sie ist bei uns. Wir wollten doch nur, dass du uns zuhörst.«
Der schrille Pfiff einer Trillerpfeife ließ Farisio herumwirbeln. Anscheinend hatte der Verkäufer seine erste Panik überwunden und sich daran erinnert, dass er mit der Pfeife um seinen Hals die Wache rufen konnte. Leider würde die nicht lange brauchen, bis sie durch die Tür stürmen würde. Farisio blieb nicht mehr viel Zeit.
Genauer gesagt, gar keine mehr, denn als er seine Aufmerksamkeit wieder auf Flinkfinger richtete, hatte der die Augen geschlossen und löste sich in diesem Augenblick ebenfalls in Luft auf. Farisio, der ihn mit seinem Körpergewicht zu Boden gedrückt hatte, stieß mit den Knien auf den Boden und fluchte. Er war außer sich vor Zorn. Nur wegen dieses Idioten war ihm der Entführer entkommen.
»Was haben Sie getan?«, brüllte er den jungen Verkäufer an, der sich wimmernd sofort wieder hinter den Tresen kauerte.
In Farisios Ohren rauschte es. Seine Kontrolle über die Dunkelheit hing am seidenen Faden, als der Schmerz über den unerwarteten Verlust über ihm zusammenschlug. Gerade erst hatte er Ileija gefunden und nun war sie ihm schon grausam entrissen worden. Er hatte ihr gedankenlos sein Herz geöffnet, weil er gedacht hatte, ein kleines Kind könne es ihm nicht brechen, denn ein kleines Kind kannte noch keine Grausamkeit und keine Boshaftigkeit. Doch er hatte nicht bedacht, dass er sie damit zur Zielscheibe für alle machen würde, die über sie an ihn herankommen wollten. Er hatte nicht daran gedacht, dass er sie genauso schnell wieder verlieren konnte, wie er sie gefunden hatte.
Ein qualvolles Heulen drang durch seine Kehle. Er spürte, wie sein Freund, der Wind, auf seinen Schmerz und seine Verzweiflung reagierte und ebenfalls brüllte und toste, doch Farisio war zu wütend, um ihm zuzuhören. Warum hatte der Wind ihn nicht vor dem gewarnt, was passieren würde? Wie hatte sein einziger Freund auf dieser Welt so etwas zulassen können?
Farisios Verzweiflung wuchs ins Unermessliche, als er erkannte, dass er allein war, dass ihm niemand helfen würde. Weder der Verkäufer, der sich immer noch voller Angst vor ihm, dem Opfer, hinter seinem Tresen versteckte, noch die Wachen, die nun in den Laden stürmten und ihre Dolche und Schwerter auf ihn richteten.
Er war allein – bis auf die Dunkelheit in seinem Inneren.
Farisio ließ zu, dass die Stimme ihm Versprechungen zuflüsterte und Hilfe anbot. Stets hatte er die Verlockungen der Dunkelheit ausgeblendet, hatte nicht zugelassen, dass auch nur eine ihrer Versprechungen Eindruck auf ihn machte. Er hatte die Stimme unterdrückt, so wie er auch die Dunkelheit gnadenlos unterdrückt hatte. Er hatte nicht hören wollen, was sie ihm zu sagen hatte, denn er hatte den Preis für ihre Hilfe nicht zahlen wollen.
Nun aber war er am Ende seiner Willenskraft und die Stimme der Dunkelheit war lauter als je zuvor. Er schluchzte, als er an Ileija dachte, die er im Stich gelassen hatte und nun nie wiedersehen würde. Sein Schmerz gefiel der Dunkelheit und Farisio hatte das Gefühl, als würde sie ihre scharfen Krallen in ihm versenken.
Als er aufschrie, brach die gestaltlose Dunkelheit aus ihm heraus und ein Chor aus Schreien antwortete ihm, während die Soldaten der Wache und der Verkäufer zusammenbrachen.
»Nein!«
Entsetzt sah er die stöhnenden Männer und Frauen an, die sich voller Schmerzen auf dem Boden wanden. Das war nicht er. Und er würde sich von der Dunkelheit auch nicht dafür benutzen lassen.
Mit letzter Willenskraft unterdrückte er die Dunkelheit und zog sie in sich selbst zurück. Sie protestierte, schrie und hieb mit ihren Krallen nach ihm, während er sie wieder in sich zog, doch er unterdrückte den Schmerz mit eiserner Entschlossenheit. Er würde sich nicht von der Dunkelheit in eine Waffe verwandeln lassen. Er weigerte sich, dieses Schicksal zu akzeptieren.
Als er die Dunkelheit besiegt und wieder eingesperrt hatte, warf er einen letzten Blick auf die niedergestreckten Männer und Frauen. Schuldgefühle schlugen über ihm zusammen und drückten ihn nieder. Er spürte ihren Schmerz, als wäre es sein eigener. Und nichts anderes hatte er verdient. Er hatte zugelassen, dass die Dunkelheit, deren Hüter er war, entkommen war und Unschuldige verletzt hatte.
»Es tut mir leid«, flüsterte er.
Doch er wartete nicht ab, bis sie sich erholt hatten. Sie würden nicht verstehen, was er getan hatte oder was er war. Sie würden ihn jagen, ihn in eine fensterlose Zelle werfen und ihn so lange untersuchen, bis er zu schwach war, um die Dunkelheit weiter im Zaum zu halten. Er hatte es bereits einmal zu oft zugelassen, dass die Dunkelheit ihn austrickste. Das würde er niemals wieder tun, egal wie hoch der Preis für ihn selbst war.
Farisio ging zur Ladentür, ohne zurückzuschauen. Er rannte nicht und zeigte weder Schuld noch Angst, als er sich den Blicken der Passanten stellte, die neugierig oder furchtsam zur offenen Tür starrten. Sie hatten die Schreie gehört und wussten nicht, was sie davon halten sollten, dass er jetzt seelenruhig und unverletzt zur Tür herausspazierte.
»Gibt es hier einen Heiler?«, fragte er laut. »Kann jemand einen Heiler holen?«
Er sah einigen jungen und älteren Männern und Frauen in die Augen, flehte mit seinem Blick um Hilfe und plötzlich veränderte sich ihr Verhalten ihm gegenüber. Plötzlich war er nicht länger verdächtig. Er war ein Opfer, das unter Schock stand.
Farisio ließ zu, dass sich die Kuftari an ihm vorbei in den Laden drängten. Jemand legte den Arm um ihn und er musste sich anstrengen, um nicht zusammenzuzucken. Er hasste es, von Fremden angefasst zu werden, auch wenn diese es nur gut meinten, so wie die freundliche, vielleicht hundertdreißig Jahre alte Dame, die ihn nun zu ihrer Teestube führte, wo sie ihm ein heißes Getränk anbot. Er trank es langsam aus, während er seinen Blick immer auf die Straße gerichtet hielt. Ihm blieb nicht viel Zeit, bis sie kommen würden, um ihn zu suchen.
»Danke«, sagte er nach ein paar Minuten und reichte seiner gutmütigen Helferin die leere Tasse. Die Wärme hatte ihm neue Stärke gegeben. Er spürte, wie die Schutzmauern in seinem Inneren die Dunkelheit wieder fest umschlossen. Es war leichtsinnig von ihm gewesen, dass er es so weit hatte kommen lassen. Es war egal, was mit ihm selbst geschah. Aber er durfte nicht vergessen, dass er Verantwortung für das Leid trug, welches die Dunkelheit anrichtete, wenn er ihr in einem Moment der Schwäche die Kontrolle überließ. Deshalb musste er sie um jeden Preis in sich eingesperrt halten und nun musste er schließlich auch für Ileija sorgen.
Mutlosigkeit und Unruhe trieben ihn zurück auf die Straße, allen gut gemeinten Protesten seiner Helferin zum Trotz, der er ein letztes trauriges Lächeln schenkte. Er bezweifelte, dass sie ihm geholfen oder Mitleid mit ihm gehabt hätte, wenn sie die Wahrheit gewusst hätte, auch wenn er es sich nie ausgesucht hatte, der Hüter der Dunkelheit zu sein. Er hatte sie nie gewollt, im Gegensatz zu seiner Mutter.
Er konnte ihr verzerrtes Gesicht heute noch genauso deutlich vor sich sehen wie in jener schrecklichen Nacht vor zehn Jahren …
Es war die ungewohnte Stille, die Farisio weckte. Seine Mutter war nie leise, wenn sie zu Hause war. Häufig feierte sie bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen mit Freunden oder Liebhabern. Das waren die Nächte, in denen er am besten schlafen konnte. Die Stunden, in denen sie vergaß, dass es ihn gab, solange er sich nur still verhielt und in seinem Zimmer blieb. Zeiten, in denen er sich nicht bemühen musste, seine Schwächen und Fehler zu vertuschen, weil er zu weich oder zu unbegabt war oder wieder einmal nicht verstanden hatte, was sie von ihm wollte. Wenn er nicht der Sohn war, den sie sich immer vorgestellt hatte und der ihr zustand. Sondern der Bastard, der ihr Leben ruinierte und bestraft werden musste.
Farisio erschauderte, als er begriff, dass seine Mutter in dieser Nacht allein war. Ohne jemanden, den sie beeindrucken, manipulieren oder verführen wollte. Es war niemand da, vor dem sie ihren Zorn und ihre Enttäuschung verstecken musste. Niemand, der ihre Hand oder ihre Magie aufhalten würde, bevor sie zuschlug …
Unwillkürlich begann er zu zittern, und die raue Decke schabte über seine frischen Wunden und brachte seine Haut zum Brennen. Aber er traute sich nicht, sich an den juckenden Stellen zu kratzen. Stattdessen lauschte er angestrengt auf die Stille vor dem nächsten Sturm.
Doch auf der Treppe blieb es ruhig. Kein zorniges Stampfen oder kühl berechnete leichte Schritte, die sich seinem Zimmer unter dem Dach näherten. Nur eine leichte Brise war durch das undichte Dachfenster zu hören. Doch der Wind war sein Freund. Von ihm hatte er nichts zu befürchten. Er beschützte Farisio an regnerischen Tagen sogar vor der Feuchtigkeit, nachdem Farisios Mutter ihn verprügelt hatte, als er vergessen hatte, das Fenster vor einem Schauer zu schließen, und der Regen die Holzdielen dermaßen durchweicht hatte, dass zwei von ihnen unter seiner Mutter durchgebrochen waren. Farisio hatte Stunden gebraucht, um sie mit seinem gebrochenen Arm so zu ersetzen, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden war. Erst nachdem er seine Strafe verbüßt hatte, hatte sie es Ybbydus erlaubt, einen Heiler für ihn zu rufen.
Nein, Stille war nicht gut. Selbst wenn seine Mutter ruhte, konnte er immer noch ihr gereiztes Murmeln im Schlaf hören. Vollkommene Stille bedeutete, dass sie nachdachte. Dass sie etwas plante. Und die meisten Pläne betrafen ihn … oder Ybbydus.
Angst ließ sein Herz schneller schlagen und er setzte sich aufrecht hin. Wenn sie nicht bei ihm war, dann war sie womöglich bei seinem Lehrer und Freund. Und das war noch schlimmer.
Bevor er darüber nachdenken konnte, war Farisio aus dem Bett. Lautlos öffnete er die Zimmertür und schlich dann die Treppe nach unten. Auf der letzten Stufe hielt er inne. Mit angehaltenem Atem beugte er sich vor und blickte den Flur entlang.
Als Erstes bemerkte er den Feuerschein, der aus der Küche kam.
Hier stimmte etwas nicht! Niemand sollte um diese Uhrzeit in der Küche sein. Im Salon, im Musikzimmer, einem der Gästezimmer oder in der Bibliothek – in all diesen Räumen konnten sich Leute aufhalten. Aber die Küche war Terjas Reich und die Köchin begann ihre Arbeit erst bei Sonnenaufgang und nicht in tiefster Nacht.
Was wollte seine Mutter in der Küche? Und warum hatte sie ein Feuer im Ofen entfacht?
Eine Antwort drängte sich ihm auf, eine Erklärung, wofür der riesige Ofen im Gegensatz zu den Kaminen in den Wohnräumen geeignet war, und er musste schlucken. Seine Angst wuchs, aber er konnte nicht wegbleiben. Er musste sehen, was sie vorhatte. Sehen, ob er Terja oder Ybbydus vielleicht vor der Wut seiner Mutter bewahren konnte. Denn anders als er selbst hatten sie diese nicht verdient.
Als er vor dem Eingang zur Küche stand und hineinsah, kam ihm der Anblick im ersten Moment wie ein Traum vor. War es wirklich seine Mutter, die diese fremdartigen Symbole und Zeichen mit blauer Farbe auf den Boden und die Wände malte? Die gut gelaunt summte und so glücklich lächelte, wie er es noch nie gesehen hatte? Und die dann mit ihrer Macht ausholte und der gefesselten Terja mit einem Hieb alle Knochen brach, sodass die Köchin wie ein todgeweihtes Tier aufschrie, während seine Mutter zu einem rituellen Gesang ansetzte und das blaue Blut in einer Schale auffing? Dann bugsierte sie die gutmütige alte Frau, die ihm jeden Tag Plätzchen und Pralinen zugesteckt hatte, wenn seine Mutter nicht hinschaute, in den prasselnden Ofen. Farisio vermochte nicht zu begreifen, wie seine Mutter dazu fähig war, wie sie die ganze Zeit lächeln konnte, während Terja schreiend bei lebendigem Leib verbrannte. Es musste ein Albtraum sein …
Doch es war Wirklichkeit. Der Wind schrie ihm seine Warnung zu: »Gefahr! Lauf!«
Farisio konnte es nicht. Ein Brüllen entriss sich seiner Kehle, als er auf den Ofen zustürzte und dabei seine Mutter umrannte, die ihren schrecklichen, falschen Gesang vor Überraschung, Schreck oder Zorn unterbrach. Dann steckte er die Hände ins Feuer, um Terja herauszuholen, um sie vor einem Schicksal zu retten, das sie nicht verdient hatte.
Seine Finger schmerzten vor Hitze und warfen Blasen – wieder eine Enttäuschung für seine Mutter, die mit ihrer Magie die perfekte Kontrolle über Flammen hatte, im Gegensatz zu ihm, der noch nicht einmal eine Kerze entzünden konnte, geschweige denn sich selbst vor Brandverletzungen schützen. Und doch bemühte sich Farisio jetzt wie nie zuvor in seinem Leben. Wenn es ihm nur einmal gelang, Magie zu wirken und Terja vor dem Feuertod zu retten!
Doch die Kleidung der Köchin stand bereits lichterloh in Brand und ihre Schreie verstummten, bevor er es auch nur geschafft hatte, sie eine Elle aus dem Ofen zu zerren. Er war zu spät. Und als er sich umsah, erkannte er, dass er gleich in doppelter Hinsicht versagt hatte.
Was auch immer seine Mutter für ein Ritual durchgeführt hatte: Es war abgeschlossen. Seine Mutter stieß den letzten Ton aus, der vor dunkler Magie frohlockend im Raum widerhallte, und setzte sich dann die Schale an den Mund, um zu trinken.
»So höre mich, dunkles Schicksal Pein! Ich beschwöre dich! Du bist mein!«
Sie lachte, als sich eine unnatürliche Dunkelheit über die blauen – die blutblauen – Zeichen und Symbole legte und sie schwarz färbte. Übelkeit überkam Farisio, als er erkannte, dass seine Mutter ihre arme, unschuldige Köchin getötet hatte, um … ja, was zu tun? Irgendein dunkles Schicksal zu beschwören? Ihn leiden zu lassen?
Um alle anderen zu bestrafen und zu unterwerfen?
Er begriff plötzlich, dass seine Mutter böse war. Nicht er war mangelhaft und hatte Strafe verdient, sondern sie. Sie hatte ihm keine Lektion erteilen wollen, damit er aus seinen Fehlern lernte. Sie hatte Ybbydus nicht gewaltsam bestraft, weil er versucht hatte, Farisio zu beschützen, sondern weil sie grausam war und sich am Leid anderer ergötzte.
Ein Schluchzen mischte sich unter das wahnsinnige Lachen, und Farisio erkannte, dass er weinte. Um Terja, um Ybbydus, um sich selbst und um alle anderen, die seine Mutter in all den Jahren verletzt hatte.
Unwillkürlich sah er wieder zum Feuer, das jetzt gierig die Leiche der Köchin verschlang. Dabei schien es grausamerweise zu den Freudenklängen seiner Mutter zu tanzen. Die Flammen waren die Einzigen, die sich noch nicht der verhängnisvollen Dunkelheit im Raum ergeben hatten. Diese Dunkelheit hing jetzt unter der Decke und füllte den kompletten Raum aus, dabei formte sie sich langsam zu einem merkwürdigen Symbol.
Dann schien das Zeichen vollständig zu sein und das unerträgliche Gelächter versiegte endlich, während Farisios Mutter begierig nach oben starrte und den Mund öffnete. Im selben Moment ertönten laute Schritte auf dem Flur. Ybbydus stürzte nur mit einer Schlafanzughose bekleidet in die Küche. Farisios Mutter wirbelte mit fassungsloser Miene herum und Farisio öffnete den Mund, um seinem geliebten Lehrer eine Warnung zuzurufen …
In diesem Moment zog sich die Dunkelheit zusammen wie eine angespannte Feder, um im nächsten Augenblick von der Decke zu schnellen … direkt auf Farisios geöffneten Mund zu!
Er wollte schreien, doch die Dunkelheit überwältigte ihn, raubte ihm den Atem und füllte ihn komplett aus. Voller Panik wollte Farisio die schwarze Masse – den Qualm? Das dunkle Licht? – wieder ausspucken und nach Luft schnappen, doch es gelang ihm nicht.
Undeutlich hörte er seine Mutter vor Zorn brüllen, dann wurde er von ihren kräftigen Händen geschüttelt, damit er die Dunkelheit herausgab. Wenn er nur gewusst hätte, wie! Wenig später waren die grausamen Finger fort, weggerissen von Ybbydus, der seine Mutter anschrie, und ein gewaltiger Schlag ertönte, als sie ihn für seine Einmischung bestrafte.
Nein! Nie wieder!
Unbändiger Zorn erfüllte ihn, breitete sich in ihm aus und strömte aus ihm heraus, bis er die Küche füllte … und plötzlich schrie seine Mutter, wie er sie noch nie schreien gehört hatte. Voller Leid und Schmerz.
»Farisio! Hör auf! Du musst dich beruhigen! Lass nicht zu, dass Pein dich beherrscht. Du bist nicht wie deine Mutter. Du willst niemandem wehtun. Lass dich nicht zur Marionette des dunklen Schicksals machen!«
Er hörte die Worte seines Freundes und Lehrers, doch erst als auch Ybbydus wimmernd und schluchzend zu Boden ging, begriff Farisio, dass die Dunkelheit in ihm nicht nur seine Mutter bestrafte. Nein, sie tat auch seinem einzigen Freund weh. Er tat Ybbydus weh.
Farisio taumelte zurück, als sich das Entsetzen in ihm ausbreitete und den Zorn verdrängte. Das hatte er nicht gewollt. Niemals würde er zulassen, dass er zu einem Werkzeug wurde, das Ybbydus verletzte.


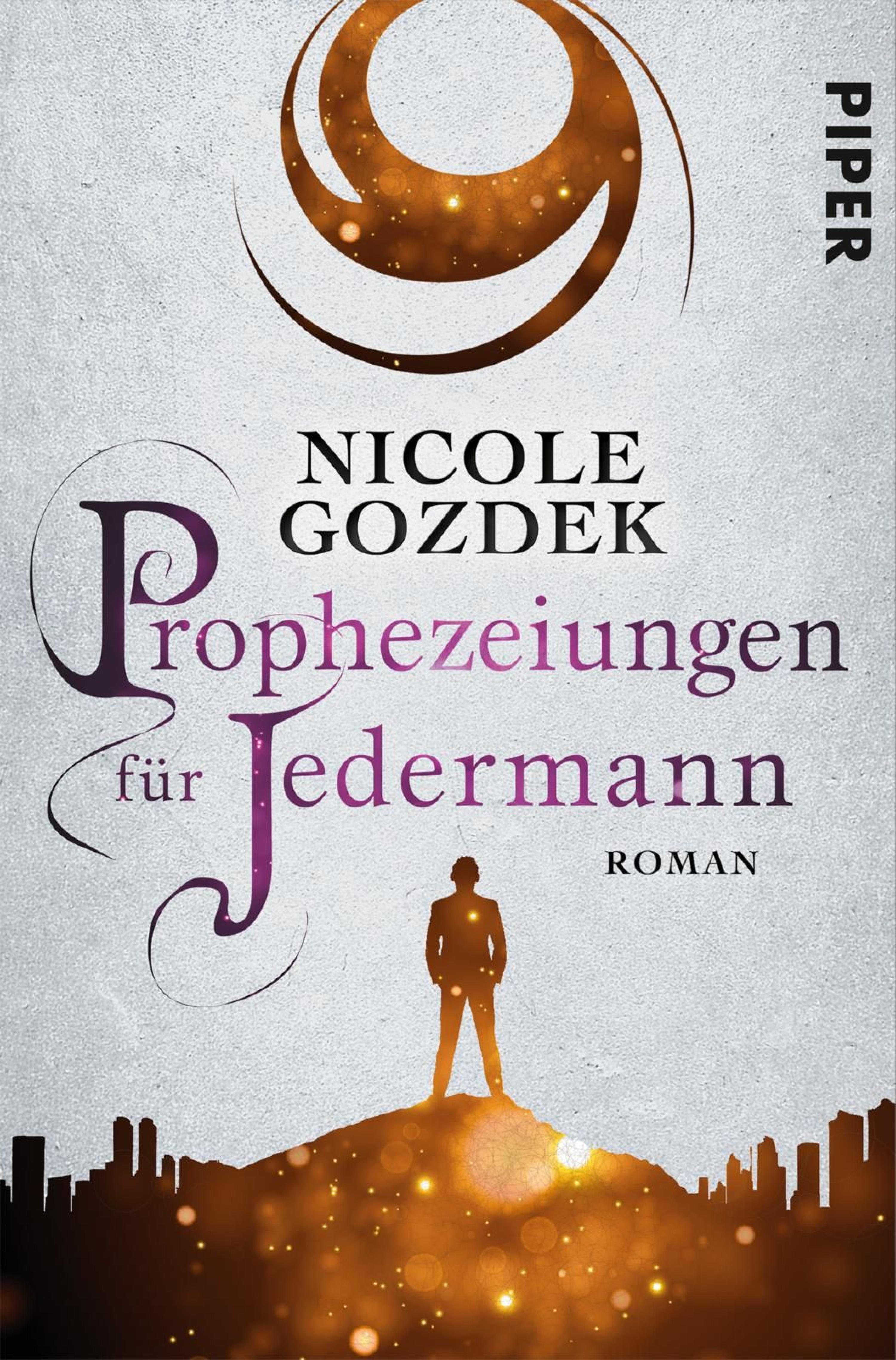

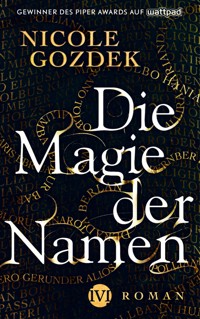
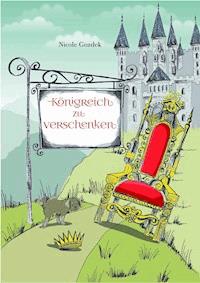













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









