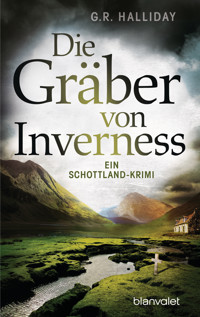
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Monica Kennedy
- Sprache: Deutsch
Ein feuchtes Grab im schottischen Moor. Eine Serienmörderin hinter Gittern. Ein Nachahmungstäter oder ein perfides Spiel der verurteilten Killerin?
Vor zwölf Jahren fasste DI Monica Kennedy die Serienkillerin Pauline Tosh. Es war ihr erster großer Fall. Vergessen von der Welt, sitzt die Mörderin seitdem hinter Gittern. Die Morde hat sie nie gestanden. Als DI Kennedy eine Nachricht erhält, dass Tosh um ein Treffen bittet, ist die Kommissarin entsprechend überrascht. Sie gibt ihrer Neugier nach und stattet der Inhaftierten einen Besuch ab. Diese übergibt der Polizistin eine handgezeichnete Karte von einem abgelegenen Moorgebiet mit einem Kreuz darauf. Gibt es etwa noch mehr Opfer? DI Kennedy geht dem neuen Hinweis nach und findet tatsächlich eine Leiche. Doch schnell stellt sich heraus, dass Tosh zum Todeszeitpunkt des Opfers ein absolut wasserdichtes Alibi hat. Woher aber wusste die Serienmörderin von der vergrabenen Leiche und läuft etwa ein weiterer, unbekannter Täter noch frei herum?
Alle Bücher der Monica-Kennedy-Reihe
Die Toten von Inverness (Bd. 1)
Die dunklen Wasser von Inverness (Bd. 2)
Die Gräber von Inverness (Bd. 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Vor zwölf Jahren fasste DI Monica Kennedy die Serienkillerin Pauline Tosh. Es war ihr erster großer Fall. Vergessen von der Welt, sitzt die Mörderin seitdem hinter Gittern. Die Morde hat sie nie gestanden. Als DI Kennedy eine Nachricht erhält, dass Tosh um ein Treffen bittet, ist die Kommissarin entsprechend überrascht. Sie gibt ihrer Neugier nach und stattet der Inhaftierten einen Besuch ab. Diese übergibt der Polizistin eine handgezeichnete Karte von einem abgelegenen Moorgebiet mit einem Kreuz darauf. Gibt es etwa noch mehr Opfer? DI Kennedy geht dem neuen Hinweis nach und findet tatsächlich eine Leiche. Doch schnell stellt sich heraus, dass Tosh zum Todeszeitpunkt des Opfers bereits hinter Gittern saß. Gibt es einen Nachahmungskiller, oder sitzt Pauline Tosh gar unschuldig im Gefängnis, und der wahre Mörder läuft noch frei herum?
Autor
G.R. Halliday wurde in Edinburgh geboren und wuchs in der Nähe von Stirling, Schottland, auf. Die Leidenschaft für ausgeklügelte Kriminalfälle hat er von seinem Vater, der Bücher über True Crime und mysteriöse Phänomene schrieb. Einige dieser Geschichten wurden zur Inspirationsquelle für seine eigenen Romane. Heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin und einer Bande halbwilder Katzen in der Nähe von Inverness in den schottischen Highlands.
Von G. R. Halliday bereits erschienen
Die Toten von Inverness · Die dunklen Wasser von Inverness · Die Gräber von Inverness
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
G.R. Halliday
Die Gräber von Inverness
Ein Schottland-Krimi
Deutsch von Bettina Spangler
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Under the Marsh« bei Vintage, a part of the Penguin Random House group of companies, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Highland Noir Ltd.
Published by Arrangement with HIGHLAND NOIR LIMITED.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung und -motiv: © www.buerosued.de
JA · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30444-7V002
www.blanvalet.de
Für Mom und Dad
1
SEPTEMBER 1994
Freya Sutherland hielt ihre Armbanduhr ins Licht und versuchte, die graue Digitalanzeige zu entziffern: 00:30. Zeit zu gehen.
Wie in Trance hob sie ihren Koffer hoch, der seitlich hinter ihr Bett geschoben war. Sie achtete darauf, keinen Laut zu machen, um ihre Eltern nicht zu wecken. Der Koffer war schwer, aber nicht zu schwer für einen Menschen, der vorhatte, sein altes Leben für immer hinter sich zu lassen. Sie sah sich ein letztes Mal in ihrem Zimmer um, ließ den Blick über die Wand mit dem Nirvanaposter und den selbst gemalten Bildern schweifen, ehe sie zur Kommode trat. Sie hatte den Zettel mit der Nachricht unter ihr Skizzenbuch geschoben. Ihr Kater, Butter, war ins Zimmer gekommen und hatte sich direkt über dem Buch positioniert, den Kopf leicht geneigt. Das Tier starrte sie eindringlich an. Fast so, als wollte es ihr etwas mitteilen, als wollte es sie zum Bleiben bewegen. Einen Moment lang erwiderte Freya den Blick – wahrscheinlich will er nur wieder was zu fressen – und strich ihm zum Abschied über das samtige Fell am Kopf. Dann scheuchte sie den Kater beiseite, griff nach dem Skizzenbuch und legte die Nachricht aufs Kopfkissen, damit ihre Mom sie dort fand.
Draußen war es stockfinster, nicht einmal der Mond bot Orientierung. Zum Glück kannte sie den Weg, der entlang der Farmgebäude zur Straße führte, gut genug, um sich auch im Dunkeln zurechtzufinden. Sie hatte viele Stunden und Tage, ganze Sommer und Winter ihrer Kindheit dort gespielt. War als Kleinkind von Pfütze zu Pfütze gesprungen, hatte später darauf Fahrrad fahren gelernt, hatte mit ihrem Dad und Jessica Wasserschlachten veranstaltet. Jetzt hatte sie das Ende des Pfades erreicht und setzte die Füße auf den beruhigend festen Asphalt der Hauptstraße. Dies löste eine andere Erinnerung aus an jenen Sommer, als es so heiß gewesen war, dass der Asphalt in der Sonne schmolz. Sie und Jessica waren barfuß gelaufen und hatten lachend mit Ästen im weichen Teer herumgestochert. Als Kinder hatten sie sich sehr nahegestanden; der Altersunterschied von einem Jahr war damals kaum zu bemerken gewesen. Gefangen in dieser Erinnerung, drehte sie sich noch einmal zum Farmhaus um. Schwarz zeichneten sich seine Umrisse vor dem dunklen Nachthimmel und den ebenso finsteren Bergen dahinter ab. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie sich nie die Mühe gemacht hatte, sich die Namen dieser Gipfel einzuprägen; sie waren einfach immer da gewesen. Genau wie Jessica immer da gewesen war. Ihre jüngere Schwester hatte sie in ihrem Abschiedsbrief nicht eigens erwähnt. Sie hatten sich schon vor einer Weile auseinandergelebt. Zwischen ihnen hatte sich ein unüberbrückbarer Graben aufgetan, besonders seit der ganzen Sache mit ihrem Dad. Freya zögerte. Vielleicht sollte sie noch einmal zurücklaufen und auch für Jessica ein paar Worte hinterlassen? Es würde sie nur wenige Minuten kosten.
Das Brummen eines Motors durchbrach ihre Gedanken. Einen Augenblick später sah sie Scheinwerfer über die Straße gleiten, grelle Flecken in der Dunkelheit. Nervosität erfasste sie. Es passierte also wirklich, sie würden es durchziehen. Gebannt sah sie zu, wie das Fahrzeug sich näherte und dann in der Haltebucht stehen blieb. Der Treffpunkt war zum Glück weit genug vom Farmhaus entfernt, ihre Eltern würden garantiert nicht wach werden. Freya blickte abermals zu dem nächtlich stillen Zuhause ihrer Kindheit zurück. Sie würde Jessica einfach bei nächster Gelegenheit einen Brief schicken und ihr alles erklären. Entschlossen kehrte sie dem Farmgebäude den Rücken zu und rollte ihren Koffer hinter sich her die Straße entlang, froh, ihn nicht mehr tragen zu müssen.
Erst als sie sich dem Fahrzeug näherte, flackerte zum ersten Mal so etwas wie Verunsicherung in ihr auf, ein flaues Gefühl in der Magengegend.
Statt des erwarteten VW Golf stand da ein dunkler Lieferwagen mit abgeschaltetem Motor, direkt neben der riesigen Blutbuche mit ihren knorrigen Ästen – ihr Großvater hatte zu Lebzeiten immer nur vom Henkersbaum gesprochen. Er war es auch gewesen, der ihr erzählt hatte, dass diese ruhige Landstraße einst die wichtigste Route Richtung Süden nach Drumnadrochit gewesen sei. Eine alte Viehtrift, über die die Bauern aus den Highlands früher ihre Rinder in die Lowlands auf den Markt trieben. Er hatte ihr Geschichten von Geistern erzählt, die auf der Straße ihr Unwesen trieben, von Dieben und Mördern, die an diesem Baum erhängt worden waren. An dunklen Wintertagen auf dem Weg zum Bus, der sie und Jessica frühmorgens zur Schule nach Inverness brachte, hatten sie sich jedes Mal an den Händen gefasst und waren ganz schnell daran vorbeigerannt.
Die Erinnerung an ihre Kindheitsängste; der Lieferwagen, von dem kein Laut ausging. Sie hatte sich das alles anders vorgestellt. Es sollte ein Augenblick voller Vorfreude werden, sie und ihre neuen Freunde, wie sie lachend zusammen ins Auto stiegen. Vor ihnen ein komplett neues Leben.
Nach kurzem Zögern sog Freya die kühle Nachtluft tief in ihre Lunge. Nahm den erdigen Geruch aus dem nahe gelegenen Wald wahr, den Rauch eines Holzfeuers, der aus einiger Entfernung heranwehte. Ein sonderbares Gefühl der Zeitlosigkeit überkam sie, als könnte sie genauso gut Hunderte von Jahren in die Vergangenheit abgetrieben worden sein.
Eine Gänsehaut kroch über Freyas Unterarme, und sämtliche Instinkte rieten ihr zur Umkehr. Am besten, sie ließ den Koffer einfach im hohen Gras am Straßenrand stehen und rannte zum Haus zurück. Kurz zögerte sie. Dann stellte sie sich vor, wie sie am nächsten Morgen auf den Bus wartete, der sie nach Inverness zur Arbeit bringen würde, in die Spielhalle in der Castle Street. Und wie sich derselbe Trott Tag für Tag wiederholen würde, über viele Jahre.
Sie machte einen Schritt auf den Lieferwagen zu und spürte, wie das taunasse Gras ihre Turnschuhe durchnässte. Zaghaft hob sie die Hand und klopfte an die Schiebetür. Das Metall fühlte sich kalt an. Zunächst kam keine Reaktion, aber dann vernahm sie ein leises Geräusch aus dem Wageninneren. Ein kaum wahrnehmbares Murmeln, als würde da drinnen jemand Selbstgespräche führen oder das Radio laufen. Ein schwacher Streifen Licht war unter der Tür auszumachen.
»Hallo? Ich bin’s.« Freyas Stimme hörte sich in ihren eigenen Ohren nach verängstigtem Kind an. Sie räusperte sich, als eine neuerliche Woge von Zweifeln in ihr anschwoll. Warum hatten ihre Freunde ihr nicht Bescheid gegeben, dass sie sie mit einem anderen Fahrzeug abholen würden? Aber wie groß stand die Chance, dass zufällig jemand anders mitten in der Nacht hier anhielt? Natürlich waren sie es. Freya nahm all ihren Mut zusammen und klopfte noch einmal, diesmal etwas fester. Die Stimme aus dem Wageninneren verstummte. Das Licht erlosch.
Wieder zögerte Freya, unsicher, was sie tun sollte. Vielleicht haben sie Zweifel, dass ich es bin? Vielleicht … Mit einem metallischen Schaben rollte die Seitentür auf. Im Inneren des Lieferwagens war es noch dunkler als draußen. Freya konnte zwar niemanden sehen, aber sie nahm den vertrauten Geruch von Mentholzigaretten wahr, weshalb sie den Koffer jetzt entschlossen hineinhob. Ein letztes Mal hielt sie inne, ehe sie in den Wagen kletterte. Die Tür rollte hinter ihr von allein wieder zu, und die Innenbeleuchtung sprang mit einem leisen Klicken an. Nach und nach gewöhnten sich Freyas Augen an die fremde Umgebung, bis ihr schlagartig der Atem stockte. Ein Adrenalinstoß jagte durch ihren Körper. Sie tastete nach der Tür, auf der Suche nach dem Griff. Doch es war zu spät.
2
SEPTEMBER 2018
Die Serienmörderin saß seit nunmehr zehn Jahren hinter Gittern, weggesperrt und so gut wie vergessen. Es war ein kalter Herbstmorgen, als Detective Inspector Monica Kennedy im Carselang-Gefängnis eintraf. Für einen kurzen Moment schloss Monica die Augen, als die schwere Eingangstür mit lautem Krachen hinter ihr ins Schloss fiel. Ihrer Erfahrung nach klangen zuschlagende Gefängnistüren fast überall auf der Welt gleich. Das Geräusch mochte das gleiche sein, aber die Atmosphäre hier ist unverwechselbar, dachte Monica, als sie die Augen wieder aufschlug und den Blick durch die riesige Eingangshalle schweifen ließ. Die grauen Granitwände sonderten eine Fülle von Gerüchen ab: nach frittiertem Essen, Bleiche, Schweiß und dem beißenden Gestank der Verzweiflung. Kannst du die Verzweiflung riechen? Monica hatte in mehr als zwanzig Jahren Polizeidienst tatsächlich wiederholt diesen unvergleichlichen Geruch an den Kleidern zahlreicher Opfer und Täter wahrgenommen, hatte die Bitterkeit gerochen, die aus deren Poren gedrungen war.
Die Gefangenen hier drinnen haben nichts zu verlieren – trau keinem über den Weg, der so ohne Hoffnung ist. Diese Warnung stammte von Monicas Dad. Er hatte es bei einem ihrer gelegentlichen Wochenendbesuche im Gefängnis gesagt, als sie noch ein Kind war. Die Einrichtung war 1890 erbaut worden, um die gefährlichsten Verbrecher ganz Schottlands unterzubringen, in einem entlegenen Tal, dem Glen Wyvis, ungefähr eine Stunde Autofahrt nordwestlich von Inverness. Ihr verstorbener Vater, »Long« John Kennedy, war Wärter im Carselang gewesen und stolz auf seinen Posten. Liebend gern hatte er vor seiner Tochter damit geprahlt und sie im Gefängnis herumgeführt.
Der Klang von Schritten auf Steinboden ließ Monica aufblicken. Ein Angestellter mit einem Klemmbrett hatte die Eingangshalle betreten, um sie abzuholen. Er trug eine dunkle Uniformhose mit weißem Hemd, darüber einen schweren North-Face-Parka. Ein Zugeständnis an die eisige Luft, die von den Bergen herunterkam – und etwas, das man in der Zeit von John Kennedy niemals geduldet hätte, da war sich Monica sicher. Der Beamte warf einen Blick auf sein Klemmbrett, dann sah er wieder zu ihr auf und betrachtete sie mit Interesse.
»Sie sind DI Monica Kennedy?« Kurz streifte sie der Gedanke, ob er mit ihrem Dad zusammengearbeitet hatte. Doch dann wurde ihr bewusst, dass er dem Aussehen nach um die dreißig war – zu jung also. Noch einmal musterte er sie, die übliche Routine. Monica war über eins achtzig groß, hellhäutig, mit dunklen Haaren und einem intensiven Blick. Sie fiel auf. Zumal sie in jüngster Zeit die Leitung einiger aufsehenerregender Ermittlungen übernommen hatte, nachdem sie fünf Jahre zuvor nach der Geburt ihrer Tochter Lucy aus London in ihre alte Heimat zurückgekehrt war.
Monica nickte und trat näher. Als sie antwortete, kamen kleine Atemwölkchen aus ihrem Mund. »Ich habe einen Termin mit Pauline Tosh.«
Der Gefängnisangestellte sah wieder auf sein Klemmbrett. Die müssen hier doch mittlerweile Computer haben?
»Und ich dachte, ihr hättet sie aufgegeben. Harte Nuss. Vermutlich vergeudete Zeit. Ich bezweifle, dass sie Sie sehen will.« Die Haare des Mannes waren flach an seinen Kopf gedrückt, die Gesichtsfarbe gräulich, die Züge angespannt.
»Sie hat mich kontaktiert«, gab Monica zurück. Sein skeptischer Unterton löste einen Hauch von Gereiztheit in ihr aus. Das Carselang war einzigartig im schottischen Strafvollzug und umfasste im Grunde zwei Einrichtungen an ein und demselben Standort. Der Westflügel des Gebäudes war den männlichen Insassen vorbehalten, während im kleineren Ostflügel Frauen untergebracht waren.
»Sie haben sie eingebuchtet, stimmt’s?« Die Stimme des Mannes überschlug sich vor Aufregung, weil er sie jetzt offenbar erkannt hatte. Instinktiv senkte Monica den Blick auf seine Brust auf der Suche nach einem Abzeichen: Es war durch den Parka verdeckt. Ihr Blick entging ihm nicht. »Entschuldigen Sie, ich wollte nicht aufdringlich sein … Mein Name ist Tyler Mitchell.«
»Schon gut.« Monica rang sich ein Lächeln ab und rief sich in Erinnerung, dass es, von ihrem Vater einmal abgesehen, nicht unbedingt jedermanns Traumjob war, mitten im Nirgendwo zu arbeiten, umgeben von einer Horde Schwerverbrecher. Da war es nur verständlich, dass der Beamte auf ein Pläuschchen aus war, um sich die Zeit zu vertreiben. Außerdem war es von Vorteil, sich mit den Angestellten gut zu stellen, wenn man eine Serienmörderin in einem maroden Gefängnis besuchte. Möglicherweise wäre sie auf Tylers Hilfe angewiesen, falls bei dem Treffen etwas schieflief. »Ich war Teil des Ermittlerteams, das sie überführt hat, ja. Ist schon eine Weile her.«
»Richtig«, sagte Tyler. »Ich erinnere mich. Hab damals davon gelesen – 2006 war das, oder irre ich mich? Für vier Morde hat man sie drangekriegt. Denken Sie, sie hat noch mehr auf dem Gewissen? Deshalb sind Sie hier, oder?«
Monica ertappte sich dabei, wie sie gedanklich die Einzelheiten des Falls durchging. Im Großen und Ganzen lag Tyler richtig. Vier Frauen aus der Region Glasgow waren damals ermordet worden, man hatte ihre Leichen an entlegenen Orten entlang der Westküste der südlichen Highlands gefunden. Monica war damals aus London in den hohen Norden gerufen worden, um der hiesigen Polizei beratend zur Seite zu stehen. Sie erinnerte sich, wie sie spätnachts noch im alten Präsidium in der Pitt Street in Glasgow gewesen war, aufgeputscht von Kaffee, als ihr ein scheinbar völlig nebensächliches Detail aufgefallen war – alle vier Fundorte hatten sich im Umkreis weniger Meilen von Campingplätzen befunden. An einem regnerischen Tag hatten sie diese Plätze besucht, um sich nach verdächtigen Männern, Angestellten oder Gästen zu erkundigen. Bei den ersten beiden hatten sie erfolglos wieder abziehen müssen, aber gerade als Monica vom dritten Campingplatz wieder aufbrechen wollte, hatte sie den Betreiber aus einer spontanen Eingebung heraus nach verdächtigen Frauen gefragt. Der Mann wollte schon lachend abwehren, als er stutzte und eine Besucherin erwähnte, die im Sommer fast jedes Wochenende mit ihrem Wohnmobil herkam. Sie traf jedes Mal spätabends ein und brach in aller Herrgottsfrühe wieder auf. Die Frau trug stets Arbeitsoveralls, obwohl sie doch angeblich Urlaub machte. Die Frau hieß Pauline Tosh: ein wenig eigenbrötlerisch und verschroben, aber allem Anschein nach harmlos. Sie war bereits als Zeugin befragt worden. Wie sich herausstellte, ging diese Frau nach dem immer gleichen Muster vor: Sie suchte die Gesellschaft von alleinstehenden, leicht verletzlichen Frauen, um sie bei nächstbester Gelegenheit zu erwürgen.
»Ja, wir nehmen an, dass sie noch mehr ermordet haben könnte«, gab Monica schließlich zu. Es war damals durch die Presse und durchs Netz gegangen, diese Information war also kaum als vertraulich zu bezeichnen. Die Sache mit den Fotos ließ sie allerdings aus. Diese hatten sie unter Toshs Habseligkeiten gefunden – sie waren allesamt in den Neunzigerjahren entstanden und zeigten sie allein neben ihrem Wohnmobil, immer an irgendwelchen abgeschiedenen Orten. Da lag der Verdacht nahe, dass sie zu jener Zeit im Gebiet der Highlands noch weitere Opfer verscharrt oder sich ihrer anderweitig entledigt hatte. Eine Zeit lang soll sie in Inverness gelebt haben.
Tyler nickte bedächtig. »Ich habe davon gelesen. Man konnte ihr nichts anhängen, es gab keine stichhaltigen Beweise.« Offenbar war Tyler noch so ein Fan von Serienmördern. Zu den seltenen Gelegenheiten, da Monica auf Partys oder zu Familientreffen ging, waren es immer die Serienmörder, über die die anderen Gäste mit ihr reden wollten. Das Märchenungeheuer der modernen Zeit. Faszinierend und von einem düsteren Glanz umgeben. Aber im wirklichen Leben waren es nicht selten völlig unscheinbare und langweilige Personen. Monica überlegte, ob der junge Gefängnisangestellte mit einem männlichen Polizeibeamten ähnlich jovial umgegangen wäre. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie er ihren Boss, Detective Superintendent Hately, oder ihren Partner, Detective Constable Connor Crawford, derart in die Mangel nahm. Offenbar huschte ihr bei dem Gedanken ein verdrossener Ausdruck übers Gesicht, da Tyler nun hastig hinzufügte: »Verzeihen Sie die vielen Fragen. Ich begleite Sie besser hinein. Pauline fühlt sich gern auf den Schlips getreten, wenn man ihre tägliche Routine durcheinanderbringt.« Damit wandte er sich zur Gegensprechanlage und drückte auf einen Knopf, um sie anzukündigen. Mit einem Summen öffnete sich die zweite schwere Tür für sie; Monica meldete sich bei einem weiteren Beamten an, der ihre Jacke durch einen Scanner schickte und sie ihr dann zurückreichte. Tyler führte sie durch ein Labyrinth aus feuchtkalten Fluren, die nach der weitläufigen Eingangshalle eng und bedrückend auf sie wirkten. »Wir sind chronisch unterbesetzt«, teilte er ihr über die Schulter mit, während er eine dritte schwere Tür aufschloss, diesmal mit einem Schlüssel. »Der Großteil der Überwachungsarbeit läuft mittlerweile automatisch über Kameras. Wir reagieren nur, wenn etwas Außergewöhnliches vorfällt.«
Mit einem Krachen fiel die Tür hinter ihnen zu, und er schloss wieder ab. Ihre Schritte hallten vom nackten Steinboden wider, während sie sich tief in das Gefängnisgebäude hineinbegaben, durch zwei weitere Türen entlang schlecht beleuchteter Korridore. Schließlich machte Tyler vor einer Metalltür mit einem Guckloch halt, das durch eine Klappe verdeckt war.
»Es gibt eine Überwachungskamera, aber falls etwas passiert, ist es besser, wenn Sie den Alarmknopf an der Wand drücken. Nur für den Fall, dass der Wachhabende im Westflügel gerade anderweitig beschäftigt ist.« Hier unten war die Luft warm und feucht, der Atem des alten Gefängnisses. Die frische Bergluft war Welten entfernt. »Kurz nach ihrer Ankunft hier hat Pauline einer Insassin ohne Vorwarnung eine Napalm ins Gesicht geschleudert – so nennen wir hier eine Mischung aus Zucker und kochendem Wasser. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie beste Freundinnen gewesen. Die Ärmste, sie ist völlig vernarbt. Es war eine Hauttransplantation nötig.« Hastig fügte er hinzu: »Sie ist natürlich mit Handschellen an den Tisch gekettet. Aber seien Sie auf der Hut.«
Monica bedankte sich bei dem Mann, obwohl es nicht nötig gewesen wäre, sie daran zu erinnern. Die Fotografien der Leichen an den verschiedenen Tatorten hatten sich ihr tief ins Gedächtnis eingebrannt.
Tyler drehte den Schlüssel im Schloss und zog die Tür auf.
Monica betrat den kleinen, fensterlosen Raum. Die Wände waren im einheitlichen Anstaltsgrün gestrichen wie überall. Eine einzelne Glühbirne in einem Gittergehäuse erhellte den Raum, die Überwachungskamera in der Ecke war ebenfalls durch ein Gitter geschützt. In der Mitte des Raumes saß eine Frau an einem Tisch. Die Tür schlug hinter Monica zu; von außen drehte sich der Schlüssel im Schloss. Pauline Tosh hob den Blick und lächelte.
Ihr Haar war immer noch dick, aber größtenteils grau. Das Gesicht schmal mit runden Backen. Die dunklen Augen sahen aus wie zwei mitternächtliche Teiche. Sie trug einen blauen Arbeitsoverall mit dem Dickies-Logo an der Brust, genau wie an dem Tag vor zwölf Jahren, als Monica im ländlichen Stirlingshire an ihre Haustür geklopft hatte.
»Ist ein paar Jährchen her«, sagte Tosh, als Monica ihr gegenüber Platz nahm.
»Sie sehen gut aus«, gab Monica zurück. »Ich habe Ihre Nachricht erhalten.« Heute war Sonntag; der handgeschriebene Brief war am Freitagmorgen bei ihr im Büro eingetroffen.
Liebe Monica,
ich bin an interessante Informationen gelangt.
Ich muss so schnell wie möglich mit Ihnen sprechen.
Herzliche Grüße
Pauline
Der Absenderstempel ganz oben rechts auf dem linierten Blatt lautete: Königliches Gefängnis Carselang. Tosh hatte sich nie zu einem der Verbrechen, derer man sie überführt hatte, bekannt, obwohl die Beweise erdrückend waren: DNA-Spuren in ihrem Transporter, persönliche Gegenstände der Opfer in ihrem Haus. Es war das erste Mal, dass Tosh auf Monica zukam; die verzweifelten Hilferufe der Familien von Vermissten, ihr Wissen mit ihnen zu teilen, waren allesamt ungehört an ihr abgeperlt.
»Ich hab Ihren Namen in den letzten Jahren ein paarmal in der Zeitung gelesen. Wieder zurück in den Highlands«, bemerkte Tosh. Sie sprach das Schottische der Lowlands mit einem leichten Glasgower Einschlag.
»Ich war überrascht, dass Sie mir geschrieben haben. Alle paar Monate erreicht uns ein Anruf. Von Professoren, die Sie gern als Studienobjekt verwenden würden – Sie sind ein Unikum, als weiblicher Serienkiller.« Monica suchte nach dem angemessenen Verhältnis zwischen Schmeichelei und Desinteresse. Der leise Anflug eines Lächelns zupfte an Toshs Mundwinkeln. Sie faltete ihre kleinen, kräftigen Hände vor sich auf dem Tisch. Monica vergewisserte sich mit einem raschen Blick, dass die Handschellen fest um ihre Handgelenke geschlossen waren. Sie hatte die Wunden der Opfer noch glasklar vor Augen, die dunklen Würgemale an deren Kehlen.
»Die denken alle, wer im Gefängnis sitzt, muss einer völlig anderen Spezies angehören. Im Gegensatz zu uns beiden. Wir wissen, dass letztlich jeder hier drinnen landen kann. Oft ist es reine Glückssache. Ich hab übrigens mitbekommen, was letztes Jahr mit Ihrer Kleinen passiert ist.« Monica spürte, wie das Narbengewebe an ihrem Bauch zu pulsieren begann, wie eine Mischung aus Schuld und Entsetzen sie durchflutete – ausgelöst durch die Erinnerung an den Fall, der ihr und ihrer Tochter um ein Haar das Leben gekostet hätte. »Lucy, das ist doch ihr Name? Er stand in der Zeitung.«
Den Namen ihres Mädchens aus dem Mund dieser Mörderin zu hören war kaum zu ertragen, doch Monica hielt mit Müh und Not den Blickkontakt aufrecht. »Ich hab’s eilig, Pauline.« Wenn Tosh sie nur hierherbestellt hatte, um sich an ihrem Unglück zu weiden, dann würde dies ein kurzes Gespräch werden. »Was wollten Sie mir mitteilen?« Tosh starrte sie an, ohne zu antworten, woraufhin Monica aufstand, sich zur Tür wandte und auf den Summer drückte.
»Ich habe eine interessante Story für Sie«, beeilte Tosh sich nun zu sagen.
Monica drehte sich zu ihr um. »Was für eine Story?«
Wieder stahl sich dieses schmale Lächeln auf das Gesicht der Frau. »Eine von der eher grausigen Sorte.«
Obwohl sich alles in ihr sträubte, nahm Monica wieder Platz. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, als sie sagte: »Grausig inwiefern?«
»Tja, das weiß ich selbst nicht so genau, Monica«, gab Tosh zurück und sah sich verstohlen um, als könnten sie in dem kleinen Raum belauscht werden. »Ich höre es hinter diesen Wänden flüstern, man erzählt sich Geschichten.«
»Wer flüstert denn?«
»Ich könnte es Ihnen zeigen«, sprach Tosh weiter, als hätte sie Monicas Frage nicht gehört. Ihr Lächeln wurde breiter und entblößte eine Reihe kleiner, unregelmäßiger Zähne. »Wenn Sie sicher sind, dass Sie das möchten?«
3
Als Monica sämtliche verschlossenen Türen ein zweites Mal passiert hatte und zurück auf dem Parkplatz vor dem Carselang stand, sog sie die frische Bergluft tief in ihre Lunge. Sie genoss die Weite, nachdem sie sich vom starren Blick der Mörderin wie mit einer Krankheit infiziert gefühlt hatte.
Beim Ausatmen stieg ein Gedanke in ihr auf: Wie hast du das nur geschafft, Dad? Dass du es Tag für Tag an diesem Ort aushalten konntest? Monica strich mit beiden Händen durch ihr schulterlanges Haar. Ein extrem verstörender Fall, an dem sie im vergangenen Frühjahr gearbeitet hatte, hatte die Erinnerungen an ihren Vater aufgefrischt und sie gezwungen, ihre komplette Kindheit auf den Prüfstand zu bringen. Sie hatte reichlich Zeit mit Grübeleien verbracht und hatte, beseelt vom Geist der Veränderung, erst kürzlich wieder begonnen, nach einem möglichen Partner Ausschau zu halten. Zumindest hatte sie sich probehalber bei einer Online-Datingseite angemeldet, nachdem ihre Mum ihr laufend damit in den Ohren gelegen hatte: »Du wirst nie jemanden finden, wenn du immer nur von Polizisten und Leichen umgeben bist, Monica. Crawford sagt, heutzutage läuft das alles übers Internet.«
Die Erinnerung an ihren Partner rief einen Mix aus Zuneigung und leichter Gereiztheit in ihr hervor. Ihre Mum, Angela Kennedy, siebenundsechzig Jahre alt, und DC Connor Crawford, einunddreißig, hatten wider Erwarten eine seltsame Art von Freundschaft geschlossen. Zu ihrem Verdruss zitierte Angela seine Meinung zu jeder Gelegenheit, egal, ob es um ihre Lieblingsthemen Kriminalromane und Verbrechensbekämpfung oder um Kriminalpsychologie ging. Erst kürzlich hatte sie Albert, Lucys übergewichtigen Kater, auf Diät gesetzt. Nicht dass es irgendetwas brachte. Bei der Erinnerung an ihre Tochter musste sie lächeln. Wie sie den kugelrunden Kater mit dem beigen Fell, der beinahe so groß war wie sie selbst, an diesem Morgen ins Badezimmer geschleift und auf die Waage verfrachtet hatte. Das hatte die bittere Wahrheit ans Licht gebracht: Das Tier hatte sogar noch an Gewicht zugelegt.
Mit einem Knopfdruck entriegelte Monica ihren blauen Volvo und stieg ein. Augenblicklich spürte sie, wie in der vertrauten Umgebung ein Teil der Anspannung von ihr abfiel. Ihre Hand zuckte zur Tasche ihres Tweedmantels, um zu überprüfen, ob der Beweismittelbeutel noch da war. Darüber, was die Mörderin ihr mitgegeben hatte, wollte sie gar nicht näher nachdenken. Du nimmst heute ein kleines Stück von Pauline Tosh mit nach Hause, daran lässt sich nichts ändern, meldete sich ihre wenig kooperative innere Stimme zu Wort. Mit einem Kopfschütteln ließ sie den Motor an.
Etwa eine Meile die Straße hinunter bemerkte Monica einen roten Audi, der ihr bekannt vorkam. Er stand in einer Parkbucht am Loch Wyvis, ganz in der Nähe des Ufers bei einer Gruppe Waldkiefern. Ein klassischer Picknickplatz in den Highlands. Wenig später entdeckte sie den kleinen, dünnen Mann mit den roten Haaren und daneben ein Kind mit blonden Locken. Sie winkten ihr fröhlich zu. Neben ihnen im Sand saß ihre Mum.
Monica stellte ihren Wagen am Straßenrand ab und stieg aus. Sie spürte die wärmenden Strahlen der Sonne, die soeben durch die Wolkendecke brach, obwohl die umliegenden Gipfel mit einer feinen Schneeschicht überzuckert waren.
»Ich habe eine kleine Spritztour gemacht«, begrüßte Crawford sie, als sie sich ihnen näherte. »Da habe ich deine Mum und Lucy zufällig in Tain gesehen. Dachte mir, wir fahren hier rauf, um dich zu treffen.«
»Was für ein Zufall, nicht wahr!«, sagte Angela.
Monica hatte ihre Mum und Lucy in einem Café zurückgelassen, wo sie Kaffee beziehungsweise Saft trinken wollten, während sie zu ihrem Treffen mit Tosh weiterfuhr. »Da schaue ich auf, und auf einmal sehe ich Crawford!« Sie war sichtlich erfreut über den vermeintlichen Zufall, aber Monica ließ sich nicht täuschen. Ihr Kollege war am Freitag dabei gewesen, als sie den Brief geöffnet hatte. Sein Interesse war nicht zu übersehen gewesen.
»Ja, wirklich ein unglaublicher Zufall.« Monica warf Crawford einen vorwurfsvollen Blick zu, woraufhin er sich schuldbewusst abwandte. Trotzdem war es ein erstaunlich gutes Gefühl, ihn zu sehen, nachdem sie mit Tosh allein in diesem beengten Raum gewesen war. Er trug eine dunkle Hose, dazu Budapester, einen Rollkragenpullover und ein edles Jackett aus grauer Wolle, das sicher nicht billig gewesen war. Seine roten Haare waren zur üblichen Tolle hochfrisiert, sein Kinn von einem leichten Bartschatten überzogen. Ihr Kollege wirkte völlig deplatziert an diesem Ort – in seinem schicken Stadtoutfit inmitten der einsamen Gebirgslandschaft. Monica wusste, dass Crawford in einer abgeschiedenen Ecke an der Westküste aufgewachsen war, aber trotzdem eine angeborene Abneigung gegen die wilde Natur hegte, die an Angst grenzte.
»Crawford baut mit mir eine Sandburg!«, rief Lucy vom Ufer her, wo sie mit einem Plastikbecher eifrig im Sand buddelte.
»Wir haben ein Picknick mitgebracht. Ich flitze schnell los und hole die Sachen!«, sagte Angela, die Crawfords Angebot, ihr dabei zu helfen, entschieden ablehnte und bereits die Böschung zum Parkplatz hinaufstapfte.
»Und, was war nun die versprochene Information?«
Monica vergewisserte sich, dass ihre Mutter außer Hörweite war, und sah zu Lucy, die mit ihrer Sandburg beschäftigt war. »Es ging um einen Ort, an dem wir graben sollen«, raunte sie ihm zu. »Wir reden am besten morgen darüber.«
»Alles klar, dann eben morgen.« Überraschenderweise schien Crawford sich damit zufriedenzugeben. Er tendierte normalerweise dazu, sich wie ein Terrier in einen zu verbeißen, wenn er das Gefühl hatte, dass man ihm Informationen vorenthielt. Vermutlich musste selbst er einsehen, dass ein Familienpicknick nicht der richtige Anlass war, um sich über eine Serienmörderin zu unterhalten. Wobei ihre Mum sicherlich begeistert gewesen wäre.
»Ich dachte, du wolltest das Wochenende mit Heather verbringen?« Er hatte seine aktuelle Freundin, Heather Sinclair, im Rahmen der Ermittlungen zu einem Fall kennengelernt. Das war im vergangenen Frühjahr gewesen. Inzwischen waren sie seit mehreren Monaten ein Paar. Früher konnte Monica bei Crawfords wechselnden Liebschaften kaum den Überblick behalten, aber in dem Fall musste man in der heutigen Zeit schon von einer ernsten Sache sprechen.
Crawford räusperte sich. »Ich wollte …« Er unterbrach sich. Irgendwie klang er verunsichert, als wäre ihm etwas peinlich.
»Alles in Ordnung, Crawford?« Er wandte sich ab und richtete den Blick talaufwärts in Richtung Carselang, eine graue Festung in der Ferne.
»Es ist nur …« Jetzt sah er wieder zu ihr, doch bevor er seinen Satz zu Ende bringen konnte, kehrte Angela zurück, mit einer karierten Picknickdecke im typischen Tartanmuster und einer Tasche voll mit Leckereien.
»Wer von euch hat Hunger? Es ist ziemlich kalt. Das wird vermutlich das letzte Picknick des Jahres, bald schneit es!«
Lucy rief ihr etwas zu, und Crawford löste den Blick von ihr. Der Moment war vorüber. Erst sehr viel später, als sie an diesen Augenblick zurückdachte, fragte Monica sich, was er wohl hatte sagen wollen. Wäre alles anders gekommen, wenn er zu einer passenderen Gelegenheit noch einmal versucht hätte, mit ihr zu reden? Ohne Lucy und ihre Mutter? Und nicht unmittelbar nach einem Gespräch mit einer Serienmörderin? Aber vielleicht hatte er ja gerade deshalb diesen Moment gewählt. Eine unterbewusste Entscheidung, die man vielleicht als Schicksal betrachten könnte.
4
Monica parkte den Volvo um die Ecke von Lucys Schule, die im Crown District von Inverness lag. Es war der Morgen nach ihrem Besuch im Carselang, und sie hatte es eilig, aufs Revier zu kommen, wo ein Meeting mit Detective Superintendent Fred Hately anstand. Doch als sie ausstieg und die hintere Wagentür öffnete, um Lucy rauszulassen, rührte sie sich nicht vom Fleck. Mit gesenktem Kopf saß sie da und umklammerte mit beiden Händen das Buch auf ihrem Schoß: eine illustrierte Ausgabe von Eine lausige Hexe.
»Ist alles in Ordnung, Liebes?«
»Ich habe Bauchschmerzen.«
Monica beugte sich zu ihrer Tochter in den Wagen und schob ihre blonden Locken beiseite, um ihre Stirn zu fühlen. Ihre Temperatur schien nicht erhöht zu sein, und sie hatte ihr Frühstück, bestehend aus einer Schale Cheerios, ohne Murren aufgegessen.
»Seit wann tut es denn weh?«
»Ich weiß nicht.«
»Machst du dir wegen irgendetwas Sorgen, Süße?« Lucy hatte sich in der Schule gut eingewöhnt und hatte bereits zwei neue Freundinnen gefunden, zu deren Geburtstagsfeiern sie eingeladen worden war. Doch als Monica jetzt genauer darüber nachdachte, fiel ihr auf, dass Lucy ungewöhnlich still gewesen war, als sie sie am Freitagnachmittag abgeholt hatte. Beim Einkaufen im Supermarkt hatte sie kaum ein Wort gesprochen, bis sie heimgekommen waren. Zu dem Zeitpunkt war Monica allerdings mit den Gedanken bereits wieder bei Toshs Brief gewesen, der am selben Tag eingetroffen war. Monica ertappte sich bei einem nervösen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett: acht Uhr fünfundfünfzig. Montagvormittag erledigte ihre Mum immer die Wäsche; sie war sicher längst auf dem Weg in den Waschsalon auf der Grant Street in Rapinch. Wie so oft überkam Monica ein Anflug von Selbsthass, dass sie sich nie ganz auf ihre Tochter und deren Wohlbefinden konzentrieren konnte. Traurig betrachtete sie Lucys pausbäckiges Gesicht, die leichte Stupsnase, auf der eine Brille saß, den perfekten Schwung ihres Mundes und ihre wilde Mähne. So ein kleines Wesen, und doch schon so kompliziert.
»Möchtest du, dass ich mit dir komme, meine Süße? Und Miss Jennings sage, dass es dir nicht gut geht?«
Hastig schüttelte Lucy den Kopf. »Ich glaube, ich fühle mich schon besser.«
»Bist du sicher?«, hakte Monica noch einmal nach und legte den Kopf schief, um in Lucys Gesicht nach irgendwelchen verräterischen Signalen zu suchen.
»Mir geht es wieder gut.« Und bevor Monica weiter nachbohren konnte, klingelte die Schulglocke. Hektisch kletterte Lucy vom Rücksitz und schnappte sich ihre Schultasche.
Eine halbe Stunde später saß Monica mit Crawford und Fred Hately zusammen in dessen Büro. Auf der Fahrt zum Revier hatte sie Lydia angerufen, die Mutter von Lucys bestem Freund Munyasa, in der Hoffnung, sie könne ihr vielleicht sagen, ob in der Schule irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen war. Leider ging der Anruf ins Leere, deshalb hinterließ Monica eine Sprachnachricht und bemühte sich, ihre Sorge um Lucy vorerst zu vergessen. Das brachte sie im Moment kein Stück weiter.
»Wie ist Ihr Treffen mit Tosh gelaufen?«, erkundigte sich Hately und lenkte ihre Aufmerksamkeit so zurück in das Hier und Jetzt. Ihr Boss war einige Jahre älter als sie. Von italienisch-schottischer Herkunft, geboren in Glasgow, das dunkle Haar ordentlich zum Seitenscheitel frisiert und im teuren Anzug, bewegte sich Hately selbstbewusst auf dem politischen Parkett – ein unverzichtbarer Charakterzug, wenn man ganz oben mitspielen wollte. Monica wusste aber in der Regel, wie sie zu ihm stand. Sie vertraute ihm, zumindest bis zu einem gewissen Grad. »Zeitverschwendung?«
»Vielleicht, vielleicht nicht.« Monica beobachtete die kaum merklichen Veränderungen, die auf Hatelys Gesicht vor sich gingen. Frische Informationen von einer Serienmörderin hatten das Potenzial, sie in alle möglichen Richtungen zu führen: Wobei sie idealerweise dazu führten, dass ein ungelöster Fall ad acta gelegt werden konnte, ein finaler Schlusspunkt für die Familie einer vermissten Person; das schlimmste Ergebnis hingegen wäre eine Schlagzeile wie Cops von Killerin hereingelegt, eine demütigende Bloßstellung in den Medien. Neu aufgerissene Wunden und falsche Hoffnungen bei verzweifelten Angehörigen, die ihre Liebsten wiederfinden wollten. Monica wühlte in der Tasche ihres abgetragenen Tweedmantels und legte den Beweismittelbeutel auf den Tisch. »Das hier hat Tosh mir gegeben.« In dem Plastikbeutel steckte ein Stück Papier, auf das mit Buntstiften etwas gekritzelt war. »Sie behauptet, es handelt sich um eine Karte.« Hately griff vorsichtig danach.
»Eine Karte? Wohin führt sie?«, meldete sich Crawford nun zu Wort.
»An der Stelle ist angeblich was vergraben. Nicht weit vom Caledonian Canal entfernt.«
»Nicht weit vom Caledonian Canal?«, wiederholte Hately. Der Kanal war ein beliebter Touristenmagnet in Inverness, am östlichen Ende der Wasserstraße, die sich durch den Great Glen über Loch Ness bis nach Fort William an der Westküste erstreckte. Monica warf einen Blick auf die Karte in Hatelys Händen. Der Kanal war eine schnurgerade blaue Linie, das Marschland rechts davon grün. Ein dunkles Rechteck und ein X befanden sich in diesem grünen Bereich. Darauf hatte Tosh gedeutet: »Haben Sie je vom Witch’s Coffin gehört, Monica?«
Während der anfänglichen Verhöre im Jahr 2006 hatte Tosh Monicas Akzent sofort erkannt. Wie sich herausstellte, hatte sie in den Neunzigern selbst eine Weile in Inverness gelebt, deshalb war sie sehr erfreut über diesen Zufall gewesen: »Vielleicht sind wir uns schon einmal begegnet und direkt aneinander vorbeigelaufen! Was, wenn wir sogar benachbart waren?«
Zufällig kannte Monica den sogenannten Witch’s Coffin. Etwas mehr als eine Meile von Rapinch und den Straßen, in denen sie aufgewachsen war, entfernt. Ein gemauertes Ziegelfundament, das in seiner Form an einen Sarg erinnerte. Es befand sich in einem Gezeitentümpel und war nur bei Ebbe zu sehen, bedeckt mit Seepocken und schwarzem Seetang. Als Kind hatte Monica oft mit ihrem Fahrrad dort angehalten und wie gebannt zu dem Stein gestarrt.
Tosh hatte noch einmal auf die Karte gedeutet. »Direkt daneben, sehen Sie?« Das X befand sich auf der meerwärts gewandten Seite des Fundaments. »Ungefähr anderthalb Meter davon entfernt.«
»Was ist dort vergraben?«, wollte Crawford wissen.
»Sie behauptet, sie wüsste es nicht.«
»Hat sie die Karte gezeichnet?«, fragte Hately und strich mit der Kuppe seines Zeigefingers über die falsch geschriebenen Worte neben dem länglichen Rechteck: Witch’s Cofin.
»Sie sagt, sie ist aufgewacht, und da lag der Zettel in ihrer Zelle. Sie meint, jemand muss ihn unter der Tür durchgeschoben haben.«
Hately rieb sich mit beiden Händen übers Gesicht und seufzte. Wie Monica war ihm klar, dass sie keine Wahl hatten. Wenn eine verurteilte Serienmörderin einem erzählte, dass irgendwo etwas vergraben lag, dann kam man um eine Überprüfung nicht herum. »Wie schnell kriegen wir das hin?«
»Ich habe heute Morgen bereits mit Clive Ridgeway gesprochen«, sagte Monica. Es war ein recht hektisches Telefonat mit dem forensischen Archäologen gewesen, während Lucy ihre Cheerios gegessen hatte. »Er sagt, er könnte noch heute Abend eine Untersuchung unterbringen, sofern die Gezeiten es zulassen.«
5
Ebbe war ziemlich genau um Mitternacht, bei absoluter Finsternis ohne einen Funken Mondlicht. Ein unheilvoller Zeitpunkt, um nach der Beute einer Serienmörderin zu graben, ging es Monica durch den Sinn. Nebel war vom Beauly Firth herangezogen, jener Bucht, die Inverness von der nördlich gelegenen Black Isle trennte. Die nächtliche Kälte drang durch ihren Mantel und kroch unter ihre Bluse. Sie spürte, wie sich die feinen Härchen an ihren Armen aufrichteten, und trat von einem Fuß auf den anderen, um sich warm zu halten. Flüchtig fragte sie sich, warum sie sich nicht etwas Vernünftigeres angezogen hatte. Wenn Lucy bei Kälte rausging, packte Monica sie immer in mehrere Schichten Pullover und eine dicke Jacke. Warum achtete sie nicht mit derselben Sorgfalt auf sich selbst?
»Ich habe gehört, es handelt sich um ein altes Fundament für einen Kran«, hörte sie Crawford in der Dunkelheit neben sich sagen. Sie standen auf einem schmalen Damm, der quer durch das Marschland führte. Der Pfad verband den Fähranleger in Rapinch, nicht weit von Monicas ehemaligem Zuhause, mit Clachnaharry am westlichen Stadtrand von Inverness. Die Marschen waren vor allem bei Hundehaltern und Hobbyornithologen beliebt, aber auch bei Jugendlichen auf der Suche nach einem Flecken, wo sie gemeinsam abhängen, rauchen, trinken und das tun konnten, was Teenies eben tun. Zumindest war der Damm in Monicas Kindheit ein beliebter Treffpunkt gewesen. »Den Witch’s Coffin meine ich«, fügte Crawford ergänzend hinzu. »Er stammt noch aus der Zeit, als der Kanal ausgehoben wurde. Er ist also gar kein echter Sarg.«
Unterhalb der Stelle, an der Monica und Crawford standen, starrten Dr. Clive Ridgeway und sein Assistent im Licht ihrer Stirnlampen angestrengt auf den schlammigen Untergrund. Ridgeway trug selbst im Winter ausschließlich kurze Hosen. Einmal hatte er Monica erzählt, er und seine Familie verbrächten die Ferien immer auf den Äußeren Hebriden, um nach Pfostenlöchern aus der Eisenzeit zu suchen. Ridgeway schien das Graben nach Geheimnissen also irgendwie im Blut zu liegen, es war so was wie seine zweite Natur.
Monica konnte den mit dunklem Seetang bedeckten Umriss des Witch’s Coffin im schwachen Schein der Taschenlampen nur schwer ausmachen. Ridgeway machte sich nun mit einem Metalldetektor zu schaffen und begann mit einer ersten Bodenuntersuchung. Nach fünfzehn Minuten machte er kehrt und stapfte durch den Matsch zum Ufer zurück. Er legte den Metalldetektor auf der Böschung ab und griff nach etwas. Monica konnte nicht erkennen, was es war. Dann kämpfte er sich zurück zu der Stelle, an der sein Assistent stand, und machte sich wieder an die Arbeit. Nach einer Weile stieß er einen Pfiff aus und murmelte: »Under the heath and under the trees, here lies the body of Bonnie Dundee.« Monica erhaschte im Scheinwerferlicht einen Blick auf den Stab, den er in den weichen Untergrund steckte. Jetzt bewegte er ihn vorsichtig hin und her, schob ihn etwas tiefer in den Boden und zog ihn dann langsam wieder heraus. Interessiert inspizierte der Forensiker die Spitze, schnupperte daran. Schließlich wickelte er einen Streifen Klebeband um den Stab, um die Stelle zu markieren, bis zu der er in den Boden eingedrungen war. Dann kam er auf Monica und Crawford zu.
»Wir müssen graben.« Er legte den Stab am Boden ab und zündete sich eine Zigarette an. »Etwa einen Meter dreißig tief. Ich denke, da unten liegt jemand.«
6
SEPTEMBER 1994
An dem Tag, an dem sie von zu Hause fortgehen wollte, packte Freya Sutherland mit großer Sorgfalt ihren Koffer. Sie kauerte neben ihrem Bett, wo sie ihn versteckt hatte, und befüllte ihn mit Kleidungsstücken. Ihre Mum oder ihre Schwester Jessica konnten jederzeit ins Zimmer platzen, ohne anzuklopfen. Ihr Dad verirrte sich hingegen nur selten nach oben, außer um zu schlafen. Seit seinem Unfall fiel ihm das Treppensteigen schwer und war zu einer schmerzhaften Tortur geworden. Seine langsamen, mühsamen Schritte durch den unteren Hausflur würde sie ohnehin rechtzeitig bemerken.
Der Unfall. Es war, als wäre seither alles anders. Eine defekte Traktorbremse, ein überladener Anhänger voller Zaunpfähle, ein leichtes Gefälle in der Straße. Er hatte Glück, dass es nur seine Beine erwischt hat, hatte Glück, dass wir seine Schreie gehört haben, einfach nur verdammtes Glück … Er humpelte mittlerweile mehr, als dass er ging, stets mithilfe seines Stocks, und blieb oft stundenlang weg, »arbeiten«, wie er behauptete. Dann kam er oft spätnachts heim, nach Bier und Zigarettenrauch stinkend, bis er eines Nachts gar nicht nach Hause gekommen war. Sie hatten auf den Feldern und in den Wäldern rings ums Farmhaus herum nach ihm gesucht, während ihre Mum nacheinander mit allen seinen Freunden und sämtlichen Krankenhäusern telefonierte. Und wie sie dann am nächsten Morgen nach unten gekommen war und ihn am Küchentisch sitzend vorgefunden hatte, während ihre Mum am Herd stand und Frühstück zubereitete, als wäre nichts gewesen.
Sie faltete das letzte Kleidungsstück, ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck »Choose Life«. Genau das gleiche Shirt hatte George Michael vor Jahren bei seinem Auftritt bei Top of the Pops getragen, wo er »Wake me up before you go-go« gesungen hatte. Die anderen hatten es ihr geschenkt, zum Spaß, um sie aufzuziehen, nachdem sie gestanden hatte, als Siebenjährige Mitglied im Wham!-Fanklub gewesen zu sein. Die Erinnerung daran entlockte ihr ein Lächeln; es war ein schönes Gefühl, Freunde zu haben, die einen so auf die Schippe nahmen. Weil es voraussetzte, dass man sich nahestand. Unweigerlich wallten die üblichen Schuldgefühle in ihr auf. Fast, als würde sie dadurch, dass sie sich diesen Menschen so verbunden fühlte, ihre eigene Familie verraten. Sie hatte den anderen gegenüber sogar Andeutungen gemacht, wie schwer es seit dem Unfall ihres Dads zu Hause war. Auch dass sie dieses Familiengeheimnis ausgeplaudert hatte, hatte sich im Nachhinein angefühlt wie Verrat. Aber war es denn wirklich so falsch, dass sie ihre Zeit lieber mit Menschen verbrachte, mit denen sie sich wohlfühlte, auch in Bezug auf sich selbst? Vielleicht würde alles anders werden, wenn sie erst einmal in Berlin wären.
Berlin. Trotz des Gefühlschaos in ihr sorgte allein der Name der Stadt für frische Vorfreude. Sie würden es wirklich tun, ein neues Leben beginnen. Vielleicht konnte sie ja zu einem völlig neuen Menschen werden? Freya schloss den Koffer und schob ihn wieder seitlich hinters Bett. Sie musste sich bremsen, um nicht noch einmal zu überprüfen, ob das Geld noch da war. Es war sicher in ihrer Schmuckschatulle verwahrt, und sie hatte an diesem Vormittag bereits zwei Mal nachgesehen.
Ihre Mum rief von unten nach ihr. Mittagszeit. Trotzdem waren es immer noch fast zwölf Stunden, bis sie sie abholen würden. Ihre Mutter hatte eine Scotch Broth zubereitet, serviert mit frischem Brot. Freya nahm am Küchentisch Platz und löffelte die Suppe in sich hinein, obwohl ihr Magen vor Nervosität rebellierte. Jessica erzählte von einer Schulfreundin; ihr Dad erwähnte ein Projekt, an dem er gerade arbeitete, und bemerkte, wie ungewöhnlich warm es für die Jahreszeit sei. Das alles nahm sie nur am Rande wahr. Genauso wie die alten Steinmauern des Farmhauses, die Bäume entlang der Straße und die düsteren Bergketten, die durch das Fenster in der Ferne auszumachen waren.
»… draußen am Henkersbaum?« Freya registrierte nur noch die letzten Worte ihres Vaters und merkte erst jetzt, dass seine Frage an sie gerichtet war. Sie blickte in die erwartungsvollen Gesichter ihrer Familie auf. Dabei überkam sie das sonderbare Gefühl, als könnten alle drei ihre Gedanken lesen und jeden Moment fragen, warum sie den gesamten Vormittag mit Packen verbracht hatte.
»Entschuldige, was hast du gesagt?«
»Mit den Gedanken woanders, wie immer«, bemerkte ihre Mum, leider nur halb zum Spaß.
Jessica setzte einen sarkastischen Ton auf. »Dad hat gesagt, weißt du, wer ein Saufgelage veranstaltet hat, draußen am Henkersbaum?«
»Am Henkersbaum?«, wiederholte Freya, viel zu erleichtert, um genervt zu sein.
»Ich dachte, ich hätte gestern Abend jemanden gesehen. Heute Morgen bin ich nachschauen gegangen. Jemand hat am Waldrand ein Lagerfeuer gemacht und eine leere Schnapsflasche liegen lassen«, sagte ihr Vater. »Da dachte ich, ob das vielleicht deine Freunde waren?«
»Was hätten die wohl hier draußen zu suchen?«, sagte Freya und merkte, wie sich ein gereizter Unterton in ihre Stimme stahl.
»Er fragt doch nur, Freya«, beschwichtigte sie ihre Mum. »Neuerdings verbringst du ja kaum noch Zeit mit uns.«
»Wir sind wohl nicht mehr cool genug für sie!«, sagte ihr Dad. Er versuchte es auf die scherzhafte Tour.
Jessica sprang sofort auf den Zug auf. Sie wollte einfach nur, dass wieder Normalität einkehrte: »Du bist jedenfalls kein bisschen cool, Dad!«
Nach dem Mittagessen gingen sie hinaus auf die Wiese hinter dem Haus. Ihr Dad wollte ihnen eine Stelle zeigen, wo er ein dichtes Gestrüpp aus Stechginster beseitigt hatte. »Schöner freier Blick, nicht wahr? Jetzt kann man von hier aus bis zum Beinn a’Bhathaich Àrd in Strathfarrar sehen«, sagte er und deutete auf die Bergkette in der Ferne.
Seit dem Unfall ihres Dads lief es bei ihm nach dem immer gleichen Muster: Am Anfang herrschte große Begeisterung über ein neues Projekt auf der Farm, gefolgt von einem Anfall von Arbeitswut. Dann, eines Abends, erschien er nicht zum Abendessen, kam erst spät nach Hause, oder ihre Mutter musste losziehen und ihn einsammeln. »Ihr werdet sehen, das wird toll, wenn es fertig ist.«
Jessica, froh, dass ihr Dad wieder ganz der Alte war, stellte ihm eine Frage, und die beiden gingen in Richtung Wald davon.
»Ich bin vor einigen Tagen in der Stadt Caroline Russells Mutter über den Weg gelaufen«, sagte ihre Mum. Freya nickte, sagte aber nichts dazu. Caroline war in der Schule ihre beste Freundin gewesen und hatte ihre Prüfungen mit Bravour bestanden, während Freya kläglich versagt hatte. Sie war auf die medizinische Hochschule in Glasgow gegangen, wohingegen Freya einen aussichtslosen Job in der Spielhalle in Inverness angenommen hatte. »Sie meinte, es gehe ihr gut auf der Uni, startet gerade in ihr zweites Jahr.«
»Hör zu, Mum …«
»Ich mein ja nur, Freya. Vielleicht könntest du auch aufs College gehen? Vielleicht kannst du deine Prüfungen wiederholen?«
Freya betrachtete die sorgenvolle Miene ihrer Mum, die blauen Augen, das graue Haar. Erst jetzt fiel ihr auf, wie stark sie seit Dads Unfall gealtert war. »Vielleicht bist du eines Tages ja stolz auf mich.«
Ohne die Antwort ihrer Mum abzuwarten, wandte sie sich ab und ging über die Wiese zurück in Richtung Haus. Ihr Dad hatte recht, es war ungewöhnlich warm, sie spürte, wie sich ein Schweißfilm auf ihrem unteren Rücken bildete. Kurz überlegte sie, welche Temperaturen in Berlin im Winter herrschen mochten. Wurde es bitterkalt? Sie hatte nie daran gedacht, sich darüber zu informieren.
Freya sah auf die Uhr. Bald drei. Immer noch eine halbe Ewigkeit bis zum vereinbarten Treffen. Sie hörte das Telefon im Farmhaus schrillen, das Geräusch drang durch die offen stehende Haustür ins Freie. Das Klingeln verstummte und setzte fast unmittelbar danach wieder ein. Offenbar hatte da jemand dringenden Gesprächsbedarf. Freya eilte durch das lange Gras und hoffte, dass es keine grünen Flecken auf den weißen Bereichen ihrer Vans hinterließ. Das Klingeln brach abrupt ab, als sie noch ein Stück vom Haus entfernt war. Fast, als hätte jemand den Hörer abgehoben. Doch wer sollte da im Haus sein? Es stand kein fremdes Auto davor, und wenn Freunde oder Bekannte vorbeigekommen wären, hätten diese sie draußen gesehen und wären zu ihnen gekommen.
Freya zog das Gartentor auf und glaubte, aus dem Haus eine Stimme zu hören. Gefolgt von einem Laut, als hätte jemand den Hörer wieder eingehängt. Sie trat ein, die Luft im Flur angenehm kühl nach der Hitze draußen. In der Küche war es ruhig, da war nur der Geruch nach Suppe, der ihr entgegenschlug, sowie das eigenartige Gefühl, als hätte eben erst jemand den Raum verlassen. Sie ging im Korridor nachsehen. Dort stand das Telefon auf seinem Tischchen und machte keinen Laut. Warum sollte jemand ins Haus kommen, den Hörer abnehmen und dann wieder verschwinden? Das war doch absurd. Freya schob den Gedanken beiseite. Jemand hatte angerufen und dann ganz schnell wieder aufgelegt, das war alles. Wenn es wirklich um etwas Wichtiges ging, würde derjenige es noch einmal versuchen.
7
Als Monica sich erkundigte, wie lange die Ausgrabungen dauern würden, blies Dr. Ridgeway zunächst eine dicke Rauchwolke in die neblige Nacht. »Optimal wäre, wir errichten eine Absperrung und lassen uns Zeit, damit wir Schicht für Schicht abtragen und nach Hinweisen durchsuchen können. Aber da es sich um ein Gezeitenbecken handelt, stehen wir etwas unter Druck …«
»Und was sollen wir Ihrer Meinung nach tun?«, meldete sich Crawford zu Wort.
»Das Beste ist, wir machen schnell«, antwortete Ridgeway. »Und bewahren die ausgegrabene Erde auf, für den Fall, dass wir sie später analysieren müssen.«
»Wann können wir loslegen?«, fragte Monica.
»Die nächste Ebbe ist gegen Mittag«, gab Ridgeway zurück, der seine Rolle offenbar sehr genoss. »Dann bringen wir es hinter uns.«
Letzten Endes erwies sich Ridgeways Vorhaben jedoch als etwas zu ambitioniert. Bis sie die nötige Ausrüstung und die entsprechenden Hilfskräfte beisammenhatten, hatten sie den niedrigsten Pegelstand bereits um eine Stunde verpasst, als sie schließlich zu graben begannen. Eine weitere Stunde verging, und die Sache mit der Grabung hatte sich herumgesprochen. Von ihrem Standpunkt auf dem Dammweg aus konnte Monica eine Gruppe von Reportern und Schaulustigen ausmachen, die von einer Stelle am Kanal ein Stück hinter der Polizeiabsperrung aus zusahen.
»Gibt nicht viel zu sehen für diese Leute.« Crawford deutete mit einem Nicken grob in ihre Richtung. Der nächtliche Nebel hatte sich auch mit Tagesbeginn nicht verzogen, sodass es am Ausgrabungsort recht düster war. Ridgeways Team hatte rund um die Stelle herum trotzdem mobile Sichtschutzwände aufgestellt, die nach Monicas Erfahrung die Neugier der Schaulustigen nur noch verstärkten.
»Ein typisch menschlicher Wesenszug«, antwortete sie. »Wir müssen immer alles wissen, wollen alles begreifen.«
Crawford dachte einen Moment nach. »Nicht immer. Manche bleiben lieber im Ungewissen und ziehen es vor, ihr Dasein unbehelligt weiterzuleben.«
Monica sah hinunter auf ihren Kollegen, der gut einen Kopf kleiner war als sie. Die feuchte Nebelluft sammelte sich auf seinem roten Haar und in seinen Augenbrauen. Er hatte eine nagelneue grüne Jacke von Patagonia aus seinem Wagen geholt. Nicht die Sorte Outdoor-Kleidung, in der man ihn normalerweise traf; es sah ganz nach einem Geschenk von seiner Freundin Heather aus. Unwillkürlich fragte Monica sich, ob er von den Schaulustigen oder von sich persönlich sprach.
Etwas weiter östlich spannte sich die Kessock Bridge mit ihren hohen Pfeilern über den Beauly Firth, hinter dem Nebel nur schemenhaft auszumachen. Grau, unheilvoll und in gewisser Weise der perfekte Hintergrund für eine solche Ausgrabung.
»Wir sind fast am Ziel«, rief Ridgeway. »Es ist mit Steinen beschwert.«
Monica spürte, wie die Anspannung stieg, während sie von ihrem erhöhten Standpunkt aus die drei um das Loch herumstehenden Archäologen beobachtete. Die Minuten vergingen quälend langsam, während sie Stein für Stein fotografierten und dann nach oben weiterreichten.
»Die Flut kehrt zurück«, murmelte Crawford und blickte besorgt hinaus aufs Meer. »Wir haben zu spät angefangen. Bald steht hier alles unter Wasser.«
Monica stellte fest, dass auch der Wind aufgefrischt hatte und jetzt von Nordwesten heranwehte. Er trieb die rasch ansteigende Flut vor sich her ins Marschland hinein. Als wäre er wild entschlossen, das, was unter Wasser und Schlamm begraben war, auf keinen Fall herzugeben.
Ridgeway beugte sich vor und schien an etwas zu ziehen. Monica schnappte Bruchteile der gedämpften Unterhaltung auf.
»Scheint erstaunlich gut erhalten …«
»Das Gesicht …«
»… füllt sich wieder …«
»… schnell rausholen …«
Weitere qualvolle Minuten verstrichen, bevor Ridgeway plötzlich bis zur Brust in der Grube stand und nach einem Leichensack verlangte. Der Fotograf beugte sich noch einmal über das Loch, um ein paar Aufnahmen zu machen, das Geräusch des Kamerablitzes gedämpft durch den sich allmählich lichtenden Nebel. Schließlich verfolgte Monica gebannt mit, wie der Leichnam, eingewickelt in etwas, das nach schwarzer Plastikplane aussah, vorsichtig aus dem Loch gehoben wurde. Die beiden Assistenten, die sich mit dem Sack durch den sumpfigen Untergrund gekämpft hatten, hielten ihn für den Leichnam auf. Als der Reißverschluss sorgfältig zugezogen wurde, erhaschte Monica einen flüchtigen Blick auf das Gesicht. Ridgeway hatte die Plastikplane ein Stück weggezogen. Lange Haarsträhnen klebten am Schädel, die Haut fleckig vom Schlamm, aber der ersten Einschätzung nach tatsächlich gut erhalten, wie eine mittelalterliche Reliquie. Der Wind wurde stärker und fegte pfeifend über das Marschland. In Monicas Vorstellung schien er von Zorn getrieben. Gleichzeitig wirbelten ihr allerlei Fragen durch den Kopf. Wen hatten sie da ausgegraben? Und vor allem: Wie kam es, dass Pauline Tosh sie so bereitwillig an diesen Ort geführt hatte?
8
Die Kälte, die aus dem Grab in der Marsch aufgestiegen war, schien immer noch an Monica zu haften, als sie gegenüber Lucys Schule am Straßenrand hielt. Der Leichnam, definitiv der einer Frau, war bereits ins gerichtsmedizinische Labor gebracht worden.
Ridgeway schätzte, dass die Tote mindestens zehn Jahre lang vergraben war. Monica hatte Crawford deshalb gebeten, sich die Vermisstenfälle von 2008 und den Jahren davor anzusehen.
»Ich möchte Pauline Toshs Namen so lange wie möglich aus der Presse raushalten«, hatte Monica Crawford noch am Grabungsort zugeraunt. »Sobald die Wind von der Verbindung zu einer Serienmörderin kriegen, stürzen die sich wie die Geier darauf.« Nur sie, Crawford und Hately wussten derzeit, dass der Hinweis auf den Fundort der Leiche von Tosh kam. »Könntest du DC Khan bitten, eine Pressemeldung zu verfassen? Weihe sie in die Sache mit Tosh ein, aber sag ihr, sie soll nur schreiben, dass wir einen Hinweis bekommen haben.«
DC Maria Khan war der jüngste Detective im Team. Sie hatte Medienerfahrung und war nach einem nicht näher definierten Fiasko in ihrem Privatleben zur Polizei gegangen. Monica vertraute ihr und war bei vorangegangenen Ermittlungen von ihrem souveränen Umgang mit der Presse beeindruckt gewesen.
Jetzt stieg sie aus ihrem Volvo und überquerte die Straße zum Schulgebäude. Am Zaun standen die wartenden Mütter bereits Schlange. Bei deren Anblick fiel ihr auf, dass Lydia, Munyasas Mum, ihren gestrigen Anruf nicht erwidert hatte. Das sah Lydia überhaupt nicht ähnlich, sie hing doch sonst ständig am Telefon. Monica reckte den Kopf. Vielleicht wartete sie ebenfalls in der Schlange. Tatsächlich entdeckte sie Lydia, ins Gespräch mit einer anderen Mutter vertieft. Sie versuchte, ihren Blick einzufangen. Dabei landete ihr Blick auf einer Frau mit rötlich blonden Haaren und in einer Wachsjacke, die etwas abseits neben einem mit Schlamm bespritzten Toyota Land Cruiser stand. Sie schien Monica eindringlich anzustarren.
Im nächsten Moment ertönte der Schulgong. Monica drehte sich um und sah eine Horde Kinder nach draußen auf den Spielplatz strömen. Wenig später entdeckte sie Lucy. Sie trottete völlig allein hinter dem Pulk her, mit gesenktem Kopf, den kleinen Rucksack über der Schulter. Wieder einmal überkamen Monica heftige Schuldgefühle, dass sie sich aufs Neue von den Sorgen um ihre Tochter hatte ablenken lassen. Sie beugte sich zu Lucy hinunter, griff nach ihrer Hand und ging mit ihr zurück zum Volvo. Als sie wieder aufsah, begann die Straße sich bereits zu leeren, und auch die Frau mit dem Land Cruiser war verschwunden.
Monica entriegelte den Wagen per Knopfdruck, zog die hintere Tür auf und schnallte Lucy in ihrem Kindersitz fest. Sie verspürte das übliche Unbehagen, das sie jedes Mal unmittelbar nach Aufsuchen eines Tatorts überfiel. Als hätte das Grauen, das sie gesehen hatte, seine Spuren hinterlassen, und jetzt lief sie Gefahr, dass sie es auf die Menschen, die sie liebte, übertrug. Sie verdrängte diesen irrationalen Gedanken und setzte sich hinters Steuer. Während sie den Motor anließ, drehte sie sich noch einmal zu Lucy um.
»Wie war dein Tag, meine Süße?«
»Ganz okay.« Lucy hatte wieder ihr Buch auf dem Schoß liegen, die illustrierte Ausgabe von Eine lausige Hexe, und starrte auf die aufgeschlagene Seite. Ob sie in der Schule vielleicht jemand ärgerte? Oder ob sie gemobbt wurde? Monica dachte zurück an ihre eigene Schulzeit und den Einfallsreichtum der Jungs aus ihrer Klasse, die sich alle möglichen Spitznamen für sie ausgedacht hatten: Monster Monica, Monica, das Mannstrum. Sie verstellte den Rückspiegel ein wenig, damit sie Lucys Gesicht sehen konnte.
»Möchtest du etwas essen? Wir könnten ins Kino gehen.«
Dieser Vorschlag schien Lucy etwas aufzumuntern. »Können wir uns Hotel Transsilvanien ansehen?«
Sie fuhren zu Burger King im Gewerbepark direkt an der Nairn Road. Monica gab sich alle Mühe, Lucy während des Essens ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Und verdrängte das Bild der Toten, das sich immer wieder in ihr Bewusstsein schob. Sie versuchte, nicht über Pauline Tosh nachzugrübeln. Dafür wäre später noch Zeit. Stattdessen sprach sie noch einmal behutsam auf ihre Tochter ein. Irgendetwas hatte das Kind auf dem Herzen: »Du weißt, du kannst mir alles sagen. Ganz egal, ob es mit der Schule zu tun hat oder mit etwas anderem.«
»Glaubst du, du könntest zaubern?«, gab Lucy zurück. »Ich glaube, ich könnte es.«
Lucy tendierte dazu, dass ihre Fantasie mit ihr durchging. Und in letzter Zeit ließ sie sich gern von ihrem Lieblingsbuch über diese Hexe inspirieren. War das ihre Art, sich ihren Problemen zu entziehen? Monica erinnerte sich, dass sie sich über große Teile ihrer Kindheit in die Welt der Fünf Freunde und der Schwarzen Sieben hineingeträumt hatte. »Ich wüsste nicht wie«, gab Monica schließlich zu. Sie beschloss, es später am Abend noch einmal zu versuchen.
Nach dem Essen überquerten sie den Parkplatz zum Kino, in dem tatsächlich Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub lief. Monica schaffte es sogar, ihr Handy den kompletten Film über ausgeschaltet zu lassen, und verkniff es sich, es zwischendurch auf neue Nachrichten zu überprüfen. Als sie es hinterher auf dem Parkplatz wieder einschaltete, waren zwei neue Sprachnachrichten eingegangen. Eine von DC Khan, die ihr mitteilte, dass sie eine erste Stellungnahme für die Presse herausgegeben habe. Und eine von Miss Jennings, mit der Bitte, in ihre Sprechstunde zu kommen. Sie müsse mit ihr über Lucy reden.
Nachdem Monica ihre Tochter an diesem Abend zu Bett gebracht hatte, versuchte sie es noch einmal bei Lydia. Diesmal war das Handy ihrer Freundin ausgeschaltet, weshalb sie überlegte, ob es vielleicht ein technisches Problem war. Oder sie hatte ihr Telefon verloren. Das wären zumindest mögliche Erklärungen, warum sie sich nicht zurückmeldete. Monica tippte eine rasche E-Mail: Hi Lydia, ich mache mir Sorgen wegen Lucy. Wollte nur fragen, ob du irgendwas gehört hast. Ich habe versucht, dich anzurufen, bin aber nicht durchgekommen. Danke, Monica X.
Sie schickte die Nachricht an die Mailadresse, die sich Lydia mit ihrem Ehemann teilte, und versuchte, ihre Besorgnis vorerst zu vergessen. Nachdenklich sah sie sich im Wohnzimmer um, betrachtete das riesige Ecksofa, die Anglepoise-Leuchte, den Wohnzimmertisch. Es waren Momente wie dieser, in denen sie es sehr geschätzt hätte, jemanden zu haben. Einen Menschen, mit dem sie lachen oder sich über gemeinsame Interessen unterhalten konnte. In ihrem früheren Leben in London war Monica sehr gerne auf Konzerte, ins Museum und in Kunstgalerien gegangen und hatte sich über Literatur ausgetauscht. Das alles schien nun Welten entfernt.
Du solltest endlich dein Profil bei der Online-Datingplattform ausfüllen, meldete sich eine innere Stimme. Wie sonst willst du jemanden kennenlernen? Sie holte ihren Laptop aus der Tasche, die an der Tür hing, und stellte es auf den Wohnzimmertisch, entschlossen, sich anzumelden.
Stattdessen zog sie ein altes externes Laufwerk heraus und schloss es an den Laptop an. Dann suchte sie nach dem Ordner mit dem Titel »Inaktiv« und fand die Datei »Pauline Tosh«. Diese verschob sie auf ihren Desktop.





























