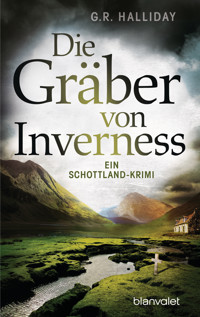8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Monica Kennedy
- Sprache: Deutsch
Die schottischen Highlands: düster, abgelegen, faszinierend – und tödlich! Der zweite Fall für DI Monica Kennedy.
Eine junge Frau ist mit ihrem Auto auf einer Bergstraße in den Schottischen Highlands unterwegs, als plötzlich ein kleines Mädchen wie aus dem Nichts vor ihr auftaucht. Sie weicht aus und kommt von der Straße ab. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einem dunklen, feuchten Raum … Dann verschwindet ein Tourist spurlos. Auch er hat kurz vor seinem Verschwinden ein kleines Mädchen gesehen.
Als ein verstümmelter Körper gefunden wird, übernimmt DI Monica Kennedy die Ermittlung. Nach sechs Monaten Abwesenheit ist sie zurück und wird dringender gebraucht denn je. Eine zweite Leiche wird gefunden und alles deutet auf einen Serienmörder hin, der schon seit Jahren aktiv und noch lange nicht fertig ist …
Alle Bücher der Monica-Kennedy-Reihe
Die Toten von Inverness (Bd. 1)
Die dunklen Wasser von Inverness (Bd. 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Eine junge Frau ist mit ihrem Auto auf einer Bergstraße in den schottischen Highlands unterwegs, als plötzlich ein kleines Mädchen wie aus dem Nichts vor ihr auftaucht. Sie weicht aus und kommt von der Straße ab. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einem dunklen, feuchten Raum … Dann verschwindet ein Tourist spurlos. Auch er hat kurz vor seinem Verschwinden ein kleines Mädchen gesehen.
Als ein verstümmelter Körper gefunden wird, übernimmt DI Monica Kennedy die Ermittlung. Nach sechs Monaten Abwesenheit ist sie zurück und wird dringender gebraucht denn je. Eine zweite Leiche wird gefunden und alles deutet auf einen Serienmörder hin, der schon seit Jahren aktiv und noch lange nicht fertig ist …
Autor
G.R. Halliday wurde in Edinburgh geboren und wuchs in der Nähe von Stirling, Schottland, auf. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er damit, seinen Vater zu beobachten, wie dieser ungeklärte Geheimnisse untersuchte. Davon fasziniert, wurden einige dieser Geschichten zur Inspirationsquelle für seinen Debütroman. Heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin und einer Bande halb wilder Katzen in der Nähe von Inverness in den schottischen Highlands.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
G. R. Halliday
Die dunklen Wasser von Inverness
Ein Schottland-Krimi
Deutsch von Bettina Spangler
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Dark Waters« bei Harvill Secker, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by G. R. Halliday
Published by Arrangement with HIGHLAND NOIR LIMITED
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: Shutterstock.com (inigocia; Helen Hotson; Dmitr1ch)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
KW · Herstellung: eR
ISBN: 978-3-641-24615-0V001
www.blanvalet.de
Für Alisa
1
Früher, als sie noch all ihre Gliedmaßen gehabt hatte, war Annabelle leidenschaftlich gern Auto gefahren. Doch ausgerechnet auf einer ihrer geliebten Spritztouren beging sie den ersten folgenschweren Fehler.
Alles begann mit ihrem iPhone. Statt es in die dafür vorgesehene Halterung am Armaturenbrett zu stecken, hatte sie es achtlos auf den Beifahrersitz des BMWs geworfen. Dort war es neben einem Exemplar des Heat-Magazins und einer Straßenkarte vom nördlichen Schottland gelandet. Beides hatte sie an einer Tankstelle kurz hinter Stirling gekauft. Sie hatte einen kurzen Tankstopp eingelegt und sich ein schnelles Frühstück genehmigt, bestehend aus einem labberigen Schinkensandwich, das nach fast nichts geschmeckt hatte, und einem ungenießbaren Kaffee aus dem Pappbecher. Anschließend hatte sie die Umverpackung und den Becher ordentlich zusammengefaltet und beides in die entsprechenden Recyclingtonnen befördert. Der Anstand gebot es ihr, die Sachen nicht einfach auf dem Tisch liegen zu lassen, damit die Bedienung sie wegräumte. Die arme Frau hatte ohnehin einen extrem überarbeiteten Eindruck gemacht. Annabelle war zweiundzwanzig und immer darum bemüht, das Richtige zu tun.
Bevor sie sich nach ihrem Stopp wieder hinters Steuer klemmte, wägte sie kurz ab, ob sie Miss Albright anrufen sollte. Die ältere Dame wohnte in London im selben Haus wie sie auf ihrer Etage in der Wohnung gegenüber. Sie war schon jenseits der neunzig. Doch wenn Annabelle ehrlich war, war es nicht Miss Albright, der ihre Sorge galt. Tatsächlich ging es ihr in erster Linie um Mr. Pepper, Miss Albrights niedlichen Zwergspitz. Buschiges schwarzes Fell und eine winzige rosa Zunge. Da Miss Albright sich aufgrund ihres Alters nicht mehr allzu oft vor die Tür wagte, kam Mr. Pepper viel zu selten raus. Wann immer sie die Zeit fand, klopfte Annabelle deshalb an die Tür ihrer Nachbarin und drehte eine kurze Runde mit dem Hund. In der Regel scharrte er bereits ungeduldig mit den Pfoten, während er hinter der Tür auf sie wartete, und knurrte leise, weil er es kaum erwarten konnte, seinen Freilauf zu bekommen. Es klang vielleicht albern, aber irgendwie fühlte sie sich verpflichtet, Mr. Pepper wissen zu lassen, dass sie bald zurück sein würde und er keine Angst zu haben brauche. Sie selbst war nach der Scheidung ihrer Eltern innerlich wie zerrissen, die Sache war nicht leicht für sie. Nur in Gesellschaft von Miss Albright und Mr. Pepper fühlte sie sich rundum wohl. Die beiden freuten sich jedes Mal unbändig, sie zu sehen.
Sie checkte die Uhrzeit auf ihrem iPhone. Fünf nach sieben am frühen Morgen. Miss Albright schlief sicher noch. Deshalb entschied Annabelle, sie erst am Nachmittag anzurufen. Stattdessen wollte sie ein erstes Foto nach ihrer Ankunft in Schottland machen. Oder besser gleich mehrere, damit sie eine kleine Auswahl hatte. Sie nahm die typische Selfie-Haltung ein: den Kopf leicht gesenkt, die rot geschminkten Lippen etwas gespitzt, die langen braunen Haare hübsch um ihr Gesicht drapiert. Das langärmelige weiße Shirt mit dem Aufdruck BRAT in großen roten Lettern musste ebenfalls zu sehen sein. Der blaue BMW M4, den ihr Dad ihr zum einundzwanzigsten Geburtstag als extrem verspätetes Geschenk präsentiert hatte, stand im Hintergrund. Und jenseits davon, in weiter Ferne, die ersten Ausläufer der Highlands, die Gipfel selbst jetzt, im späten Frühjahr, noch leicht mit Schnee überzuckert.
Nachdem sie eine Viertelstunde lang mit verschiedenen Filtern experimentiert hatte, beschloss sie, dass die Qualität des Fotos ausreichen musste. Besser bekam sie es auf die Schnelle nicht hin. Hastig tippte sie den folgenden Begleittext: Leute, ich sehe beschissen aus, aber was soll’s! Bin auf dem Weg ins Land jenseits des Walls! Ein Roadtrip in den eisigen Norden! Ist das nicht megaaufregend? Küsschen xx. Sie las die Zeilen noch einmal durch und fand, dass sie ausreichend spontan klangen. Also postete sie die paar Worte zusammen mit dem Foto auf Instagram, der einzigen Plattform, die sie regelmäßig nutzte, und sah sich dann eine Reihe von Bildern auf anderen Profilen an. Wunderschöne Menschen mit strahlenden Gesichtern, die ganz offensichtlich Spaß hatten. Kaum einen von ihren Instagram-Freunden hatte sie je im richtigen Leben getroffen, aber vielleicht würden sich die Leute ihre Fotos ansehen und sich für sie begeistern, so wie das umgekehrt der Fall war?
Vielleicht sieht er es ja auch und wird eifersüchtig, weil du, ohne ihm was zu sagen, nach Schottland unterwegs bist? Mit einer fahrigen Geste fegte sie diesen lächerlichen Gedanken beiseite. Schließlich war er bei der Polizei und führte sich auf, als wäre er mindestens zehn Jahre älter. Wahrscheinlich hatte er keinen Schimmer, was Instagram überhaupt war. Sie wollte ohnehin nichts mehr mit ihm zu tun haben, nach allem, was geschehen war. Dieser Trip hatte nicht das Geringste mit ihm zu tun. Klar war ihr ein wenig bange bei dem Gedanken, diese weite Reise so ganz allein auf sich zu nehmen. Aber seit wann brauchte sie einen Vorwand, um sich ins Auto zu setzen? Wenn sie den Fuß aufs Gaspedal setzte und beschleunigte, ging es ihr sofort besser.
Noch eine Stunde später hatte sie den salzigen, fettigen Geschmack von Schinken auf den Lippen. Aber immerhin hielt der Kaffee sie wach, während sie auf der A9 Richtung Norden dahinbretterte. Sie war die Nacht durchgefahren und hatte für die Strecke von London nach Stirling, die sie über verschiedene Autobahnen geführt hatte, gerade mal sechs Stunden gebraucht. Kein schlechter Schnitt. Von dort aus dauerte es weitere zweieinhalb Stunden, bis sie Inverness erreichen würde. Auch das konnte sich sehen lassen.
Es war immer noch früher Vormittag, als die gut ausgebaute Straße, die sie durch weite, monotone Moorlandschaften geführt hatte, plötzlich abfiel und die Hauptstadt der Highlands sich zum ersten Mal vor ihr auftat: ein Meer an Häusern, das sich dicht ans Wasser drängte – der Moray Firth, wie ihr das Navi verriet. Direkt vor ihr spannte sich eine riesige Brücke auf Betonpfeilern über den Fjord. Annabelle hatte vorgehabt, einfach geradeaus weiter zur gegenüberliegenden Landzunge zu fahren. Doch das Navi hatte andere Pläne: Die Stimme forderte sie dazu auf, am nächsten Kreisverkehr links abzubiegen. Widerstrebend fügte sie sich und umfuhr die Außenbezirke der Stadt, vorbei an trostlosen Industrieanlagen, die so gar nicht zu ihrem perfekten Bild der Highlands passen wollten. Keine Spur von vielfarbig karierten Schottenmustern, nichts, das an die Romantik von Outlander erinnert hätte.
Nach weiteren zehn Minuten, als sie die Stadt endlich hinter sich ließ und der Landstraße folgte, war ihre Enttäuschung vergessen. Ihr Weg führte sie nun unmittelbar am Ufer des Meeresarms entlang, und in der Ferne konnte sie die ersten dunkleren Schemen der Bergketten ausmachen. Mit einem Mal wurde sie von großer Vorfreude gepackt: auf die schroffen Massive des Westens und Glen Affric, angeblich das malerischste Tal in ganz Schottland. Sie hatte bei ihren Online-Recherchen von der berühmten Panoramaroute hinunter in dieses Naturschutzgebiet gelesen und wollte unbedingt dorthin, allerdings plante sie, eine weniger befahrene, unbekannte Straße zu nehmen. Laut Navi waren es noch rund vierzig Kilometer bis zum Ziel.
Gerade mal eine halbe Stunde später ragten die hohen Bergflanken bereits drohend nah vor ihr empor. Nachdem sie ein verwahrlost wirkendes Dorf hinter sich gelassen hatte, hielt sie schließlich an, als ein Hinweisschild vor ihr auftauchte: GLEN TURRIT.
Hier, an der Zufahrt zu diesem entlegenen Tal, machte sie den zweiten Fehler.
Das Zufahrtstor zu der durch ein Schild als privat gekennzeichneten Straße war mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Die letzte Person, die hier vorbeigekommen war, hatte die Kette allerdings nur lose um den Holzpfosten geschlungen und dann den Bügel nicht richtig einrasten lassen, wie Annabelle zu ihrer Freude feststellte. Sie hielt das Schloss in der Linken und sah sich verstohlen nach den steilen, bewaldeten Hängen um, die sich zu beiden Seiten der Straße erstreckten. Aus diversen Online-Foren wusste sie, dass der Weg ursprünglich als Zufahrt zu einem Wasserkraftwerk genutzt worden war. Der dazugehörige Staudamm war in den Fünfzigerjahren errichtet worden. Die Straße, die gerade mal breit genug für ein Fahrzeug war, wand sich über viele Kilometer hinweg durch die Talsenke, immer dem Verlauf des Flusses folgend, und führte schließlich über den Damm, bis man nach weiteren dreißig Kilometern unweit von Strathcarron auf ein weiteres verschlossenes Tor traf. Von dort aus war es nicht mehr weit bis zur Isle of Skye an der Westküste.
Als Annabelle ihren spontanen Ausflug hierher geplant hatte, war sie in einem der Foren auf einen Post gestoßen, in dem es hieß, man könne den Verwaltern, die über den Schlüssel verfügten, ein kleines Trinkgeld zahlen, damit sie die Tore für einen öffneten. »Zwanzig Pfund sollten jeweils reichen«, hatte es da geheißen. »Und selbst beim zwanzigfachen Preis wäre die Strecke noch jeden Penny wert. Denn wo sonst findet man eine Privatstraße, auf der man ungestört durch ein Tal der Highlands fahren kann?«
Eine schmale geteerte Fahrbahn also, zu beiden Seiten gesäumt von hoch in den Himmel ragenden, düsteren, lange Schatten werfenden Bergen, und kein anderes Fahrzeug weit und breit: Unweigerlich musste Annabelle an eine Autowerbung denken. Sie stellte sich einen extrem disziplinierten Fahrer in Anzug und Krawatte vor, der seinen Wagen in angemessenem Tempo über viele Kilometer Asphalt steuerte, der feuchte Traum eines jeden Autofans. Allein bei dieser Vorstellung bekam sie schwitzige Hände. Spritztouren übers Land waren für sie das Größte. Wenn sie den Jungs von Top Gear im Fernsehen dabei zusah, wie sie ungehindert Gas gaben und dabei ihre gewohnten Scherze trieben, kam sie ins Schwärmen. Aber die Wirklichkeit sah leider wie so oft ganz anders aus. Unwillkürlich musste sie an ihren Trip nach Cornwall anlässlich der Hochzeit ihres Dads denken. Das war vor einigen Monaten gewesen. Die ganze Strecke über hatte sich der Verkehr gestaut, sie hatte hinter langen Kolonnen von Wohnmobilen und Familienkutschen festgesessen.
Jetzt aber würde es ganz anders sein. Noch einmal sah sie sich nach dem nahen Wald um. Die Gegend wirkte völlig verlassen, für sie als Stadtmensch weckten diese Weite und die extreme Einsamkeit Demut in ihr. Hoch oben auf den umliegenden Gipfeln waren noch vereinzelt Schneefelder zu sehen, doch die Strahlen der Sonne hatten bereits so viel Kraft, dass Annabelle in dem langärmeligen Shirt und ihren Leggings nicht fror. Bis zu diesem Augenblick hatte sie nicht recht daran geglaubt, dass es diese Straße wirklich gab. Unschlüssig stand sie da, die Hand immer noch am Schloss. Welch ein Zufall, dass es nicht komplett eingerastet war … Es schien ihr fast, als hätte das Schicksal es so gewollt. Und so machte sie sich daran, den Bügel zu öffnen und die Kette zu lösen.
Es war einfach perfekt. Die freie Fahrbahn, der weite blaue Himmel und die schneebedeckten Berge rings um sie herum. Die scharfen, engen Windungen entlang des Flusses. Endlich konnte Annabelle das Äußerste aus ihrem Wagen herausholen. Durch die Kurven jagen, anschließend Vollgas geben und auf das tiefe, durchdringende Röhren des Motors lauschen, um dann vor der nächsten Biegung wieder hart zu bremsen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, blitzte hinter ihrem verbissenen, hoch konzentrierten Ausdruck immer wieder ein nervöses Lächeln auf. Und gleichzeitig ließ sie all das, worüber sie nicht nachdenken wollte, hinter sich. Genau wie den Staub, den sie mit den Reifen aufwirbelte, sodass er im Sonnenlicht glitzerte.
Nach drei weiteren langen, sich stetig windenden Kilometern weitete sich das Tal, und die Straße verlief gerade. Die Bergflanken wichen mehr und mehr zurück. Annabelle preschte mit annähernd hundertfünfzig Stundenkilometern über eine leichte Unebenheit in der Fahrbahn und spürte, wie der Wagen kurz abhob, als in der Ferne endlich die betonierte Mauer des Staudamms in Sicht kam.
Das sanfte Sonnenlicht fiel schräg auf den Asphalt und brachte das senfgelbe Heidekraut, das die weitläufige Moorlandschaft sprenkelte, zum Leuchten. Annabelle atmete tief durch und lächelte versonnen. Jetzt drosselte sie behutsam die Geschwindigkeit. Es war ein berauschendes Gefühl, als befände sie sich in einem Amphitheater: die Berge, die Mauern, die die Arena umgrenzten, der Himmel darüber, das Publikum, und sie die Hauptakteurin mittendrin.
Ihr nächster Gedanke war, dass sie dringend ein Foto machen musste. Sie warf einen Blick auf die leere Handyhalterung am Armaturenbrett und erinnerte sich, dass sie ihr Telefon achtlos auf den Beifahrersitz hatte fallen lassen.
Rasch warf sie einen prüfenden Blick auf die Straße vor ihr und überzeugte sich, dass sie freie Fahrt hatte. Schnurgerade zog sich die Strecke hin, mindestens noch zwei weitere Kilometer, sie hatte keinen Gegenverkehr. Wieder ging sie ein wenig vom Gas und streckte den Arm nach links aus. Vergeblich tastete sie nach ihrem Handy. Sie bekam nur glattes, glänzendes Papier zu fassen. Jetzt drehte sie den Kopf zum Beifahrersitz. Das Telefon war unter die Zeitschrift gerutscht.
Sie blickte erneut in Fahrtrichtung. Ein Stück weit vor ihr tauchte am Straßenrand ein riesiger Baum auf, buchstäblich der einzige weit und breit inmitten der ausgedehnten Moorebene. Der Weg durch die Talsenke war immer noch frei, immer noch schnurgerade. Es taten sich keinerlei Hindernisse vor ihr auf. Also streckte sie erneut die Hand hinüber, um das Magazin beiseite zu schieben. Mit einem flüchtigen Blick nach links schnappte sie sich das Handy.
»Hab dich!« Zufrieden richtete Annabelle die Augen wieder auf die Fahrbahn.
Das kleine Mädchen stand mitten auf der Straße.
Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Mit einer Klarheit, als wäre das Bild eingefroren, sah Annabelle das Kind vor sich. Sie registrierte das weiße T-Shirt und die abgeschnittenen Jeans-Shorts, die spindeldürren Ärmchen und Beine, die daraus hervorragten. Die nackten Füße auf dem Asphalt. Blonde Haare, blasser Teint und blaue Augen, die mit einer eigenartigen Entschlossenheit auf Annabelle geheftet waren.
Ihr blieb keine Zeit, um aufs Bremspedal zu steigen. Instinktiv riss sie das Lenkrad herum.
Der BMW schoss mit über hundert Stundenkilometern über die Fahrbahn hinaus. Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen starrte Annabelle auf den massiven Baum. Sah die schartige, wie in Falten gelegte Rinde. Die Sekunden vor dem Aufprall zogen sich scheinbar endlos in die Länge; sie hatte sogar noch Gelegenheit, sich die folgende Frage zu stellen: Warum läuft dieses Mädchen ausgerechnet hier auf die Straße? Warum beim einzigen Baum weit und breit?
Die Antwort darauf sollte Annabelle erst sehr viel später erfahren. Denn den entscheidenden Fehler hatte sie bereits vor geraumer Zeit gemacht. Als sie sich zu ihrem Pech genau für diesen Fahrzeugtyp in genau diesem Blau entschieden hatte.
Das Rad der Zeit drehte sich wieder schneller, die Karosserie traf auf hartes, unbarmherziges Holz, und alles um sie herum wurde schwarz.
2
Detectice Inspector Monica Kennedy saß mit ihrer kleinen Tochter im viel besuchten Burger King in einem Gewerbegebiet von Inverness. Als sie den Blick beiläufig durch das Restaurant schweifen ließ, blieb er zufällig an einer jungen Frau hängen. Sie saß an einem Tisch am anderen Ende des Essbereichs, neben ihr ein kleiner Junge, der in einem Buggy festgeschnallt war. Vermutlich ihr Sohn. Mit strenger Miene sah die Mutter das Kind an. Es hatte die Fäustchen in sein grünes T-Shirt gekrallt und den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Während Monica die beiden beobachtete, spürte sie, wie sich ein altbekanntes ungutes Gefühl in ihrer Magengrube bemerkbar machte. Eine Ahnung, dass etwas nicht stimmte, dass es ihre Pflicht war einzugreifen. Genau dieses feine Gespür für unsichtbare Schwingungen war es, das ursprünglich dafür gesorgt hatte, dass sie eine Laufbahn bei der Polizei eingeschlagen hatte. Und das sie zugegebenermaßen mehr als nur einmal in Schwierigkeiten gebracht hatte.
»Krieg ich noch Ketchup für meine Pommes?« Diese Frage aus dem Mund ihrer vierjährigen Tochter übertönte das Stimmengewirr der Gäste rund um sie herum und riss Monica aus ihren Gedanken. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie die Frau eine ganze Weile unverhohlen angestarrt hatte. Blinzelnd sah sie zu Lucy. Beim Anblick ihrer blonden Haare und der blauen Augen wurde ihr warm ums Herz.
»Aber sicher, Liebes.« Monica griff nach einem Tütchen Ketchup, riss es mit den Zähnen auf und reichte es Lucy. Es fiel ihr schwer, nicht noch einmal zu der Frau und dem Kind zu spähen. Der Junge war ungefähr drei Jahre alt und hatte auf den ersten Blick sauber gekleidet und gut gepflegt gewirkt. Keinerlei äußere Spuren von Gewalt oder Vernachlässigung. Du bist in letzter Zeit wirklich arg überspannt, rügte sie sich selbst. Überall glaubst du, Probleme zu wittern. Du kannst es einfach nicht lassen, wie? Dabei solltest du dich zur Abwechslung mal ganz auf Lucy konzentrieren. Dieser Ausflug war eigentlich als sonntägliche Belohnung für ihre Tochter gedacht gewesen: erst ein Besuch im Kino (Pets) und anschließend ein Essen bei Burger King.
Immerhin habe ich mich am Riemen gerissen und Hately nicht sofort zurückgerufen, rechtfertigte Monica sich im Stillen. Während sie im Kino gesessen hatten, hatte ihr Vorgesetzter, Detective Superintendent Fred Hately, ihr eine Nachricht mit der Bitte hinterlassen, ihn so schnell wie möglich zu kontaktieren. Das wäre im Grunde nichts Ungewöhnliches – wenn Monica nicht schon seit einem halben Jahr kein Mitglied des Ermittlerteams der Mordkommission mehr gewesen wäre. Sie hatte sich eine Auszeit von diesem Job genommen, um genug Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können. Auslöser für diese Entscheidung war ein Fall gewesen, der für sie beide um ein Haar in einer Tragödie geendet hätte. Hately hatte ihrer Bitte um eine vorübergehende Versetzung stattgegeben und sie in die Verkehrsabteilung abkommandiert. Dies war das erste Mal seit Monaten, dass er sie außerhalb des Diensts zu erreichen versuchte. Schlagartig schnürte sich ihr Magen zusammen. Denn eine solche Nachricht von ihm konnte nur eines bedeuten: Es gab schlechte Neuigkeiten.
»Die Erzieherinnen im Kindergarten haben gesagt, wir sollen nicht so viel Süßes oder Salziges essen«, flötete Lucy, während sie den Ketchup aus der Tüte auf ihre Pommes quetschte. »Und auch nicht so viel hiervon, da ist nämlich beides drin.«
»Ein weiser Ratschlag. Dem kann ich nur beipflichten.«
»Warum sind Salz und Zucker ungesund?«, wollte Lucy wissen. Fragend sah sie Monica an und kräuselte die Nase, ein Gesichtsausdruck, der typisch für sie war.
Monica tat so, als müsste sie über die Antwort nachdenken, und sah erneut zu der Frau hinüber. Die fixierte nach wie vor mit strengem Blick ihr Kind. Leise raunte sie ihm etwas zu. Erst jetzt fiel Monica der Teddy auf, den der kleine Junge mit beiden Händen umklammert hielt. Abwesend drehte er dem Spielzeug den Hals um. Monica warf einen prüfenden Blick auf die Mutter. Sie war ordentlich gekleidet, trug Jeans, ein graues Sweatshirt und dazu hohe Stiefel. Außerdem zeigte sie keinerlei Anzeichen dafür, dass sie unter übermäßigem Druck stand oder psychische Probleme hatte.
»Hat der Junge da drüben was angestellt?« Offenbar war Lucy Monicas interessiertem Blick gefolgt.
»Ich weiß es nicht, Liebes.«
Lucy schob ihr Tablett von sich. »Ich bin fertig mit Essen.«
Monica nickte und stand auf. Einige von den Gästen an den Nebentischen drehten sich nach ihr um. Wie immer erregte sie mit ihrer auffallenden Erscheinung die Neugier der Leute: Sie war über eins achtzig groß, selbst in ihren flachsten Schuhen, und trug einen langen grauen Mantel aus Tweedstoff, der zwar teuer gewesen, stellenweise aber schon etwas fadenscheinig war. Schulterlange dunkle Haare umrahmten ihr blasses Gesicht und ließen es noch fahler wirken.
Entschlossen ging sie um den Tisch herum, half Lucy in ihre Jacke und zog den Reißverschluss zu. Beim Verlassen des Restaurants konnte Monica es sich nicht verkneifen, noch einen letzten Blick auf die Mutter und ihren Sohn zu werfen. Der Junge blickte starr ins Leere, sein niedliches rundes Gesichtchen war zu einer wütenden Grimasse verzerrt. Währenddessen scrollte die Mutter auf ihrem Handy und schenkte dem Kind keinerlei Beachtung. Siehst du, da war nichts, alles ganz harmlos. Nur ein kleiner Disput zwischen Mutter und Sohn. Du mit deiner Paranoia bauschst die Dinge nur unnötig auf. Während ihr diese Gedanken durch den Kopf schossen, sah Monica zu ihrer Tochter. Nur um sich zu vergewissern, dass sie noch neben ihr herlief. Obwohl sie die kleine Hand fest in der ihren spürte.
Als sie wieder im Volvo saßen, rief Monica Hately schließlich doch zurück.
»Kennedy?« Schon beim zweiten Klingeln meldete er sich mit seinem unverkennbaren Glasgower Akzent. Seine Stimme klang leicht verunsichert, dabei brachte ihren Chef normalerweise so gut wie nichts aus der Ruhe. Monica warf einen Blick in den Rückspiegel und sah nach Lucy; ihr Köpfchen war nach unten geneigt, sie war in ein Buch vertieft, das aufgeschlagen auf ihrem Schoß lag. Draußen floh eine Familie lachend vor dem einsetzenden Regen ins Kino. Die ersten Tropfen waren bereits auf der Windschutzscheibe gelandet. Plötzlich stieg eine verblasste Kindheitserinnerung aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins auf: wie sie, ihre Mum und ihr Dad zusammen vor einem aufkommenden Sturm davongelaufen waren. Und gleichzeitig weckte der tiefgraue Himmel draußen eine düstere Vorahnung in ihr. »Wir haben eben einen männlichen Leichnam reinbekommen. Ziemlich übel zugerichtet. Sieht ganz nach Mord aus. Ich will es kurz machen, Monica: Wir brauchen Sie hier. Sie sind meine beste Ermittlerin. DI Simpson ist im Süden unterwegs. Er ist bereits mit einem anderen Fall betraut. Und DC Crawford kann ich die Sache unmöglich überantworten, ihm fehlt es an der nötigen Erfahrung. Was meinen Sie? Denken Sie, dass Sie schon so weit sind?«
Monica fühlte sich völlig überrumpelt. Mit zusammengezogenen Brauen starrte sie durch die Windschutzscheibe in den Regen. Unzählige Gedanken jagten ihr durch den Kopf. Doch ihr Entschluss stand schnell fest. »Ich bin sofort bei Ihnen.«
3
Der Rechtsmediziner Dr. Dolohov hob den Kopf und lächelte, als er Monica zur Tür hereinkommen sah. Es war ihre erste Begegnung seit jenem Fall im vergangenen Herbst.
»DI Monica Kennedy«, begrüßte er sie mit seinem unverkennbaren Akzent. Der gebürtige Russe hatte die englische Sprache ohne jeden Zweifel im Süden des Königreichs erlernt. Lässig strich er sich mit der Hand über die kurz geschorenen grauen Haarstoppel und rückte seine Brille gerade. »Sieh einer an. Die beste Ermittlerin, die wir hier im Norden haben, ist zurück! Bereit für den Kampf gegen die Ungeheuer dieser Welt! Die Frage ist nur – hat sie es noch drauf?« Er legte den Kopf schief und musterte sie feixend, aber zugleich aufrichtig interessiert. »Sie machen mir ja keinen begeisterten Eindruck. Warum so betrübt?«
Monica schüttelte nur den Kopf, obwohl sie Dolohov, der immer zu Scherzen aufgelegt war, durchaus mochte. Seine kindliche Neugier hatte etwas Erfrischendes. Besser, als wie eine Heldin gefeiert zu werden, besser als das heimliche Getuschel hinter vorgehaltener Hand, weil man über ihre Vergangenheit Bescheid wusste.
»Ach, es ist wegen meiner Tochter. Nach allem, was bei diesem letzten Fall passiert war …«, hörte sie sich sagen, obwohl ihr unbegreiflich war, warum sie sich ausgerechnet diesem Mann gegenüber öffnete. »Ich fürchte, ich bin zu einer richtigen Helikoptermutter geworden …«
»Nun ja, Kinder können auch wahre kleine Teufel sein«, gab Dolohov zurück, als handelte es sich um eine unumstößliche Wahrheit. »Ich bin mir sicher, dass viele Leute ohne ihre Zöglinge glücklicher wären. Meine Großmutter wuchs in der Ukraine auf. Als sie noch klein war, während der großen Hungersnot in den Dreißigern, sind angeblich reihenweise Freunde von ihr verschwunden. Die Leute hätten ihre Kinder verkauft, meinte sie immer. Um nicht verhungern zu müssen. Stellen Sie sich das nur vor.«
»Lieber nicht.«
»Kann ich verstehen«, gab Dolohov zurück. »Tja, diesen armen Menschen ist das sicher nicht leichtgefallen. Aber hatten sie eine Wahl? Worauf ich hinauswill: Vielleicht ist es ratsam, die Liebe zu den eigenen Kindern nicht allzu groß werden zu lassen. Aus reinem Selbstschutz.«
Monica quittierte die eigenartigen Gedankengänge des Arztes mit einem Stirnrunzeln. Dann warf sie einen Blick zur Tür. Ihre beiden Kollegen sollten jeden Moment hier sein, sie hatte sie per Textnachricht verständigt, kurz bevor sie selbst losgefahren war.
Dass DC Connor Crawford noch nicht eingetroffen war, wunderte sie nicht im Geringsten. Monica kannte ihn seit einem halben Jahr. Damals hatten sie an ihrem ersten gemeinsamen Fall gearbeitet. Anfangs hatte sie ihm skeptisch gegenübergestanden, weil er mit seinen noch nicht mal dreißig Jahren eine besondere Vorliebe für Bars und Frauen an den Tag legte. Doch dann hatte sie allmählich Vertrauen zu ihm gefasst. Und mittlerweile mochte sie den temperamentvollen, unternehmungslustigen jungen Mann sogar recht gern. Vermutlich war er am Abend zuvor aus gewesen und hatte die Nacht durchzecht oder sie in einem fremden Bett verbracht.
Das Ausbleiben von DC Ben Fisher überraschte sie dafür umso mehr. Er war mit Mitte zwanzig der Jüngere von beiden, ein Akademiker mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Gewöhnlich verhielt er sich tadellos. Und er war weit mehr von Ehrgeiz getrieben als Crawford, den er mit seiner hyperkorrekten, pedantischen Art regelmäßig auf die Palme brachte. In Monicas Augen hätten die beiden Detectives nicht unterschiedlicher sein können: Crawford der aufgeweckte, impulsive Frauenheld, Fisher der ruhige, besonnene Pragmatiker. Bei ihrem letzten gemeinsamen Fall hatten sie alle drei eng zusammengearbeitet, und bei jedem Einzelnen von ihnen hatten die Ermittlungen tiefe Spuren hinterlassen. Auf die eine oder andere Weise. Die Ereignisse verfolgten sie alle bis zum heutigen Tag.
Mit einer unwirschen Kopfbewegung schüttelte Monica die Erinnerungen ab. Das alles lag in der Vergangenheit, und dort sollte es künftig auch bleiben.
»Wie Sie meinen«, sagte Monica nur, und damit war das Thema für sie erledigt. Der Fall hatte Vorrang. Sie kannte Crawford und Fisher gut genug, um zu wissen, dass sie alles daransetzen würden, um schnellstmöglich herzukommen. Sie würde die beiden später ins Bild setzen. »Was haben Sie denn nun für mich, warum wollte Hately unbedingt, dass ich vorzeitig in den Dienst zurückkehre?«
Dolohovs Züge hellten sich auf. »Hier drüben. Sehen Sie selbst.« Er streifte ein frisches Paar Einmalhandschuhe über und winkte Monica zu einer der Kühleinheiten im hinteren Bereich der Leichenhalle. »Eine Gruppe von Anglern hat ihn entdeckt – er hatte sich an der Uferböschung nahe einem Staudamm verfangen, in der Nähe von Beauly war das.« Monica nickte. Sie kannte die Gegend von diversen Spazierfahrten in den Tälern westlich von Inverness. Dort ging sie gerne wandern.
Nach kurzem Zögern zog Dolohov den Leichnam hervor und deckte ihn ab. Der Anblick, der sich ihr bot, war an Grausamkeit kaum zu überbieten: Das, was von ihm übrig war, war aufgedunsen und bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung. Die Haut war stark ausgebleicht, ein Zeichen dafür, dass sie begonnen hatte, sich in ihre Bestandteile, diverse Fette und Proteine, zu zersetzen. Das Gesicht zeigte kaum mehr menschliche Züge, es war derart aufgequollen, dass es nur noch einer breiigen Masse glich. Hastig schluckte Monica den aufsteigenden Ekel hinunter und zwang sich dazu, sich dem Toten zu nähern. Bei genauerem Hinsehen konnte sie an Kinn und Oberlippe feine schwarze Härchen erkennen. Tatsächlich, ein Mann. Dann ließ sie den Blick über den restlichen Körper wandern. Das linke Bein war von der Wade abwärts nicht mehr vorhanden. Der rechte Arm fehlte komplett, der linke reichte nur bis zum Ellbogen.
»Wie ist er ums Leben gekommen?«
»Er ist ertrunken«, antwortete Dolohov. »In der Lunge finden sich Wasser und pflanzliche Rückstände. Davor allerdings … Er muss eine ziemliche Tortur durchgemacht haben.« Der Pathologe räusperte sich verlegen und deutete auf das zerfaserte Fleisch an der rechten Schulter. »Der Arm wurde am Gelenk abgetrennt, er wurde ihm gewaltsam herausgerissen«, sagte er und veranschaulichte seine Worte mit einer ruckartigen Geste. Dann deutete er auf die Stelle, wo der linke Unterarm hätte sein sollen. »Am Gelenk abgetrennt, ebenfalls mit roher Gewalt«, fuhr er fort und legte dann eine Kunstpause ein, um das Gesagte nachwirken zu lassen. »Rein theoretisch wäre es möglich, dass diese Verletzungen durch eine starke Strömung verursacht wurden. Wenn sich seine Arme in einem Wehr oder Ähnlichem verfangen hätten zum Beispiel.«
Monica nickte, auch wenn ihr dieses Szenario wenig plausibel erschien.
»Allerdings spricht ein wesentliches Detail dagegen. Sehen Sie hier.« Dolohov deutete auf das, was vom linken Bein noch übrig war. Ein Stück schneeweißer Knochen ragte aus dem aufgeweichten Fleisch hervor. »An dieser Stelle ist der Knochen durchtrennt. Er wurde eindeutig mit einem Schneidewerkzeug bearbeitet.«
»Mit einem Schneidewerkzeug?«
»Einer Säge vermutlich«, gab Dolohov zurück. Jetzt hob er den Blick zu Monica und sah sie vielsagend an.
»Um Himmels willen.« Sie hatte die Worte nur leise vor sich hin gemurmelt, und trotzdem schien ihr Echo überdeutlich durch die weiß geflieste Leichenhalle zu schallen. »Sie sagten, er sei ertrunken. Dann hat man ihm das also vor seinem Ableben angetan?« Allmählich begriff sie, warum Hately so erschüttert geklungen hatte.
»Ja. Man hat ihn bei lebendigem Leib zerlegt.« Dolohov bekräftigte seine Worte mit einem Nicken. »Stück für Stück.«
4
Monica stand am Ufer des Beauly und folgte aufmerksam den gespenstischen Lichtern, die sich unter Wasser bewegten. Die Mitglieder der Taucheinheit machten sich in diesem Moment vom Aigas-Staudamm aus auf den Weg hinaus in die schwarzen Tiefen. Es war bald zehn Uhr abends und stockfinstere Nacht. Nur die Lampen am Wehr und die Scheinwerfer der umstehenden Fahrzeuge, bestehend aus ihrem eigenen Volvo, zwei Einsatzwagen und einem Polizeivan, durchschnitten die eisige Dunkelheit und spendeten spärliches Licht. Die Taucher hatten die Aufgabe, sich auf die Suche nach den fehlenden Gliedmaßen der Leiche zu begeben sowie nach möglichen Hinweisen zu suchen, die Aufschluss über die Identität des Toten geben konnten. Wer war das Opfer? Warum war der Mann ertrunken? Und die wichtigste Frage von allen: Wer hatte ihm das angetan?
»Was für eine gottverlassene Gegend. Dabei sind wir nur dreißig Kilometer von Inverness entfernt. Irgendwie fühlt man sich wie in einer fremden Welt, wenn man zu allen Seiten hin von Bergen umgeben ist.«
Beim Klang von DC Connor Crawfords Stimme fuhr Monica herum. Er war mindestens einen Kopf kleiner als sie. Im Halbdunkel betrachtete sie seine hohen Wangenknochen und das schmale Gesicht, seinen drahtigen, muskulösen Körper. Die roten Haare waren wie immer zu einer ordentlichen Tolle frisiert. Er trug einen leicht abgetragenen braunen Anzug aus Wollstoff und darüber eine ebenfalls braune Lederjacke, ein auffallender Kontrast zu dem frisch gestärkten weißen Hemd mit den sauberen Manschetten und dem aufdringlichen Duft nach teurem Aftershave, der von ihm ausging. Fast, als hätte er das Outfit eigens für seinen Auftritt an diesem Ort gewählt. Der leicht zerzaust wirkende, aber überaus attraktive Detective war ganz offensichtlich während seiner Freizeit gestört worden, in der er außerhäusigen Hobbys frönte.
Crawford war mit drei Pappbechern Kaffee in der Hand aufgekreuzt, gerade als Monica die Leichenhalle hatte verlassen wollen. Wie überaus praktisch. So hatte er eine gute Ausrede gehabt, um sich den halb verwesten, verstümmelten Leichnam nicht ansehen zu müssen.
»Typisch Highlands«, gab Monica schließlich zurück. Sie wusste mittlerweile, dass Crawford selbst in einer abgeschiedenen Gegend an der Westküste aufgewachsen war, doch schien er im Lauf der Jahre eine Mischung aus Furcht und Abscheu gegenüber allem nicht Urbanen entwickelt zu haben. Schon des Öfteren hatte sie sich gefragt, warum er sich nicht gleich nach London oder in den Speckgürtel von Schottland hatte versetzen lassen. Das hätte sehr viel besser zu ihm gepasst.
Angestrengt starrte er auf das spiegelglatte schwarze Wasser und zuckte mit den Schultern. »Mein Grandad hat immer gesagt, dass man Teile der Highlands nachträglich ein zweites Mal zum Christentum bekehren müsste. Dass die Menschen in den entlegeneren Regionen nach und nach zum Heidentum zurückgekehrt seien. Ständig warnte er vor der Gefahr des Aberglaubens. Ich habe als Kind jedes Mal eine Gänsehaut bekommen.« Er verschränkte die schmalen Arme vor der Brust, als müsste er sich vor dieser Vorstellung und der kriechenden Kälte zugleich schützen.
Monica zog ihren Mantel enger um sich und nahm einen Schluck vom lauwarmen Kaffee. Es war ihr zweiter, er war eigentlich für DC Fisher bestimmt gewesen. Nun ja, wenn er nicht auftaucht … Erst jetzt kam ihr in den Sinn, Crawford nach seinem Verbleib zu fragen. »Hat Ben Fisher sich eigentlich bei Ihnen gemeldet?«
Ihr junger Kollege starrte weiter wie gebannt aufs Wasser. »Warum hätte er ausgerechnet mich anrufen sollen? Sie wissen doch, wie er ist. Vermutlich liegt er gemütlich im Bett und liest irgendeine leichte Lektüre. So etwas wie das Handbuch für leitende Ermittler. Nur um Sie zu beeindrucken«, gab er flapsig über die Schulter zurück. Für einen flüchtigen Moment tauchte Fisher vor ihrem geistigen Auge auf, aufrecht im Bett sitzend, die dunklen Haare zu einem perfekten Seitenscheitel frisiert, die Brille auf der Nase und im frisch gewaschenen Pyjama statt des üblichen gut sitzenden Anzugs. Und dabei arbeitete er verschiedene theoretische Fallbeispiele durch, während er den aktuellen und überaus realen Fall verpasste. Diese Vorstellung entlockte Monica ein leichtes Schmunzeln. Crawford ließ sie dabei aber keine Sekunde aus den Augen. Sie glaubte nämlich genau zu spüren, dass er mehr wusste, als er zugeben wollte. Immerhin hatte er ein besonderes Talent dafür, Informationen aus anderen herauszuquetschen.
»Ich möchte nicht in diese trübe Suppe abtauchen müssen. Da sieht man ja die Hand vor Augen nicht.« Crawford deutete mit dem Kinn auf das Gewässer. Monicas Blick folgte wieder dem gespenstischen wellenförmigen Licht der Taucher tief unter der Oberfläche. Es wirkte übernatürlich, wie Feenglanz aus einer jenseitigen Welt. Monica malte sich die beklemmende Schwärze dort unten aus und schauderte. Ob Crawford aus Erfahrung sprach? Sie glaubte, sich entfernt zu erinnern, dass er von einem Tauchurlaub erzählt hatte. Hatte er nicht nach versunkenen Schiffswracks getaucht? Irgendwo im Mittelmeer?
»Wir müssen es wenigstens versuchen«, sagte sie schließlich. Falls Crawford wirklich etwas über Fishers Verbleib wusste, ließ er es sich nicht anmerken. Außerdem würde er sein Wissen garantiert nicht mit ihr teilen.
»Haben wir es mit organisiertem Verbrechen zu tun?«
»Das liegt natürlich nahe. Zumal wir bislang nichts über das Opfer wissen. Männlich, mittleren Alters, eher groß und korpulent.« Einige der aufsehenerregendsten Fälle, an denen Monica gearbeitet hatte, waren Bandenverbrechen in London oder Glasgow gewesen. Grausamkeiten wie brutalste Folter und sadistische Amputationen standen da an der Tagesordnung. Doch irgendetwas sagte ihr, dass das in dieser Sache nicht zutraf.
»Die Frage ist nur: Warum haben die den Toten nicht gleich ganz verschwinden lassen? Sie hätten ihn doch überall vergraben können.« Mit einer vagen Geste deutete Crawford auf die dunklen Wälder ringsum. Er joggte jetzt auf der Stelle, um sich warm zu halten, weil seine Jacke und der Anzug sich bei dem eisigen Wetter als ungeeignet erwiesen.
»Vielleicht wollte man, dass er gefunden wird? Vielleicht …« Noch bevor Monica den Gedanken zu Ende führen konnte, spürte sie, wie ihr Handy in der Manteltasche vibrierte. Es war eine unbekannte Nummer, deshalb meldete sie sich mit einem knappen »DI Kennedy«. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war ihr zu ihrer Überraschung vertraut, doch hatte sie nicht erwartet, sie je wiederzuhören. Sie war wie ein Echo aus ferner Vergangenheit.
5
Annabelle glaubte, die Finsternis um sich herum regelrecht greifen zu können. Langsam schlug sie die Augen auf und blinzelte mehrfach. Mit jedem weiteren Wimpernschlag wuchs ihre Panik, denn die Dunkelheit wollte nicht weichen. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht.
Für den Bruchteil einer Sekunde regte sich in ihr die leise Hoffnung, sie möge zu Hause in ihrem Bett liegen, bei geschlossenen Jalousien. Es ist mitten in der Nacht. Du musst schlecht geträumt haben. Eigentlich klang diese Erklärung plausibel. Doch nach und nach gewann die Realität die Oberhand, und ein Bild schob sich in ihr Bewusstsein: von einer Landkarte mit Bergen und Seen. Wenig später kehrten auch die restlichen Erinnerungen zurück. An das Tor. Die Straße. Das kleine Mädchen. Den Unfall.
Du bist blind, deshalb siehst du nichts! Irgendetwas ist mit deinen Augen!
Bei diesem Gedanken jagte ihr das Adrenalin durch die Adern. Sie versuchte, sich aufzurichten, wurde aber von unsäglichen Schmerzen übermannt. Sie gingen von ihrem rechten Bein aus.
»Hilfe! Bitte, jemand muss mir helfen!«, schrie sie und versuchte verzweifelt, den anbrandenden Höllenqualen auszuweichen. Doch sie spülten gnadenlos über sie hinweg, bis ihr heiße Tränen über die Wangen flossen.
Lange Zeit war da nichts als der unerträgliche Schmerz. Nur allmählich klang er ab, bis Annabelle wieder klar denken konnte und feststellte, dass ihr Kopf zwar pochte wie bei der schlimmsten Migräne, sie aber dort, wo ihre Augen sein müssten, nichts spürte. Sie verhielt sich völlig ruhig und versuchte zu blinzeln. Immer noch kein Schmerz. Vorsichtig hob sie beide Hände zum Gesicht und tastete nach ihren Augäpfeln. Alles schien in Ordnung zu sein. Langsam schlug sie die Lider wieder auf und starrte in die undurchdringliche Dunkelheit.
Es herrschte tiefschwarze Nacht, deshalb konnte sie nichts sehen. Sie saß in ihrem Wagen fest, ihr Bein musste bei dem Unfall einen komplizierten Bruch erlitten haben. Das war die Erklärung. Und wenn sie sich in ihrem Auto befand, musste auch ihr Handy ganz in der Nähe sein. Nach und nach kamen die Einzelheiten zurück: wie sie die Hand nach dem Telefon ausgestreckt hatte. Und dann den Blick von der Fahrbahn genommen hatte. Wie hatte sie nur so unsagbar dumm sein können? Verzweifelt rang sie nach Luft und hob langsam den linken Arm. Fieberhaft tastete sie nach dem Lenkrad und nach anderen vertrauten Gegenständen. Doch sie bekam nichts als kalte Luft zu fassen.
Annabelle kämpfte gegen die aufs Neue aufwallende Panik an und versuchte es erneut. Diesmal bewegte sie ihre Hand nach rechts. Wenn sie wirklich im Auto festsaß, würde sie doch sicher irgendwo gegen die Tür stoßen. Dann könnte sie nach dem Griff tasten und sich neu orientieren.
Ihre Fingerkuppen streiften flüchtig über etwas Weiches. Sie wusste auf Anhieb, was es war. Teppich. Ein dicker Flokati, wie früher in ihrem Elternhaus. So einer hatte vor vielen Jahren in ihrem Zimmer gelegen. Wie war das möglich? Der Innenraum ihres BMWs war mit Leder und Kunststoff ausgekleidet, und auf dem Boden lag zwar Teppich, aber der fühlte sich völlig anders an. Als Annabelle die zitternden Finger zu ihrer Nase führte, nahm sie einen eigenartigen Geruch wahr. Irgendwie modrig. Ganz anders als ihr eigener Wagen. Der roch noch fabrikneu und frisch nach Zitrone.
Im nächsten Moment registrierten ihre überreizten Sinne etwas, das ihr längst hätte auffallen müssen: Sie lag auf dem Rücken. Warum saß sie nicht aufrecht auf dem Fahrersitz ihres Autos? Jäh drang die grausame Wahrheit, die sich ihr die ganze Zeit über entzogen hatte, mit aller Klarheit in ihr Bewusstsein. Sie fand weder Lenkrad noch Türgriff, weil sie sich nicht mehr in ihrem Wagen befand. Sie war irgendwo anders, an einem Ort, wo es dunkel war. Und das konnte nur eines bedeuten: Jemand hatte sie aus dem Unfallwrack befreit. Und sie dann hierhergebracht.
6
»Monica? Monica Kennedy? Bist du das?« Sie starrte immer noch auf die glatte Wasseroberfläche und folgte dem Licht der Tauchlampen. Angestrengt versuchte sie, die Stimme am Telefon einzuordnen.
»Wer spricht da?«
»Ich bin’s, Bill … Bill Macdonald.«
Monica zermarterte sich das Gehirn und durchsiebte unzählige Namen, die ihr während ihrer beruflichen Laufbahn begegnet waren. Verbrecher, die sie dingfest gemacht hatte, ehemalige Kollegen, Opfer, Zeugen. Der Mann sprach mit starkem Akzent, eindeutig Inverness. Sie wusste, dass sie ihn irgendwoher kannte. »Helfen Sie mir auf die Sprünge«, bat sie schließlich.
»Weißt du nicht mehr?«, fragte der Mann und klang beinahe ein wenig eingeschnappt, weil sie ihn nicht auf Anhieb erkannte. »Bill, Big Bill, aus dem Sumpf.«
Mit »Sumpf« war Rapinch gemeint, ein Stadtteil von Inverness, den die Allgemeinheit bevorzugt mied. Es war die Gegend, in der Monica selbst aufgewachsen war und wo ihre Mutter nach wie vor lebte. Bei diesen Worten wurde sie schlagartig dreißig Jahre in die Vergangenheit zurückkatapultiert, in ihre eigene Kindheit. Und in ihre persönliche Hölle, die Unterrichtsstunden für schottische Volkstänze, an denen jedes Schulkind ihrer Heimatstadt gezwungen war teilzunehmen. Sie war so gut wie immer eine der Letzten gewesen, die als Tanzpartnerin ausgesucht worden war. Mit ihrer außergewöhnlichen Körpergröße hatte sie auf die heranwachsenden Jungen einschüchternd gewirkt. Ganz anders Big Bill Macdonald. Bei den seltenen Gelegenheiten, da er teilgenommen hatte, hatte er mit seinem dichten blonden Haarschopf interessiert in ihre Richtung gespäht. Monica erinnerte sich noch lebhaft, wie froh sie damals gewesen war, sich zur Abwechslung nicht nach unten buckeln zu müssen, um ihrem Tanzpartner die Hand zu reichen. Dieses erleichternde Gefühl, einmal nicht die Größere zu sein. Wie sein Spitzname nahelegte, war er damals schon annähernd eins neunzig groß gewesen und hatte um die neunzig Kilo gewogen. Und das im dritten Highschooljahr. Bereits mit vierzehn hatte er das alte Triumph-Motorrad seines Dads gefahren und war in einer abgewetzten Bikerhose aus Leder in die Schule gekommen. Seine Hände waren immer schwarz und ölverschmiert gewesen. Er hatte ein Hell’s Angel werden wollen, genau wie sein Vater, und der war Mitglied diverser Motorradgangs gewesen, wenn man den Gerüchten glauben wollte. Die Familie hatte direkt um die Ecke von Monicas Elternhaus gewohnt. Manchmal hatte sie sich auf einen Plausch zu ihm gesetzt, während er in der elterlichen Einfahrt an seinem Bike herumgeschraubt hatte. Sie erinnerte sich an die sengenden Strahlen der Nachmittagssonne auf ihrem Rücken. Wie er gelegentlich zu ihr herübergespäht und sein Blick einen Tick zu lang auf ihren schlanken Beinen und den hübsch gerundeten Hüften verweilt hatte.
»Ich habe deine Nummer von deiner Mum. Wusste gar nicht, dass du wieder hier oben wohnst. Es ist bestimmt … wie lange? Mindestens zehn Jahre her?«
Zehn Jahre und ein paar zerquetschte, dachte Monica. Aber immer noch nicht lange genug. Wenn sie wegen Lucy nicht auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen wäre, wäre sie garantiert sehr viel länger fortgeblieben. Unwillkürlich musste sie an die entscheidende Szene mit ihrem Vater zurückdenken, damals, als sie ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt hatte. Ihre Blicke waren sich in beiderseitigem Entsetzen begegnet, während der eiskalte Regen ihnen ins Gesicht geklatscht war. Im Jahr 2000 war das gewesen, zu Beginn des neuen Millenniums. Sie war in ihren Wagen gestiegen, einfach drauflosgefahren und hatte kein Wort mehr mit ihm gesprochen, bis sie ihn auf dem Totenbett wiedergesehen hatte. Zwölf Jahre später war das gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war seine Krankheit zum Glück bereits so weit fortgeschritten gewesen, dass an ein klärendes Gespräch nicht mehr zu denken gewesen war. Nun also wieder einmal ihr Dad. Seit diesem letzten Fall im Herbst wurde sie das Gefühl nicht los, dass er ständig durch ihre Gedanken geisterte, sie nachts in ihren Träumen heimsuchte. Inverness und die Straßen, durch die sie als Kind so gern mit ihm spaziert war … Heutzutage lief sie dieselben Straßen mit Lucy entlang. Die ganzen alten Erinnerungen schienen plötzlich wie lebendige Kreaturen zu erwachen und ihre Köpfe zu heben.
Jetzt warf sie einen Blick zu Crawford, um sich von diesen Gedanken loszureißen. Er saß auf dem Beifahrersitz in ihrem Volvo und wischte sich auf einem iPad durch eine Reihe von Fotos, die den noch nicht identifizierten Leichnam zeigten, bevor er aus dem Wasser geholt worden war. Darauf war gut zu erkennen, wie der aufgedunsene Körper sich in den ins Wasser hängenden Ästen verfangen hatte. Direkt neben der kleinen Fischerhütte. Als hätte der Leichnam regelrecht darauf gewartet, entdeckt zu werden. Erst jetzt kam ihr der Gedanke, dass vielleicht sogar jemand ihn eigens dort platziert hatte, damit man ihn fand.
»Was kann ich für dich tun, Bill?« Sie wollte diesen Anruf und die dadurch geweckten Erinnerungen so schnell wie möglich hinter sich bringen und sich wieder dem Fall widmen. Wenn ein alter Bekannter sie kontaktierte, bedeutete das in der Regel, dass derjenige in der Klemme steckte und der Meinung war, sie als Detective könnte ihn irgendwie raushauen. Sie erinnerte sich düster an den jüngsten Klatsch, den ihre Mutter ihr über Bill und seine Familie erzählt hatte. Hatte er nicht einen Sohn? Und der hatte irgendwelchen Ärger wegen Drogen?
Doch als Bill sein Anliegen vorbrachte, stellte sich heraus, dass der Anruf rein gar nichts mit ihm und seiner Familie zu tun hatte.
»Ich hab hier in meiner Bar einen Typen sitzen, der macht Ärger … Er hat dich erwähnt. Meinte zu mir, er würde dich kennen, dass ich dich anrufen und dir ausrichten soll, du sollst ihn holen kommen.«
Wie üblich am Sonntagabend war im Zentrum von Inverness nicht viel los. Monica parkte ihren Volvo auf der Huntly Street gleich neben der Ness Bridge, schräg gegenüber vom Inverness Castle, einem roten Backsteinriesen, der vor dem nächtlichen Himmel hell erstrahlte. Der Schein der Straßenlaternen spiegelte sich im dunklen Fluss. Monica ertappte sich dabei, wie sie einen Moment hinunterstarrte und sich fragte, ob die Arme des Toten auf die andere Seite des Staudamms gelangt sein könnten und nun irgendwo dort unten trieben. Und sich auf ihrem Weg zum Meer ans eisige Nichts klammern wollten. Bei dieser Vorstellung überlief sie ein Schauer. Allerdings gab es keine Verbindung zwischen Ness und Beauly, wie sie sich jetzt ins Gedächtnis rief.
»Immer gibt es Zoff in diesem Pub.« Crawfords Stimme durchbrach ihre Gedanken. Er deutete auf die abweisende Fassade des Lokals, zu dem Bill Macdonald sie gelotst hatte. The Clach. Sie überquerten die Straße und hielten auf den Eingang zu. Monica rüttelte am Türgriff. Abgeschlossen. Durch die blickdichte Scheibe auf Kopfhöhe fiel schwaches gelbliches Licht. Sie hämmerte entschlossen gegen die Tür.
Im nächsten Moment war ein Summer zu hören, und als sie gegen das Türblatt drückte, ertönte ein Klicken. Die üblichen Pubgerüche schlugen ihnen entgegen: halb verflogenes Rasierwasser, abgestandenes, verschüttetes Bier und die verschiedensten Körperausdünstungen. Monica trat ein, dicht gefolgt von Crawford, und ließ den Blick durch den zwielichtigen Raum und die vielen Reihen von Flaschen hinter der Theke schweifen. In der Ecke blinkte unbeeindruckt ein Einarmiger Bandit. Direkt neben dem Spielautomaten saß ein Mann auf einer Bank. Vornübergebeugt, den Kopf in die Hände gestützt. Monica trat zögernd auf ihn zu. Er hatte dunkle Haare und trug ein hellblaues Hemd, das am Kragen eingerissen war.
»Fisher?« Monica versuchte gar nicht erst, ihre Verwunderung zu verbergen. Langsam sah der jüngere Kollege zu ihr auf. Die sonst so ordentlich frisierten Haare standen ihm wirr vom Kopf ab. Ein roter Fleck prangte auf seiner Wange. Von der Brille, die er normalerweise auf der Nase trug, keine Spur. Monica war davon ausgegangen, dass Bill Macdonald sie wegen irgendeines Kleinkriminellen aus dem Sumpf kontaktiert hatte. Jemand, der ihr in der Vergangenheit Informationen in der Hoffnung zugespielt hatte, die Bekanntschaft mit einem echten Detective würde ihn irgendwann aus einer misslichen Lage retten oder gar vor dem Gefängnis bewahren. Auch wenn es sie erstaunt hatte, dass Ben Fisher nicht zur Leichenhalle gekommen war, wäre Monica nie auf die Idee gekommen, dass der junge Detective Constable derart in der Klemme stecken könnte. Schließlich war er normalerweise derart korrekt und brav, dass er nie einen Pub betreten, geschweige denn auch nur einen Tropfen Alkohol angerührt hätte. Da erschien ihr die Vorstellung, dass er zu Hause begeistert im Handbuch für leitende Ermittler blätterte, schon um einiges plausibler. Jetzt musste sie jedenfalls zweimal hinsehen, um ganz sicher zu sein, dass es wirklich Fisher war. Sie blickte sich kurz zu Crawford um und registrierte seine verblüffte Miene. Ratlos schüttelte er den Kopf und strich sich mit der Hand durch die roten Haare.
»Ich habe zwar mitbekommen, dass er in letzter Zeit öfter was trinken geht … aber dass es so schlimm steht …«, sagte der Detective, als müsste er sich verteidigen. Monica wandte sich wieder Fisher zu und stieß einen verhaltenen Fluch aus. Darauf, dass einer ihrer zuverlässigsten Ermittler ausgerechnet in der entscheidenden Anfangsphase eines neuen Mordfalls eine persönliche Krise durchlief, konnte sie gut und gerne verzichten. Zumal sie selbst erst seit heute wieder im Dienst war, nach einem halben Jahr Auszeit. Sie war längst noch nicht zu hundert Prozent belastbar. Bis sie wieder in gewohnter Form wäre, würde noch eine Weile vergehen.
»Was um alles in der Welt ist passiert, Fisher?« Der Schock, ihn hier so zu sehen, ließ Monica ihre übliche Besonnenheit vergessen.
»Er ist mit einem von den MacFarlanes aneinandergeraten.« Monica drehte sich nach der tiefen Stimme um. Sie kam von dem Mann hinter dem Tresen. Big Bills breites Gesicht hatte nichts von seiner Jungenhaftigkeit eingebüßt, dabei war seit ihrer letzten Begegnung mehr als ein ganzes Jahrzehnt vergangen. Seine blonden Haare waren kein bisschen schütter geworden. »Er hat ihm einen Fausthieb verpasst und dann geschworen, dass er ihn umbringen würde.«
»Die MacFarlanes?«, wiederholte Monica verständnislos. Diese Leute waren polizeibekannt, eine richtige Problemfamilie. Ein Überbleibsel des alten Clansystems, wie es überall in den schottischen Highlands noch vereinzelt existierte, selbst zweihundertfünfzig Jahre nach Culloden: Vertreter einer nicht totzukriegenden Stammesmoral und der keltischen Vorliebe, wilde Saufgelage abzuhalten.
Bill nickte. Er trug eine schwarze Lederjacke, die seinen kräftigen Körperbau betonte. Alles in allem war er eine einschüchternde Erscheinung. Jetzt fielen ihr auch die beiden anderen Gäste auf, vermutlich Freunde von Bill; sie trugen ähnliche Jacken. Beim Eintreten hatte sie die Männer nicht gesehen, weil sie ein Stück abseits saßen.
»Sie wollten ihm den Schädel einschlagen und ihn am Ferry Point ins Wasser werfen.«
Bedächtig bewegte Monica den Kopf hin und her. Kurzzeitig vergaß sie sogar ihren Zorn auf DC Fisher und war einfach nur grenzenlos erleichtert, dass es in diesem Pub geschehen war, im Beisein von Bill. Fisher hatte großes Glück gehabt, dass er hier gelandet war. Sonst läge er jetzt im Krankenhaus oder, schlimmer noch, in der Leichenhalle. Allerdings erhielt ihre Erleichterung sofort einen Dämpfer. Denn ihr war klar, dass die MacFarlanes ihn von nun an im Auge behalten würden. Keiner legte sich unbehelligt mit diesen Typen an. Natürlich würden sie nicht scharf darauf sein, es mit der Polizei zu tun zu bekommen, aber Fisher musste sich darauf gefasst machen, dass sie sich früher oder später an ihm rächen würden. Vielleicht nicht unbedingt in absehbarer Zeit, aber garantiert spätestens dann, wenn er die Sache wieder vergessen hatte.
»Was für ein Schlamassel«, entfuhr es Monica, und sie ging in die Hocke, um Fisher genauer in Augenschein zu nehmen. Die Knöchel an seiner rechten Hand waren geschwollen und blutverschmiert. An seiner rechten Wange blühte ein leuchtendes Veilchen in Gelb und Violett. Sehr wahrscheinlich von einem linkshändigen Angreifer, wie sie fast automatisch zur Kenntnis nahm. Der junge Detective starrte auf den schmutzstarrenden Boden und wich beharrlich ihrem Blick aus. »Wie kam es dazu?«, fragte sie an Bill gewandt, ohne Fisher aus den Augen zu lassen.
»Ach, du weißt schon, das Übliche. Dein Freund da hat den ganzen Nachmittag hier gesessen und getrunken. Irgendwann fing er an, die anderen Gäste anzupöbeln. Drohte damit, sie alle hinter Gitter zu bringen.«
Monica warf Crawford einen verstohlenen Blick zu. Was Bill da erzählte, reichte locker aus, um einem Kollegen fristlos zu kündigen. Plötzlich hatte sie das unergründliche Gefühl, dass die Geschehnisse des Tages irgendwie zusammenhingen: ihr Anfall von Paranoia in diesem Burger King, der Tote in der Leichenhalle und jetzt das hier. Ein würdiger Abschluss für einen der beschissensten Sonntage seit Langem. Das alles ergab nur überhaupt keinen Sinn. Nichts in seinem Leben war Fisher wichtiger als sein Job. Die Polizei war für ihn so etwas wie eine Ersatzfamilie. Auf den ersten Blick schien er die schrecklichen Ereignisse ihres letzten Falls von allen am unbeschadetsten überstanden zu haben, zumal er sich mit seinem unermüdlichen Einsatz als einer der vielversprechendsten Anwärter auf eine Beförderung hatte profilieren können. Warum sollte ausgerechnet er eine solche Dummheit begehen?
7
Annabelle musste trotz der höllischen Schmerzen irgendwann vor Erschöpfung in den Schlaf gesunken sein, denn im Traum war sie wieder in London. Sie überquerte die London Bridge auf dem Weg zu einer Party, die in einem sonderbaren viktorianischen Tanzsaal stattfand. Es war die Art von Lokalität, bei der man ganz bewusst auf den Shabby-Look setzte, mit umgedrehten Bierkisten als Tischen und mit Sitzsäcken statt Stühlen. Dort war sie mit jemandem verabredet. War es ihre Mum oder ihr Dad?
Neugierig sah sie sich um. Überall standen Grüppchen von Leuten beisammen, die sich in der hippen Umgebung allesamt pudelwohl zu fühlen schienen. Als fänden sie nichts dabei, sich perfekt gestylt in Pose zu werfen wie für ein Instagram-Foto. Hauptsache, man bekam ausreichend Herzchen dafür. Doch dann bewegte sich aus einer Ecke des Raums ein Schatten auf sie zu. Unbeirrt, aber ohne Eile überquerte er den schmutzigen Holzboden, stieg über Sitzsäcke und Bierkistentische hinweg. Er hatte etwas Zerstörerisches, einen Hauch von Verderbtheit an sich.
Annabelle nahm eine andere Haltung ein. Versuchte, möglichst lässig zu wirken, so wie sie es für all die Gelegenheiten, bei denen sie vor dem Hörsaal an der Uni warten musste, einstudiert hatte: die eine Hüfte seitlich leicht vorgeschoben, das Handy auf Armeslänge von sich gestreckt, als würde sie nur einen beiläufigen Blick darauf werfen und es nicht zwanghaft nach neuen Nachrichten überprüfen.
Ihr Bein begann zu pulsieren, als der Schatten sich ihr näherte. Immer heißer fühlte es sich an, bis Annabelle es nicht mehr aushielt: Sie musste es sich ansehen. Verwundert stellte sie fest, dass man um ihr rechtes Bein herum ein schwarzes Zelt errichtet hatte. Und dann spürte sie zu ihrem Schrecken, wie sich in ihrem Inneren etwas regte. Das schmerzhafte Pulsieren wurde stärker, und Annabelle schrie aus Leibeskräften. Verzweifelt sah sie sich um und flehte um ein Wunder. Hoffte, ihre Mum oder ihr Dad würden herbeieilen und ihr helfen. Die anwesenden Gäste hatten sich allesamt von ihr abgewandt. Aber es waren ohnehin nur Wachspuppen, wie sie nun registrierte. Reglos standen sie in ein gespenstisches orangefarbenes Licht getaucht da.
Schweißgebadet fuhr sie aus dem Schlaf hoch, und sofort durchzuckte sie ein lähmender Schmerz, ausgehend von ihrem gebrochenen Bein. Versuch, ruhig und gleichmäßig zu atmen, mahnte eine innere Stimme. Genau wie dein Therapeut es dir geraten hat, als das mit den Panikattacken anfing. Es war der lächerliche Versuch, gegen den überwältigenden Cocktail aus Schmerz und Angst anzukämpfen, aber sie hatte kaum eine Wahl. Also kniff sie die Augen zu und atmete langsam und tief ein und aus. Nach einer Weile stellte sie fest, dass die Stimme in ihrem Kopf tatsächlich richtiglag: Der Schmerz war abgeklungen.
Doch nun trat schleichend die Furcht an seine Stelle. Die Erinnerung an diesen Flokati unter ihren Fingerkuppen. Genau wie der in ihrem früheren Kinderzimmer, nur alt und modrig. Wo war sie? Wer hatte sie hierhergebracht? Es konnte ja unmöglich derselbe Teppich sein. Sie lebte seit über zehn Jahren nicht mehr in ihrem Elternhaus. Es war Hunderte von Kilometern entfernt von den schottischen Highlands. Außerdem hatten ihre Mum und ihr Dad sich vor Jahren im Streit getrennt und daraufhin scheiden lassen. Dennoch wurde sie das eigenartige Gefühl nicht los, in dieses stille Zimmer zurückversetzt worden zu sein, in dem sie viele einsame Stunden mit ihren Spielsachen verbracht hatte. Zusammen mit all den simplen, seltsamen Wahrheiten, die es sie gelehrt hatte.
Ein Geräusch durchdrang ihre fieberhaften Gedanken. Ein Körper, der sich bedächtig auf einem Stuhl bewegte. Die Antwort war ein sachtes Knarzen. Annabelle war wie gelähmt; sie hatte den Atem angehalten. Dann vernahm sie ein leises Zischen, als atmete jemand aus. Sie war nicht allein in diesem Zimmer. Bestimmt war es derjenige, der sie aus dem Auto gezerrt und hierhergebracht hatte.
Eiskalte Panik packte sie wie eine rasch anschwellende Flutwelle und riss sie mit sich fort. Zögernd schlug sie die Augen auf. Statt von undurchdringlicher Dunkelheit war sie diesmal von einem gräulichen Zwielicht umgeben. Sie blickte an die glatte Betondecke über sich. Nach wie vor hatte sie Schwierigkeiten zu begreifen, dass all das real war. Ein Wimmern musste über ihre Lippen gekommen sein, denn jetzt knarzte der Stuhl erneut.
»Psst … Hier bist du in Sicherheit.« Der Sprecher erhob sich und kam näher, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Betrachte diesen Ort als dein neues Zuhause.«
8
Auf dem hübschen Gesicht von Monicas Mutter lag ein nervöser Ausdruck, als sie sich über den Küchentresen beugte und ihre Tochter ansah.
»Ich dachte, es sei ein Notfall – er meinte, er müsse dich beruflich sprechen.« Angela Kennedy schüttelte ihr dichtes graues Haar, während sie von Bill Macdonalds nächtlichem Anruf erzählte. Seit Monica vom Duschen zurück war, versuchte sie, sich zum wiederholten Mal zu rechtfertigen.
Am Abend zuvor hatte Monica beschlossen, lieber bei ihrer Mutter auf dem Sofa zu schlafen, statt nach Hause in ihre eigene Wohnung zu fahren. In den vergangenen sechs Monaten war das zu einer Gewohnheit geworden. Hier hatte sie einen sehr viel leichteren Schlaf, der ihr erheblich seltener Albträume bescherte, und dass sie sich vollständig bekleidet hinlegte, brachte ihr einen entscheidenden Vorteil: So war sie jederzeit bereit, vor Ungeheuern zu fliehen, die durch Fenster oder Türen eindrangen.
Monica rieb sich den Nacken, um die schmerzhafte Verspannung darin zu lösen. Das Sofa ihrer Mutter war leider noch unbequemer als ihr eigenes. Aber wenigstens konnte sie so zusammen mit Lucy frühstücken – ihre Tochter hatte bereits tief und fest geschlafen, als Monica am Vorabend hergekommen war. Sie hatte sie nicht wecken und mit nach Hause nehmen wollen.
Seit ihrer Rückkehr nach Inverness kurz nach Lucys Geburt hatte Monica sich lange Zeit bemüht, ihre Besuche in Rapinch auf ein Minimum zu beschränken. Wegen all der üblen Erinnerungen an ihre frühe Zeit als Polizistin, als die Sache mit ihrem Vater so heftig aus dem Ruder gelaufen war. Außerdem hatte sie nicht eben das Bedürfnis, den vielen bekannten Gesichtern aus ihrer Vergangenheit zu begegnen. An diesem Morgen aber bereute sie ihre Anwesenheit hier noch aus einem anderen Grund: Ihre Mutter hatte wieder einmal angefangen, unangenehme Fragen zu stellen. »Ich dachte, es könnte vielleicht mit diesem neuen Fall zu tun haben. Dass er irgendwelche Infos hätte.«
Schön wär’s, ging es Monica durch den Sinn. Sie wählte ihre folgenden Worte mit Bedacht, weil sie sich sehr wohl bewusst war, dass ihre Mutter solche Dinge jederzeit beim nächsten Supermarkttratsch weitererzählen konnte. Oder sie anonym im nächsten Online-Forum verbreiten würde. Ihre Mum diskutierte nämlich liebend gern mit Wildfremden im Internet über ihre Lieblingsthemen: wahre Verbrechen, Polizeiserien im Fernsehen und Krimis.
»Es war nichts Ernstes, nur eine harmlose Schlägerei in der Bar, die er managt.« Monica konnte sich bereits lebhaft vorstellen, wie ihre Mutter ihre eigenen Ermittlungen aufnahm. Und wenn sie das nächste Mal beim Friseur saß und sich die Haare machen ließ, tauschte sie sich mit ihren Freundinnen garantiert über ihre neuesten Erkenntnisse aus.
Was zum Teufel hatte sich Fisher nur gedacht? Als sie den jungen Detective am Vorabend nach Hause gefahren hatte, hatte sie sich im Auto zu ihm umgedreht und ihm genau diese Frage gestellt, während Crawford auf dem Beifahrersitz betreten zur Windschutzscheibe hinausgestarrt hatte, als hätte er nichts mitbekommen, um seinem Kollegen die Blamage zu ersparen. Fisher aber hatte sie nur mit unbewegter Miene angesehen.
»Ich hatte ganz vergessen, was zu essen … Ist alles nicht so einfach, seit diesem Fall im letzten Jahr.« Er hatte ein klägliches Lachen von sich gegeben. »Und ein paar Frauenprobleme habe ich auch.«
Monica hatte seinen Blick erwidert. Sie hatte nach wie vor Schwierigkeiten, all das mit der bebrillten, spießigen Version von DC Ben Fisher in Einklang zu bringen, einem Mann, der sich für seine gute Arbeit als Detective ihren Respekt redlich verdient hatte. Ihr war natürlich bewusst, welch tiefe Wunden der Fall, auf den er anspielte, bei ihrem Team hinterlassen hatte, doch im Vergleich zu ihr selbst und zu Crawford schien Fisher noch glimpflich davongekommen zu sein. Zumindest machte es nach außen hin den Anschein. Vielleicht warst du zu blauäugig?