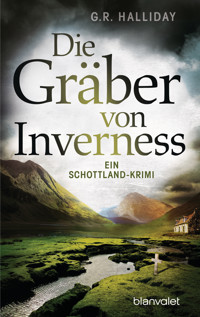7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Monica Kennedy
- Sprache: Deutsch
Mörderische Highlands! Auftakt der neuen spektakulären Krimireihe aus Schottland!
Inverness, Schottland: Der wunderschöne idyllische Landstrich wird von einem schrecklichen Verbrechen erschüttert. In den schottischen Highlands wird die Leiche des 16-jährigen Robert gefunden. Er wurde von seinem Mörder sorgfältig drapiert, in seiner Luftröhre findet sich ein schwarzer Stein. DI Monica Kennedy ist eine erfahrene Ermittlerin, doch dieser Fall geht ihr an die Nieren. Ihr Instinkt sagt ihr, dass dies erst der Anfang ist. Und sie soll recht behalten. Denn im Dunklen verborgen lauert der Killer – und beobachtet und wartet …
Alle Bücher der Monica-Kennedy-Reihe
Die Toten von Inverness (Bd. 1)
Die dunklen Wasser von Inverness (Bd. 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Inverness, Schottland: Der wunderschöne idyllische Landstrich wird von einem schrecklichen Verbrechen erschüttert. In den schottischen Highlands wird die Leiche des 16-jährigen Robert gefunden. Er wurde von seinem Mörder sorgfältig drapiert, in seiner Luftröhre findet sich ein schwarzer Stein. DI Monica Kennedy ist eine erfahrene Ermittlerin, doch dieser Fall geht ihr an die Nieren. Ihr Instinkt sagt ihr, dass dies erst der Anfang ist. Und sie soll recht behalten. Denn im Dunklen verborgen lauert der Killer – und beobachtet und wartet …
Autor
G. R. Halliday wurde in Edinburgh geboren und wuchs in der Nähe von Stirling, Schottland, auf. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er damit, seinen Vater zu beobachten, wie dieser ungeklärte Geheimnisse untersuchte. Davon fasziniert, wurden einige dieser Geschichten zur Inspirationsquelle für seinen Debütroman. Heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin und einer Bande halbwilder Katzen in der Nähe von Inverness in den schottischen Highlands.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
G. R. Halliday
Die Toten von Inverness
Ein Schottlandkrimi
Deutsch von Bettina Spangler
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »From the Shadows« bei Harvill Secker, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © Highland Noir Ltd 2019
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: © Favoritbuero, München
Umschlagmotive: © Adam Burton/Photolibrary/Getty Images; Helen Hotson/Shutterstock.com
JaB · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24613-6V001
www.blanvalet.de
Für Sarah
Freitag
1
Am herbstlichen Nachthimmel über den Wester Ross Mountains waren die ersten Sterne erschienen, doch Robert nahm keine Notiz davon. Er hielt den Kopf gesenkt, während er sein Fahrrad in die dunkle Garage schob. Dann trat er ins Freie, schlug die Tür hinter sich zu und rannte fröstelnd zum hell erleuchteten Hauseingang. Der anderen Person allerdings, die ihn aus den Schatten der Bäume heraus beobachtete, fielen die Sterne sehr wohl auf. Für sie bestand kein Zweifel daran, dass sie ein Zeichen des Himmels waren.
An der Schwelle zögerte Robert kurz, um nach dem Handy in seiner Tasche zu tasten. Nur zu gern hätte er die Nachrichten gleich noch einmal gelesen.
Stammten sie wirklich von seiner Mum? Das ergab doch keinen Sinn. Und das Telefon – es war mit Klebeband am Lenker seines Mountainbikes befestigt gewesen, als er sich am Morgen auf den Weg zur Schule hatte machen wollen. Das war noch viel eigenartiger. Andererseits war nichts mehr, wie es war, seit sie fortgegangen war. Als wäre seine Welt komplett aus den Angeln gehoben. Robert klopfte die Tasche seiner dunkelblauen Jeans ab. Zwanghaft prüfte er zum wiederholten Mal, ob das Telefon noch da war. Er zog die Hand zurück und verkniff es sich, es hervorzuholen. Nicht, dass sein Dad noch etwas mitbekam und Fragen stellte. Schließlich war es seine Schuld, dass sie weg war, oder nicht? Irgendwie musste er sie vergrault haben.
Robert drückte die Haustür auf. Seit Wochen schon schloss sein Vater nicht mehr ab. Offenbar hoffte er nach wie vor, dass sie zurückkommen würde. Was bringt ihn nur auf den Gedanken? Im Haus war ein Geräusch zu hören, ein leises Rascheln, als hätte sich auf dem alten Sofa jemand umgedreht. Er stellte sich vor, wie sein Vater hoffnungsvoll den Kopf in die Höhe reckte und in die Stille hineinlauschte.
»Ich bin’s«, rief Robert, eine Hand bereits am Treppengeländer.
»Ich hatte dich eigentlich gleich nach der Schule zurückerwartet.« Die Stimme seines Dads verriet, was für ein Schwächling er war. Einfach nur erbärmlich. »Du bist erst sechzehn. Ich hatte dich doch gebeten anzurufen und Bescheid zu geben, dass alles gut ist.«
»Ja und? Du wirst es überleben.« So ein Weichei. Kein Wunder, dass Mum ihn verlassen hat. Ehe Robert diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, kam ihm ein noch viel schrecklicherer Verdacht: Was, wenn es ganz anders war? Was, wenn sie seinetwegen gegangen war?
Nein, das kann nicht sein.
Er schloss die Hand um das Telefon in seiner Tasche. Das hier war Beweis genug. Sie hatte ihn um ein Treffen gebeten. Warum hätte sie das tun sollen, wenn sie seinetwegen gegangen wäre? Andererseits hatte seine Mutter ihn noch nie Robert genannt. Immer Robbie oder Rob. Was sollte das plötzlich? Ratlos strich er sich über die kurzen braunen Haare. Er sollte mit seinem Dad reden, ihn lesen lassen, was sie geschrieben hatte. Vielleicht hatte sie … Robert wusste nicht recht, wie er es nennen sollte … einen Nervenzusammenbruch oder eine Depression?
Er klammerte sich an dieser Vorstellung fest, ein winziger Hoffnungsschimmer. Das würde alles erklären. Warum sie gegangen war, die sonderbaren Nachrichten. Vermutlich schämte sie sich und machte sich Gedanken, was sein Dad und er von ihr dachten. Robert malte sich aus, wie er ihr zärtlich die Hand auf die Wange legte und sie tröstete. Schon gut, Mum, wir sind für dich da. Er wandte sich in Richtung Wohnzimmer, blieb dann aber wie angewurzelt stehen, als er die erstickten Laute aus dem Inneren des Raums wahrnahm. Eine nie gekannte Angst gesellte sich zu den anhaltenden Magenschmerzen, als ihm bewusst wurde, was er da hörte: Sein Vater weinte. Möglichst leise wandte er sich ab und schlich nach oben zu seinem Zimmer, das direkt am Treppenabsatz lag.
Er war aufgewühlt und durchlebte ein Wechselbad der Gefühle. Das alles schlug ihm gewaltig auf den Magen. Er fühlte sich gleichzeitig alt und ausgelaugt, jung und kraftlos.
Als er die Tür öffnete, nahm er ganz schwach einen fremden Geruch wahr. War es ein Parfüm? Das seiner Mum? Robert schüttelte unwillkürlich den Kopf – reines Wunschdenken. Die trippelnden Schritte von Ellie, seinem Hund, ließen ihn aufhorchen. Er drehte sich um. Sie war ein schon in die Jahre gekommener Schottischer Hirschhund mit strubbeligem grauem Fell, das ihr tief in die Stirn hing. Die Hündin schnupperte kurz an Roberts Bein, dann drängte sie sich an ihm vorbei ins Zimmer. Er strich ihr über das Fell und sah zu, wie sie ein wenig ungeschickt auf sein Bett sprang. Langsam drehte sie sich mit ihrem langen, sehnigen Leib um die eigene Achse und ließ sich auf die Decke sinken.
Robert trat ein, stieß die Tür hinter sich zu und ließ seine Tasche achtlos auf den Boden fallen. Er hatte Hausaufgaben zu erledigen und musste sich auf die Prüfungen vorbereiten. Kurz warf er einen Blick auf den sträflich vernachlässigten Lernplan, der an der Wand gegenüber hing. Bevor seine Mum sie verlassen hatte, war er ein eifriger und fleißiger Junge gewesen. Er hatte so viel Wissen wie nur möglich in sich aufgesaugt, um irgendwann aus Wester Ross wegzukommen. In diesen nordwestlichen Teil der schottischen Highlands und speziell in ihre Gegend kamen Touristen in erster Linie zum Bergwandern. Oder um die Strände zu besuchen. Wie Robert gehört hatte, sollte es sogar Leute geben, die eigens herkamen, um fernab jeglicher künstlichen Beleuchtung am nächtlichen Himmel die Sterne und Planeten zu beobachten. Die hatten ja keine Ahnung, wie es war, in einem derart gottverlassenen Tal mitten im Nirgendwo zu leben. Wieder schüttelte er den Kopf, den Blick immer noch auf den Plan geheftet. Momentan hatte er nicht den Nerv, sich wegen alldem Gedanken zu machen. Seine Mum geisterte ständig durch seinen Kopf.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch, und wieder wanderten seine Hände unwillkürlich an seine Tasche. Der Anblick des Bechers neben seiner noch ausgeschalteten Schreibtischlampe ließ ihn innehalten. Es war die Lieblingstasse seines Dads, die weiße mit dem alten, verwaschenen Werbeaufdruck vom Landwirtschaftsministerium.
Augenblicklich war das Telefon vergessen. Er beugte sich vor und knipste die Lampe an. Die Tasse war noch warm. Heiße Schokolade. Die mochte er für sein Leben gern. Sofort stiegen Schuldgefühle in ihm auf. Das war typisch Dad, seine Art, ihm zu zeigen, dass er ihn verstand und genauso empfand wie er. Robert nahm einen Schluck von der cremigen, süßen Flüssigkeit. Und gleich noch einen. Der intensive Geschmack hüllte all seine Sinne ein, während er sich neben Ellie auf das Bett legte und sich zusammenrollte. Ihr weiches Fell an seinem nackten Arm wirkte beruhigend auf ihn. Von unten vernahm er das leise Murmeln des Fernsehers. Und wider Erwarten empfand er auch dieses Geräusch als tröstlich.
Ellie winselte und riss den Kopf herum. Robert folgte dem Blick des Hundes zur Fensterseite des Zimmers. Die Dunkelheit schien zu ihm zurückzustarren. Ein Schauder durchfuhr ihn. Nun zog er doch das Handy aus der Tasche. Nach kurzem Zögern fing er an zu tippen, bevor er es sich anders überlegen konnte: Ich würde dich sehr gerne sehen. Wann können wir uns treffen? Schnell drückte er auf Senden.
Er ließ das Handy auf die Decke fallen und kraulte Ellie den Kopf. Strich über den feinen Flaum an ihren Ohren. Er atmete ihren unverwechselbaren Duft ein, ein Destillat aus wohliger Wärme und Sicherheit. Geistesabwesend starrte er auf eine Stelle oberhalb ihrer Augen, blinzelte. Jede einzelne Strähne ihres Fells stach überdeutlich hervor. Wieder ein Blinzeln. Diesmal schien Ellie vor seinen Augen zu verschwimmen.
Die Hündin winselte erneut. Plötzlich streckte sie sich, sprang vom Bett herunter und bewegte sich seltsam steif auf das Fenster zu. Sie drehte sich nach ihm um und fing seinen Blick ein, das Weiß ihrer Augen größer als sonst. Sie fing an, mit der Pfote in dem Haufen Schmutzwäsche zu wühlen, der sich direkt unterhalb des Fensters türmte.
»Was ist denn los, Ellie, was hast du?«
Robert registrierte seine undeutliche Aussprache, spürte den Speichelfaden, der ihm übers Kinn lief. Er hob die Hand, um sich über den Mund zu wischen, doch sein Arm wollte ihm nicht gehorchen. Eine Woge der Panik riss ihn mit. Er wollte sich im Bett aufrichten, war aber nicht dazu in der Lage.
Dann schrie er.
Allerdings war das, was über seine Lippen kam, nicht mehr als ein klägliches Hauchen. Noch einmal versuchte er hochzukommen. Als er feststellen musste, dass er nicht einmal den Kopf drehen, geschweige denn einen Finger rühren konnte, packte ihn für einen schrecklichen Moment die nackte Angst.
»Dad. Bitte hilf mir«, wollte er rufen. Doch die Worte blieben leblos in seiner Kehle stecken.
Dad. Bitte.
All die verletzenden Dinge, die er seinem Vater an den Kopf geworfen hatte.
Das Fernsehgerät verstummte. Robert vernahm mehrfach ein leises Klicken. Sein Vater knipste gerade sämtliche Lichter im Wohnzimmer und anschließend die unten im Flur aus.
Ellie bellte. Ihre Lefzen bebten, die gelb verfärbten Eckzähne waren entblößt. Wie schon zuvor nahm Robert ganz schwach diesen fremden Geruch wahr. Er versuchte zu schlucken und spürte, wie ihm der Speichel die Kehle hinunterrann. Extrem süß im Geschmack, aber mit einer unterschwelligen Note. Ein Hauch von Bitterkeit. Wieder versuchte er zu schlucken. Nichts. Konnte er überhaupt noch atmen? Eine beklemmende Enge legte sich um seine Lunge, abermals wurde er von Panik erfasst.
Dad. Bitte! Hilf mir.
Im nächsten Moment waren die Schritte seines Vaters auf der Treppe zu hören. Das vertraute Knarzen der Dielenbretter, als er oben am Absatz innehielt, direkt vor der Tür zu Roberts Zimmer. Die Tür ging auf.
Daddy.
Sein Beschützer, er spendete ihm Trost bei jeder Art von Ängsten. Vor der Dunkelheit, vor Monstern.
»Rob.« Die Stimme seines Dads auf dem Flur. »Tut mir leid, alles … das mit Mum. Du weißt, du kannst jederzeit zu mir kommen und mit mir reden …«
Bitte hilf mir, Dad. Doch die Worte blieben eingeschlossen in Roberts Kehle, und außerdem lag er mit dem Rücken zur Tür, weshalb sein Vater sein Gesicht nicht sehen konnte.
»Wir können uns morgen unterhalten.« Sein Vater klang viel zu geknickt und zu niedergeschlagen, um eine Antwort von seinem Sohn zu erwarten. »Komm, Ellie, ab nach unten und ins Körbchen mit dir.«
Die Hündin winselte, dann stieß sie ein kurzes Bellen aus. Sie wollte sich nicht von der Stelle rühren.
Sieh mich an, Dad. Bitte schau nach mir!
Robert hörte, wie sein Vater einen Schritt ins Zimmer machte. »Ellie. Komm.« Seine Stimme klang schärfer. Widerstrebend wandte sich die Hündin vom Fenster ab und folgte ihrem Herrchen. Am Fußende von Roberts Bett blieb sie noch einmal kurz stehen und winselte, dann verschwand sie aus seinem Blickfeld.
Innerlich schrie und schrie Robert.
Doch der Schrei schaffte es nicht über seine Lippen. Er hörte, wie sich die Tür mit einem leisen Klicken schloss, gefolgt von den Schritten seines Vaters, die sich über den Flur entfernten.
Hilflos starrte er in die Dunkelheit. Der leicht bittere Geschmack der heißen Schokolade brannte unter seiner Zunge, als sich mehr und mehr Spucke ansammelte, die er nicht mehr schlucken konnte. Der schwache Duft nach einem Parfüm hing in der Luft. Er starrte vor sich hin, unfähig zu irgendeiner Bewegung, während seine Augen sich nach und nach an die schlechten Lichtverhältnisse gewöhnten.
Für eine Weile herrschte Stille im Haus. Dann summte mit einem Mal das Telefon neben ihm. Robert konnte sich nur leider nicht rühren und die Nachricht lesen. Weil er den Kopf nicht bewegen konnte, zwang er seine Augen möglichst weit nach links und schaffte es, ein einzelnes Wort auszumachen. »Jetzt.«
Kurz darauf drang ein Geräusch vom Fenster her an sein Ohr, aus der Ecke, wo der bodenlange Vorhang hing. Es klang wie ein schweres Atmen – jemand saugte Luft tief in seine Lunge.
Dann das leise Rascheln von Stoff, als der Vorhang sich über den Teppichboden bewegte.
Robert starrte angestrengt in die Finsternis hinein. Ein bleiches Gesicht grinste ihm entgegen.
Samstag
2
Der nackte Leichnam lag in eigenartiger Pose da, mit vornübergebeugtem Torso, das Gesicht in den Untergrund gedrückt. Detective Inspector Monica Kennedy betrachtete den Hinterkopf des Toten mit den kurzen dunklen Haaren. Auf dem unteren Rücken waren tiefe rote Striemen zu erkennen, die Haut wirkte erschreckend bleich und verletzlich. Der Gestank von Verwesung lag in der Luft. Ein Geruch, von dem ihr allererster Vorgesetzter unten in Glasgow behauptet hatte, dass man ihn niemals wieder vergessen würde. Wie recht er doch hatte.
Suchend sah sie sich um. Das Stück Land lag unweit dem Minch, jener Meerenge, welche die Westküste der schottischen Highlands von den Äußeren Hebriden trennt. Durch den nachmittäglichen Dunstschleier glaubte Monica die schroffen Bergketten auf der Insel Skye emporragen zu sehen. Wie ein Ungeheuer, das am Horizont kauerte, jederzeit bereit zum Angriff.
Das nächste Wohnhaus stand knapp fünfhundert Meter entfernt. Weit genug, dass jemand den Leichnam unbeobachtet hier hätte ablegen können. Wahrscheinlich waren der oder die Täter im Schutz der Dunkelheit gekommen. Sie hatten sich alle Zeit der Welt lassen können. So hätte sie selbst es jedenfalls gehandhabt. Nach achtzehn Jahren Erfahrung in der Verbrechensbekämpfung konnte sie durchaus sagen, dass sie ziemlich sicher ungestraft davonkäme, würde sie je einen Mord begehen wollen. Mit dieser Überzeugung ging sie nicht unbedingt hausieren – es war kein Thema, das sie bei einer Runde Stout zur Sprache gebracht hätte –, aber den Gedanken empfand sie als tröstlich. Schließlich bestand ihr Job darin, diesen Unmenschen aufzuspüren, der das Opfer in der wunderschönen Wildnis abgelegt hatte.
Monica sah erneut hinunter auf den Toten. Überall waren Schnittwunden, blaue Flecken und geronnenes Blut zu erkennen, aber auf den ersten Blick war nicht ersichtlich, was die eigentliche Todesursache war. Am liebsten hätte sie die Hand nach ihm ausgestreckt, ihr mütterlicher Instinkt drängte sie, ihn zu trösten – als wäre das bei einem Verstorbenen noch möglich. Ihr Schutzoverall spannte ein wenig um die Hüften und raschelte, als sie in die Hocke ging, sich vorsichtig vorbeugte und die Grashalme rund um die Beine des Opfers behutsam zur Seite strich. An den Stellen, wo der Körper am Boden auflag, war die Haut rot-violett verfärbt. Daraus ließ sich schlussfolgern, dass der Tote an dieser Stelle abgelegt worden war, bevor der Blutfluss zum Stillstand gekommen war, oder er war bereits vorher in diese ungewöhnliche Position gebracht worden.
Monicas Blick wanderte an dem weißen Rücken abwärts. Es war der Rücken eines Jungen, da war sie sich relativ sicher, doch diesen Verdacht würde sie nicht laut äußern, solange sie nicht die endgültige Bestätigung hatten. Man durfte seine Gedanken niemals vorschnell in Worte fassen, weil man damit jederzeit den einen oder anderen vor den Kopf stoßen konnte. Erst musste eine solche Vermutung von wenigstens acht Experten diskutiert und bestätigt werden. Sie verlagerte ihr Gewicht auf die Knie und spürte den kalten feuchten Boden durch den plastikartigen Einwegoverall. Dann fiel ihr Blick auf etwas, das ihr den Atem stocken ließ. Sie beugte sich weiter vor.
»Um Himmels willen«, murmelte sie.
Hastig stand sie auf. Starrte noch einen Moment auf den Leichnam, ehe sie sich in Bewegung setzte und auf die Gruppe von Gaffern zuging, die sich an der Straße weiter hinten versammelt hatten, sichtlich angetan von der samstagnachmittäglichen Showeinlage. Ein Polizeibeamter, keiner, den sie kannte, kam auf sie zu. Er muss neu sein, dachte Monica. Sie war seit mehr als vier Jahren in den Highlands stationiert und gab sich redlich Mühe, sich die Namen und Gesichter von sämtlichen Streifenbeamten einzuprägen. Natürlich gelang ihr das nicht immer, aber der Wille zählte.
Wie die meisten wirkte auch er verdutzt, als er ihrer Größe gewahr wurde. Sie wurde nicht gern daran erinnert, dass sie in dem weißen Anzug aussehen musste wie eine Furcht einflößende Vogelscheuche, die man zu Halloween extra auf das Feld gestellt hatte, um den Kindern Angst einzujagen, mit ihrer bleichen Haut und den langen Gliedmaßen, die aus den Ärmeln des Anzugs – eigentlich eine Nummer zu klein für sie – herausschauten. Dass sie Größe L trug, war schlimm genug. Aber auf Größe XL oder XXL zu wechseln … Nie im Leben.
Monica schüttelte den Kopf und verdrängte die Scham, die sie wegen ihrer Körpergröße empfand. Sie war in dieser Situation völlig unangebracht. Vermutlich hatte sie es hier mit einem Tatort zu tun, denn aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um Mord, und der Fall lag demnach in ihrem Verantwortungsbereich. Außerdem gab es, wenn man ehrlich war, wohl kaum einen Menschen, der in einem von diesen scheußlichen Dingern nicht unmöglich aussah.
Sie atmete tief durch und schälte sich aus dem Overall wie eine sich häutende Schlange. Dann legte sie ihn zusammen und steckte ihn mit den Überschuhen in die Papiertüte, damit sich die Kriminaltechnik die Sachen ansehen konnte. Sie dachte an Beweisstücke wie Mikroplastikfasern, die sie unter Umständen unfreiwillig im Umfeld der Leiche aufgesammelt hatte. Winzige Partikel des Toten, die sich verzweifelt an ihrer zweiten Haut festklammerten.
Der Beamte hörte nicht auf, sie anzuglotzen. Mit offenem Mund stand er da, als könnte ihr eigenartiges Äußeres in irgendeiner Weise in Verbindung mit diesem zusammengekrümmten toten Etwas stehen. Als wäre er jäh in einer anderen, albtraumhaften Welt erwacht.
»Was ist los?«, fragte sie und erwiderte seinen starren Blick mit tief in die Stirn gezogenen Augenbrauen. Insgeheim wünschte sie sich beinahe, er würde endlich seine Bemerkung zu ihrer bescheuerten Aufmachung fallen lassen.
Er schüttelte den Kopf, die Augen weit aufgerissen, das Gesicht kreidebleich. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass das vermutlich seine erste Leiche war und sein verstörter Ausdruck gar nicht ihr galt. Möglicherweise stand er unter Schock, und für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie so was wie ein schlechtes Gewissen. Nun, er konnte von Glück sagen, dass sie hier die Verantwortung trug und nicht der neue Kollege. Detective Constable Crawford war noch nicht zurück von wo auch immer er das Wochenende verbracht hatte. Gott weiß, in welchem Bett er diesmal aufgewacht war. Seit seiner Beförderung in die Mordkommission war das der erste Fall, an dem sie zusammenarbeiteten, aber die wenigen Begegnungen mit ihm hatten ihr bereits deutlich vor Augen geführt, dass er auf jede noch so kleine Schwäche seines Gegenübers sofort ansprang. Als sähe er jedes Anzeichen von Unsicherheit bei den Kollegen als Chance, sich zu profilieren.
Der Streifenbeamte öffnete erneut den Mund, bekam aber immer noch kein Wort heraus. Diesmal hatte Monica Erbarmen mit ihm.
»Wer hat den Leichnam gefunden?«
»Ich war der Erste am Tatort … Jemand hatte angerufen. Spaziergänger.« Er deutete auf einen Mann und eine Frau, die neben dem Streifenwagen mit dem eingeschalteten Blaulicht standen. Ihre Gesichter wirkten in dem bläulichen Schein ungewöhnlich kalt. Der Anblick ließ Monica frösteln.
Eindringlich musterte sie das junge Paar. Identische orangefarbene Gore-Tex-Jacken, jede bestimmt an die dreihundert Pfund teuer und eigentlich für Berge gedacht, die diese Leute gewiss nie besteigen würden. Zu ihren Füßen saß ein schwarzer Cockerspaniel. Offenbar war er gut erzogen, denn er rührte sich nicht vom Fleck. Entsetzen stand in ihren Gesichtern. Sie schätzte die beiden vom Typ her als jung und erfolgreich ein, Ärzte oder Juristen vielleicht. Monica schloss sie als Tatverdächtige sofort aus – noch so ein Gedanke, den sie vorerst lieber für sich behielt.
»Ihr Hund, er lief hier herüber, und … da entdeckten sie den Toten.« Der Beamte führte eine zitternde Hand an die Stirn und ließ den Kopf sinken. »Ich habe die Verdächtigen …« Er unterbrach sich, schnappte nach Luft und machte einen neuen Anlauf. »Ich habe die Zeugen vom Tatort weggeführt und sie gebeten, sich für eine eingehendere Befragung zur Verfügung zu halten. Anschließend habe ich eine Absperrung um den Tatort herum errichtet, bis …«
Monica nickte verständnisvoll. Sie sollte ein paar aufmunternde Worte an ihn richten, um ihm mehr Sicherheit zu geben, weil er offensichtlich Angst hatte, er könnte irgendetwas falsch gemacht haben. Doch sie beschloss, dass sie es besser nicht tat. Am Ende hatte er tatsächlich einen folgenschweren Fehler begangen, der sich erst im Nachhinein herausstellen würde.
Das Geräusch eines herannahenden Fahrzeugs erregte ihre Aufmerksamkeit, sie drehte sich um. Ein silberner Audi hatte am Rande der Wiese unweit der Ansammlung Schaulustiger angehalten. Monica beobachtete, wie DC Connor Crawford die Tür öffnete und ausstieg. Er war nicht sonderlich groß, aber von drahtiger Statur, mit dunkelroten Haaren, die vorne zu einer Tolle gekämmt waren. Die weiblichen Mitarbeiterinnen auf dem Revier unterhielten sich gerne tuschelnd darüber, wie »durchtrainiert« und »scharf« er doch sei. Für Monicas Geschmack sah er viel zu geschleckt aus, fast ein bisschen verweichlicht. Wie ein stolzer Fuchs – hübsch anzusehen, aber mit Vorsicht zu genießen. Man konnte ihm keinen Meter über den Weg trauen. Er sah sich um, beinahe misstrauisch, als witterte er Scherereien.
Monica entging nicht, dass er immer noch denselben braunen Anzug trug wie gestern Nachmittag beim Verlassen des Büros. Nur, dass er jetzt völlig zerknittert war von den Besuchen in diversen Pubs, Nachtklubs und wo auch immer er sich nach der Arbeit noch herumgetrieben hatte. Monica empfand eine gewisse Genugtuung, dass sie mit ihrer Einschätzung seiner Person offenbar richtiggelegen hatte. Warten Sie’s nur ab, gleich werden Sie sehen, was für Riesenscherereien hier auf Sie warten, Crawford, ging es ihr durch den Kopf.
Sie wandte sich ab und sah den Leuten von der Spurensicherung dabei zu, wie sie ihr Zelt aufbauten, bis ihr Kollege von sich aus auf sie zukam. Sie beobachtete, wie der weiße Nylonstoff im Wind flatterte und sich in regelmäßigen Abständen zusammenfaltete, er wirkte wie lebendig vor dem zusehends dunkler werdenden Himmel.
»Wir sollten eine Meldung rausgeben. In Erfahrung bringen, wo junge Menschen vermisst werden. Wissen Sie von irgendwelchen Vermisstenfällen hier in der Gegend?«, wandte sich Monica an den jungen Streifenbeamten, der nicht von ihrer Seite gewichen war.
Er schüttelte den Kopf, doch sein Blick flackerte und wanderte über Monicas Schulter hinweg zur Leiche. »Wer … wer tut so etwas?«
Sie seufzte. Tja, gute Frage. Doch prompt meldete sich eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf: Jeder könnte es getan haben. Wirklich jeder. Die ganze Welt spielt doch inzwischen verrückt.
3
Der Regen trommelte unaufhörlich auf das Dach des Land Rovers. Das Wasser rann am Türrahmen herunter und tropfte in das Fahrzeuginnere. Michael Bach nahm einen Zug von seiner Zigarette und schnipste sie dann zum Fensterspalt hinaus. Der Gestank nach Rauch blieb im feuchten Wageninneren hängen und vermischte sich mit der warmen Heizungsluft. Der Motor lief.
Seine Uhr zeigte drei Uhr nachmittags an, aber der dunkle Himmel über der Westküste der schottischen Highlands ließ vermuten, dass es später war, sehr viel später. Die Sonne war hinter tiefschwarzen Wolken verschwunden. Der Beinn Dearg, jener Berg, zu dessen Füßen Loch Broom lag, war in grau-violetten Nebel gehüllt.
Höchste Zeit, nach Hause zu fahren. Trotzdem zündete er sich eine weitere Zigarette an und ging gedanklich zum wiederholten Mal das kurze Telefonat von letzter Woche durch.
Können wir uns heute Vormittag treffen?
Wir haben nächste Woche einen Termin.
Bitte, es ist wichtig.
Nichol Morgan war siebzehn. Der Junge hatte seine Probleme, daran bestand kein Zweifel, aber er war einer von den weniger komplizierten Fällen. Michael hatte ein relativ gutes Verhältnis zu ihm, wie er selbst fand. Zumindest so gut es eben ging, wenn man der Betreuer war.
In Ordnung, hatte Michael schließlich geantwortet. Treffen wir uns in einer Stunde.
Nur, dass es dann nicht zu diesem Treffen gekommen war. Mittlerweile war eine ganze Woche verstrichen.
Vom Parkplatz am Ufer des schwarzen Sees inmitten der hügeligen Gebirgslandschaft aus beobachtete Michael den Himmel über Ullapool, der in dieser Sekunde aufbrach. Der Ort lag extrem abgeschieden – hier lebten in erster Linie Fischer, passionierte Bergwanderer, Trinker und gesellschaftliche Außenseiter. Nichts für Zartbesaitete. Wieder musste er an Nichol denken und spürte den zunehmenden Druck in der Magengegend. Scham. Reue. Er war zwei Stunden zu spät draußen vor dem Bahnhof in Inverness aufgekreuzt und hatte nach dem Jungen Ausschau gehalten. Hatte ihn auf dem Handy zu erreichen versucht, ihm mehrere Nachrichten geschickt, vergebens auf Antwort gehofft. Der Junge hatte nichts mehr von sich hören lassen.
Wieder nahm er einen tiefen Zug von seiner Zigarette, der Rauch brannte in seiner Lunge.
Erst am darauffolgenden Morgen war eine Antwort bei ihm eingegangen. Er klappte sein Telefon auf und las die sonderbare Nachricht noch einmal: Die Zukunft liegt in den Sternen.
Eine Zeile aus einem Buch, das Nichol im Schulunterricht gelesen hatte? Etwas aus einem Science-Fiction-Comic? Michael hatte Folgendes zurückgeschrieben: Wo steckst du? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, dass wir uns gestern verpasst haben.
Doch danach herrschte Funkstille. Keine Reaktion mehr auf einen seiner Anrufe oder die Nachrichten, die Michael hinterließ.
Immer wieder verschwanden Klienten von ihm spurlos, das war nichts Ungewöhnliches. Es gehörte quasi zu seinem Berufsalltag. Die jungen Leute hauten einfach ab, verkrümelten sich nach Glasgow oder London. In Nichols Fall bezweifelte er das allerdings. Der Junge machte auf ihn nicht den Eindruck, als wäre er ein Ausreißer. Aber er war und blieb verschwunden – oder hatte ihn jemand entführt?
Michael stieß ein gezwungenes Lachen aus, als wollte er seine eigenen Gedanken der Lächerlichkeit preisgeben. Wer hätte ihn denn entführen sollen?
»Wahrscheinlich geht es ihm blendend.« Dumpf hallten die Worte im Wageninneren nach, doch sie klangen wenig überzeugend. Eisern hielt sich der Rauchgeruch im Kondenswasser auf der Innenseite der Scheibe, während der Regen unaufhörlich auf das Wagendach trommelte.
Gerade wollte er den Motor anlassen, als ein roter Volkswagen auf den Parkplatz gefahren kam. Im feuchten Dunst ging von der Karosserie ein unheimliches Leuchten aus. Langsam rollte der Wagen vor Michaels Motorhaube und verstellte ihm den Weg. Die Scheinwerfer sahen aus wie ein glühendes Augenpaar im trüben Dämmerlicht, dann wurde aufgeblendet, erst einmal, dann noch einmal.
Fröstelnd zog Michael den Reißverschluss seiner Jacke zu – eigentlich hatte sie seinem Dad gehört, eine Daunenjacke von Mountain Equipment aus den Siebzigern. Sie war rot und blau und schon etwas ausgewaschen und außerdem eine Spur zu eng für seine breiten Schultern. Er kletterte aus dem Land Rover und eilte auf das Fahrzeug zu, während der Regen erbarmungslos auf ihn herunterprasselte und Haut und Haare durchnässte. Im Näherkommen fiel ihm auf, dass er den Fahrer des Wagens kannte.
Der Name des Mannes war Ben Fisher, DC Ben Fisher, von der örtlichen Polizei. Der jüngste Bruder eines früheren Klassenkameraden von Michael. Sein letzter Stand war, dass dieser ehemalige Klassenkamerad drüben in Amerika Arbeit gefunden hatte. Schon seltsam, wie zwei Menschen, die zusammen aufgewachsen waren, letztlich so unterschiedliche Leben führen konnten.
DC Fisher ließ sein Fenster herunterfahren. Seine schwarzen Haare waren zu einem ordentlichen Seitenscheitel frisiert. Angesichts des strömenden Regens verzog er das bebrillte Gesicht. Er trug eine Anzugjacke – die typische Großstadtkluft – und verriet dadurch, dass er mit dem rauen Wetter hier oben an der Westküste nicht vertraut war.
»Mr. Bach?«, sagte Fisher, der Michael entweder nicht erkannte oder sich stur ans übliche Protokoll hielt.
»Der bin ich.« Michael hielt eine Hand hoch, um seine Augen gegen den Regen abzuschirmen.
»Sie haben einen jungen Mann namens Nichol Morgan als vermisst gemeldet?«
4
Michael folgte der Beschilderung zur Leichenhalle. Sie lag versteckt im rückwärtigen Teil des Gebäudes, am Ende eines nicht enden wollenden Labyrinths aus langen Fluren und einer Reihe von Schwingtüren – das sorgsam gehütete Geheimnis des Raigmore-Krankenhauses: ein ermordeter Junge und Gott weiß was noch. Er versuchte den Gedanken abzuschütteln und wollte gerade die letzte Tür aufstoßen, als ihn etwas innehalten ließ. Durch die Glasscheibe konnte Michael die Treppe erkennen, die hinunter zur Leichenhalle führte, unmittelbar hinein ins Herz der Unterwelt.
Ein klebriger Schweißfilm legte sich auf seinen Rücken – seine Daunenjacke war viel zu warm für das gut beheizte Gebäude –, und der Geruch nach Bodenpolitur, der den Krankenhausmief nur schwerlich zu überdecken vermochte, setzte ihm arg zu. Eine Erinnerung drängte aus den Tiefen seines Gedächtnisses empor.
Michael zuckte zusammen, als hinter ihm ein Geräusch durch den Korridor hallte. Das Quietschen von Schritten auf Linoleum. Ihm wurde bewusst, dass seine Hand zitterte, und plötzlich überkam ihn ein Impuls: der unbändige Drang, wie ein kleines Kind den Kopf einzuziehen und wegzulaufen. Stattdessen schob er die Hand in die Jackentasche und drehte sich tapfer um.
Michael war ein hochgewachsener Mann, der es gewohnt war, auf seine Mitmenschen herabzublicken, aber die dunklen Augen der Frau, die jetzt auf ihn zukam und ihn aus ihren unverwandt ansah, befanden sich auf einer Höhe mit ihm. Sie muss knapp einen Meter neunzig groß sein, dachte er, und für einen flüchtigen Moment schien er vergessen zu haben, warum er hier vor der Tür zu einer Leichenhalle stand. Leicht gebeugt kam sie auf ihn zu, mit ihren breiten Schultern in einem dunklen Wollmantel, der ihr nicht ganz bis zu den Knien ging. Im Laufen breitete sich der Mantel hinter ihr aus, sodass man den Eindruck bekam, als schwebte sie.
Er blinzelte kurz und sah erneut hin. Sie war schätzungsweise um die vierzig, mit schulterlangem schwarzem Haar, einem rundlichen Gesicht und blassem Teint. Sie schien kein Problem damit zu haben, von Toten umgeben zu sein. Er räusperte sich und zwang sich ein Lächeln ins Gesicht, um sein Unbehagen zu überspielen.
»Michael Bach?«, fragte sie und sprach es aus wie »back«, mit leichtem Akzent, der sie eindeutig als Bewohnerin von Inverness auswies. Irgendetwas an seiner Miene musste ihn verraten haben, denn jetzt legte sie den Kopf schief, als hätte er ihr Interesse geweckt. »Danke, dass Sie gekommen sind. Mir ist bewusst, dass es … nicht ganz leicht ist.« Sie machte eine kurze Pause, um die Worte sacken zu lassen. »Der Junge ist unter höchst tragischen Umständen ums Leben gekommen. Zudem hat er über Nacht im Freien gelegen.« Wieder schwieg sie einen Augenblick. Sie schien ihn zu taxieren, seine Reaktionen abzuschätzen.
»Wollen Sie damit andeuten, dass er nicht mehr aussieht, wie er aussehen sollte?«, fragte Michael und wischte sich mit der Hand übers Gesicht, als ihm die grauenvolle Tragweite seiner Worte bewusst wurde.
Sie nickte kaum merklich und schien abzuwarten, ob er noch etwas hinzufügen würde. Als nichts mehr kam, schob sie sich verlegen an ihm vorbei, stieß die Tür auf und marschierte ihm voraus die Treppe hinunter.
Der Leichnam lag auf einem Tisch aus Edelstahl und war mit einem Tuch bedeckt. Ein Mann in OP-Kleidung stand dahinter. Michael ertappte sich dabei, wie er auf die anonyme Gestalt unter dem Leichentuch starrte. Darunter zeichnete sich etwas ab, ein lebloses Objekt, das einst ein Junge gewesen war. Seine Hand schloss sich fester um das Feuerzeug in seiner Tasche. Keiner sprach ein Wort, und nach kurzem Zögern schlug der Gerichtsmediziner das Laken zurück.
Es war nicht Nichol.
Für Michael bestand kein Zweifel daran, die Gesichtsform stimmte nicht. Der Tote machte einen wesentlich älteren Eindruck, es waren sogar vereinzelte Bartstoppeln zu erkennen. Nichol hatte immer noch eine Haut wie ein Baby gehabt. Die Züge dieses Jungen waren verquollen, er sah eigenartig aus, als wäre seine Seele durch etwas ersetzt worden, oder besser gesagt durch nichts: Da war nichts Geheimnisvolles mehr, nichts Überraschendes.
»Er ist es nicht.«
»Sind Sie sicher?«
Michael riskierte abermals einen Blick. Diesmal bemerkte er die unmissverständlichen Spuren der Gewalt. Etwas am Hals des Jungen, das wie ein Bluterguss aussah, ein geplatztes Äderchen im rechten Auge. Jemand hatte ihm das angetan, ihm schrecklich wehgetan, sich bewusst dafür entschieden, ihm das Leben zu nehmen. Erst jetzt fiel Michael der Gestank nach Tod und Verwesung auf. Unwillkürlich schlug er die Hand vor den Mund und wurde von einem Würgereiz gepackt. Im selben Moment kam ihm die schreckliche Erkenntnis, dass ihn das Gesicht des Jungen bis in die dunkelsten Winkel seiner Träume verfolgen würde. Über diese Kellertreppe hinauf in die wirkliche Welt.
Draußen vor dem Krankenhaus war ein eigenartiger Nebel aufgezogen und hatte den Regen verdrängt. Schwer senkte er sich über den Parkplatz und schien alles unter sich zu ersticken. Michael wollte sich eine Zigarette anzünden, doch seine Hände zitterten viel zu stark.
»Was ist mit ihm geschehen?«, fragte Michael. »Das war nicht …« War nicht was?
»Wir stehen ganz am Anfang unserer Ermittlungen. Noch einmal vielen Dank für Ihr Kommen«, sagte die Polizistin und kehrte ihm den Rücken zu.
»Was unternehmen Sie denn jetzt in Nichols Fall?«
Sie blieb noch einmal stehen und sah sich über die Schulter zu ihm um. Ihre Umrisse zeichneten sich vor dem grellen Licht im Eingangsbereich des Krankenhauses ab. »Ich werde dafür sorgen, dass man Sie telefonisch verständigt, sobald wir Näheres wissen.«
»Ich glaube einfach nicht, dass er so mir nichts, dir nichts abgehauen wäre, ohne etwas zu sagen.«
Jetzt drehte sie sich vollständig zu ihm um. »Ich möchte kein Spielverderber sein, aber das bekommen wir leider sehr häufig zu hören, wenn jemand verschwindet. Es ist nicht ganz so einfach, wenn der Vermisste über sechzehn ist. Streng genommen wird er nämlich bereits wie ein Erwachsener behandelt.«
»Aber Sie müssen doch etwas unternehmen? Womöglich schwebt er in Gefahr – Sie haben doch gesehen, was mit diesem Jungen da drinnen passiert ist.« Michael hatte sichtlich Mühe, seinen Ärger im Zaum zu halten.
»Ich habe den Bericht zu Nichol gelesen, Mr. Bach. Man hat gesehen, wie er in einen Zug gestiegen ist. Wenn ich mich nicht irre, deutet dabei nichts auf ein Verbrechen hin.«
»Er ist erst siebzehn.«
Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn und sah ihn an. Da war etwas hinter ihren Augen … Gedanken, die ihr durch den Kopf schwirrten. Irgendetwas sagte Michael, dass sie ihn sondierte, nicht recht wusste, wie sie ihn einschätzen sollte.
»Ist Ihnen denn irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Unmittelbar vor seinem Verschwinden?«
Michael starrte sie an. Diese dunklen Augen, die kleinen Lachfältchen, die erst jetzt, im hellen Licht des Eingangs, sichtbar wurden. Wobei es ihm schwerfiel, sie sich lachend vorzustellen. Er zermarterte sich das Hirn, suchte krampfhaft nach einer Antwort, weil das genau die Art von Frage war, die bei solchen Verhören einen Schlusspunkt setzen konnte. Normalerweise müsste die Antwort lauten: Nicht, dass ich wüsste.
»Da war nur eine Sache …« Er durchforstete seine Gehirnwindungen nach irgendetwas, woran er sich im Zusammenhang mit Nichol erinnerte.
Die Kriminalbeamtin legte den Kopf schief, beide Hände in die Hüften gestemmt, der dunkle Mantel warf Falten.
»Vor einem Monat – vielleicht ist es noch länger her – fing Nichol plötzlich an, etwas mit sich herumzutragen.« Michael ertastete das Feuerzeug in seiner Jackentasche und ballte die Finger darum zur Faust.
»Was war es?«
»Ein Stein. Ein schwarzer Stein.« Michael musste schlucken, weil ihm nur allzu bewusst war, wie nebensächlich und unbedeutend das, was er zu sagen hatte, klingen musste. Er machte sich nichts vor, natürlich würde die Polizistin seine Finte sofort durchschauen.
»Was war daran so ungewöhnlich?«
»Das kann ich nicht sagen.« Er verstummte, vielleicht weil ihm sein Täuschungsmanöver mit einem Mal peinlich war. »Er berührte damit immer wieder seine Lippen, fast als würde er das Ding küssen.«
Die Beamtin musterte ihn lauernd. Sie machte ganz den Eindruck, als wollte sie etwas erwidern, doch im nächsten Moment wurde die Tür hinter ihr aufgezogen. Ein kleiner, schmächtiger Mann trat ins Freie. Er war Ende zwanzig, Anfang dreißig, wobei seine ausgezehrten Züge auch auf ein höheres Alter hätten schließen lassen können. Er hatte etwas Ungepflegtes, fast Wildes an sich. Das typische Highland-Gesicht, mit hohen Wangenknochen und einer spitzen Nase mit einem Höcker, der darauf hindeutete, dass sie ihm bereits mehrfach gebrochen worden war. Mit seinen roten Haaren und dem durchdringenden Blick sah er aus wie ein etwas klein geratener keltischer Krieger.
Der Mann redete auf die Polizistin ein, bis er Michaels Gegenwart registrierte. Unverhohlen starrte der Kerl ihn an, sodass er schließlich den Blick senkte.
»Die Kollegen sind so weit, die Autopsie kann beginnen.«
Für einen flüchtigen Moment verspürte Michael so etwas wie Erleichterung. Dass sie es waren und nicht er, deren Anwesenheit dort drinnen gefragt war. Er würde nicht zusehen müssen, wie sie das Tuch von dem Jungen herunterzogen und die scharfe Klinge in seinen Körper eindrang. Er registrierte das knappe Nicken, mit dem sie sich verständigte. Michael nahm an, dass es sich bei dem Mann ebenfalls um einen Detective handelte. Die beiden kehrten ihm wortlos den Rücken zu und steckten konspirativ die Köpfe zusammen. Die Frau war beinahe einen ganzen Kopf größer; auf den ersten Blick hätte man sie auch für Mutter und Sohn halten können. Sie warfen ihm einen letzten flüchtigen Blick zu, dann nickte die Frau ihm zum Dank zu, ehe sie zurück ins Gebäude gingen und sich wieder auf den Weg in die Leichenhalle machten.
5
Monica stellte den leeren Pappbecher auf der glänzenden Arbeitsfläche aus Edelstahl ab, vom Koffein wie berauscht. Sie musste an den Anruf denken, der sie erreicht hatte, gerade als sie mit Lucy ins Kino gehen wollte. Sie hatten schon drinnen in der Lobby gestanden und sich beratschlagt, welchen Film sie schauen sollten, und ihr kleines Mädchen war vor Aufregung und Vorfreude von einem Bein aufs andere gehüpft. Sie wollten die wenige gemeinsame Zeit, die ihnen blieb, möglichst gut nutzen.
Und dann hatte natürlich wieder einmal ihr Telefon klingeln müssen. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie überlegt, nicht ranzugehen und sich vom Duft des Popcorns leiten zu lassen. Es wäre so einfach gewesen, nach Lucys Hand zu greifen, mit ihr zum Kartenschalter und anschließend zum Süßigkeitenstand zu gehen und es sich in den samtigen Kinosesseln bequem zu machen. Drei Stunden später hätte sie sich wortreich bei ihrem Vorgesetzten entschuldigt. In Augenblicken wie diesen wünschte Monica sich bisweilen, sie wäre eine andere: eine bessere Mutter und eine schlechtere Polizistin. Denn schon beim ersten Klingeln hatte sie Lucys Hand losgelassen und den Anruf entgegengenommen.
Statt in den Genuss von Zuckerrausch und Filmvorführung zu kommen, hatte sie den bohrenden Blick und die Enttäuschung ihrer Tochter wegstecken müssen, als sie ihr zu erklären versucht hatte, dass jemand von der Arbeit angerufen habe und Granny kommen würde, um sich zum Trost zu Hause mit ihr eine DVD anzusehen. Ins Kino könnten sie ja auch morgen noch gehen. Vielleicht. Monica warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr an der Wand der Leichenhalle. Fast zehn Uhr, und das an einem Samstagabend. Sofern der Mörder sich nicht in den nächsten Stunden wie durch ein Wunder von selbst stellte, waren die Chancen, dass sie ihn zeitnah fassten, verschwindend gering.
Sie schüttelte den Kopf, um diesen sinnlosen Gedanken zu verscheuchen, und trat näher an den Leichnam heran. Jetzt war sie ihm so nah, dass sie nur die Hand hätte auszustrecken brauchen, und sie hätte die dunklen Flecken am Hals des Jungen berührt, die violetten Blutergüsse an seinen Beinen und am Bauch. Die Neonröhre über ihrem Kopf flackerte. Warum waren Leichenhallen eigentlich immer in irgendwelchen fensterlosen Kellern untergebracht? Diese Frage hatte sie tatsächlich schon einmal gegoogelt: Demnach war man sich einig darüber, dass in Zeiten, bevor es Strom gab, Tote unterirdisch aufbewahrt wurden, weil es dort kühler war und sie daher langsamer verwesten. Doch Monica stellte sich gern vor, dass man sich Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, als die ersten Leichenhäuser errichtet wurden, gedacht hatte, wir alle würden ja ohnehin früher oder später unweigerlich unter der Erde landen, und deshalb hatte man die Toten schon gleich in unterirdischen Gewölben untergebracht. Unter der Erde war nun einmal der perfekte Ort für sie.
Der Gerichtsmediziner wandte sich Monica zu. Sie waren sich noch nie zuvor begegnet, trotzdem dachte er nicht daran, sich ihr offiziell vorzustellen. Stattdessen deutete er nur mit dem Kinn auf den Leichnam zwischen ihnen, als wäre er nichts weiter als ein totes Tier auf der Schlachtbank.
»Sie waren schon mal bei einer Obduktion zugegen?«
Wortlos nickte sie. Wie viele waren es gewesen? Zu viele, um sich an jede einzelne zu erinnern.
»Manch einem fällt es schwer, dabei zuzusehen. Schließlich wird uns dabei schonungslos vor Augen geführt, woraus wir letztendlich gemacht sind. Sobald die Haut entfernt ist, liegt alles in seiner schaurigen Schlichtheit offen vor uns da. Ihre Jungs von der Kriminaltechnik haben alles Nötige unternommen?«
Sie starrte ihn feindselig an. »Meine Mädchen von der Kriminaltechnik. Das Team steht unter der Leitung von Gemma Gunn. Sie haben den Leichnam noch am Tatort untersucht und ihn sich heute am frühen Abend näher angesehen.«
»Selbstverständlich. Wir hier gehen hingegen streng nach Lehrbuch vor, nicht wahr, Christian?« Er erhob die Stimme und richtete das Wort an den jungen Assistenten, der hinter ihm etwas in den Computer tippte. »Was haben wir?«
Sollten das nicht eigentlich Sie mir sagen?, dachte Monica, sprach es aber nicht aus. Der Arzt war dem äußeren Anschein nach Ende fünfzig, Anfang sechzig. Schlank, mit kurz rasierten grauen Haaren, wie man unter der üblichen OP-Kopfbedeckung erkennen konnte, dazu blaue Augen und ein Akzent, den sie nicht recht verorten konnte. Südengland? Oder ganz etwas anderes?
Als sie nichts erwiderte, versuchte er es erneut. »Wie ich hörte, finden sich Male auf dem Rücken des Jungen?«, sagte er, die Mundwinkel zu einem dünnen Lächeln hochgezogen. Erst jetzt durchschaute Monica, was der Pathologe im Schilde führte: Er versuchte ihr auf den Zahn zu fühlen, sie einzuschüchtern. Offenbar wollte er ihr zeigen, wer hier das Sagen hatte.
»Es könnte sich um Bissspuren handeln«, sagte Monica. »Meine Leute haben mir inoffiziell bestätigt, dass sie zu groß seien, um von einem Menschen zu stammen.«
»Ein Ungeheuer also?«, fragte er, worauf er ein unterdrücktes Prusten folgen ließ.
Monica starrte ihn an und ging nicht auf seinen unangebrachten Spott ein. »Sie haben sämtliche Spuren am Tatort gesichert, die auf Speichel hindeuteten, bevor man ihn hierherbrachte. Aber meine Leute gehen davon aus, dass die Bisswunden von einem Tierschädel oder vom Modell eines Kiefers stammen könnten.«
Langsam nickte er, seine Miene wurde wieder ausdruckslos. Vielleicht war er sogar eine Spur enttäuscht, dass Monica die Bissverletzungen nicht zu verunsichern schienen. Er wandte sich ab und sah auf den Computermonitor, von wo er mit leiser Stimme die vorläufigen Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorlas.
»Schmutz unter den Fingernägeln. Keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich zur Wehr gesetzt hat. Schürf- und Schnittwunden an den Handgelenken und Fußknöcheln, die darauf schließen lassen, dass er gefesselt war. Vermutlich mit Kabelbindern. Diverse Druckstellen am Hals. Er wurde wiederholt gewürgt, bevor er starb. Schnittwunden und Hämatome am ganzen Körper, eine Reihe von Einstichstellen entlang des unteren Rückens, nicht tief.« Der Arzt legte ein Messer auf den Seziertisch, das Klirren von Metall auf Metall war zu hören. »Unvorstellbar, wie jemand einem anderen Menschen so etwas antun kann.« Monica atmete tief ein und fragte sich, worauf genau er sich mit »so etwas« bezog.
»Wir wären dann so weit, Dr. Dolohov«, verkündete der Assistent und trat von seinem Computer zurück. Er hielt einen Audiorekorder in der behandschuhten Hand.
»Vielleicht fördern wir ja noch mehr zutage«, sagte Dolohov und warf Monica ein spöttisches Lächeln zu, ehe er die weiße Maske aufsetzte und das Messer zur Hand nahm.
In jüngeren Jahren war Monica der Überzeugung gewesen, dass sie sich nie an den Anblick gewöhnen würde, wie eine Klinge menschliche Haut und Fleisch durchschnitt. Doch nach fünf Jahren in der Mordkommission Glasgow, zehn in London und jetzt wieder hier, wo ihr Leben seinen Anfang genommen hatte, kam es ihr erschreckend normal vor, Männer, Frauen und sogar Kinder mit geöffneten Leibern auf Seziertischen liegen zu sehen. Sie sah zu, wie der Pathologe auf beiden Seiten des Torsos jeweils einen Schnitt setzte, von der Achsel bis zum Brustbein, und dann noch einen vom Brustbein bis zur Leiste, sodass sich vorne auf dem Oberkörper des Jungen ein Y abzeichnete.
Dolohov legte das Messer erneut beiseite und klappte die entstandenen Hautlappen mit den Händen zurück, sodass Eingeweide und innere Organe sichtbar wurden. Alle diese sakrosankten Dinge, die eigentlich nie ans Tageslicht kommen sollten, Opfergaben gleich.
Aus reinem Pflichtgefühl dem Jungen gegenüber verfolgte sie das Geschehen. Sehr wahrscheinlich hatte er Familie, Freunde, die sich um ihn sorgten; zumindest in seinem eigenen Leben hatte er die Hauptrolle gespielt. Gerade durchschnitt der Gerichtsmediziner die Rippen und das Brustbein, um die inneren Organe zu entfernen. Stück für Stück befreite er sie aus ihrem Käfig, mit präzisen Handgriffen, wie ein Jäger, der das erlegte Wild zerwirkte.
Der Junge war gefoltert und getötet worden. Von einem Monster zerfleischt. Aber er war in einer ganz bestimmten Position abgelegt worden. Ausgerichtet nach Westen, fast als betete er, als steckte eine verborgene Botschaft dahinter. Doch wem sollte diese Botschaft gelten?
Dolohov wischte mit einem Tuch das Blut von der rosigen Außenhaut des Magens, dann zog er das Messer über das Organ und schob anschließend einen behandschuhten Finger in die entstandene Öffnung. Das hatte er schon unzählige Male getan, dessen war Monica sich sicher. Sie bewunderte, wie zielstrebig seine Finger sich bewegten, das Zusammenspiel der Hände, die langsam, ganz bedächtig, die Öffnung im Magen vergrößerten.
»Leer. Entweder, er hatte schon eine ganze Weile nichts mehr zu sich genommen, oder er musste sich während seines Martyriums übergeben«, sprach der Arzt in das Aufnahmegerät, das ihm der Assistent hinhielt.
Im selben Moment nahm sie den Geruch wahr. Obwohl der Leichnam in der Kühlkammer gelegen hatte, hing da eindeutig eine Spur von Eisen in der Luft, der Geruch von Blut, von rohem Fleisch, der aus den Überresten des Magens entwich, vermischt mit einem Hauch halb verdauter Nahrung.
»Auch zwischen seinen Zähnen kann ich keine Essensreste entdecken. Möglicherweise hat der Mörder ihn gesäubert, ehe er sich seiner entledigte«, fuhr Dolohov fort. Monica nahm diese Information nickend zur Kenntnis und speicherte sie für später ab.
Knarzend ging die Tür auf, und DC Crawford betrat den Obduktionssaal. Monica warf ihm einen knappen Blick zu und registrierte sofort seinen Gesichtsausdruck; der angespannte Kiefer ließ keinen Zweifel daran, warum er so kurz vor der Autopsie den Waschraum hatte aufsuchen müssen.
»Ich mache nun weiter mit seiner Kehle«, diktierte Dolohov, während er den Kopf des Jungen stärker nach hinten legte. Ein leises Knacken war zu hören, als er die Wirbel in seinem eigenen Genick dehnte.
Wieder machte er sich an dem Jungen zu schaffen, setzte Schnitte, legte die Luftröhre frei, entfernte sie und platzierte sie auf dem Tisch.
»Hier sieht man sehr schön, wie sie erst gewaltsam gequetscht und anschließend eingedrückt wurde. Von jemandem, der über sehr viel Kraft verfügt. Möglicherweise wurde er gewürgt, bis er bewusstlos wurde, und dann wieder aus der Ohnmacht geholt. Um Genaueres sagen zu können, müssen wir den toxikologischen Befund abwarten.« Er benutzte das Seziermesser, um auf die einzelnen Verletzungen zu deuten. »Er hat sich die Zunge fast vollständig durchgebissen. Oder es war sein Angreifer. Ungeheuerlich.« Er wandte sich seinem Assistenten zu. »Schießen Sie ein Foto davon. Damit wir die Wunde mit den Bissspuren an seinem Rücken abgleichen können.« Der junge Mann nickte und griff nach der Kamera, die auf der Arbeitsfläche bereitlag.
Als er fertig war, wischte der Pathologe mit den Fingern über die blutige Luftröhre, hielt inne und wiederholte das Ganze noch einmal.
»Sonderbar«, sagte er mit verwunderter Miene. »Da scheint etwas in der Luftröhre festzustecken.« Er schnitt sie der Länge nach auf, fischte mit dem Zeigefinger etwas heraus und hielt es Monica hin.
Sie zog sich einen Handschuh über und nahm den Gegenstand entgegen. Ungläubig schüttelte sie den Kopf und flüsterte den Namen, der ihr als Erstes in den Sinn kam: »Michael Bach.«
Sonntag
6
Monica sog die kühle Nachtluft tief in ihre Lunge, froh, endlich wieder draußen zu sein nach den vielen Stunden in dieser unterirdischen Halle mit ihren organischen Gerüchen eines geöffneten Körpers.
Sie warf einen flüchtigen Blick zum Haupteingang des Krankenhauses. Die ersten samstagabendlichen Partyleichen trudelten nach und nach in der Notaufnahme ein. Monica sah einen Krankenwagen vorfahren, ein Mann wurde auf einer Trage herausgerollt, das Oberteil vorne voller Blut, der Kopf einbandagiert, sodass er an einen verwundeten Soldaten erinnerte. Das Stadtzentrum von Inverness schien sich auf eine ganz eigene Version der Wochenendhölle spezialisiert zu haben.
»Kann ich Sie mitnehmen?«, fragte Crawford.
Der Klang seiner Stimme ließ sie herumfahren. Sie hatte schon fast vergessen, dass er neben ihr herlief, so sehr war sie darauf fixiert, möglichst schnell nach Hause zu kommen, ins Bett zu kriechen und wenigstens ein paar Stunden zu schlafen, bevor sie sich am Morgen mit Michael Bach unterhalten würden. Erst da fiel ihr wieder ein, dass sie den Volvo drüben im Präsidium hatte stehen lassen. Vom Raigmore-Krankenhaus war es allerdings nur ein fünfminütiger Fußmarsch einmal um den halben Kreisverkehr herum.
Sie warf einen Blick auf ihr Handy, um nach der Uhrzeit zu sehen. Schon nach eins. Gerade wollte sie den Mund öffnen und das Angebot dankend ausschlagen. Eine alte Gewohnheit: Niemals jemandem einen Gefallen schuldig sein, lautete ihre Devise. Dann aber rief sie sich in Erinnerung, dass es nur eine kurze Mitfahrgelegenheit war, die er ihr anbot. Und wenn sie in Zukunft gut zusammenarbeiten wollten, würde sie sich wohl oder übel an ihn gewöhnen müssen. Also nahm sie dankend an.
Crawford nickte und deutete vage auf seinen Audi. »Mir fällt es nach wie vor schwer zuzusehen, wenn sie aufgeschnitten werden … Aber irgendwann wird es für mich hoffentlich auch zur Routine.«
Überrascht sah Monica ihn an. Mit dieser Offenheit hatte sie nicht gerechnet. Aber warum sollte man sich überhaupt an den Geruch einer verwesenden Leiche gewöhnen wollen? Fiel das irgendjemandem leicht? Im Laufe der Jahre hatte sie sich diese Frage selbst wiederholte Male gestellt.
Monica zog die Tür auf und setzte sich auf den Beifahrersitz, den sie so weit wie möglich nach hinten schob, damit ihre Beine Platz hatten. Immerhin würde sie zu Hause sein, um Frühstück für ihre Tochter zu machen. Ein schwacher Trost, nachdem das Wochenende derart beschissen geendet hatte.
Ihr Handy vibrierte in der Tasche. Mum? Sie konnte sich die erwartungsvolle Miene ihrer Mutter nur allzu lebhaft ausmalen. Konnte sich vorstellen, wie sehr sie sich freute, dass ihre Tochter die Ermittlungen in diesem Fall leiten würde, weil er mit Sicherheit für großes öffentliches Aufsehen sorgen würde. Bestimmt konnte sie es kaum erwarten, ihr ihre persönliche Meinung zu dem Mord kundzutun und erste Mutmaßungen anzustellen. Angela Kennedy hatte sich ein breites kriminologisches Wissen angeeignet, indem sie sich regelmäßig auf Internetseiten zum Thema Verbrechensbekämpfung tummelte und sich jeden Krimi im Fernsehen ansah.
Es war allerdings nicht Monicas Mum. Widerstrebend nahm sie den Anruf entgegen.
»DI Kennedy?« Im Hintergrund war die Geräuschkulisse eines Call-Centers zu hören.
»Am Apparat.«
»Sie haben eine Meldung rausgegeben, weil Sie an Vermisstenfällen interessiert sind? Speziell an verschwundenen jungen Männern?«
Hab ich das?, fragte sie sich mit wachsendem Unbehagen.
»Soeben ist ein Anruf reingekommen. Ein gewisser Steven Wright hat seinen Sohn als vermisst gemeldet.« Monica starrte hinaus in den Regen, der wieder eingesetzt hatte. Sie sah zu, wie die Tropfen auf der Windschutzscheibe landeten und das hell erleuchtete Krankenhausgebäude vor ihr verschwimmen ließen.
»Wie lautet die Adresse?«, hakte Monica nach und spürte, dass Crawfords Blick sich voller Neugier auf sie richtete.
»Das ist es ja gerade, der Mann wohnt drüben in Wester Ross. In den Bergen. Etwa fünfunddreißig Kilometer von Gairloch und dem Fundort der Leiche entfernt.«
Monica bedankte sich und beendete das Gespräch.
»Was ist los?«, erkundigte sich Crawford mit unverhohlener Neugier.
»Ein Hinweis auf die mögliche Identität des Opfers«, gab Monica zurück. Wieder spürte sie das Vibrieren ihres Handys, als die Nachricht mit der genauen Adresse eintraf. Es war nicht weit von Achnasheen, in den Bergen, ein Stück von der Hauptstraße in Richtung Westküste entfernt.
»Dann sollten wir wohl gleich hinfahren, was meinen Sie?«, schlug Crawford vor, doch er wirkte unsicher. Vielleicht wunderte er sich, dass sich ihre Begeisterung in Grenzen hielt.
Ja, sollten wir wohl, dachte Monica. Sie stellte sich vor, wie Lucy am Morgen aufwachte und sich fragte, wo ihre Mummy schon wieder steckte. Vielleicht konnte die Sache warten – sie konnten Steven Wright genauso gut am frühen Vormittag einen Besuch abstatten. Was machte es für einen Unterschied? Dann wiederum stellte sie sich vor, wie sie diesen Vorschlag ihrem Vorgesetzten unterbreitete, Detective Superintendent Fred Hatley. Seine Antwort hatte sie deutlich im Ohr: Sie sind leitende Ermittlerin in diesem Fall, DI Kennedy. Es ist Ihre Pflicht, Ihre Verantwortung.
Wieder starrte sie zur Windschutzscheibe hinaus in den Dunst und den Regen, der noch dichter zu fallen schien. Genauso düster und schwer wie die Schuldgefühle, die sich in ihr bemerkbar machten. Aber wie sie es auch drehte und wendete, sie waren unvermeidlich.
7
Connor Crawford brachte den Audi vor einer Reihe abgedunkelter Häuser zum Stehen. Tiefschwarz ragten in der Ferne die steilen Gebirgsketten empor, als kündeten sie von kommender Bedrohung. Und als könnten sie jeden Moment über diesen Wohnhäusern, über den Leben ihrer Bewohner zusammenbrechen.
Irgendwann holt es uns alle ein, dachte Monica. Der Regen, mittlerweile mehr ein kondensierender Nebel, benetzte ihr Gesicht, kaum dass sie aus dem Wagen stieg. Das spärliche Licht und der Kohlerauch in der Luft verliehen dem Ort ein seltsam mittelalterliches Flair. Ein sicherer, selbstbestimmter Weiler, bis eines Tages wie aus dem Nichts das Grauen Einzug hielt. Oder vielmehr mitten unter diesen Menschen sein Haupt erhob. Wenn sie sich festlegen müsste, wäre die wohl verlässlichste Vermutung, dass derjenige, der den Jungen auf dem Gewissen hatte, ein Bekannter von ihm war. Auf jeden Fall war es naheliegender, als davon auszugehen, dass ein Fremder ihn umgebracht hatte.
»Das da muss es sein«, sagte Crawford überflüssigerweise und deutete auf das einzige Haus, in dem hinter den Vorhängen Licht brannte. Ein Streifenwagen parkte direkt davor. Monica nickte. Crawford hatte eine Dose Energydrink geleert, bevor sie den Parkplatz des Krankenhauses verlassen hatten. Und dann noch eine an der Abzweigung kurz hinter Garve. Er war um ein unverfängliches Gespräch bemüht gewesen und hatte Spekulationen zum Fall angestellt, während sie eine SMS an ihre Mutter geschickt hatte, in der sie ihr erklärte, dass sie vorerst nicht nach Hause kommen würde.
Irgendwann hatte Crawford es aufgegeben, sodass sie die restliche fünfundvierzigminütige Fahrt durch die nächtliche Finsternis, mitten durch die Berge, schweigend verbracht hatten. Zur Ablenkung hatte sie versucht, sich im Stillen ein Bild von ihrem neuen Kollegen zu machen. Sie registrierte, wie ordentlich und gepflegt das Innere seines Wagens aussah. Sie bemerkte auch die Muskelstränge und Venen an seinen Unterarmen, weil er vor der Fahrt seine Hemdsärmel hochgekrempelt hatte. Den Großteil seiner Muskelmasse schien er um den schmalen Schultergürtel und den Nacken herum zu tragen, der beinahe so breit war wie sein Kopf. Er erinnerte sie an einen Kater. Auch seine deformierte Nase war ihr nicht entgangen, sie nahm an, dass sie vom Boxen stammte. Im Grunde würde jede Form von Kampfsport zu ihm passen, wo er seine Unsicherheit doch mit sich herumzutragen schien wie eine zweite Haut.
Sie folgte Crawford über den Gartenweg zur Haustür und ließ ihm den Vortritt. In einer Nacht wie dieser war es nur fair, dem armen Vater den zusätzlichen Schock zu ersparen, wenn aus der Dunkelheit plötzlich eine Hünin von einer Frau vor seiner Haustür auftauchte.
Monica registrierte die Garage rechts vom Haus. Ein kleiner vernachlässigter Garten war im schwachen Schein, der durchs Oberlicht über der Haustür fiel, zu erkennen: eine rechteckige Rasenfläche, die schon lange nicht mehr gemäht worden war, und Pflanztöpfe, in denen nur noch Unkraut wucherte. War der Besitzer des Hauses zu beschäftigt, um sich um derlei Kleinigkeiten zu kümmern? Oder gab es andere, familiäre Probleme? Probleme von der Sorte, die ein Kind dazu brachten, von zu Hause wegzulaufen und sich in einem Albtraum wiederzufinden? Die Sorte Probleme, die einen Vater dazu bringen konnten, seinen Sohn zu töten und es nach etwas anderem aussehen zu lassen?
Ihre Gedanken kehrten zurück zu dem Leichnam auf dem Obduktionstisch. Diese eigenartige Position, in der er abgelegt worden war, die eingedrückte Luftröhre. Was für ein Vater könnte seinem eigenen Kind so etwas antun? Die grausame Antwort, die ihr eigener Verstand ihr präsentierte, aber lautete: so mancher. Mehr, als man vermuten würde, unter den entsprechenden Umständen.
Nach einem kurzen, kräftigen Klopfen von Crawford öffnete eine uniformierte Polizistin die Tür, und Monica zog den Kopf ein, um ins Haus zu treten. Die Beamtin – Police Constable Carol Stewart, wie sie sich mit leiser Genugtuung entsann – führte sie in den Flur.
Sogleich fiel ihr auf, dass Stewart eine Pistole am Gurt trug. Die Highlands waren der einzige Teil Schottlands, wo Polizisten standardmäßig bewaffnet zu Einsätzen fuhren, die nicht als Notfälle eingestuft waren. Etwas, woran Monica sich noch immer nicht gewöhnt hatte. Unwillkürlich kam ihr das Motto der schottischen Polizei in den Sinn – »Wir sorgen für Ihre Sicherheit.« Aber wenn nötig, schossen sie auch auf einen.
Monica legte Stewart eine Hand auf den Arm und raunte ihr etwas zu. Sie wollte ganz sicher sein, bevor sie dem Vater gegenübertrat: »Haben Sie ein Foto von Robert?«
Stewart, die eine ordentliche Kurzhaarfrisur und eine Brille mit breitem Gestell trug, senkte den Blick auf Monicas Hand, ehe sie mit dem Kinn auf eine Pinnwand hinter ihr deutete.
Monica sah sich die Collage, die das Leben der hier wohnhaften Familie dokumentierte, eingehend an: sonnengebräunte, strahlende Gesichter, offenbar irgendwo im Urlaub. Ein Geburtstagsessen in einem Restaurant und ein Junge, der ihr bekannt vorkam. Einer, den sie erst vor Kurzem in der Leichenhalle hatte liegen sehen. Dasselbe kurze dunkle Haar, derselbe zarte Flaum im Gesicht, den er mit jugendlichem Stolz trug. Ein intelligent wirkendes Lächeln, man konnte sich den Jungen wunderbar bei einem Wissensquiz für Schüler vorstellen. Monica spürte die unterschiedlichsten Gefühle in sich aufwallen. Sie konnte sich glücklich schätzen, dass sie Fortschritte in ihren Ermittlungen zu verzeichnen hatten, doch gleichzeitig machte sich ein dumpfes Grauen angesichts des bevorstehenden Gesprächs in ihr bemerkbar.
PC Stewart führte sie in das kleine Wohnzimmer. Das Gasfeuer im Kamin warf ein bläuliches Licht in den Raum, darüber hing ein Landschaftsdruck. Das Deckenlicht brannte hell, als könnte es in irgendeiner Weise die Nacht und all ihre Schrecken fernhalten. Monicas Erfahrung nach würden die meisten Eltern alles tun, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es nicht um das eigene Kind ging. Dass die Polizei sich in der Tür geirrt hatte, dass man den falschen Namen hatte.
Eindringlich musterte sie die Züge von Steven Wright, als er von der unberührten Tasse Tee vor ihm auf dem Tisch aufblickte. Schon leicht ergrautes Haar, ein schmales, sorgenvolles Gesicht. Er trug Jeans und ein kariertes Hemd, das ihn irgendwie verletzlich aussehen ließ. Der arme Tropf, der völlig unpassend gekleidet zur Party erschienen war. Ihr erster Gedanke war, dass er nichts mit dem zu tun hatte, was auch immer seinem Sohn zugestoßen war. Aber leider lag man mit der ersten instinktiven Vermutung allzu oft falsch.
Monica ließ sich ihm gegenüber auf dem Sofa nieder und überlegte, ob sie ihn für dieses Gespräch nicht doch besser aufs Revier bitten sollte. Irgendetwas allerdings sagte ihr, es lieber nicht zu tun. Bis der Tote offiziell identifiziert war, hatten sie es hier mit einem Vermisstenfall zu tun. Stevens Erinnerungen wären vermutlich weniger getrübt, solange er noch hoffen konnte, dass sein Sohn am Leben war. So hart es auch klingen mochte.
»Wann haben Sie Robert das letzte Mal gesehen?«, erkundigte sich Monica. Sie beobachtete Steven Wrights Mienenspiel, wie sich sein Ausdruck schleichend veränderte, während er über eine Antwort nachzusinnen schien. Sein Blick huschte nach links und war zur Decke gerichtet. Einigen Online-Experten zufolge war dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass er die Wahrheit zu sagen gedachte und sich ernsthaft zu erinnern versuchte, statt sich eine Geschichte zurechtzulegen. Vorausgesetzt, dieser jemand war Rechtshänder, bei Linkshändern galt das Gegenteil. Und was, wenn eine Person sich an eine Lüge erinnerte?