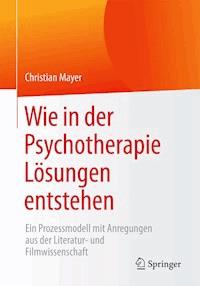Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Büchner-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Klage über die neoliberalen Zwänge, die unser Leben bis in die privatesten Bereiche zu einer Angelegenheit von Effizienz, Rendite und Wachstum machen, ist berechtigt und reicht doch nicht aus. Wer unbefriedigende Lebens- und Gesellschaftsumstände tatsächlich verändern möchte, muss bei sich selbst beginnen. Christian Mayers neues Buch versammelt Ansätze, die in der Lage sind, unsere eingefahrenen Denkmuster in Bewegung zu bringen und damit Räume und Perspektiven zu öffnen für produktive Gespräche. Denn: Wirklich Neues entsteht im noch nicht Bekannten. Als passionierter Viel- und Allesleser findet Mayer Inspiration für sein Projekt auf den Gebieten von Literatur, Psychologie und Philosophie ebenso wie in der Quantenphysik oder in alternativen Bildungstheorien. Vom bedingungslosen Grundeinkommen bis zur Digitalisierung, den Problembezirken der Umweltverschmutzung bis hin zu den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung: Mayer führt seine Leserschaft an die Grenzen unseres Alltagsdenkens. Jenseits davon entdeckt er einen reichhaltigen Ideenschatz, der das Potenzial in sich trägt, die Gesellschaft voranzubringen – hin zu einem solidarischen und nachhaltigen Miteinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Mayer
Die Grenzen meines Denkens sind die Grenzen meiner Welt
Wie wir vorhandene Potenziale für einen gesellschaftlichen Wandel mobilisieren können
ISBN (Print) 978-3-96317-171-0
ISBN (ePDF) 978-3-96317-686-9
ISBN (ePUB) 978-3-96317-712-5
Copyright © 2019 Büchner-Verlag eG, Marburg
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
www.buechner-verlag.de
Inhalt
1 Das beste aller Leben – eine Suche1.1 Zwischen Individualität und …1.2 … den Ansprüchen der Gesellschaft1.3 Veränderungen beginnen mit einer Horizonterweiterung2 Gesellschaft – von blinden Flecken2.1 Aufklärung light2.2 Die große Erzählung – in den Fängen einer Ideologie2.3 Jenseits von Konsum und Happiness3 Ökonomie – was und warum sich etwas ändern muss3.1 Zeit, sich Gedanken zu machen3.2 Das Bedingungslose Grundeinkommen, eine komplexe Angelegenheit3.3 Substanzlose Kritik3.4 Der Wandel geschieht – werden wir »traditionslos«4 Forschung – Wissenschaft im Fokus4.1 Der Fall Galilei und das Bild der Wissenschaft4.2 Abhängige Forschung – zwischen Stiftungsprofessur, Publikationsdruck und ungestellten Forschungsfragen4.3 Forschung auf Abwegen – Schattenseiten des Wissenschaftsbetriebs4.4 Methodisch inkorrekt ins Glück4.5 Was sich eine Gesellschaft leisten will5 Sprache und Denken – warum wir beidem mehr Aufmerksamkeit schenken sollten5.1 Sprache war und ist niemals neutral5.2 Einmal von der Sprache zur Welt und zurück5.3 Exkurs: das Denken denken5.4 Praktisches Denken6 Natur – faszinierend, unbegreiflich, schützenswert6.1 Der Versuch, die Natur zu verstehen6.2 Die Quantenphysik – Bildersturm in den Naturwissenschaften6.3 Skizze einer heutigen Umweltsituation6.4 Ohne sinnliche Wahrnehmung kein Bewusstsein7 Schule – zwischen Bildung, Kompetenzen, Digitalisierung und Wissen7.1 Bildung im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Kompetenzen7.2 Weil Wissen nicht nur bei Aufgaben und Problemen hilft8 Würde – über den Umgang miteinander und die Verschiebung von Werten8.1 Auf der Suche nach einem festen Ausgangspunkt8.2 Was die Würde mit Herausforderung und Biologie zu tun hat8.3 Zusammenleben in Zeiten der Ökonomisierung9 Zum Schluss – und jetzt?!9.1 Denkendes Empfinden und Neugier9.2 Horizonterweiterungen10 Quellenverzeichnis10.1 Literatur10.2 Online11 Endnoten11.1 Das beste aller Leben11.2 Gesellschaft – von blinden Flecken11.3 Ökonomie – was und warum sich etwas ändern muss11.4 Forschung – Wissenschaft im Fokus11.5 Sprache und Denken – warum wir beidem mehr Aufmerksamkeit schenken sollten11.6 Natur – faszinierend, unbegreiflich, schützenswert11.7 Schule – zwischen Bildung, Kompetenzen, Digitalisierung und Wissen11.8 Würde – über den Umgang miteinander und die Verschiebung von Werten11.9 Zum Schluss – und jetzt?!Das beste aller Leben – eine Suche
Zwischen Individualität und …
Wir leben das beste aller Leben.
Gefühlt kann, darf, soll und muss sich heute jeder ganz individuell entfalten und seinem persönlichen Lebensglück nacheifern. Gleichzeitig suggerieren uns die Medien, dass diese Fokussierung auf das eigene Ich nicht nur einen selbst, sondern in Summe sogar die gesamte Gesellschaft glücklicher macht. Aber: Stimmt das?
Dass man die Richtung seines Lebensweges selbst in der Hand hat, war nicht immer so. Früher wurde man in einen Stand hineingeboren und hatte sein Leben innerhalb desselben zu meistern. Das wurde auch kaum infrage gestellt. Um 1800 begannen die Menschen, sich im Zuge der Industrialisierung und der Aufklärung mehr und mehr aus quasi schicksalshaft festgelegten gesellschaftlichen Beziehungen zu lösen. Und dennoch sollte es bis Mitte des 20. Jahrhunderts dauern, bis sich der einzelne Mensch aus eigenen Kräften individuell entfalten konnte. Eine wirklich begrüßenswerte Entwicklung.
Und doch bietet die moderne Form der Individualisierung – ohne dass wir dies wirklich wahrnehmen – ein sehr enges Korsett. Denn dem heutigen Individualitätsstreben wurde die Forderung nach persönlicher Optimierung an die Seite gestellt. Das Streben nach Individualität wird zum unsichtbaren Käfig, wenn sie aus den falschen Motiven angegangen und durch die falschen Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Dies illustriert uns auf wunderbare Weise Richard Kraft, der titelgebende Protagonist in Jonas Lüschers Roman. Kraft ist Rhetorikprofessor aus Tübingen, der sich aufgemacht hat ins Silicon Valley, um in einem 18-minütigen Vortrag zu begründen, weshalb alles was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Eines Nachmittags sitzt der Professor bei einer Pause im Freien und schnappt das Gespräch zweier junger Entrepreneurs auf. Der eine schwärmt dem anderen vor, dass er seine Produktivität dank des sich in der Tasse vor ihm befindlichen Nahrungsmittels deutlich erhöht habe. Soylent – so der Name des Mittels – enthalte alle lebenswichtigen Stoffe und könne getrunken werden, womit keine Zeit für langwieriges Einkaufen, Kochen und Essen vergeudet werde. Kraft wird klar:
»Das also ist die Zukunft. Nein, viel schlimmer noch, die Gegenwart: Man nehme eine menschliche Tätigkeit – in diesem Fall das Essen –, befreie sie von allen kulturellen Bedeutungen, von allen historischen Bezügen, von allem emotionalen Ballast, bis man den nackten, vermessbaren Kern vor sich hat. Diese Brühe in der Schnabeltasse ist der quantifizierbare Überrest einer über Jahrtausende gewachsenen, reichhaltigen, prägenden kulturellen Tätigkeit, aufgelöst in eine Reihe von Messwerten: Soundso viel Gramm Proteine, soundso viel Gramm Fett, nullkommadrei Gramm von diesem Vitamin, eineinhalb Jota von jenem Spurenelement, etceteraetcetra … Am meisten beunruhigt ihn aber die Einsicht, dass hinter diesem Prozess der Quantifizierung der Wunsch nach einer Ökonomisierung durch Rationalisierung steckt.«1
Kraft beschreibt nichts anderes als uns in unserer Gesellschaft. Hinfort mit allem, was nicht zur Optimierung von Abläufen beiträgt – nicht nur in der Arbeitswelt. Soziale Beziehungen, kulturelle Eigenheiten, Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen werden mehr und mehr zu Faktoren zweiter Klasse. Wie soll man effizienter mit seinen Ängsten umgehen, wie optimaler hoffen?
… den Ansprüchen der Gesellschaft
Es braucht nicht viel und schon bekommt das vermeintlich paradiesische Szenario, das Namen trägt wie Moderne, Zivilisation oder Fortschritt, erste Kratzer. Je mehr ich selbst im Zentrum meiner Überlegungen stehe, je mehr ich selbst der neuralgische Punkt bin, um den sich meine Gedanken drehen, desto weniger bleibt Raum für die Idee des Citoyen, jenen Staatsbürger, der im Zuge der Französischen Revolution das Licht der Welt erblickte. Heute verblasst das Interesse am Gemeinwesen Generation für Generation, Jahr für Jahr. Das Solidaritätsprinzip habe sich überlebt, hören wir immer wieder, und was das bedeutet, spüren die Menschen immer mehr. Es ist eben nicht so, dass die Menschen in unseren Graden in diesem glücklichen Zustand leben, den uns die modernen Möglichkeiten eröffnen sollten. Das hat nichts mit Lamentieren auf hohem Niveau zu tun. Natürlich ist der Lebensstandard in Deutschland für viele so hoch wie in kaum einem anderen Land. Und dennoch bleiben immer mehr Menschen verdutzt stehen, weil sie spüren, dass sich irgendetwas in die falsche Richtung bewegt. Nicht umsonst nehmen im wohlsituierten Deutschland psychische Erkrankungen zu, während das Arbeitsklima – scheinbar als Gegentrend zur Erderwärmung – beständig kälter wird. Der Begriff der Solidarität ist vielerorts zu einer Worthülse verkommen. Und auch im hoch gelobten vereinten Europa sieht es nicht anders aus. Angela Merkel muss sich in Griechenland einen Vergleich mit Adolf Hitler gefallen lassen, in Italien gewinnen Populisten und Rechte an Macht, in Spanien sorgt die Jugendarbeitslosigkeit für eine Perspektivlosigkeit ohnegleichen und Großbritannien will gleich ganz aus der Europäischen Union aussteigen. Eine harmonische Gemeinschaft sieht anders aus. Im Blick auf die Welt als Ganzes sind wir vor allem mit unangenehmen Phänomenen konfrontiert: Welthunger, Kindersterblichkeit, (Kinder-)Sklaverei, Naturzerstörung und Meeresverschmutzung. Auch die Erkenntnis, dass unser Wohlstand von jenen Schultern getragen wird, die nichts von diesem Wohlstand haben, die beständige Forderung nach immer mehr Wachstum, die Heiligsprechung der Kaufen-Kaufen-Kaufen-Mentalität, das mittlerweile offiziell bestätigte finanzielle Auseinanderdriften zwischen Armen und Reichen, die Antwortlosigkeit der Politik auf all diese Probleme und nicht zuletzt die Beobachtung, dass die sozialen Spannungen immer weiter zunehmen – dies alles ruft in immer mehr Menschen ungute Gefühle hervor.
Der Mensch der Industrienationen ist in zwei Welten gefangen. Auf der einen Seite steht das individuelle Ich, um das sich alles dreht, weil es das gesellschaftliche Narrativ so will. Auf der anderen das gemeinschaftliche Wir, zu dem wir zwangsläufig gehören, um das wir uns aber immer weniger bemühen. Vermutlich sind sich nicht viele dieser Polarität konkret bewusst. Das mag an der beständigen Beschallung liegen, die da dröhnt, dass die Konzentration auf das Ich für alle positive Folgen habe, also auch für unser Zusammenleben. Wenn wir ehrlich sind, scheint sich dieses Versprechen nicht zu bewahrheiten. Im Gegenteil! Mehr und mehr Menschen haben Probleme mit diesem Gegensatz. Besonders dann, wenn sie diese (Welt-)Probleme einmal ernsthaft an sich heranlassen. Dann mag so manchen die Frage umtreiben, wo er sich selbst in dieser Welt sieht. Er wird sein Leben reflektieren und überlegen müssen, wie er sein bisheriges Leben bewertet. Und dann wird es kompliziert. Immerhin verlangt dieser Gedanke, tief in sich hineinzuhören, die eigenen Werte auszuloten und sich selbst als Teil einer Gesellschaft kennenzulernen, die mehr und mehr einen Gemeinschaftssinn negiert.
Gerade weil dies unangenehme Überlegungen und Erkenntnisse provozieren kann, scheuen sich die meisten davor, sich auf eine solche Selbstbetrachtung einzulassen. Sie wählen den bequemeren Weg, die Augen zu verschließen, um sich weiterhin auf die Schultern klopfen und den gewohnten Gang beibehalten zu können. Dabei haben wir als (freie) Menschen die Wahl. Wir können auch stehen bleiben und uns der Hektik entreißen, die ein Immer-schneller-immer-höher-immer-Weiter von uns verlangt. Im Stillstand, in der Kontemplation, können wir uns auf das Bild konzentrieren, das sich uns von der Gesellschaft und dem Weg, den sie beschreitet, zeigt. Veränderungen beginnen immer aus einem Selbst heraus. Also aus dem Individuum. Deshalb müssen Bedingungen geschaffen werden, in denen sich die Individualität eines jeden möglichst breit entfalten kann. Also gerade nicht innerhalb des heute beengten Denkmusters.
Veränderungen beginnen mit einer Horizonterweiterung
»Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen«, lautet ein viel zitierter Aphorismus. Wir sind gesellschaftlich und wissenschaftlich heute so weit, weil andere vor uns uns mit ihren Gedanken, Ideen und Entwicklungen den Boden dafür bereitet haben. Eigentlich müssten wir auf diesen Schultern viel weiter blicken können. Anstatt auf diesen aber den gesamten Horizont im Auge zu haben, um zu überlegen, wohin die Reise gehen soll, fokussieren wir nur einen einzigen Punkt am Horizont und steuern gedankenlos auf diesen zu. Ein Punkt, dessen Koordinaten von einer rein instrumentell verstandenen Rationalität und den Regeln des Wettbewerbs vorgegeben werden. Ein Punkt, der dermaßen zum Fetisch geworden ist, dass wir es nicht wagen, auch nur kurz zu blinzeln, geschweige denn diesen infrage zu stellen.
Besonders augenscheinlich wird dies, wenn wir uns Menschen widmen, die aktiv etwas in der Gesellschaft ändern wollen. Gerne beschimpft man sie als »Gutmenschen«, nimmt ihre Stimmen nur am Rande wahr und widmet sich dann wieder seinem Tagesgeschäft. Doch damit tut man diesen Menschen Unrecht. Lässt man sich nämlich einmal auf ihre Überlegungen ein, erkennt man, dass sie von einer anderen Warte auf Welt und Gesellschaft blicken. Technisch gesprochen, machen sie sich und die Gesellschaft zum Objekt ihrer Beobachtungen. Sie nehmen eine Perspektive ein, von der aus sie sich den Zwängen des Alltags mit all seinen Routinen und Traditionen entledigen und »von oben« auf das blicken, was sich ihnen darbietet. Was sich hier so einfach schreibt, beschreibt in Wirklichkeit eine unglaublich schwierige gedankliche Leistung. Gewohnheiten, Bequemlichkeit und Unwissenheit belassen uns im wohlbekannten Alltag. Nur wer all das überwinden kann, hat die Möglichkeit, sich der Gesellschaft nebenan zu stellen, um einen Blick »von außen« zu wagen.
Besonders gelungen ist dies Albert T. Lieberg und Fabian Scheidler in ihren Büchern Systemwechsel und Chaos. Die von ihnen darin eingenommene Vogelperspektive ist die Voraussetzung für ein systemisches Denken. Immerhin hängt alles miteinander zusammen. Eine kleine Änderung hier, kann große Auswirkungen dort zur Folge haben. Lieberg und Scheidler ermöglicht der Blick von außen, notwendige Transformationen zu identifizieren, weil sie dank ihrer neuen Perspektive in der Lage sind, Fehlentwicklungen besser wahrzunehmen. Deshalb streiten beide Autoren auch für einen Umbau institutioneller Strukturen. Sie fordern unter anderem einen radikalen Umbau des Systems Wirtschaft.
Damit sind sie nicht alleine. Solche Forderungen gibt es in unterschiedlicher Couleur – von seichten Anpassungsversuchen bis hin zu radikalen Veränderungen. Dabei scheint die Wirtschaft das Spielfeld schlechthin zu sein, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme in Angriff zu nehmen. Bedenkt man die heutige Präsenz, die heutige Macht des Wirtschaftlichen, das sich längst auch im Privatleben breitgemacht hat, kann man dem nur zustimmen. Dennoch ist es wohl zu unterkomplex gedacht, dass allein die Veränderung unseres Wirtschaftssystems – wie immer diese auch aussehen mag – eine Gesellschaft in Gänze voranzubringen vermag. Dieser Gedanke unterschlägt nämlich, dass es für bewusste Änderungen Menschen braucht. Und Menschen sind eben nicht nur durch das Wirtschaftliche bestimmt, das sie umgibt. Menschen haben ethische Fragen, organisieren ihre Gemeinschaft über Politik, versuchen mittels Kunst und Religion gänzlich unökonomische Fragen zu beantworten und sind damit beschäftigt, ihre Nachkommen zu empathischen und sozialen Menschen zu erziehen.
Möchte man gesellschaftlichen Wandel voranbringen, muss man zweigleisig vorgehen. Neben institutionellen Veränderungen muss der Mensch selbst in die Lage versetzt werden, an den herrschenden Problemen arbeiten zu können. Bildlich gesprochen, bedarf es einer Horizonterweiterung, weil nur ein breiterer Blick neue, bisher ungesehene Dinge erkennen lässt. Er böte die Möglichkeit, über den Weg nachzudenken, den eine Gesellschaft gehen möchte. Darüber, wie eine Gesellschaft aussieht, der wir zutrauen, die Anforderungen der Zukunft zu meistern. Und nicht zuletzt dürften wir von einer solchen Gesellschaft behaupten, dass sie tatsächlich frei wäre.
Die Absicht meines Buches ist es, einmal jene Themen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, die uns – obwohl sie unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben fundieren – nicht täglich in privaten wie beruflichen Gesprächen oder den Medien begegnen. Ich beschränke mich dabei auf einige wichtige Felder, in denen Potenziale für nachhaltige Veränderungen schlummern. Jedes dieser Felder beschreibt einen unterschiedlichen Winkel, aus dem ein bewusster gesellschaftlicher Wandel in Angriff genommen werden kann. Dabei geht es nicht einsinnig darum, klar umrissene Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme zu präsentieren. Vielmehr soll in diesem Prozess deutlich werden, was es heißt, die Grundlagen und Begrenzungen des eigenen Denkens zu durchleuchten, sie infrage zu stellen und – im besten Fall – zu verändern. Denn eines ist klar: Wer mitreden möchte in der Gesellschaft und nicht nur mitschwimmen, der braucht viele – teils ungewöhnliche und neue – Blickmöglichkeiten. Immerhin schützt Perspektivenvielfalt vor Perspektivlosigkeit.
Die Fragen, die mich im Folgenden interessieren, sind:
• Welche Aspekte werden im gesellschaftlichen Selbstverständnis gerne ausgeblendet?• Ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen mehr als sozialromantische Spinnerei?• Welche gesellschaftliche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung und was bedeutet das für unser Gemeinschaftswesen?• Welche Möglichkeiten der Veränderung schlummern in unserer Sprache und was heißt es, frei zu denken?• Wie lässt sich unser Naturverständnis beschreiben und welche Probleme liegen darin geborgen?• Welche Folgen haben die Priorisierung von Digitalisierung und sogenannten »Kompetenzen« in der Schule?• Was hat es mit dem Begriff der Würde auf sich und welche Werte spielen heute eine Rolle?Gesellschaft – von blinden Flecken
Damit sich eine Gesellschaft selbstbestimmt entwickeln kann, … muss sie sich ihres verkürzten Selbstverständnisses bewusst werden. Die Konzentration auf Effizienz, Effektivität und Rationalität führt zu einer verengten Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit.
Aufklärung light
Aus dem Jahr 1784 stammt Immanuel Kants berühmte Antwort auf die Frage, was Aufklärung sei. Zwei Punkte waren ihm zentral: Mut und Verstand – und zwar im Zusammenspiel. Es brauche Mut, damit der Mensch sich seines eigenen Verstandes bediene, um sich loszusagen von falschen Autoritäten. Gleichzeitig solle der Mensch Ergebnisse nur dann als gültig anerkennen, wenn er sie durch eigenes Nachdenken als gut und richtig verstehe. Seit der Essay im 18. Jahrhundert erschienen ist, hat er nichts von seiner Bedeutung verloren. Auch heute noch dürfen sich Schülerinnen und Schüler zumindest durch Auszüge dieses Schriftstücks arbeiten. Er gehört zum Bildungskanon einer modernen Gesellschaft und das ist auch sinnvoll. Immerhin leben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft.
Heute spricht man eher von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, doch gehen beide Termini aus der Aufklärung hervor. Dabei scheint die Phrase des »Aufgeklärt-Seins« in den vergangenen Jahrhunderten einen inflationären Gebrauch erfahren zu haben. Bereits im beginnenden 19. Jahrhundert schrieb August Wilhelm Schlegel, dass die Aufklärung versuche, auch sprachlich in den gesellschaftlichen Verhältnissen Fuß zu fassen und so höre man von aufgeklärten Regierungen reden, von aufgeklärter Erziehung und Theologie, einer aufgeklärten Geschichte sowie einer aufgeklärten Physik und selbst einer aufgeklärten Mathematik.1 Heute sei alles »aufgeklärt«. Doch, so zweifelte Schlegel: »Wenn die Aufklärung also wirklich leistet, was sie verspricht, so wäre es unstreitig eine herrliche Bequemlichkeit, etwas zu haben, womit man alle möglichen Dinge beleuchten könnte, und sicher wäre immer das Rechte an ihnen zu sehen.«2 – Wohl mit Bedacht wählt Schlegel hier den Konjunktiv, verwendet die Begriffe »wenn«, »wäre« und »könnte«. Und verschiedene Befunde der Gegenwart unterstützen seine Skepsis beziehungsweise vertiefen sie zum Fragezeichen: Weltweit gewinnen Populisten an Einfluss, der Kampf gegen alte Missstände wie Krankheiten und Hunger bleibt akut und neue Herausforderungen wie beispielsweise die Plastikvermüllung der Ozeane oder die Klimaerwärmung kommen hinzu. Natürlich gelingt es den Menschen – global gesehen – bestimmte Themen in den Griff zu bekommen. Ernährungsprogramme hier, Atomabkommen dort. Und gerade die für Deutschland geltenden Wirtschaftsindikatoren wie Wachstum, Arbeitslosigkeit, Verschuldung und Beschäftigung deuten alle auf eine glorreiche Zukunft hin – zumindest auf dem Papier. Unterm Strich brauchen wir uns aber dieser Erfolge nicht zu rühmen. Für Menschen des 21. Jahrhunderts, die sich vernünftig schimpfen, sind die zu lösenden Aufgaben brennend aktuell und beängstigend groß. Die unwiederbringliche Zerstörung natürlicher Ressourcen, immer noch knapp eine Milliarde hungernder Menschen weltweit, über drei Milliarden Menschen, die in extremer beziehungsweise relativer Armut leben, die Existenz von Waffen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß, Menschen, denen nach wie vor der Zugang zu sauberem Trinkwasser, medizinischer Versorgung, Pflege und Bildung fehlt.3 Aber auch im vergleichsweise reichen Deutschland nehmen die sozialen Spannungen zu, hervorgerufen durch eine zunehmende Segmentierung in Oben und Unten.
Trotzdem: Kaum jemand würde bestreiten, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben. Diese Phrase schmeichelt unserem Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung. Aufklärung gleicht einem Heilsbegriff, etwas das wir »haben« und »sind«. Vorschnell rückt die Aufklärung selbst damit aus der Wahrnehmung, was einen kritischen Blick auf sie erschwert. Wo Aufklärung zum nicht mehr hinterfragbaren Begriff wird, unterläuft sie allerdings ihre eigenen Vorgaben. Und gerade die unzähligen ökologischen, ökonomischen und sozialen Baustellen, die uns täglich in der Presse vor Augen geführt werden, sollten uns doch über die Bedeutung dieser Vokabel nachdenken lassen.
In einem groß angelegten Entwurf haben das Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zwischen den Jahren 1939 und 1944 in ihrer Dialektik der Aufklärung getan. Ihre Erkenntnisse haben eine bis heute unangenehme Aktualität. Adorno und Horkheimer wollten wissen, ob die Aufklärung dazu beigetragen habe, den Menschen unabhängiger, freier zu machen, und ihre Antwort ist ein klares Nein. Die beiden Philosophen wenden bei ihren Überlegungen die ursprüngliche Kritik der Aufklärung auf die Aufklärung selbst an. Diese sehen sie im Scheitern begriffen, da die Aufklärung ihre kritische Haltung verloren habe und damit wieder einen vorkritischen Zustand begünstige. Ein Indiz unter vielen ist für Adorno und Horkheimer die Beobachtung, dass der Mensch die Vernunft nur noch dafür zu nutzen wisse, sich die Welt untertan zu machen, indem alles zur Ware werden, einen Preis haben und sich verkaufen lassen müsse. Für die beiden Philosophen hat der Mensch damit seine kritische Haltung verloren. Nicht mehr Reflexion, sondern Konsum und das damit einhergehende unkritische Funktionieren werden zum Fixstern, an dem sich das Leben ausrichte.4 Gut 70 Jahre nach Horkheimer und Adorno und in Anbetracht der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ist die Gültigkeit dieser Einschätzung kaum noch zu leugnen.
Sicherlich ist die Darstellung des Autorenduos getragen von einer düsteren Grundstimmung, die den positiven Erträgen der menschlichen Vernunft, den technologischen und kulturellen Errungenschaften, keinen Raum einräumt. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass die Dialektik der Aufklärung als Reaktion auf den nationalsozialistischen Faschismus entstanden ist. Damals wurde der Verstand dazu missbraucht, barbarische und kaum vorstellbare Gräueltaten zu legitimieren. Aber auch in einer gemäßigteren Version hat die Kritik der Dialektik heute nichts von ihrer Bedeutung verloren. Viele spüren, dass etwas aus dem Ruder läuft. Wenn uns hin und wieder ein ungutes Gefühl beschleicht und wir uns fragen, ob die Entwicklungen unserer heutigen Gesellschaft wirklich alle so toll und begrüßenswert sind, dann sind wir Horkheimer und Adorno ganz nah. Dann treten auch wir aus dem Kreis der ewigen Ja-Sager heraus und legen den Grundstein für ein Stück wahre Aufklärung: einen Zweifel, der zu neuen Fragen führt.
Genau besehen gibt es heute viele kritische Stimmen und diese verschaffen sich teilweise auch Gehör. Aber sie sind nicht produktiv – zumindest nicht alle. Probleme werden erkannt, es folgt aber kein Zur-Tat-Schreiten. Die Stimmung kippt, aber die Revolution bleibt aus. Scheinbar genügt es nicht, informiert zu sein. Das mag daran liegen, dass das reine Informiertsein über Missstände und die zugrunde liegenden Ursachen nichts bringt. Wenn die Information nicht wirklich in unser Bewusstsein dringt, setzt sie dort auch kein Nachdenken über die eigentlich notwendigen Konsequenzen in Gang. Ich werde hierauf später noch zu sprechen kommen.
Natürlich konnten Adorno und Horkheimer Mitte des 20. Jahrhunderts nicht ahnen, welche Quantensprünge die technische Entwicklung noch nehmen würde, trotzdem sahen die beiden damals schon, dass sich die Menschen zusehends den technischen Möglichkeiten unterwarfen und damit eine neue Form der Diktatur heranzüchteten. Durch Abstraktion und Vereinheitlichung wird alles messbar, bewertbar und beweisbar. Was sich diesem Diktat nicht unterordnen lässt, gilt als Aberglaube. Aberglaube gehört aber nicht zu einer rationalen Welt, ist damit irrational und darf von uns legitimerweise vernachlässigt werden. An dieser neuen Form der Beherrschung arbeiten wir so letztlich alle mit.5
Kritischen Sichtweisen wie dieser begegnet man auch in der Gegenwart, man sieht aber zugleich, mit welcher Vehemenz Menschen entgegengetreten wird, die an einem »Alles-ist-gut-und-schön-Weltbild« kratzen. Spielverderber mag man nicht. Die Kritik am Technikfetisch ist keine generalisierte Technikkritik. Technische Entwicklungen sind wichtig und richtig. Problematisch wird es nur dort, wo sie allein deshalb als gut und nützlich gelten, weil es sich um Neuerungen handelt. Bisweilen kann es besser sein, den Gesang des Hohelieds zu verschieben und zuerst einmal nachzufragen, hinzusehen, Erkenntnisse zu sammeln, bevor man in Euphorie ausbricht ob der neu eingeführten Technik.
Als vor über einhundert Jahren die Röntgenstahlen entdeckt wurden, machte sich die reiche Oberschicht einen Spaß daraus, auf ihren Partys Röntgengeräte aufzustellen, um sich gegenseitig die Knochen zu fotografieren.6 Das war kein kurzlebiger Trend. Bis in die Mitte der 1950er Jahre konnten sich Kunden in Schuhgeschäften ihre Füße per Pedoskop röntgen lassen, um den perfekten Schuh zu finden. Vielleicht wäre etwas mehr Skepsis gesünder gewesen. Aber besonders in unserer schnelllebigen Zeit ist abwarten und prüfen nicht in.
Die Entwicklungen im Zuge der Industrie 4.0 werden wirtschaftlich hoch gelobt – Kritisches zur Arbeitsmarktentwicklung klingt bisweilen fehl am Platz. Bei der Digitalisierung der Klassenzimmer leuchten die Augen von Bildungspolitikern, Lobbyisten und IT-Unternehmen – kritische Anmerkungen zum negativen Einfluss auf die kognitive Entwicklung von Kindern werden kaum diskutiert. Die Einführung von humanoiden Pflegerobotern löst für viele Sozialpolitiker den Pflegenotstand – diesbezügliche Einwände ob einer entsolidarisierten Gesellschaft werden kaum wahrgenommen. Unliebsamem gegenüber verschließen wir gerne die Ohren. Hier einmal genauer nachzufragen wäre ein erster Schritt zu einem wirklich aufgeklärten Leben. Nach Kant verbleibt der Mensch allerdings gerne im Zustand seiner Unmündigkeit – einfach, weil das Leben solcherart viel bequemer ist. Kant:
»Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, usw., so brauche ich mich ja nicht selbst bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen.«
Man mag sich angesichts der täglichen Informationsflut unserer modernen Gesellschaft zurecht überfordert fühlen, der impliziten Forderung Kants zu folgen und sich in Hinblick auf alle Gegenstände selbst ein Bild zu machen. Die modernen Informationsmedien aber bieten hierfür gerade die Möglichkeit. Jeder ist heute in der Lage, sich einem Thema zu widmen, sich einzulesen, Meinungen gegenüberzustellen, Tatsachen gegen Humbug abzuwägen, um sich selbst ein Bild zu machen. Zugegeben: Dies setzt einen breiten Wissensgrundstock und einen kompetenten Umgang mit den Medien voraus. Ohne das lässt sich die Qualität des Vorgefundenen nicht bewerten. Fake News, Chatbots und Co. sind die Stolpersteine und Hürden, die hier überwunden werden müssen.
Die Ausrede, man habe keine Chance, sich adäquat zu informieren, zieht heute nicht mehr. Das ist der Preis, den wir für die Allverfügbarkeit von Informationen bezahlen müssen. Natürlich braucht es Zeit, Engagement und vor allem den Willen, sich eines Themas anzunehmen und sich einzuarbeiten. Die Gegenüberstellung unterschiedlicher Sichtweisen kann dabei zu einem äußerst spannenden Prozess werden. Sich vernünftig einem Thema zu widmen, auch einmal Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die nicht der Vox populi entsprechen, kann wahre Begeisterung für ein Thema in uns auslösen. Die Personalisierung von Suchergebnissen durch Google und andere Suchmaschinen gefährdet letztlich diese Möglichkeit, auch mit widerstreitenden Positionen in einen produktiven Austausch zu kommen. Dadurch entsteht die Gefahr, unwissend in einer Blase zu leben, in der Stereotype immer wieder nur bestätigt werden. Gerne wird vergessen, dass Aufklärung kein Endzustand ist. Nichts, das man erreichen kann und dann darüber verfügt. Wer aufhört, an einem aufgeklärten Leben zu arbeiten, hat aufgehört, aufgeklärt zu sein.
Die große Erzählung – in den Fängen einer Ideologie
Zwischen Ehrgeiz und Angst
Die Marktschreier des herrschenden Systems haben dafür gesorgt, dass die Menschen mit dem richtigen Wirtschaftsverständnis sozialisiert werden: Liberalisierung der Märkte, Individualisierung der Gesellschaft, Privatisierung der (Alters-)Vorsorge, Senkung von Unternehmenssteuern und Lockerung des Arbeitsschutzes. Alles schön verpackt in das Heilsversprechen, dass eine an diesen Vorgaben orientierte Wirtschaftsordnung zur Glückseligkeit führt. Diese Themen zu diskutieren ist gefährlich. Schnell wird man in eine der bekannten Schubladen gesteckt und plötzlich befindet man sich in guter Gesellschaft mit Arbeitsverweigerern, mit Sozialversagern, mit jenen, die nicht belastbar sind.
Vielleicht liegt das daran, dass zwei Gefühle in uns miteinander ringen. Da ist der Ehrgeiz, der uns anspornt, immer besser und anderen überlegen zu sein. Der Ehrgeiz fühlt sich wohl in einer Umgebung der Leistungsorientierung. Hier kann er sich austoben. Auch wenn einige den Menschen als »faules Wesen« bezeichnen, das man zum Tun zwingen müsse, wissen doch die meisten, dass der Mensch ein (Er-)Schaffer ist. Menschen wollen etwas tun, etwas verändern. Wollen Leistung erbringen. Auch im Privaten. Diesem Streben, diesem Willen nach Leistung erst verdankt die Menschheit ihre Fortschritte. Gleichzeitig meldet sich aber die Angst. Wir fürchten uns davor, auf der Strecke zu bleiben, nicht mehr mitzukommen. Bei beidem handelt es sich um zutiefst menschliche Gefühle. Das gesellschaftliche Selbstverständnis erlaubt es aber lediglich dem Ehrgeiz, sich öffentlich zu zeigen. Schließlich sind die Ehrgeizigsten die Erfolgreichsten. Mittlerweile ist der Ehrgeiz als Tugend so etabliert, dass ein kritisches Gespräch über ihn schnell als Angriff gewertet wird. Auch wenn das nicht beabsichtigt ist. Die Gesellschaft ist hier sehr empfindlich. Immerhin geht es um nichts Geringeres als unser Weltbild, das uns zeigt, dass Ehrgeiz nicht nur belohnt wird, sondern auch unter allen Umständen gefördert werden muss. Selbst wenn das bedeutet, den Sozialdarwinismus jährlich mehr und mehr zu rekultivieren.
Die Orientierung am persönlichen Ehrgeiz, der geeicht ist auf individuellen Erfolg, darf nicht infrage gestellt werden. Deshalb ist es auch so schwer, aus der Schublade der Abtrünnigen wieder herauszukommen, steckt man einmal darin. Besonders der ökonomische Ehrgeiz wird heute geadelt, obwohl seine destruktiven Auswirkungen – neben all seinen Vorzügen – immer größere Schatten auf die gesellschaftliche Stabilität werfen. Wir leben in einer Zeit, in der Wachstum längst nicht mehr nur etwas Gutes hervorbringt, in der Produktivitätssteigerungen nicht mehr allen zugutekommen und in der die Phrase »Wohlstand für alle« längst ihren Glanz verloren hat. Aber das kann man sich nur schwer eingestehen. Schließlich war man doch sein ganzes bisheriges Leben Teil dieser Geschichte, in der die Doktrin eines Immer-Mehr unhinterfragt ist. Selten wird gefragt, wessen Schultern unseren Wohlstand tragen.
Immer mehr Menschen fürchten sich, das gewohnte Weltbild eventuell korrigieren zu müssen, dass die zunehmende Ökonomisierung des (Privat-)Lebens die Gesellschaft auseinanderreißt. Mehr und mehr scheint sich der Ausspruch der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher zu bewahrheiten: So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Dabei nähern wir uns dem großen Vorbild – den USA – an, indem wir den Sozialstaat zunehmend aushöhlen und Erfolg wie Misserfolg auf das Individuum verdichten. Schaffe es allein oder scheitere allein!
Vielleicht ist diese Entwicklung der Preis, den eine Gesellschaft dafür bezahlen muss, in einer florierenden Wirtschaft zu leben. Die Daten scheinen diese Sprache zu sprechen: Die Arbeitslosigkeit in der BRD ist von 5,3 Millionen im Jahr 2005 auf knapp 2,6 Millionen im April 2017 gesunken. Der Staatsüberschuss belief sich im Jahr 2016 auf stolze 19 Milliarden Euro, die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2010 bis 2016 betrug 2,0 Prozent, die Anzahl der Beschäftigten stieg im selben Zeitraum um 0,9 Prozent und spätestens seit 2012 ist die Verschuldung der öffentlichen Haushalte leicht rückläufig.7
Vielleicht geht es nicht anders und wir müssen uns entscheiden zwischen weniger Wohlstand und dafür mehr Gemeinschaft. Oder vielleicht ist es sogar noch gravierender und wir haben diese Entscheidung überhaupt nicht, weil ein anderes Wirtschaften nicht nur weniger Wohlstand hervorbringen würde, sondern zugleich auch keine andere (bessere) Gesellschaft. Vielleicht ist es so, wie es uns überall erzählt wird: Es braucht ein freies Spiel der Marktkräfte. Weg mit den Regulierungen! Lockerung des Arbeitsschutzes! Keine Eingriffe des Staates! Weg mit dem Protektionismus! Sozial ist, was Arbeit schafft!
So könnte man die aktuelle Lage sehen. Doch das wäre falsch.
Eine Idee auf dem Weg in die Köpfe der Menschen
Stellt man die richtigen Fragen, versteht man immer mehr, wie sich unser Bild von Wirtschaft zu dem entwickeln konnte, was es heute ist. Sucht man an den richtigen Stellen, erkennt man, welcher großen Erzählung wir eigentlich erlegen sind. Um das zu verstehen, müssen wir uns der großen Depression der 1930er Jahre zuwenden. Der Börsen-Crash in den USA löste ein bis dato unvorstellbares Leid in der Bevölkerung aus. Unternehmen gingen pleite, Arbeiter verloren ihre Stellen, die Lehre des freien Marktes lag am Boden. Dies ist die Situation, in der sich der britische Ökonom John Maynard Keynes (1883–1946) zu Wort meldet. In seiner General Theory zeigt er auf, weshalb ein entfesselter Markt nicht das bester aller Systeme sei, warum ein liberales System die Krise begünstige und eine Lösung der herrschenden ökonomischen Verwerfungen nicht gelingen könne. Als Keynes Vorschläge zur Überwindung der Krise nach viel Widerstand angenommen wurden und sich die Wirtschaft tatsächlich binnen kürzester Zeit erholte, schien der Liberalismus endgültig am Ende. Wäre da nicht Friedrich August von Hayek (1899–1992) gewesen.
Hayek startete 1931 eine steile Karriere an der London School of Economics. Er hatte den Liberalismus dermaßen verinnerlicht, dass er es kaum ertragen konnte, dass seine Sichtweise auf die Welt der Wirtschaft vielerorts als gescheitert betrachtet wurde. Während Keynes dem Staat durchaus steuernde Wirkungen zusprach, glaubte Hayek, dass Menschen nur dann frei seien, wenn sie sich den Kräften des Marktes unterwarfen. – Eine Paradoxie! Ob Hayek sich dieser bewusst war? In seinen weiteren Arbeiten übernahm er eine Idee seines Widersachers Keynes, der in den letzten Sätzen seines Buches davon sprach, dass nichts die Welt mehr beherrsche als die Ideen von Ökonomen. Selbst Menschen, die sich selbst für frei von intellektuellen Einflüssen wähnten, seien meist Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen, ist da zu lesen.
Hayek wollte das Denken der Intellektuellen verändern. Er wusste, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen konnte, sondern viel Zeit – vielleicht sogar Generationen – benötigen würde. Das aber war sein Ziel: die Welt überzeugen von der Macht des freien Marktes. Um diesen Plan umzusetzen, regte er 1944 die Gründung einer Gesellschaft an, in der sich Gleichgesinnte treffen sollten. Aus diesem Plan ging 1947 die Mont-Pelerin-Gesellschaft hervor, die ihren Namen vom gleichnamigen Dorf oberhalb des Genfer Sees ableitet. Viele Intellektuelle folgten dem Ruf, darunter Milton Friedman, Walter Eucken, Karl Popper und Ludwig von Mises. Heftig diskutierten sie, wie eine neoliberale Gesellschaft funktionieren sollte. Schnell war klar, dass man sich der zeitgenössischen Intellektuellen als gesellschaftlichen Meinungsführern annehmen musste. Das Problem: Diese Intellektuellen waren Keynesianer. Es musste den Mitgliedern der Mont-Pelerin-Gesellschaft also gelingen, diese Leute zu bekehren. Es dauerte lange, doch seit den 1970er Jahren schien das große Ziel zum Greifen nahe. Nachdem man genügend Professoren auf Linie gebracht hatte, wurden die Studienpläne und Lehrbücher vereinheitlicht, wodurch sich die Neoliberalen wie von selbst vermehrten. Der uniformierte Lehrstoff sorgte von allein dafür, dass offensichtliche Widersprüche nicht mehr erkannt werden konnten. Stattdessen trieben die Neoliberalen ihre Theorien voran. Diese Entwicklung wirkt bis heute in einer befremdlichen Eintönigkeit in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre nach. Ein für die Sozial- oder Geisteswissenschaften schwer vorstellbarer Zustand.
Anfang der 1990er Jahre verließ das liberale Denken die Sphäre der Wirtschaft und schwappte auf alle Lebensbereiche über. Plötzlich war da überall ein Markt und rationales Verhalten. Sogar in der Familie und in Freundschaften. Moral wurde zu etwas, das der Markt entscheidet. Zwar waren seit Gründung der Mont-Pelerin-Gesellschaft gut fünfzig Jahre vergangen, doch hat sich Hayeks große Vision realisiert: Eine maßgebliche Riege von Ökonomen und mehr und mehr auch das Denken der allgemeinen Bevölkerung waren von neoliberalem Gedankengut beeinflusst. Das war weder ein einfaches noch ein günstiges Unterfangen gewesen. Damit neoliberale Theorien in Studienplänen, Konferenzen und Veröffentlichungen Beachtung finden konnten, brauchte es ein millionenschweres Budget. Dieses fand man in diversen Stiftungen, Unternehmensverbänden (in Deutschland allen voran die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) und Parteien. International waren und sind die Unterstützer breit aufgestellt: Hoover Institution, American Enterprise Institute, Foundation of Economic Education, Institute for Economic Affairs, Liberty Fund, Heritage Foundation, Center of Policy Research, Cato Institute und andere. Bereits 1989 stellte der Leiter des britischen Institute of Economic Affairs, John Blundell, in seinem Beitrag »Wie man den Krieg der Ideen führt« fest:
»Seit einigen Jahrzehnten ist die finanzielle Förderung der Wirtschaftswissenschaften nun en vogue. Obwohl mehrere Hundert Millionen, vielleicht sogar Milliarden Dollar vergeudet wurden, um Lehrstühle für freie Marktwirtschaft zu finanzieren, haben wir in den Wirtschaftswissenschaften seit geraumer Zeit den Sieg davongetragen.«8
Was hier in aller Kürze geschildert wurde, hat der österreichische Ökonom Stephan Schulmeister in seinem Werk Der Weg zur Prosperität in aller Ausführlichkeit belegt. Er illustriert diesen Kampf Hayeks sehr dezidiert und erläutert gekonnt, wie neoliberale Ökonomen ihre Theorien vor Widerlegungen schützen (können), weshalb heute jeder wirtschaftlich »Gebildete« das Mantra von der Liberalisierung der Finanzmärkte herunterbetet (auf Kosten der Vernachlässigung von sozialen Zielen seitens der Politik) und warum der unbändige Glaube an die heilende Kraft eines deregulierten Marktes in den Köpfen regiert. Auch wenn empirische Daten ein ganz anderes Lied singen, die Perspektive und das Denken der Gesellschaft sind geeicht.9
»Uns geht es doch gut!«
All das ist keine Kritik am Wettbewerb per se, der durchaus Positives hat. Aber es ist eine Kritik an falsch gedachten, rein auf einer Ideologie fußenden Ausgestaltung von neoliberalen Rahmenbedingungen für den Wettbewerb, die einen Großteil der heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen zu verantworten haben. Wenn wir sagen »Uns geht es so gut wie nie«, dann entspringt diese Aussage einem (anerzogenen) verkürzten Blick. »Uns geht es gut«, weil die neoliberale Perspektive die Auswirkungen für diesen vermeintlichen Wohlstand vernachlässigt. Die Frage, wer für diesen Wohlstand bezahlt, bleibt ungestellt. Die Agenda 2010 hat Tür und Tor geöffnet für die Etablierung eines nie dagewesenen Niedriglohnsektors, die deutschen Außenhandelsüberschüsse zerstören regelrecht die Industrien anderer Nationen – besonders anschaulich ist das am Beispiel Griechenland10 zu studieren –, der Staat wird zunehmend ausgeblutet, was ihm den Spielraum für längst nötige Investitionen im Bildungs- und Gesundheitsbereich nimmt. Nicht zuletzt zerstört die Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit neoliberalen Überzeugungen den sozialen Zusammenhalt. Es verbietet sich, von einem »Wir« zu sprechen, dem es gut gehe, weil der Wohlstand, von dem gesprochen wird, von immer mehr Schultern getragen wird, die von ebendiesem Wohlstand nichts haben. Das ist Neoliberalismus in Reinkultur. Unglaublich, weil ungewohnt, aber zigmal empirisch bewiesen.
Zwischen all den sprudelnden Gewinnen der Unternehmen – Mitte 2018 berichteten die Nachrichten sogar davon, die Wirtschaft könne überhitzen – stehen die Menschen, die verzweifelt versuchen, keine Karrierechance verstreichen zu lassen. Das berühmte Hamsterrad ist längt ein Menschenrad geworden. In solch einer Gesellschaft stehen einer tief greifende Reflexion unüberwindbare Widerstände entgegen. Die gravierende Zunahme der prekär Beschäftigten, die Auflösung der Mittelschicht und die damit einhergehende Angst, jenem Teil anzugehören, der nach unten wegbricht, nährt die Furcht vor einem Leben in (sozialer) Armut. Einem Leben, das mit keinem wirtschaftlichen Erfolg aufwarten kann. Eine solche Furcht sorgt dafür, dass die Menschen funktionieren, sich anstrengen, sich der Masse anpassen und keine Energie dafür aufbringen können, etwas grundlegend infrage zu stellen. Das Wirtschaftliche scheint zum Wächter in Jeremy Benthams berühmtem Panoptikum aus dem 18. Jahrhundert geworden zu sein. Jenem legendären Gefängnisentwurf, in dessen Mitte ein einzelner Wachturm steht, mit nur einem Wächter bemannt, der aber in der Lage ist, alle Insassen zu beobachten. Eine Permanentkontrolle, gepaart mit der Angst vor Sanktionen. In solch einem Umfeld passt man sich an.
Jenseits von Konsum und Happiness
Psychische Belastungen
So unbestreitbar die unsichtbare und doch beständig spürbare Kontrolle vonseiten der Wirtschaft auf unser Leben einwirkt, so deutlich zeigen sich deren Auswirkungen. Für die Psychologen Michael P. Leitner und Christina Maslach zählt der Burn-out zu den größten Berufsrisiken des 21. Jahrhunderts. Er ist – so die Psychologen – »ein Phänomen, das überall zunimmt, das in jeden Winkel eines modernen Arbeitsplatzes kriecht, wie ein Virus wächst und die zunehmend befremdete, desillusionierte, ja sogar verärgerte Beziehung, die Menschen heute zu ihrer Berufswelt haben, vergiftet«11. Zustände wie emotionale Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Sinnentleerung und fehlende Wertschätzung sind nur die ersten Seiten eines umfangreichen Symptomenkatalogs. Häufig gehen damit Entfremdungserscheinungen einher. Die vormals gute Beziehung und Identifikation des Arbeitnehmers mit seiner Arbeit geht sukzessiv verloren. Für Leitner und Maslach liegt die Wurzel des Problems in einer sich zum Negativen hin veränderten Arbeitswelt. Die Kluft zwischen der Unternehmenswelt und den Sorgen der »einfachen« Menschen sei gewaltiger denn je. Die Zusammenschlüsse von Unternehmen zu Global Playern würden Firmenkulturen zerstören, in denen das ehemals unabhängige Unternehmen nun größeren Strategien folgen müsse und in einen kaum mehr überschaubaren Prozess eingebettet sei. Auch die von den Mitarbeitern gefühlte Ausnutzung in Verbindung mit unverhältnismäßigen Unterschieden bei den Lohnentwicklungen zwischen einfachen Arbeitnehmern und den Gehältern auf der Managementebene hinterlassen bedrückende moralische Fragen. Flankiert wird diese Entwicklung durch die neuen Kommunikationsmedien, die neben ihren positiven Effekten auch ständige Erreichbarkeit ermöglichen.12