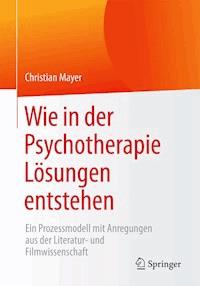Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Büchner-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Rettet die Wirtschaft … vor sich selbst!" rechnet ab mit der Mainstream-Ökonomie, mit ihren mathematischen Modellen und kühnen Kalkulationen einer Zukunft, die sich dann doch immer ganz anders gestaltet. Wie kann es sein, dass eine Profession, die häufig mit grotesken Fehleinschätzungen auffällt, in der Öffentlichkeit dennoch als unverzichtbarer Hort der Weisheit wahrgenommen wird? Christian Mayer hilft uns, ein ganz neues Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen zu entwickeln. Eines, das ökonomisches Geschehen in der Welt nicht auf eine Sammlung fehlerhafter Formeln reduziert. Das den Menschen als vielschichtiges, komplexes Wesen anerkennt, der mit dem Modell des Homo oeconomicus nur wenig gemein hat. Dabei führt uns der Autor zugleich auf ein Feld, auf dem der Kampf um die Ökonomie der Zukunft bereits begonnen hat. Denn der Widerstand gegen die neoklassische Sichtweise der Wirtschaft ist längst erwacht. So zeigt Mayer nicht nur die Schwächen des alten Ansatzes auf, sondern auch den Reichtum neuerer Ideen und Modelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Mayer
Rettet die Wirtschaft ... vor sich selbst!
Faszinierende Reise ans Ende des neoklassischen Universums
ISBN (Print) 978-3-96317-101-7
ISBN (ePDF) 978-3-96317-601-2
ISBN (ePub) 978-3-96317-657-9
Copyright © 2018 Büchner-Verlag eG, Marburg
Umschlaggestaltung: DeinSatz Marburg, [email protected]
Bildnachweise Umschlag: DeinSatz Marburg auf Grundlage von Wojciech Pijecki »Create a Lost Fantasy Micro World«, https://wegraphics.net/blog/tutorials. Wolken: Fotografie von Jessie Eastland, 2010, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sky-2.jpg?uselang=de (CC BY-SA 3.0); Graugänse: Fotografie von Matthias Fichtner, 2013, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Abendflug_der_Graug%C3%A4nse.jpg?uselang=de (CC BY-SA 3.0); Auto: Fotografie von Wikimedia-Uploader Modrak, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma serati_GranTurismo_at_night.jpg (CC BY-SA 3.0)
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
www.buechner-verlag.de
Inhalt
Von grauer Wirtschaftstheorie inmitten bunter Vielfalt
Der Mensch und das Wirtschaften
Gefangen im eigenen Weltbild
Leben, um etwas zu werden
Beschränktes Erfolgsverständnis und Elitenkult
Von Bedürfnissen, dem Konsum und warum Souveräne Idioten sind
Konsum: ein tägliches Dilemma und ein Tabu
Vom Konsum und dem Durchtrennen der Fäden
Vom Endzweck aller Produktion
Auf der Suche nach dem besten Gesellschaftsmodell: Rawls und die Utilitaristen
Neoliberale Freiheit und ihre Folgen für die Gesellschaft
Was uns die Spieltheorie über unsere Gesellschaft verrät
Was man vom Elfenbeinturm aus nicht sehen kann
Ein Stück Wirtschaftsgeschichte
Quo errat demonstrator
Der heilige Formalismus
Neoklassische Freiheit und Naturgesetzlichkeit
Warum Modelle problematisch sind und glaubhafte Prophezeiungen den Kurs der Geschichte verändern
Gewohnheiten und die Faszination der Zahlen
Zwischen neoklassischer Theorie, Realität und Fortschritt
Bedenkliche Modell-Logik: einige Beispiele
Internalisierung: wenn es der Markt regeln soll
Wissenschaftlicher Fortschritt: Wenn er nicht so will, wie wir gerne hätten
Immer mehr Nestbeschmutzer – eine neue Generation von Wirtschaftswissenschaftlern
Sprache macht Wirtschaft oder warum Arbeitnehmer eigentlich Arbeitgeber sind
Über die Metapher zum unternehmerischen Selbstbild
Die Verantwortung der Medien
Die Würde des Arbeitgebers
Wie uns das Kürzen als Sparen verkauft wird und andere Märchen
Das religiöse Fundament der herrschenden Lehre
Der große Unbekannte: der Kapitalismus
Das Geldsystem – angeschlagenes Herzstück unserer Wirtschaft
Über Geld, Zinsen und warum wir Wachstum brauchen
Geldfunktionen und Symbolcharakter
Zinsen als Lockmittel, der Zinseszinseffekt und die Zinsschuldner
Historische Entwicklungen und Geldexperimente der Vergangenheit
Das Zinseszinsverbot
Silvio Gesell: Das Geld muss der Ware gleichen
Die Brakteaten
Das Experiment von Wörgl: Eine regionale Wirtschaft floriert in Zeiten der Krise
Und heute?
»Negativzinsen«
Qualitatives Wachstum ist auch keine Lösung
Das Zinsproblem – nach wie vor ein blinder Fleck im gesellschaftlichen wie universitären Diskurs
Macht die Wirtschafts- zur Sozialwissenschaft!
Der Homo oeconomicus – ein Ideologiesklave ohne Erklärungsgehalt
Dem Homo oeconomicus ein Moralempfinden zugestehen
Der neue Homo oeconomicus – ein brauchbarer Modellmensch
Verdeckte Schieflagen: die Sache mit dem Eigentum
Den Eigentumsbegriff neu denken
Für die Entkapitalisierung des Bodens
Eigentum verpflichtet – aber wen und zu was?
Die unselige Allianz von Wirtschaft und Bildung
Bildung und die Suche nach dem Glück
OECD, PISA und der neoliberale Traum eines neuen Bildungswesens
Die plumpe Forderung nach mehr ökonomischer Bildung
Exkurs: Einseitige Lehrbücher und die Kontrolle des Denkens
Unterrichtsmaterialien und der Kampf um die Deutungshoheit
Von gallischen Dörfern oder wo Alternativen existieren
Wie wir unsere eigene Passivität legitimieren
Nachhaltige Nachhaltigkeit und warum Bilanzen nicht die Realität abbilden
Regionalität – eine Lösung?
Bilanzen sind blind für echte soziale und ökologische Vorgänge!
Komplementärwährungen: Im Geldsystem schlummert noch viel Potenzial
Was zu tun ist!
Quellenverzeichnis
Literatur
Online-Artikel
Endnoten
Register
Sachregister
Personenregister
Von grauer Wirtschaftstheorie inmitten bunter Vielfalt
Wir glauben, nur am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen würden wir mit der Welt der Wirtschaft in Berührung kommen. Allenfalls noch über die in der Politik getroffenen Entscheidungen, deren Auswirkungen wir dann im Geldbeutel spüren. Zuhause begegnen uns wirtschaftliche Themen nur noch passiv bei der allmorgendlichen Zeitungslektüre. Im Privaten – so nehmen wir an – haben Gewinnmaximierung, Leistung, Angebot und Nachfrage kein Mitspracherecht. Im Kreis der Familie, bei Freunden und beim gemütlichen Plausch mit dem Nachbarn sind wir »wirtschaftsfrei«.
Auch ich war lange dieser Ansicht. Mehr noch: Je intensiver ich mich im Studium der Wirtschaftspädagogik mit ökonomischen Theorien beschäftigte, desto mehr wuchs in mir die Erkenntnis, dass es gerade die ökonomische Fachwelt ist, die in weiten Teilen »wirtschaftsfrei« ist, also sich nicht mit der real existierenden Wirtschaft beschäftigt oder weite Teile ausblendet. Wie kam ich zu dieser Ansicht?
Durch das Wirtschaftsgymnasium zum ersten Mal mit ökonomischen Fragen in Berührung gekommen, wollte ich mehr erfahren über angebots- und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Ich wollte mehr erfahren über die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsste, um die allgemeine Wohlfahrt zu verbessern. Heute weiß ich, dass ich bereits mit diesem Bild der Stellschrauben einem Denken erlegen war, dessen Fundament im Wirtschaftslehreunterricht gegossen wurde und auf das die Studieninhalte ihre mechanischen Wirtschaftsmodelle errichten konnten. Anstatt etwas über den Menschen zu erfahren, der eigentlich den Ausgangspunkt für Wirtschaftsfragen bilden sollte, blieb dieser blass und unnahbar. Lediglich über unbegrenzte Bedürfnisse, rationale Erwartungen und eine egoistische Nutzenmaximierung schimmerte das schwache Bild eines recht komisch gearteten Homo sapiens zwischen den Vorlesungsinhalten hindurch. Anstatt Gesprächen über Menschen, ihre Ängste, Sehnsüchte und die damit verbundenen Einflüsse auf ihr wirtschaftliches Handeln, glichen die meisten Veranstaltungen einem mathematischen Imponiergehabe.
Eine dieser Veranstaltungen ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Über 45 Minuten hinweg konstruierte unser Professor eine Formel, deren triviale Aussage darin bestand, dass Menschen weniger illegal oder ordnungswidrig handelten, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dabei erwischt zu werden, und je höher die zu erwartende Strafe ist. Als Angehörige der akademischen Zunft, so der Dozent, sollten wir nicht nur die Aussage dieser Formel kennen, sondern auch noch den Beweis für ihre Richtigkeit bekommen. Anstatt die Ergebnisse einer empirischen Studie zu erhalten, verwendete der Dozent weitere 45 Minuten darauf, uns die interne Konsistenz dieser Formel mathematisch zu beweisen. Derlei Situationen waren unser Tagesgeschäft. Als einer meiner Kommilitonen das Thema seiner Abschlussarbeit mit seinem Dozenten besprach, war ich kurz davor, den Glauben an die Wissenschaftlichkeit der Ökonomie zu verlieren. Der Kommilitone wollte ein Entscheidungsmodell für das Personalwesen entwickeln, das erklären sollte, wie Unternehmen die für sie besten Mitarbeiter finden können. Motiviert und mit vielen Ideen ging er ins Gespräch. Dessen Quintessenz war ernüchternd. Viele Punkte ließen sich nicht realisieren, da der Dozent verlangte, das Modell müsse mathematisch konstruiert werden. Auf den Einwand des Kommilitonen, er könne dann aber nicht alle wichtigen Facetten ins Modell integrieren, bekam er die Antwort, dass dies dann eben so sei. Er müsse endlich anfangen, wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten.
Kein Wunder, dass solche Situationen Fragen über Sinn und Unsinn wissenschaftlicher Methodik aufwerfen. Spätestens seit der Wirtschafts- und Finanzkrise haben viele Teile der Wirtschaftswissenschaften mit öffentlicher Kritik zu kämpfen. Und heute, Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, einer der größten Bankenrettungsaktionen der Geschichte und der heute mehr denn je brodelnden wirtschaftlichen Konflikte in Europa – aber auch im Rest der Welt – scheint sich wenig bewegt zu haben. Nicht nur, dass kaum umfangreiche und ergebnisoffene Kontroversen mit den Studierenden geführt werden, selbst heute herrscht noch Uneinigkeit über ganz grundlegende Fragen. Diese reichen von den Auswirkungen des Mindestlohns bis hin zur Frage, ob wenig regulierte Beschäftigungsverhältnisse zu mehr Produktivität und damit zu mehr Wirtschaftswachstum führen oder nicht.1
Wie kann es sein, dass sich Ökonomen über ganz grundsätzliche Fragen uneinig sind? Natürlich sind die Wissenschaften heute längst über den anachronistischen Zustand hinaus zu glauben, es gäbe nur eine Wahrheit. Multiperspektivität gehört zu den grundlegenden Eigenschaften von Wissenschaft dazu – zumindest in einem philosophischen Sinne. Uneinigkeiten auf ganz basaler Ebene aber lassen gewisse Zweifel an den Grundfesten dieser wissenschaftlichen Disziplin aufkommen. Das ist so, als würden sich Astrophysiker heute noch darüber streiten, ob das heliozentrische oder das geozentrische Weltbild richtig sei.
Viele meiner Studienkolleginnen und -kollegen betrachteten das Studium als Martyrium, das für eine gut bezahlte und erfüllende Arbeitsstelle durchschritten werden müsse. Nach Berührpunkten zwischen den Theorien der Lehrbücher und den Phänomenen der »Welt da draußen« fragten mit fortschreitendem Studium immer weniger. Vermutlich wäre auch ich recht unzufrieden und kritiklos durchs Studium gegangen, hätten nicht die anderen Zweige meines Studiums – die der Germanistik und der Erziehungswissenschaft – dafür gesorgt, mein Bewusstsein für die Historizität der Gesellschaft zu schärfen, womit unveränderlichen anthropologischen Theorien eine Abfuhr erteilt wurde. Stets verhält sich der Mensch in Reaktion auf seine Umwelt. Und diese ist immer im Wandel. Für die Erziehungswissenschaften lässt sich dieser Wandel verfolgen über die Geisteswissenschaftliche Pädagogik und ihre Hermeneutik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die durch den Sputnikschock 1957 ausgelösten Veränderung der Erziehungswissenschaft hin zur empirisch-analytischen Pädagogik und in der Folge zur Kritischen Theorie. All diese Selbstverständnisse der Erziehungswissenschaft sind Reaktionen auf gesellschaftliche Veränderungen. Eine solche Spiegelung kultur- und geschichtsbedingter Phänomene vermisste ich Großteils in den wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen. Die Unterscheidung in ein neoklassisches und ein keynesianisches Wirtschaftsverständnis, deren theoretische Fundamente selbst nie Gegenstand irgendwelcher Dispute waren, konnte doch nicht alles sein. Auch das äußerst mechanische Verständnis der Wirtschaft und die oberflächliche Besprechung des wirtschaftenden Menschen, wurden für mein Empfinden zu unterkomplex betrieben. Und das blieb nicht ohne Folgen.
Am Ende meines Studiums verließ ich die Hochschule, las die Wirtschaftsnachrichten, hörte und sah, welche ökonomischen Probleme es zu lösen galt – und fühlte mich nicht in der Lage, kompetente Antworten geben zu können. Diese unbefriedigende Situation bereitete den Nährboden für meine Suche. Ich begann zu fragen, welche anderen Sichtweisen es auf die Welt der Ökonomie gibt. Ich begann nach jenen Themen, Theorien, Autoren und Denkschulen zu suchen, die es nicht in die ehrwürdigen Hallen einer universitären Massenveranstaltung geschafft hatten. Dabei sollte ich auch erfahren, dass nicht Erklärungsgehalt, nicht Prognosefähigkeit, nicht wirtschaftspolitische Relevanz die Kriterien des Für und Wider einer Aufnahme in den Lehrkanon bilden, sondern Bequemlichkeit, Unwissenheit und Kritiklosigkeit der (Nachwuchs-)Elite sowie wirtschaftliche Interessen.
Was ich jenseits dessen fand, was wir herrschende Meinung nennen, war überwältigend! Die Zahl kritischer Experten ist enorm. Nur gehen ihre Stimmen meist unter in den Geräuschen des hektischen Alltags. Hier, fernab des Mainstreams, fand ich probate Antworten und Erklärungen auf aktuelle Fragen. Hier erkannte ich, dass Ökonomie mehr ist als graue Einheitstheorie. Hier lernte ich aber auch, dass Ökonomie ein zu wichtiges Thema ist, um es einer elitären Minderheit zu überlassen.
Es ist wichtig, dass wir uns ansehen, wie der Großteil der Mainstreamökonomen die Welt sieht. Gemeint ist die Sichtweise der Neoklassiker. Also jene Denkschule, die uns vorwiegend in Zeitungen, dem Fernsehen und in Talkshows begegnet. Diese Analyse ist wichtig, denn ein ums andere Mal wollen Experten wirtschaftliche Probleme mit den immer gleichen Denkmodellen lösen. Modelle, die viele heutige Probleme erst geschaffen haben und selbst kaum noch durchdacht werden. Modelle, die durch den sakralen Schein universitärer Hallen geheiligt und damit fast unangreifbar werden.
Denn – und das ist das Ermutigende – es gibt sie, die Lösungen für unsere Probleme. Doch um diese zu verstehen, müssen wir uns in einem ersten Schritt klarmachen, warum wir sklavisch einem Wirtschaftswachstum hinterherhecheln, warum die Schuldenberge systembedingt wachsen müssen, warum Geld heute mehr Herrschafts- denn Tauschmittel ist, warum all die hochgepriesenen Lösungsversuche für Länder der sogenannten Dritten Welt scheitern müssen, warum das Geld allen Sparmaßnahmen zum Trotz scheinbar immer weniger wird und warum heute ein fast unbemerkter Kampf um die Deutungshoheit wirtschaftlicher Realität herrscht. Haben wir all das verstanden, können alternative Möglichkeiten keimen und heranreifen.
Wer das versucht, wer seinen Kopf aus der Masse erhebt, dem weht ein eisiger Wind entgegen. Schließlich begleiten uns zwei mahnende Vokabeln Tag für Tag. Der Kabarettist Volker Pispers nennt sie die Götter kapitalistischer Staaten: Wachstum und Produktivität. Sie sind es, denen wir huldigen, denen wir alles unterordnen. Wohlstand und Lebensstandard sind Geschenke dieser Götter. Wer immer sie kritisiert, weiß – so der häufig zu hörende Vorwurf – deren Bedeutung für unsere moderne Wohlstandsgesellschaft nicht zu schätzen. Dabei wollen viele deren Bedeutung für unser Leben gar nicht in Abrede stellen. Wir benötigen eine funktionierende und florierende Wirtschaft. Doch brauchen wir keine unangreifbaren Götter, denen unreflektiert gehuldigt wird. Fragwürdiges und Ineffizientes bleiben ansonsten tabuisiert.
Derzeit beginnt der sakrale Schild, der diese Götter umgibt – bestehend aus Gewohnheiten, Indoktrinationen und gesellschaftlichem Desinteresse an wirtschaftlichen Fragestellungen –, zu bersten. Viele tragen mittlerweile dieses Gefühl in sich, dass irgendetwas Grundlegendens in unserem Wirtschaftsverständnis nicht stimmen kann. Aber noch sind wir nicht in der Lage, diese Götter zu entzaubern. Um sie argumentativ zu säkularisieren, müssen wir bei ganz grundlegenden Dingen beginnen und uns von verkrusteten Denkgewohnheiten befreien. Ludwig Wittgenstein hat dies passend beschrieben:
»Man muß beim Irrtum ansetzen und ihn in die Wahrheit überführen. D. h. man muß die Quelle des Irrtums aufdecken, sonst nützt uns das Hören der Wahrheit nichts. Sie kann nicht eindringen, wenn etwas anderes ihren Platz einnimmt. Einen von der Wahrheit zu überzeugen, genügt es nicht, die Wahrheit zu konstatieren, sondern man muß den Weg vom Irrtum zur Wahrheit finden.«2
Kehren wir also zurück zu ganz grundsätzlichen Annahmen über die Wirtschaft. Nehmen wir Altbekanntes einmal auseinander und schauen nach, was zutage tritt. Machen wir keinen Halt vor Tabus und legen wir sogar unsere Sprache auf den Seziertisch.
Der Mensch und das Wirtschaften
Gefangen im eigenen Weltbild
Leben, um etwas zu werden
Viele Menschen schuften und arbeiten bis über ihre Grenzen hinaus. Viele tun dies aus Angst, in prekäre Verhältnisse abzurutschen. Aber auch gut situierte Menschen und Menschen, denen diese Angst nicht im Nacken sitzt, wirtschaften ohne Unterlass. Es lässt sich kaum bestreiten, dass Menschen – zumindest in den Industrienationen – nicht ausschließlich wirtschaften, um zu überleben. Eigentlich könnten viele weniger arbeiten, einen Gang zurückschalten und würden dennoch ihr tägliches Brot verdienen. So scheint der Mensch in unseren Breitengraden aber nicht gestrickt zu sein. Ein erwünschter Zustand ist nur so lange Ziel, bis er realisiert wurde. Danach meldet sich wieder diese Ruhelosigkeit zu Wort. Das mag nicht zuletzt an den modernen gesellschaftlichen Strukturen liegen, an den Marketingkonzepten der Unternehmen, die uns ständig sagen, was wir zu brauchen haben. Das neueste Smartphone, die aktuelle Designerhose, die angesagteste Sonnenbrille, das trendigste Auto, das coolste Irgendwas. Das ist mittlerweile ein alter Hut. Woher aber kommt das Bedürfnis nach diesem Immer-Mehr? Gibt es Gründe dafür, die unabhängig von konkreten medialen Einflüssen sind?
Der Frage nach dieser Rastlosigkeit ging auch der Wiesbadener Philosoph Helmuth Plessner in den 1930er Jahren nach. Da sein Vater jüdischer Herkunft war, musste er Deutschland 1933 verlassen. Durch sein Exil in den Niederlanden war es Plessner kaum möglich, in Fachkreisen Gehör zu finden. Besonders nicht im nationalsozialistischen Deutschland. Erst in den 1980er Jahren wurde ihm die späte Ehre zuteil, mit seinen Beiträgen zur Philosophie Anerkennung zu finden. Und es sollte nochmals zehn Jahre dauern, bis auch seinen sozialen Studien respektzollend Beachtung geschenkt wurde. Warum erschafft der Mensch Kultur, wollte Plessner wissen. Damit ging sein Blick nicht nur weit über die ökonomische Sphäre hinaus, sondern erfasste auch diejenigen Motive menschlichen Handelns, die nicht oder nur teilweise von wirtschaftlichen Erwägungen bestimmt sind.
Ursprünglich von einem biologischen Verständnis ausgehend, näherte er sich später dem Menschen über einen philosophischen Weg. Seinem früheren naturwissenschaftlichen Metier treu bleibend, startete Plessner seine Überlegungen am Übergang vom Tier zum Menschen. Für ihn ist allein der Mensch in der Lage, sich seines eigenen Erlebens bewusst zu werden. Also über sich nachzudenken und seine Erfahrungen zu interpretieren. Der Mensch hat ein Inneres und wird sich selbst nur über Reflexion bewusst. Für eine Beobachtung seiner selbst muss es dem Menschen möglich sein, außer sich stehen zu können. Der Mensch hat etwas Inneres, etwas Geistiges und etwas Äußeres, einen Körper. In diesem Zwiespalt gefangen, muss sich der Homo sapiens finden. Indem Plessner dem Tier diese Existenzweise nicht zubilligt, wird für ihn das Tier zur reinen Natürlichkeit, das ausschließlich seinen Instinkten folgt. Diese Instinktsicherheit ist dem Menschen durch sein Geistiges und damit durch seine Freiheit verloren gegangen. Da nun dem Menschen aber die Möglichkeit gegeben ist, über sich selbst und sein Leben nachzudenken, wird der Mensch erst durch das Machen zum Mensch, erst hier unterscheidet er sich vom Tier. Der Mensch ist also gezwungen, ein Leben zu führen, sich eines zu erschaffen.
Warum sich aber so etwas wie Kultur schlechthin entwickelt – unabhängig davon, welchen Kulturkreis man sich ansehe –, ist damit noch nicht beantwortet. Weder spirituelle Theorien noch der gerne genommene naturalistische Argumentationsweg über Darwin oder Freud halten für Plessner eine überzeugende Erklärung bereit. So kann ihm niemand eine vernünftige Erklärung für die Entstehung des Geistes präsentieren. Während die eine Seite den Nutzen, das sachlich Objektive aus den Augen verliert, kann die andere das »Überwerkzeughafte« nicht begreiflich machen. Sowohl naturwissenschaftliche als auch geisteswissenschaftliche Vorstellungen verabsolutieren ein bestimmtes menschliches Symptom. Den eigentlichen Grund für diese ständige Unruhe, das fortwährende Streben nach Mehr, sieht Plessner in der menschlichen Existenzform selbst. Es bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als sein Leben, in das er mit der Geburt geworfen wurde, zu gestalten, zu leben. Erst durch das Erschaffen kann der Mensch Einklang finden, eine Harmonie zwischen Natur und Geist. »Der Mensch lebt also nur, wenn er ein Leben führt.«3 Aus dieser Perspektive können wir auch verstehen, warum Menschen beständig Anforderungen an sich stellen. Erst in der Übersteigerung gelingt eine Kompensation dieser Gleichgewichtslosigkeit. Hierin erklärt sich diese Unrast des Menschen, dieses Getriebensein. Fälschlicherweise verstehen viele diesen Drang, die Umwelt zu verändern, als Beweis dafür, dass der Mensch wirtschaftlich etwas erreichen möchte. Wohlgemerkt entlädt sich dieses Drängen aber nicht nur in wirtschaftlichem Tun, sondern eben ganz generell in der kulturellen Entwicklung. Also auch in der Lebensgestaltung, gleich wie diese aussehen mag. Heute aber hat sich ein Credo unseres Denkens bemächtigt, das das Streben nach mehr vorwiegend ökonomisch erklärt. Dies belegt unser gesellschaftliches Selbstverständnis: Etwas ist gut und brauchbar, wenn es sich in bare Münze wandeln lässt oder die persönlichen Karrierechancen verbessert.
Beschränktes Erfolgsverständnis und Elitenkult
Ob wir etwas erreicht haben, messen wir häufig daran, wie hoch das Einkommen oder wie prestigeträchtig die Anstellung ist. Das ökonomische Umfeld ist Lebensraum und Richter in einem. Der amerikanische Ökonom Gary S. Becker ging sogar so weit, ökonomische Theorien auf Bereiche menschlichen Zusammenlebens zu übertragen, die bei oberflächlicher Betrachtung nichts mit wirtschaftlichen Themen zu tun haben. Er begutachtete die Rassendiskriminierung, die Ehe samt deren Scheidung, die Bevölkerungsentwicklung und die Kriminalität ökonomisch. Selbst die Familie musste sich in sein wirtschaftliches Korsett pressen lassen. Becker glaubte, die Menschen würden sich immer und überall rational, nutzenmaximierend, kurz: ökonomisch verhalten. Für solch einen Imperialismus gab es dann 1992 auch den »Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel«; einen Preis, der fälschlicherweise als Wirtschaftsnobelpreis in der Presse firmiert.4
Die Wirtschaft ist heute die alles bestimmende Macht. Ökonomisch erfolgreiche Menschen schaffen es auf Titelseiten, in Sondersendungen, in die Tagesschau. Kulturelle Erfolge allenfalls ins Feuilleton. Mütter und Väter, die ihr Leben erfolgreich damit bestreiten, ihre Kinder zu sozialen, empathischen und beziehungsfähigen Menschen zu erziehen, nicht einmal dahin. Die Wirtschaft bestimmt den Menschen, sie ist der neuralgische Punkt, um den sich das Leben dreht. Wir sind in diesem Weltbild gefangen. Nicht weil es das einzig Wahre wäre, sondern weil wir es nicht anders kennen. Dagegen weiß die Pädagogik, dass
»der Mensch durch Arbeit, durch Ausbeutung und Pflege der Natur, seine Lebensgrundlage schaffen und erhalten [muss] (Ökonomie), er muss die Normen und Regeln menschlicher Verständigung problematisieren, weiterentwickeln und anerkennen (Ethik), er muss seine gesellschaftliche Zukunft entwerfen und gestalten (Politik), er transzendiert seine Gegenwart in ästhetischen Darstellungen (Kunst) und ist konfrontiert mit dem Problem der Endlichkeit seiner Mitmenschen und seines eigenen Todes (Religion). Zu Arbeit, Ethik, Politik, Kunst und Religion gehört als sechstes Grundphänomen das der Erziehung. Der Mensch steht in einem Generationenverhältnis, wird von Angehörigen der ihm vorausgehenden Generation erzogen und erzieht Angehörige der ihm nachfolgenden Generation«5.
Genau betrachtet müssen wir das herrschende Weltbild als ein sehr verengtes Weltbild entlarven. Wir streben nicht (nur) nach mehr, weil wir wirtschaftlich vorankommen wollen. Wir kommen wirtschaftlich voran, weil wir nach mehr streben. Dieses Mehr rein ökonomisch zu fassen ist Ausdruck eines stark beschnittenen Selbstbilds. Und in dieser begrenzten Sicht steckt die Gefahr, sich nicht mehr vorstellen zu können, dass vieles anders sein könnte. Nicht in einer verklärten und völlig unrealistischen Vorstellung, sondern in einer absolut bodenständigen.
Die Wirtschaft ist die treibende Kraft, der sich alles unterordnen muss. Ökonomen werden zu Allwissenden. Sie geben sogar auf ganz unökonomischen Gebieten Rat. Heute ist kaum noch eine gesellschaftspolitische Debatte möglich, ohne sich die Auskünfte eines Ökonomen einzuholen, weiß der Soziologe Jens Maeße von der Universität Gießen. Werden etwa Bildungsexperten, Soziologen und Sprachwissenschaftler »nur« als Experten für ihre Disziplin interviewt, sprechen wir Ökonomen eine »Generalzuständigkeit« zu, um die großen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Kaum bemerkbar herrscht hier eine Schieflage. Während Ökonomen offiziell als Experten für das Schicksal der Europäischen Union, die Menschen in Griechenland, oder für die deutschen Steuerzahler gehandelt werden, haben die Sozial- und Gesundheitsexperten, die auf die zunehmende Armut hinweisen, einen schlechteren Stand. Sogar Rechtsexperten treffen, wenn sie die Rechtmäßigkeit der geldpolitischen Maßnahmen von Mario Draghi in Zweifel ziehen, bei Politikern auf taube Ohren. So bedeutend die Expertisen dieser anderen Wissenschaftler sind, so wenig entfalten sie eine Universalmacht, wie das bei den Wirtschaftswissenschaftlern der Fall ist. Mit ein Grund hierfür ist das akademische Prestige. Den Wirtschaftswissenschaften ist es wie keiner zweiten Disziplin gelungen, einen Elitekult zu erzeugen. Durch Rankings zu Forschungsleistungen, der Etablierung von Top-Universitäten und dem damit einhergehenden Versuch, wissenschaftliche Leistungen objektiv messen zu wollen, ist dieser Prozess in Deutschland seit den 1990er Jahren zu beobachten.6 Mit der Folge von Wirtschaftswissenschaftlern als Gesellschaftsoberhäuptern. Natürlich muss eine solche Situation zu der seit Langem zu beobachtenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche führen. Es ist nur verständlich, dass in einem solchen Umfeld der ökonomisch Erfolgreiche zum Helden wird. Wenn wir die Wirtschaft aber als etwas sehen, das neben Politik, Ethik, Religion, Kunst und Erziehung zu einer Grundaufgabe menschlicher Lebensführung gehört, dann befreit diese Erkenntnis. Nicht von den wirtschaftlichen Zwängen unserer Gesellschaft, die wir durchaus benötigen. Sie befreit vom Irrglauben, wirtschaftliches Schaffen entspränge einer Motivation, die anderen Motivationen vorausginge. Ein solches Bewusstsein ist bitter nötig, wollen wir das System Wirtschaft verstehen und etwaige Irrwege erkennen. Denn nur die Befreiung aus dem verengten Weltbild schafft die Möglichkeit, unvoreingenommen, unbeeinflusst das Bekannte zu durchdenken.
Von Bedürfnissen, dem Konsum und warum Souveräne Idioten sind
Konsum: ein tägliches Dilemma und ein Tabu
Wer sich an kalten Wintertagen 75 Mal eine wohlig warme Badewanne gönnt, könnte sich für die hierfür nötige Wassermenge auch ein Kilogramm Rindfleisch genehmigen. Die verbrauchte Wassermenge wäre identisch. Konkreter: Für die Herstellung eines Kilogramms Rindfleisch braucht es 15.000Liter Wasser. Schließlich will das Vieh getränkt, das Getreide gesät und geerntet und der Stall gereinigt werden. Weiter ist die Rindfleischproduktion gemäß WWF-Report der größte Flächenfresser überhaupt. Außerhalb der EU werden für ein Kilogramm 49Quadratmeter – in Deutschland aufgrund der industriellen Produktion »nur« 27Quadratmeter – benötigt.7 Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten Biosprit. Längst ist bekannt, dass einige Länder, die früher für den Anbau von Nahrungsmitteln gewirtschaftet haben, heute vermehrt Biosprit produzieren.
Die Wirtschaft ist geprägt durch derartige Gegensätze. Selten hat eine Konsumentscheidung nur positive Folgen. Deshalb sind wirtschaftliche Fragen stets auch gesellschaftliche Fragen. Die Menschen müssen entscheiden, ob Nahrungsmittel wie Mais auf dem Teller oder doch im Tank landen sollen. Unterstellen wir eine gewisse menschliche Verantwortung und sehen wir den Menschen als moralisches Wesen, dann kommen wir nicht umhin, uns solchen Dilemmata zu stellen. Das ist unangenehm, mitunter schwierig und doch unvermeidlich. Wir können solche Fragen zwar stellenweise beiseiteschieben, ihnen keine Beachtung schenken und auf morgen vertagen. Hinwegfegen können wir sie jedoch nicht. Immer wieder brechen diese grundlegenden Fragen durch die dünne Schutzschicht unserer Gewohnheiten und selektiven Wahrnehmung. Früher oder später müssen diese Punkte diskutiert werden. Und das gelingt nur, wenn wir offen über unseren Konsum nachdenken. Derartige Gespräche sind immer heikel. Denn man ahnt, dass nachhaltiger Konsum reduzierten Konsum bedeuten könnte.
Unangenehm sind diese Gespräche auch deshalb, weil die Wirtschaftswissenschaften von einer Annahme ausgehen, deren Auswirkungen bis tief ins Fundament mikroökonomischer Theorien zu spüren sind: Der Mensch gilt als unersättlich. Nie hat er genug. Er will immer mehr. Mit solch einem Menschenbild läuft die Ökonomie nicht Gefahr, dass aus einer Wachstums- eine Stagnationsökonomie werden könnte. Dass Menschen etwa durch Reflexion ihres Konsumverhaltens die Jagd nach Bedürfnisbefriedigung reduzieren könnten, wird in der neoklassischen Forschung tabuisiert. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Nein, der Mensch muss als ein seinen Bedürfnissen unterworfenes Wesen gelten. Was seine Bedürfnisse angeht, ist der Mensch nicht Herr im eigenen Haus. Dabei klafft eine riesige Rationalitätslücke. Immerhin loben die Ökonomen doch, sie würden den Menschen als unabdingbar frei sehen. Als jemanden, der durchdacht, rational sich selbst optimiert und die besten Entscheidungen treffen kann. Von diesem Bild weichen die Neoklassiker auch kaum ab. Nur wenn es um die Möglichkeit geht, sein eigenes Knappheitsempfinden kritisch zu reflektieren, wird die Freiheit an die Leine genommen. Hier finden wir auch den Endzweck allen Wirtschaftens. Zumindest in der neoklassischen Geschichte: Das Ziel des Wirtschaftens ist der Konsum – wohl gemerkt nicht eine lang anhaltende Bedürfnisbefriedigung.8 Deshalb erstrahlt auch das Konsumwachstum im Lichte des eigenen Heiligenscheins. Konsum muss stattfinden und deshalb prasseln auch ständig neue Verlockungen auf uns ein.
Vom Konsum und dem Durchtrennen der Fäden
Historisch gesehen ist diese Kaufen-Kaufen-Kaufen-Mentalität noch gar nicht so alt. Vielmehr ist sie ein historisch einmaliges Phänomen, das sich in einem Prozess Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt hat. Die Industrialisierung war – bei all ihrem Elend – Türöffner für ein völlig neues Selbstbild. Erst mit der Zeit war es den Menschen möglich, sich als freie und selbst entscheidende Individuen zu sehen. Nicht zuletzt soweit, dass die Welt der Waren die Aufgabe übernahm, dem Leben einen Sinn zu geben. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich in unserer Konsumgesellschaft etwas Charakteristisches herausgebildet: Auch wenn Arbeit für viele etwas Befriedigendes, gar Erfüllendes hat, so haben nicht wenige das Gefühl, als lebten sie in zwei Welten. In der einen – der schmutzigen – findet die Produktion statt. Hier herrschen Leistungsdruck, ein florierender Niedriglohnsektor, steigende psychische Erkrankungen und Korruption. In der anderen – der schönen – herrscht die Glamourwelt der Waren. Diese beiden Welten dürfen sich nicht berühren, gar überschneiden. Viel wird unternommen, sie getrennt zu halten.9 Immerhin muss die Welt des Konsums eine erstrebenswerte und glorifizierte Welt sein. Schließlich braucht eine Überflussgesellschaft trotz gesättigter Märkte weiter Menschen, die beständig konsumieren. Und wenn keiner mehr kaufen will, die Menschen alles haben, dann schlägt die Stunde der Verkaufspsychologen. Selbst Mittellose sollen am ständigen Konsum teilnehmen. Null-Prozent-Finanzierung und Co. machen es möglich.
Bedürfnisse entstehen dabei in erster Linie durch den Prozess der Produktion selbst. Güter dienen nicht mehr der Bedürfnisbefriedigung, sondern dem Verkauf der Waren. Werbespots erzählen nur noch von Werten, vom Image, das mit dem Kauf erworben wird. Die (technischen) Funktionen rücken in den Hintergrund. Es ist fadenscheinig zu behaupten, es ginge um die Bedürfnisse der Menschen. Die Produktion muss am Leben erhalten werden. Unser Wirtschaftssystem braucht deshalb Menschen mit ganz bestimmten Eigenschaften. Galt es früher als angebracht zu sparen, war Bescheidenheit eine Zier und versuchte man, Gebrauchsgüter mehrfach zu verwenden, muss der Verbrauch, der Konsum heute in anderem Licht erstrahlen. Das Besitzen und Präsentieren von Konsumgütern erst erschafft meine persönliche Identität und ordnet mich einer sozialen Schicht zu. Damit unsere Wirtschaft weiter laufen kann, braucht sie Konsumenten, die gelernt haben, vor der Knappheit von Ressourcen die Augen zu verschließen, und die bereit sind, verschwenderisch zu leben.10 Anstatt Geld zu sparen, um sich davon dann das ersehnte Produkt zu kaufen, ist es heute angesagter, auf Kredit zu kaufen. Konsumiere jetzt, heute, immer. Der Kunde ist nur dann König, wenn er verbraucht.
Über die Medien erfahren wir, wie sich der Verbraucherpreisindex verändert. Dank IFO-Geschäftsklimaindex bekommen wir Einblicke ins Innere der Unternehmen und hören, ob dank positiver, gar euphorischer Konsum- und damit Absatzzunahmen die Sektkorken knallen, oder ob dort eine deprimierende Stimmung herrscht, weil die Kunden nicht so richtig konsumieren wollen. Nach Weihnachten berichten uns die Nachrichten, ob der Einzelhandel in diesem Jahr wieder zufrieden war und mehr absetzen konnte als in den Jahren zuvor. Aber wo liest, sieht, hört man etwas vom Erdüberlastungstag? Jenen Tag, der angibt, ab wann eine Gesellschaft für den Rest des Jahres auf Pump und damit auf Kosten der Erde lebt. Ist dieser Tag erreicht, sind alle natürlichen wie erneuerbaren Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Brennmaterial, Wasser, Bauholz und Getreide. Es wurde alles verbraucht, was zur Verfügung stand und in entsprechender Zeit nachwachsen kann. Im Jahr 2000 war der Erdüberlastungstag am 1. Oktober erreicht, 2014 am 19. August, 2015 am 13. August, 2016 am 8. August und 2017 bereits am 2. August. All die Nachhaltigkeitserklärungen klingen angesichts dieser Entwicklung höhnisch. Und wenn man doch einmal die Nachhaltigkeit zu einem ernsthaft zu diskutierenden Thema machen möchte, gilt man schnell als realitätsfremder Enthusiast. In einer Realität, die das Bild einer unbegrenzten Warenwelt, einer Allverfügbarkeit der Ressourcen und einem ewigen Streben nach einem reicheren Leben malt, gibt es kaum Platz für Spielverderber.
In dieser Welt hat man Scheuklappen für alles, was nicht in die persönliche Lebensvorstellung passt. Die amerikanische Journalistin Elizabeth Kolbert hat mit ihrem Buch Das sechste Sterben eindrucksvoll belegen können, dass die Menschheit in einer unglaublichen Geschwindigkeit dazu fähig ist, sich ihrer Lebensgrundlage zu berauben. Längst hat das nächste große Artensterben begonnen – und endet erst, wenn der Mensch nicht mehr ist. Die Recherchen des Buches überzeugten, so dass es dafür 2015 sogar einen der begehrten Pulitzerpreise gab. Wer dem Buch Aufmerksamkeit schenkt, dem bleibt kaum anderes übrig, als sich mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Und das ist gar nicht so einfach. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass Konsummuster zugleich Kulturmuster sind.
»Hunde- und Katzenfleisch isst man nicht, Pferdefleisch essen nur mache, Rindfleisch ist kein Problem, wenn man nicht Vegetarier ist. Wer Fleisch isst, muss das in der Regel nicht begründen, wer nie Fleisch isst dagegen schon. Männer brauchen Fleisch, Frauen eher nicht. Vor allem informell, aber auch formell geregelt ist, wo und wie man essen darf und wo und wie nicht,«11
so der Wirtschaftssoziologie Reinhold Hedtke von der Universität Bielefeld.
Konsum findet innerhalb gesellschaftlicher Konventionen statt, in denen dem Einzelnen aber eine hehre Position zugesprochen wird. Der Kunde ist König, ist Souverän. Das ist das Credo der Neoklassiker. Unternehmen können und werden nur das herstellen, was die Kunden im Vorfeld auch nachfragen. Produzieren die Unternehmen an den Wünschen ihrer Kunden vorbei, werden diese Unternehmen über kurz oder lang vom Markt verschwinden (müssen). Der Kunde bestimmt die Richtung. – So zumindest die Theorie. Eng verwandt mit der Konsumentensouveränität ist die Konsumentenfreiheit. Wir bestimmen nämlich nicht nur, was wir haben möchten und was produziert werden soll. Wir sind auch frei zu entscheiden, wann wir was wo kaufen möchten. Viel wurde schon darüber gestritten, wie frei wir nun wirklich sind und ob nicht die Macht der Konzerne mit ihren finanzstarken Marketingabteilungen nicht doch Bedürfnisse in uns wecken, die wir ohne entsprechende psychologische Werbestrategie nicht haben würden. Es gibt Untersuchungen, die diesen Verdacht bestätigen und solche, die ihn widerlegen. Gehen wir von einem souveränen und freien Konsumenten aus, wird er sich reflektiert entscheiden können, ob er dieses Bedürfnis befriedigen möchte oder nicht. Dass es aber offenbar hier eine gewisse Machtasymmetrie gibt, zeigt uns schon die Existenz von Verbraucherberatungen.12 Scheinbar sind wir nicht in der Lage, alle für uns nötigen Informationen zusammenzutragen, um dann daraus begründete Schlüsse zu ziehen. Deshalb kommt der Verbraucherbildung ja auch diese immense Rolle zu. Wir brauchen unabhängige Tests, Gutachten, Beratungen, Tipps, wie wir uns in der Welt des Konsums »richtig« bewegen. Das Ziel ist eine möglichst hohe Transparenz zu schaffen, auf dass wir wirklich frei und nach unserem Gutdünken entscheiden können. Wie passend ist an dieser Stelle die Verbindung zu Kleists essayistischer Erzählung »Über das Marionettentheater« aus dem Jahre 1810. Ein namenloser Erzähler unterhält sich mit einem Tänzer über eine Marionette auf der Bühne. Ihr wird absolute Anmut und Grazie zugesprochen. Der Mensch jedoch sei zu solch einer Perfektion nicht mehr im Stande. Erst wenn er sich einer Fremdsteuerung ausliefere, sei es ihm möglich zu glänzen, von allen anerkannt und bewundert zu werden. Hierfür müsse aber das Ich verdrängt werden, zugunsten einer von außen kontrollierten Handlung. Wer tatsächlich frei sein will, der muss sich der steuernden Fäden an Händen und Füßen bewusst sein, muss sie durchtrennen können und muss darüber hinaus auch in der Lage sein, stehen zu können, wenn die helfenden Fäden nicht mehr sind. Eine solche fast schon rebellische Handlung findet sich heute aber immer weniger. Für den österreichischen Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier ist die jetzige Jugend angepasster denn je. Der Rebellentypus ist ausgemerzt. Seine Stelle hat nun der »fröhliche Konformist« inne. Dieser hat den Konsum emporgehoben zum Sinnstifter. Doch wer sich über den Konsum definiert, ist auf den Markt angewiesen.13 Wer kann, ja wer will denn da noch seine ihn steuernden Fäden durchtrennen? Das wäre ein hehres Unterfangen.
Vom Endzweck aller Produktion
Bei all den Fragen nach der Souveränität der Konsumenten, ihren echten und unechten Bedürfnissen und dem Streben nach immer besserem Konsum, verlieren wir das Grundlegendste aus den Augen. Für die Sozialwissenschaftlerin Marianne Gronemeyer geht es bei der Produktion unserer Waren vordergründig um Müll. Damit meint sie weder die Mülldeponien, die Müllverwertung oder den Plastikunrat, der sich in den Weltmeeren zu immer größeren Müllinseln sammelt. Gronemeyer sieht in der Müllerzeugung den Hauptzweck unserer Warenproduktion. Unabhängig davon, welche Ware wir uns ansehen, ihr eigentlicher Daseinszweck besteht darin, Müll zu werden. Während Brauchbarkeit und Tauglichkeit beschworen werden, wird schnelle Unbrauchbarkeit und Untauglichkeit erhofft. Heutige Waren sind bereits Müll, bevor sie überhaupt in Gebrauch genommen werden. Ständig werden neue Waren angepriesen und lassen Bestehendes veralten. Etwas kann noch so neu sein, stets und in immer kürzerer Zeit kommt etwas Neueres und verwandelt die bisherige Ware in Müll. Alles was produziert wird, ist stets nur die Vorstufe des ihm Nachfolgenden. Alles was hergestellt wird, trägt bereits den Makel des Defizitären in sich. Hauptziel unserer Gesellschaft ist es, Müll zu produzieren.
Gronemeyer, ehemalige Professorin der Fachhochschule Wiesbaden, riskiert hier eine interessante Sichtweise auf unser Produktionssystem. Positiv betrachtet kennt auch die Betriebswirtschaftslehre das von ihr beschriebene Szenario. Hier heißt es aber Produktlebenszyklus. Ein neues Produkt wird entwickelt und uns zum Kauf angeboten. Durch Werbung und dergleichen wird es bekannt, begehrt, gekauft und der Absatz steigt. Irgendwann jedoch passiert, was passieren muss. Die Kunden sind von diesem Gut gesättigt. Sie wollen es nicht mehr haben. Unternehmen versuchen dann zwar noch, mittels verschiedener Versionen die Nachfrage weiter zu stimulieren, doch irgendwann wird der Absatz rückläufig, es lässt sich kaum noch ein Gewinn erwirtschaften und das Produkt stirbt. Jetzt ist Zeit für etwas Neues und der Prozess beginnt von vorne. Von Müll ist hier keine Rede. Fokussiert werden eine möglichst lange und profitable Wachstumsrate mit maximaler Verkaufsmenge. Und auch wenn ein Gut verkauft wird, darf weder das Bedürfnis des Kunden nach diesem Produkt für immer gestillt sein, noch sollte das Produkt auf ewig »überleben«. So muss es laut der Systemlogik auch sein. Mit Dauerhaftem lässt sich weniger Profit erzielen als mit Vergänglichem. Der Produktlebenszyklus ist ein Euphemismus der Müllerzeugung. Für Gronemeyer ist es erschreckend, dass die meisten in dieses System hinein statt aus diesem hinaus wollen.
Einen Lösungsweg sieht sie in der deutschen Sprache versteckt. Genauer im Wort »aufhören«. Auf der einen Seite meint dies nämlich das Schlussmachen, das Beenden. Auf der anderen Seite das Auf-hören, Auf-horchen. Gerade im Aufhören steckt das Lauschen, das Innehalten. Man bleibt wie angewurzelt stehen, alle Geschäftigkeit ist unterbrochen. Es geht also nicht darum, etwas besser zu machen, sondern etwas zu unterlassen. Wenn wir uns fragen, was zu tun ist, um diesen Irrsinn zu beenden, dann sieht Gronemeyer mehrere Punkte. Greifen wir zwei davon heraus. Für sie ist die Sorge um eine Weltrettung wenig fruchtbar. Niemand ist im Stande, die Welt zu retten. An solch einer Aufgabe kann man nur scheiten. Realisierbarer ist da ein persönliches Innehalten in unserer übersättigten Gesellschaft, die uns täglich von Konsens, Konsum, Konkurrenz und Konformität predigt und daran ein Versprechen für Sicherheit, Zeitersparnis, Bequemlichkeit und Anerkennung knüpft. Gegen diese Litanei können wir aufbegehren. Nur hier ist uns ein »Es reicht!« möglich. Weiter kommt es darauf an, die Macht der Systemzwänge zu erkennen. Wohlgemerkt ohne sie anzuerkennen. Hierfür braucht es Orte ohne Macht, ein Abseits, ein ruhiges Eck. Gronemeyer bringt diesen Punkt prägnant und in einer anschaulichen Sprache zum Ausdruck:
»Womöglich sind heute Orte, leer von Macht, Nischen, Abseitse, nicht mehr zu finden, sondern erst zu gründen. Das Abseits ist ein Ort für Deserteure. Der Deserteur ist der ›Nicht-mehr-Mitmacher‹ par excellence; er ist Befehlsverweigerer, er entzieht dem Machthaber seine Mittäterschaft, indem er sich heimlich[,] still und leise, vor allem aber unerlaubt von der Truppe entfernt. Er gilt darum als feige, aber das kann ihm egal sein. […] Was [aber] sind das für Orte, die leer sind von Macht? Es ist nicht von Ungefähr, dass sich so gar nichts Genaues darüber sagen lässt. Denn Orte, leer von Macht, entstehen erst dadurch, dass da Menschen sind, die sie mit ihrer Anwesenheit füllen. Sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie besiedeln. Sie werden aus einer tiefen Abneigung gegen Gleichmacherei, Vereinheitlichung und Reih und Glied erschaffen. Es sind Stätten, in denen Menschen so zusammenwirken, dass nicht alles, was man zum Leben braucht, Geld kostet. […] Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel derer, die um Integration kämpfen, bedrohlich macht, erscheint den Systemdeserteuren gerade als das Rettende. Ihre Nicht-Zugehörigkeit verheißt ihnen ein Stück Freiheit, Ohn-Macht – jene Haltung, die nichts begehrt von dem, was die Macht verwaltet, am allerwenigsten die Macht selbst – gilt ihnen als radikale Form des Widerstandes.«14
Und da ein Ziel immer einen Weg braucht, beschreibt die promovierte Erziehungswissenschaftlerin mehrere Schritte. Vereinfacht dargestellt heißen diese: Achte darauf, nicht zu vertrotteln. Entwickle eine »Sperrmüllgesinnung«; frage dich, ob du wirklich das Neueste vom Neuen brauchst, obwohl dein Altes noch funktioniert oder reparabel ist. Hilf auch den Kindern, nicht zu verblöden. Beanspruche Menschen in dem, was sie können, und lasse dich von ihnen beanspruchen. Erst so kann gegenseitiger und gemeinschaftlicher Nutzen entstehen. All das sind Gemeinplätze, das weiß auch Gronemeyer. Aber vielleicht sind sie gerade deshalb dazu geeignet, diese Kultur des Abseits zu erschaffen.
Wäre es wirklich erstrebenswert, würden alle ihren Konsum reduzieren? Immerhin brauchen wir doch Absatz, brauchen wir neue Produkte, brauchen wir Wachstum. Das ist (leider) nicht zu leugnen. Unser heutiges System ist tatsächlich auf Wachstum angewiesen. Durch technische Neuerungen, die Rationalisierung menschlicher Arbeit durch effektivere Maschinen, brauchen wir das Wachstum wie der Fisch das Wasser. Die durch den immer stärkeren Maschineneinsatz freigesetzten Arbeiter bekommen nur dann wieder eine Anstellung, wenn unsere Volkswirtschaft mit entsprechender Geschwindigkeit expandiert. Nur so entstehen an anderer Stelle neue Arbeitsplätze. Wollen wir die Arbeitslosigkeit auch nur konstant halten, so brauchen wir eine jährliche Beschäftigungsschwelle von zwei bis drei Prozent Wachstum. Von einer Reduzierung der Arbeitslosigkeit kann hier aber noch nicht gesprochen werden. Über den Hauptgrund für diesen Wachstumszwang werden wir an späterer Stelle15 noch genauer sprechen. Es ist nämlich in der Tat so, dass wir diesen nicht von heute auf morgen ignorieren können. Dennoch: Es ist ermutigend zu sehen, dass der Konsumismus immer mehr Menschen abstößt. Es etabliert sich bei vielen ein Bewusstsein, das sie innehalten lässt.
Foodsharing, ein verstärktes Interesse an Fragen über die Herkunft und die Produktionsweisen der Waren und vermehrte Aufklärungskampagnen ermöglichen es den Menschen wieder, bewusster und damit bestimmter zu leben. Nicht mehr das gesellschaftliche Gros gibt vor, was gut und richtig, was brauchbar und unbrauchbar, was in und out ist, sondern man selbst. Diese Menschen wollen wieder souverän sein, frei sein. Um diesen Status aber zu erlangen, braucht es etwas, das der Berliner Philosoph Byung-Chul Han einen Idioten nennt. Während die Intelligenten etymologisch gesehen einsichtig und verständig sind und auf Vorhandenes zurückgreifen müssen, sind sie nicht ganz frei. Sie sind eher im Dazwischen gefangen. Der Idiot hingegen denkt gänzlich Neues. Er kümmert sich nicht um Normen und Regeln, er interessiert sich nicht für das Geschwätz anderer. Der Idiot hat Mut, sich von der Orthodoxie abzuwenden, weg vom Konformitätszwang. Deshalb braucht es für tief greifende Veränderungen mehr Außenseiter, Narren, Idioten.16 Menschen, denen es egal ist, was andere über sie denken. Menschen, die gegen das Dogma der Ökonomen verstoßen und bewusst über ihre Bedürfnisse nachdenken. Menschen, die die Brisanz der Fragen erkennen, ob Essen im Tank oder im Magen landet, ob Müllproduktion Endzweck allen Wirtschaftens sein soll, um dann entsprechend ihre persönlichen Handlungen durchdacht, frei, selbstbestimmt zu wählen. Das ist angesichts einer immer angepassteren Gesellschaft alles andere als leicht. Aber keiner hat je behauptet, es sei einfach, ein Idiot – ein Souverän – zu sein.
Auf der Suche nach dem besten Gesellschaftsmodell: Rawls und die Utilitaristen
Wirtschaften hat immer etwas mit der Frage zu tun, wie die Menschen ihre Gesellschaft organisiert haben möchten, was konsequenterweise auch zu Themen wie Gerechtigkeit bzw. einer ausgewogenen Verteilung von Ressourcen führt. Die Frage nach einer gerechten Gesellschaftsordnung beschäftigte den amerikanischen Philosophen John Rawls, als er selbst kurz nach dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima dort als Soldat stationiert war und mit eigenen Augen sehen musste, zu was Menschen in der Lage sind. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass Rawls seine Doktorarbeit im Fach Moralphilosophie schrieb und sich in dieser der Beurteilung des menschlichen Charakters annahm. Berühmt wurde sein fiktives »Gerechtigkeitsspiel«. Wie würden Menschen eine Gesellschaftsordnung aufbauen, wenn sie, nachdem die Ordnung von allen akzeptiert wurde, in diese Gesellschaft geworfen würden, ohne aber im Vorfeld zu wissen, welche Person sie selbst darin wären? Heißt: Es könnte sein, dass man als Bettler in die Welt tritt oder als Milliardär. Man könnte als jemand aus einfachen Arbeiterverhältnissen in dieser Welt auftauchen oder aber in einer wohlsituierten Oberschichtenfamilie. Man könnte als Tollpatsch oder als jemand mit unglaublichen Fähigkeiten Teil der Gesellschaft sein. Niemand wüsste dies im Vorfeld – hierüber liegt Rawls berühmter »Schleier des Nichtwissens«. Vermutlich würde man versuchen, die Ordnung dermaßen zu konstruieren, dass ein materieller wie finanzieller Wohlstand gleichmäßig verteilt wären. Hier kann keiner den anderen übervorteilen. Zumindest nicht zu Beginn. Auch für Rawls widerspricht eine Gesellschaft, die ausschließlich Gleichheit anstrebt der menschlichen Natur, was unweigerlich zu ihrem Niedergang führen müsse. So bestechend Rawls Gedankenspiel auf den ersten Blick scheint, so vehement wurde es kritisiert. Von linker Seite wie von rechter. Selbst wenn alle Menschen in einem fiktiven Gedankenspiel zu Beginn (noch) gleich wären, hieße das nicht automatisch, dass alle Menschen hier und dort auch dieselben Interessen hätten.