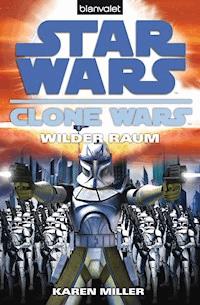5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Godspeaker
- Sprache: Deutsch
Packende High-Fantasy für die Fans von Trudi Canavan und Auftakt einer epischen Trilogie: »Die Herrscherin« von Karen Miller als eBook bei dotbooks. Ist ihr ein Leben im Staub vorherbestimmt? Die junge Hekat wächst in der Wüste Mijaks auf, wo das Leben eines Mädchens nichts wert ist – bis ein Sklavenhändler auf ihre Schönheit aufmerksam wird und sie in die Hauptstadt verschleppt. Doch obwohl sie hier ein Leben in Luxus führen könnte, hat Hekat bald höhere Ziele, als den Reichen als Edelsklavin zu dienen: ihre glühenden Ambitionen führen sie an die Seite des Kriegsfürsten Raklion, erst als Klingentänzerin, dann als seine Frau und Auserwählte des Skorpiongottes. Doch je höher Hekat aufsteigt, desto höher ist der Preis, den sie dafür bezahlen muss. Ist sie wirklich bereit, jedes Opfer zu bringen – auch wenn sie dafür den Menschen aufgeben muss, den sie am meisten liebt? »Ein absolut fesselndes Werk, voll von politischen Intrigen, Täuschungen, göttlicher Intervention, Krieg und vielem mehr.« Fantasy Magazine Jetzt als eBook kaufen und genießen: der High-Fantasy-Roman »Die Herrscherin« von Karen Miller. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1134
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ist ihr ein Leben im Staub vorherbestimmt? Die junge Hekat wächst in der Wüste Mijaks auf, wo das Leben eines Mädchens nichts wert ist – bis ein Sklavenhändler auf ihre Schönheit aufmerksam wird und sie in die Hauptstadt verschleppt. Doch obwohl sie hier ein Leben in Luxus führen könnte, hat Hekat bald höhere Ziele, als den Reichen als Edelsklavin zu dienen: ihre glühenden Ambitionen führen sie an die Seite des Kriegsfürsten Raklion, erst als Klingentänzerin, dann als seine Frau und Auserwählte des Skorpiongottes. Doch je höher Hekat aufsteigt, desto höher ist der Preis, den sie dafür bezahlen muss. Ist sie wirklich bereit, jedes Opfer zu bringen – auch wenn sie dafür den Menschen aufgeben muss, den sie am meisten liebt?
»Ein absolut fesselndes Werk, voll von politischen Intrigen, Täuschungen, göttlicher Intervention, Krieg und vielem mehr.« Fantasy Magazine
Über die Autorin:
Karen Miller wurde in Vancouver, Kanada geboren und lebt bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr in Australien. Nachdem sie ihr Studium in Kommunikationswissenschaften abgeschlossen hatte, zog sie für drei Jahre nach England. Sie arbeitete in vielen verschiedenen Berufen, unter anderem als Pferdezüchterin. Inzwischen widmet sich Karen Miller in Sydney ganz dem Schreiben.
Karen Miller veröffentlichte bei dotbooks bereits die »Godspeaker«-Trilogie mit den Bänden »Die Herrscherin«, »Die Thronerbin« und »Die Tyrannin« und die »Chroniken von Lur« mit den Bänden »Der Erbe des Windes« und »Der König des Sturms«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2019
Copyright © der englischen Originalausgabe 2007 by Karen Miller
Die englische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Godspeaker 1: Empress of Mijak« bei HarperCollins Publishers, Sydney, Australia.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2009 by Penhaligon Verlag, München, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
First published by HarperCollins Publishers, Sydney, Australia in English in 2007. This German edition published by arrangement with HarperCollins Publishers Pty Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: HildenDesign ©hildendesign www.hildendesign.de Illustration: Veronika Wunderer
Map by Karen Miller and Darren Holt.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-701-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Herrscherin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Karen Miller
Die Herrscherin
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Link
dotbooks.
Für Dave Duncan, einen Gelehrten, Gentleman und verdammt guten Schriftsteller. Danke für all den fabelhaften Lesestoff – und die Mittagessen. Mögen noch viele weitere folgen!
ERSTER TEIL
ERSTES KAPITEL
Trotz der beiden brennenden Talglampen war es dunkel in der Küche, die Luft erstickt vom Gestank ranziger Ziegenbutter und verdorbenen Ziegenfleisches. Spinnen hatten die Ecken mit widerwärtigen Netzen überzogen, in denen sie die Hülsen von Fliegen und Blutsaugern horteten. Ein Ofen aus Lehmziegeln nahm die Hälfte des Raums zwischen der Tür und dem einzigen Fenster ein. Drei Holzregale standen in der Küche, ein klappriger hölzerner Hocker und ein verschrammter Holztisch – beinahe unerhört in diesem Land, dessen Bäume schon vor Ewigkeiten versteinert waren.
In der Dunkelheit unter dem Tisch hockte das Kind ohne Namen und lauschte auf den Streit zwischen dem Mann und der Frau.
»Aber du hast es versprochen«, jammerte die Frau. »Du hast gesagt, dieses dürfte ich behalten.«
Die harte Faust des Mannes krachte auf das Holz über dem Kopf des Kindes. »Das war vor einer weiteren schlechten Ernte, Schlampe, bevor zwei weitere Dorfbrunnen vertrocknet sind! All die Münzen, die es kostet, es zu Rittern – bin ich aus Geld gemacht? Wage es nicht, dich zu beklagen –, als es geboren wurde, hätte ich es auf die Felsen werfen können, ich hätte es auf dem Amboss aussetzen können!«
»Aber es kann arbeiten, es ...«
»Nicht wie ein Sohn!« Seine Stimme knisterte wie Blitz, grollte wie Donner durch den kleinen, verqualmten Raum. »Wenn du mir mehr Söhne geworfen hättest ...«
»Ich habe es versucht!«
»Nicht genug!« Ein weiteres Donnern der Faust auf Holz. »Das Weibbalg geht. Allein der Gott weiß, wann hier wieder Händler vorbeikommen werden.«
Die Frau schluchzte, raue kleine Laute wie von einer sterbenden Ziege. »Aber es ist noch so klein.«
»Klein? Seine Blutzeit ist gekommen. Es kann zurückzahlen, was es mich gekostet hat, genau wie die anderen Weibbälger, die du geworfen hast. Das ist mein letztes Wort. Noch ein Ton und ich schlage dir die Zähne heraus und die Augen blau.«
Als die Frau es wagte, ihm den Gehorsam zu verweigern, war das Kind so überrascht, dass es sich in die Finger biss. Es spürte den kleinen Schmerz kaum; sein ganzes Leben war Schmerz, gewaltig wie die unfruchtbaren Ödländer jenseits des Gottespfahls des Dorfes. So war es schon seit seinem ersten jämmerlichen Schrei gewesen. Jetzt war es beinahe taub dagegen.
»Bitte«, flüsterte die Frau. »Erlaub mir, sie zu behalten. Ich habe dir sechs Söhne geboren.«
»Es hätten elf sein sollen!« Jetzt klang der Mann wie einer seiner knochendürren Hunde, geifernde Bestien, die in dem steinigen Garten hinter ihrer Hütte um Abfälle kämpften.
Das Kind zuckte zusammen. Es hasste diese Hunde beinahe so sehr, wie es den Mann hasste. Sein Hass war eine lodernde Flamme, tief und sicher verborgen vor den Blicken des Mannes. Er würde es töten, wenn er ihn sah, würde es an einem mageren, verschorften Knöchel packen und mit dem Kopf gegen den nächstbesten ockerroten Felsen schmettern. Das hatte er einmal mit einem Hund gemacht, der es gewagt hatte, ihn anzuknurren. Die anderen Hunde hatten das Gehirn des toten Tieres aufgeleckt und dann während der ganzen langen, kalten Nacht um den blutigen Kadaver gekämpft. Auf seiner fadenscheinigen Decke unterm Küchentisch war das Kind beim Knirschen ihrer Zähne eingeschlafen und hatte geträumt, die Knochen, an denen sie nagten, seien seine eigenen.
Aber ob gefährlich oder nicht, es weigerte sich, von seinem Hass abzulassen, dem Einzigen, was ihm gehörte. Er tröstete und nährte es, füllte seinen schmerzhaft leeren Magen in den Nächten, in denen es nichts zu essen bekam, weil die Beine der Frau gespreizt waren, weil sie in den Wehen lag oder weil der Mann von Kaktusblut betrunken war und sie schlug.
Er schlug sie jetzt, Schläge mit der offenen Hand ins Gesicht, während er fluchte und schwitzte und sich in Raserei hineinsteigerte. Die Frau war klug genug, nicht aufzuschreien. Das Kind lauschte auf das Klatschen seiner Hand auf den eingefallenen Wangen der Frau, auf seine lüsternen Atemstöße und ihr unterdrücktes Stöhnen, und es stellte sich vor, ihm ein Messer in die Kehle zu rammen. Wenn es die Augen schloss, konnte es das Blut scharlachrot herausspritzen sehen, konnte es auf den Boden plätschern hören, während er stöhnte und röchelte und starb. Das Kind war sich sicher, dazu fähig zu sein. Hatte es nicht die Männer mit ihren stolzen Messern Ziegen die Kehlen durchschneiden sehen – und sogar einmal einem Pferd, das sich die Beine gebrochen hatte und zu nichts mehr taugte, als Fleisch, Haut und gebleichte, ausgekochte Knochen zu liefern?
Im untersten Regal der Küche lagen in einem Kasten Messer. Das Kind spürte, wie seine Finger sich hoben und verkrampften, als hielte es einen geschnitzten, beinernen Griff, spürte, wie ihm das Herz unter den Rippen pochte. Die geheime Flamme flackerte, loderte ... und erstarb.
Es hatte keinen Sinn. Er würde das Kind einfangen, bevor es ihn töten konnte. Es würde den Mann heute nicht besiegen, auch nicht morgen oder auch nur im nächsten Gottesmond. Es war zu klein und er war zu stark. Aber eines Tages, in vielen Gottesmonden von heute an, würde es groß sein, er dagegen alt und in sich zusammengesunken. Dann würde das Kind es tun und seinen Körper danach den Hunden vorwerfen und lachen und lachen, während sie seinen Hintern verschlangen und ihre fragenden Zungen durch die leeren Augenhöhlen seines Schädels schoben.
Eines Tages.
Der Mann schlug die Frau abermals, so heftig, dass sie auf den Boden aus festgetretener Erde fiel. »Fünf Mal hast du meinen Samen vergiftet und Hündinnen geworfen: Drei Söhne, die du geworfen hast, lebten nicht einmal einen Gottesmond lang. Ich sollte dich verfluchen! Sollte dich hinauswerfen, damit der Gottessprecher sich um dich kümmert!«
Die Frau schluchzte wieder, die vernarbten Arme vor dem Gesicht gekreuzt. »Es tut mir leid – es tut mir leid ...«
In dem Kind, das lauschte, stieg Verachtung auf. Wo war die Flamme der Frau? Hatte sie überhaupt eine? Weinen. Betteln. Wusste sie nicht, dass das genau das war, was der Mann wollte, sie gebrochen und blökend im Schmutz sehen? Die Frau sollte zuerst sterben.
Aber das würde sie nicht. Sie war schwach. Alle Frauen waren schwach. Überall im Dorf sah das Kind es. Selbst die Frauen, die nur Söhne geworfen hatten und auf jene hinabblickten, die auch Weibbälger geworfen hatten, die Frauen, die dem Gottessprecher halfen, die verfluchten Hexen zu steinigen, deren Körper nichts hervorspien als weibliches Fleisch ... Selbst diese Frauen waren schwach.
Ich bin nicht schwach, sagte sich das Kind voller Ingrimm, während der Mann die Frau mit Gift und Gehässigkeit durchtränkte und die Frau weinte und ihm glaubte. Ich bettele niemals.
Jetzt drückte der Mann die Ferse zwischen die Zitzen der Frau und stieß sie flach auf den Rücken. »Du solltest dem Gott danken. Ein anderer Mann hätte dir schon vor Sommern die Beine gebrochen und dich hinausgeworfen. Ein anderer Mann hätte in einer besseren Hündin als dir zwei Hände voll lebender Söhne gepflügt!«
»Ja! Ja! Ich habe großes Glück! Ich bin gesegnet!«, brabbelte die Frau, während sie sich die geschundene Stelle an ihrer Brust rieb.
Der Mann warf seine Hosen ab. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Spreiz dich, Hündin. Du gibst mir in neun fetten Gottesmonden von jetzt an einen lebenden Sohn oder ich schwöre beim Gottespfahl des Dorfes, dass ich dich auf dem Amboss zurücklassen werde!«
Würgend, gehorsam zog die Frau ihr zerrissenes Hemd hoch und ließ die dünnen Schenkel auseinanderfallen. Das Kind schaute ungerührt zu, während der Mann die Furche der Frau pflügte, grunzend und schwitzend vor Anstrengung. Er hatte eine winzige Pflugschar und die Erde der Frau war alt und staubig. Sie trug ihr Hundszahnamulett um den Hals, aber dessen Macht war lange tot. Das Kind glaubte nicht, dass aus dieser Saat ein Sohn kommen würde. In neun fetten Gottesmonden von heute an oder früher würde die Frau sterben.
Endlich vertröpfelte sein Samen; der Mann stand auf und zog sich die Hosen hoch. »Morgen bei Hochsonne werden Händler ins Dorf kommen. Es könnten mehrere Sommer vergehen, bevor weitere kommen. Ich habe den Gottessprecher dafür bezahlt, uns als Verkäufer aufzulisten, und einen Ziegenschädel ans Tor gehängt. Das Geld kommt nicht wieder, daher wird das Weibbalg gehen. Benutze deine Wasserration, um es zu säubern. Benutze einen Tropfen von meiner, und ich werde dich auspeitschen. Ich werde dich an einem Seil aufhängen, das ich aus deiner eigenen Haut gedreht habe. Verstanden?«
»Ja«, flüsterte die Frau. Sie klang müde und geschlagen. Zwischen ihren Beinen war Blut.
»Wo ist das Weibbalg jetzt?«
»Draußen.«
Der Mann spuckte. Er spuckte immer. Vergeudete Wasser. »Finde es. Wenn es sauber ist, kette es an die Mauer, damit es nicht wegläuft wie das letzte.«
Die Frau nickte. Er hatte ihr damals mit seinem Ziegenstock die Nase gebrochen. Das Kind, drei Sommer jünger zu jener Zeit, hatte den Knochen der Frau splittern hören, hatte das Blut spritzen sehen. Als es sich daran erinnerte, erinnerte es sich auch an das, was der Mann dem anderen Weibbalg angetan hatte, damit es ihm leidtat, weggelaufen zu sein. Dinge, bei denen das Weibbalg geschrien hatte, die jedoch keine Spuren hinterlassen hatten, weil Händler für beschädigte Waren weniger zahlten.
Dieses Weibbalg war eine Närrin gewesen. Ganz gleich, wohin die Händler einen brachten, es musste besser sein als das Dorf und der Mann. Händler waren die einzige Flucht für Weibbälger. Händler ... oder der Tod. Und das Kind wollte nicht sterben. Wenn sie es morgen bei Hochsonne holen kamen, würde es bereitwillig mit ihnen gehen.
»Ich werde es anketten«, versprach die Frau. »Es wird nicht weglaufen.«
»Das will ich dir auch geraten haben«, knurrte der Mann, dann erklang das Klatschen von Ziegenhaut auf Holz, als er die Küchentür aufstieß und ging.
Die Frau drehte den Kopf, bis ihre rotgeränderten Augen unter dem Küchentisch fanden, wonach sie suchten. »Ich habe es versucht. Es tut mir leid.«
Das Kind kroch aus der Dunkelheit und zuckte die Achseln. Der Frau tat es immer leid. Aber das änderte nichts, was spielte es also für eine Rolle? »Händler kommen«, sagte das Kind. »Jetzt waschen.«
Die Frau zuckte zusammen und der Atem fing sich rau in ihrer Kehle. Sie klammerte sich an das Tischbein und zog sich auf die Knie hoch, dann hielt sie sich an der Tischkante fest, keuchend, wimmernd, bis sie aufrecht stand. Es war Wasser in ihren Augen. Sie streckte eine von Arbeit knotige Hand aus und berührte die Wange des Kindes mit rauen Fingerspitzen. Das Wasser zitterte, aber es fiel nicht.
Dann wandte die Frau sich auf dem Absatz um und ging hinaus in den glutheißen Tag. Das Kind ohne Namen, das nicht verstand, das keinen Anteil nahm, folgte ihr.
Die Händler kamen am nächsten Tag einen Finger vor Hochsonne. Nicht die vier vom letzten Mal mit ihren zerlumpten Kleidern, mageren Eseln, halb verhungerten Börsen und so gut wie keinen Sklaven. Nein. Diese beiden Händler waren prächtig. Sie saßen auf hochmütigen weißen Kamelen, Perlen und Spangen klimperten an ihren Gliedern, an ihren Ohren baumelten Ohrringe und sie trugen heilige Amulette um den Hals. Ihre dunkle Haut leuchtete von duftenden Ölen; in ihren Gürteln steckten juwelenbesetzte Scheiden. Hinter ihnen erstreckte sich der längste Schlangenrücken von Handelsware. Minderwertige Söhne, von ihren Vätern verstoßen, Weibbälger und Frauen. Alle nackt, alle in Ketten. Einige waren in die Sklaverei hineingeboren, andere gerade erst verkauft worden. Der Unterschied lag in ihren Gottzöpfen; wer schon lange Sklave war, trug einen tief blutroten Zopf, ein Zeichen des Gottes, dass sie Besitz waren. Die neuen Sklaven würden ihre roten Zöpfe noch bekommen.
Fünf hochgewachsene Männer mit Schwertern und Speeren bewachten die gefesselten Sklaven. Sie trugen Amulette in ihren Gottzöpfen, selbst ihre Sklavenzöpfe waren mit Zaubern versehen. Sie mussten besondere Sklaven sein, diese Wachen. In der Karawane gab es auch Packkamele, in gewöhnlichem Braun, aneinandergebunden, beladen mit Körben, kreuz und quer übersät mit Reisezaubern. Ein sechster, ungefesselter Sklave führte sie; er war kaum mehr als ein Junge und auch sein roter Gottzopf trug Amulette. Auf sein Zeichen hin beugten die Kamele stöhnend ihre schwieligen Knie, um sich auf den harten Boden zu hocken. Die Sklaven hockten sich ebenfalls hin, schweigend und schwitzend.
Das Kind, das in seinen eigenen Ketten wartete, deren grobe Eisenbänder ihm Handgelenke und Knöchel aufschürften, beobachtete die Händler unter gesenkten Wimpern, während sie absaßen und im Staub und Schmutz des kleinen Hofs des Mannes standen. Mit ihren schlanken Fingern strichen sie sich über die glänzenden Seidenroben, schoben sich ihre mit leuchtenden Perlen besetzten Gottzöpfe hinter die Ohren. Ihre Fingernägel hatten alle die gleiche schöne, ovale Form und waren mit hellen Farben bemalt, die zu ihrer Kleidung passten: Grün und Purpur und Blutrot und Gold. Sie waren größer als der größte Mann im Dorf. Größer als der Gottessprecher, der alle überragen musste. Einer von ihnen war sogar fett. Sie waren die prächtigsten Geschöpfe, die das Kind je gesehen hatte, und in dem Wissen, dass es mit ihnen fortgehen würde, dass es für immer den Schmutz und das Elend des Mannes und des Dorfes hinter sich lassen würde, schlug dem Kind das Herz schneller, und seine eigenen Nägel, rissig und formlos, gruben sich tief in die schmutzigen, vernarbten Handflächen.
Die Händler betrachteten den rissigen, kahlen Boden, auf dem nur noch verdorrte Reste von Bewuchs erkennbar waren, die Hütte aus Lehmziegeln mit dem Dach aus getrockneten, schlecht verwobenen Gräsern, den Pferch mit wenig einträglichen Ziegen und den Mann, in dessen blutunterlaufenen Augen Hoffnung und Habgier leuchteten. Sie tauschten einen Blick und schürzten die dicken Lippen. Ein Hohngrinsen malte sich auf ihren Zügen ab. Das Kind fragte sich, woher sie kamen, um so sauber und so missbilligend zu sein. Von einem Ort, der anders sein musste als dieser. Es konnte nicht erwarten, selbst einen solchen Ort zu sehen und nur für eine einzige Nacht in Mauern zu schlafen, die nicht nach Angst und Ziegen stanken. Wenn es sein musste, würde es hundert Ketten tragen und auf Händen und Knien über den brennenden Sand des Ambosses kriechen, solange es nur diesen Ort erreichte.
Der Mann starrte die Händler ebenfalls an und ihm schienen die Augen vor Erstaunen aus den Höhlen zu springen. Er neigte immer wieder den Kopf vor ihnen, wie ein Huhn, das nach Getreide pickte. »Exzellenzen. Willkommen, willkommen. Vielen Dank, dass Ihr mit mir Geschäfte machen wollt.«
Der dünne Händler trug dicke, goldene Ohrringe; auf seine rechte Wange war in hell leuchtendem Scharlachrot ein stechender Skorpion tätowiert. Das Kind biss sich auf die Zunge. Er hatte Geld genug, um sich einen solchen Schutz zu kaufen? Und Macht genug, dass ein Gottessprecher es ihm erlaubte? Aieee ...
Er trat vor und blickte auf den Mann hinab, während er mit dem Finger nach dem Kind schnippte. »Nur das da?«
Das Kind war verzaubert. Des Händlers Stimme war tief und dunkel wie die Mitte der Nacht und formte die Worte anders als der Mann. Wenn der Mann sprach, klang es wie Steine, die in der trockenen Schlucht aneinanderrieben, hässlich wie er. Der Händler war nicht hässlich.
Der Mann nickte. »Nur das da.«
»Keine Söhne, die nicht gebraucht werden?«
»Ich bitte um Vergebung, Exzellenz«, sagte der Mann. »Der Gott hat mir wenige Söhne gewährt. Ich brauche sie alle.«
Stirnrunzelnd umkreiste der Händler das Kind mit langsamen, maßvollen Schritten. Es hielt den Atem an. Wenn es dem Händler nicht gefiel und wenn der Mann es deswegen nicht tötete, würde es einem Mann aus dem Dorf als Sklavin gegeben werden, um sich von ihm schlagen zu lassen, ihm Söhne zu gebären und ohne Unterlass hart für ihn zu arbeiten. Eher würde das Kind sich das Fleisch mit Stein aufschneiden und die Hunde von sich kosten und sich von ihnen zerreißen lassen.
Der Händler streckte die Hand aus, deren Innenfläche weich und rosig war, und strich dem Kind damit über den Schenkel und Hintern. Seine Berührung war warm und schwer. Er sah den Mann an. »Wie alt?«
»Sechzehn.«
Der Händler verharrte reglos. Sein Gefährte löste eine Kamelpeitsche aus seinem Gürtel – einer Kette kostbarer Steine – und ließ das Leder knallen. Die Hunde des Mannes, die zur Sicherheit eingesperrt waren, heulten und warfen sich gegen das Geflecht aus Ziegenlederriemen ihres Gefängnisses. In dem Pferch daneben blökten die Ziegen des Mannes und liefen durcheinander, ließen ängstlich runde Köttel fallen; ihre gelben Schlitzaugen glänzten.
»Wie alt?«, fragte der Händler noch einmal. Seine grünen Augen waren schmal und kalt.
Der Mann wand sich mit gesenktem Kopf und schlang die Finger ineinander. »Zwölf. Vergebt mir. Ein ehrlicher Irrtum.«
Der Händler stieß einen leisen ungläubigen Laut aus. Er hatte etwas mit seinen Augenbrauen gemacht. Sie waren kein dichter, verfilzter Balken wie die Augenbrauen des Mannes, sondern wölbten sich in zwei goldenen Halbkreisen über seinen Augen. Das Kind starrte sie fasziniert an, während der Händler sich vorbeugte, bis sein dunkles Gesicht dicht vor seinem war. Es hätte gern den scharlachroten Skorpion auf seiner Wange berührt. Sich ein wenig von seinem Schutz gestohlen, für den Fall, dass er es nicht kaufte.
Mit langen, schlanken Fingern zupfte er dem Kind an den Ohrläppchen, zeichnete die Umrisse seines Schädels, seiner Nase, seiner Wangen nach und drückte ihm die Lippen zurück, um alle Zähne abzutasten. Er schmeckte nach Salz und Dingen, die das Kind nicht kannte. Er roch nach Freiheit.
»Hat sie schon geblutet?«, fragte er und sah den Mann über die Schulter hinweg an.
»Seit vier Gottesmonden.«
»Unversehrt?«
Der Mann nickte. »Natürlich.«
Der Händler zog die Lippen zurück. »Es gibt kein ›natürlich‹, wo Männer und Frauenfleisch weilen.«
Ohne Vorwarnung stieß er dem Kind die Hand zwischen die Beine; seine Finger drückten und tasteten, höher hinauf, tiefer hinein. Die Zähne gebleckt und die eigenen Finger zu kleinen Krallen gebogen, stürzte das Kind sich kreischend auf ihn, als wögen seine Ketten nicht mehr als die Spangen an den schlanken, eleganten Handgelenken des Händlers. Der Mann sprang schreiend herbei, die Fäuste erhoben, das Gesicht verzerrt, aber der Händler brauchte ihn nicht. Er schob das Kind beiseite, als sei es eine Kornmotte, griff ihm ins schwarze, verfilzte Haar und riss es auf die Zehenspitzen hoch, bis es vor Schmerz brüllte, nicht vor Zorn, und ihm die Hände schlaff herunterfielen. Das Kind spürte, wie sein Herz auf seine dünnen Rippen eindrosch und Verzweiflung in ihm aufstieg. Es presste die Augen zusammen und schmeckte zum ersten Mal, seit es denken konnte, die salzige Schärfe von Tränen.
Es hatte alles verdorben. Jetzt würde es kein Entkommen aus dem Dorf mehr geben, kein Leben jenseits des messerscharfen Horizonts. Der Händler würde es beiseitewerfen wie verdorbenes Fleisch, und wenn er und sein fetter Freund fort waren, würde der Mann es töten oder es würde gezwungen sein, sich selbst zu töten. Keuchend wie eine Ziege im Schlachthaus, wartete das Kind darauf, dass der Schlag fiel.
Aber der Händler lachte. Ohne es loszulassen, drehte er sich zu seinem Freund um. »Was für eine kleine Hexenkatze! Ungezähmt und wild wie alle hier im wilden Norden. Aber siehst du die Augen, Yagji? Das Gesicht? Die Länge der Knochen und die Anmut der Flanken? Ihre süßen, knospenden Brüste?«
Zitternd wagte das Kind es, ihn anzusehen. Wagte es zu hoffen
Der Fette lachte nicht. Er schüttelte den Kopf, dass die elfenbeinernen Anhänger an seinen Ohren hin und her baumelten. »Sie ist mager.«
»Heute, ja«, pflichtete der Händler ihm bei. »Aber mit Essen und Bädern und drei mal drei Gottesmonden ... wir werden sehen!«
»Deine Augen sehen das Unsichtbare, Aba. Magere Bälger haben oft Krankheiten.«
»Nein, Exzellenz!«, beteuerte der Mann. »Keine Krankheit. Kein Eiter, keine Blähsucht, keine Würmer. Gutes Fleisch. Gesundes Fleisch.«
»Das Wenige, was davon vorhanden ist«, sagte der Händler. Er drehte sich um. »Sie hat keine Krankheiten, Yagji.«
»Aber sie hat ein übles Temperament«, wandte sein fetter Freund ein. »Sie ist undiszipliniert und wild. Sie wird Ärger machen, Aba.«
Der Händler nickte. »Das ist wahr.« Er streckte die Hand aus und fing die Kamelpeitsche, die ihm zugeworfen wurde, mühelos auf. Die Finger in ihr Haar gekrallt, ließ er dem Kind die geflochtene Peitsche um die nackten Beine knallen, so dass die kleinen Metallgewichte an ihrem Ende blutige Muster ins Fleisch zeichneten.
Die Schläge brannten wie Feuer. Das Kind bohrte die Zähne in die Unterlippe und starrte ohne einen Wimpernschlag in die wachsamen Augen des Händlers, forderte ihn auf, ihm das ungenährte Fleisch von den Knochen zu reißen, wenn er wollte. Er würde sehen, dass es kein Schwächling war, dass es seiner Münze würdig war. Heißes Blut tropfte an seiner Wade hinab und kitzelte es am Knöchel. Binnen Sekunden kamen die kleinen schwarzen Wüstenfliegen, um sein Blut zu trinken. Als der Händler sie hörte, verzichtete er auf den nächsten Schlag und warf die Kamelpeitsche stattdessen ihrem Besitzer zu.
»Lektion eins, kleine Hexenkatze«, sagte er und nahm die Finger aus ihrem Haar, um über die scharfe Linie ihrer Wangen zu streichen. »Erhebe noch einmal deine Hand oder deine Stimme gegen mich, und du wirst sterben, ohne jemals die Freuden kennenzulernen, die auf dich warten. Hast du mich verstanden?«
Die schwarzen Wüstenfliegen waren gierig und bei ihrem eifrigen Saugen bekam das Kind eine Gänsehaut. Es hatte gesehen, was sie lebenden Geschöpfen antun konnten, wenn man sie nicht daran hinderte. Es versuchte, nicht auf der Stelle umherzutanzen, während die fiebrigen Fliegen sich um ihre blutigen Striemen stritten. Es verstand nur, dass der Händler nicht vorhatte, es zurückzuweisen. »Ja.«
»Gut.« Er verscheuchte die Fliegen, dann zog er aus seiner purpurnen und goldenen Tasche einen winzigen Tonkrug. Als er den Deckel abnahm, roch das Kind die Salbe darin, dick und fett und fremdartig.
Zur Überraschung des Kindes ließ er sich auf ein Knie nieder und rieb ihm die brennenden Beine mit der wohlduftenden Paste aus dem Krug ein. Seine Finger fühlten sich auf der sonnenversengten Haut des Kindes kühl und sicher an. Der Schmerz verschwand und das Kind war verblüfft. Es hatte nicht gewusst, dass ein Mann ein Weibbalg berühren und ihm nicht wehtun konnte.
Dies brachte das Kind auf die Frage, was es sonst noch nicht wusste.
Als der Händler fertig war, steckte er den Krug in die Tasche, stand auf und blickte auf das Kind hinab. »Hast du einen Namen?«
Eine dumme Frage. Weibbälger besaßen keine Namen, ebenso wenig wie die Steine auf dem Boden oder die toten Ziegen im Schlachthaus, die darauf warteten, gehäutet zu werden. Das Kind öffnete den Mund, um dies zu sagen, schloss ihn dann jedoch wieder. Der Händler lächelte beinahe und in seinen Augen stand ein Ausdruck, den es noch nie zuvor gesehen hatte. Eine Frage. Oder eine Herausforderung. Es bedeutete etwas. Das Kind war davon überzeugt, dass es etwas bedeutete. Wenn es nur herausfinden konnte, was ...
Es ließ den Blick zur Seite wandern, zu der Lehmziegelhütte mit dem schäbigen Küchenfenster, hinter dem die Frau dachte, sie könne nicht gesehen werden, während sie gefährlicherweise den Handel beobachtete. Die Frau, die keinen Namen hatte, nur Beschreibungen. Hündin. Miststück. Schlampe. Ziegenschlitz. Dann sah das Kind den Mann an, der zitternd vor Gier auf sein Geld wartete. Wenn es sich selbst einen Namen gab, wie wütend würde ihn das machen!
Aber dem Kind fiel keiner ein. Sein Geist war leerer Sand, wie der Amboss. Aber der Händler hatte ihm einen Namen gegeben, nicht wahr? Er hatte es benannt, hatte es ...
Das Kind reckte das Kinn vor, so dass es dem Händler in die grünen, leuchtenden Augen sehen konnte. »Hekat«, sagte es. Seine Zunge stolperte über das seltsame Wort, über den monotonen Tonfall, mit dem er sprach. »Ich. Name. Hekat.«
Der Händler lachte abermals. »Ein so guter Name wie jeder andere und besser als die meisten.« Er hob die Hand, zwei Finger emporgereckt; sein fetter Freund warf ihm einen roten Lederbeutel zu, in dem Münzen klimperten.
Der Mann trat vor, die schwarzen Augen von Hunger erfüllt. »Wenn Euch das Balg gefällt, werde ich Euch weitere züchten! Bessere als dieses hier, zweimal so viele Münzen wert.«
Der Händler schnaubte. »Es ist ein Wunder, dass du auch nur dieses eine hervorgebracht hast. Fordere nicht den Gott heraus mit deinem Prahlen, auf dass dein Same nicht zur Gänze vertrocknen möge.« Naserümpfend ließ er den Beutel in die offenen Hände des Mannes fallen.
Der Mann riss an der verknoteten Schnur des Beutels, so unbeholfen, dass der Inhalt zu Boden fiel. Mit einem gequälten Aufschrei ließ er sich auf die Knie sinken, ohne sich um blaue Flecken zu scheren, und begann nach den Silbermünzen zu grabschen. Er schürfte sich die Knöchel an den scharfen Steinen auf, aber der Mann bemerkte das Blut nicht, ebenso wenig wie die summenden, schwarzen Fliegen, die herbeigeschossen kamen, um es zu trinken.
Einen Moment lang beobachtete der Händler ihn wortlos. Dann trat er die Finger des Mannes in den Schmutz. »Dein Silber hat keine Flügel. Nimm dem Kind die Ketten ab.«
Der Mann riss die Augen weit auf und verzog vor Schmerz das Gesicht. »Abnehmen ...?«
Der Händler lächelte; sein scharlachroter Skorpion bog die Scheren zurück. »Bist du taub? Oder möchtest du es sein?«
»Exzellenz?«
Der Händler legte die linke Hand auf das lange Messer an seiner Seite. »Kopflose Männer können nicht hören.«
Der Mann riss die Finger los und erhob sich taumelnd auf die Füße. Keuchend schloss er die Fesseln auf, ohne das Kind anzusehen. Die Haut um seine Augen zuckte, als sei er von einem Skorpion gestochen worden.
»Komm, kleine Hekat«, sagte der Händler. »Du gehörst jetzt mir.«
Sie folgte ihm zu dem wartenden Sklavenzug und dachte, dass er ihr seine eigenen Ketten um Handgelenke und Knöchel legen würde, bevor er sie zu den anderen nackten Sklaven schickte, die auf dem Boden hockten. Stattdessen führte er sie zu seinem Kamel und wandte sich dann an seinen Freund. »Eine Robe, Yagji.«
Der fette Händler, Yagji, seufzte und holte aus einem der Körbe des Packkamels ein hellgelbes Kleidungsstück. Kaum atmend riss sie die Augen auf, während der dünne Händler sein Messer zur Hand nahm und den Stoff durchschnitt, bis er ihrem kleinen Körper passte. Lächelnd ließ er die zurechtgeschnittene Robe über ihren Kopf gleiten und zog ihre Arme durch die verkürzten Ärmel, bevor er den kühlen Stoff auf ihrer nackten Haut glatt strich. Sie war erstaunt. Sie wünschte, die Söhne des Mannes wären da gewesen, um dies zu sehen, aber sie waren bei der Arbeit. Schlangentanzen und Ziegenhüten.
»So«, sagte der Händler. »Jetzt werden wir reiten.«
Bevor sie etwas erwidern konnte, hob er sie hoch und setzte sie auf das Kamel.
Der fette Händler pfiff durch die Zähne. »Zehn Silberstücke! Musstest du so viel geben?«
»Wenn ich weniger gegeben hätte, wäre das eine Beleidigung des Gottes gewesen.«
»Tze! Das ist Wahnsinn, Abajai! Du wirst es bereuen und ich ebenfalls!«
»Das glaube ich nicht, Yagji«, erwiderte der dünne Händler. »Wir wurden durch den Gott hierhergeführt. Der Gott wird uns beschützen.«
Er stieg auf das Kamel und ließ es aufstehen. Mit einem gedämpften Fluch stieg der fette Händler auf sein eigenes Kamel und der Sklavenzug setzte sich wieder in Bewegung. Der Mann und die Frau und die Ziegen und die Hunde blieben hinter ihnen zurück.
Hekat saß auf dem hochmütigen weißen Kamel des Händlers, den Kopf hocherhoben, und blickte kein einziges Mal zurück.
ZWEITES KAPITEL
Als das Dorf und sein Gottespfahl aus gesplittertem, verwittertem Holz hinter ihnen in der hitzeflirrenden Ferne immer kleiner wurden, sagte der dünne Händler Abajai, dessen Hand warm und sicher auf Hekats Schulter lag: »Die anderen, die wir gekauft haben. Kennst du sie?«
Er und der fette Yagji hatten noch vier weitere Dorfbewohner gekauft, nachdem sie den Besitz des Mannes verlassen hatten. Eine Frau, ein weiteres Weibbalg und zwei Jungen. Im Gegensatz zu ihr gingen sie zusammen mit den anderen Sklaven, an diese oder aneinander gekettet und bewacht von fünf hochgewachsenen Sklaven mit Speeren. Sie selbst saß vor Abajai auf seinem weißen Kamel, dessen raues Haar ihre nackten Beine kitzelte. Jetzt schüttelte sie den Kopf. »Nein. Hekat kennt Mann. Frau. Söhne des Mannes.« Eine Gänsehaut überlief sie. »Gottessprecher.«
»Niemanden sonst? Du hattest keine Freunde?«, fragte Abajai. »Wer wird heute Nacht um dich weinen, Hekat?«
Sie zuckte die Achseln. »Hekat nicht weinen.«
Yagji, der neben ihnen herritt, seufzte. »Musst du mit ihr reden, Abajai? Sie ist kein Schoßtier.«
Abajai kicherte. »Ich habe dich mit deinem Affen reden hören.«
Sie sah ihn über ihre Schulter hinweg an. »Affe?«
»Ein Tier. Übelriechend, laut, gierig.« Er lächelte. »Yagji wird euch miteinander bekannt machen, wenn wir Et-Raklion erreichen.«
»Das werde ich nicht«, sagte Yagji. »Sie wird dem kleinen Hooli schlechte Manieren beibringen. Abajai, du solltest diese da verkaufen, bevor wir nach Hause kommen.« An einer Kette um seinen Hals baumelte ein roter, zu einem einzigen starrenden Auge geschliffener Stein; er umfasste ihn mit dicken Fingern. »Da ist eine Dunkelheit ...«
»Aberglaube«, brummte Abajai. »Der Gott wollte, dass wir diese hier finden, Yagji. Du machst dir ganz umsonst Sorgen. Wir werden Et-Raklion erreichen.«
Hekat runzelte die Stirn. »Et-Raklion?«
»Unser Zuhause.«
»Wo?«
Abajai deutete geradeaus, wo der Boden sich mit dem Himmel traf. »Weiter, als dein Auge reicht, Hekat. Es ist eine Reise von vielen Gottesmonden.«
Sie schüttelte den Kopf. Eine solche Entfernung konnte sie sich nicht vorstellen. Schon jetzt wusste sie nicht mehr, wo sie war. Das unfruchtbare Land erstreckte sich zu allen Seiten, eingehüllt in all seine heißen Farben: Rot, Orange, Braun. Grasbüschel verdorrten unter der Sonne. Der Himmel war eine schwere Hand, die sie auf den gebackenen Boden drückte. Unter dem Tappen der Kamelfüße, dem Klirren der Sklavenketten und dem Klackern der Kiesel auf Fels wartete die Stille wie eine Sandkatze, die sich anschickte, zu erdrücken und zu töten. Wenn sie nicht Acht gab, würde sie vergessen zu atmen.
Abajais Hand lag wieder auf ihrer Schulter. »Fürchte dich nicht, Hekat. Bei mir bist du sicher.«
»Sicher?«
Yagji kicherte. »Er mag ein Affe sein, aber zumindest versteht mein Meiner Hooli mehr als eins von fünf Worten!«
Abajai beachtete ihn nicht. »Ja, Hekat. Sicher. Das bedeutet, dass ich dich beschützen werde.« Seine Finger hatten sich ein wenig angespannt und seine Stimme war sanft. Dieses Wunder war geradeso erdrückend wie der Himmel. »Keine Schläge. Kein Hunger. Sicher.«
Sie wurde eins mit der Stille. Im Dorf war kein Weibbalg sicher. Nicht vor dem Mann oder seinen Söhnen oder dem Gottessprecher, der wie ein Geier durch die Straßen stolzierte, immer auf der Suche nach einer Sünde, um den Schuldigen zu steinigen.
»Sicher«, wisperte sie schließlich. Das weiße Kamel zuckte mit einem Ohr, leise brummend, während es ging. Sie drehte sich zu dem Händler um. »Sicher Et-Raklion?«
Er schenkte ihr ein breites Lächeln. Seine Zähne waren blendend weiß. Winzige Edelsteine blitzten darin, blau und rot und grün. Sie sog scharf die Luft ein und berührte voller Staunen ihre eigenen Zähne. Im Dorf waren ihr seine Edelsteine nicht aufgefallen. Abajai lachte. »Gefallen sie dir?« Sie nickte. »Du wünschst dir, du hättest selbst welche?«
Der fette Yagji stöhnte wie eine Frau. »Aba, ich flehe dich an! Schutzzauber in deinen Zähnen sind eine Sache. Das gehört sich so. Aber in ihrem Mund? Was für eine Verschwendung!«
»Vielleicht«, erwiderte Abajai achselzuckend. »Aber in Todorok werde ich ihr ein Amulett kaufen. Andere Augen sind nicht blind, Yagji. Sie werden sehen, was du nicht sehen kannst.«
»Ja, ja, sie werden sehen«, brummte der fette Händler wie ein Kamel. »Sie werden sehen, dass du gottverlassen bist!«
Lachend verscheuchte Abajai eine hartnäckige Fliege. »Mit dieser Beute? Yagji, küsse dein Auge zur Buße für deine Ketzerei.«
Yagji küsste sein rotes Steinauge nicht, berührte es jedoch abermals. »Du forderst den Gott heraus, dich heimzusuchen, Aba. Prahle weniger. Bete mehr.«
Hekat seufzte. Worte, Worte, summ, summ, summ. »Abajai.« Er hatte gesagt, sie dürfe seinen Namen benutzen. »Erzähl Hekat Et-Raklion.«
»Tu es nicht«, sagte Yagji. »Sie wird es bald genug sehen.«
»Sie kann kaum einen zivilisierten Satz herausbringen, Yagji«, entgegnete Abajai. »Wenn ich nicht mit ihr spreche, wie sonst soll sie lernen?« Er tätschelte ihr die Schulter. »Et-Raklion ist eine mächtige Stadt, Hekat.«
»Stadt?«
Er breitete die Arme aus. »Ein großes, großes, großes Dorf. Du weißt, was groß ist?«
Sie nickte. »Ja. Groß nicht Dorf. Hekat Dorf klein.«
Seine leuchtenden Zähne blitzten abermals auf. »Sie ist nicht dumm, Yagji. Unterernährt, ja, und sie hatte bisher keine Gelegenheit zu lernen. Aber auf keinen Fall ist sie dumm.«
Yagji warf die Hände hoch. »Und das ist gut, Aba? Intelligente Sklaven sind gut? Aieee! Der Gott schütze uns!«
Dann verstummte das Gespräch. Schweigend entfernten sie sich von der am Himmel herabgleitenden Sonne und jagten ihren langen, dünnen Schatten auf dem roten, felsigen Boden nach. Abajai war wie der Gott, er wusste, wohin er reiten musste, auch wenn das Land leer war. Hekat fielen die Augen zu, und ihr Kopf wackelte hin und her wie ein verwelkendes Gras an seinem Stängel. Abajais Hand lag auf ihrer Schulter. Sie würde nicht fallen. Sie war sicher. Sie schlief ein.
Als er sie wachrüttelte, war der blaue Himmel verblasst. Der Abend dämmerte. Nadelstichwinzige Sterne blitzten wie die Edelsteine in Abajais Zähnen. Der Gottesmond und seine Gemahlin waren aufgegangen, schmale Silberscheiben vor der sich vertiefenden Dunkelheit. Die weißen Kamele hoben schnüffelnd den Kopf, verlangsamten ihren Schritt, blieben stehen und legten sich auf dem Boden nieder.
»Das wird genügen«, sagte Abajai, während er sich aus dem Sattel gleiten ließ. »Zäune die Sklaven ein, Obid«, befahl er dem ältesten und größten der Wachmänner. »Essen und Wasser.«
»Wie viel, Herr?«, fragte Obid. »Dieses Dorf war arm. Die Vorräte gehen zur Neige, und jagen kann man hier nicht.«
Abajai ließ den Blick über die von der Sonne getötete Ebene wandern. »Eine Faust Korn, ein Becher Wasser, bei Abend- und Sonnenaufgang, bis mein Wort wechselt. In zwanzig Hochsonnen werden wir Todorok erreichen und frische Vorräte kaufen. Was wir haben, wird bis dahin reichen.«
Hekats Augen weiteten sich. Zwanzig Hochsonnen? So weit entfernt! War irgendein Mann aus dem Dorf jemals so weit gereist? Sie glaubte es nicht.
Während Obid und die anderen Wachen die Sklaven und die Kamele für die Nacht fertig machten, packten Abajai und Yagji Körbe und Speisen aus. Einen Moment lang beobachtete sie sie mit wachsendem Unbehagen. Sie zappelte und sah sich um. Da war nichts, wohinter sie sich hätte hocken können. Yagji bemerkte es. Er hielt in der Arbeit inne und zupfte Abajai am Ärmel.
»Hekat?«, fragte Abajai.
»Muss Wasser lassen.«
»Brunzen meinst du?«
Meinte sie das? Sie vermutete es und nickte. »Muss Wasser jetzt lassen.«
Er ging zu seinem weißen Kamel, öffnete einen der Tragekörbe und nahm einen kleinen Tontopf heraus. »Brunze hier hinein und gib es Obid.«
Es Obid geben? Sie riss die Augen auf. »Obid wollen Körperwasser?«
»Ich will es.« Als er sah, dass sie noch immer nicht verstand, fügte er hinzu: »Dein Dorf. Behalten die Leute Körperwasser?«
»Für Ziegenleder. Keine Ziegen, Abajai.«
»Nein, aber wir machen unser Körperwasser zu Gold, wenn wir in ein Dorf kommen, wo es gebraucht wird. Brunze jetzt, Hekat. Wir müssen das Lager aufschlagen.«
Also brunzte sie und gab den Topf mit der darin umherschwappenden Flüssigkeit Obid. Er sprach nicht mit ihr, sondern goss ihr Wasser lediglich in einen großen Tonkrug, den er dem kräftigsten Packkamel abgenommen hatte. Als sie fortging, spürte sie die Seitenblicke der gefesselten Sklaven, staunend und eifersüchtig.
Sollten sie doch staunen. Sollten sie hassen. Sie scherte sich nicht um sie.
Nach dem Brunzen setzte sie sich, müde und wund vom Kamelreiten, gähnend im Schneidersitz auf die Decke, die Abajai ihr gab, und beobachtete staunend, wie die Händler aus den Körben der Packkamele Rollen mit farbigem Tuch nahmen und sie in kleine Räume verwandelten.
»Zelte«, erklärte Abajai, als er ihre Überraschung bemerkte. »Du wirst in meinem schlafen.«
In den Körben der weißen Kamele war besseres Essen, als die Sklaven es bekamen. Besser als jedes Essen, das sie in ihrem Leben gerochen hatte. Yagji machte aus Brocken getrockneten Kameldungs ein Feuer und wärmte das Essen in einem eisernen Topf über den Flammen, wobei er Blätter hinzugab, die sie nicht kannte. Er bewahrte sie in kleinen, glänzenden Kästchen auf und redete vor sich hin, während er ein wenig von diesem abzwickte, ein wenig von jenem. Yagji war seltsam. Während das Essen langsam warm wurde und solch herrliche Gerüche freisetzte, drehte ihr Magen sich um und um. Sie erstickte beinahe an den Säften, die ihren Mund überfluteten.
»Nicht danach schnappen«, sagte Abajai, als er ihr eine zur Hälfte gefüllte Tonschale und einen Löffel gab. Er schlug ihr mit den Knöcheln hart auf den Kopf. »Würde. Zurückhaltung. Anstand. Diese Dinge musst du lernen.«
Sie kannte diese Worte nicht. Sie wusste nur, dass sie ihn verstimmt hatte. Zum zweiten Mal an diesem Tag brannte salziges Wasser in ihren Augen.
»Tz-tz-tze«, besänftigte er sie und diesmal bekam sie keine Knöchel zu spüren, nur ein sanftes Klopfen auf die Wange. »Iss. Langsam. Ich werde dir etwas zu trinken holen. Du kennst Sadsa?«
Den Mund vollgestopft mit Fleisch, aieee, so wunderbar, schüttelte sie den Kopf und sah zu, wie er nach einem leeren Bronzebecher griff und ihn aus einer Lederflasche füllte. Yagji nickte. »Gute Idee«, meinte er. »Wenn du schon darauf bestehst, sie in deinem Zelt schlafen zu lassen, wird es das Beste sein, wenn sie ordentlich berauscht ist.«
Abajai schüttelte den Kopf. »Hekat ist keine Gefahr.«
»Sagst du.«
»Der Gott sagt es«, erwiderte Abajai stirnrunzelnd.
Yagji stellte seine eigene Schale beiseite und stöberte in dem Lederbeutel, in dem sich seine kleinen Schachteln mit Blättern befanden. »Vorsicht ist besser als Nachsicht«, erklärte er und warf ihm einen kleinen, gelben Beutel zu.
Abajai verdrehte die Augen, aber er nahm etwas blaues Pulver aus dem Beutel, warf es in den Bronzebecher und ließ die Flüssigkeit kreisen. Dann warf er Yagji den Beutel wieder zu und gab ihr den Becher. »Sadsa, Hekat. Trink.«
Kein Mann hatte sie je zuvor bedient. Frauen bedienten Männer, so war es Sitte. Beinahe träumerisch hob sie den Bronzebecher an die Nase. Sadsa war cremig-weiß und der scharfe, süßsaure Geruch kitzelte. Auf der schaumigen Oberfläche des Getränks trieben winzige blaue Tupfen. Sie sah Yagji, dem sie nicht traute, an. »Was?«
»Sadsa ist Kamelmilch«, erklärte Abajai. »Gut für dich.«
Er verstand nicht, daher zeigte sie auf den gelben Beutel, den Yagji noch immer in der Hand hielt. »Was?«
Abajai lachte. »Ich hab's dir doch gesagt, Yagji. Nicht dumm.« Er beugte sich vor und tätschelte ihr abermals die Wange. »Zum Schlafen, Hekat. Es wird dir nicht schaden. Trink.«
Er hatte sie vor dem Mann gerettet. Er hatte sie nicht nackt mit den anderen Sklaven in Fesseln gelegt, er hatte ihr Kleidung gegeben und ihr erlaubt, vor ihm auf seinem prächtigen weißen Kamel zu reiten. Sie trank. Die Sadsa floss wie sanftes Feuer ihre Kehle hinab und in ihren Bauch. Sie rang würgend nach Luft. Die tanzenden Flammen verschwammen. Yagjis Gesicht und Abajais verschwammen ebenfalls. Sie stellte den Bronzebecher auf den Boden und aß mehr Fleisch. Ihre Finger fühlten sich unbeholfen an, wie sie den Löffel hielten. Allzu bald war die Schale leer. Sie sah Abajai hoffnungsvoll an.
»Nein«, sagte er. »Dein Bauch hatte genug Überraschungen. Trink deine Sadsa aus, dann musst du schlafen.«
Als der Becher leer war, konnte sie kaum noch die Augen offen halten. Er entglitt ihren unbeholfenen, fettigen Fingern und rollte in kleinen Kreisen auf dem Boden, die sie zum Lachen brachten. Das Lachen brachte sie zum Lachen. Was für ein dummes Geräusch! Der Mann mochte es nicht, er hatte sie geschlagen, wenn sie lachte. Lachen war etwas, das man im Geheimen tat. Das man beinahe nie tat. Aber Abajai war nicht wütend. Er lächelte, einen rätselhaften Ausdruck in den grünen Augen, und die Juwelen in seinen Zähnen wirkten im zuckenden Feuerschein überaus kostbar. Der scharlachrote Skorpion saß still in seiner Haut und schützte ihn. Sie versuchte aufzustehen, aber ihre Beine hatten sich in Gras verwandelt. Stattdessen legte sie sich auf den Rücken, starrte zu den Sternen empor und lachte noch heftiger.
»Oh, bring es ins Bett, Aba«, sagte Yagji ungehalten. »Wenn es das ist, was uns auf der langen Straße nach Et-Raklion erwartet, bezweifle ich, dass wir am Ende noch miteinander sprechen werden.«
»Et-Raklion«, sang sie an den Gottesmond und seine Gemahlin gewandt. »Hekat gehen Et-Raklion. Lalalala ...«
Starke Arme glitten unter ihre Schultern und Knie. Abajai hob sie hoch, wie der Atem des Gottes Staub hob. »Siehst du, wie der Gott lächelt, Yagji?«, fragte er. »Sie hat passend zu ihrem Gesicht eine süße Singstimme.«
Yagji sagte etwas, das sie nicht verstehen konnte, aber es klang unhöflich. Sein Gesicht, das sie verkehrt herum sah, trug einen unhöflichen Ausdruck. Rückwärts über Abajais Arm baumelnd, zeigte sie auf den anderen Händler. »Komischer Yagji machen Ziegen reden. Mäh, mäh, mäh.«
Abajai legte sie in seinem Zelt auf etwas, das so warm und weich war wie eine Wolke aus Sonnenschein, und deckte sie mit einer Decke zu, die nicht auf ihrer Haut kratzte.
»Schlaf, Hekat«, sagte er.
»Abajai«, seufzte sie und ihre Lippen bogen sich nach oben, während sie kopfüber in die warme Dunkelheit fiel. »Abajai.«
Sie erwachte bei hellem Tageslicht aus einem bösen Traum über die Hunde des Mannes und musste so dringend Wasser lassen, dass ihr Bauch sich zusammenkrampfte. Abajai schnarchte, eine lange, reglose Gestalt unter seinen gestreiften Wolldecken. Mit noch vom Traum hämmerndem Herzen fummelte sie die Zeltlasche auf und stolperte nach draußen, wo Obid und die anderen Wachen an dem Schlangenrücken von Sklaven auf und ab gingen, ihnen ihre schmutzigen Wolldecken wegnahmen und sicherstellten, dass keiner in der Nacht gestorben war. Sie trugen Eimer und die Sklaven hockten sich einer nach dem anderen darüber und ließen Wasser. Machten Münzen für Abajai.
Sie hatte keine Zeit, um einen eigenen Eimer zu erbitten; heiße Rinnsale kitzelten an ihren Oberschenkeln, daher entfernte sie sich vom Zelt, raffte die gelbe Robe, die Abajai ihr gegeben hatte, und ließ ihr eigenes Wasser fließen. Obid sah sie. Er drückte seinen Eimer einem anderen Wachposten in die Hand und lief mit hin- und her baumelnden Armen, die rotbefleckten Zähne wie Messerspitzen gebleckt, auf sie zu.
Sie taumelte rückwärts und bog die Finger zu Krallen. »Abajai!«
Er kam gerade in dem Moment aus dem Zelt, als Obid sie erreichte und ausholte, um ihr ins Gesicht zu schlagen. »Obid!«, rief er. »Hunta!«
Obid fiel auf die Knie wie eine von der Axt gefällte Ziege und drückte die Stirn in den Schmutz. »Herr.«
Abajai trug eine dunkelgrüne Robe. In der Hand hielt er einen Knüttel mit einem Knoten an einem Ende und geflochtenen Riemen am anderen. Er warf ihn in die Luft, fing ihn direkt über dem Knoten wieder auf und ließ die Riemen auf Obids nach vorn gebeugte Schultern knallen. Obid trug nichts am Leib als sein Lendentuch. Auf der hellbraunen Haut bildeten sich sofort Striemen und er wimmerte. Noch vier Mal schlug Abajai ihn. Obids Finger zuckten, aber er schrie nicht auf.
»Steh auf«, befahl Abajai. Er klang ruhig, aber streng. »Siehst du diese da?«
Obid, der nun wieder stand, sah sie an. »Herr.«
»Diese da darf ohne mein Nicken nicht angerührt werden.«
Obid rang nach Worten. »Herr, diese da hat ihr Wasser auf den Boden fließen lassen.«
»Ah.« Abajai hockte sich vor sie hin und der scharlachrote Skorpion spreizte die Klauen, als er das Gesicht verzog. »Was habe ich dir gesagt, Hekat?«
»Eimer benutzen.«
»Wenn du keinen Eimer benutzt, verschwendest du dein Wasser. Geradeso gut könntest du meine Münzen stehlen. Hast du verstanden?«
Sie spürte, wie die kühle Neusonnenluft ihr in der Kehle stockte. Der Gottessprecher bewahrte seine zweitschärfsten Steine für Diebe auf. »Nicht stehlen, Abajai«, stieß sie hervor. »Keine Zeit für Eimer. Musste brunzen jetzt.«
Abajai seufzte. Hinter ihm war Obids Gesicht ausdruckslos wie Stein. Nur seine hellblauen Augen lebten, waren voller Fragen. »Hekat, du bist kostbar. Aber wenn du noch einmal die Ohren gegen mein Wort verschließt, werde ich Obid zunicken und er wird dich schlagen. Geradeso, als wärest du eine der Sklavinnen, die er bewacht. Verstehst du das?«
Hekat, du bist kostbar. Die Worte platzten in ihr auf wie eine seltene, unerwartete Regenwolke. Von Freude überflutet nickte sie. »Ja, Abajai. Wasser in den Eimer.«
Seine Lippen zuckten. »Du musst all meinen Worten gehorchen, Hekat. Verstehst du das?«
»Ja, Abajai.«
Geschmeidig wie eine Schlange, erhob er sich auf die Füße. »Gut. Obid?«
Obid trat vor. »Herr.«
Abajai legte eine Fingerspitze auf ihren Kopf. »Wenn ich dir nicht zunicke, ist diese da vor dir verborgen.«
Jetzt wanden sich die Fragen in Obids Augen wie Maden in altem Fleisch. »Ja, Herr.«
»Kehr zurück zu deiner Arbeit. Wir brechen bald auf.«
Obid verneigte sich. »Herr.«
Sie beobachtete, wie Obid zu der Sklavenreihe zurücklief, wo die anderen Wachen so taten, als sähen sie nicht hin. »Obid nicht mögen Hekat.«
Abajai betrachtete sie mit einem schwachen Lächeln. »Interessiert das Hekat?«
Sie grinste. »Nein. Hekat nicht interessieren.«
»Gut«, sagte er. »Es ist töricht, sich für die Gefühle eines Sklaven zu interessieren. Jetzt komm.«
Sie kehrte mit ihm zu ihrem Lager zurück, wo Yagji Tee braute und in einer Pfanne Maiskuchen buk. Er trug eine weiße, mit goldenen Fäden durchschossene Robe. All seine Gotteszöpfe wurden in einem Pferdeschwanz in seinem Nacken zurückgehalten und er hatte sein rotes Steinauge abgenommen. Jetzt baumelte eine grüne, zusammengerollte Schlange an seinem Hals. Der Stein, aus dem sie geschnitzt war, glänzte. Sie hatte noch nie zuvor etwas Derartiges gesehen.
»Noch mehr Ärger, Aba?«, fragte er säuerlich, während sie sich auf eine Decke setzte und beobachtete, wie Abajai Essen und Trinken für zwei Personen abmaß.
»Nein«, sagte Abajai und reichte ihr einen Teller und einen Becher. Dann griff er nach einem Krug und hielt ihn über ihre Maiskuchen. »Honig?«
»Was Honig?«
»Was ist Honig«, verbesserte er sie. »Du musst richtiges Mijaki lernen, Hekat. Eine flüssige, angenehme Redeweise. Nicht dieses zusammengeschusterte Knurren, das du von dir gibst.«
»Was Mijaki?«
»Was ist Mijaki. Es ist die Sprache unseres Volkes. Wir sind Mijaki. Dieses Land ist Mijak, Geschenk des Gottes.« Als sie ihn verständnislos ansah, schüttelte er den Kopf. »Das hat er dich nie gelehrt, dein Vater?«
Vater. Er meinte den Mann? Sie zuckte die Achseln. »Weibbälger wie Ziegen. Wer wollen Ziegen lehren?«
»Nur gottverlassene Narren«, murrte Yagji.
Abajai warf ihm einen finsteren Blick zu. »Was ist mit deiner Mutter?«
Sie kicherte. »Frau nicht lehren. Mann schlagen Frau, wenn reden mit Weibbälger.« Sie nippte vorsichtig an ihrem Becher, der diesmal keine Sadsa enthielt, sondern Tee. Er war kühl genug, um davon zu trinken. Mit plötzlichem Durst nahm sie einen tiefen Schluck. »Frau versuchen. Reden ein wenig, wenn Mann fort.«
»Hat sonst noch jemand mit dir geredet?«
»Manchmal.« Sie zuckte die Achseln. »Mann nicht gefallen. Aber Hekat hören Mann zu. Hören Jungen von Mann zu. Männern, die Mann besuchen. Hekat lernen Worte. Lernen zählen.«
Abajai lächelte. »Kluge Hekat.« Wieder hob er den Krug. »Honig ist süß. Weißt du, was ›süß‹ ist?«
Sie schüttelte den Kopf und riss die Augen auf, als Abajai einen klebrig goldenen Strom auf ihre Maiskuchen goss. »Iss«, sagte er, immer noch lächelnd. »Benutz die Finger.«
»Ich dachte, du wolltest es zivilisieren«, protestierte Yagji.
»Das wird noch kommen«, erwiderte Abajai, als sie den Becher absetzte und den Teller auf ihrem Schoß balancierte. »Für den Augenblick lass sie die Welt mit den Fingern berühren. Lass die Welt für sie real werden. Etwas, das es anzunehmen, nicht zu fürchten gilt. Wenn sie mir ein Vermögen einbringen soll, muss sie ...«
»Wenn sie uns ein Vermögen einbringen soll«, korrigierte ihn Yagji und deutete auf ihren Teller. »Du hast Aba gehört, Affe. Iss! Wenn du nicht isst, wirst du kein Fleisch auf den Knochen haben und die gute Münze, die wir für dich bezahlt haben, wird vergeudet gewesen sein!«
Noch mehr Ziegenworte von Yagji. Sie würde auf Abajai hören. Sie klappte einen Maiskuchen zusammen und schob ihn sich in den Mund. Als der klebrig-goldene Honig auf ihrer Zunge schmolz, traten ihr die Augen schier aus den Höhlen. Das war ›süß‹? Dieses – dieses ...
Abajai und Yagji lachten über sie. »Und? Magst du Honig, Hekat?«, wollte Abajai wissen.
Sie kaute. Schluckte. Blickte auf die anderen honiggetränkten Maiskuchen hinab. Sie waren jetzt kalt, aber das scherte sie nicht. »Hekat mögen.«
»Du solltest danke sagen«, meinte Yagji naserümpfend. »Nur Wilde und Affen haben keine Manieren. Sag: Danke, Yagji und Abajai.«
Ihre Zunge sehnte sich nach mehr süß. »Danke, Abajai und Yagji.« Sie lächelte, ein Lächeln, das allein für Abajai bestimmt war. »Danke für Honig.«
Abajai tätschelte ihre Wange. »Gern geschehen, Hekat. Jetzt iss. Die Sonne fliegt empor. Wir müssen gehen.«
Während sie seinem Wort gehorchte und sich süße Maiskuchen in den Mund stopfte, nahm Yagji Abajai den Honigkrug ab und goss etwas davon über seine eigenen Kuchen. »Unterrichte es, wenn es sein muss, Aba, aber verkneif dir Liebkosungen. Es mag einen flinken Verstand für eine Sklavin haben, aber dein Schoßtier versteht nicht so viel, wie du denkst.«
Abajai lachte und trank seinen Tee.
Nach dem Frühstück stiegen sie auf die weißen Kamele und die Karawane setzte sich wieder in Bewegung, zog langsam, aber stetig unter dem heißen blauen Himmel weiter. Jeden Tag bei Hochsonne lehrte Abajai Hekat ordentliches Mijaki und Yagji brummelte vor sich hin. Am sechzehnten Tag, kurz nach Neusonne, veränderte sich das Land; war bisher alles flach gewesen, so erhoben sich jetzt von Schluchten getrennt steile Hügel. Vier Finger nach der neunzehnten Hochsonne erreichten sie eine Straße, die sich wand und krümmte wie eine Schlange, bevor sie über einen scharfen Kamm hinabstürzte. Hohe, dürre Bäume mit gertenartigen Ästen säumten die Straße zu beiden Seiten und schürften ihnen Gesicht, Arme und Beine auf. Die Kamele beklagten sich bei jedem Schritt und Abajai legte den Arm fester um Hekats Mitte und lehnte sich zurück, während sie in den Talgrund hinunterschlurften.
Als sie ihr Ziel erreichten, sog sie scharf die Luft ein. Vor ihnen breitete sich ein grünes Land aus! Üppiges Gras, so weit das Auge reichte, und mehr blühende Büsche, als jemals im Dorf wuchsen. Aus der Erde sprudelten Wasserquellen hervor. Aieee! Sie wünschte, sie hätten innehalten können, sie wollte das gurgelnde Wasser berühren, wollte mit nackten Füßen durch all das wachsende Gras laufen, aber die Tiefsonne sorgte bereits für lange, dünne Schatten. Sie würden bald das Lager aufschlagen müssen. Yagji schlief schon und vertraute darauf, dass sein Kamel mit dem von Abajai Schritt halten würde.
Abajai weckte ihn. »Wir haben die Länder des Kriegsherrn Jokriel erreicht, Yagji. Der wilde Norden liegt hinter uns.«
Grunzend und schnüffelnd richtete Yagji sich auf. »Endlich. Ich möchte niemals wieder dort hinreisen, Aba. Mach dir eine Notiz.«
»Wir reisen, wohin der Gott uns schickt«, entgegnete Abajai. »Jetzt lass uns unsere Pflicht vor dem Gottespfahl tun und dann ein schönes Fleckchen für unser Lager suchen.«
Ein Stück vor ihnen stand ein Gottespfahl an der Straße, wie Hekat jetzt sah. Er hatte die Form eines Skorpions mit einer weißen Steinkrähe an der Spitze und ragte hoch und grimmig auf. An seinem Sockel gab es keine Gottesschale für Opfergaben, sondern einen ungleichmäßigen Klumpen blauen Kristalls. Abajai und Yagji ließen ihre Kamele und den Sklavenzug innehalten und Hekat sah zu, wie Abajai zum Gottespfahl ging, zwei kleine, geschnitzte Zylinder aus der Tasche seiner Robe nahm und sie auf den wenig bemerkenswerten Stein presste. Helles Licht flackerte auf, flüchtig wie ein herabfallender Stern. Überrascht sah sie Yagji an.
»Der Kriegsherr bewacht die Grenzen seiner Länder«, erklärte Yagji. »Händler reisen, wohin sie wollen, aber wir müssen unser Erscheinen dennoch ankündigen und beweisen, dass wir unseren Straßenzoll entrichtet haben.«
Sie wusste nicht, was ein Kriegsherr war, sie verstand nicht, was Yagji meinte oder wie Abajai es fertiggebracht hatte, das Licht aus dem Stein auflodern zu lassen.
»Tz-tze«, sagte Yagji ungeduldig, weil sie nicht begriff. »Soll Aba es erklären, wenn er wünscht. Mir ist es herzlich egal, was du weißt und was du nicht weißt.«
Aber Abajai hatte, als er zu seinem Kamel zurückkehrte, kein Interesse daran, über Steine und Kriegsherren zu reden. Er wollte nur endlich das Lager aufschlagen. Als sie weiterritten und nach dem besten Ort für die Nacht Ausschau hielten, sah sie kleine, graue Tiere mit langen Ohren im Gras links und rechts von ihnen. Auf Abajais Befehl tötete Obid die umherhüpfenden Geschöpfe mit einer Steinschleuder. Wann immer er einen schlaffen Leib in den Sack auf seiner Schulter stopfte, warf er Abajai ein breites Lächeln zu.
»Kaninchen«, erklärte Abajai, als er ihre Verwirrung bemerkte. »Kennst du keine Kaninchen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Keine Kaninchen Dorf.«
»Du bist jetzt weit entfernt von deinem Dorf, Hekat. Vergiss diesen Ort, er existiert nicht.«
Sie nickte. »Ja, Abajai. Wie weit Todorok Dorf?«
»Wir werden es morgen ein oder zwei Finger nach Hochsonne erreichen.«
»Mehr Honig dort?«, fragte sie ihn hoffnungsvoll.
Das brachte ihn zum Lachen. »Vielleicht. Und mehr Sklaven.«
Einen Moment lang stieg Furcht in ihr auf. Wenn er ein Weibbalg fand, das kostbarer war als sie ... »Viele Sklaven jetzt.«
»So etwas wie zu viele Sklaven gibt es nicht, Hekat.«
Sie sollten über etwas anderes reden. Sie runzelte die Stirn und fügte ihre Worte sorgfältig zusammen, wie er es sie gelehrt hatte. »Wie weit ist Et-Raklion?«
Er stieß einen erfreuten Laut aus. »Noch viele Gottesmonde mit der Karawane. Dein Dorf liegt an der Türschwelle zum Amboss, Hekat. Den Amboss, kennst du ihn?«
Sie nickte. Der Amboss war die grimmige, ewige Wüste, einen Hochsonnenritt vom Gottespfahl des Dorfes entfernt. Sie hatte sie natürlich nie gesehen, wusste jedoch von Männern und Jungen, die sich auf der Jagd nach Sandkatzen in die Wüste hineinwagt hatten und nie wieder gesehen worden waren. Sie hatte sich oft gewünscht, der Mann würde ebenfalls so töricht sein.
»Et-Raklion liegt an der gegenüberliegenden Seite von Mijak. Die Stadt Et-Raklion, wo der Kriegsherr lebt, wo wir leben, liegt in der Nähe der Grenze von Mijaki, eine schnelle Reise von einem halben Gottesmond vom Sandfluss entfernt.«
Verwirrt drehte sie sich um, um ihn anzusehen. »Grenze? Sandfluss?«
Er schüttelte den Kopf. »Deine Welt würde in eine verkümmerte Nussschale hineinpassen, Hekat. Die Grenze ist die Stelle, an der Mijak endet. Der Sandfluss ist eine Wüste wie der Amboss, wenn auch nicht so gewaltig, verstehst du?«
Yagji, der neben ihnen lag, richtete sich auf. »Spar dir den Atem, Aba. Es braucht keine Geographie. Bring ihm ein Dutzend Arten bei, die Beine zu spreizen, und es wird mehr als genug für unseren Zweck wissen.«
Sie mühte sich, die Bedeutung seiner Worte zu entwirren. »Mijak endet?«
»Ja.« Abajai legte ihr seine warme Hand in den Nacken. »Am Sandfluss. Jenseits des Sandflusses liegen andere Länder. Wir besuchen diese Orte nicht, die Menschen dort sind tot für uns.«
»Warum?«
Abajai zuckte die Achseln. »Weil der Gott es gesagt hat.«
»Warum?«
Yagji kreischte und küsste sein Echsenfußamulett. Abajais Finger schlossen sich um ihren Hals, die bemalten Nägel bohrten sich ihr in die Kehle und seine Lippen berührten ihr Ohr. »Möchtest du leben, Hekat?«
Mit hämmerndem Herzen nickte sie. Abajais Stimme war dunkel und kalt geworden. Er war wütend. Was hatte sie getan? Sein scharfer Atem versengte ihre Wange.
»Frag den Gott niemals, warum. Nicht in deinem Herzen und niemals mit deinem Mund. Verstehst du?«
Nein, aber er tat ihr weh. Wieder nickte sie.
»Gut«, sagte er und ließ sie los. »Das ist alles, was du heute lernst.«
Yagji hatte sein Amulett so heftig geküsst, dass der geschnitzte gelbe Stein sein Fleisch gespalten hatte. Ein dünner Blutsfaden tröpfelte ihm übers Kinn. Er berührte die kleine Wunde, starrte auf das Blut und beugte sich dann vor, um seinen nassen, roten Finger Abajai hinzuhalten.
»Siehst du das, Aba! Der Gott beißt mich! Er gibt ein Zeichen! Träume nicht länger von einem Vermögen. Verkaufe deine kostbare Hekat in Todorok, ich flehe dich an!«
Abajai gab ihm ein viereckiges, weißes Tuch. »Die Strafe des Gottes trifft keine Unbeteiligten, Yagji. Du blutest für deine eigene Sünde oder durch ein Versehen. Hekat wird in Todorok nicht verkauft.«
Hekat stieß den Atem aus und wartete darauf, dass ihr Herz langsamer zu schlagen begann. Sie wollte nicht, dass Abajai wusste, welche Angst sie ausgestanden hatte. Lange Zeit ritt Yagji schweigend neben ihnen her, wobei er das weiße Tuch mit zitternden Fingern an seine aufgeschnittene Lippe hielt. Seine Augen waren groß und starrten voraus, in die einbrechende Abenddämmerung.
»Wir werden noch einmal darüber reden, Abajai«, sagte er schließlich sehr leise. »Bevor wir Et-Raklion erreichen.«
»Wir werden über viele Dinge reden, Yagji«, erwiderte Abajai genauso leise. »Bevor wir Et-Raklion erreichen.«
DRITTES KAPITEL
Einen halben Finger nach Hochsonne am nächsten Tag erreichten sie das Dorf Todorok. Hekat schaute und schaute, so viel Seltsames gab es zu sehen.
Zuerst Todoroks Gottespfahl. Er sah neu aus, unberührt von grellem Sonnenschein, nicht vom Sturmwind zersplittert. Doppelt so hoch wie der Gottespfahl, den sie im Dorf zurückgelassen hatte, war er in leuchtenden Gottesfarben bemalt: Purpur, Grün und Gold. Aus glänzendem, schwarzem Kristall geschnitzte Skorpione krochen ringsum zu der weißen Krähe an seiner Spitze empor und trugen dem Gott Nachrichten zu. Die Gottesschale an seinem Sockel war ebenfalls ein Skorpion, schweres, schwarzes Eisen, den Schwanz erhoben, die Krallen ausgestreckt, und ihr Bauch war voller Münzen. Abajai warf Gold hinein, als sie vorbeikamen, und drückte zum Zeichen seines Respekts die Knöchel auf die Brust. Auf dieselbe Weise zeigte Yagji Respekt. Sie tat es den beiden Männern nach, nachdem Abajai ihr in die Schulter gekniffen und geknurrt hatte.
Sie hatte kaum aufgehört, über den Gottespfahl zu staunen, als ihr ein zweites Mal der Atem geraubt wurde. Todorok war groß. Es hatte breite, mit glatten Steinen bedeckte Straßen und weiß gestrichene Häuser. Deren Dächer waren nicht aus Gras, sie hatten Schuppen