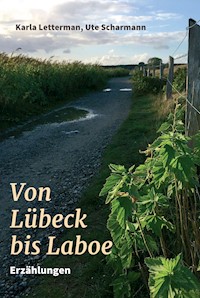Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nie hätte Oberkommissar Alois Aisner damit gerechnet, in dem idyllischen Harzstädtchen Bad Lauterberg auf derart skurrile Leute zu stoßen. Schon an seinem ersten Arbeitstag kreuzen allerlei verdächtige Gestalten seinen Weg. Eine Gruppe Neonazis tritt immer dreister in der Öffentlichkeit auf und ängstigt Andersdenkende. Als Aisner den Tod einer alten Dame aufklären soll, die über brisante Papiere zur Hexenforschung verfügte, kommt allmählich Licht in die Machenschaften der rechten Gruppe. Es fehlt nur noch ein Puzzleteil, um den Ermittlungen zum Durchbruch zu verhelfen. Ausgerechnet Eagle-Eye, der Sohn seiner Lebensgefährtin, könnte den entscheidenden Hinweis geben. Aber der Zehnjährige schweigt, weil er selbst etwas zu verbergen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Hexenpapiere
Harzkrimi
Copyright © 2018 by Karla Letterman
ePub Edition, Version 1.0, 04/2018
ISBN 978-3-947167-17-3
ABBILDUNGSNACHWEISE:
Umschlagmotiv © pixeldreams - Tomasz Pacyna # 31520197 | depositphotos.com
Porträt Autorin, Foto Walpurgisfeier © Thomas Schmitt-Schech | lichtblick-fotokompass.de
LEKTORAT:
Sascha Exner
DRUCK:
Frick Kreativbüro & Onlinedruckerei e.K., Krumbach
VERLAG:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Kapitel 1: Der erste Tag als Herr Professor
Kapitel 2: Psychomaus und Adlerauge
Kapitel 3: Die Promenadenmischung auf Nazisuche
Kapitel 4: Hexentanz
Kapitel 5: Anschlag Nummer zwei
Kapitel 6: Hugins Auftritt
Kapitel 7: Das Opfer
Kapitel 8: Stecher und Fuchs
Kapitel 9: Der Schatz der alten Kommunistin
Kapitel 10: Planänderung
Kapitel 11: Wolfsrudel
Kapitel 12: Instruiert
Kapitel 13: Alarm
Kapitel 14: Erfolg und Schock
Kapitel 15: Hugins Problem
Kapitel 16: Verbannt
Kapitel 17: Abgetaucht
Kapitel 18: Das Geheimnis der Wissenschaftlerin
Kapitel 19: Eklat
Kapitel 20: Anruf aus Hannover
Kapitel 21: Der Investor
Kapitel 22: Die Liedermacher singen
Kapitel 23: Noras Entdeckung
Kapitel 24: Verbindungen
Kapitel 25: Am Feuer
Kapitel 26: Das Phantom
Kapitel 27: Svenja
Kapitel 28: Verdientes Wochenende
Kapitel 29: Finale fatal
Kapitel 30: Kai Nehr
Kapitel 31: Das Geschenk
Was ich mir erlaubt habe
Danke!
Gestatten, Karla!
Kontakt erwünscht
Eagle-Eye zum Kennenlernen
Es geht weiter
Geisterbahn (Arbeitstitel)
Kapitel 1:
Der erste Tag als Herr Professor
Ein weiteres Mal pflügte Alois Aisner mit beiden Händen über den Kopf. Seine Frisur, bei Arbeitsantritt noch Machart englischer Rasen, hatte jetzt den Charme von Punk nach Gewitter. Ähnlich durcheinander liefen seine Gedanken. Sollte er ganz schnell Larissa heiraten und den Namen Bokelmann annehmen? Aber nein, für einen solchen Schritt war es entschieden zu früh. Doch er konnte die immer gleichen Bemerkungen auf Kosten seines Nachnamens nicht mehr hören, eine ausgewachsene Aisner-Scherz-Allergie hatte sich des Kriminalkommissars bemächtigt. Warum hatten sie den einzigen österreichischen »Tatort«-Ermittler nicht Mayr, Huber oder Pichler nennen können?
So reizend er seine neue Heimat, das Harzstädtchen Bad Lauterberg, auch fand — die Erfinder origineller Witze wohnten woanders. »Nein so was, Herr Kollege, dass Sie sich die Mühe machen wollen, in unserer abgelegenen Provinz zu ermitteln! Bei dieser weiten Anreise extra aus Wien...« Variationen davon bekam er garantiert zu hören, sobald er sich vorstellte. — »Aisner mit A, nicht mit E wie der Tatortkommissar!«, hatte er anfangs noch geantwortet. — »Ach, dann heißen Sie wohl auch nicht Moritz, sondern Max?«, entgegnete etwa sein Gesprächspartner (oder Ignaz oder Ernstl oder Sepp). Ein besonders Dreister klopfte ihm sogar auf die Schulter, als er befand: »Ihr Ösis könnt wohl nicht mal eure eigenen Namen richtig schreiben, ha ha!« Die Frage »Wo haben Sie denn Bibi gelassen?« hatte er nicht erst einmal gehört.
Als er vor einer Stunde seinen künftig engsten Kollegen Norbert Kellner begrüßt hatte, begann dieser, seinen Dialekt zu imitieren: »Ja, mei, d’r Herr Oberleutnant Chefinspektor!«, lärmte Kellner, dass der Teamraum vibrierte, und zwinkerte ihm gut gelaunt zu. »Alois heißen’S, da sagt man doch Loisl zu in Ihrer Hoamoat, stimmt’s neet?« Während Aisner verdattert schwieg, beeilte sich Kellner, eine weitere Kostprobe seiner Expertise beizubringen: »Bei Euch in Wien is’ doch a jeder gleich der Herr Doktor, gell? Oder – wenn oaner a Respektsperson is’ wia Sie – a Herr Professor, ne woahr?!«
Dass weder Bestätigung noch Richtigstellung von ihm erwartet wurde, war Aisner klar. Man wollte dem Neuen auf den Zahn fühlen und dabei ein bisschen Spaß haben. Er verkniff sich die Bemerkung, Österreich bestehe nicht nur aus Wien, denn er wollte weder beleidigt noch oberlehrerhaft daherkommen. Es sollte noch mehrere Tage dauern, bis Aisner seinen neuen Spitznamen erlauschte. Doch ab der Minute, in der er den Raum verließ, war er für die anderen »der Herr Professor Gendarm«.
Seine jungenhaft zerwühlte Frisur stand in augenfälligem Gegensatz zum korrekt sitzenden Dreiteiler, den er für seinen ersten Tag im Kommissariat hatte reinigen lassen. Button-Down-Hemd und schmale dunkelblaue Krawatte hatte er vorige Woche noch gekauft, auch wenn Larissa meinte, sein altes weißes Hemd sei noch gut genug, und den schon leicht fadenscheinigen Stoff am Rücken sehe man doch unter »den ganzen Zwiebelschichten« sowieso nicht.
Nun jedoch war Aisner froh über seine formelle Kleidung, denn die brünette Mittvierzigerin, die ihm der diensthabende Kollege aufdrängte, legte offensichtlich Wert auf korrekten Schick. Zu ihrem tannengrünfarbenen Jackenkleid trug sie passende Pumps und Lederhandtasche. »Hier möchten welche eine Aussage machen«, hatte der Diensthabende angekündigt, und auf Aisners erstaunte Rückfrage »...welche?« nur geantwortet: »Ja, da sind zwei, die wollen einen Überfall zu Protokoll geben.« Warum er das Protokoll nicht selbst aufnahm, behielt der Kollege für sich, und Aisner wollte vor der Frau keine Diskussion darüber anfangen. Doch als die Tochter erschien, war ihm klar, warum der Kollege sich zurückgezogen hatte. Es roch sofort nach Drama.
»Wo bleibst du denn, Nora-Theres?!«, fauchte die Mutter sie an, die sich als Beate Wolff-Lutter vorgestellt und dann ungeduldig in Richtung Tür gespäht hatte. Das Mädchen, das nun aufreizend lässig ins Zimmer geschlendert kam, war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, das konnten auch die über ihre Augen fallenden üppigen, schwarz gefärbten Pony-Strähnen nicht verdecken. Aisner schätzte sie auf 15 oder 16.
»Ich musste mal auf die Toilette, das wird doch selbst die Polizei wohl erlauben?«, entgegnete Nora-Theres, wobei sie ihre Mutter direkt anblickte, von Aisner jedoch nicht die geringste Notiz zu nehmen schien.
»Meine Tochter möchte eine Aussage machen!«, erklärte die Ältere, jetzt deutlich an ihn gewandt. Aisner entging das Zucken um ihre Mundwinkel nicht, das auf mühsame Beherrschung schließen ließ.
»Möchte? ‚Soll‘ trifft es wohl eher!«, verbesserte die Tochter scharf, die sich immer noch ausschließlich an ihre Mutter wandte.
Er verfügte über genügend Berufserfahrung, um die Provokationen nicht auf sich zu beziehen. Gleichwohl war er nicht gewillt, den Zuschauer für abstruse Familienspielchen abzugeben. Ruhe und Sachlichkeit würden die Spannung am ehesten entschärfen, vermutete der Kommissar. Betont formell fragte er deshalb die Schülerin nach ihrem Namen, woraufhin diese erwartungsgemäß Nora-Theres Wolff-Lutter angab. »Wohnhaft?«, fuhr er fort.
»Ja – sehen wir vielleicht aus wie Obdachlose?«, fragte sie aufsässig zurück.
»Mädchen, Mädchen...«, mischte sich ihre Mutter ein. »So verheult, wie du nach Hause kamst, sollte ich meinen, du wärst in deinem Interesse hier. Wenn nicht, gehen wir sofort wieder!«
»Vielleicht versteht die junge Dame mich wegen meines Dialekts nicht«, schlug Aisner mit scheinbar verbindlichem Lächeln vor. »In diesem Fall können Sie die Personalien gern bei meinem Kollegen im Erdgeschoss aufgeben.«
Er konnte förmlich sehen, wie Nora-Theres sich einen Ruck gab. Vielleicht verlor sie den Geschmack an ihren Albernheiten, jedenfalls verlief die Befragung von nun an komplikationslos.
Sie war von zwei Mitschülern aus der Parallelklasse in der Pausenhalle der KGS beschimpft, bedroht und geschubst worden. Dabei war ihr iPhone der neuesten Generation zwischen die Fronten geraten und zu Bruch gegangen – was die Mutter zweimal betonte. Aisner registrierte irritiert, dass das Mädchen mit einem ebensolchen Smartphone hantierte. Auf seine Nachfrage antwortete die Schülerin gelangweilt: »Natürlich hab ich sofort ein neues bekommen. Meine Eltern wollen mich doch erreichen können.«
»Nun denken Sie bloß nicht, Herr Kommissar, dass 700 Euro für uns Peanuts sind!«, riss Beate Wolff-Lutter das Wort an sich. »Auch wir finden das Geld nicht auf der Straße. Und auch wenn wir uns den Ersatz zum Glück leisten können, bestehe ich darauf, dass die Zerstörer unseres Eigentums zur Rechenschaft gezogen werden!«
Offenbar hatten die beiden Jungen sich so geschickt angestellt, dass es keine Zeugen gab. Auf Aisners Frage nach dem genauen Wortlaut der Drohungen blieb Nora-Theres größtenteils vage, was in ihm den Verdacht aufkeimen ließ, dass sie vor ihrer Mutter nicht alle Details preisgeben wollte.
»Sie haben mich für morgen Abend Punkt acht zum alten FSC-Vereinsheim bestellt«, schloss das Mädchen den Bericht ab. »Ich soll allein kommen, sonst wollen sie richtig Ärger machen.«
Was die Jungen wohl gegen sie in der Hand hatten?, überlegte der Kommissar. In Anwesenheit der Mutter würde er das höchstwahrscheinlich nicht erfahren, doch er konnte sie schlecht aus dem Raum schicken. Blitzschnell kam ihm eine Idee. Mochte sie auch unkonventionell sein, gegenüber den Kollegen konnte er nachher immer noch behaupten, in Österreich sei so etwas gang und gäbe.
»Du gehst da morgen hin, und ich begleite dich. Ganz offen. Die sollen sehen, dass du dich nicht einschüchtern lässt.«
»Spielen denn heute alle verrückt?!«, rief die Mutter so schrill, dass Aisner damit rechnete, gleich werde einer seiner Kollegen erscheinen, um nach dem Rechten zu sehen. »Das kommt überhaupt nicht infrage. Meine Tochter geht dort nicht hin. Keinesfalls. Und Sie – Sie machen gefälligst Ihren Job und unternehmen was gegen diese, diese...« Während sie aus dem Zimmer rauschte, konnte Aisner noch die Worte »Gangster«, »Nichtsnutze«, »Banditen« und »Schurken« verstehen.
»Maik und Artur sind Nazis«, erklärte Nora-Theres, die jetzt ruhig vor ihm stand. Als er sie daraufhin nur erwartungsvoll ansah, zögerte sie kurz. Dann sah sie zu Boden. Sie hielt den Blick gesenkt, als sie murmelte: »Und – äh... Entschuldigung. Für... also für vorhin.« Da Aisner dem nichts hinzuzufügen hatte, begann er die Dinge auf seinem Schreibtisch zusammenzuräumen. Doch Nora-Theres war noch nicht fertig. »Kann ich Sie noch was fragen?«
»Nur zu!«
»Sind Sie eigentlich der neue Vater von Eagle-Eye?« Jetzt scannte sie sein Äußeres unverhohlen neugierig.
»Ja, gewissermaßen«, lachte Aisner. »Kann man vielleicht so sagen.« Bevor er sie fragen konnte, woher sie Larissas zehnjährigen Sohn kannte, rief ihre Mutter nach ihr, und der barsche Ton signalisierte die Neige der Geduldsreserve.
Kapitel 2:
Psychomaus und Adlerauge
Larissa Bokelmann hatte Herdbesuch von Uroma Hilde, und weil Eagle-Eye das wusste, drückte er sich in Erwartung der einen oder anderen Kostprobe ebenfalls in der Küche herum. Seit neuestem, genauer gesagt seit es mit Alois ernster wurde, ließ sich seine Mutter systematisch in die traditionelle deutsche Kochkunst einweisen, die ihre Großmutter aufs Leckerste beherrschte.
Vorher hatte sich Larissa an »fettiger Pfanne«, einer Hackfleisch-Knoblauch-Komposition mit Zucchini-Einschlüssen, und »Asia Heat«, Hähnchenkeulen an roten Chilischoten, die Eagle-Eye nur mit einer Extrapackung Quark als Dip ertragen konnte, ausgetobt. »Für Frauen gibt es Wichtigeres als Kochen«, war ihre Antwort gewesen, wenn er sich beschwert hatte, »frag deine Oma!« Das hatte er genau einmal getan. Larissas Mutter Marion hatte ihm dann »eine Art Irish Stew« zubereitet, woraufhin er hatte eine Kolik simulieren müssen, um einer Lammfleischvergiftung zu entgehen. Marion wies zwar überaus gern auf Larissas Mängel hin, was jedoch keineswegs bedeutete, dass sie selbst vollkommen gewesen wäre.
Larissa pflegte sich von ihrer Mutter fernzuhalten. Ihre Großmutter Hilde hingegen betete sie an. Von ihr ließ sie sich jetzt das traditionelle Kochen beibringen. Heute standen Kartoffelpuffer mit Apfelmus auf dem Programm. Die zerschnittenen und aufgekochten Äpfel simmerten schon im großen blauen Emailletopf gemütlich vor sich hin und verbreiteten einen fruchtigen Duft.
»Alo wird begeistert sein!«, verkündete Larissa euphorisch. Sie liebte diese Atmosphäre: das Radio lief leise im Hintergrund, vorsorglich zurecht gelegte Küchengeräte erwarteten ihren Gebrauch, Gewürze standen portioniert in Porzellandöschen und Blechschächtelchen, Obst und Gemüse lagen vorbereitet auf Brettern, und während des Abmessens, Schnippelns und Rührens hatte man immer mal eine Hand frei zum Naschen. Kleine Plaudereien mit ihrer verehrten Oma wechselten mit Phasen konzentrierten Arbeitens.
»Boah, nee, Scheiße, Mann!«, kreischte der Junge plötzlich. Er sprang auf wie von der Tarantel gestochen, hämmerte mit beiden Fäusten auf den Eichentisch, sodass drei Kartoffeln auf den Fußboden kullerten, warf seiner Mutter einen brennenden Blick zu, stapfte in die Diele und knallte die Tür hinter sich.
»Was war das denn?« Hilde Mehmke vergaß, warum sie ihre linke Hand gehoben hielt, mit der sie eine Haarsträhne aus der Stirn hatte streichen wollen, und starrte nun ratlos auf die nassen Finger, die noch auf Augenhöhe verharrten.
Larissa war klar, was passiert war: »Hör mal hin. Erkennst du das Lied im Radio?« Sie wies mit dem Kinn Richtung Fensterbank, wo der Apparat stand.
»Ach herrje, ist er immer noch so empfindlich?«, erkundigte sich Hilde. Beide Frauen lauschten nachdenklich den Klängen des Songs »Save tonight« von Eagle-Eye Cherry. Während die Ältere sich zum hundertsten Mal fragte, warum ausgerechnet eine schwedische Trällerkirsche hatte Namenspate ihres Urenkels werden müssen, wandte Larissa den Blick nach innen und sah die Bilder ihrer Zeit mit Tennis-Dennis vorüberziehen.
Auf der Katzencouch im Wohnzimmer der verreisten Großmutter hatte sie auf dem Ghettoblaster ihre Lieblingshits abgespielt, die sie sorgsam auf Kassette aufgenommen hatte. Nicht weniger als 14 Anläufe hatte es sie gekostet, den Hit »Save tonight« störungsfrei aufzuzeichnen, den sie beide
liebten. Damals hatte sie noch gedacht: Der Typ ist so sportlich, da kann er kein ernsthaftes Drogenproblem haben. Mal ein Joint, mal ein Wodka, mal was ausprobieren, mal gut drauf sein. Machte fast jeder. Let’s delay our misery!
Groß, athletisch, gut situiert, im Sommer knusprig braun und vielbewundert, zelebrierte Dennis Wittmann das Spiel mit Aufschlag und Rückhand so lange erfolgreich, bis er einen zweiten weißen Sport für sich entdeckte: den mit der Linie und dem Sniefen. Irgendwann gestand Larissa sich ein, dass seine Höhenflüge immer gekünstelter wurden. Was tragfähiges Selbstbewusstsein gewesen war, zerbröselte im Staccato der weiter und weiter steigenden Erwartungen. Sie wollte ihm helfen, den Flugdrachen an die Leine zu legen, doch da war schon zu viel Abstand zwischen dem Boden und seinem Bewusstsein.
Vielleicht war es dieses Versagen, das in ihr den Plan reifen ließ, Psychologie zu studieren. »Das schaffst du nie! Du kriegst keinen Abschluss hin, und ich soll dich dann bestimmt immer weiter durchfüttern«, hatte ihre Mutter orakelt. Larissa hatte damals noch unbekümmert über diese Einschätzung gelacht und sich schon das Göttinger Georg-Elias-Müller-Institut angesehen, aber leider hatte Marion bis heute Recht behalten. Geschafft hatte sie gerade noch die Abiturprüfungen, doch ihr Notenschnitt ließ eine Zulassung zum Psychologiestudium in weite Ferne rücken. Mal ein Joint, mal ein Wodka – auch ihre Konzentration hatte unter dem ständigen Ausprobieren gelitten. Wenigstens ließ sie sich nicht aushalten! Um ihrer Mutter den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte sie noch während ihrer Schulzeit mehrere Putzjobs begonnen und sie solange wie möglich auch während der Schwangerschaft fortgeführt. Oma Hilde schüttelte während dieser Zeit nur betrübt den Kopf und mutmaßte im Stillen, dass ihre Tochter ihrer geliebten Enkelin gar keinen Erfolg gönnte. Marion betonte die Schwäche ihrer eigenen Tochter, wann immer sie konnte, und beschied ihr einen desaströsen Männergeschmack. »Mit diesem Tennisspieler kommst du unter die Räder«, war sie sich sicher. Larissa war letztlich zu patent für Traumkatastrophentänzer und zog sich von ihm zurück. So hatte Dennis außer etlichen aufregenden Nächten nichts zu Eagle-Eyes Existenz beigetragen. Die Stimmung dieser Nächte jedoch verwahrte Larissa tief in ihrem Herzen, und sie gab ihrem Sohn den Namen der Erinnerung.
»Was, Spiegelei?!«, fragte entgeistert der betagte, weder des Englischen mächtige noch in Popmusik bewanderte Standesbeamte . »So können Sie doch kein Kind nennen.« Larissas Korrektur verstand er als »Igelei«, woraufhin er ihr einen tief missbilligenden Blick zuwarf. »Wollen Sie mich nicht verstehen oder können Sie es nicht? Ihr Sohn braucht einen Namen, der eines Menschen würdig ist!«
An dieser Stelle hätte sie schalten und die künftigen Probleme ahnen können. Stattdessen erklärte sie dem Beamten höflich, dass ein schwedischer Staatsbürger Eagle-Eye heiße, dass das Adlerauge bedeute, ihrer Meinung nach sehr viel Würde ausstrahle und Schweden ja wohl auch keine Bananenrepublik sei. Sie setzte ihren Wunsch durch. Jetzt, zehn Jahre später, bedauerte sie das.
Wer in der niedersächsischen Provinz Eagle-Eye heißt, hat keine Chance auf eine durchschnittliche Kindheit. Er kann sich, bemüht, den auffälligen Namen vergessen zu machen, anpassen bis zur Unterwürfigkeit. Er kann, wenn er schon Aufmerksamkeit erregt, für einen wahren Grund sorgen: pöbeln, randalieren – oder elitär werden. Eagle-Eye Bokelmann suchte seinen Weg immer wieder neu zwischen Rebellieren und Verkriechen. Ihm war sein Name lästig, wie Pickel im Gesicht oder zu große Ohrläppchen, am liebsten hätte er nichts damit zu tun gehabt. Doch immer wieder wurde er daran erinnert, selbst ausgebildete Pädagogen konnten sich Anspielungen manchmal nicht verkneifen. Sein Kunstlehrer hatte ihn erst vor wenigen Tagen aufgezogen: »Unser Junge mit dem scharfen Blick soll mal vortreten und die Bilder an der Wand beurteilen. Komm, Adlerauge, pick die besten raus!«
Nachdem Larissa schon häufiger in der Schule aufgetaucht war, um ein Mitglied des Lehrkörpers wegen unangemessener Witze zu Lasten ihres Sohnes zur Rede zu stellen, hatten sie ihr dort das Etikett »Psychomaus« angeheftet. Ob einer der Lehrer von ihren Studienplänen Wind bekommen hatte oder ob es an ihren Zitaten aus der Fachzeitschrift »Psychologie heute« lag, die sie mit nicht nachlassender Begeisterung las, konnte niemand sagen.
Eagle-Eye wusste nicht, ob er sich mehr über sich selbst ärgern sollte oder mehr über die Radiosender. Warum spielten sie ausgerechnet dieses blöde Lied so oft! Wer beamte ihn jetzt zurück in die Küche, damit er endlich zwei, drei Kartoffelpuffer abgreifen konnte? Zum Glück kam seine Mutter um die Ecke: »Ach, mein Schatz, hier bist du, kannst du uns helfen? Alo ist ja noch nicht da, und wir brauchen mal einen Mann zum Abschmecken.« Lässig und mit gönnerhafter Pose trat er an den Herd und angelte einen krossen Reibekuchen aus der Pfanne. Wie er es zusammen mit seinem Freund Marvin auf Youtube gesehen hatte, schloss er die Augen, biss hinein und ließ sich Zeit mit dem Urteil. »Ja, also, ganz gut. Müsste man nochmal mit Apfelmus probieren.« Hilde war so erleichtert, dass sich ihre Zunge fast verheddert hätte, als sie ihrem Urenkel einen großen Teller vorsetzte. »Hier, bitteschön, mein kl..ig.. guten Adler..tit!« Weder Kleiner noch Igel konnte sie jetzt sagen, und Adler war eigentlich auch falsch, doch der köstliche Duft des Essens machte den Fehler vergessen. Der Junge genoss Hildes Kochlektionen mindestens ebenso wie seine Mutter.
Als eine Stunde später Alois die Küche betrat, hatte sich Hilde Mehmke längst verabschiedet. Larissa ließ einen Sender mit deutschsprachigen Hits laufen, sie hatte den Tisch gedeckt, die ersten Gartentulpen in zwei Vasen dekoriert und das Apfelmus in die urige rot-weiße Porzellanschüssel gefüllt. Eagle-Eye hatte Besuch von Marvin, mit dem er sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte. Die späte Nachmittagssonne schien zum Sprossenfenster hinein, in der Pfanne brutzelte der Kartoffelteig vor sich hin. Larissa schaffte es dank ihrer durchtrainierten Figur, selbst in einer blau-weiß-karierten Küchenschürze von Hilde unwiderstehlich auszusehen, und Alois Aisner berichtete, im Nachhinein zu sanftem Humor fähig, von seinem ersten Tag im Bad Lauterberger Kommissariat. Larissa wandte sich kokett zu ihm um, sie wollte ihre Verführungskunst wirken sehen. Der Blick, den sie auffing, war vielversprechend, die Situation also ausbaufähig.
Doch der kleine Dämon des Tages ließ ausgerechnet Falco singen: Drah’ di net um, oh, oh, oh, schau, schau, der Kommissar geht um. Da wurde Alois Aisner, auch wenn er nie in Wien gelebt hatte, von einem so starken Schwall Heimweh erfasst, dass die Gegenwart einen Schritt zurückweichen musste.
Kapitel 3:
Die Promenadenmischung auf Nazisuche
Die meisten Erwachsenen empfanden Eagle-Eye, den hageren dunkelblonden Viertklässler mit den wachsamen grünen Augen, als leicht misstrauisch und etwas linkisch. Vorsichtig, zuweilen auch störrisch und widerspenstig, bewegte er sich durch den Schulalltag. Was seine aufmerksame Klassenlehrerin Britta Heitermann zwar erahnte, aber nicht aus eigener Erfahrung kannte, war der neugierige, unternehmungslustige kleine Kerl, der mit drei engen Freunden Forellen fing und wieder freiließ, die ausrangierten Paletten der örtlichen Druckerei zu Lagerfeuerholz zerlegte und Plastikhandschuhe beschaffte, damit Larissa beim Putzen nicht so aufgedunsene Hände bekam. Letzteres erledigte er in der Drogerie in der Hauptstraße, wo die Mutter seines besten Freundes Marvin arbeitete. Ihr half er manchmal das Parfumregal aufzustocken. Mittags, wenn er von der Grundschule am Hausberg nach Hause schlenderte, spähte er kurz durchs Schaufenster, ob sie Dienst hatte. Dann fragte er sie, ob was zu tun sei, und sie ließ ihn in dem Glauben, ihr innerhalb einer Viertelstunde richtig helfen zu können. Als sie ihm das erste Mal angeboten hatte, er dürfe sich dafür eine Kleinigkeit aus dem Sortiment aussuchen, hatte er ein Ü-Ei gewählt. Doch kaum aus der Tür, stürzte er schon wieder herein und fragte verlegen, ob er es noch umtauschen könne. Als er dann die Handschuhe haben wollte, schwante ihr nichts Gutes hinsichtlich der geplanten Nachmittagsaktivitäten. Sie bediente sich gern der Sichtweise, dass ihr Marvin nur der Angestiftete war, wenn die Jungs mal wieder beim Mäusegrillen oder Mädchenaufscheuchen erwischt wurden. Deshalb fragte sie Eagle-Eye streng: »Was willst du denn mit den Handschuhen? Du weißt aber schon, dass Wasserbomben-Werfen verboten ist, ne?« Womit sie ihn auf Ideen brachte. Doch wahrheitsgemäß antwortete er, er wolle nur seiner Mutter Gutes tun.
Als Eagle-Eye zwei Stunden später mit Marvin, Leon und Bingo in ihrem Versteck, einem Hochsitz auf dem Scholben, hockte, gab er zu bedenken, dass Wasserbomben nicht nur Wasser beinhalten müssten, sondern auch klebrige Zusätze enthalten könnten, die Mädchen »ganz eklig und schrecklich finden«.
»Oder was Rotes, wie Blut«, schlug Bingo vor. Bingo war natürlich ein Spitzname. Er besaß wie Eagle-Eye einen ungewöhnlichen Vornamen, der aber immerhin zu einer vorteilhaften Abkürzung anregte. Offiziell hieß Bingo Zbigniew, doch kaum jemand machte sich die Mühe, seinen polnischen Namen richtig auszusprechen. Bis auf Frau Heitermann, die sich ihrer Vorbildfunktion bewusst war und außerdem fest an eine multikulturelle Zukunft Deutschlands glaubte. Damit war sie in der niedersächsischen Provinz noch in der Minderheit, üblicher war ein Misstrauen gegenüber den östlichen Nachbarn, besonders in der Großeltern-Generation: »Polen? Waren die nicht im Krieg gegen uns?«, weshalb Zbigniew nicht allzu viele Einladungen zu Geburtstagsfeiern seiner deutschen Klassenkameraden erhielt. Marvin – türkischer Vater –, Leon – alleinerziehender Vater – und Eagle-Eye waren dafür wahre Freunde. Die vier Jungen, die als Einzelne Außenseiter gewesen wären, gestalteten sich zusammen ihre kleine fantastische Welt. Wer sie um die Häuser ziehen sah, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen: Drei zierliche, drahtige Burschen wurden um zwei Kopflängen überragt von dem Vierten, dessen Glieder schlackerten wie die Arme eines jungen Tintenfischs. Leon wurde deshalb auch »die Krake« genannt, aber niemals von seinen drei Freunden.
Die bewaldeten Berge, in die sich das Kurstädtchen anmutig hineinschmiegte, boten den Jungen viel Raum für Abenteuer. Natürlich konnten sie sich die Fahrt auf den Hausberg mit der steilsten Seilbahn Norddeutschlands nicht allzu oft leisten. Doch den Wanderpfad hinauf zu steigen hatten sie meist keine Lust. Stattdessen harrten sie mitunter stur an der Talstation in der Schulstraße aus, bis sie die Tickets großspuriger Touristen in Empfang nehmen konnten, die ihren Mut überschätzt hatten. Kreidebleich im Gesicht, versuchte manch ausgewachsener Mann seine Fahrkartenspende wie ein wohltätiges Werk aussehen zu lassen. »Na, mein Junge, möchtest du gern mal fahren? Komm her, ich trete dir meine Karte ab!« Meist nahm der Angesprochene die Gabe still und dankbar lächelnd entgegen. Manchmal jedoch stach einen von ihnen der Hafer. »Okay, danke, ich fahre gern mit Ihnen«, hatte Leon neulich einem verdutzten Bremer eröffnet, der dann errötend etwas von fehlendem Kleingeld murmelte, um aus der Nummer herauszukommen. Den Vogel abgeschossen hatte Eagle-Eye vorige Woche, nachdem ihm eine Gruppe rundlicher Schlabberdamen auf einen Schlag vier Karten geschenkt hatte. »Klar fahren wir gern mit der Sesselbahn. Wir essen auch gern noch ein Eis. Dann können wir nämlich nicht reden, wenn der Wanderführer uns fragt, ob wir Sie gesehen haben.« – »Woher wusstest du, dass die wandern sollten?«, erkundigte sich Bingo später fasziniert. – »Die hatten doch so Sticker vom Kneippkurheim an der Jacke. Aktivkur oder so. Da muss man immer wandern, das hat mir meine Uroma Hilde erzählt.«
An der Seilbahn wollten sie sich sicherheitshalber ein paar Tage nicht sehen lassen, deshalb hatten sie sich an der Oderbrücke des Kurparks getroffen. Von dort war es nicht weit bis zu ihrem Hochsitzversteck auf dem Scholben. Den Hochsitz hatten sie im vergangenen Herbst verwaist vorgefunden. Auch wenn sie seit ein paar Wochen nicht mehr ganz sicher waren, die alleinigen Nutzer zu sein, betrachteten sie ihn als ihr Geheimnis. Zu gern hockten sie im Halbdunkel auf den kargen Bretterbänken und tauschten sich flüsternd über ihre neuesten Pläne aus. Ihr Heimweg vom Scholben zurück in die Stadt führte sie wie zufällig durch die Sebastian-Kneipp-Promenade, die parallel zum Kurpark lief. Natürlich hätten sie auch durch den Park gehen können, so wie sie gekommen waren. Doch es war noch Zeit, und ohne dass es eines Wortes bedurft hätte, war jedem klar, dass sie alle jetzt Lust auf Abwechslung hatten.
Wie so oft stand Gregor Lautenbach an der Einfahrt zum Hinterhof seines Hauses, wo er ein alt eingesessenes Antiquitätengeschäft betrieb, und wartete auf Kundschaft. Der Laden hatte schon bessere Zeiten gesehen, doch Lautenbach stand nicht etwa als Versager da, sondern profitierte immer noch vom exzellenten Ruf seiner Vorfahren. Er verstand es, die Deutungshoheit über sein Tun und seinen Charakter zu behalten und verschaffte sich als »Angehöriger einer angesehenen Händler-Dynastie« Respekt. Dass er vom Lions-Club Südharz, dem er gern angehört hätte, ebenso verachtet wurde wie von den Rotariern, münzte er in der Öffentlichkeit zu Stärke um, indem er den »Club de la Licorne«, den Einhornclub, gründete. »Billig, immer nur diese englischen Bezeichnungen«, pflegte er lästernd die Nase über die beiden etablierten Clubs zu rümpfen, wenn man ihn fragte, »im Club de la Licorne legen wir etwas mehr Wert auf Bildung.«
Sein Lieblingsprojekt war der Aufbau einer Partnerschaft mit dem südfranzösischen Höhlenort Montignac, der die weltberühmte Grotte von Lascaux beherbergt. Dazu blähte Lautenbach die Bedeutung der Scharzfelder Einhornhöhle gegenüber seinen französischen Ansprechpartnern wortreich auf. Noch allerdings ließen unterschriftsreife Partnerschaftsverträge auf sich warten. Daran änderten weder Lautenbachs Hinweise auf die 270 Millionen Jahre Höhlenentstehungsgeschichte etwas noch seine Versicherung, dass der Gesamthohlraum die Abmaße der bekannten Höhle um ein Vielfaches übersteige. Den Einheimischen galt sie schlicht als größte begehbare Höhle des Westharzes mit etwas alberner Einhorn-Folklore. Diese Skepsis musste sich zu Lautenbachs Leidwesen irgendwie auf die Franzosen übertragen haben.
Während der Antiquitätenhändler nach Kundschaft Ausschau hielt, konnte er nicht umhin, einen Blick auf das Treiben in der Sebastian-Kneipp-Promenade zu werfen. Und wen sah er da? Schon wieder schlenderten diese nutzlosen Jungs, Bastarde aus zweifelhaften Elternhäusern, durch die Gegend. Die führten doch wieder was im Schilde! Er hatte die vier im Verdacht, das Herzchen auf seine Bürotür gesprüht zu haben, das ihn tagelang der Lächerlichkeit preisgegeben hatte – bis es Hebestreit, dem Schriftführer des Einhornclubs, endlich gelungen war, es zu entfernen. Der Gedanke erzürnte ihn immer noch derart, dass er sich nicht zurückhalten konnte. »Ey, ihr da! Spiegelei! Habt ihr keine Hausaufgaben auf? Setzt euch mal auf den Hosenboden, statt hier rumzulungern. Haut ab hier, ihr Promenadenmischung!«
Promenadenmischung? »Geiler Name!«, strahlte Bingo, als sie wenig später in die Ahnstraße abgebogen waren. Vor Gregor Lautenbachs Augen hatten sie natürlich nichts dergleichen getan. Gemäß ihrem Grundsatz PCA – provozieren, cool bleiben, ablachen – hatten sie das Obereinhorn, wie Lautenbach von Nicht-Bewunderern genannt wurde, keines Blickes gewürdigt. »Und a propos Name«, fügte Bingo hinzu, »ich hatte gestern Abend eine Idee für dich. Igor Igel. Willst du so heißen?«
»Igel kannste vergessen«, brummte Eagle-Eye, doch bevor er fortfahren konnte, rief Marvin: »Igor ist cool, Alter. Gebongt. Ge-bingo-bongt!« Hüpfend legte er die Hände trichterförmig an den Mund und verkündete durch dieses Megaphon: »Hier kommt Igor, Igor der... der Große...«
»Igor der Schreckliche!«, lachte Leon.
»Nee«, warf Bingo ein, »das war Iwan. Hat meine Mama im Fernsehen geguckt.«
»Er ist auch nicht so mega-schrecklich«, gab Marvin zu bedenken.
»Aber groß ist er auch nicht«, fand Leon, und redete schnell weiter, als er Eagle-Eyes drohenden Blick auffing, »aber ein ‚von‘ ist er: Igor von der Promenadenmischung!«
Beschwingt kam Eagle-Eye nach Hause, doch hier erwartete ihn eine bedrückte Stimmung. »... Arsch offen«, hörte er seine Mutter noch sagen, und es klang nicht angriffslustig, sondern eher resigniert.
»Na, na, Mädchen, Fäkalausdrücke bringen uns auch nicht weiter«, tadelte Hilde ihre Enkelin.
»Also bitte, Oma, was heißt denn ‚deutsche Mädels tun das nicht‘? Ich dachte, so ’ne Ansage wäre seit Jahrzehnten out?!«
Eagle-Eye, der zwecks Essensaufnahme die Küche angesteuert hatte, sah neugierig von seiner Mutter zur Urgroßmutter. »Is’ was mit Nora?«, fragte er Larissa.
»Ja, Nora-Theres hat Ärger mit Mitschülern«, antwortete sie. Doch plötzlich sah sie ihn aufmerksam an. »Aber wie kommst du denn darauf?«
»Na, ‚deutsche Mädels‘ und so’n Kram, das sagen doch die Nazis. Und da sind ja welche, bei Nora in der Parallelklasse.«
Hilde warf Larissa einen Blick zu, der »Schweigen!« bedeutete. Dann wandte sie sich an den Jungen: »Worauf hast du denn Appetit? Spiegelei oder Rührei mit Schinken?«
»Spiegelei? Spiegelei! Ich kann’s nicht mehr hören! Ich will Wodka! Und übrigens heiße ich jetzt Igor, damit ihr’s wisst!«
Nachdem er Türen knallend die Küche zum Flur hin verlassen hatte, nur um nach zehn Minuten angelegentlich und mit Unschuldsmiene vom Wohnzimmer her wieder aufzutauchen, setzte ihm Hilde das leckerste Bauernfrühstück der Welt vor. »Ein richtiges Männerfrühstück. Mit Salzgurke. Wie bei den Russen!« Und Larissa kraulte ihm den Nacken.
Eagle-Eye war besänftigt. Doch wenn sie glaubten, sie könnten ihn für dumm verkaufen, hatten sie sich getäuscht! Er stampfte die Treppe hoch, stellte im Bad laut johlend die Dusche an, schlich zurück in sein Zimmer und presste schnell sein Ohr an das Heizungsrohr, das ihr Gespräch im Wohnzimmer deutlich genug nach oben übertrug.
»Supertalent? Wieso braucht sie dafür Reizwäsche?«, fragte Hilde gerade.
»Na, sie ahmt diese Poptussis nach. Die vermarkten nicht nur ihren Gesang, sondern ihren Körper gleich mit.«
»Will Nora-Theres denn Popsängerin werden?«
»Ja klar, deswegen ist sie doch schon beim Stadtfest aufgetreten.«
»Aber das war ein Reinfall! Die trifft doch jeden dritten Ton nicht richtig.«
»Na, deshalb doch die Wäsche, Oma!«
Wäsche und so was ließ Eagle-Eye natürlich kalt. Mädchenkram. Aber Nora-Theres war sonst gar nicht verkehrt. Er kannte sie, weil sie sich oft genug bei Larissa ausheulte. Zwar hatte sie reiche Eltern, immer das neueste Smartphone und alle Markenklamotten, die sie sich wünschte. Doch reden konnte sie zuhause mit niemandem, und Zweifel waren dort genau wie andere Störmomente nicht gern gesehen. Während Larissa für Noras Eltern einfach »die Putze« war, der man keine große Beachtung schenkte, war sie für Nora-Theres eine wichtige Ratgeberin. Larissa hatte nichts gegen diese Rolle einzuwenden – vielleicht, weil es in den Gesprächen mit der 15-Jährigen um Träume ging und um Ereignisse jenseits des Kleinstadthorizonts. Denn Larissa hatte ihren Plan vom Psychologiestudium keineswegs aufgegeben. Vor vier Semestern hatte sie ein Fernstudium begonnen, von dem sie ihre Umwelt allerdings erst nach den ersten größeren Prüfungen in Kenntnis setzen würde. Nur Alo und Nora wussten Bescheid. Alle anderen ließ sie in dem Glauben, als, wie ihre Mutter es formulierte, »erste Reinemachefrau mit großem Latinum« zufrieden zu sein.
Hilde kannte Noras Großmutter vom Kurhaus-Stammtisch. Dort tauschten sich die Älteren über Ereignisse von früher aus, zeigten sich alte Schwarzweißfotos und tratschten über dies und jenes. Hier hatte Hilde von den Sprüchen mit den »deutschen Mädels« gehört. Sie empörte sich jetzt ausgiebig darüber, dass junge Leute so redeten. Sollte man nicht mal deren Eltern ins Gebet nehmen? Wer das eigentlich genau sei? Das wusste auch Larissa nicht. Im Unterschied zu Eagle-Eye hatten die beiden nicht den Hauch einer Idee davon, was sich in der Spielbank, im Piercingstudio und in der »Schnitzelmeile« abspielte. Und in der Schule. Eagle-Eye freute sich darauf, seinen Jungs eine neue spannende Geschichte auftischen zu können.
Auch wenn sie schon viel davon gehört hatten, wussten die vier Mitglieder der Promenadenmischung nicht so ganz genau, was Nazis waren.
»Frau Heitermann sagt, das sind Leute mit engem Horizont«, zitierte Eagle-Eye seine Lehrerin.
»Hm, und was’n das?«, erkundigte sich Bingo. »Sind die kurzsichtig, oder was?«
»Mann, Leute«, mischte sich Marvin ein, »die hassen Türken, das weiß doch jedes Baby. Sagen immer, die nehmen ihnen die Arbeit weg.«
»Wieso, wollten die auch ’ne Döneria aufmachen?«, wurde Leon jetzt neugierig. »Hätten sie doch längst machen können, gab doch bis vor Kurzem keine!«
»Ich glaube«, sinnierte Eagle Eye, »Frau Heitermann meint, das sind Arschlöcher. Aber das will sie nicht so sagen.«
»Ist Lauterbach denn auch ’n Nazi?«, hakte Leon nach.
»Weiß ich doch nicht!«, gab Eagle-Eye genervt zurück. »Ich weiß nur, dass es hier welche gibt und dass die sich immer in der Spielbank oder in der Schnitzelmeile treffen.«
»Hat das auch Frau Heitermann gesagt?«, wollte Marvin wissen.