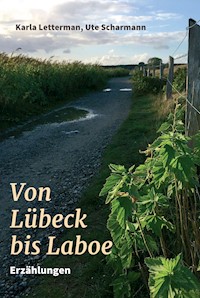9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Häkelclub ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Häkelclub hält zusammen – komme was Wolle! Im beschaulichen Ort Bökersbrück in der Lübecker Bucht scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Bis Maike auf der Weide bei einem Zusammenstoß mit einem Stier ums Leben kommt. Ihr Mann Henri ist am Boden zerstört. Was soll er nur mit Maikes Handarbeitsladen ›Nähschiff & Nadelflotte‹ anfangen? Edda, die einzige Angestellte, möchte einen Verkauf unbedingt verhindern. Ihr gelingt es, Henri für Wolle & Co. zu begeistern und spannt ihn in die Treffen des Häkelclubs ein. ›Häkel-Henri‹ wird er fortan von seinen Stammtischkumpels genannt. Doch das ist ihm egal, denn bald bemerkt er, dass die Damen des Clubs finstere Machenschaften aufdecken möchten, denen wohl auch Maike auf der Spur war. Wurde ihr das zum Verhängnis? Der Häkelclub ermittelt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Karla Letterman
Mörderische Masche
Ein Fall für Henri und den Häkelclub
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Keno
Prolog
Henri sagte sich später oft, dass er es hätte verhindern können.
»Ich gehe jetzt das Polnische Warmblut ansehen, egal ob es dir Heißblut nun passt oder nicht!«
Er stand im Flur und war stinksauer. Maike wollte ein Pferd begutachten – an einem Sonntag, ihrem einzigen gemeinsamen Tag, und heute noch dazu dem Jahrestag seines Antrags! Er konnte sich noch gut an ihre Rührung erinnern, damals vor fünf Jahren, als er vor ihr auf die Knie fiel und die samtbezogene Ringschachtel öffnete.
Und nun hatte sie das Datum einfach vergessen.
Seine Stimmung hatte sich auf sie übertragen. Sie kickte die Pantoffeln weg, bevor sie ihre Stiefeletten mit dem groben Profil überstreifte, und ließ die Hausschuhe mitten im Flur liegen. Normalerweise nahm sie sich die Zeit aufzuräumen, weil sie wusste, wie sehr er Unordnung hasste. Doch jetzt wollte sie offenbar nichts wie weg.
Sein Verdruss füllte ihn ganz und gar aus; er fand keine Worte. Weder erwähnte er den Jahrestag, noch hakte er nach, was genau sie vorhatte. »Schon wieder ein neues Pferd beim Rinderbaron begutachten?«, war die Frage, die ihm auf der Zunge lag. Doch bevor er sie aussprechen konnte, war Maike schon aus der Tür.
Mit kraftvollen Schritten eilte sie über den Innenhof, zog ihr Rad aus dem Schuppen und schwang sich in einer fließenden Bewegung darauf.
Er sah ihr aus dem schmalen Flurfenster nach. Heute hob sie nicht die Hand zum Gruß, wie sie es sonst so oft tat. Zum Maike-Gruß, der immer ein klein wenig nachlässig wirkte, doch Henri war sicher, dass das eine antrainierte Attitüde war, da sie sich in Wahrheit auch für den kleinsten Weg am liebsten mit Küsschen und Tätscheln verabschiedete, und er liebte sie dafür. Grundsätzlich jedenfalls.
Als er ihre Hausschuhe mit den Füßen mehr unter die Flurbank trat als schob, spürte er weder Zärtlichkeit noch Verständnis. Er war enttäuscht und unwirsch.
Na gut. Dann würde sie eben stundenlang weg sein. Dann würden sie eben kein Picknick am See machen, nicht zusammen den Crémant probieren, den er, von Vorfreude und heimlichem Stolz erfüllt, extra beim Weinhändler besorgt hatte. Vielleicht würde er die Flasche allein öffnen, nur für sich? Grimmige Schadenfreude erfüllte ihn bei dem Gedanken.
Er trug den dicken Bildband über antike Standuhren, den die Buchhändlerin ihm besorgt hatte, auf die Veranda, ließ sich in den Korbstuhl fallen und blätterte gedankenverloren darin herum. Die boshaft flüsternde Stimme in seinem Kopf gab keine Ruhe, also ging er in die Küche und öffnete den Crémant.
Als das Mobiltelefon klingelte, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder, seine Finger waren auf einen Schlag eiskalt. Er tastete nach dem Gerät, nervös, fahrig, stieß die Sektflasche um.
»Deine Frau hatte einen Unfall.« Es war die Mutter des Rinderbarons. Ihre Stimme klang hohl. »Ein … ein Bulle hat sie … Besser, du kommst her.«
Henri verschwendete keinen Gedanken an Promille und Fahrtüchtigkeit. Er sprang in den Kangoo und trat das Gaspedal durch.
Den Suzuki Jimny, der ihm auf schnurgeradem Feldweg entgegenkam, hätte er beinah gestreift. Doch statt eines schlechten Gewissens braute sich Wut in ihm zusammen: Wer bitte ist in einem solchen Spielzeugauto unterwegs? Diese Farbe allein! Leuchtendes Türkis, wie lächerlich! Ein Möchtegern-SUV in Bonbonpapier. Zum Teufel mit diesen Sonntagsfahrern!
Nach der Kurve am Lindenhain sah er Blaulicht. Es kam von rechts, von einer der Weiden. Henri kannte die Feldwege und nahm direkten Kurs auf die große Koppel.
Maike lag da, reglos, mit seltsam verdrehten Beinen. Eine Rettungsassistentin, die neben ihr gekniet hatte, erhob sich. Henri nahm überdeutlich wahr, wie der andere Sanitäter zum Wagen ging und das Blaulicht ausschaltete.
Henri kauerte sich neben Maike, strich ihr über den Arm, über die Schürfwunden. Sie lag auf der Seite. Am Rücken war das Shirt modrig-feucht und klebte am Körper. Er wagte nicht, es hochzuschieben. Er berührte mit dem Handrücken zart ihre Wange. Sie war nicht kalt. War sie nicht sogar ziemlich warm? Da war doch Leben in ihr, merkten die das nicht? Warum schalteten die das Rettungslicht aus? Waren die noch zu retten?
Henri rief und schrie und brüllte.
Er spürte eine Hand auf seiner Schulter. Sanften Druck auf dem Arm. Hörte Stimmen in wattiger Ferne. Säuseln, Raunen, Murmeln. Es drehte sich. Irgendwas drehte sich. Irgendwas zerschellte.
Vor dem inneren Auge sah er die umgestoßene Sektflasche, sah den Crémant heimtückisch in die Ritzen zwischen den Verandadielen triefen.
Dielen. Streben, Stäbe. Augen glänzten. Böses Glänzen. Schillernder Ring. Der Bulle tänzelte aufgebracht im Fanggitter. Die Leute des Rinderbarons hatten ihn offenbar eingefangen.
Henri sah die breite dicke Stirn, ein Bollwerk, sah dunkle schlierige Augen auf sich gerichtet. Der Nasenring des Bullen glänzte silbern. Blank gewienert wie Sonntagsschmuck.
1 Holunderblütenmelancholie
Edda Langner stand mit zwei prall gefüllten Segeltuchtaschen vor dem hinteren Busausstieg, eingeklemmt in der Menge der Mitfahrenden. Ihre lederne Handtasche trug sie schräg über dem Oberkörper, um in jeder Hand eine der ausladenden Taschen halten zu können, die zwar nicht schwer, aber unhandlich waren. Sie bugsierte sie mühsam durch die Masse von Menschen, die unmittelbar vor Schul- und Arbeitsbeginn unterwegs waren. Manchmal wünschte sie sich, Jugendliche würden Älteren ihren Sitzplatz abtreten, so wie sie es selbst früher getan hatte, doch das passierte heutzutage nur alle Jubeljahre einmal. Ich sehe eben noch nicht so alt aus, versuchte sie sich zu trösten, doch wenn sie ehrlich war, wusste sie genau, dass ihre grauen Haare sie in den Augen von Kindern eher noch älter als 58 machten.
Der Busfahrer bremste so abrupt, dass mehrere Fahrgäste stolperten und unfreiwillig nach vorn, zurück oder zur Seite taumelten. Dabei verkeilte sich die Tasche, die Edda links trug, so unglücklich zwischen Rucksäcken, Armen und Schultern, dass sie sie von leichter Panik befallen im letzten Moment losließ.
Als sie auf dem Gehweg stand und sich beide Bustürhälften seufzend schlossen, sah sie aus dem Augenwinkel, wie ein halb garer, rothaariger Bursche aus dem Bus sich in ihre Richtung ironisch zum Dank verneigte. Er schwenkte dabei zwei, drei Holunderzweige wie eine Trophäe über seinem Kopf. Edda war bedient. Eine Stunde Arbeit im Eimer. Und der schöne, stabile Segeltuch-Shopper beim Teufel.
Sie hatte noch überlegt, ob sie nur eine oder doch besser beide Taschen mit Holunderblüten füllen sollte. In der Feldflur hinter ihrem Haus gedieh der Schwarze Holunder prächtig und säumte die Wege im Frühsommer mit seinen weißen, duftigen Blüten, die wie Schaumkronen auf dem grünen Blättermeer tanzten. Doch gestern hatte sie dann gar nicht mehr aufhören mögen, die Dolden abzuknipsen, so herrlich meditativ fand sie die Arbeit. Außerdem hatte sie im Stillen gehofft, dass die Chefin, der sie die Blüten versprochen hatte, damit genug Sirup produzieren würde, um ihr ein Fläschchen abzutreten. Dann hätte sie endlich wieder einen guten Grundstoff für ihren Lieblingscocktail Hugo. Doch so blieb wieder nur der Sirup aus dem Supermarkt, den sie viel zu süß fand. Unwirsch ruckte Edda ihre Handtasche zurecht, klemmte die Tragegriffe des verbliebenen Shoppers unter dem rechten Arm fest und trat in zügigem Schritt ihren Fußweg an.
Das süße Aroma der Holunderblüten stieg ihr in die Nase und weckte eine vage Erinnerung. Sosehr sie sich aber auch bemühte, sie bekam sie nicht richtig zu fassen. Der Treibsand verstrichener Jahre hatte davon nicht mehr als eine Ahnung zurückgelassen. Es musste ein schönes Erlebnis gewesen sein, Edda spürte, wie ein Hauch Sehnsucht sie streifte.
Sie schloss die massive Holztür auf und betrat den Handarbeitsladen ›Nähschiff & Nadelflotte‹ durch den Hintereingang. Im Flur ließ sie die Riesentasche mit den Dolden auf den Boden gleiten und schob sie sacht mit dem Fuß an die Wand. Sie streifte den Lederriemen über den Kopf, hängte die Handtasche an den Griff der Küchentür und fuhr sich mit beiden Händen durch die raspelkurzen Haare, ihr Markenzeichen. Mecki-Schnitt hatten ihre Freunde früher dazu gesagt, oder Igel. Dann kam jemand auf Stachelbeere, und diese Bezeichnung hatte ihr gefallen, sie klang so vorwitzig-weiblich.
Edda war früh dran. Umso besser, dann konnte sie Kaffee aufsetzen und in Ruhe ein Tässchen trinken, bevor die quirlige junge Chefin den Laden mit Tatkraft flutete.
Es war Montagmorgen. Wahrscheinlich würden sie Zeit haben, die neuen Angebote der Lieferanten zu studieren, bevor die ersten Kundinnen den Laden betraten. Edda freute sich darauf, in den Katalogen zu schmökern. Handarbeiten waren ihre Leidenschaft, schon seit der Schulzeit. Während ihre Freundinnen im Bett bei Taschenlampenschein aufgeregt ›Bravo‹-Heftchen durchgeblättert hatten, hatte sie selbst bis tief in die Nacht hinein Norwegermuster gestrickt. Sie tat das für ihr Leben gern, begleitete das Werden eines Kleidungsstücks mit dem stolzen Staunen der Urheberin und sah gespannt zu, wie selbst entworfene Rhomben, Sterne und Ranken heranwuchsen.
Wolle, Garn und Webwaren strahlten für Edda Geborgenheit aus, es waren die Rohstoffe einer Kreativität, die Beständiges schuf. Stricken war ihre liebste Handarbeit, doch sie brannte auch für Häkeln, Sticken und Nähen. Sie bekam nicht genug davon, aus Seide, Mohair, Baumwolle, Perlgarn, Filz und Kunstleder etwas Neues, etwas Einmaliges entstehen zu lassen.
Edda hatte auf dem Lederstuhl hinter dem Verkaufstresen Platz genommen. Die Ladentür war aufgesperrt. Falls eine Kundin oder ein Kunde einträte: Sie wäre bereit.
Ein wenig wunderte sie sich, dass Maike noch nicht da war. Zwar kam die Chefin hin und wieder ein bisschen später, aber sie versäumte es eigentlich nie, Edda darüber zu informieren. Nun ja, Montagmorgen. Maike wusste, dass nichts Dringliches anlag, wahrscheinlich dehnte sie das Frühstück ein wenig aus; Henri, ihr Mann, war in Kurzarbeit geschickt worden und hatte es vermutlich nicht eilig. Das Uhrengeschäft, in dem er als Feinwerkmechaniker arbeitete, durchlebte gerade eine Auftragsflaute. »Eine vorübergehende«, wie Maike ihren Mann zitierte. Mal sehen, dachte Edda.
Ihr Blick fiel auf den Holunderstängel, den sie aus dem Doldenmeer herausgefischt und in eine schmale Glasvase gestellt hatte. Seine Blüte war klein und von berührend filigraner Anmut. Spontan zog sie einen Bleistift aus dem mintfarbenen Stifteköcher, schnappte sich ein Blatt aus dem Papierstapel des Belegdruckers und begann mit einer Skizze.
In schnellen, sicheren Strichen hatte sie fünf Blätter um einen schlanken, geschwungenen Stiel angeordnet, dann begann sie eine schirmförmige Rispe zu zeichnen. Sie ließ einzelne Blüten aus der Dolde hervorschießen wie weiße Sternschnuppen. Voilà! Ein aufregend asymmetrisches Gebilde war entstanden.Sie konnte sich die Holunderblüte als pastellfarbenes Strickmuster auf mitternachtsblauem Grund vorstellen oder auch als Stickvorlage für eine Tischdecke. Sie würde mit Maike besprechen, ob sie darauf aufbauend vielleicht sogar einen Blütenmusterkatalog entwickeln sollte. Wie sie diese kreative Arbeit liebte!
Edda betrachtete die Skizze noch einmal mit Abstand – und plötzlich war sie da, die Erinnerung. Sie mochte zwölf oder dreizehn Jahre alt gewesen sein, als sie für den Biologieunterricht ein Herbarium anlegen sollten. Taglichtnelke, kriechender Günsel, Holunderblüte, Hahnenfuß, Spitz- und Breitwegerich, Bärenklau. Oft war sie gemeinsam mit einem Mitschüler und Freund aus Kindergartentagen losgezogen, um die Blumen und Kräuter zu sammeln. Rafael – oder hieß er Rainer? – riss stets voller Ungeduld die Pflanze mitsamt fleischiger Wurzel aus dem Boden und wunderte sich dann, wenn sie beim Pressen nicht richtig trocknete. Doch eines Tages …
Edda stockte. Ihr Blick war durch das Schaufenster auf zwei betagte Damen gefallen, die auf dem Gehweg vor dem Laden innegehalten hatten. Sie kauften hin und wieder Druckknöpfe oder Stopfgarn für zwei Euro zwanzig und taten dann so, als könnte das Geschäft ohne ihre Einkäufe nicht existieren. Jetzt fuchtelte die Ältere mit ihrer Gehhilfe vor der Fensterscheibe herum, und beide schüttelten, als sie Eddas Blick bemerkten, empört die dauerwellenumrahmten Häupter. Edda sprang auf, doch als sie aus der Ladentür trat, hatten sich die beiden abgewandt und watschelten, immer noch kopfschüttelnd, weiter.
Edda kontrollierte den Gehweg, sammelte drei Hamburgerverpackungen auf, die der Wind an die Wand vor dem Schaufenster gedrückt hatte, und ging ins Haus zurück. Vermutlich hatten die Alten geargwöhnt, der Müll stamme aus ihrem Laden.
Edda entsorgte das Einwickelpapier im Müllcontainer auf dem Hof und nahm wieder im Lederstuhl Platz. Die Zeichnung lag vor ihr auf dem Verkaufstisch. Feingliedrige Blätter, zarte Blüten, wie in ihrem Herbarium, wie es sein sollte. Rainer hingegen – nein, Raimund hieß er! – hatte sich wie ein Junge fürs Grobe gebärdet.
Sie erinnerte sich jetzt lebhaft an die eine besondere Szene. Als sie Raimunds frisch geschnittenen, feisten Holunderstängel sah, entwand sie ihm diesen lachend und ließ ihn so lange neue Stiele schneiden, bis er einen passend zierlichen vorweisen konnte. Da saßen sie dann inmitten der duftenden Dolden, stachen ihre Strohhalme in die Pappkrusten von Sunkist-Pyramiden und saugten, plötzlich verlegen, süßliche Limonade ein. Da ergriff Edda die Initiative: Indem sie vorgab, die geschnittenen Stängel zu sortieren, berührte sie wie beiläufig Raimunds Finger. Zuerst hatte er seine Hand erschrocken zurückgezogen, doch es dauerte nicht lange, bis er Gefallen an dem Spiel fand. Hatten sie sich nicht schließlich sogar einen hastigen Kuss auf die Wange gedrückt? Edda schloss die Augen, um die Bilder jenes Sommers heraufzubeschwören.
Die gläserne Pendeltür ächzte, jemand betrat energischen Schrittes den Laden. Edda schrak zusammen. Kaum war sie einmal ausnahmsweise nicht hundertprozentig präsent, rauschte natürlich die Chefin herein!
Doch es war nicht Maike, sondern Frau Padderatz, die Frührentnerin, die über dem Supermarkt wohnte und an manchen Tagen mit einem schier unerschöpflichen Redebedürfnis in den Laden kam. Sie betrachtete dann vorgeblich Wollneuheiten, während sie sich mit zunehmender Empörung über rauchende Kassiererinnen und Lageristen beschwerte, deren Ausdünstungen bis in ihr Wohnzimmer zogen – als ob Maike oder Edda daran etwas ändern könnten.
Edda holte Luft. Frau Padderatz’ Gesichtsausdruck nach zu urteilen, mussten die Angestellten des Supermarkts heute geradezu erbittert um die Wette paffen. Sie machte sich auf eine ausufernde Predigt über mangelnde Rücksichtnahme gefasst.
»Finden Sie es wirklich schicklich, den Laden heute zu öffnen?«
Der Tonfall stimmte, doch der Text irritierte Edda.
»Wie meinen Sie?«
»Na, besonders pietätvoll ist das ja wohl nicht.« Frau Padderatz brummte oder grunzte, es war auf jeden Fall ein verächtliches Geräusch.
»Ja, aber was …?«
Da klingelte das Ladentelefon. Edda war froh. Vielleicht entwickelte sich ein längeres Gespräch, und die Frührentnerin würde wieder von dannen ziehen.
Sie erkannte die Stimme zunächst nicht. »Wie bitte? Welcher Henri … was? Sind Sie das, Herr Ketelsen?«
Edda sah Frau Padderatz an und hob entschuldigend die Schultern. Da ihr Gegenüber die Geste jedoch nicht vollends richtig deutete, legte sie die Hand über das Mikrofon und murmelte beklommen: »Verzeihung – ob Sie mich wohl bitte allein lassen könnten?«
Nachdem die lästige Besucherin den Laden verlassen hatte, schloss Edda die Tür ab. Irgendwas war passiert.
Wie in Trance nahm sie den Telefonhörer wieder auf, lauschte und hörte sich schließlich selbst sagen: »Herr Ketelsen – einen Moment … das … das kann doch nicht sein.Das ist doch ganz unmöglich …« Dafür ist sie viel zu jung.
Nachdem Henri Ketelsen aufgelegt hatte, starrte Edda den Telefonhörer an, ohne die Nachricht zu begreifen. Diese Wörter ergaben doch keinen Sinn! Maike ist tot.
Edda räumte Wollknäule von links nach rechts und wieder zurück. Dabei leerte sie einen Becher Kaffee nach dem anderen. Inzwischen spürte sie ihr Herz bis zum Hals schlagen, gleichzeitig fröstelte sie. Wirre Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Was mache ich jetzt mit den Holunderblüten? Welcher Jahrgang ist Maike noch gleich?
Sie warf einen Blick auf die Wanduhr, vergaß die Uhrzeit jedoch sofort wieder. Den Laden konnte sie heute nicht mehr öffnen, Frau Padderatz hatte recht gehabt.
Als sie ›Nähschiff & Nadelflotte‹ durch den Hintereingang verließ, vergaß sie abzuschließen. An der Bushaltestelle fragte sie sich, warum ein junger rothaariger Mann sie so schuldbewusst musterte. Sie hatte den schon mal gesehen, doch wo?
Als sie auf die Rückbank gesunken war, weit entfernt von den anderen Fahrgästen, und die ausgedehnte ostholsteinische Feld- und Wiesenlandschaft an ihr vorüberglitt, kam ihr eine Frage in den Sinn, die sie bis ins Mark traf: Was würde jetzt aus ihr werden?
2Henris Vorsatz
Henri konnte Dosen-Ravioli und Tiefkühl-Croque nicht mehr sehen. Seit acht Wochen waren sie seine Hauptnahrungsmittel. Doch ab sofort würde er wieder richtig kochen!
Er würde auch wieder auf Menschen zugehen. Mit Schaudern erinnerte er sich an sein Telefonat mit Edda Langner am Tag nach dem Unfall. Er hatte nur gestammelt, war kaum in der Lage gewesen, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Die folgenden Gespräche waren ihm etwas besser gelungen, aber stets hatte er sich hinter dem Telefon verschanzt. Doch so konnte es nicht weitergehen, er konnte sich nicht dauerhaft verkriechen. Henri seufzte.
Als er den Gurkenhobel suchte, wurde ihm klar, wie lange er kein Gemüse mehr geschnippelt hatte. Eigentlich hatten sie das Einkaufen und Kochen gerecht unter sich aufteilen wollen, doch mit der Zeit war es darauf hinausgelaufen, dass Maike, die geübter und einfallsreicher war, kochte, während Henri die Lebensmittel besorgte.
Wenn möglich, kaufte er direkt bei regionalen Erzeugern ein. Als Junge vom Bauernhof hatte er den Unterschied zwischen frischer Ware und Supermarktprodukten sehr genau kennengelernt, und auch wenn er jetzt in einem Reihenhaus ›in der Stadt‹ lebte, wie seine Eltern sich ausdrückten, legte er Wert auf unverarbeitete Lebensmittel. Dass er sich seit Maikes Tod fast ausschließlich von Konserven ernährt hatte, war gar kein gutes Zeichen.
Den Gurkenhobel fand er schließlich nicht in der Besteckschublade, sondern im Gewürzfach. So flink und energisch Maike auch gewesen war, ein System hatte sie nicht gehabt. Oder wenn, dann eines, das nur sie selbst durchschaute.
Henri reihte die geschälten Kartoffeln der Größe nach neben der weiß-blauen Fayenceschüssel auf, legte den Hobel mittig auf den Rand und begann, die Knollen über die metallene Schnittfläche zu ziehen. Im Radio, NDR1 Welle Nord, tönte Kylie Minogue ›Can’t get you out of my head‹. Die Wörter segelten am Rande seiner Wahrnehmung vorbei. Henri arbeitete im Takt. Can’t – Schnitt. Out – Schnitt. Head – Schnitt.
Er stellte sich vor, Maike würde ihn beobachten. Wenn er die Kartoffeln bis auf drei Zentimeter heruntergehobelt hatte, legte er die Enden beiseite, um nicht mit dem Daumen ins Messer zu geraten. Vorausschauend wie immer, Henri, würde sie jetzt sagen, ihm im Vorbeigehen einen Kuss auf den Nacken drücken und feststellen, dass sie ihm wieder einmal die Haare nachschneiden musste. Oder sie würde eine Bemerkung über seine großen, feingliedrigen Hände machen, die sie so schön gefunden hatte.
Bratkartoffeln zubereiten war von Anfang an ihre Sache gewesen, darauf hatte sie bestanden. Aber er hatte ihr oft genug zugesehen und wusste, dass er Geduld brauchte, wenn er rohe Kartoffeln verarbeitete. Also würde er noch damit warten, die Eier aufzuschlagen und unterzurühren, sonst brannten sie an. Kartoffeln, Eier, Gewürzgurken dazu – fertig wäre sein Bauernfrühstück. Schinken hatte er nicht, egal.
»Stay forever and ever, and ever, and ever«, lockte Kylie. Diese Worte drängten in Henris Bewusstsein vor, sie schmerzten. Er verstellte den Drehregler des Radios, bis er den eifrigen Singsang eines Sportreporters hörte. Eishockey. Das interessierte ihn nicht die Bohne, gut so. Da kam man nicht auf Gedanken, die man nicht ertragen konnte.
Das Öl war heiß, Henri schaufelte die erste Lage Kartoffelscheiben in die Pfanne. Er rüttelte behutsam am Griff und hoffte, dass die Kartoffeln elegant hin- und herglitten. Für den Fall, dass Maike zuschaute. Es gelang ganz gut. So – und jetzt … Er hatte im Gefühl, dass nun ein bestimmter Handgriff an der Reihe war. Schneiden, schaufeln, rütteln, rühren … schütteln! Natürlich, jetzt musste man von weit oben drei, vier Prisen Salz locker aus dem Handgelenk schütteln und darauf achten, dass sich das Salz gut verteilte.
Der Salzstreuer stand auf dem Tisch. Es waren nur noch drei Körnchen darin, er brauchte Nachschub. Henri schob vorsichtshalber die Pfanne von der heißen Herdplatte und zog den Apothekerschrank mit den Gewürzen auf. Der handliche gelbe Karton fiel ihm sofort ins Auge, Jodsalz. Leer. Mist! Eine leere Packung in den Schrank zurückstellen, das konnte auch nur Maike passieren. Wo war die neue Schachtel? Er schob die Döschen und Tütchen im Gewürzfach beiseite. Cayennepfeffer, Oregano, Kümmel, Kurkuma. Zimt, Thymian, wieder Kurkuma. Nelken, orientalisches Rosengewürz, Harissa. Und da … Henri kniff die Augen zusammen, das konnte doch nicht wahr sein: noch mal Kurkuma! Dafür kein Salz in Sicht.
Nun, salzen konnte man auch nachträglich. Henri stellte die Pfanne zurück auf die heiße Platte und regelte die Temperatur herunter. Dann schob er die ersten Kartoffeln an den Rand und schaufelte eine zweite Lage hinein.
Er widmete sich dem zweiten Gewürzfach. Diverse Currys vom Altenauer Kräuterpark, Maikes Wundermittel. Ob das Dal-Bhat-Gewürz zum Bauernfrühstück passte? Henri öffnete vorsichtig den Deckel der rechteckigen Dose und schnupperte. Lecker! Jedenfalls zu Linsen …
Er probierte das Brasil-Gewürz. Nein, das eignete sich wirklich nur für Fleisch- und Grillgerichte, wie es auf dem Etikett stand. Grillen, Rindersteak, Henri spürte einen Kloß im Magen. Der Rinderbaron züchtete Fleischrindrassen, Charolais, Angus und seit Neuestem auch Fleckvieh. Der Bulle, der Maike getötet hatte, war ein Angus. Guter Zuchtbulle, sehr gefragt. Henris Schultern verkrampften. Aus dem Verkehr ziehen sollte man den! Stattdessen zeugte er am laufenden Band weitere breitstirnige Ungeheuer.
Die Kartoffeln in der Pfanne meldeten sich mit einem Zischen. Henri fuhr zusammen. Die meisten sahen schon knusprig aus. Schnell drehte er sie mit dem Pfannenwender um. Sein Magen knurrte. Zeit, die Eier aufzuschlagen. Jetzt fehlte nur noch dieses verflixte Salz!
Vielleicht brauchte man es gar nicht. Henri beschloss, es durch würzige Schärfe zu ersetzen. Er streute eine gehäufte Teelöffelladung Cayennepfeffer in die Pfanne. Drei Prisen Harissa folgten und dann noch – wozu hatte man das Zeug schließlich? – ein Löffelchen Kurkuma. Er rührte beherzt um, während der Sportreporter mit großem Enthusiasmus den Puck höchstselbst ins Tor zu katapultieren schien.
Zeit, eine Kartoffel zu probieren! Henri sonderte eine Scheibe ab, schob sie an den Pfannenrand, piekte mit der Gabel hinein – gar, aber nicht zu weich, perfekt! Herzhaft biss er ein Stück ab. Sein Mund wurde augenblicklich trocken, der Bissen stach, vor Schreck schluckte er, dann schnappte er nach Luft.
Als sein Hustenanfall endlich abgeklungen war, wusste er nicht, wie sich der Herd ausgestellt hatte. Die Pfanne, die ganz unschuldig auf dem Herd stand, bot ihren Inhalt fotoreif dar. Vom Rand der Arbeitsplatte blitzte die Cayennepfeffer-Dose wie materialisierte Schadenfreude zu ihm herüber.
Er musste hier raus! Kurz entschlossen schlüpfte er in die schon leicht ausgelatschten Mokassins und nahm seinen sandfarbenen englischen Trenchcoat vom Haken. Maike hatte sich immer darüber amüsiert, wie sehr er an dem alten Stück hing! Sorgsam strich Henri über den Stoff, der nach wie vor tadellos war. Er mochte Wertarbeit und zog ein zeitlos elegantes Kleidungsstück jedem modischen Trend vor.
Er steckte den Haustürschlüssel in die Seitentasche, überquerte mit langem Schritt die Schwelle und zog die Tür zu. Erst nach hundert Metern und einer steifen Brise um die Nase fragte Henri sich, ob es klug war, ins Max Muckefuckzu gehen. Es war Donnerstagabend: Heute tagte der Stammtisch.
»Stell dich dem Leben, Junge!« Deutlich hörte er die Worte der Mutter in seinem Ohr. Sie hatte für seine Liebe zur Literatur, die sie für Besessenheit hielt, kein Verständnis gehabt. Auch wenn er ihr immer versichert hatte, er werde einen praktischen Beruf ergreifen, was er als Feinwerkmechaniker schließlich auch getan hatte, hatte sie ihre Zweifel gehabt. »Du musst raus aus deinem Schneckenhaus!« Er hatte abgewunken, weil er darin kein Problem sah. Er zog sich eben gern mal zurück.
Aber im Alter von 35 Jahren, an einem Donnerstag im Juli, fasste sich Heinrich Ketelsen junior auf dem Weg in die Kneipe ein Herz. Ich nehme es wieder mit dem Leben auf.
Nur einen Atemzug später fragte er sich, ob das gelingen konnte. Es gab so viele Kreaturen mit breiter Stirn. Er hatte ihnen zwar zwei geschickte Hände, Logik und Mutterwitz entgegenzusetzen, doch unter der Trauer funktionierten sein Kopf und sein Herz nur bedingt.
Max Johannsen stand hinter dem Tresen des Max Muckefuckund produzierte wie am Fließband Bier mit Blume. Er nickte Henri kurz zu. War da etwas Linkisches in seinem Blick? Doch Max zerstreute Henris Bedenken, als er ihm zusätzlich in altvertrauter Weise zuzwinkerte. »Zum Stammtisch, Bro?«
Das »Bro« war neu, wahrscheinlich ein Zugeständnis an die hippen Hamburger Gäste, die neuerdings die Kneipe fluteten. Sie nahmen eine Fahrt von 80 Kilometern und mehr in Kauf, um dem Tipp in einem Szenemagazin zu folgen: Max Muckefuck, eine herrlich abgefuckte Location am Rande der Zivilisation mit sprichwörtlich schlechtem Kaffee. So hatte es die unerschrockene, kneipenerfahrene Reporterin beschrieben. Die Großstädter, spitz auf abgefahrene Erlebnisse, folgten der Empfehlung. Bald hatten sie raus, dass man im Max Muckefuckzwar den Kaffee am besten in die Blumentöpfe kippte, dafür aber ein bezahlbares, ehrliches Herrengedeck bekam, von dem man in Hamburg nur noch träumen konnte. Max hatte außerdem, angeregt durch die polnischen Pflegekräfte im Ort, das Wodkagedeck auf die Karte gehoben: 4 cl Wódka Mazowiecka, zwei sauer eingelegte Pilze und ein Rauchwurstende. Da er den polnischen Schnaps im Dutzend billiger bezog, hatte er einen Deal mit den Mitarbeitern der Bökersbrücker Polizeistation abgeschlossen. Diese kontrollierten die Fahrer mit ›HH‹-Kennzeichen erbarmungslos, waren dafür aber angesichts ostholsteinischer Autos von plötzlicher Blindheit befallen. Im Gegenzug schloss Max an jedem zweiten Freitag im Monat die Falttür zu seinem Veranstaltungsraum diskret hinter einer Gruppe durstiger Uniformträger.
Henri hielt auf den hinteren Kneipenraum zu, in dem der Stammtisch stattfand. Seine Schritte wurden langsamer. Er fuhr sich mit den Fingern über den Kopf. Jetzt, da Maike ihm nicht mehr die Haare schnitt, musste er sich dringend einen Friseur suchen! Wahrscheinlich sah er mittlerweile aus wie ein verlotterter Säufer. Wann hatte er das letzte Mal bewusst in den Spiegel gesehen?
Wie auf Knopfdruck begann er das Auf und Ab des trunkenen Geschwätzes wahrzunehmen. Der Sportreporter meldete sich im Hinterkopf: Ran an den Feind. Volle Fahrt voraus. Gib's ihm, Bro! Bro, Brother, Bruder. Nun gut, schließlich war er einer von ihnen.
Henri trat einen Schritt vor. Er spürte die Ratlosigkeit der anderen wie eine Trennwand zwischen ihnen. Wie spricht man bloß einen Kumpel an, der gerade viel zu jung Witwer geworden ist?, mochten sie sich fragen.
Andy Blumenroth mit den überlangen Beinen rutschte auf dem dünnen Polster des Kiefernstuhls ein Stückchen nach rechts, dann gleich wieder nach links und schließlich ganz nach vorn. Der spitze Winkel in seinen Knien sah ungesund aus. »Henri! Na so was …«
Kris Grundmann gickelte verlegen. »Heinrich junior, alte Socke«, wofür er gleich den tadelnden Blick seines Gegenübers erntete.
Engelbert Bruns, wenngleich näher an Heinrich seniors Alter, wusste, dass der Junior seinen Vornamen hasste, und er hatte Verständnis dafür. Er nannte ihn niemals Heinrich. »Henri, setz dich zu uns.« Engelbert deutete auf den freien Stuhl zu seiner Linken.
Henri verharrte für einen Moment. Früher hatte er sich am Stammtisch wie zu Hause gefühlt. Aber früher war, wenn auch nicht lange her, doch so weit weg. Früher, das war vor Maikes Tod gewesen. Früher, als er noch wusste, wohin er gehen konnte und wo er hingehörte.
Natürlich war ihm klar, dass Andy, Kris und besonders Jochen Möllerhahn, der Rinderbaron, der heute in der Runde fehlte, schon immer hinter seinem Rücken über ihn scherzten. Alle außer ihm arbeiteten in der Landwirtschaft und fühlten sich ihm überlegen, was Kraft, Härte und Robustheit betraf. Für sie war er Henri, unser Sensibelchen. Doch im Großen und Ganzen waren die Jungs in Ordnung; wenn er Hilfe brauchte, konnte er mit ihnen rechnen, genau wie er sie umgekehrt unterstützte, wenn ein Motor zu reparieren war. Fast jedem half er. Jochen Möllerhahn war davon ausgenommen.
Früher lag in verhangener Ferne. Die Jungs hatten keine Ahnung, wie sie ihm jetzt helfen sollten. Er würde sich an Wodka-Gedeck und Bratkartoffeln entlang hangeln müssen, um ihr stilles Einverständnis wiederherzustellen. Zum Glück war Jochen nicht da. Henri atmete geräuschvoll ein.
Er ließ sich auf den Stuhl neben Engelbert fallen. Sein Magen machte sich erneut bemerkbar und grollte unüberhörbar.
»Ein Steak, mein Junge?« Engelbert Bruns klopfte ihm auf die Schulter.
Steak war das falsche Stichwort, es klang nach Fleischrindbullen. Henri begann zu keuchen. Kris, der es gut meinte, rief der Kellnerin doppeltes Herrengedeck für Henri zu. Die anderen schlossen sich der Bestellung an.
Als die Getränke aufgetragen wurden, begann sich die Stimmung zu entkrampfen. Andy prostete Henri zu. »Sag mal, was machst du jetzt eigentlich mit Maikes Geschäft?«
»Ich … ach, weißt du …« Henri nahm einen großen Schluck Bier. »… das … das entscheide ich morgen.«
Kris, der für sein glucksendes Lachen bekannt war, gickelte einmal mehr. »Behalt’s doch!«
»Genau, werde Geschäftsmann!«, pflichtete Engelbert ihm grinsend bei.
»Wollladenbesitzer, das ist mal was ganz anderes«, rief Andy und klopfte auf seine mageren, spitz gewinkelten Oberschenkel. Dann wurde er kurz ernst. »Du musst nur auf diese Häkel- und Strickclub-Frauen aufpassen. Die haben nicht nur spitze Nadeln, sondern auch spitze Zungen!«
Kris prustete los. »Strickclub, wow! Da eröffnen sich ganz neue Welten. Bald strickst du deine Westen selbst!«
»Pullunder«, murmelte Henri.
»Hä? Pullunder? Mensch, das klingt schon wie’n Fachausdruck!« Kris fand mit jedem weiteren Schluck Alkohol größeren Gefallen an seinem eigenen Vorschlag. »Hast dich schon heimlich eingearbeitet, was?«
Engelbert lächelte väterlich. »Das will alles gut überlegt sein.«
Kris ließ sich nicht irritieren. »Henri, der Stofflieferant von Bökersbrück!« Er johlte.
Henris Schädel dröhnte. Warum war es so kompliziert, sich dem Leben zu stellen? Warum hielt es so viele Tücken bereit? Warum ließ es Leute Fragen stellen, die einem selbst nicht in den Sinn kamen?
»Willkommen zurück. Lange nicht gesehen, Henri.« Der da mit volltönender Stimme im Plauderton sprach, besaß sie, die breite Stirn. Jochen Möllerhahn lehnte lässig am Rahmen der Falttür und sah auf die Runde herab. Henri blickte zu ihm hoch und musste feststellen, dass ihm das nicht bekam. Sein Blickfeld verschwamm. Etwas glitzerte. Er hielt es nicht aus, er musste weg.
»Was ist mit dir los?«, fragte Andy, der Henri zum Pissoir gefolgt war.
Henri stützte sich an der Wand ab, taumelte trotzdem. »Dieser Ring … seit wann … Wieso hat der einen Nasenring?«
»Was für einen Nasenring?« Andy krauste die Stirn. »Bro, wovon sprichst du?«
Bro, das war zu viel. Henris Körper sackte zusammen. Ungewollter Wodka, geharnischtes Lächeln und heimtückisches Glitzern überkamen ihn. Er würde einen neuen Versuch machen, sich dem Leben zu stellen. Aber erst, wenn diese silbern schimmernden Ringe nicht mehr überall auftauchten.
3Maikes Laden
Henri war spät in Gang gekommen. Wieder einmal war es eher Mittag als Morgen. Wieder einmal wollte sich keine Tatkraft einstellen. Doch diesmal musste er sich aufraffen.
Nach Maikes Tod hatten sie ›Nähschiff & Nadelflotte‹ sieben Wochen lang nur mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten betrieben, erst seit diesem Montag hielt Edda Langner den Laden wieder regulär geöffnet. Was für ein Glück, dass die patente Frau in der Lage war, den Laden selbstständig weiterzuführen! Auch die Entscheidung, ab wann sie wieder regulär öffnen sollten, hatte sie ihm abgenommen. Doch er konnte sie unmöglich die ganze Woche über allein lassen. Sie hatten vereinbart, dass er vorbeischauen würde, und daran würde er sich halten, auch wenn er sich lieber weiterhin verkrochen hätte.
Seit Torben Wucherpfennig ihn in Kurzarbeit geschickt hatte und ihn lediglich zweimal pro Woche im Uhrmacherladen erwartete, kam Henri nur noch zu diesen Gelegenheiten – dienstags und mittwochs – zeitig auf die Beine. An den anderen Tagen brühte er einen Pfefferminztee auf, schob das Plissee am Schlafzimmerfenster halb hoch, sodass er genug sehen konnte, ohne dabei geblendet zu werden, und krabbelte zurück unter die heimelige Decke.
Manchmal verweilte sein Blick auf dem Hochzeitsfoto, das auf Maikes Nachttisch stand. Immer wieder wunderte er sich, dass sie trotz ihrer hochhackigen Pumps so klein neben ihm wirkte, dabei maß sie doch 1,74 Meter. Damals hatte er seinen Bleistiftbart schick gefunden; Maike hatte ihm den noch vor der Hochzeit ausreden wollen, doch es hatte weitere zwei, drei Jahre gebraucht, bis er sich auch mit blankem Gesicht wohlfühlte. Wie gepflegt er ausgesehen hatte! Er musste unbedingt seine strähnig, beinah zottelig fallenden Haare in Form bringen lassen!
Wenn Henri mit seinem Tee wieder im Bett lag, fragte er sich: lesen oder lösen?
Hätte man ihm vor einem halben Jahr prophezeit, er werde sich einmal ernsthaft mit Sudoku befassen, hätte er entschieden den Kopf geschüttelt. Inzwischen hatte er nicht nur den Stapel Rätselhefte von Maikes Nachttisch abgearbeitet, sondern längst Nachschub besorgt. Er redete gern ein wenig mit den Zahlen. »Na, naseweise Neun, denkst du, dass du vor der schüchternen Zwei drankommst?« Oder: »Auch wenn Maike dich jetzt nicht sehen kann, heißt das nicht, dass deine hinterhältige Taktik unbemerkt bleibt.«
Maike und Zahlen: eine Liaison, die er nie recht durchschaut hatte. Ziffern schienen zu ihr zu sprechen, nicht nur aus Sudoku-Aufgaben. Wenn es galt, Umsätze und Besucheraufkommen zu analysieren, oder wenn aus langen Kolonnen Rückschlüsse gezogen werden mussten – immer dann war Maike Feuer und Flamme. Bevor Henri sie besser kannte, war er von einem Zusammenhang zwischen mathematischer Begabung und systematischer Arbeitsweise ausgegangen. Doch Maike widerlegte diese Vermutung gnadenlos. Zwar überschlug sie abzuführende Mehrwertsteuer und Gewinn im null Komma nichts, stellte dann aber leere Salzpackungen zurück ins Regal. Außerdem hinterließ sie Papierfetzen mit wichtigen Notizen an den unmöglichsten Orten. Einmal hatte er sie zufällig an einen Arzttermin erinnert, weil er unter dem Zahnbecher ein Zettelchen hervorlugen sah. »Gyn, 9 h«, hatte er ihr vorgelesen, und sie hatte es gerade noch rechtzeitig in die Praxis geschafft.
Bei Henri verhielt es sich umgekehrt: Er war planvoll und gewissenhaft, doch Kopfrechnen hasste er. Immerhin begann er jetzt, sich mit den Ziffern im Sudoku-Quadrat zu versöhnen.
Im Nachhinein spürte er ein nicht unerhebliches Schuldbewusstsein, weil er Maike so oft gerügt hatte. »Dein Rätselfimmel hält dich vom Lesen ab. So ist schon mancher verblödet«, hatte er bisweilen behauptet und demonstrativ das neueste Werk von Richard David Precht oder auch die ›ZEIT‹ auf seine eigene Bettdecke geworfen, in der Hoffnung, Maike würde, während er sich wusch, einen Blick riskieren und dann vom guten Text nicht mehr loskommen. Nichts dergleichen war je passiert. Wenn sie ihre Zahlenrätsel satthatte, hatte sie zu ihren eigenen Wälzern gegriffen: ›Bewegungsapparat Pferd‹ etwa oder ›Handbuch Reitpraxis‹.
Wann immer er jetzt nicht einschlafen konnte, nahm Henri eines der Bücher zur Hand. Sie dufteten beide nach ihr: das Handbuch nach ihrem Mango-Haarshampoo, und das andere kurioserweise nach ihrer Lavendel-Handcreme. Mit einem Maike-Buch auf dem Kissen, dicht neben seinem Gesicht, hatte er eine Alternative zum Schäfchenzählen ersonnen. Dabei musste er sämtliche Pferde einer riesigen Herde nacheinander beim Namen rufen. Zwischen Improvisationen wie Maika, Maiko, Maraika und Sulaika gelang es ihm schließlich, wegzudösen.
Wenn sich Henri morgens fürs Lesen entschied, staunte er über den Sitz von Erbsenbein und Sesambein, über Krongelenk und weitere anatomische Pferdespezialitäten – aber nur so lange, bis er den Tee ausgeschlürft hatte. Dann schwang er sich aus dem Bett.
An diesem Freitag hatte es mit dem Schwung nicht klappen wollen. So war es bereits kurz vor elf, als Henri ausgehfertig das Haus verließ und sich Richtung ›Nähschiff & Nadelflotte‹ aufmachte. Beinah wunderte er sich ein wenig über sich selbst. Warum tat er sich so schwer mit diesem Weg? An Edda Langner lag es nicht, auch wenn er sie nur flüchtig kannte und bezüglich ihrer Anrede etwas verunsichert war. Ihr weithin bekannter Spitzname, das Frollein, war sehr präsent, zugleich aber auch wahnsinnig irritierend. Prompt verhaspelte sich Henri gleich bei der Begrüßung.
»Moin, Fräulein, äh Frau …«
Den ersten Satz hatte er schon mal vermasselt. Betreten schwieg er. Hinter ihm schwang die gläserne Pendeltür ins Schloss und klang wie eine Ohrfeige. Zum Glück war keine Kundschaft im Laden.
Die eher kleine, untersetzte Angestellte trat beherzt auf Henri zu. Ihre streichholzkurzen Haare, deren Farbe zwischen aschblond und mausgrau changierte, hätten sie im Einklang mit dem ungeschminkten Gesicht ausdruckslos erscheinen lassen – wäre da nicht das Kleid gewesen. Henri fiel Maikes Bemerkung über eine Berliner Design-Ikone ein, deren Modeschöpfungen Edda Langner liebte. An mehr erinnerte er sich nicht; aber dass ein kornblumenblaues, hochgeschlossenes Strickkleid aus gegenläufig gestreiften Rauten mit schrägem Schlitz überm Knie etwas Außergewöhnliches war, sah sogar er auf den ersten Blick.
»Also guten Tag, äh …, Frau Langner.«
Zu Henris Erleichterung sah sie ihn freundlich an. »Frollein bitte.«
»Fräulein, also Frollein, aber … soll ich Sie wirklich so nennen? Ich dachte …«
»Sie dachten, das sagt man nicht mehr?«
»Ja.« Henri nestelte ein großes weißes Baumwolltaschentuch aus der linken Hosentasche.
»Das geht nicht nur Ihnen so, Herr Ketelsen. Die Leute in Bökersbrück haben mich zwar über die Jahre einfach als Fräulein Langner angesprochen, doch den meisten war klar, dass das unpassend war. Ich fand es oft sogar unverschämt.«
Henri nickte.
»Aber dann … wissen Sie, wo sich meine Meinung geändert hat?«
Henri schüttelte den Kopf.
»Geben Sie ruhig mal einen Tipp ab!«
Henri straffte den Rücken. »In … Stockelsdorf?«
Edda Langner lachte aus vollem Hals. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Weil, äh … Stockelsdorf, da kommt meine Mutter her, und damals sagte man das doch noch mit dem Fräulein und … also, es ist ja auch nicht so weit weg von hier.« Henri betupfte seine Stirn mit dem Baumwolltuch.
»Stockelsdorf!« Edda Langner schüttelte erheitert den Kopf. »Ich will es Ihnen verraten: in Berlin.«
Henri schob das Tuch wieder in seine Hosentasche. »Ach. Und wie?«
Sie kicherte. »Ich war zu einer Familienfeier eingeladen, und mein Neffe … ich kann Ihnen sagen, der kennt sich aus! Einmal pilgerte er abends mit uns durch die Stadt. Wir landeten in einer Bar und die hieß: Frollein Langner.«
Henri versuchte einen Pfiff, doch der geriet etwas lahm. »Ui.«
»Es gab noch Kuchen vom Café-Betrieb am Nachmittag und dazu Cocktails. Polar Crush, Manhattan … und irgendwas mit Piraten, das weiß ich noch.«
»Piraten und Sahneschnitten?«
»Tja … Berlin, Herr Ketelsen.«
Henri nickte.
»Waren Sie schon mal da?«
Henri schüttelte den Kopf.
»Wollten Sie denn nie hin?«
Henri wiegte den Kopf von links nach rechts.
Er bemerkte die Tränen in seinen Augen erst, als Edda Langner den Blick abwandte.
»Maike und ich wollten zusammen hin. Zu unserem Hochzeitstag. Fünf Jahre wären es gewesen, jetzt im September. Sie hat da ein Hotel empfohlen bekommen, direkt an der S-Bahn. Oder U-Bahn. Wir wollten ins Uhrenmuseum und danach zum Hoppegarten.« Henri schluckte. »Rennbahn und Restaurant.« Er wischte sich mit dem Riesentaschentuch über seine Augen. »Und wer weiß, vielleicht wären wir später auch noch in eine Bar gegangen.«
Edda Langner räusperte sich und sprach schnell weiter. »Jedenfalls finde ich es seit diesem Barbesuch ganz nett, Frollein Langner genannt zu werden. Ist so etwas wie ein Privatwitz. Als würde man mich kurz zurück nach Berlin beamen.«
»Also …« Henri atmete auf. »Dann weiß ich ja jetzt endlich, wie ich Sie richtig anspreche.«
Edda Langner ließ eine kurze Pause verstreichen. »Und ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich dachte schon, das wird nichts mehr in dieser Woche.«
»Aber das hatten wir doch vereinbart.«
»Ja.« Edda Langners Blick flog zum Wandkalender. Freitag.
Henri äugte konzentriert auf ein Regal neben dem Kalender, in dessen Fächern sich riesige, flauschige Wollbälle drängten. Und damit sollte man noch etwas stricken? Die sahen doch schon nach Endprodukt aus!
»Verkauft sich so was?« Er deutete zum Regal.