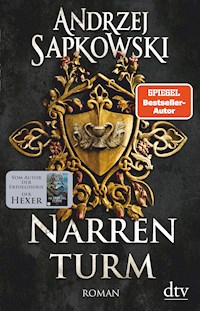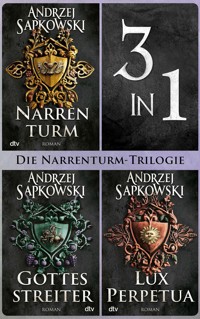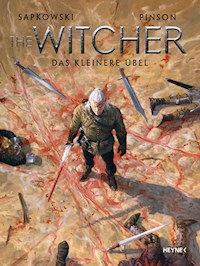49,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 49,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Erbe der Elfen: Seit dem blutigen Überfall auf Cintra ist die Erbin des Reiches verschollen. Es gehen Gerüchte um, dass sie nicht tot ist, sondern von Geralt, dem Hexer, entführt und an einen geheimen Ort gebracht wurde … In dem fast verwaisten Stammsitz der Hexer soll in den geheimen Künsten ausgebildet werden. Schon bald zeigt sich, dass sie großes magisches Potential besitzt. Dann aber wird sie immer öfter zum Medium einer geheimnisvollen Macht, die allen in ihrer Umgebung ein böses Ende voraussagt … Die Zeit der Verachtung: Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Am Vorabend der Besprechungen sieht sich Geralt, der Hexer, einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Der geheimnisvolle Rience, sein alter Gegenspieler, verfolgt Ciri, die Prinzessin von Cintra, die unter Geralts Schutz steht. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation. Ciri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte. Feuertaufe: In Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, der Thronerbin von Cintra, proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Cirilla? Geralt, noch kaum von seinen schweren Verletzungen genesen, macht sich auf den Weg nach Nilfgaard, begleitet von Rittersporn und der Bogenschützin Milva sowie dem geheimnisvollen Regis, der über seltsame Kräfte verfügt. Doch auch eine gerade erst gegründete Geheimloge von Zauberinnen will Cirilla um jeden Preis finden und zur Königin machen, um so die Macht der Zauberer zu sichern … Der Schwalbenturm: Ciri, die Prinzessin von Cintra, ist auf der Suche nach ihrem Schicksalsort, dem legendären Schwalbenturm. Und die rivische Königin will Geralt, den Hexer, und seine Gefährten als Partisanenkämpfer in dem blutigen Krieg gegen Nilfgaard verpflichten. Doch es gelingt ihnen, sich abzusetzen. Bei einem Überfall gerät Geralts Wolfsmedaillon, das Insignium seines Hexertums, in fremde Hände… Die Dame vom See: Eine letzte große Schlacht wird das Schicksal von Ciri, der Prinzessin von Cintra, und Geralt, dem Hexer, erfüllen. Wird sich die uralte Prophezeiung bewahrheiten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Das Erbe der Elfen: Seit dem blutigen Überfall auf Cintra ist die Erbin des Reiches verschollen. Es gehen Gerüchte um, dass sie nicht tot ist, sondern von Geralt, dem Hexer, entführt und an einen geheimen Ort gebracht wurde … In dem fast verwaisten Stammsitz der Hexer soll in den geheimen Künsten ausgebildet werden. Schon bald zeigt sich, dass sie großes magisches Potential besitzt. Dann aber wird sie immer öfter zum Medium einer geheimnisvollen Macht, die allen in ihrer Umgebung ein böses Ende voraussagt …
Die Zeit der Verachtung: Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Am Vorabend der Besprechungen sieht sich Geralt, der Hexer, einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Der geheimnisvolle Rience, sein alter Gegenspieler, verfolgt Ciri, die Prinzessin von Cintra, die unter Geralts Schutz steht. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation. Ciri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte.
Feuertaufe: In Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, der Thronerbin von Cintra, proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Cirilla? Geralt, noch kaum von seinen schweren Verletzungen genesen, macht sich auf den Weg nach Nilfgaard, begleitet von Rittersporn und der Bogenschützin Milva sowie dem geheimnisvollen Regis, der über seltsame Kräfte verfügt. Doch auch eine gerade erst gegründete Geheimloge von Zauberinnen will Cirilla um jeden Preis finden und zur Königin machen, um so die Macht der Zauberer zu sichern …
Der Schwalbenturm: Ciri, die Prinzessin von Cintra, ist auf der Suche nach ihrem Schicksalsort, dem legendären Schwalbenturm. Und die rivische Königin will Geralt, den Hexer, und seine Gefährten als Partisanenkämpfer in dem blutigen Krieg gegen Nilfgaard verpflichten. Doch es gelingt ihnen, sich abzusetzen. Bei einem Überfall gerät Geralts Wolfsmedaillon, das Insignium seines Hexertums, in fremde Hände…
Die Dame vom See: Eine letzte große Schlacht wird das Schicksal von Ciri, der Prinzessin von Cintra, und Geralt, dem Hexer, erfüllen. Wird sich die uralte Prophezeiung bewahrheiten?
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen Die Zeit der Verachtung Feuertaufe Der Schwalbenturm Die Dame vom See
Roman
Aus dem Polnischen von Erik Simon
Elaine blath, Feainnewedd
Dearme aen a’cáelme tedd
Eigean evelienn deireádh
Que’n esse, va en esseáth
Feainnewedd, elaine blath!
Das Blümchen, Wiegenlied und
beliebter Abzählvers der Elfen
Wahrlich sage ich euch, es wird kommen eine Schwertzeit, eine Beilzeit, eine Zeit der Wolfsstürme. Es wird kommen die Zeit der Weißen Kälte und des Weißen Lichts, die Zeit des Wahnsinns und die Zeit der Verachtung, Tedd Deireádh, die Zeit des Endes. Die Welt wird im Frost ersterben, und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem Älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen Ichaer, dem ausgesäten Samenkorn. Aus dem Samenkorn, das nicht keimen wird, sondern in Flammen ausbrechen.
Ess’tuath esse! So wird es sein! Haltet Ausschau nach den Zeichen! Welche Zeichen das sein werden, will ich euch künden – zuvörderst wird das Blut der Aen Seidhe die Erde tränken, das Elfenblut …
Aen Ithlinnespeath, die Weissagung der
Ithlinne Aegli aep Aevenien
DASERSTEKAPITEL
Die Stadt brannte.
Die engen Straßen, die zum Graben führten, zur ersten Terrasse, verströmten Rauch und Hitze, die Flammen verzehrten die dicht gedrängten Strohdächer, leckten an den Mauern des Schlosses. Von Westen her, vom Hafentor, drang Geschrei heran, der Lärm eines erbitterten Kampfes, die dumpfen Stöße des Rammbocks, unter denen die Mauern erbebten.
Überraschend wurde sie von den Angreifern umzingelt, nachdem diese die von wenigen Soldaten, von Bürgern mit Hellebarden und den Armbrustschützen der Zünfte verteidigte Barrikade durchbrochen hatten. Die von Schabracken aus schwarzem Tuch bedeckten Pferde flogen wie Vampire über die Befestigungen hinweg, helle, blankgezogene Breitschwerter säten Tod unter den fliehenden Verteidigern.
Ciri fühlte, wie der Ritter, der sie auf den Sattelbogen gezogen hatte, jäh das Pferd zügelte. Sie hörte seinen Schrei. Halt dich fest, schrie er. Halt dich fest!
Andere Ritter in den Farben von Cintra preschten an ihnen vorbei, schlugen sich weiter vorn mit den Nilfgaardern. Ciri sah es einen Moment lang, aus den Augenwinkeln – einen wahnwitzigen Wirbel von blau-gelben und schwarzen Mänteln inmitten des Klirrens von Stahl, der Schläge gegen Schilde, des Wieherns der Pferde …
Ein Schrei. Nein, kein Schrei. Ein Brüllen.
Halt dich fest!
Furcht. Jeder Ruck, jede Erschütterung, jeder Sprung des Pferdes reißt schmerzhaft an den um den Riemen gekrallten Händen. Die krampfhaft zusammengepressten Beine finden keinen Halt, die Augen tränen vom Rauch. Der Arm, der sie umschlingt, engt sie ein, nimmt ihr den Atem, drückt schmerzhaft gegen die Rippen. Ringsum schwillt ein Schrei an, ein Schrei, wie sie noch nie einen gehört hat. Was muss man einem Menschen antun, dass er so schreit?
Furcht. Ohnmächtig machende, lähmende, atemberaubende Furcht.
Wieder klirrt Eisen, wiehert ein Pferd. Die Häuser ringsum tanzen, aus den Fenstern sprüht Feuer, und dort, wo eben noch eine morastige Gasse war, ist der Boden mit Leichen übersät, mit der weggeworfenen Habe der Flüchtenden. Der Ritter hinter ihr bricht plötzlich in sonderbares, heiseres Husten aus. Über die in die Riemen verkrallten Hände strömt Blut. Gebrüll. Das Schwirren von Pfeilen.
Fall, Aufprall, schmerzhafter Stoß gegen die Rüstung. Neben ihr donnern Hufe, über sie huscht ein Pferdebauch mit offenem Sattelgurt hinweg, wieder ein Pferdebauch, eine wehende schwarze Schabracke. Ein Ächzen wie von der Axt eines Holzfällers, wenn sie den Baum trifft. Doch da ist kein Holz, da trifft Eisen auf Eisen. Ein Schrei, erstickt und dumpf, direkt neben ihr stürzt etwas Großes und Schwarzes in den Dreck, verspritzt Blut. Ein gepanzerter Fuß zuckt hin und her, pflügt die Erde mit dem riesigen Sporn.
Ein Ruck. Eine Kraft reißt sie hoch, zieht sie auf einen Sattelbogen. Festhalten! Wieder das Trappeln von Pferdehufen in wahnsinnigem Galopp. Hände und Füße suchen verzweifelt einen Halt. Das Pferd bäumt sich auf. Festhalten! … Da ist kein Halt. Da ist keiner … keiner … Da ist Blut. Das Pferd stürzt. Sie kann nicht abspringen, sich nicht befreien, sich nicht aus der Umklammerung der Arme in dem Panzerhemd lösen. Nicht dem Blut entkommen, das ihr über Kopf und Hals strömt.
Ein Ruck, aufspritzender Morast, der harte Aufprall auf dem Boden, der erstaunlich unbewegt ist nach dem wilden Ritt. Das durchdringende Wiehern und Schreien des Pferdes, das versucht, die Kruppe zu heben. Das Donnern von Hufeisen, vorbeihuschende Steigbügel und Hufe. Schwarze Mäntel und Schabracken. Geschrei.
In der Straße ist Feuer, eine brüllende Feuerwand. Vor diesem Hintergrund ein Reiter, so groß, dass sein Kopf über die brennenden Dächer zu ragen scheint. Das mit schwarzem Tuch bedeckte Pferd tänzelt, wirft den Kopf hin und her, wiehert.
Der Reiter schaut sie an. Ciri sieht das Funkeln seiner Augen durchs Visier des großen Helms, der mit den Flügeln eines Raubvogels verziert ist. Sie sieht den Widerschein des Feuers auf der breiten Schwertklinge in der gesenkten Hand.
Der Reiter schaut. Ciri kann sich nicht bewegen. Ihr ist der kraftlose Arm des Erschlagenen im Wege, der ihre Taille umschlingt. Sie kann sich nicht bewegen, weil etwas Schweres und vom Blute Nasses auf ihrer Hüfte liegt und sie an den Boden nagelt.
Und sie kann sich vor Angst nicht bewegen. Eine ungeheuerliche Furcht, von der sich ihr Inneres zusammenkrampft und die bewirkt, dass Ciri das Wimmern des verwundeten Pferdes nicht mehr hört, das Tosen der Flammen, die Schreie der Menschen, die ermordet werden, und das Dröhnen der Trommeln, nichts von all dem nimmt sie wahr. Das Einzige, was es gibt, was zählt, was Bedeutung hat, ist die Furcht. Die Furcht, die die Gestalt eines schwarzen Reiters mit einem federgeschmückten Helm angenommen hat, reglos vor der roten Wand von lodernden Flammen.
Der Reiter spornt das Pferd an, die Flügel des Raubvogels an seinem Helm flattern, der Vogel setzt zum Flug an. Zum Angriff auf das wehrlose, von Furcht gelähmte Opfer. Der Vogel – oder vielleicht der Ritter – schreit, gellend, schrecklich, grausam, triumphierend. Schwarzes Pferd, schwarze Rüstung, wehender schwarzer Mantel, und hinter allem Feuer, ein Meer von Feuer.
Furcht.
Der Vogel schreit. Die Flügel schlagen, die Federn schlagen gegen das Gesicht. Furcht.
Zu Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Ich bin allein, ich bin klein, ich bin wehrlos, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege nicht einmal einen Schrei aus der verkrampften Kehle heraus. Warum kommt mir niemand zu Hilfe?
Ich habe Angst!
Die Augen funkeln durchs Visier des großen gefiederten Helms. Der schwarze Mantel verdeckt alles …
»Ciri!«
Sie erwachte schweißgebadet, starr, und ihr eigener Schrei, der Schrei, der sie geweckt hatte, klang, vibrierte noch immer mitten in ihr, unterm Brustbein, brannte ihr in der ausgetrockneten Kehle. Es schmerzten die in die Decke verkrampften Hände, es schmerzte der Rücken …
»Ciri. Beruhige dich.«
Ringsum war Nacht, eine dunkle und windige Nacht, die eintönig und melodisch die Wipfel der Föhren rauschen, die Stämme knarren ließ. Da war kein Feuer mehr und kein Geschrei, nur jenes rauschende Wiegenlied. Nebenan waberten Licht und Wärme des Lagerfeuers, die Flammen glänzten auf den Schnallen des Zaumzeugs, spiegelten sich rot auf Griff und Scheide des Schwertes, das an dem auf dem Boden liegenden Sattel lehnte. Es gab kein anderes Feuer und kein anderes Eisen. Die Hand, die ihre Wange berührte, roch nach Haut und Asche. Nicht nach Blut.
»Geralt …«
»Es war nur ein Traum. Ein böser Traum.«
Ciri begann heftig zu zittern, zog Arme und Beine an.
Ein Traum. Nur ein Traum.
Das Lagerfeuer war schon heruntergebrannt, die Birkenscheite waren rot und durchscheinend, sie knisterten, und blaue Flammen schossen hervor. Die Flammen erleuchteten die weißen Haare und das scharfe Profil des Mannes, der Decke und Mantel über sie breitete.
»Geralt, ich …«
»Ich bin bei dir. Schlaf, Ciri. Du musst dich ausruhen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.«
Ich höre Musik, dachte sie plötzlich. In diesem Rauschen … ist eine Musik. Lautenmusik. Und Stimmen. Kleine Prinzessin aus Cintra. Kind der Vorsehung … Kind des Älteren Blutes, des Elfenblutes. Geralt von Riva, der Weiße Wolf, und seine Vorherbestimmung. Nein, nein, das ist eine Legende. Von einem Dichter erfunden. Sie lebt nicht mehr. Sie wurde in den Straßen der Stadt erschlagen, als sie fortging …
Halt dich fest … Festhalten …
»Geralt?«
»Was ist, Ciri?«
»Was hat er mit mir gemacht? Was ist damals geschehen? Was hat er … mit mir gemacht?«
»Wer?«
»Der Ritter … Der schwarze Ritter mit Federn am Helm … Ich kann mich an nichts erinnern. Er schrie … und schaute mich an. Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist. Nur, dass ich Angst hatte … so schreckliche Angst …«
Der Mann beugte sich herab, die Flammen des Lagerfeuers spielten auf seinen Augen. Das waren seltsame Augen. Sehr seltsame. Früher einmal hatte sich Ciri vor diesen Augen gefürchtet, nicht gern hineingeschaut. Doch das war lange her. Sehr lange.
»Ich kann mich an nichts erinnern«, flüsterte sie und suchte seine Hand, die hart und rau war wie unbearbeitetes Holz. »Dieser schwarze Ritter …«
»Es war ein Traum. Schlaf ruhig. Das kommt nicht wieder.«
Ciri hatte derlei Versicherungen schon oft gehört, früher. Man hatte es ihr viele Male gesagt, sie wieder und wieder beruhigt, wenn sie mitten in der Nacht von ihrem eigenen Schrei erwacht war. Doch jetzt war es anders. Jetzt glaubte sie es. Weil es jetzt Geralt von Riva sagte, der Weiße Wolf, der Hexer. Der ihre Vorherbestimmung war. Dem sie vorherbestimmt war. Der Hexer Geralt, der sie inmitten von Krieg, Tod und Verzweiflung gefunden, sie mit sich genommen und versprochen hatte, dass sie sich nie mehr trennen würden.
Sie schlief ein, ohne seine Hand loszulassen.
Der Barde beendete sein Lied. Den Kopf leicht geneigt, wiederholte er auf der Laute das Leitmotiv der Ballade, zurückhaltend, leise, eine Terz höher als der ihn begleitende Schüler.
Niemand sagte ein Wort. Außer der leiser werdenden Musik waren nur das Rauschen der Blätter und das Knacken der Äste in der riesigen Eiche zu hören. Dann aber begann plötzlich eine Ziege zu meckern, die abseits an einem der Wagen angebunden war, welche rings um den uralten Baum standen. Sofort, wie auf ein Signal hin, stand einer der in dem großen Halbkreis versammelten Zuhörer auf. Er warf den kobaltblauen, goldverbrämten Mantel über die Schulter zurück und verneigte sich steif und würdevoll.
»Hab Dank, Meister Rittersporn«, sagte er mit voller Stimme, doch nicht laut. »Es sei mir, Radcliffe von Oxenfurt, dem Meister der Magischen Arkana, zweifellos im Namen aller hier Anwesenden gestattet, dir Dank und Anerkennung für deine große Kunst und dein Talent auszusprechen.«
Der Zauberer ließ den Blick über die Versammelten schweifen, die, ihrer gut hundert, zu Füßen der Eiche dicht im Halbkreis lagerten, standen, auf den Wagen saßen. Die Zuhörer nickten, flüsterten. Ein paar Leute begannen zu klatschen, ein paar andere grüßten den Sänger mit erhobenen Händen. Die gerührten Weibsbilder schnieften und wischten sich die Augen, womit sie nur konnten, je nach Stand, Beruf und Vermögen: die Bäuerinnen mit dem Ärmel oder dem Handrücken, die Frauen der Kaufleute mit seidenen Tüchern, Elfen und Adlige mit Batist, und die drei Töchter des Freiherrn Vilibert, der mit seinem ganzen Gefolge die Beizjagd unterbrochen hatte, um den berühmten Troubadour zu hören, schnäuzten sich hörbar und hingebungsvoll in geschmackvolle wollene Umschlagtücher von der Farbe verrotteten Laubs.
»Ich übertreibe nicht«, fuhr der Zauberer Radcliffe fort, »wenn ich sage, dass du uns aufs Tiefste bewegt hast, Meister Rittersporn, dass du uns zum Aufmerken und zum Nachdenken gebracht, unsere Herzen gerührt hast. Ich bin so frei, dir unseren Dank und unsere Hochachtung auszudrücken.«
Der Troubadour stand auf und verbeugte sich, wobei ihm die am kecken Hütchen befestigte Reiherfeder über die Knie strich. Der Schüler unterbrach sein Spiel, grinste und verbeugte sich ebenfalls, doch Meister Rittersporn warf ihm einen drohenden Blick zu und murmelte halblaut etwas. Der Bursche senkte den Kopf und widmete sich wieder dem leisen Klimpern auf seiner Laute.
Es kam Leben in die Versammelten. Nachdem die Kaufleute von den Karawanen miteinander getuschelt hatten, rollten sie ein ansehnliches Bierfässchen vor die Eiche. Der Zauberer Radcliffe hatte sich in ein leises Gespräch mit dem Freiherrn Vilibert vertieft. Die Töchter des Freiherrn hörten auf zu schniefen und himmelten Rittersporn an. Der Barde bemerkte es nicht, da er gerade vollauf damit beschäftigt war, einer ausdauernd schweigenden Gruppe wandernder Elfen zuzulächeln, zuzuzwinkern und dabei die Zähne blitzen zu lassen. Sein Interesse galt insondere einer der Elfen, einer dunkelhaarigen und großäugigen Schönheit mit einer kleinen Hermelintoque. Rittersporn hatte Rivalen: Auch seine Zuhörer – Ritter, Schuljungen und Vaganten – hatten die Besitzerin der großen Augen und der kleinen Toque wahrgenommen und bedachten sie mit Blicken. Die Elfe, sichtlich erfreut über das Interesse, zupfte an den Spitzenmanschetten ihrer Bluse und klimperte mit den Wimpern, doch die männlichen Elfen in ihrer Begleitung umringten sie von allen Seiten und machten kein Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Buhler.
Die Lichtung bei der Eiche Bleobheris, ein Ort, wo oft Volksversammlungen abgehalten wurden, Reisende Rast machten und Wanderer sich trafen, war bekannt für ihre Toleranz und Offenheit. Die Druiden, unter deren Schutz der jahrhundertealte Baum stand, nannten die Lichtung den »Ort der Freundschaft« und empfingen bereitwillig jeden Gast. Aber selbst bei außerordentlichen Gelegenheiten, wie es der soeben beendete Auftritt eines weltbekannten Troubadours war, hielten sich die Reisenden bei ihren eigenen, recht deutlich abgegrenzten Gruppen. Elfen blieben bei den Elfen. Die Handwerker unter den Zwergen gesellten sich zu ihren bis an die Zähne bewaffneten Stammesverwandten, die als Schutztruppe für die Handelskarawanen dienten, und duldeten höchstens noch Gnomen-Bergleute und Halbling-Bauern in ihrer Nähe. Alle Nichtmenschen hielten gleichermaßen Abstand zu den Menschen. Die Menschen zahlten es den Nichtmenschen auf dieselbe Weise heim, doch auch unter ihnen war keine Spur von Integration zu beobachten. Der Adel sah angewidert auf Kaufleute und Hausierer herab, Soldaten und Söldner rückten von den Hirten in den stinkenden Mänteln ab. Die wenigen Zauberer und Adepten isolierten sich völlig und bedachten alle ringsum in gerechtem Gleichmaß mit ihrem Hochmut. Den Hintergrund indes bildete die zusammengedrängte, dunkle, finster schweigende Masse der Bauern. Sie, die mit den über die Köpfe ragenden Rechen, Mistgabeln und Dreschflegeln an eine Armee erinnerten, ignorierten alle und alles.
Eine Ausnahme bildeten wie üblich die Kinder. Befreit von dem Gebot, sich während des Auftritts des Barden still zu verhalten, stürmte die Rasselbande mit wildem Geschrei in den Wald, um sich dort mit Feuereifer einem Spiel zu widmen, dessen Regeln jemand, der die glücklichen Kinderjahre schon hinter sich hatte, für gewöhnlich nicht verstand. Die kleinen Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnomen, Halbelfen, Viertelelfen und Knirpse rätselhafter Herkunft kannten und akzeptierten keine gesellschaftlichen und Rassenschranken. Vorerst.
»In der Tat!«, rief einer der auf der Lichtung anwesenden Ritter, ein spindeldürrer Kerl in einem rot-schwarzen Wams, das mit drei schreitenden Löwen verziert war. »Das hat der Herr Zauberer gut gesagt! Schöne Balladen waren das, bei meiner Ehre, Herr Rittersporn, wenn Ihr einmal in der Nähe von Kahlhorn seid, dem Kastell meines alten Herrn, dann tretet ein, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. Wir werden Euch bewirten wie einen Fürsten, was sage ich, wie König Wisimir selber! Ich schwöre auf mein Schwert, ich habe viele Troubadoure gehört, aber die sind gar nichts im Vergleich zu Euch, Meister. Nehmt von uns, den Edelgeborenen und zum Ritter geschlagenen, Wertschätzung und Huldigung für Eure Kunst entgegen!«
Mit unfehlbarem Gespür für den richtigen Augenblick zwinkerte der Troubadour dem Schüler zu. Der Bursche legte die Laute beiseite und nahm eine kleine Schatulle vom Boden auf, die dazu diente, bei den Zuhörern gewichtigere Bekundungen ihrer Anerkennung zu sammeln. Er zögerte, ließ den Blick über die Menge schweifen, worauf er die Schatulle wieder hinlegte und einen nahebei stehenden leeren Zuber ergriff. Mit einem geneigten Lächeln hieß Meister Rittersporn die Umsicht des jungen Mannes gut.
»Meister!«, rief eine stattliche Frau, die auf einem Wagen mit der Aufschrift »Vera Loewenhaupt und Söhne« saß, der mit Waren aus Weidenruten beladen war. Von den Söhnen war weit und breit nichts zu sehen, wahrscheinlich waren sie damit beschäftigt, die von der Mutter erarbeitete Habe zu vergeuden. »Meister Rittersporn, wie das? Ihr lasst uns im Ungewissen? Das ist doch nicht das Ende Eurer Ballade? Singt uns davon, was weiter geschah!«
»Lieder und Balladen«, sagte der Künstler mit einer Verbeugung, »sind nie zu Ende, meine Dame, denn die Poesie ist ewig und unsterblich, sie kennt weder Anfang noch Ende …«
»Aber was war danach?« Die Kauffrau gab sich nicht geschlagen, während sie freigiebig klingende Münzen in den Zuber warf, den ihr der Schüler hinhielt. »Erzählt uns wenigstens davon, wenn Ihr nicht davon singen mögt. In Euren Liedern sind überhaupt keine Namen gefallen, aber wir wissen ja, dass der Hexer, den Ihr besingt, kein anderer als der berühmte Geralt von Riva ist; jene Zauberin jedoch, zu der er in heißer Liebe entbrannt ist, ist die nicht minder berühmte Yennefer. Jenes Überraschungskind indes, das dem Hexer versprochen und vorherbestimmt ist, muss ja wohl Cirilla sein, die unglückliche Prinzessin aus dem von den Angreifern verwüsteten Cintra. Ist es nicht so?«
Rittersporn lächelte geduldig und geheimnisvoll.
»Ich singe von allgemeingültigen Dingen, edle Wohltäterin«, erklärte er. »Von Gefühlen, die jedem zuteil werden können. Nicht von konkreten Personen.«
»Mitnichten!«, brüllte jemand aus der Menge. »Jeder weiß, dass die Lieder vom Hexer Geralt handeln!«
»Ja, ja!«, piepsten die Töchter des Freiherrn Vilibert im Chor, während sie die tränennassen Tücher auswrangen. »Singt noch etwas, Meister Rittersporn! Was war danach? Haben der Hexer und die Zauberin Yennefer schließlich zueinandergefunden? Und haben sie sich geliebt? Waren sie glücklich? Wir wollen es wissen! Meister, Meister!«
»Ach was!«, rief kehlig der Anführer einer Gruppe von Zwergen und schüttelte den rotblonden, bis zum Gürtel reichenden Bart. »Ein Dreck ist das, Prinzessinnen, Zauberinnen, Vorherbestimmung, Liebe und derlei blauäugige Ammenmärchen. Das alles ist ja, nichts für ungut, Herr Dichter, reiner Schwindel oder poetische Erfindung, damit es schöner wird und rührend. Aber die militärischen Dinge, wie das Gemetzel und die Plünderung von Cintra, wie die Schlachten von Marnadal und Sodden, das habt Ihr uns wirklich schön gesungen, Rittersporn! Ha, für so ein Lied lässt man gern etwas Silber springen, wo es doch das Herz des Kriegers erfreut! Und man konnte sehen, dass Ihr keinen Deut gelogen habt, das sage ich, Sheldon Skaggs, und ich kann Wahrheit und Lüge unterscheiden, denn ich war in Sodden dabei, ich habe da mit der Axt in der Hand gegen die Invasoren aus Nilfgaard gestanden …«
»Ich, Donimir von Troy«, schrie der dünne Ritter mit den drei Löwen auf dem Wams, »war in beiden Schlachten um Sodden, aber Euch habe ich da nicht gesehen, Herr Zwerg!«
»Weil Ihr wahrscheinlich das Lager bewacht habt!«, versetzte Sheldon Skaggs. »Ich aber war in der vordersten Linie, dort, wo es heiß herging!«
»Gib acht, was du sagst, Langbart!« Donimir von Troy lief rot an und rückte den vom Schwert heruntergezogenen Waffengürtel zurecht. »Und zu wem!«
»Gib selber acht!« Der Zwerg schlug mit der Hand auf die hinterm Gürtel steckende Axt, wandte sich zu seinen Kumpanen um und bleckte die Zähne. »Habt ihr den gesehen? Den beschissenen Ritter? Wappenträger! Drei Löwen auf dem Schild! Zwei scheißen, aber der dritte knurrt!«
»Frieden, Frieden!« Ein grauhaariger Druide in weißem Gewand unterband mit scharfer, gebieterischer Stimme den aufkommenden Streit. »Das schickt sich nicht, meine Herren! Nicht hier, nicht unter den Ästen von Bleobheris, der Eiche, die älter ist als jeder Zank und Streit dieser Welt! Und nicht in der Gegenwart des Dichters Rittersporn, dessen Balladen uns Liebe lehren sollen, nicht Händel.«
»Richtig!«, unterstützte den Druiden ein untersetzter, beleibter Priester mit schweißglänzendem Gesicht. »Ihr seht, aber habt keine Augen, ihr hört, doch eure Ohren sind taub. Denn die Liebe Gottes ist nicht in euch, weil ihr wie leere Fässer seid …«
»Wenn schon von Fässern die Rede ist«, piepste ein langnasiger Gnom von einem Wagen mit der Aufschrift »Eisenwaren, Herstellung und Verkauf«, »so rollt doch noch eins her, ihr Herren Zunftleute! Dem Dichter Rittersporn ist ganz gewiss die Kehle trocken geworden und uns von all der Rührung nicht weniger!«
»Wahrlich, wie leere Fässer, sage ich euch!«, übertönte der Priester den Gnom, nicht gewillt, sich aus der Fassung bringen zu lassen und seine Predigt zu unterbrechen. »Reinweg gar nichts habt ihr von den Balladen des Herrn Rittersporn verstanden, nichts daraus gelernt. Ihr habt nicht verstanden, dass diese Balladen vom Schicksal der Menschen handeln, davon, dass wir in der Hand der Götter nur Spielzeug sind und unsere Länder der Spielplatz. Die Balladen sprechen von der Vorherbestimmung, von unser aller Vorherbestimmung, und die Legende vom Hexer Geralt und der Prinzessin Ciri, wenngleich sie auf den wahren Hintergrund jenes Krieges gelegt ist, ist doch nur ein Gleichnis, ein Fantasieprodukt des Dichters, und sollte dazu dienen, dass wir …«
»Du redest Unsinn, heiliger Mann!«, rief Vera Loewenhaupt von der Höhe ihres Wagens herab. »Was für eine Legende? Was für ein Fantasieprodukt? Ich jedenfalls kenne Geralt von Riva, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen, in Wyzima, wo er die Tochter von König Foltest entzaubert hat. Und später bin ich ihm noch einmal auf dem Händlerweg begegnet, als er auf Bitten der Gilde einen grimmigen Greifen erlegte, der die Karawanen überfiel, und mit dieser Tat vielen guten Menschen das Leben rettete. Nein, das ist keine Legende und kein Märchen. Die Wahrheit, die reine Wahrheit hat uns Meister Rittersporn hier gesungen.«
»Ich kann das bestätigen«, sagte eine schlanke Kriegerin, die ihre schwarzen Haare glatt nach hinten gekämmt und zu einem dicken Zopf geflochten hatte. »Auch ich, Rayla aus Lyrien, kenne Geralt, den Weißen Wolf, den berühmten Vernichter der Ungeheuer. Die Zauberin Yennefer habe ich ebenfalls des Öfteren gesehen, denn ich war in Vengerberg, wo sie ihren Wohnsitz hat. Davon, dass die beiden sich geliebt hätten, ist mir jedoch nichts bekannt.«
»Aber es muss wahr sein«, ließ sich plötzlich mit melodischer Stimme die hübsche Elfe mit der Hermelintoque vernehmen. »Diese schöne Ballade von der Liebe kann nicht erfunden gewesen sein!«
»Kann sie nicht!«, sekundierten der Elfe die Töchter des Freiherrn Vilibert und wischten sich wie auf Kommando die Augen mit den Tüchern. »Auf gar keinen Fall!«
»Herr Zauberer!«, wandte sich Vera Loewenhaupt an Radcliffe. »Haben sie sich geliebt oder nicht? Ihr wisst sicherlich, wie es wirklich gewesen ist mit dem Hexer und dieser Yennefer. Lüftet den Schleier des Geheimnisses!«
»Wenn das Lied sagt, dass sie sich geliebt haben«, sagte lächelnd der Zauberer, »dann war es so, und diese Liebe wird die Jahrhunderte überdauern. Das ist die Kraft der Poesie.«
»Es heißt«, warf Freiherr Vilibert plötzlich ein, »dass Yennefer von Vengerberg auf der Anhöhe von Sodden gefallen ist. Dort sind mehrere Zauberinnen ums Leben gekommen …«
»Das ist nicht wahr«, sagte Donimir von Troy. »Ihr Name steht nicht auf dem Denkmal. Das ist meine Gegend, ich war so manches Mal auf der Anhöhe und habe die in das Denkmal gemeißelten Inschriften gelesen. Drei Zauberinnen sind dort umgekommen. Triss Merigold, Lytta Neyd, genannt die Koralle … Hmm … Der dritte Name ist mir entfallen …«
Der Ritter schaute den Zauberer Radcliffe an; der aber lächelte nur und sagte kein Wort.
»Aber dieser Geralt«, ließ sich plötzlich Sheldon Skaggs vernehmen, »dieser Geralt, der diese Yennefer geliebt hat, der hat anscheinend schon ins Gras gebissen. Ich habe gehört, dass es ihn irgendwo im Flussland erwischt hat. Hat Ungeheuer umgebracht, bis er schließlich seinen Meister gefunden hat. So ist das, ihr Leute, wer mit dem Schwert kämpft, kommt durch das Schwert um. Jeder trifft irgendwann auf einen Besseren und kriegt Eisen zu fressen.«
»Das glaube ich nicht.« Die schlanke Kriegerin verzog die blassen Lippen, spuckte saftig auf den Boden, verschränkte klirrend die mit Kettenpanzer bewehrten Unterarme vor der Brust. »Ich glaube nicht, dass Geralt von Riva auf einen Besseren treffen kann. Ich hatte Gelegenheit zu sehen, wie dieser Hexer mit dem Schwert umgeht. Er ist einfach unmenschlich schnell …«
»Gut gesagt«, warf der Zauberer Radcliffe ein. »Unmenschlich. Hexer sind Mutanten, daher ist die Schnelligkeit ihrer Reaktion …«
»Ich weiß nicht, wovon Ihr redet, Herr Magier.« Die Kriegerin verzog die Lippen zu einer noch widerwärtigeren Grimasse. »Eure Worte sind zu gelehrt. Doch eines weiß ich: Kein Schwertkämpfer, den ich kannte oder kenne, kann sich mit Geralt von Riva messen, mit dem Weißen Wolf. Darum glaube ich nicht, dass er im Kampf besiegt worden ist, wie der Herr Zwerg behauptet.«
»Jeder kneift den Hintern dicht, wenn er gegen viele ficht«, sprach Sheldon Skaggs sentenziös. »Wie die Elfen sagen.«
»Die Elfen«, teilte kalt ein hochgewachsener, hellhaariger Vertreter des Älteren Volkes mit, der neben der hübschen Toque stand, »pflegen sich nicht derart ordinär auszudrücken.«
»Nein! Nein!«, piepsten hinter den bräunlichen Tüchern hervor die Töchter des Freiherrn Vilibert. »Der Hexer Geralt kann nicht umgekommen sein! Der Hexer hat die ihm vorherbestimmte Ciri gefunden und dann die Zauberin Yennefer, und alle drei haben lange und glücklich gelebt. Nicht wahr, Meister Rittersporn?«
»Aber das war doch eine Ballade, edle Fräuleins.« Der bierdurstige Gnom, der Hersteller von Eisenwaren, gähnte. »Was kann man von einer Ballade für Wahrheit verlangen? Wahrheit ist eine Sache, Poesie eine andere. Nehmen wir nur diese … Wie hieß sie doch? Ciri? Dieses berühmte Überraschungskind. Ich war des Öfteren in Cintra und weiß, dass der König und die Königin dort kinderlos waren, sie hatten weder Sohn noch Tochter …«
»Lüge!«, rief ein rothaariger Mann in einer Kutte aus Seehundsfell, der ein kariertes Tuch um die Stirn gebunden hatte. »Königin Calanthe, die Löwin von Cintra, hatte eine Tochter, Pavetta. Sie ist mit ihrem Mann bei einem Sturm ums Leben gekommen, die Strudel des Meeres haben sie verschlungen, beide.«
»Ihr seht selber, dass ich nicht lüge!«, rief der Eisenwarengnom alle als Zeugen an. »Pavetta, und nicht Ciri, hieß die Prinzessin von Cintra.«
»Cirilla, genannt Ciri, war die Tochter jener ertrunkenen Pavetta«, erklärte der Rothaarige. »Sie war keine Prinzessin, sondern Fürstentochter von Cintra. Und sie war auch das dem Hexer vorherbestimmte Überraschungskind; sie war es, die die Prinzessin, noch ehe das Kind zu Welt kam, dem Hexer versprach, wie es Herr Rittersporn gesungen hat. Aber der Hexer konnte sie nicht finden und mitnehmen, da ist der Herr Dichter von der Wahrheit abgewichen.«
»Ist er, aber wie«, schaltete sich ein sehniger junger Mann ins Gespräch ein – der Kleidung nach zu urteilen wohl ein Handwerksgeselle auf Wanderung, ehe er sein Meisterstück anfertigt und die Meisterprüfung ablegt. »Dem Hexer ist seine Vorherbestimmung entgangen. Cirilla ist während der Belagerung von Cintra umgekommen. Bevor sich Königin Calanthe vom Turm stürzte, hat sie mit eigener Hand der Fürstentochter den Tod gegeben, damit sie Nilfgaard nicht lebendig in die Fänge geriet.«
»Das war anders, ganz anders«, widersprach der Rothaarige. »Die Fürstentochter ist während des Gemetzels erschlagen worden, als sie versuchte, aus der Stadt zu entkommen.«
»Wie dem auch sei«, schrie der Eisenwarengnom, »der Hexer hat diese Ciri nicht gefunden! Der Dichter hat gelogen!«
»Aber schön hat er gelogen«, sagte die Elfe mit der Toque und schmiegte sich an den hochgewachsenen Elf.
»Es geht nicht um die Poesie, sondern um die Tatsachen!«, rief der Eisenwarenhändler. »Ich sage, die Fürstentochter ist von der Hand ihrer eigenen Großmutter umgekommen. Jeder, der in Cintra war, kann das bestätigen!«
»Und ich sage, dass sie auf der Straße erschlagen wurde, als sie zu fliehen versuchte«, teilte der Rothaarige mit. »Ich stamme zwar nicht aus Cintra, aber ich weiß das, weil ich bei der Mannschaft des Jarls von Skellige war, der Cintra im Krieg unterstützt hat. Der König von Cintra, Eist Tuirseach, stammt bekanntlich von den Skellige-Inseln, er war der Onkel des Jarls. Ich aber habe in der Mannschaft des Jarls in Marnadal und in Cintra gekämpft und dann, nach der Niederlage, bei Sodden …«
»Noch ein Mitkämpfer«, knurrte Sheldon Skaggs an die ihn umringenden Zwerge gewandt. »Lauter Helden und Krieger. He, Leute! Ist unter euch wenigstens einer, der nicht in Marnadal oder bei Sodden gekämpft hat?«
»Spott ist fehl am Platze, Skaggs«, sagte der hochgewachsene Elf tadelnd und legte der Schönheit mit der Toque den Arm um die Schultern, um bei den anderen Bewunderern jeden Zweifel zu zerstreuen. »Bilde dir nur nicht ein, dass nur du bei Sodden gekämpft hast. Ich beispielsweise habe auch an dieser Schlacht teilgenommen.«
»Fragt sich, auf welcher Seite«, flüsterte Freiherr Vilibert Radcliffe so zu, dass es gut zu hören war, doch der Elf ignorierte es völlig.
»Wie allgemein bekannt«, fuhr er fort, ohne den Freiherrn und den Zauberer auch nur eines Blickes zu würdigen, »haben in der zweiten Schlacht um Sodden an die hunderttausend Krieger im Felde gestanden, von denen mindestens dreißigtausend gefallen sind oder versehrt wurden. Herrn Rittersporn gebührt Dank, dass er in einer seiner Balladen diesen berühmten, aber auch schrecklichen Kampf für die Ewigkeit bewahrt hat. Sowohl in den Worten als auch in der Melodie dieses Liedes habe ich nicht Lobpreis gehört, sondern Warnung. Abermals, Lob und ewiger Ruhm gebühren dem Herrn Dichter für eine Ballade, die vielleicht dazu beiträgt, dass sich eine Wiederholung der Tragödie, die dieser grausame und nutzlose Krieg war, in Zukunft vermeiden lässt.«
»Wahrlich«, sagte Freiherr Vilibert und blickte den Elf herausfordernd an. »Merkwürdige Dinge habt Ihr aus der Ballade herausgehört, werter Herr. Ein nutzloser Krieg, sagt Ihr? Ihr möchtet eine Tragödie in Zukunft gern vermeiden? Sollen wir das so verstehen, dass, wenn Nilfgaard uns wieder angreifen würde, Ihr zur Kapitulation rietet? Das Joch von Nilfgaard unterwürfig annehmen würdet?«
»Das Leben ist eine unschätzbare Gabe und muss bewahrt werden«, sagte der Elf kalt. »Nichts rechtfertigt eine Schlächterei und Hekatomben, wie es beide Schlachten um Sodden waren, die verlorene und die gewonnene. Beide haben euch Menschen Tausende von Existenzen gekostet. Ihr habt ein unvorstellbares Potential verloren …«
»Elfengerede!«, platzte Sheldon Skaggs heraus. »Dummes Geschwätz! Das war der Preis, der gezahlt werden musste, damit die anderen in Anstand und Frieden leben können, statt sich von den Nilfgaardern in Ketten legen, blenden, in die Schwefelgruben und Salzbergwerke prügeln zu lassen. Diejenigen, die den Heldentod gestorben sind und dank Rittersporn ewig in unserer Erinnerung leben werden, haben uns gelehrt, wie man sein Heim verteidigt. Singt Eure Balladen, Rittersporn, singt sie allen vor. Die Lehre wird nicht vergebens sein, sondern uns nützen, Ihr werdet es sehen! Denn heute oder morgen wird Nilfgaard wieder über uns kommen, denkt an meine Worte! Jetzt lecken sie sich die Wunden und erholen sich, aber der Tag ist nicht fern, da wir ihre schwarzen Mäntel und gefiederten Helme wieder zu Gesicht bekommen werden!«
»Was wollen sie von uns?«, rief Vera Loewenhaupt. »Warum haben sie es auf uns abgesehen? Warum lassen sie uns nicht in Ruhe leben und arbeiten? Was wollen sie, diese Nilfgaarder?«
»Unser Blut!«, brüllte Freiherr Vilibert.
»Und unser Land!«, schrie jemand aus der Menge der Bauern auf.
»Und unsere Weiber!«, sekundierte ihm Sheldon Skaggs und rollte drohend mit den Augen.
Ein paar Leute lachten auf, aber leise und heimlich. Denn obgleich es eine sehr komische Vorstellung war, dass jemand außer Zwergen auf die ungemein unattraktiven Zwergenfrauen aus sein könnte, so war es doch ein riskantes Thema für Späße, vor allem in Anwesenheit der kleinen, stämmigen und bärtigen Herrschaften, deren Äxte und Dolche die hässliche Angewohnheit hatten, unheimlich flink hinter den Gürteln hervorzuschnellen. Und die Zwerge, aus unerfindlichen Gründen durch und durch davon überzeugt, alle Welt sei auf ihre Frauen und Töchter scharf, waren in dieser Hinsicht überaus reizbar.
»Dazu musste es eines Tages kommen«, sagte plötzlich der grauhaarige Druide. »Das musste geschehen. Wir haben vergessen, dass wir nicht allein auf Erden sind, nicht der Nabel der Welt. Wie dumme, faule, vollgefressene Karpfen in einem trüben Teich glaubten wir nicht an die Existenz von Hechten. Wir haben zugelassen, dass unsere Welt wie jener Teich verschlammte, versumpfte und zu faulen begann. Blickt euch um – überall Verbrechen und Sünde, Gier, Gewinnsucht, Zank, Zwietracht, Sittenverfall, Missachtung aller Werte. Statt so zu leben, wie es die Natur uns heißt, haben wir begonnen, diese Natur zu vernichten. Und was kommt dabei heraus? Die Luft ist verpestet vom Gestank der Eisenhütten, Flüsse und Bäche sind von Schlachthöfen und Gerbereien verschmutzt, die Wälder werden auf Teufel komm raus abgeholzt … Ha, sogar in die lebendige Rinde der heiligen Bleobheris, schaut nur, da gleich überm Kopf des Herrn Dichters, hat jemand mit dem Klappmesser einen widerlichen Ausdruck eingeritzt. Noch dazu fehlerhaft – nicht genug, dass das ein Vandale war, es war auch noch ein Ignorant, der nicht schreiben kann. Was wundert ihr euch? Das musste ein böses Ende nehmen …«
»Ja, ja!«, fiel der dicke Priester ein. »Besinnt euch, ihr Sünder, ehe es zu spät ist, denn der Zorn der Götter und die Vergeltung sind über euch! Denkt an die Weissagung von Itlina, an die prophetischen Worte von der Strafe der Götter, die das von Verbrechen vergiftete Geschlecht heimsuchen wird! Erinnert euch: ›Es kommt die Zeit der Verachtung, und der Baum wird sein Laub verlieren, die Knospe wird verdorren, die Frucht verfault, und das Korn wird bitter, und in den Flusstälern strömt statt Wasser Eis. Und es wird kommen die Weiße Kälte und danach das Weiße Licht, und die Welt wird im Frost ersterben.‹ So spricht die Prophetin Itlina! Doch bevor das geschieht, werden Zeichen erscheinen und Plagen hereinbrechen, denn vergesst nicht, Nilfgaard ist eine Gottesstrafe! Das ist die Geißel, mit der die Unsterblichen euch Sünder züchtigen, damit ihr …«
»Ach, haltet den Mund, Hochwürden!«, blaffte Sheldon Skaggs und stampfte mit dem schweren Stiefel auf. »Es wird einem ganz übel von Eurem Aberglauben und Gefasel! Die Gedärme drehen sich einem um …«
»Vorsicht, Sheldon«, unterbrach ihn der hochgewachsene Elf mit einem Lächeln. »Spotte nicht über eine fremde Religion. Das ist weder schön noch anständig, noch … ungefährlich.«
»Ich spotte über nichts«, widersprach der Zwerg. »Ich ziehe die Existenz der Götter nicht in Zweifel, aber es bringt mich auf, wenn jemand sie in die irdischen Angelegenheiten hineinzieht und einem mit den Prophezeiungen irgendeiner verrückten Elfe den Kopf vernebelt. Die Nilfgaarder sollen also ein Werkzeug der Götter sein? Unsinn! Denkt, ihr Menschen, zurück an die Zeiten von Desmond, Radowid, Sambuk, an die Zeiten von Abrad Alteiche! Ihr erinnert euch nicht, weil euer Leben kurz ist wie das einer Eintagsfliege, aber ich weiß es noch und will euch daran erinnern, wie es war, hier in diesen Landstrichen, gleich nachdem ihr an der Jarugamündung und im Pontardelta aus euren Booten gestiegen seid. Aus der Besatzung von vier angekommenen Schiffen wurden drei Königreiche gebildet, und später haben die Stärkeren die Schwächeren geschluckt und so ihre Macht gestärkt. Sie haben andere unterworfen, sie sich einverleibt, und die Königreiche wuchsen, wurden immer größer und stärker. Und jetzt macht Nilfgaard dasselbe, denn das ist ein starkes und einiges, strenges und geschlossenes Land. Und wenn ihr euch nicht ebenso zusammenschließt, wird Nilfgaard euch schlucken, genau wie der Hecht den Karpfen, wie unser weiser Druide gesagt hat!«
»Sollen sie es nur versuchen!« Donimir von Troy warf sich in die mit drei Löwen verzierte Brust und ruckte geräuschvoll am Schwert in der Scheide. »Wir haben sie bei Sodden Mores gelehrt, wir können es auch ein zweites Mal tun!«
»Ihr bildet euch gar zu viel ein«, knurrte Sheldon Skaggs. »Ihr habt anscheinend vergessen, Herr Ritter, dass Nilfgaard vor der zweiten Auseinandersetzung bei Sodden wie eine eiserne Walze durch eure Länder gefahren ist und mit den Leichen von Angebern Eures Schlages die Felder von Marnadal bis ins Flussland übersät hat. Und Einhalt haben den Nilfgaardern auch nicht solche Schreihälse wie Ihr geboten, sondern die vereinigten Streitkräfte von Temerien, Redanien, Aedirn und Kaedwen. Gemeinsames Sinnen und einheitliches Handeln – das hat sie aufgehalten!«
»Nicht nur«, sagte Radcliffe volltönend, aber sehr kalt. »Nicht nur das, Herr Skaggs.«
Der Zwerg räusperte sich laut, schnäuzte sich, schurrte mit den Stiefeln, woraufhin er sich leicht zu dem Zauberer hin verneigte.
»Niemand wird Euren Konfratres die Verdienste absprechen«, sagte er. »Schande über den, der nicht das Heldentum der Zauberer auf der Anhöhe von Sodden würdigt, denn sie haben sich wacker geschlagen, haben ihr Blut für die gemeinsame Sache vergossen, haben wacker zum Sieg beigetragen. Herr Rittersporn hat sie in seiner Ballade nicht vergessen, und auch wir werden sie nicht vergessen. Doch bedenkt, dass jene Zauberer vereint und solidarisch auf der Anhöhe kämpften, dass sie die Führung des Vilgefortz akzeptierten, so wie wir, die Krieger der Vier Königreiche, den Oberbefehl Wisimirs anerkannt haben. Schade nur, dass diese Eintracht und Solidarität nur für die Zeit des Krieges ausgereicht hat. Denn jetzt, wo Frieden ist, haben wir uns wieder gespalten. Wisimir ist sich mit Foltest über Fragen des Zolls und des Stapelrechts uneins, Demawend von Aedirn zankt sich mit Henselt um die Nördliche Monarchie, und der Liga von Hengfors und den Thysseniden von Kovir geht das alles sonst wo vorbei. Und auch unter den Zauberern sucht man, wie ich gehört habe, heute vergebens nach der früheren Eintracht. Bei euch gibt es keine Geschlossenheit, keine Disziplin, keine Einheit. Aber in Nilfgaard gibt es das alles!«
»Über Nilfgaard herrscht Emhyr var Emreis, ein Tyrann und Monarch, der Gehorsam mit Peitsche, Strick und Beil erzwingt!«, donnerte Freiherr Vilibert. »Was schlagt Ihr uns da vor, Herr Zwerg? Wozu sollen wir uns zusammenschließen? Zu einer ähnlichen Tyrannei? Und welcher König, welches Königreich sollte Eurer Ansicht nach sich die Übrigen unterordnen? In wessen Hand würdet Ihr gern Zepter und Knute sehen?«
»Was kümmert mich das?« Skaggs zuckte mit den Schultern. »Das sind eure Menschenangelegenheiten. Egal, wen ihr schließlich zum König macht, es wird jedenfalls kein Zwerg sein.«
»Und auch kein Elf, nicht einmal ein Halbelf«, fügte der hochgewachsene Vertreter des Älteren Volkes hinzu, während er abermals den Arm um die Schönheit mit der Toque legte. »Sogar einen Viertelelf haltet ihr für den letzten Dreck …«
»Da drückt Euch der Schuh.« Vilibert lächelte. »Ihr stoßt in dasselbe Horn wie Nilfgaard, denn Nilfgaard redet auch immerzu von Gleichheit, verspricht Euch die Rückkehr zu den alten Zuständen, wenn es uns nur besiegt und aus diesen Ländern hinauswirft. So eine Einheit also, so eine Gleichheit schwebt Euch vor, von so einer redet, so eine verkündet Ihr! Weil Nilfgaard Euch dafür mit Gold bezahlt! Und es ist kein Wunder, dass Ihr einander so gern habt, denn das ist ja eine Elfenrasse, diese Nilfgaarder …«
»Unsinn«, sagte der Elf kalt. »Ihr redet Dummheiten, Herr Ritter. Der Rassismus macht Euch offensichtlich blind. Die Nilfgaarder sind genau solche Menschen wie Ihr.«
»Das ist eine Lüge! Sie sind die Nachkommen von Schwarzen Seidhe, das weiß jeder! In ihren Adern fließt das Blut von Elfen. Elfenblut!«
»Und was fließt in Euren Adern?« Der Elf lächelte spöttisch. »Wir vermischen unser Blut seit Generationen, seit Jahrhunderten, wir und ihr, das gelingt uns bestens, ich weiß nicht, ob zum Glück oder zum Unglück. Es ist kein Vierteljahrhundert her, dass ihr begonnen habt, gemischte Verbindungen zu verdammen, übrigens mit kläglichem Erfolg. Und jetzt zeigt mir einen Menschen ohne Beimischung von Seidhe Ichaer, vom Blut des Älteren Volkes.«
Vilibert lief sichtlich rot an. Auch Vera Loewenhaupt errötete bis über die Ohren. Der Zauberer Radcliffe senkte den Kopf und hüstelte. Interessanterweise wurde auch die schöne Elfe mit der Hermelintoque rot.
»Wir alle sind Kinder von Mutter Erde«, ertönte leise die Stimme des grauhaarigen Druiden. »Wir sind Kinder von Mutter Natur. Und obwohl wir unsere Mutter nicht achten, obwohl wir ihr manchmal Kummer und Schmerz zufügen, obwohl wir ihr das Herz brechen, liebt sie uns, liebt uns alle. Lasst uns dessen eingedenk sein, die wir hier versammelt sind, am Ort der Freundschaft. Und wir wollen uns nicht streiten, wer von uns zuerst hier war, denn zuerst wurde von einer Welle die Eichel angespült, und aus der Eichel keimte die Große Bleobheris, die Älteste von allen Eichen. Wenn wir unter den Ästen der Bleobheris stehen, zwischen ihren zeitlosen Wurzeln, wollen wir nicht unsere eigenen, brüderlichen Wurzeln vergessen, die Erde, aus der diese Wurzeln erwachsen. Denken wir an die Worte aus dem Lied des Dichters Rittersporn …«
»Genau!«, rief Vera Loewenhaupt. »Wo ist er eigentlich?«
»Er hat sich verdrückt«, stellte Sheldon Skaggs mit einem Blick auf den leeren Platz unter der Eiche fest. »Hat das Geld genommen und sich ohne Abschied verdrückt. Wahrlich auf Elfenart!«
»Auf Zwergenart!«, piepste der Eisenwaren-Gnom.
»Auf Menschenart«, berichtigte der hochgewachsene Elf, und die Schönheit mit der Toque legte den Kopf an seine Schulter.
»He, Spielmann«, sagte Madame Lantieri, als sie ohne anzuklopfen ins Zimmer kam und eine Geruchswolke von Hyazinthen, Schweiß, Bier und Rauchfleisch vor sich hertrieb. »Du hast Besuch. Kommt herein, ehrenwerter Herr.«
Rittersporn strich sich die Haare zurecht und richtete sich in dem riesigen geschnitzten Lehnstuhl auf. Die beiden Mädchen sprangen hurtig von seinen Knien, bedeckten ihre Reize, zogen die offenherzigen Hemden zusammen. Die Scham der Dirnen, dachte der Dichter, wirklich kein übler Titel für eine Ballade. Er stand auf, zog den Gürtel zu und legte das Wams an, während er den auf der Schwelle stehenden Edelmann ansah.
»In der Tat«, sagte er, »Ihr versteht es immer, mich zu finden, obwohl Ihr selten den passenden Moment wählt. Zu Eurem Glück hatte ich noch nicht entschieden, welche von den beiden Hübschen ich vorziehe. Und bei deinen Preisen, Lantieri, kann ich mir nicht beide leisten.«
Madame Lantieri lächelte verständnisinnig, klatschte in die Hände. Die beiden Mädchen – eine hellhäutige, sommersprossige von den Inseln und eine dunkelhaarige Halbelfe – verließen eilig das Zimmer. Der auf der Schwelle stehende Mann legte den Mantel ab und reichte ihn Madame Lantieri zusammen mit einem kleinen, aber prall gefüllten Beutel.
»Entschuldigt, Meister«, sagte er, trat näher und setzte sich an den Tisch. »Ich weiß, dass ich Euch zur Unzeit behellige. Aber Ihr seid unter der Eiche so plötzlich verschwunden … Ich habe Euch auf der Landstraße nicht eingeholt, wie ich es vorhatte, und im Städtchen nicht sofort Eure Spur gefunden. Seid versichert, ich werde nicht viel von Eurer Zeit in Anspruch nehmen …«
»Das sagt Ihr immer, und immer ist es Schwindel«, fiel ihm der Barde ins Wort. »Lass uns allein, Lantieri, und achte darauf, dass wir nicht gestört werden. Ich höre, mein Herr.«
Der Mann musterte ihn mit forschendem Blick. Er hatte dunkle, feuchte, wie tränende Augen, eine spitze Nase und unschöne, schmale Lippen.
»Ich komme ungesäumt zur Sache«, erklärte er, sobald sich die Tür hinter der Madame geschlossen hatte. »Mich interessieren Eure Balladen, Meister. Genauer gesagt, gewisse Personen, von denen Ihr singt. Mich beschäftigen die wahren Schicksale der Helden Eurer Balladen. Denn wenn ich mich nicht irre, haben Euch doch die wirklichen Schicksale realer Personen zu den schönen Werken inspiriert, die wir unter der Eiche gehört haben? Ich meine … Ich meine die kleine Cirilla von Cintra. Die Enkelin von Königin Calanthe.«
Rittersporn schaute zur Decke, trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Mein werter Herr«, sagte er trocken. »Für seltsame Dinge interessiert Ihr Euch. Nach sonderbaren Dingen fragt Ihr. Ich habe den Eindruck, dass Ihr nicht der seid, für den ich Euch gehalten habe.«
»Und für wen habt Ihr mich gehalten, wenn ich fragen darf?«
»Ich weiß nicht, ob Ihr dürft. Das wird davon abhängen, ob Ihr mir jetzt Grüße von unseren gemeinsamen Bekannten bestellt. Das hättet Ihr gleich zu Beginn tun sollen, aber Ihr habt es irgendwie vergessen.«
»Ich habe es keineswegs vergessen.« Der Mann griff in eine Innentasche der sepiafarbenen Samtjacke und holte einen zweiten Beutel hervor, etwas größer als derjenige, den er der Kupplerin ausgehändigt hatte, aber ebenso prall und verheißungsvoll klingend, als er auf die Tischplatte traf. »Wir haben einfach keine gemeinsamen Bekannten, Rittersporn. Aber ob dieser Beutel nicht imstande ist, dieses Manko auszugleichen?«
»Was gedenkt Ihr für diese dürre Geldkatze zu kaufen?« Der Troubadour verzog den Mund. »Das ganze Bordell von Madame Lantieri und den umliegenden Grund und Boden?«
»Sagen wir, ich gedenke die Kunst zu fördern. Und einen Künstler. Um mit dem Künstler über sein Schaffen plaudern zu können.«
»So sehr liebt Ihr die Kunst, mein Herr? Und so sehr drängt es Euch zu einem Gespräch mit dem Künstler, dass Ihr versucht, ihm Geld aufzudrängen, noch ehe Ihr Euch ihm vorgestellt habt, womit Ihr die elementarsten Regeln des Anstandes verletzt?«
»Zu Beginn unseres Gesprächs« – der Unbekannte kniff um ein Winziges die dunklen Augen zusammen – »hat mein Inkognito Euch nicht gestört.«
»Aber jetzt stört es mich allmählich.«
»Ich brauche mich meines Names nicht zu schämen«, sagte der Mann mit einem leichten Lächeln auf den dünnen Lippen. »Ich heiße Rience. Ihr kennt mich nicht, Meister Rittersporn, und das ist kein Wunder. Ihr seid zu bekannt und berühmt, um alle Eure Verehrer zu kennen. Aber jedem Bewunderer Eures Talents kommt es so vor, dass er Euch kennt, Euch so gut kennt, dass eine gewisse Vertraulichkeit ganz und gar angemessen ist. Das betrifft auch mich, im vollen Umfang. Ich weiß, dass das eine irrige Annahme ist, entschuldigt freundlichst.«
»Ich entschuldige freundlichst.«
»Ich kann auch darauf rechnen, dass Ihr bereit seid, mir ein paar Fragen zu beantworten …«
»Nein, das könnt Ihr nicht«, unterbrach ihn der Dichter von oben herab. »Nun entschuldigt Ihr freundlichst, aber ich diskutiere ungern über die Thematik meiner Werke, über Inspiration, über die Personen, die fiktiven wie auch die anderen. Das verdrängt nämlich die Poesie aus ihrer poetischen Schicht und führt zur Trivialität.«
»Tatsächlich?«
»Ganz entschieden. Denkt doch, wenn ich nach dem Vortrag der Ballade von der lustigen Müllerin verkünden würde, dass es sich dabei in Wahrheit um Zvirka handelt, die Frau des Müllers Schlammbeißer, und die Mitteilung hinzufügen würde, dass man sie jeden Donnerstag nach Herzenslust bumsen kann, weil der Müller donnerstags zum Markt fährt, dann wäre das schon keine Poesie mehr. Es wäre entweder Kuppelei oder widerwärtige Verleumdung.«
»Verstehe, verstehe«, sagte Rience rasch. »Aber das ist wohl ein schlechtes Beispiel. Mich interessieren ja niemandes Sünden oder Verfehlungen. Ihr werdet niemanden bloßstellen, wenn Ihr auf meine Fragen antwortet. Ich brauche nur eine kleine Information: Was ist wirklich aus Cirilla geworden, der Fürstentochter von Cintra? Viele Leute behaupten, sie sei bei der Eroberung der Stadt umgekommen, es gibt sogar Augenzeugen dieses Ereignisses. Aus Eurer Ballade folgt indes, dass das Kind überlebt hat. Es interessiert mich wirklich, ob das Eure Erfindung ist oder eine Tatsache. Wahrheit oder Fiktion?«
»Euer Interesse freut mich außerordentlich«, anwortete Rittersporn mit breitem Lächeln. »Ihr werdet lachen, Herr Wie-heißt-Ihr-doch-gleich, aber genau darum ging es mir, als ich die Ballade verfasste. Ich wollte die Zuhörer erbauen und ihr Interesse wecken.«
»Wahrheit oder Fiktion?«, wiederholte Rience kalt.
»Wenn ich das verriete, würde ich die Wirkung meiner Arbeit zunichtemachen. Leb wohl, Freund. Du hast die ganze Zeit ausgenutzt, die ich dir widmen konnte. Aber dort warten zwei von meinen Inspirationen, im Ungewissen, für welche ich mich entscheiden werde.«
Rience schwieg lange und schickte sich keineswegs zum Gehen an. Er betrachtete den Dichter mit seinem unsympathischen, feuchten Blick, und der Dichter spürte eine wachsende Unruhe. Von unten her, aus dem Gemeinschaftssaal des Bordells, drang ein fröhliches Stimmengewirr herauf, hin und wieder durchsetzt von hohem Damenkichern. Rittersporn wandte den Kopf, wie um hochmütigen Ekel zu demonstrieren, schätzte aber in Wahrheit die Entfernung ab, die ihn von der Zimmerecke und dem Gobelin trennte, der eine Nymphe zeigte, die sich aus einem Krug Wasser über die Brüste rinnen ließ.
»Rittersporn«, ließ sich Rience schließlich vernehmen und steckte eine Hand in die Tasche der sepiabraunen Jacke. »Beantworte meine Fragen, ich bitte sehr. Ich muss die Antwort wissen. Das ist für mich unermesslich wichtig. Und glaube mir, für dich auch, denn wenn du im Guten antwortest …«
»Was dann?«
Auf den dünnen Lippen erschien ein widerwärtiges Grinsen. »Dann werde ich dich nicht zum Reden zwingen müssen.«
»Pass auf, du Galgenstrick.« Rittersporn stand auf und tat so, als mache er eine drohende Miene. »Ich verabscheue Gewalt und Zwang. Aber gleich werde ich Madame Lantieri rufen, und sie wird einen gewissen Klumpner kommen lassen, der in diesem Etablissement die ehren- und verantwortungsvolle Funktion des Rausschmeißers innehat. Das ist ein wahrer Künstler auf seinem Gebiet. Er tritt dich in den Hintern, und schon fliegst du über die Dächer dieser Stadt, so schön, dass die wenigen Passanten um diese Zeit dich für den Pegasus halten.«
Rience machte eine kurze Bewegung mit der Hand, und etwas blitzte darin auf. »Bist du sicher«, fragte er, »dass du noch rufen kannst?«
Rittersporn gedachte nicht herauszufinden, ob er es noch konnte. Auch zu warten gedachte er nicht. Noch ehe das Stilett in Riences Hand wirbelte und klickte, setzte er mit einem langen Sprung in die Zimmerecke, tauchte unter den Wandteppich mit der Nymphe, öffnete mit einem Fußtritt die Geheimtür und stürzte Hals über Kopf die gewundene Treppe hinab, geschickt dem glatt gescheuerten Geländer folgend. Rience setzte ihm nach, doch der Dichter war sich seiner Sache sicher – er kannte den Geheimgang wie seine Westentasche, er hatte ihn so manches Mal auf der Flucht vor Gläubigern benutzt, vor eifersüchtigen Ehemännern und vor gewaltbereiten Konkurrenten, denen er hin und wieder Reime und Noten stahl. Er wusste, dass sich in der dritten Biegung eine Drehtür befand, hinter der eine Leiter in den Keller führte. Er war sich sicher, dass der Verfolger wie viele vor ihm nicht würde bremsen können, sondern weiterlaufen und auf die Falltür treten, worauf er im Schweinestall landen würde. Er war sich sicher, dass der schmerzhaft gefallene, mit Mist beschmierte und von den Schweinen bedrängte Verfolger keine Lust mehr haben würde, die Jagd fortzusetzen.
Rittersporn irrte sich, wie üblich, wenn er sich einer Sache sicher war. Hinter seinem Rücken blitzte plötzlich etwas bläulich auf, und der Dichter spürte, wie ihm ein Krampf durch Hände und Füße lief, dass sie taub und steif wurden. Er schaffte es nicht, vor der Drehtür zu bremsen, die Beine versagten ihm den Dienst. Er schrie auf und stürzte die Treppe hinab, prallte gegen die Wände. Mit trockenem Knacken öffnete sich unter ihm die Falltür, der Troubadour fiel hinab in Dunkelheit und Gestank. Noch ehe er auf dem Boden aufschlug und das Bewusstsein verlor, fiel ihm ein, dass Madame Lantieri etwas von einer Reparatur des Schweinestalls gesagt hatte.
Zu sich kam er vom Schmerz in den gefesselten Händen und in den Armen, die man ihm grausam in den Schultergelenken verdreht hatte. Er wollte schreien, konnte es aber nicht; ihm war, als habe man ihm die Mundhöhle mit Lehm zugeschmiert. Er kniete auf einem Lehmboden, und eine knirschende Leine zog ihn an den Armen in die Höhe. Um den Schmerz in den Armen zu mildern, versuchte er aufzustehen, doch seine Beine waren ebenfalls gefesselt. Atemlos gelang es ihm trotzdem, auf die Füße zu kommen, wobei ihm die Schnur, die ihn gnadenlos nach oben zog, eine große Hilfe war.
Vor ihm stand Rience, und seine bösen, feuchten Augen glänzten im Licht der Laterne, die ein danebenstehender, fast zwei Meter großer, unrasierter Kerl hielt. Ein zweiter Kerl, sicherlich nicht kleiner, stand hinter ihm. Rittersporn hörte ihn atmen und roch den Gestank alten Schweißes. Es war dieser Zweite, Stinkende, der an der Leine zog, die an den Handgelenken des Dichters befestigt war und über einen Balken lief.
Rittersporns Füße lösten sich vom Boden. Der Dichter wimmerte laut durch die Nase, zu etwas anderem war er nicht imstande.
»Genug«, sagte Rience endlich, fast sofort, doch Rittersporn kam es wie eine Ewigkeit vor. Er berührte den Boden, doch niederknien konnte er beim besten Willen nicht – die straffe Leine hielt ihn weiter gespannt wie eine Saite.
Rience trat näher. Sein Gesicht zeigte keinerlei Regung, die tränenden Augen hatten nicht im Mindesten ihren Ausdruck verändert. Auch die Stimme, mit der er sprach, war ruhig, leise, geradezu ein wenig gelangweilt.
»Du lausiger Versschmied. Du Abschaum. Du Stück Dreck. Du eingebildete Null. Mir wolltest du entkommen? Mir ist noch niemand entkommen. Wir sind mit unserem Gespräch noch nicht am Ende, du Witzfigur, du Hornochse. Ich habe dich etwas gefragt, unter weitaus angenehmeren Bedingungen. Jetzt wirst du meine Fragen beantworten, aber unter weitaus weniger angenehmen Umständen. Du wirst doch antworten?«
Rittersporn nickte heftig. Erst jetzt lächelte Rience. Und gab ein Zeichen. Der Barde wimmerte verzweifelt, als er spürte, wie sich die Leine spannte und die nach hinten verdrehten Arme in den Gelenken knirschten.
»Du kannst nicht sprechen«, stellte Rience fest, noch immer mit seinem falschen Lächeln. »Das tut weh, was? Du musst wissen, dass ich dich vorerst zum eigenen Vernügen hochziehe, ich schaue schrecklich gern zu, wie es jemandem wehtut. Na, noch ein bisschen höher.«
Fast wäre Rittersporn an seinem Wimmern erstickt.
»Genug«, befahl Rience schließlich, worauf er an den Dichter herantrat und ihn beim Jabot packte. »Pass auf, Hähnchen. Ich werde jetzt den Bann lösen, damit du reden kannst. Aber wenn du versuchst, deine hübsche Stimme lauter als notwendig zu erheben, wird es dir leidtun.«
Er machte eine Handbewegung, berührte mit seinem Ring die Wange des Dichters, und Rittersporn spürte, wie das Gefühl in Kinnlade, Zunge und Gaumen zurückkehrte.
»Jetzt«, fuhr Rience leise fort, »werde ich dir ein paar Fragen stellen, und du wirst darauf antworten, fließend, rasch und erschöpfend. Wenn du aber auch nur einen Augenblick lang zögerst oder stockst, wenn du mir den geringsten Anlass gibst, an der Wahrheit deiner Worte zu zweifeln … Schau nach unten.«
Rittersporn gehorchte. Entsetzt stellte er fest, dass von den Fesseln um seine Fußgelenke eine kurze Schnur zu einem Eimer führte, der mit Kalk gefüllt war.
»Wenn ich Anweisung gebe, dich höher zu ziehen«, sagte Rience mit grausamem Lächeln, »und zusammen mit dir diesen Eimer, dann wirst du die Hände gewiss nicht mehr gebrauchen können. Ich bezweifle, dass du danach noch imstande sein wirst, die Laute zu spielen. Ich bezweifle es wirklich. Daher nehme ich an, dass du reden wirst. Habe ich recht?«
Rittersporn bestätigte es nicht, weil er vor Angst weder den Kopf bewegen konnte noch ein Wort herausbrachte. Rience machte nicht den Eindruck, dass er auf eine Bestätigung Wert legte.
»Ich, versteht sich«, teilte er mit, »werde sofort wissen, ob du die Wahrheit sagst, ich durchschaue auf der Stelle jede Ausflucht, lasse mich weder von poetischen Kunststückchen noch von verquaster Allgemeinbildung täuschen. Das ist eine Kleinigkeit für mich, wie es eine Kleinigkeit war, dich auf der Treppe zu lähmen. Ich rate dir also, Halunke, wäge jedes Wort. Aber schade um die Zeit, fangen wir an. Wie du weißt, interessiert mich die Heldin einer deiner schönen Balladen, die Enkelin der Königin Calanthe von Cintra. Die Fürstentochter Cirilla, mit Kosenamen Ciri genannt. Nach Augenzeugenberichten ist dieses Persönchen vor zwei Jahren bei der Eroberung der Stadt ums Leben gekommen. In der Ballade hingegen schilderst du anschaulich und rührend ihre Begegnung mit jenem sonderbaren, geradezu legendären Individuum, diesem … Hexer Geralt. Wenn man das poetische Gefasel von der Vorherbestimmung und den Wegen des Schicksals außer Acht lässt, folgt aus der Ballade, dass das Kind den Kampf um Cintra heil überstanden hat. Ist das wahr?«
»Ich weiß nicht …«, ächzte Rittersporn. »Bei den Göttern, ich bin nur ein Dichter! Ich habe dies und jenes gehört, und den Rest …«
»Ja?«
»Den Rest habe ich mir ausgedacht. Ausgesponnen! Ich weiß nichts!«, heulte der Barde auf, als er sah, dass Rience dem Stinkenden ein Zeichen gab, und fühlte, wie sich die Leine straffer spannte. »Ich lüge nicht!«
»Stimmt.« Rience nickte. »Du lügst nicht einfach, das würde ich spüren. Aber irgendwie redest du drum herum. Du hättest dir die Ballade nicht einfach so ausgedacht, ohne Grund. Und diesen Hexer kennst du ja. Du bist wiederholt in seiner Gesellschaft gesehen worden. Also rede, Rittersporn, wenn dir deine Gelenke lieb sind. Alles, was du weißt.«
»Diese Ciri«, presste der Dichter hervor, »war dem Hexer vorherbestimmt. Ein sogenanntes Überraschungskind … Ihr habt sicherlich davon gehört, es ist eine bekannte Geschichte. Ihre Eltern hatten gelobt, sie dem Hexer zu übergeben …«
»Die Eltern sollten das Kind diesem wahnsinnigen Mutanten übergeben? Diesem gedungenen Mörder? Du lügst, Versschmied. Solche Märchen kannst du den Weibern vorsingen.«
»So war es, ich schwöre es bei der Seele meiner Mutter«, schluchzte Rittersporn. »Ich weiß es aus sicherer Quelle … Der Hexer …«
»Red von dem Mädchen. Der Hexer interessiert mich vorerst nicht.«
»Ich weiß nichts über das Mädchen! Ich weiß nur, dass der Hexer nach Cintra geritten ist, um sie zu holen, als der Krieg ausbrach. Ich bin ihm damals begegnet. Von mir hat er von dem Gemetzel erfahren, vom Tod Calanthes … Er hat mich nach dem Kind gefragt, nach der Enkelin der Königin … Aber ich wusste ja, dass in Cintra alle umgekommen waren, dass in der letzten Bastion keine Menschenseele am Leben geblieben war …«
»Rede. Weniger Metaphern. Mehr Tatsachen!«
»Als der Hexer vom Fall Cintras und von dem Gemetzel erfuhr, gab er die Reise auf. Wir flohen beide nach Norden. In Hengfors habe ich mich von ihm getrennt, seither habe ich ihn nicht gesehen … Aber unterwegs hat er ein wenig von dieser … dieser Ciri erzählt … und von der Vorherbestimmung … Also habe ich diese Ballade verfasst. Mehr weiß ich nicht, ich schwör’s!«
Rience schaute ihn unter gesenkten Brauen hervor an. »Und wo ist dieser Hexer gegenwärtig?«, fragte er. »Dieser gedungene Mörder von Ungeheuern, der poetische Schlächter, der sich gern über die Vorherbestimmung auslässt?«
»Ich habe gesagt, dass ich ihn zuletzt …«
»Ich weiß, was du gesagt hast«, fiel ihm Rience ins Wort. »Ich höre aufmerksam zu, was du sagst. Und du hör mir aufmerksam zu. Antworte präzise auf die dir gestellten Fragen. Die Frage lautete wie folgt: Wenn seit über einem Jahr niemand den Hexer Geralt gesehen hat, wo hält er sich verborgen? Wo pflegt er sich verborgen zu halten?«
»Ich weiß nicht, wo das ist«, sagte der Troubadour rasch. »Ich lüge nicht. Ich weiß es wirklich nicht …«
»Zu schnell, Rittersporn, zu schnell.« Rience lächelte böse. »Zu schnell. Du bist schlau, aber unvorsichtig. Du weißt nicht, sagst du, wo das ist. Aber ich wette, du weißt, was es ist.«
Rittersporn biss die Zähne zusammen. Vor Wut und Verzweiflung.
»Na?« Rience gab dem Stinkenden ein Zeichen. »Wo verbirgt sich der Hexer? Wie heißt dieser Ort?«
Der Dichter schwieg. Die Leine straffte sich, verdrehte ihm schmerzhaft die Arme, die Beine lösten sich vom Boden. Rittersporn heulte auf, abgehackt und kurz, denn der Ring des Zauberers knebelte ihn sofort.
»Höher, höher.« Rience stemmte die Arme in die Hüften. »Weißt du, Rittersporn, ich könnte dir magisch das Hirn sondieren, aber das ist anstrengend. Außerdem sehe ich gern zu, wie die Augen vor Schmerz aus den Höhlen treten. Und du wirst es ja doch sagen.«
Rittersporn wusste, dass er es sagen würde. Die an seinen Fußgelenken befestigte Schnur spannte sich, der kalkgefüllte Eimer rutschte knirschend über den Boden.
»Herr«, sagte plötzlich der zweite Kerl, verdeckte die Laterne mit seinem Umhang und spähte durch eine Ritze in der Stalltür. »Da kommt jemand. Anscheinend eins von den Mädchen.«
»Ihr wisst, was ihr zu tun habt«, zischte Rience. »Lösche die Laterne.«