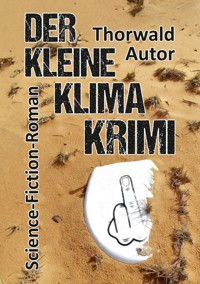4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge vollkommen unerfahrene Zoologe Leonard Fischer wird unverhofft und ungewollt mit einer Doktorarbeit in einem afrikanischen Nationalpark beauftragt. Seine Unterkunft befindet sich in einem paradiesischen Edeltouristencamp und er muss als Gegenleistung als Ranger arbeiten. Die Umstellung von der Theorie am Schreibtisch auf die Praxis im Busch fällt ihm schwer und er stolpert von einem Abenteuer ins nächste. Innerhalb weniger Tage muss er feststellen, dass die reale "Innere Mechanik des Paradieses", vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz mit der Idealvorstellung übereinstimmt. Das Camppersonal ist "ein klein bisschen seltsam". Es folgt im Umgang mit den Touristen bizarren Regeln. Die Regel Nr. 1 lautet nicht "Der König der Tiere ist der Tourist", sondern "Die Touristen suchen das wahre Afrika und es ist unsere wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie es nicht finden!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thorwald Autor
Die innere Mechanik desParadieses
Happy Homo sapiens safariens
Copyright: © 2022 Thorwald Autor
Umschlag & Satz: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de
Titelfoto: EcoPic (www.depositphotos.com)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover
978-3-347-64821-0
Hardcover
978-3-347-64823-4
E-Book
978-3-347-64827-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Gesichtsverlust
Von Ameisen und Löwen
Allein im Paradies
Von Hasen und Igeln
Der Geruch von Abenteuer
Alles ist im Fluss
Pissen oder schießen
Ranger
Rettung
66 % paradise & 66 % adventure
Chief de Campi
Die Innere Mechanik des Paradieses
Hunter
Camp-Rundgang
Jimmy-Joe
Blasrohre
Kugelschreiber
Campi Malari
Unbekannte Schatten
Nachts im Camp
Frühstück
Adventure-Tour Start
Eukalyptus-Vollmantel
Außerhalb des Naturgesetzes
Doppelblindversuch
Am See
Büffelsuche
Hunters Heldenepos
Gefahr für Tourist Nr. 4
buffalo buffalo buffalo …
Löwenangriff
Messezelt
Umzingelt
Shake-Spear
Keine Katzen Keine Elefanten
Im Pool aus Schnäbeln und Krallen
Khaki-Fieber
Mr. Buhari
Panische Flucht
Hunters glasklarer Plan
Gefahr im Dunkeln
Story-Teller
Allein mit Götz
Aberglaube und andere Waffen
Ankunft der Kavallerie
Volltreffer
42:1
Gesichtsverlust
Götz war schon sehr früh unterwegs. Er fuhr den Weg am Fluss entlang. Er musste sich auf den sich durch die Büsche und Bäume schlängelnden Weg konzentrieren, da die beiden Fahrspuren stellenweise kaum mehr zu sehen waren. Außerdem musste man um diese Zeit auf die Nilpferde achten, die nachts zum Grasen den Fluss verließen und dann morgens in den Fluss zurückkehrten – häufig traf man morgens noch auf einige Nachzügler. Das Ziel von Götz war das Touristencamp. Er hatte einige Tage in einem abgelegenen Lager verbracht, um einen seiner Malariaanfälle auszukurieren. Es ging ihm schon wieder besser, aber er war äußerst schlecht gelaunt. Die Malariaanfälle wurden immer häufiger. Sein sowieso schon schlechtes Verhältnis zum Campchef würde sich dadurch nicht verbessern. Er beschloss noch schnell im neu eingerichteten Drohnencamp vorbeizufahren, um zu sehen, wie weit die Arbeiten vorangekommen waren. Zur Wildererbekämpfung sollte nun Hightech eingesetzt werden. Das Drohnencamp bestand aus zwei Technikcontainern und einigen Zelten, die gerade aufgebaut wurden. Götz war noch vom alten Schlag. Er hatte von dem ganzen PC-Kram keine Ahnung. Er hasste das Zeug und das Zeug hasste ihn. Allerdings musste er zugeben, dass manches doch ausgesprochen nützlich war.
Er parkte seinen Land Rover vor den Büschen, die die beiden großen, ca. 2,50 m hohen, nebeneinanderstehenden Container vor den Blicken der Touristen schützten. Die Container waren zugesperrt, es war noch niemand da. Aber das sollte ihm auch recht sein. Heute würde der Computerfuzzi ankommen. Sollte der sich doch um den Kram kümmern.
Er würde noch kurz die Zelte kontrollieren und dann weiterfahren. Er ging um die Container herum und blieb abrupt stehen. An der Seite eines Containers bemerkte er einen schwarzen Fleck, um den herum die Farbe abgeblättert war. Er kannte dieses Muster. So sahen Einschusslöcher in Fahrzeugen aus, wenn Wilderer auf sie geschossen hatten. Die Wilderer waren besser vernetzt als viele glaubten und hatten mitbekommen, dass nun moderne Technik gegen sie eingesetzt werden sollte. Eine genauere Inspektion ergab, dass der Schuss durch beide Container hindurchging. Das Einschussloch im zweiten Container war genauso groß wie im ersten. Die Kugel hatte sich im ersten Container nicht aufgepilzt oder war ins Trudeln gekommen. In Verbindung mit dem relativ großen Einschussloch konnte das nur bedeuten, dass es sich um ein großkalibriges Vollmantelgeschoss handelte. Das war ungewöhnlich, denn diese Patronen waren teuer, nur schwer zu beschaffen und kostbar für Wilderer. Damit konnte man Elefantenbullen so schießen, dass sie an Ort und Stelle zusammenbrachen, was mit einer Kalaschnikow in der Regel nicht klappte. Mit einer Kalaschnikow beschossene Elefanten lebten z.T. noch Stunden, manche auch Tage. Sie liefen weg und das Elfenbein ging den Wilderern verloren.
Es wäre einfacher gewesen, mit einer Kalaschnikow auf die Container zu feuern. Oder noch einfacher: Die Container mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Das hätte aber nicht viel genützt, denn die wertvollen Geräte waren alle noch im Hauptcamp. Außerdem befand sich das erste Einschussloch auf einer Höhe von fast zwei Meter. Zu hoch um Schaden anzurichten.
Götz konnte sich keinen Reim darauf machen. Der Schütze stand wahrscheinlich einige Meter neben dem Zelt und die Kugel musste auch das Zelt durchschlagen haben. Nach kurzer Suche sah er das Ausschussloch aus dem Zelt. Er ging um das Zelt herum. Auf der Rückseite des Zeltes bemerkte er etwas Eigenartiges. Im Sand sah er die Abdrücke von zwei Händen und darüber den Abdruck einer Hyäne und eines Büffels. Hyänen kamen hier häufig vor. Sie besuchten nachts auch gerne die Camps auf der Suche nach Essbarem. Meist waren sie harmlos. Mit Büffeln dagegen war nicht zu spaßen. Auch wenn sie bei weitem nicht so gefährlich waren wie die Touristen immer glaubten. Er ging weiter um das Zelt herum. Er konnte kein Einschussloch entdecken.
Was war hier passiert? Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen, als er sich der Vorderseite des Zeltes näherte. Eine deutlich sichtbare Blutspur war dort auf dem Boden zu sehen. Jemand, der stark geblutet hatte, hatte das Zelt verlassen. Blutige Schuhabdrücke führten aus dem Zelt. Ein Unterhemd voller Blut lag auf dem Boden. Nach einigen Metern wurde die Blutspur dünner und ging dann über in regelmäßige Blutstropfen. Deutlich war der Schuhabdruck zu sehen. Ein Schuhabdruck, der nicht vom Camp-Personal stammte, denn die Schuhe des Camp-Personals wurden alle vom Camp gestellt und hatten ein einheitliches Profil. Damit konnte man sofort anhand des Fußabdrucks das Camp-Personal von den Wilderern und sonstigen ungebetenen Gästen unterscheiden.
Vorsichtig betrat Götz das Zelt. Es roch stark nach Urin. Auf dem Bett war ein breiter blutiger Abdruck erkennbar. Auf dem Boden lag eine Patronenhülse. Er hob sie auf. Es war eine .458 Winchester Magnum. Das Kaliber, das auch die Ranger benutzten. Auf der Rückseite des Zeltes hatte anscheinend ein Kampf stattgefunden. Am Boden befand sich ein umgeworfenes Tischchen und eine große Pfütze aus Blut und, dem Geruch nach zu schließen, Urin. Das war eigentlich ein Indikator für einen erfolgreichen Angriff eines Löwen oder eines Leoparden. Die Blase des Opfers entleerte sich in diesen Fällen. Das konnte allerdings nicht zutreffen, denn es fehlten Schleifspuren. Das Opfer war zwar anscheinend schwer verletzt, war aber noch selbst aus dem Zelt gegangen und nicht hinausgeschleift worden.
Das deutete eher auf einen Hyänenangriff hin. Hyänen bissen manchmal Schlafenden ins Gesicht beziehungsweise zogen ihnen mit einem Biss das Gesicht ab und verschwanden mit diesem. In Afrika sein Gesicht zu verlieren war weit tragischer als in anderen Ländern. Ein Hyänenangriff würde die große Blutlache erklären. Wenn das Opfer mit einem Handtuch oder etwas ähnlichem seine Wunde bedeckt hatte, würde zumindest für eine Weile wenig Blut auf den Boden tropfen und das Opfer war durchaus noch in der Lage, selbst zu gehen. Götz streifte mit einem Finger durch die Flüssigkeit am Boden. Das Blut war noch nicht gestockt. Was immer hier passiert war, es war erst vor kurzem passiert.
Götz untersuchte den Bereich vor dem Zelt. Er musste nicht lange suchen. Deutlich zeichnete sich der Abdruck einer Hyänenpfote im Sand ab. Wahrscheinlich handelte es sich bei der verletzten Person um den Computerspezialisten. Anscheinend war er schon einen Tag früher gekommen.
Die Spur verlief zwischen einigen Büschen vor zum Fluss, der nicht weit vom Zelt weg war, dann wieder zurück zum Pfad, der zu einem Beobachtungsturm für die Touristen führte. Gut sichtbar folgte die Spur dem Pfad, nach 20 m bog sie allerdings wieder zum Fluss ab, nur um kurz darauf wieder zum Pfad zurückzukehren. Anscheinend benötigte der Verletzte Wasser. Götz dachte an die Krokodile. Es war keine gute Idee, sich verletzt und wahrscheinlich mit stark eingeschränkter Sicht dem Wasser zu nähern.
Götz folgte der deutlich sichtbaren Spur auf dem Pfad mit dem Auto. Wahrscheinlich musste er den Verletzten so schnell es ging zum Hauptcamp bringen und dann würde man ihn mit dem Flugzeug ins Krankenhaus fliegen.
Nach dem nächsten Abbiegen in Richtung Fluss gab es keine Spur mehr zurück. Götz stieg aus und folgte den immer noch regelmäßigen Blutstropfen zum Fluss. An der Kante zum Fluss, der einige Meter tiefer lag, sah er etwas Rotes im Gras liegen. Es war ein blutverschmiertes Gewehr.
Götz blieb einige Meter vor dem Gewehr stehen. Es war leicht zu erkennen, was passiert war. Hier war jemand abgestürzt und hatte ein großes Loch im Hang hinterlassen. Die Ufer wurden jedes Jahr in der Regenzeit massiv unterspült. Alle wussten, dass man sich der Kante nicht nähern durfte. Vor allem, weil man nach einem Absturz nicht mehr einfach hochkam. Das war in Verbindung mit den Krokodilen eine ungünstige Konstellation. Götz ging in die Knie und kroch vorsichtig vor bis zum Loch, das nun in der Kante war. Es ging steil nach unten und unten war nur lehmiges Wasser. Von der abgestürzten Person war nichts zu sehen. Er rief, aber niemand antwortete. Mit einem Ast zog Götz das Gewehr zu sich heran. Dann lief er zurück zum Wagen. Wer immer da hineingestürzt war, hatte sich mittlerweile wahrscheinlich schon auf mehrere Krokodile verteilt. Vielleicht lebte er aber auch noch. Götz drückte auf die Hupe, dreimal. Dann lauschte er.
Von Ameisen und Löwen
Leonard Fischer wusste genau, dass er nicht wusste, was das alles sollte. Nachdem sich schon im Kindergarten herausgestellt hatte, dass er nicht dumm war, schickten ihn seine Eltern dummerweise auf ein Gymnasium, damit aus ihm mal etwas Ordentliches wird. Vielleicht ein schlauer Rechtsanwalt oder ein erfolgreicher Ingenieur. Etwas in dieser Richtung. Leonard widersprach nicht. Diese Richtung war genauso gut oder schlecht wie jede andere. Irgendetwas musste er tun, warum also nicht aufs Gymnasium gehen. Bildung war wichtig. Das hatte er schon im Kindergarten begriffen und sich das Lesen selbst beigebracht, um die vielen interessanten Comic-Hefte verschlingen zu können. Leider war damit die Anwendbarkeit der Bildung bereits zum großen Teil ausgereizt. Leonard und sein bester Freund Robert, der ein nahezu identisches Leistungsprofil besaß, hatten sich bis zum Abitur durchgeschlagen und obwohl es ihnen nicht gefiel, verweilten sie sogar ein Jahr länger auf dem Gymnasium als unbedingt nötig gewesen wäre. Aber das zusätzliche Jahr hatte sich anscheinend ausgezahlt. Seine Eltern waren hocherfreut. Die höhere Bildung schien sein Denken verändert zu haben. Der Junge wusste endlich was er wollte. Er würde Biologie studieren! Nichts anderes kam in Frage.
Leonard sagte ihnen nicht, warum es unbedingt Biologie sein musste. Sein Freund Robert und er hatten, nach einigen bewusstseinserweiternden Getränken, die spontane Idee, die Zukunft hier und jetzt und selbst in die Hand zu nehmen. Sie schrieben eine Auswahl aus den Fächern, die ihnen spontan so einfielen, auf Zettel und zogen ein Los. Auf den Zetteln stand u.a. Jura, BWL, Germanistik und Geschichte. Biologie war nicht dabei. Die Wahl fiel auf Germanistik. Damit war die Angelegenheit endgültig entschieden und sie feierten dies entsprechend. An diesem Abend lernte sein Freund Robert allerdings seine neue Flamme Christine kennen. Sie hatte vor, Biologie zu studieren und weigerte sich beharrlich, auf Germanistik umzusteigen. So wurde aus Germanistik kurzerhand Biologie. Auch für Leonard.
Nach dem Bachelorstudium entschied sich Leonard für ein Masterstudium in Zoologie. Diesmal ohne seinen Freund Robert, der zwischendurch einer neuen Flamme in ein BWL-Studium gefolgt war. Das wunderte Leonard nicht. Denn eines hatte er im Bachelorstudium gelernt: Die Gehirne männlicher Säugetiere folgten ziemlich einfachen Grundmustern. Da er nicht dumm war, wusste er das schon vorher. Bei gewissen Szenen im Fernseher hatte Leonard eine bestimmte Vermutung, auf welche Stelle auf dem Bildschirm 99 % + X der männlichen Zuschauer gerade blickten. Neu im Studium war, dass man diese einfachen Sachverhalte mit einer Unzahl von Fachausdrücken erklärte beziehungsweise verschleierte.
Zoologie interessierte Leonard genauso wenig wie Biologie. Aber irgendetwas musste man ja tun. Da er jede Art von körperlicher Arbeit hasste, kam diese nicht infrage. Leider hasste er auch jede Art von geistiger Arbeit. Eine Kombination, die seine Zukunftsaussichten etwas eintrübte.
Was Ameisenlöwen so trieben, musste er erst einmal nachschlagen. Aber Prof. Glaser hatte eine Masterarbeit über Ameisenlöwen im Angebot. Eine Masterarbeit, die wenig Aufwand versprach. Leonard wurde hellhörig und er fragte bei der Sekretärin um einen Termin nach. Nachdem er die Sekretärin ausgiebig betrachtet hatte (also circa eine Zehntelsekunde lang), sagte ihm sein Gefühl, dass Ameisenlöwen eine gute Wahl waren. Als ihn die Sekretärin auch noch freundlich anlächelte, war es entschieden. Also Ameisenlöwen.
Prof. Glaser beschäftigte sich unter anderem mit Insekten. Vor allem afrikanischen Insekten, die sich irgendwo in der Nähe von Löwen oder Leoparden herumtrieben. Es gab keine einzige Vorlesung, in der er nicht vom Thema abkam und eine Anekdote aus Afrika erzählte. Er begann immer mit „Hatte ich schon erwähnt, dass ich in Afrika war?“ An den Geschichten, die dann folgten, hätte der Lügenbaron Münchhausen sicher seine Freude gehabt. Aber es war stets sehr unterhaltsam.
Die Masterarbeit verlief einigermaßen ruhig und war mit erfreulich wenig Aufwand verbunden. Leonard verbrachte einen Großteil seiner Zeit damit, mit den Personen, die in seinem Fokus standen und das waren Personen mit einem XX-Chromosomensatz, herumzuschäkern. Das Ergebnis der Masterarbeit war überraschenderweise trotzdem nicht schlecht. Deshalb wurde ihm eine entsprechende Doktorarbeit angeboten. Das sich anschließende kontemplative Dasein als Doktorand nahm allerdings schon einige Wochen später ein tragisches Ende. Nach einer kleinen Institutsfeier, die er nicht ganz nüchtern verließ, hatte er dummerweise den Thermostat, der seine Tierchen bei ihrer Lieblingstemperatur hielt, in die falsche Richtung gedreht. Das wars. Für die Tierchen und für ihn. Am nächsten Tag musste er beim Professor antreten. Zaghaft klopfte er an die Tür.
Prof. Glaser, ein vollschlanker Mann um die 50 mit Brille, saß an seinem Schreibtisch, links und rechts eingerahmt von Akten, umgeben von vielen Bildern an den Wänden mit afrikanischen Motiven und hatte sich in ein Schriftstück vertieft. Während er weiterlas, sah er kurz auf und deutete auf einen Stuhl. Dann legte er das Schreiben weg, räusperte sich kurz und sah Leonard ernst an. Vor ihm saß ein 23 Jahre alter, schwarzhaariger, schlanker, knapp 1,80 Meter großer Durchschnittstyp, dem man ansah, dass er nur wenig Zeit im Freien verbrachte.
»Tja, Herr Fischer, ich habe von Ihrem bedauerlichen Fehler gehört. Nicht nur bedauerlich für Sie, sondern auch bedauerlich für unser Institut. Ich gehe davon aus, dass Ihnen klar ist, dass sich damit Ihre Doktorarbeit erledigt hat.«
»Ich…ich…es tut mir leid, dass mir das passiert ist«, brachte DoDo mühsam heraus. Es tat ihm wirklich leid, dass er seinen Professor so enttäuscht hatte, denn Prof. Glaser war stets freundlich und fast immer gutgelaunt. Leonard mochte ihn. Er würde das Donnerwetter, das sich gerade über ihm zusammenbraute, über sich ergehen lassen und dann abtauchen. Wohin auch immer. Irgendwie würde es schon weitergehen. Eine Karriere als Taxifahrer war doch auch nicht zu verachten.
Es folgte, wie erwartet, eine ordentliche verbale Abreibung. Leonard machte das, was er in diesen Fällen immer machte: Er sah auf den Boden, ließ im Kopf eines seiner Lieblingslieder laufen und versuchte möglichst wenig auf die Worte von Prof. Glaser zu achten.
»Also DoDo, was sagen Sie dazu?«
Leonard sah überrascht auf und sah in das gespannte Gesicht von Prof. Glaser. Er hatte gar nicht mehr auf die Worte des Professors geachtet. Hatte er wirklich DoDo gesagt? Diesen Spitznamen hatte man ihm verpasst, als er mit seiner Doktorarbeit begonnen hatte. Damit wurde sein Leistungsprofil, das normalerweise immer eine Handbreit unter dem Minimum lag, treffend charakterisiert. DoDo stand für „Doktor Do-Little“. Do-Little mit Bindestrich! Und Prof. Glaser hatte das anscheinend mitbekommen. Wie peinlich!
»Ich…ähm…ich…ah… Könnten Sie bitte den letzten Teil wiederholen?«
»Kann ich gerne. Es überrascht mich, dass Sie so erstaunt sind, dass ich Ihren neuen Spitznamen kenne. Schließlich ist das mein Institut und ich sollte eigentlich über die Dinge Bescheid wissen. Aber kommen wir zum Thema zurück. Ich biete Ihnen eine neue Doktorarbeit an. Allerdings hat das Ganze einen kleinen Haken: Sie müssten zeitnah anfangen. Das Thema ist zwar ein wenig anders, als das, was Sie bis jetzt gemacht haben, aber … nun ja doch irgendwie ähnlich. Nur ohne Ameisen.«
Leonard schnappte gierig nach dem Strohhalm »Und was genau würde das Thema sein?«
Prof. Glaser stand auf und fing an, hinter seinem Schreibtisch hin und her zu gehen.
»Hatte ich schon erwähnt, dass ich in Afrika war? Ich denke ja. Was ich allerdings noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich dorthin gute Kontakte habe. Der Leiter eines Touristencamps hat mich erst vor kurzem gefragt, ob ich jemand wüsste, der gerne eine Doktorarbeit in Afrika machen würde. Das wäre doch etwas für Sie!«
»Ja…ich…ich weiß nicht. Ich – was genau wäre denn das Thema?«
»Das Übliche. Einige Löwen werden mit Sendern versehen. Der Nationalpark grenzt an landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Da sind Konflikte mit den Löwen nicht selten. Die Wirksamkeit einiger neuer Methoden zur Minimierung der Konflikte mit den Löwen soll getestet werden, in Ihrem Fall speziell der Einsatz von Drohnen.
Natürlich ist mir bewusst, dass die Feldforschung in Afrika der Traum jedes Zoologen ist. Leider muss ich an dieser Stelle etwas Wasser in den Wein gießen. Die Feldarbeit wird fast vollständig vom Personal des Camps erledigt werden. Ihre Aufgabe wäre in erster Linie, die Daten zu erfassen und wissenschaftlich auszuwerten.
Die Verwendung der Drohnen wird von einem Spezialisten geleitet, denn sie werden auch noch anderweitig eingesetzt. Natürlich muss noch die Feinabstimmung zwischen Löwen, Drohnen und der Software erfolgen. Aber im Wesentlichen geht es nur um die wissenschaftlich korrekte Erfassung der Daten und deren Auswertung. Spannende Aufenthalte in der Wildnis sind zwar dabei, werden jedoch eher selten sein. Die meiste Zeit müssten Sie leider im Touristencamp verbringen.
Und wie bei Doktorarbeiten üblich, stehen auch einige Arbeiten im Umfeld an. Sie müssen sporadisch mit einigen Touristen durch den Nationalpark fahren. Und als Löwenexperte die anstehenden Fragen zu den Löwen beantworten. Sie bekommen eine entsprechende Ausbildung und eine kostenlose schmucke Uniform. Also was sagen Sie?«
Der Kloß, der sich in Leonards Hals bei der Aussicht auf afrikanische Wildnis pur, umgeben von Moskitos, Schlangen und Skorpionen und gejagt von konfliktfreudigen Löwen, schlagartig gebildet hatte, löste sich wieder. Er sah sich in einem Jeep, vollgepackt mit hübschen Touristinnen, durch einen Nationalpark gondeln. Eine ruhige und entspannte Zeit an den Futtertöpfen des Touristencamps würde auf ihn zukommen. Und die nächtlichen Abenteuer würden sich auf die Touristinnen beschränken. Den Spaß mit den Löwen würde er gerne anderen überlassen. Nur ein einziger kleiner Punkt störte ihn noch etwas:
»Herr Professor, ich habe keine Ahnung von Löwen.«
»Das ist nicht so schlimm. Sie hatten zwar die eine oder andere Vorlesung zu diesem Themenbereich, aber ich nehme an, das meiste haben Sie wieder vergessen. Mit dem Wenigen, das Sie von den Vorlesungen noch wissen, liegen Sie wahrscheinlich nur knapp über dem Touristenniveau. Das lässt sich aber schnell ändern. Ich habe Ihnen einige Fachbücher zusammengestellt, die Sie unbedingt lesen sollten. Und sie werden vor Ort natürlich entsprechend eingewiesen. Vor allem aber werden Sie dort einige Geschichten erfahren, die so nicht in den Fachbüchern stehen. In ein paar Tagen sind Sie ein Löwenexperte dritter Klasse. Die Touristen werden Sie dann von einem echten Experten nicht mehr unterscheiden können. Und denken Sie an die Schimpansen-Expertin Dr. Jane Goodall. Sie war Sekretärin. Oder an die Gorillaforscherin Dian Fossey. Sie war Bewegungstherapeutin. Am meisten lernt man durch „learning by doing“. Es ist Zeit, die Theorie zu verlassen und sich mit ein wenig Praxis zu beschmutzen. Oder, wie Goethe sagte: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,/Und grün des Lebens goldner Baum“.«
Prof. Glaser machte eine kleine Pause. Dann fuhr er fort:
»Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Meine Sekretärin wird Ihnen eine Mappe mit den wichtigsten Informationen mitgeben. Die Mappe sollten Sie aufmerksam durchlesen. Erst dann geben Sie mir Bescheid. Sagen wir in einer Stunde?«
»In einer Stunde?«
»Ja, es eilt ein wenig. Sie müssen noch etwas Equipment mitnehmen, das vor Ort dringend gebraucht wird. Einige kleine Geräte, die im Handgepäck Platz haben. Um 8:00 Uhr geht Ihr Flug.«
»Was denn? Schon morgen? Ich, ich muss sicher noch einige Dinge erledigen!«
»Nein, nicht morgen, heute Abend!«
Nachdem DoDo mit den Unterlagen verschwunden war, ging Prof. Glaser zu Frau Lang, seiner Sekretärin. Frau Lang sah ihn vorwurfsvoll an.
»Herr Professor ich fürchte fast, dass Sie diesmal den Bogen überspannt haben. Glauben Sie er lässt sich darauf ein? Das ist doch alles sehr kurzfristig. Und außerdem haben Sie ihn in Ihrem Schreiben an das Camp als Zoologen mit Löwenerfahrung angekündigt. Die merken das doch, dass der keine Ahnung hat und das gibt bestimmt Ärger.«
Prof. Glaser wackelte verneinend mit dem Zeigefinger.
»Das stimmt so nicht Frau Lang, denn er hat ja Erfahrungen mit „Löwen“. Und es gibt immer Ärger, oft allerdings dort, wo man ihn nicht erwartet. Ich habe schon viele Studenten erfolgreich ausgewildert, ich halte es für einen Fehler, sie mit zu vielen Details zu belasten. Im echten Leben genügt es oft, einen kleinen Vorsprung zu haben, man muss kein 110 %-tiger Experte sein. Kennen Sie die Geschichte mit den Wanderern und dem Löwen?«
Frau Lang schüttelte den Kopf.
»Zwei Wanderer übernachten in Afrika. Als sie bemerken, wie sich ein Löwe anschleicht, greift einer von ihnen vorsichtig zu seinen Turnschuhen und zieht sie an.
»Du glaubst doch wohl nicht, dass du mit deinen dämlichen Schuhen schneller als der Löwe bist?« raunt ihm der andere leise zu.
»Nein, aber schneller als du!«
Prof. Glaser lachte. »Eine Geschichte wie aus dem echten Leben. Außerdem ist es meine Aufgabe, die Arbeit vor Ort zu kontrollieren. Das Camp hat mir schon bei meinem letzten Besuch ausnehmend gut gefallen. Glauben Sie wirklich ich lasse mir das entgehen, weil sie DoDo rauswerfen? Die Dinge sind eventuell nicht so wie sie zu sein scheinen. Ich habe eine Sicherung für unseren fleißigen Studenten eingebaut. Jemand wird sich um ihn kümmern.«
Nach diesen Worten schritt Prof. Glaser wieder in sein Zimmer. Im Türrahmen drehte er sich um.
»Es ist mir natürlich nicht entgangen, Frau Lang, dass DoDo bei den Kollegen und insbesondere bei den Kolleginnen sehr beliebt ist, er ist ein sympathischer Bursche. Das wird ihm auch in Afrika über einige Hürden hinweghelfen.«
Allein im Paradies
DoDo war mitten im Paradies. Und er musste es mit niemandem teilen, denn er war weit und breit der Einzige. Die Zeit der Angst war nun vorbei. Die Angst war der einsetzenden Panik gewichen.
Ängstlich blickte er aus seinem Zelt durch eine kleine fensterartige Öffnung mit Moskitonetz nach draußen. Ansonsten war das Zelt vorne und hinten sehr sorgfältig verschlossen.
DoDo schluckte bei dem Gedanken, an die kommende Nacht in diesem Camp oder was immer das hier darstellen sollte. Das hier bestand lediglich aus einem einzigen Zelt und zwei großen Containern mit technischem Zeug, in denen einige Techniker bei seiner Ankunft gearbeitet hatten. Eigentlich hatte er erwartet im Touristencamp untergebracht zu werden. Stattdessen hatte man ihn ohne jede Erklärung hier abgesetzt. Die Umgebung war durchaus idyllisch, denn das hier lag an einem Fluss, in dem es vor Flusspferden nur so wimmelte. Eigentlich war es genauso, wie Afrika immer im Fernsehen gezeigt wurde. Hier war die Natur nicht nur natürlich, sondern sogar fernsehtauglich – die Welt war hier offensichtlich noch in Ordnung. Zumindest wenn man sie von der Couch aus im Fernseher betrachtete. Ein kleines Stück Paradies mit einer Diagonale von einigen Zoll, je nach Größe des Bildschirms. DoDo hatte das beunruhigende Gefühl, recht viel mehr Paradies würde es hier vor Ort auch nicht werden.
Die Einrichtung des Zeltes war spartanisch. Sie bestand aus einem Bett auf der rechten Seite, einem langen schmalen Tisch auf der linken Seite, auf der Rückseite links befanden sich zwei große übereinander gestapelten Aluminiumboxen sowie ein Tischchen rechts, davor ein Plastikstuhl. Der Boden bestand aus einer dicken Plastikfolie. An der Kopfseite des Bettes im hinteren Zeltbereich stand ein Gerät, das so gut zum Paradies passte wie Rotz auf eine Türklinke. Mit einer Schlaufe über dem Lauf am Bett fixiert, stand dort ein Gewehr. Das sah nicht mehr nach Fernsehafrika aus. Irgendetwas sagte DoDo, dass das keine Deko-Waffe war. Dies löste bei ihm unerfreuliche Assoziationen aus, die er gleich wieder verdrängte. DoDo klammerte sich lieber an das, was er gelernt beziehungsweise gelesen hatte und woran er bis vor kurzem noch fest glaubte: Wie jedermann in vielen Büchern nachlesen konnte, waren die Tiere harmlos, um nicht zu sagen wohlwollend, sofern man einige einfache Regeln beachtete, die ihm momentan leider nicht alle einfielen.
In der Nähe, nur circa 200 Meter flussabwärts, stand ein kleiner Turm aus Holz am Fluss, zu dem ein schmaler Pfad führte. Nach seiner Ankunft deponierte DoDo erst mal sein Gepäck im Zelt. Da sich niemand um ihn kümmerte, beschloss er, sich ein wenig umzusehen. Er schnappte sich sein Fernglas und marschierte zum Turm. Er war etwa drei Meter hoch und eine schöne breite Treppe führte nach oben. Das war sicher nicht für die Feldbeobachtung gedacht, sondern für die Touristen. Davor war, an den vielen Reifenspuren erkennbar, ein kleiner sandiger Parkplatz. Der Turm war ein klares Indiz, dass sich hier nicht nur viele Tiere, sondern auch viele Touristen tummelten. Am Fuß der Treppe lag ein verdächtiges längliches Etwas. DoDo war kein Freund von Schlangen. Langsam näherte er sich. Zu seiner Beruhigung entpuppte sich das Etwas bei näherer Betrachtung als Ast.
Von oben hatte man einen herrlichen Überblick über die Flusslandschaft. Exotische Vögel bevölkerten die Luft und das Wasser. Krokodile lagen am Ufer und sonnten sich. Es gab sie in allen Größen. Die meisten waren so groß, dass man mit ihnen auf keinen Fall das Wasser teilen wollte. Plötzlich hörte er das Trompeten von Elefanten und bald darauf tauchten die ersten auf seiner Seite des Flusses, etwa 100 Meter flussabwärts, auf. Das Flussufer auf dieser Flussseite fiel wahrscheinlich steil ab, denn er konnte nur die Kante sehen, aber anscheinend gab es dort eine Furt. Es handelte sich um einige Elefantenkühe mit Jungen. Sie verweilten kurz am Fluss und durchquerten ihn anschließend. Kaum waren die ersten auf der anderen Seite, da tauchten schon die nächsten auf. Mittlerweile war die Sonne am Untergehen. Zum Schluss kam noch ein riesiger Elefantenbulle, der sich langsam, immer ein wenig äsend, dem Fluss näherte. DoDo beschloss, sich die Flussüberquerung des Bullen noch anzusehen und dann zurückzugehen, da es allmählich dunkel wurde. Trotz des schwindenden Lichtes konnte DoDo in seinem Fernglas noch die Stoßzähne erkennen. Sie waren nicht makellos weiß, sondern sahen etwas verschmutzt aus.
Als der Bulle in den Büschen am anderen Flussufer verschwand, war es nicht nur Zeit für den Rückweg, es war auf einmal auch stockdunkel. Mist! Daran hatte er nicht gedacht. Dabei hatte er schon mal irgendwo gelesen, dass die Dämmerungsphase in den Tropen überraschend kurz ist. Und jetzt, da er den Pfad zum Camp oben vom Turm aus nur mehr schemenhaft erkennen konnte, musste er unwillkürlich an die Geschichten seines Professors denken. In diesen Geschichten gab es eine verdächtig hohe Dichte von gefährlichen Tieren wie Schlangen, Löwen, Leoparden, Büffeln und, was nun nicht unerheblich war, Flusspferden. Der Professor konnte sich anscheinend wider Erwarten all diesen Widrigkeiten entziehen. Selbstverständlich glaubte ihm die Geschichten niemand. Sie waren allerdings eine stets willkommene Auflockerung in seinen Vorlesungen, wenn auch die eine Hälfte frei erfunden und die andere Hälfte einfach falsch war. Zumindest blieben anhand der Geschichten einige Fakten im Gedächtnis hängen.
Flusspferde verlassen nach Sonnenuntergang das Wasser um zu grasen. Sie entfernen sich dabei manchmal sehr weit vom Fluss. Und reagieren allergisch, wenn man zwischen sie und den Fluss gerät. Die meisten Menschen, die in Afrika von großen Tieren umgebracht wurden, waren Flusspferden in die Quere gekommen. Das Flussufer auf dieser Seite war zwar eventuell zu steil für die Flusspferde, aber wahrscheinlich gab es noch weitere Durchlässe, wie den, den die Elefanten nutzten.
Links vom Pfad, auf der Seite, die vom Fluss wegführte, standen viele Büsche. Sie waren nun in der Dunkelheit nur noch undeutlich erkennbar. Bei diesem schlechten Licht könnte man ein Nilpferd leicht mit einem Busch verwechseln. Mit dem Fernglas konnte er, zumindest bei den Büschen in der Nähe, noch erkennen, dass es sich um Büsche und nicht um Flusspferde handelte.
Ein weiteres Detail drängte sich in DoDos Bewusstsein. Die meisten Schlangen fliehen, wenn man sich ihnen nähert. Die Puffottern bleiben allerdings einfach liegen. Sie warten, bis man auf sie tritt und dann beißen sie zu. Dummerweise gehörten Puffottern zu den Schlangen, die es hier häufig gab. Eine Taschenlampe oder zumindest ein Handy, wären nun Gold wert. In der Hast vor seiner Abreise hatte er nur sein Handy eingepackt und das befand sich jetzt irgendwo in der Tasche im Zelt.
Er überlegte, ob er um Hilfe rufen sollte. Aber konnte er sich das leisten? Schließlich war er Zoologe. Ein Zoologe, der um Hilfe rief, weil er in der Wildnis ist, wäre wie ein Arzt, der um Hilfe ruft, wenn er Blut sieht. Er würde sein Gesicht verlieren. Das kam nicht in Frage! Hierbleiben konnte er aber auch nicht. Die breite Treppe würde die Fleischfresser nicht davon abhalten, ihm einen Besuch abzustatten. In vielen schlauen Büchern stand zwar, dass der Mensch nur in Ausnahmefällen zur Beute wird. Leider musste er feststellen, dass sich sein Gehirn seit einsetzen der Dunkelheit konsequent weigerte, geschriebene Wahrheiten rückhaltlos anzuerkennen.
Langsam wich die Angst der Panik. Es war Zeit zu handeln.
Ein lauter Hilferuf schallte mehrmals durch das Paradies. Aber vom Camp kam kein rettendes Licht, das sich in seine Richtung bewegte. Er konnte von hier aus nicht einmal die Lichter im Camp sehen. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste sich alleine und im Dunkeln auf den Weg machen. Langsam tastete er sich auf dem schmalen Pfad entlang. Der Pfad war anscheinend so häufig benutzt worden, dass in der Mitte der sandige Boden sichtbar wurde. Den hellen Sand konnte er in der Dunkelheit schwach erkennen. Eine kleine technische Maßnahme minimierte die Gefahr eines Schlangenbisses. DoDo hatte den Ast, der am Fuß der Treppe lag, aufgehoben und klopfte damit regelmäßig auf den Pfad. Das sollte auch die trägste Puffotter verscheuchen.
Das Herz schlug schnell und die Knie waren weich. Die dummen Büsche sahen aus wie Nilpferde. Sofern sich das Tier nicht bewegte, weil es aufmerksam dem rhythmischen Schlaggeräusch lauschte, das dieser seltsame und näherkommende Schatten auf dem Pfad von sich gab, konnte DoDo ein Nilpferd erst auf ein paar Meter von einem Busch unterscheiden.
Es war besser leise zu sein. DoDo richtete seine Aufmerksamkeit deshalb weg von den Puffottern hin zu den Nilpferden und unterließ das Schlagen auf den Pfad. Immer wieder blieb er stehen und lauschte. Vielleicht konnte er sie fressen hören? Als es noch hell war, war ihm die Entfernung zum Turm kurz vorgekommen, jetzt zog sich der Weg in die Länge. Jeden Augenblick musste er die Lichter des Camps sehen. Oder war er etwa in der Dunkelheit vom ursprünglichen Pfad abgekommen? Zwei große Schatten zeichneten sich in der Dunkelheit ab. Elefanten? Ängstlich hob DoDo sein Fernglas. Ein tiefer Schreck durchfuhr ihn, als er erkannte, was es war und was das für ihn bedeutete. Das waren keine Elefanten, das waren die beiden Container! Eigentlich hatte er jetzt Stimmen und Licht erwartet. Stattdessen war alles ruhig und dunkel. Der kleine Lkw der Techniker war nicht mehr da. Er wagte es nicht, in der Dunkelheit zwischen den Containern durchzugehen um zu kontrollieren, ob die Türen der Container, die sich auf der anderen Seite befanden, verschlossen waren und wirklich niemand da war. Stattdessen ging er zu der ihm zugewandten Seite und klopfte auf einen der Container. Aber nichts rührte sich. Das hohle Geräusch passte nicht hierher. Es schien die Wildnis zu stören. Er musste sich überwinden, um noch einmal zu klopfen, dieses Mal energischer. Aber nichts und niemand regte sich. Das konnte nur bedeuten, dass er alleine im Camp war. Alleine und umgeben von erschreckend viel Dunkelheit, erschreckend viel Afrika und erschreckend wenig Paradies.
Für einen Moment blieb er wie erstarrt stehen, weiter hoffend, dass er Stimmen hörte. Aber da war nichts. Er war allein und würde es bis morgen bleiben. Er hatte keine Lust die Nacht ungeschützt im Zelt zu verbringen. Dann schon lieber in einem der Container. Eilig legte er die kurze restliche Strecke zum Zelt zurück. Er brauchte Licht.
Die Vorderseite des Zeltes stand weit offen. DoDo stoppte. Die Vorstellung, im Dunklen in das dunkle Zelt zu gehen, ängstige ihn. Wer wusste schon, was in der Zwischenzeit schon alles hineingekrochen war? Mit Hilfe seines Fernglases versuchte er etwas zu erkennen. Aber er sah wenig. Was sollte er jetzt tun? Ein brechender Ast in den Büschen hinter dem Zelt ließ ihn zusammenzucken und motivierte ihn enorm. DoDo ging rasch in das Zelt und zog hastig seine Reisetasche hinaus ins Freie. Nervös wühlte er in der Tasche herum. Endlich konnte er sein Handy ertasten und schaltete die Lampe ein. Zuerst leuchtete er einmal in die Runde. Zu seiner Beruhigung konnte er keine strahlenden Augenpaare entdecken, die ihn anstarrten. Dann machte er sich auf den Weg zur Rückseite der Container. Zwischen den beiden Containern war Platz genug zum Durchgehen. Aber zwischen Container und Boden befand sich eine Handbreit Freiraum. Ideal für längliche Tiere, um sich zu verstecken und in leichtsinnige Füße zu beißen. DoDo ging lieber außen herum, wobei er den Boden sorgfältig ausleuchtete. Dann stand er vor den Containern. Beide besaßen Türen. Beide Türen waren zugesperrt. Mist! Er musste wohl oder übel ins Zelt.
Eilig machte er sich auf den Rückweg zum Zelt. Zunächst musste er das Zelt auf Schlangen kontrollieren. Jetzt erkannte er schlagartig, welchen großen Vorteil die spärliche Einrichtung des Zeltes hatte. Außerdem hatten die wenigen Möbelstücke einen großen Abstand zum Boden. Das Absuchen des Zeltes nach Schlangen und ähnlichem Zeug war einfach. Dann packte er die Tasche, warf sie auf den Tisch und machte sich umgehend daran den Reißverschluss des Zeltes zu schließen. Dieser bestand aus drei Strängen, einer links unten, einer rechts unten und einer vertikal in der Mitte. Wie er auch zog und zerrte, dort wo sich die Reißverschlüsse trafen, blieb ein Loch. Groß genug für eine Mamba. Eine dicke Puffotter müsste eventuell den Bauch einziehen. DoDo überlegte kurz. Er brauchte eine Schlangenbremse. Die Unterhemden. Mit zwei Unterhemden, die er vorne im Zelt und in das Loch im Reißverschluss auf der Rückseite des Zeltes stopfte, konnte er das Problem lösen.
Nun machte er einen zweiten etwas intensiveren Schlangencheck. Dann schaltete er das Handy aus. Der Akku war fast leer.
DoDo setzte sich auf das Bett. An Schlaf war nicht zu denken. Vorerst konnte er nichts weiter tun als warten. Die Aufregung legte sich etwas und nun merkte er, dass er sehr durstig war. Auf dem Tischchen hatte er eine große Wasserflasche gesehen, die er nun ziemlich schnell leerte.
Draußen war es mittlerweile ein klein wenig heller geworden. Gab es hier im Camp Lampen? Zumindest zeichnete sich an der Vorderseite des Zeltes ein heller Strich ab. Eine Inspektion ergab, dass sich in dem Bereich, in dem es hell war, ein Klettverschluss gelöst hatte. Daneben befanden sich weitere Klettverschlüsse. Er löste die Klettverschlüsse vorsichtig und so leise es ging ab und konnte nun den Zeltstoff wegklappen. Dahinter befand sich ein Moskitonetz. Das Ganze ergab eine Art Fenster. DoDo sah nach draußen. Es war tatsächlich eine Art Lampe, die draußen brannte: der Mond war aufgegangen. Nun fielen DoDo weitere Klettverschlüsse auf beiden Seiten des Zeltes auf. Vorsichtig und leise öffnete er auch sie. Jetzt konnte er sehen, was sich draußen tat. Zumindest, wenn es nicht im Schatten der Bäume stand.
Draußen war alles ruhig. Zeit sich etwas auszuruhen und nachzudenken. Er legte sich für einen Augenblick auf das Bett.
Von Hasen und Igeln
Als DoDo erwachte, wusste er im ersten Moment nicht, wo er war und musste sich erst einmal orientieren. Er lag auf dem Bett. Anscheinend war er eingeschlafen. Er hatte keine Ahnung wie spät es war. Es war noch dunkel. Er warf einen Blick durch das Moskitofenster auf der anderen Seite. Da war nur einer der Container zu erkennen. Auf seiner Seite war draußen nichts Besonderes. Jetzt merkte er auch, warum er aufgewacht war. Das Wasser wollte wieder ins Freie. Im Zelt befand sich keine Toilette. Draußen hatte er auch keine gesehen, aber das machte nichts. Die drängendere Frage war, ob er das sichere Zelt verlassen und sich in die afrikanische Wildnis begeben sollte. Er beschloss, die Lage zunächst einmal aus der sicheren Position im Zelt zu sondieren und sah weiter aus dem Fenster.
War der Schatten da vorne vorher nicht an einer anderen Stelle? Außerdem vernahm er nun ein leises Geräusch, das er zunächst nicht einordnen konnte. Ziemlich nah am Zelt. Außerhalb seines Sichtbereiches. Er starrte nach draußen. Das Geräusch wurde langsam lauter. Der Verursacher kam näher. Dann hielt DoDo den Atem an. Der wuchtige Kopf eines Büffels schob sich langsam und grasend in sein Sichtfeld. Direkt neben dem Zelt. Nach und nach wurde immer mehr des Büffels sichtbar. Lag es am Mondlicht oder waren die wirklich so groß? DoDo hatte den Eindruck, der Büffel war so groß wie ein Nashorn, mit gefährlichen und gewaltigen Hörnern.
Der Büffel graste in aller Ruhe und war offensichtlich vollkommen entspannt. Das konnte man von DoDo nicht behaupten. Sein Herz raste. Der Büffel musste ihn jeden Augenblick riechen! Und was würde er dann tun? Der dünne Zeltstoff würde ihn nicht aufhalten können. Trotz seiner Angst konnte DoDo nicht umhin, die Stärke des Tieres zu bewundern. Groß, gefährlich, muskulös, wuchtig und unbezwingbar. Diese Worte bildeten sich nahezu von selbst in seinem Kopf. Wohlwollend war nicht dabei. Wie winzig und hilflos er dagegen war. Er wagte nur ganz flach zu atmen. Langsam graste der Büffel am Zelt entlang und war schließlich an der Vorderseite des Zeltes.
DoDo bewegte sich etwas und das Bett knarrte. Der Büffel drehte sich sofort um und starrte nun in seine Richtung. DoDo hielt den Atem an. Und er erstarrte. Was er jetzt auf keinen Fall brauchen konnte, war ein weiteres Ächzen des Bettes. Der Büffel fixierte weiterhin das Zelt. DoDo konnte die Luft nicht länger anhalten. Er versuchte möglichste leise zu atmen, aber das gelang ihm nicht. Deutlich hörbar strömte die Luft aus seinen Lungen. In seiner Panik bewegte sich DoDo ein wenig. Das Bett gab ein weiteres Knarren von sich. Der Büffel hatte das gehört und streckte nun abrupt seinen Kopf in Richtung DoDo und verstärkte den bedrohlichen Eindruck. Er schien DoDo durch das Moskitofenster hindurch zu fixieren. Aber wahrscheinlich konnte er ihn nicht sehen, da es im Zelt dunkler war als draußen. Oder doch? Zumindest machte der Büffel einen Schritt in seine Richtung. Dabei stieß er gegen eine der Schnüre mit denen das Zelt gespannt war. Im Zelt wurde dadurch ein im Vergleich zur sonstigen Stille ziemlich lautes Geräusch erzeugt.
Das war zu viel. Die Container! Er musste raus zu den Containern. Sie waren zwar abgesperrt aber sie standen so eng beieinander, dass der Zwischenraum Schutz vor dem Büffel bot. Da kam kein Büffel hinein. DoDo sprang aus dem Bett. Er lief zum hinteren Ende des Zeltes, riss den vertikalen Reißverschluss auf und versuchte sich möglichst schnell durchzuquetschen. Er blieb aber mit der Schulter hängen. Er hatte keine Zeit einen weiteren Reißverschluss zu öffnen. Er drückte mit Gewalt nach draußen. Die Panik verlieh ihm große Kräfte. Plötzlich kam er durch, allerdings zunächst nur mit dem Oberkörper. In der Folge fiel er der Länge nach vor dem Zelt auf den Boden. Irgendwo rechts hinter ihm und nur wenige Meter entfernt war der Büffel, der wahrscheinlich gerade ihn seine Richtung galoppierte. So schnell es ging rappelte er sich auf und hetzte ohne sich umzusehen zu den Containern. Es waren nur wenige Meter. Aber er schaffte es nicht. Noch härter als üblicherweise Theorie und Praxis trafen nun Büffel und Zoologe aufeinander. Durch den Aufprall wurde DoDo von den Beinen gefegt. Er lag auf dem Boden und sah nach oben. Der Büffel hatte sich einige Meter vor ihm platziert und starrte ihn an. Das war definitiv nicht der Zeitpunkt um an Hasen und Igel zu denken. Trotzdem schoss genau das durch den Kopf von DoDo, „Ich bin schon da“ sagte der Igel zum Hasen. In diesem Fall war es kein zweiter Igel, sondern ein zweiter Büffel in dessen Hinterteil DoDo mit voller Wucht gerannt war. Der zweite Büffel war einige Meter nach vorne gelaufen und hatte sich dann herumgeworfen um der Gefahr die Stirn zu bieten. Nun starrte er DoDo an. Dummerweise stand er genau vor der Lücke zwischen den Containern. Es war kein Zoologie-Studium notwendig, um trotz des schlechten Lichtes zu erkennen, dass der Büffel von finsteren Gedanken durchdrungen war.
DoDo rappelte sich so schnell es ging auf. Es blieb nur noch ein Weg übrig, um die Lücke zwischen den Containern zu erreichen, das war der Weg zwischen Zelt und Container. DoDo hastete zwischen dem Zelt und dem Container entlang. Es erging ihm wie dem Büffel. Er übersah die Spannschnur und fiel hart. Sofort stand er auf und lief weiter. Zumindest bis zur nächsten Spannschnur. Dann fiel er wieder hin. Das Zelt war nicht groß und besaß an einer Seite nur drei Spannschnüre. DoDo arbeitete sie alle drei ab. Bei jedem Kontakt verursachte die Spannschnur ein schnalzendes Geräusch. Nach der letzten warf er einen kurzen Blick nach links, dort wo. jeden Augenblick der Büffel Nr. 1 auftauchen würde, rappelte sich dann hoch und erreichte endlich den rettenden Spalt zwischen den Containern. Sofort lief er bis zur Mitte. Dann drehte er sich um. Kein Büffel versuchte ihm zu folgen. Und zwar weder von der einen, noch von der anderen Seite. Gerade als DoDo sich entspannen wollte, fiel ihm die Spannweite zwischen den Containern auf. Er streckte beide Hände aus. Mit den Handflächen konnte er gerade noch beide Container berühren. Verdammt! Viel zu weit. Er hatte sich geirrt. Die Büffel konnten ihm locker in den Spalt folgen. DoDo sah verzweifelt nach oben. Aber die Container waren zu hoch. Ohne Hilfsmittel konnte er nicht auf das Dach klettern.
Schwer atmend hielt er inne, und sah sich weiter um. Auf keiner Seite war ein Büffel zu sehen. Kurz darauf hörte er, wie sich mehrere große Tiere im Galopp entfernten. Zunächst hörte er nur das Stampfen der Hufe, dann das Geräusch, als sie durch die Büsche krachten.
Nun war es wieder still. DoDo beruhigte sich langsam wieder. Hier konnte er nicht bleiben. Er musste wieder ins Zelt zurückzugehen. Zunächst ging er zwischen den Containern zu der Seite, an der der Fluss lag. Von der Ecke aus beobachtete er aufmerksam die Umgebung. Es war nichts zu erkennen. Dann wiederholte er die Prozedur auf der anderen Seite der Container. Alles war ruhig. Die Büffel waren anscheinend weg. Sollte er wirklich den relativen Schutz der Container verlassen? Er musste sich überwinden. Dann lief er die kurze Strecke zur Rückseite des Zeltes, quetschte sich durch die Öffnung und schloss sofort den Reißverschluss. Auch die Schlangenbremse wurde neu justiert.
Er setzte sich auf das Bett. Nun konnte er in Ruhe nachdenken. Bis auf einige Schrammen war er ungeschoren davongekommen. Innerhalb einiger Sekunden war er 5-mal zu Boden gegangen. Jedes Mal durch eigene Schuld. Die Büffel waren sicher nicht harmlos. Aber nicht einmal der Büffel, in den er hineingerannt war, hatte ihn sofort angegriffen. Allerdings wusste er aus den Vorlesungen, dass man wilden Tieren nicht so nahekommen sollte. Wenn man sie auf nahe Distanz überraschte, griffen sie entweder an oder sie rannten weg. Wahrscheinlich hatte ihn nur seine rasche Flucht zwischen Zelt und Container vor einem Angriff des zweiten Büffels bewahrt. Keiner der Büffel hatte ihn verfolgt. Sie hatten es nicht einmal versucht. Wahrscheinlich hatte er mit seiner panischen Flucht aus dem Zelt vollkommen überreagiert und dadurch erst die Gefahr erzeugt. Er nahm sich vor, es beim nächsten Mal besser zu machen.
Er dachte weiter nach. Da war doch noch was. Ach ja. Er musste auf die Toilette. Das hatte er ganz vergessen. Die Frage, ob er nach draußen gehen würde, hatte sich allerdings erledigt. Er führte die leere Plastikflasche einer neuen Verwendung zu und stellte sie anschließend vorsichtig auf dem Tischchen wieder ab.
So wie es aussah, war er in dem Zelt nur relativ sicher. Und man wusste nicht, was im Laufe der Nacht noch alles auftauchen würde. DoDo machte sich bereit für Plan B. Das letzte Mal, als er ein Gewehr in der Hand hatte, war am Jahrmarkt vor einigen Jahren. Er wusste wo vorne und hinten war, wo sich der Abzug befand und dass man das Gewehr durch repetieren laden musste.
Er stellte sich neben das Bett und löste die Schlaufe am Lauf, mit der das Gewehr am Bett fixiert war. Dann hob er die Waffe hoch. Zumindest wollte er sie hochheben. Dies gelang ihm aber erst beim zweiten Versuch, denn sie war überraschend schwer. Mit der Waffe in der Hand setzte er sich in der Dunkelheit anschließend auf das Bett. Er wagte es nicht, die Lampe des Handys zu benutzen, um seine Anwesenheit nicht zu verraten. War das Gewehr geladen? Er hatte keine Ahnung. Es war wohl besser, den Abzug nicht zu berühren. Das Gewehr hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Luftgewehr auf dem Jahrmarkt. Er versuchte den Hebel an der Seite hochzuklappen, aber das funktionierte nicht. Erst im zweiten Versuch, als er mehr Kraft aufwendete, ging der Hebel nach oben. Er zog den Hebel nach hinten und konnte nun mit den Fingern fühlen, dass sich eine Patrone im Magazin befand. Er schob den Hebel langsam wieder nach vorne und schloss ihn. Er wusste, dass das Gewehr nun geladen war. Vorsichtig legte er es auf den langen Tisch, nachdem er seine Tasche vom Tisch genommen hatte. Irgendwie war die Waffe beängstigend und beruhigend zugleich. Notfalls würde wahrscheinlich bereits der Lärm eines Schusses ein angreifendes Tier vertreiben. Das Schlimmste schien überstanden zu sein. Jetzt musste er nur noch bis morgen warten, bis die Techniker zurückkamen.
Der Geruch von Abenteuer
Als DoDo das nächste Mal aufwachte, wurde es draußen bereits hell. Irgendein Tier schnüffelte an der Rückseite des Zeltes. Das hörte sich nicht nach einem Tier an, das Gras frisst. Das hörte sich eher nach einem Tier an, das Tiere frisst, die Gras fressen. Und es hörte sich groß an. Möglichst leise und mit klopfendem Herzen stand DoDo auf. Im Zelt war es immer noch düster.
Das Schnüffeln wurde intensiver und die Haare stellten sich bei DoDo auf, als er sah, dass sein Unterhemd aus dem Loch auf der Rückseite des Zeltes gezogen wurde. Anschließend erschien eine Schnauze in der kleinen Öffnung. Zum Entsetzen von DoDo gab der Reißverschluss etwas nach und die Schnauze kam etwas tiefer in das Zelt.
Das war zu viel. Er griff zum Gewehr, richtete den Lauf auf die Rückseite des Zeltes und schloss die Augen. Er wusste, gleich würde es fürchterlich laut werden. Ängstlich drückte er ab. Das Geräusch, das er dann hörte, war erschreckender als ein Donnerhall und das unangenehmste Geräusch, das er je gehört hatte. Es machte nur leise „Klick“. DoDo sah verzweifelt auf das Gewehr. Eigentlich war es doch geladen. Was hatte er falsch gemacht? Nervös repetierte er. Dazu musste er den Lauf auf dem Tisch abstützen, denn das Gewehr war sehr schwer. Die Schnauze steckte immer noch in der Öffnung. DoDo hielt wieder auf die Zeltrückwand und drückte nochmals ab. Wieder machte es nur „Klick“.
Aber das Klicken störte anscheinend die Schnauze und sie zog sich zurück. Und machte sich langsam und stetig schnüffelnd auf den Weg zur Seite des Zeltes.
DoDo öffnete das Gewehr noch einmal. Mit den Fingern fühlte er, dass eine Patrone im Magazin war. Was war nur mit diesem blöden Gewehr los. Es war nun genügend Licht im Zelt. Er konnte schemenhaft sehen, dass eine Patrone in den Lauf geschoben wurde, als er den Hebel langsam nach vorne drückte. War möglicherweise die Munition defekt? Das Schnüffeln kam nun von der Seite des Zeltes. Mit der Waffe in der Hand, den Finger am Abzug, machte er einen Schritt nach vorne und ließ dabei die Seite des Zeltes nicht aus den Augen. Das war keine gute Idee. Er stolperte über die Reisetasche, die er in der Nacht auf den Boden gestellt hatte, damit das Gewehr auf dem Tisch Platz hatte. Ein Schuss krachte und der starke Rückstoß brachte DoDo vollends aus dem Gleichgewicht. Er ging mit Schwung zu Boden. Dabei krachte sein Kopf auf den kleinen Tisch. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Boden. Etwas Warmes lief über seinen Kopf. Der ganze Boden war schon voll damit. Auch seine Kleidung hatte sich vollgesaugt. Er setzte sich auf und wischte sich das Blut aus den Augen. Dann zog er sich am Bett hoch, richtete sich langsam auf und suchte sein Handy. Es rutsche ihm durch seine blutverschmierten Finger und krachte zu Boden. Er zog das vordere Unterhemd aus dem Loch und wischte das Handy, sein Gesicht und seine Hände ab. Schließlich konnte er das Handy einschalten. Er setzte sich auf das Bett und machte ein Foto seines Kopfes. Die Wunde war nicht so groß wie er befürchtet hatte. Sie blutete immer noch leicht. Er sah an sich herunter. Alles war voller Blut. Wie konnte aus einer so kleinen Wunde so viel Blut laufen und ihn und den ganzen Boden bedecken? Der ganze hintere Teil des Zeltes war nass. DoDo leuchtete mit dem Handy auf den Boden. Am Boden lag das Gewehr, der umgeworfene Tisch und nun sah er in der Ecke die Flasche mit Urin. Sie war jetzt nicht mehr gefüllt. Das erklärte Einiges.
Im Zelt roch es seltsam. Die Explosionsgase des Schusses, das Blut und der Urin ergaben eine spezielle Mischung. Ein skurriler Gedanke durchzuckte DoDo: „So riecht also Abenteuer“. Seine Ohren klingelten. Der Schuss war immens laut. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass das Gewehr in einem geschlossenen Raum abgefeuert wurde. Er hörte fast nichts mehr. Auch nicht ob das schnüffelnde Tier noch da war. DoDo verspürte ein immer größer werdendes Bedürfnis, sich zu waschen. Wasser war genug da. Er musste nur zum Fluss kommen. Und auf die Krokodile achten. Es war sicher keine schlechte Idee, das Gewehr mitzunehmen. Gegen den Schnüffler, gegen die Krokodile, gegen die Wildnis und nur für alle Fälle. Er versuchte es aufzuheben. Es war glitschig und es drohte ihm aus den Fingern zu gleiten. Erst als er das Unterhemd als Zwischenlage benutzte konnte er es aufheben. Er legte es auf den Tisch und wischte mit dem Unterhemd das Blut ein wenig weg. Das Unterhemd legte er über seine Schulter. Er würde es mitnehmen. Unterhemden hatten in Afrika überraschend viele Verwendungsmöglichkeiten. Er stützte den Lauf des Gewehres auf den Tisch und repetierte langsam. Diesmal sprang eine leere Patrone heraus und landete auf dem Zeltboden. Anscheinend hatte er bei den ersten Repetierversuchen keine Patrone erwischt. Jetzt achtete er darauf, dass eine Patrone in den Lauf glitt. Nun konnte er das Zelt verlassen.
DoDo kontrollierte noch kurz durch das Moskitofenster den Außenbereich. Aber der Schnüffler, wahrscheinlich eine Hyäne, war nicht zu sehen. Vermutlich hatte ihn der Schuss vertrieben. Er öffnete den Reißverschluss und trat vorsichtig vor das Zelt. Die Sonne war aufgegangen und jetzt im Tageslicht sah alles viel rosiger aus. Er sah sich um. Weder der Schnüffler noch ein Büffel war zu sehen. Alles lag friedlich da, fast schon paradiesisch.
Alles ist im Fluss